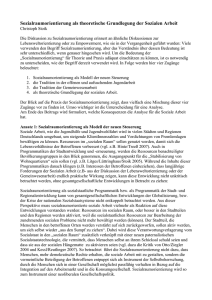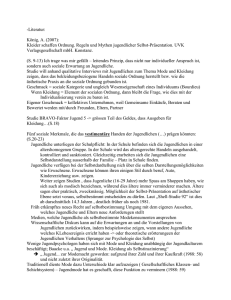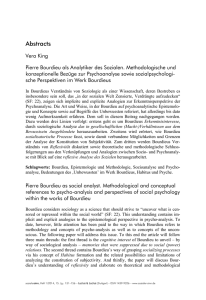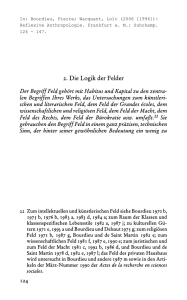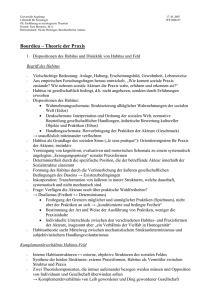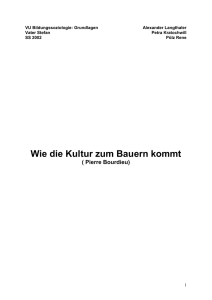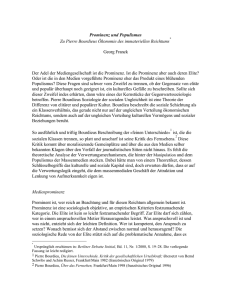Bourdieus Kapitalsorten und die Auswirkungen auf schulische Bildung
Werbung
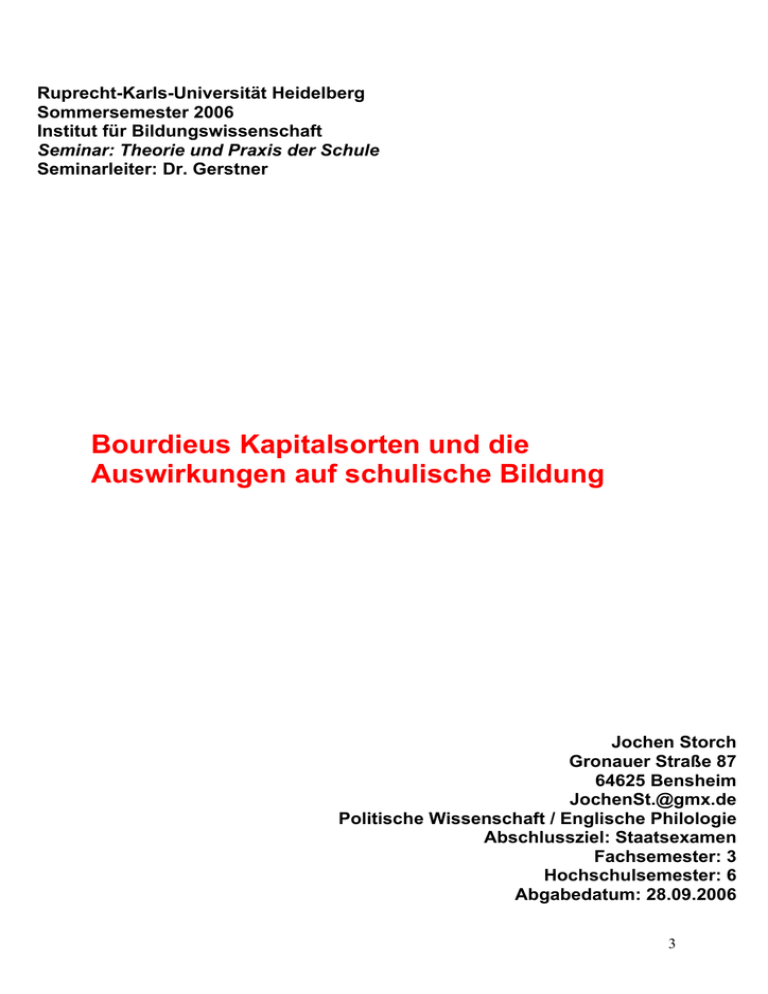
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Sommersemester 2006 Institut für Bildungswissenschaft Seminar: Theorie und Praxis der Schule Seminarleiter: Dr. Gerstner Bourdieus Kapitalsorten und die Auswirkungen auf schulische Bildung Jochen Storch Gronauer Straße 87 64625 Bensheim [email protected] Politische Wissenschaft / Englische Philologie Abschlussziel: Staatsexamen Fachsemester: 3 Hochschulsemester: 6 Abgabedatum: 28.09.2006 3 Inhalt 1. Einleitung 3 2. Kapital bei Bourdieu 2.1 Ökonomisches Kapital 3 2.2 Kulturelles Kapital 4 2.2.1 Der inkorporierte Zustand 4 2.2.2 Der objektivierte Zustand 5 2.2.3 Der institutionalisierte Zustand 5 2.3 Soziales Kapital 6 3. Kritische Würdigung 7 4. Bibliographie 5. Plagiatserklärung 4 1. Einleitung Die bildungspolitische Debatte der letzten Jahre kreist in Deutschland immer wieder um die zentrale Problematik des Zusammenhangs von sozialer Herkunft und schulischen Erfolgschancen. Soziale Herkunft wird hier größtenteils als ökonomische Komponente verstanden, berechnet in ökonomischen Maßen wie dem Einkommen der Eltern der Schüler. Außer Acht gelassen wird hierbei allzu oft, dass das ökonomische Setting einer Familie lediglich der Ausdruck einer anderen, nicht immer in mathematischen Größen bezifferbaren „Kapitalsorte“ ist, nämlich des jeweilig unterschiedlichen Bildungsniveaus des engsten sozialen Milieus der Kinder, der Familie. Das Seminarthema „Theorie und Praxis der Schule“ nehme ich im Folgenden zum Anlass, mit dem Soziologen Pierre Bourdieu einen der bedeutendsten Theoretiker zu Wort kommen zu lassen; mit seinem wegweisenden Beitrag zur Debatte löst er sich von einer rein ökonomischen Sichtweise auf den Kapitalbegriff und erweitert ihn zu mehreren Ausformungen. Die Struktur dieser Arbeit ist wie folgt: Zunächst werden anhand des ökonomischen, des kulturellen und des sozialen Kapitals die 3 grundlegenden Züge der Kapitalsorten Bourdieus erklärt, die Implikationen dieser Begrifflichkeiten für die Institution Schule und das Phänomen der Chancenungleichheit erläutert, um schließlich eine kritische Würdigung des Bourdieuschen Konzepts vornehmen zu können. 2. Kapital bei Bourdieu Ökonomisches Kapital Der Begriff „Kapital“ stammt aus der Ökonomie. Er meint die hier individuell wie kollektiv akkumulierbare Aneignung von materiellen Dingen. Die ausschließlich ökonomisch – materielle Dimension des Begriffs sieht Bourdieu grundsätzlich problematisch, denn „[d]ieser wirtschaftswissenschaftliche Kapitalbegriff reduziert die Gesamtheit der gesellschaftlichen Austauschverhältnisse auf den bloßen Warenaustausch, der […] vom Eigennutz geleitet ist.“ 1 Sofern ausschließlich dieser materielle Ansatz verfolgt wird, werden alle Austauschbeziehungen ignoriert, die von nicht-materieller, uneigennütziger Natur sind. 2 Die Ökonomie vereinnahmt den Kapitalbegriff insofern für sich, als dass der Warenaustausch als einzige Form sozialen Austauschs gewertet wird und alle anderen Formen hier keine Berücksichtigung finden. 3 Neben der Wirtschaftswelt sieht Bourdieu eine Welt, deren „Güter“ nicht quantifizierbar und mit einem objektiven Preis auszeichenbar sind; dennoch spiegeln diese Güter einen ebenso hohen Machtfaktor in sozialen Beziehungen wider. Aus diesem Grund ist es nicht ausreichend, den Kapitalbegriff zur Wirtschaft hin zu verengen; vielmehr ist es wichtig, soziale Austauschbeziehungen in ihrer Ganzheit zu betrachten und „die Gesetze zu bestimmen, nach denen die verschiedenen Arten von Kapital […] gegenseitig ineinander transformiert werden. Von zentraler Bedeutung, insbesondere hinsichtlich einer Analyse von sozialer Ungleichheit und schulischer Chancenungleichheit, ist der Terminus des kulturellen Kapitals. 1 Bourdieu, Pierre: Die verborgenen Mechanismen der Macht. Hamburg: VSA-Verlag, 1992, 50. Ibid., 50-51. 3 Ibid., 51. 2 5 Kulturelles Kapital Unter „Kulturellem Kapital“ versteht Bourdieu die Gesamtheit der individuell akkumulierten kulturellen Inhalte, mit dem spezifischen Blick auf die Schule lässt sich hier von Bildung sprechen. 3 Zustandsformen kulturellen Kapitals lassen sich nach Bourdieu unterscheiden: Der inkorporierte, der objektivierte und der institutionalisierte Zustand. 4 Der inkorporierte Zustand In Abgrenzung an Theorien, die unterschiedlichen schulischen Erfolg entweder mit unterschiedlichen wirtschaftlichen Investitionen („Humankapital-Schule“ 5 ) oder der Verschiedenheit von Begabung und Fähigkeit erklären 6 , führt Bourdieu den Begriff des inkorporierten, also „körpergebunden[en]“ kulturellen Kapitals ein. Das Kapital wird über die Zeitinvestition in Bildung akkumuliert und ist an die Person gebunden, die die Invesition „in sich“ vornimmt; somit ist der Erwerb dieser Form des Kapitals nicht delegierbar. 7 Diese Besonderheit der Kapitalsorte lässt sie in den Vorzug kommen, größtmöglichste Sicherheit vor Ausbeutungsversuchen durch die Eigner ökonomischen oder sozialen Kapitals zu erlangen. Denn im Gegensatz zu einer materiell übertragbaren Sache, die als Objekt durch ein Subjekt lediglich besessen werden kann, verschmilzt in dieser Kapitalform das Subjekt mit dem Objekt zu einer untrennbaren Einheit: „Inkorporiertes Kapital ist ein Besitztum, das zu einem festen Bestandteil der Person, zum Habitus geworden ist; aus „Haben“ ist „Sein“ geworden.“ 8 Die Verinnerlichung kulturellen Kapitals verläuft durch Zeitinvestition, wodurch die „Dauer des Bildungserwerbs“ 9 zum wichtigsten Indikator zur Bestimmung der Kapitalform wird. Hinsichtlich der Schule attestiert Bourdieu dem inkorporierten kulturellen Kapital, wie ein natürlicher vorschulischer Selektionsmechanismus zu wirken: Kinder wachsen in verschiedenen familiären Milieus auf, die Dauer, die Intensität und der Grad des Schulstoffbezugs der vorschulischen Bildung prägt die Chancenungleichheit bereits am ersten Schultag. An diesem Punkt, an dem Bourdieu den Ursprung der Ungleichheit umschreibt, manifestiert sich seine Hauptthese: „In der engsten Beziehung zum Schulerfolg des Kindes steht - mehr noch als die vom Vater erzielten Abschlüsse und mehr als des von ihm absolvierten Bildungsgangs – das allgemeine Bildungsniveau der Eltern.“ 10 Ein wichtiger Aspekt ist in diesem Zusammenhang die Art der Weitergabe kulturellen Kapitals: Sie läuft meist nicht intendiert, sondern im Hintergrund während der Sozialisierung des Kindes ab. 11 Diese Tatsache ist ein entscheidender Grund für die weitgehende Nichtberücksichtigung der Kapitalform. Je nach Stärke des „Kulturkapitals“ 12 des familiären Umfelds akkumulieren Kinder einen 4 Bourdieu (1992), 53. Ibid., 54. 6 Ibid., 53. 7 Ibid., 55. 8 Ibid., 56. 9 Ibid., 56. 10 Bourdieu, Pierre: Wie die Kultur zum Bauern kommt. Hamburg: VSA-Verlag, 2001, 2. 11 Ibid., 5. 12 Bourdieu (1992), 58. 5 6 unterschiedlichen Grad an vorschulischer Bildung. Im Idealfall ist nach Bourdieu die „gesamte Zeit der Sozialisation zugleich eine Zeit der Akkumulation.“ 13 Die Tatsache, dass die Stärke der Akkumulation in verschiedenen familiären Umfeldern unterschiedlich ist, weist auf einen ersten Ursprung der Chancenungleichheit der Kinder. Die Zeitkomponente verbindet den Ansatz des ökonomischen mit dem des kulturellen Kapitals; so ist es in verschiedenen wirtschaftlichen Konstellationen entweder möglich oder unmöglich, dem Kind Zeitressourcen zur Akkumulation kulturellen Kapitals zur Verfügung zu stellen. 14 Die Persistenz dieser strukturellen Chancenungleichheit ist nach Bourdieu eine der entscheidenden Probleme und lässt sich auf ein ihr innewohnendes Charakteristikum zurückführen: Ihre Reproduktionsfähigkeit. Ein Ausbruch aus dem Kreislauf der strukturellen Ungleichheit wird dann schwer möglich, wenn die jeweiligen Sozialmilieus ihre Kinder mit ihren spezifischen Erwartungshorizonten und Zielvorstellungen prägen, und zwar bevor die Schule ihr Potential als homogenisierende Institution ausspielen kann; wie es Girard und Bastide treffend formulieren: „Die Pläne der Familien reproduzieren gleichsam die soziale Stratifikation, die sich im Übrigen in den verschiedenen Schularten wiederfindet.“ 15 Der objektivierte Zustand Das objektivierte kulturelle Kapital gewinnt seine Bedeutung aus seiner ambivalenten Rolle als Teilaspekt des Objekts, dass allerdings nur über die entsprechende Existenz inkorporierten kulturellen Kapitals zur Entfaltung kommen kann. Als Beispiele für die Kapitalsorte lassen sich Güter wie Bücher, Lexika, Instrumente oder Maschinen anführen. 16 Der Eigner ökonomischen Kapitals, beispielsweise in Form eines Computers, kann die Funktionslogik seines Guts nicht verstehen und somit dessen Potentiale nicht ausschöpfen, wenn ihm das entsprechende Wissen, die entsprechende Theoriekenntnis fehlt, er nicht über das notwendige objektivierende Kulturkapital verfügt. In dieser Zustandsform erschließt sich das Objekt dem Subjekt in seiner Ganzheit. 17 Hier wird der Unterschied zwischen materieller Übertragung und symbolischer Aneignung kulturellen Kapitals deutlich. In materieller, ökonomischer wie juristischer Hinsicht kann eine Übertragung eines Guts problemlos von statten gehen, indem nach Zahlung des Kaufpreises ein neuer Eigentümer im rechtmäßigen Besitz des Gegenstands ist. Die Einzigartigkeit des kulturellen Kapitals besteht nun aber gerade in der Schwierigkeit seiner Übertragung. Aus dieser besonderen Problematik folgert Bourdieu die Uneindeutigkeit gesellschaftlicher Rollenverteilung; in einer Gesellschaft, in der die Besitzer ökonomischen Kapitals, also beispielsweise Produktionsmittel, nicht über das nötige inkorporierte kulturelle Kapital zum Verständnis des jeweiligen Guts verfügen, aber gleichzeitig die Besitzer dieses Kapitals nicht die Besitzer des Guts sind, drängt sich eine Frage auf: Wer ist Herrscher, wer ist Beherrschter? 18 Nichtsdestotrotz erkennt Bourdieu das ökonomische Kapital als die dominante Kapitalsorte an, wodurch sich für die Bildungsinstitutionen wie die Schule ein enormer Konkurrenz- und im gleichen Atemzug Selektionseffekt einstellt, dergestalt dass der Wettlauf um Arbeitsplätze ein 13 Ibid., 58. Bourdieu (1992), 59. 15 Bourdieu (2001), 6. 16 Vgl. Bourdieu (1992), 53. 17 Vgl. Bourdieu (1992), 60-61. 18 Vgl. Bourdieu (1992), 60. 14 7 Wettlauf um inkorporiertes kulturelles Kapital wird – ein Rennen, das, wie bereits im letzten Kapitel analysiert, mit ungleichen Startvoraussetzungen beginnt. Der institutionalisierte Zustand Als Antwort auf die Eigenart des inkorporierten Zustands kulturellen Kapitals, das körpergebunden an den Eigner ein biologisch bedingtes Ende zu erwarten hat, hat sich die institutionalisierte Form, wie der Name bereits erkennen lässt, „institutionalisiert“, d.h. juristisch abgesichert und von Person zu Person übertragbar gemacht. Als klassisches Beispiel fungiert hier der amtliche Titel: „Durch den schulischen oder akademischen Titel wird dem von einer bestimmten Person besessenen Kulturkapital institutionelle Anerkennung verliehen.“ 19 Die eigentlich nicht exakt bestimmbare Akkumulation kulturellen Kapitals wird in diesem Prozess standardisiert, d.h. es werden Standards zur Abgrenzung der Titel festgelegt, „relativ unabhängig […] von dem kulturellen Kapital, das dieser tatsächlich zu einem gegebenen Zeitpunkt besitzt.“ 20 Diese Standardisierung hat zur Folge, dass dem natürlichen Kontinuum des Grads kulturellen Kapitals die Vorstellung einer stufenweisen Ausprägung dieses Kapitals entgegengesetzt und legitimiert wird: Minimale Leistungsunterschiede ziehen maximale Konsequenzen für die schulische Laufbahn nach sich. 21 Ein weiteres Wesensmerkmal der Kapitalsorte liegt in ihrer wechselseitigen Umwandelbarkeit in ökonomisches Kapital: Einem schulischen Titel kann ein Geldwert zugewiesen werden. 22 Soziales Kapital In Abgrenzung zum ökonomischen wie zum kulturellen Kapital ist die Kapitalsorte „Soziales“ Kapital“ zwar auch individuell akkumulierbar, jedoch ohne den Kollektivzusammenhang nicht zu denken. Bourdieu definiert den Terminus als „die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von […] institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind.“ 23 Mit dem institutionalisierten kulturellen Kapital verbindet ihn der Aspekt der Institutionalisierung, z.B. gekennzeichnet durch die Übernahme eines gemeinsamen Namens. Der Grad des Sozialkapitals bestimmt sich nicht nur aus der Größe des eigenen Personennetzwerkes, sondern auch im Besonderen aus der Größe des sozialen Kapitals des oder der Bekannten. Zu unterscheiden sind hierbei 2 verschiedene Profite, die aus einer sozialkapitalbasierten Austauschbeziehung gewonnen werden können, nämlich materielle wie symbolische. 24 Die symbolischen Profite ziehen ihre große Bedeutung aus der Tatsache, dass das eigene Prestige mit von dem der Gruppenmitglieder abhängt; so kann besonders viel Sozialkapital aus der Bekanntschaft mit Mitgliedern einer „erlesenen und angesehenen“ 25 Gruppe 19 Bourdieu (1992), 62. Ibid., 61-62. 21 Ibid., 62. 22 Ibid., 62. 23 Ibid., 63. 24 Ibid., 65. 25 Ibid., 65. 20 8 gewonnen werden. Im Gegensatz zur Familie, die zu den „Verwandtschaftsbeziehungen“ 26 zählen, konstituiert sich die soziale Gruppe bewusst in einem institutionalisierten Prozess, den „Institutionalisierungsriten“ 27 Kennzeichnend für diesen Prozess ist die Umwandlung von Zufallsbeziehungen in dauerhafte Beziehungsgeflechte, die mit der Zeit ein Gefühl der Verpflichtung entstehen lassen, entweder basierend auf „subjektiven Gefühlen“ 28 , oder „institutionellen Garantien“ 29 . In Form der Gruppe wird soziales Kapital reproduziert, ein Phänomen, das wir bereits bei der Analyse des kulturellen Kapitals kennen gelernt haben. Nachdem sich die Gruppe institutionalisiert, erfolgt ihre Reproduktion über die Austauschbeziehungen, „der Austausch macht die ausgetauschten Dinge zu Zeichen der Anerkennung […].“ Im selben Maße wie sich die Gruppe konstituiert und reproduziert, achtet sie auf die Einhaltung der Grenzen der Austauschbeziehungen. So ist jedes Neumitglied eine potentielle Gefahrenquelle für den Gruppencharakter. 30 Der Beitrag des Konzepts des sozialen Kapitals zur Problematik der Chancenungleichheit lässt sich, ähnlich dem Konzept des kulturellen Kapitals, anhand der Reproduktionsfähigkeit erkennen. Kinder aus familiären Milieus mit einem geringen Bildungsniveau werden somit beispielsweise nicht den gleichen Zugang zu symbolischem Sozialkapital haben wie solche aus einem bildungsstarken familiären Umfeld. Denn der Theorie Bourdieus folgend, ist nicht nur die Weite des Netzwerks, sondern insbesondere das Prestige der einzelnen Mitglieder des Netzwerks entscheidend für die Akkumulation von Sozialkapital. Wenn man diesen Gedanken zu Ende denkt und den Begriff „Gruppe“ auf gesellschaftliche Klassen bzw. Schichten abstrahiert, wird der Zusammenhang zwischen kulturellem und sozialem Kapital deutlich: Ein hoher Grad an institutionalisiertem kulturellen Kapital in Form von Titeln führt zu einem hohen Prestige, wodurch es den Eignern wiederum leicht fällt, ihr Sozialkapital zu erhöhen, getreu dem Motto „Wer hat, dem wird gegeben“: „[d]er Ertrag der für die Akkumulation und Unterhaltung von Sozialkapital erforderlichen Arbeit [ist] umso größer […], je größer dieses Kapital selber ist.“ 31 3. Kritische Würdigung Bourdieus Beitrag zur Debatte um den Ursprung der Chancenungleichheit der Schüler ist ohne Zweifel als bedeutend zu bezeichnen, vor allem weil er durch die theoretische Darlegung der verschiedenen Kapitalsorten die Perspektive auf die Problemlage fruchtbar erweitert. Er befreit sich von einem Kapitalbegriff, der ausschließlich von der Ökonomie bestimmt wird und legt durch die Analyse anderer Kapitalformen, insbesondere durch die Entfaltung des kulturellen Kapitals den eigentlichen Kern des Themas frei: Die wichtigste Ursache der Ungleichheit ist weder in unterschiedlichen Begabungen, noch in unterschiedlichen Geldinvestitionen, sondern in der Chancenungleichheit zu suchen, der die Kinder bereits vor dem Eintritt in die Schule ausgesetzt sind. Die Diskrepanz zwischen den Chancen erklärt sich größtenteils aus den unterschiedlichem Vorraten kulturellen Kapitals innerhalb 26 Ibid., 65. Ibid., 65. 28 Ibid., 65. 29 Ibid., 65. 30 Vgl. Bourdieu (1992), 66. 31 Ibid., 67. 27 9 der verschiedenen familiären Milieus. Doch wer hieraus schlussfolgert, dass Bourdieu die Schule von der Schuld an der Problematik befreit, sieht sich getäuscht; er kritisiert die Institution Schule aufs Schärfste, gerade weil sie eine wesentliche Mitverantwortung für die Reproduktionsfähigkeit bestehender sozialer Strukturen der Ungleichheit trägt. Getreu dem Titel seines Aufsatzes „Die konservative Schule“ wirft Bourdieu der Schule vor, die Chancenungleichheit zu konservieren, zu wahren, anstatt Schülern die Chance zu ermöglichen, sich aus ihrem sozialen Milieu zu befreien. Das Ideal der „formalen Definition schulischer Gerechtigkeit“ 32 führt somit zu einer Aufrechterhaltung der Ungleichheit: […] [I]ndem das Schulsystem alle Schüler, wie ungleich sie auch in Wirklichkeit sein mögen, in ihren Rechten wie Pflichten gleich behandelt, sanktioniert es faktisch die ursprüngliche Ungleichheit gegenüber der Kultur.“ 33 Eine gute Pädagogik dagegen müsste es als oberstes Ziel ansehen, die vorschulischen Unterschiede im kulturellen Kapital zu kompensieren, und somit „allen die Mittel an die Hand zu geben, all das zu erwerben, was unter dem Anschein der „natürlichen“ Begabung nur den Kindern der gebildeten Klassen gegeben ist.“ 34 Ein möglicher Ausweg aus dem Dilemma der sich reproduzierenden sozialen Strukturen könnte dann entstehen, wenn Eltern aus einem bildungsarmen Milieu ihren Kindern den Zugang zu den höheren Schulzweigen ermöglichen. Doch Bourdieu betrachtet diese Option als unrealistisch. Nach ihm werden die sozialen Strukturen in ihrer Ungleichheit sowohl von der Gesellschaft wie von der Schule in der Gestalt bewahrt, dass die sozial niederen Klassen ihren Erwartungshorizont an die aktuelle Struktur anpassen, ohne sich eine Befreiung zuzutrauen: „So trägt alles dazu bei, diejenigen, die, wie man sagt, „keine Zukunft haben“, zu „vernünftigen“ oder, […], zu „realistischen“ Erwartungen, was sehr oft heißt, zum Verzicht auf das Hoffen anzuhalten.“ 35 Fraglos zielt Bourdieu darauf ab, den Begabungsmythos, mit dem allzu oft der wahre Ursprung der Ungleichheit verschleiert wird, zu entkräften. An diesem Punkt kann ich zwar seine Argumentation nachvollziehen, jedoch komme ich nicht zu derselben extremen Folgerung, dass die soziale Ungleichheit überhaupt keinen relevanten Bezug zu unterschiedlichen Fähigkeiten oder Begabungen besitzt. Die Kinder sind beim Eintritt in die Schule meiner Ansicht nach nicht das ausschließliche Produkt des Grads an kulturellem Kapital innerhalb ihrer familiären Umfelder; Bourdieu übersieht an diesem Punkt, dass Kinder sehr wohl unterschiedliche Begabungen aufweisen, und das unabhängig von ihrer sozialen Disposition. Nichtsdestotrotz stimmte ich vollkommen überein, dass die Schule nicht nur das Potential, sondern auch die Pflicht hat, die Strukturen der Ungleichheit zu zerbrechen, anstatt sie zu konservieren. Ihr kommt „faktisch und von Rechts wegen […] [die Erfüllung der Funktion zu], […] unterschiedslos allen Mitgliedern der Gesellschaft die Befähigung zu den kulturellen Praktiken zu geben, die der Gesellschaft als die nobelsten gelten.“ 36 Alles in Allem ist festzuhalten, dass Pierre Bourdieu mit seinen bildungstheoretischen Beiträgen ein hochaktuelles Thema berührt. Seine Theorie ist gekennzeichnet durch seine Konstruktivität, sie entlarvt bisherige Mythen, aber verharrt nicht in dieser destruktiven Position, sondern zeigt Lösungswege auf. 32 Bourdieu (2001), 10. Ibid., 10. 34 Ibid., 10. 35 Bourdieu (2001), 8. 36 Ibid., 18. 33 10 Plagiatserklärung Folgende Erklärung ist ab sofort allen Hausarbeiten beizulegen: Von Plagiat spricht man, wenn Ideen und Worte anderer als eigene ausgegeben werden. Dabei spielt es keine Rolle, aus welcher Quelle (Buch, Zeitschrift, Zeitung, Internet usw.) die fremden Ideen und Worte stammen, ebenso wenig, ob es sich um größere oder kleinere Übernahmen handelt oder ob die Entlehnung wörtlich oder übersetzt oder sinngemäß ist. Entscheidend ist allein, ob die Quelle angegeben ist oder nicht. Wird sie verschwiegen, liegt ein Plagiat, eine Täuschung, vor. In solchen Fällen kann keine Leistung des Studierenden anerkannt werden: Es wird kein Leistungsnachweis (auch kein Teilnahmeschein) ausgestellt, eine Wiederholung der Arbeit ist nicht möglich und die Lehrveranstaltung wird in der Institutskartei als "nicht bestanden (P)" registriert. Ich erkläre hiermit, diesen Text zur Kenntnis genommen und in dieser Arbeit kein Plagiat im o.g. Sinne begangen zu haben. Datum, Unterschrift 11