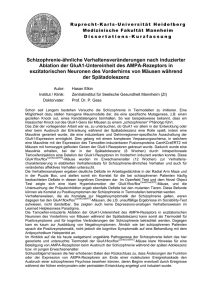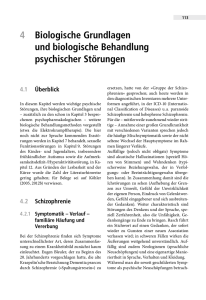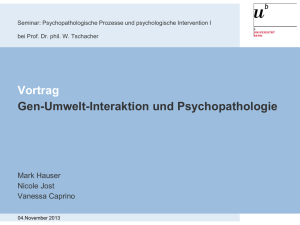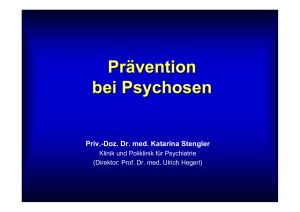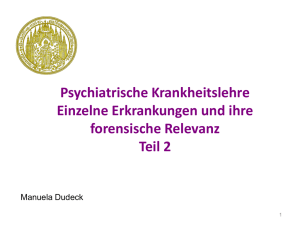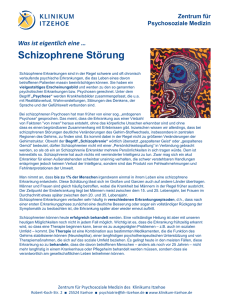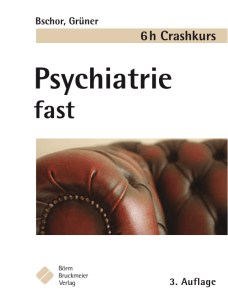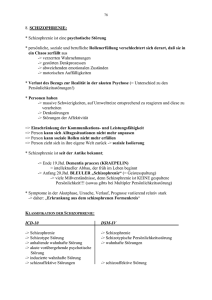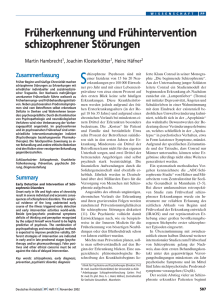Dr. Michael J. Hemmerle Multimodale Verhaltenstherapie bei
Werbung

Dr. Michael J. Hemmerle Multimodale Verhaltenstherapie bei schizophrenen Störungen Einführung Schizophrenie ist eine schwerwiegende psychische Störung, charakterisiert nach dem heute in der Forschung meist verwendeten diagnostischen Verfahren, der Positive and Negative Syndrom Scale (PANSS, Kay 1987) durch die positiven Symptome Wahn, formale Denkstörungen, Halluzinationen, Erregung, Größenwahn, Feindseligkeit sowie Misstrauen/Verfolgungswahn und die negativen Symptome Affektverarmung, emotionale Isolation, mangelnde Beziehungsfähigkeit, passivapathische soziale Isolation, er-schwertes abstraktes Denkvermögen, mangelnde Spontaneität und Gesprächsfähigkeit sowie stereotypes Denken. Prädiktor eines ungünstigen Verlaufes ist ein schleichender Beginn mit unspezifischen Symptomen über bis zu mehreren Jahren. Diese Phase vor dem Erscheinen des vollen Störungsbildes ist diagnostisch besonders wichtig, da durch eine frühzeitige Behandlung ein Ausbruch des vollen Störungsbildes oft verhindert wer-den kann. Die Diagnose ist in diesem Zeitraum nicht eindeutig möglich, da alle hier auf-tretenden Symptome auch bei anderen Störungen vorkommen können. Selbst vorüber-gehend auftretende eindeutige Symptome wie Halluzinationen oder Wahn bedeuten nicht, dass notwendiger Weise eine Schizophrenie bevorsteht (z.B. Klosterkötter 2008). Der Gefahr des Ausbruchs einer Schizophrenie kann damit begegnet werden, dass bei der Anamnese und während der Therapie darauf geachtet wird, ob bereits alltägliche Anforderungen mit zahlreichen und intensiven sensorischen Eindrücken wie Diskotheken- oder Innenstadtbesuche zu einer Verschlechterung des Befindens führen. Auch wenn eine andere Störung vorliegt sollten Patienten in einem solchen Zustand die Grenze ihrer Belastbarkeit wahrnehmen und respektieren lernen, um sich zu schützen, da auch andere Störungen sich sonst verstärken würden. Genau dies schützt effektiv vor dem Ausbruch einer Schizophrenie. Diesen Umstand zu beachten ist auch möglich, wenn eine eindeutige Diagnose noch nicht möglich ist. Medikamentöse antipsychotische Behandlung bringt gegenüber einer kognitiven Verhaltenstherapie keine Vorteile (Klosterkötter 2008). Bei der Psychotherapie ist es wichtig, Betroffene und ihre Familien nicht unbedingt bei der Erzielung ihrer oft hoch gesteckten Ziele zu unterstützen, sondern Ansprüche zu senken und die eigene Ver-wundbarkeit zu akzeptieren. Wenn schon alltägliche Situationen mit intensiven Reizen den Zustand verschlechtern ist die Chance gering, dass Schule oder Ausbildung wie vor Beginn der Störung bewältigt werden. Die Gefahr, durch eine längerfristige Therapie die soziale Entwicklung zu vernachlässigen ist kleiner als die Gefahr eines Rückfalles und einer Verschlimmerung. Dies ist jedoch von Betroffenen und vor allem auch von ihren Familien oft schwer zu akzeptieren und gelingt oft nur im Rahmen einer längerfristigen Familienarbeit. Zahlreiche Therapieprogramme wurden entwickelt und evaluiert, neben dem Integrierten Psychologischen Therapieprogramm für schizophrene Patienten (IPT Roder et al. 1992) beginnend mit der von Liberman, auf Deutsch von Hahlweg und seinen Kollegen seit 1986 evaluierten Familienbetreuung schizophrener Patienten. Inzwischen ist die Wirk-samkeit von Psychotherapie bei Schizophrenie nachgewiesen, sie wird in den Leitlinien empfohlen (Gaebel und Falkai 2006). Betroffene berichten in Veröffentlichungen davon, wie sie Schizophrenie mit psychotherapeutischer Hilfe überwanden (Lauveng 2008) oder mit ihr leben lernten. Es besteht Hoffnung auf Heilung oder zumindest auf Recovery, wie der Zustand erfolgreicher Lebensbewältigung mit weiter bestehenden schizophrenen Symptomen genannt wird (Amering/Schmolke 2007). Um dies zu erreichen wird im Rahmen einer multimodalen Verhaltenstherapie eine kombinierte Anwendung möglichst vieler wirksamer Vorgehensweisen in einem systematischen, zielgerichteten Problemlöseprozess angestrebt. Die Funktionsbereiche Kognition, Emotion und Motivation sowie möglichst viele Bezugspersonen und –institutionen sollten erreicht und einbezogen werden. Die Vorgehensweisen, deren Wirksamkeit empirisch nachgewiesen ist, sind: • Kognitive Therapie in den Bereichen: o Familienarbeit o Psychoedukation o Frühsymptommanagement o Belastungsmanagement o Training sozialer Fertigkeiten o Behandlung positiver Symptome • Medikation • Kognitives Training • Tierbegleitete Aktivitäten • Sport • Kunsttherapie Die therapeutische Haltung Eine Besonderheit bei Schizophrenie ist das hohe Maß an Stigmatisierung, das Betroffene erleiden. 91% der Bevölkerung schätzen Betroffene als bedürftig, 61% als hilflos, 54% als unberechenbar ein (Amering 2007). Das bedeutet, dass auch fast alle Betroffenen selbst Vorbehalte gegen über Menschen haben, die an Schizophrenie leiden – und damit gegen sich selbst. Diese Selbststigmatisierung ist ein wichtiges Thema in der Therapie, das praktisch nie von den Betroffenen selbst angesprochen wird. Folge sind ausgeprägte Identitätsstörungen. Daher wird das Vorliegen der Störung immer wieder verleugnet. Therapeuten sollten sich diesen Umstand vergegenwärtigen. Um Selbststigmatisierung zu vermindern kann z. B. die Verwendung des Begriffs Schizophrenie vermieden werden. Betroffene können ihre Störung nennen, wie sie wollen. Schwere emotionale Krise ist eine Formulierung, die von Betroffenen manchmal lieber gewählt wird. Hier auf Krankheitseinsicht zu bestehen und Betroffene zur Akzeptanz ihres Zustandes durch das Bestehen auf die Diagnose Schizophrenie zu nötigen ist nicht erforderlich. Entscheidend ist die Erarbeitung eines gemeinsamen Störungsbildes, die unbedingt erfolgen muss, auch wenn es lange dauert und zwischenzeitlich andere Interventionen notwendig sind. Das eigene Störungsbild sollte auf eigenen Erfahrungen der Betroffenen beruhen, die gemeinsam ausgewertet werden, und sich dem Vulnerabilitäts-Stress-Bewältigungsmodell (Hahlweg 2006) annähern. Umfangreiche Programme zum Abbau von Stigmatisierung werden seit vielen Jahren mit Betroffenen, ihren Familien und der gesamten Bevölkerung durchgeführt. Sie umfassen: • Symptomreduzierung • Information, Aufklärung • Vermittlung von Erfahrungen im Umgang mit Kranken • Empowerment gegen Selbststigmatisierung • Nicht-stigmatisierende Behandlung • Verbesserung der Versorgung Der Erfolg blieb begrenzt. Dies veranlasste Wulf Rössler, Chefarzt der psychiatrischen Klinik in Zürich, und sein Team (Nordt et al. 2006) einmal nach der Einstellung von Menschen zu fragen, die in solchen Kliniken berufstätig sind. Die Ergebnisse, die in der deutschsprachigen Schweiz gefunden wurden, zeigen, dass Menschen mit Schizophrenie von den in den psychiatrischen Kliniken Tätigen aller Berufsgruppen in gleicher Weise als gefährlicher, unberechenbarer, dümmer, schmuddeliger, unnormaler, unzuverlässiger, eigenartiger, weniger vernünftig, kontrolliert und gesund eingeschätzt werden wie von einer repräsentativen Stichprobe der Allgemeinbevölkerung. Auch die erwünschte soziale Distanz, gemessen an der Bereitschaft, Menschen mit Schizophrenie als Schwiegersohn oder tocher, Freund, Nachbar, Kollege, Staatsbürger oder Besucher in eigenem Land zu akzeptiert ist größer, während sie für Menschen mit einer Depression kaum von der Einstellung gegenüber Gesunden abweicht. Diese Ergebnisse sind von großer Bedeutung, da sich die Art, wie ein Mensch von anderen gesehen wird, auf seine Identität auswirkt. Die Einstellung eines Therapeuten gegenüber seinen Klienten wirkt sich auf den Therapieerfolg aus. Bei Schizophrenie muss eine erfolgversprechende Psychotherapie daher bei der therapeutischen Ausbildung der Menschen ansetzen, denen ein Betroffener in der Klinik begegnet. Ziel ist es, Vorbehalte abzubauen und Zuversicht in die Wirkung des eigenen therapeutischen Handelns zu gewinnen. Auch Menschen mit Schizophrenie haben gesunde Persönlichkeitsbereiche, mit ihnen kann eine Beziehung aufgenommen werden, hier möchten Betroffene wahrgenommen werden und Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit ihrer Störung erhalten. Eine aufrichtig positive therapeutische Haltung ist Voraussetzung für eine erfolgreiche multimodale Verhaltenstherapie der Schizophrenie (Amering/ Schmolke 2007). Ob dies möglich ist, entscheidet die Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbstreflexion, Aufrichtigkeit und gegebenenfalls zur Selbstmodifikation der Therapeuten. Die heute vorliegenden Kenntnisse über Schizophrenie und der Möglichkeiten ihrer Therapie geben Anlass zur Hoffnung. Einige wichtige Ergebnisse sollen hier vorgestellt werden. Je nach Interesse und Auffassungsvermögen können die Inhalte dieses Beitrages Betroffenen und ihren Angehörigen im Rahmen einer Psychoedukation vermittelt werden. Psychoedukation, die Vermittlung von Informationen und Fähigkeiten mit dem Ziel, psychische Störungen zu lindern, ist ein wichtiger Bestandteil multimodaler Verhaltenstherapie. Dazu ist vorweg zu betonen, dass bei der Durchführung der zahlreichen vorliegenden Standardprogramme zur Psychoedukation bei Schizophrenie Vorsicht geboten ist. Zu viel Information zum falschen Zeitpunkt kann zu depressiver Stimmung, Suizidgedanken und verringerter Lebensqualität führen (Karow und Pajonk 2006). Besser ist es, flexibel auf die jeweils bestehenden Fragen einzugehen. Dann kann die Vermittlung von Informationen therapeutisch wirken. Zur Psychoedukation: Ergebnisse der Forschung zur Schizophrenie Neurologische und neuropsychologische Befunde Einige Befunde wurden herausgegriffen, weil sie einerseits durchgehend zu finden waren und weil sie andererseits die veränderte Reaktion Betroffener auf Sinnesreize wi-derspiegeln. Diese unten genannten Befunde helfen Betroffenen und Angehörigen, sich auf die Besonderheiten des Erlebens einzustellen. Während einer Schizophrenie berichten viele Betroffene, dass sie sich in Situation mit vielen Sinnesreizen deutlich mehr belastet fühlen als zu gesunden Zeiten und Wichtiges schlechter von Unwichtigem unterscheiden können. Dieser Umstand kann anhand der genannten Befunde verständlich werden. Eine distanzierte Betrachtung und ein sachlicherer Umgang mit den erlebten Veränderungen und ihren Folgen, nämlich der Gefahr einer Verschlechterung des Zustandes durch zu langen Aufenthalt in Situationen mit starken, vielfältigen Sinnesreizen, z. B. Diskotheken und Innenstädten, kann dadurch erleichtert werden. Allgemein wurden im Zuge der Forschung Abweichungen oder Verzögerungen der Ent-wicklung des Nervensystems bei Schizophrenie mit bildgebenden Verfahren gezeigt. Die in der Jugend erfolgenden Umbauprozesse des Gehirns laufen bei Betroffenen weniger ausgeprägt ab (Gogtay et al. 2008). Dies geht einher mit veränderten Reaktionen auf Sinnesreize. Häufig repliziert werden konnten Veränderungen der Reaktion auf evozierte Potentiale im Elektroenzephalogramm. Die im EEG nach 50 ms bei Gesunden nach einem etwas lauteren Ton in einer Reihe gleicher Töne auftretende Welle ist bei Schizophrenie deutlich niedriger ausgeprägt. Je stärker die schizophrene Symptomatik ist, umso weniger zeigt sich diese Welle. Dieses Phänomen wird Mismatch Negativity genannt (Kircher/ Gauggel 2008). Eine andere Veränderung findet sich bei der Reaktion auf zwei in kurzer Folge dargebotene Sinnesreize, zum Beispiel zwei Klicks. Menschen mit einer Schizophrenie habituieren weniger. Dieses Phänomen wird Prepulse Inhibition genannt (a. a. O.). Erlebt wird dies als intensivere Wahrnehmung. Die Hintergrundgeräusche können nicht ausgeblendet werden, wodurch der Aufenthalt an lärmbelasteten Orten sehr anstrengend ist. Der Aufenthalt, das Lernen oder Arbeiten an Orten mit hohem Ge-räuschpegel ist für Menschen mit Schizophrenie äußerst anstrengend. In einem ruhigen Umfeld sind sie deutlich leistungsfähiger. Interessante Einblicke in die Entwicklung neuropsychologischer Fähigkeiten gab die Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study. Für diese Studie wurden alle 1037 Kinder, die in den Jahren 1972/73 auf der Südinsel Neu Seelands geboren wurden, vom 3. bis zum 32. Lebenjahr regelmäßig untersucht. Im Alter von 7, 9, 11 und 13 Jahren wurden acht Subtests der WechslerIntelligence Scale for Children – revidierte Fassung – (Deutsch: Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder HAWIK-R) durchgeführt. Im Jahre 2010 wurden die Testergebnisse derjenigen gesondert ausgewertet und mit der Gesamtpopulation verglichen, die bis zum Alter von 32 Jahren eine Schizophrenie entwickelten (Reichenberg et al. 2010). Diese Ergebnisse erlauben nun einen Einblick, welche Veränderungen der intellektuellen Entwicklung einer Schizophrenie vorausgehen. Die Ergebnisse zeigen, dass tatsächlich bereits in der Kindheit schlussfolgerndes Denken und Begriffsbildung, Fähigkeiten, für die Abstrakti-onsvermögen erforderlich ist, im Mittel geringer ausgeprägt sind. Sie entwickeln sich wie bei Gesunden, allerdings im Durchschnitt auf einem etwas niedrigeren Niveau. Auf-merksamkeit, Arbeitstempo und Arbeitsgedächtnis sind in der Kindheit durchschnittlich, zeigen aber eine während der Entwicklung zunehmende Verzögerung. Bemerkenswert – und dieser Umstand ist wichtig für die Psychoedukation – ist, dass kein dauerhafter Abbau von Fähigkeiten gefunden wurde. Es ist denkbar, dass Menschen mit Vulnerabilität für schizophrene Störungen einen gesunden Entwicklungsstand erreichen können, wenn sie spezifisch gefördert werden oder ihrer langsameren Entwicklung die erforderliche Zeit gegeben wird. Betroffene müssen also akzeptieren, dass ihnen manche Anforderungen schwerer fallen und dass sie manche Fähigkeiten langsamer entwickeln. Andere Befunde, (siehe Abschnitt „Sport“) werfen die Frage auf, ob diese Unterschiede zum Teil nicht Ursache, sondern Folge der Tatsache sind, dass Menschen mit Schizophrenie – und möglicherweise auch solche mit einer Vulnerabilität hierfür – sich wegen ihrer höheren Empfindlichkeit für Sinnesreize mehr zurückziehen, weniger aktiv sind und die Unterschiede der Gehirnentwicklung zum Teil Folge dieser Inaktivität sind. Dies ist eine spannende Frage für die weitere Forschung. Ein Verlust von intellektuellen Fähigkeiten tritt durch die Erkrankung vor allem vor-übergehend, während akuter Phasen der Störung, auf. Für die Therapie bedeutet das zu beachten, dass Menschen in akuten schizophrenen Episoden besondere Lernbedingungen und gezielte Förderung brauchen. Vor allem scheint es so zu sein, dass eine zu lange Hospitalisierung, Beeinträchtigungen durch Nebenwirkungen hoch dosierter Medikation und die anschließende unvermittelte Rückkehr in den Alltag Rückfälle provoziert. Betroffene brauchen die Möglichkeit, in kleinen Schritten ihre Fähigkeiten wieder aufzubauen und sich unter geeigneten Bedingungen auf den Alltag vorzubereiten. Ein weiteres interessantes Ergebnis der Dunedin Multidisciplinary Health and Deve-lopment Study war, dass 35 der 1037 Teilnehmer die diagnostischen Kriterien für eine Schizophrenie erfüllten, jedoch nur 11 Teilnehmer sich deswegen in Behandlung befan-den. 24 Teilnehmer hatten offensichtlich einen Weg gefunden, ohne Behandlung zu leben. Es ist zu hoffen, dass noch untersucht wird, unter welchen Bedingungen ihnen dies gelang. Die Prävalenz der Schizophrenie wird üblicherweise mit 1 Prozent angegebenen. Diesen Ergebnissen zufolge wird sie möglicherweise unterschätzt. Auch die Tatsache, dass Schizophrenie in allen Regionen der Erde in ähnlicher Häufigkeit auftritt, bestätigt sich nicht, die Ein-Jahres-Inzidenz reicht von 2,7% in Italien bis zu 8,3 % in Irland (McGrath et al. 2007). Genetik Eine weitere regelmäßig gestellte Frage ist, welche Rolle genetische Einflüsse auf das Entstehen einer Schizophrenie haben. Das Risiko zu erkranken steigt an, je enger die Verwandschaft zu einem Betroffenen ist, bei Enkeln 5 Prozent, bei Kindern 13 Prozent, bis zu 48 Prozent bei eineiigen Zwillingen. Einige Gene haben sich in verschiedenen Studien (Kircher/Gauggel 2008) als bedeutsam erwiesen, z. B. das Dysbindin-Gen, das Gen für Neuregulin 1 und das Gen für COMT (Catechol-OMethyltransferase). Umgekehrt tritt jedoch nur bei 2% der Träger dieser identifizierten Risikogene eine Schizophrenie auf, 98% der Träger solcher Gene bleiben gesund. Die Vulnerabilität für schizophrene Störungen scheint auf eine Interaktion mehrerer Genbereiche zurück zu gehen. Bei den Veränderungen der genannten Gene handelt es sich um Einzelnukleo-tidpolymorphismen, Genkopiezahlvarianten und Unterschiede in der Expression bestimmter Genbereiche. Alle diese Phänomene gehören zur gesunden Variabilität unserer Gene. Es wurden keine Genschäden oder Mutationen gefunden. Verschieden Untersuchungen zeigten auch unterschiedliche Genbereiche, die mit schizophrenen Störungen einhergingen. Diese Forschungsergebnisse sprechen dafür, dass andere Einflüsse als die ererbten Gene hinzutreten müssen, damit eine Schizophrenie entsteht. Eine Interaktion von Umwelt- und Geneinflüssen wurde für den Konsum von THC und das COMT-Gen gefunden. Dieses Gen liegt in einer Variante mit der Aminosäure Me-thionin und in einer Variante mit Valin vor. Die Valin-Variante erhöht deutlich das Risiko, durch THC-Konsum an einer Schizophrenie zu erkranken (Caspi et al. 2005). Auch auf andere Drogen reagieren Betroffene der klinischen Erfahrung nach deutlich stärker. Auch wenn diese Befunde nicht systematisch erhoben wurden zeigte die unten dargestellte Untersuchung (Hemmerle et al. 2010), dass Betroffene, die Drogen konsumierten, höhere Dosen von Antipsychotika einnehmen mussten und einen schlechteren Verlauf hatten. Immunologische Befunde Andere Interaktionen mit genetischen Einflüssen weisen auf Einflüsse des Immun-systems hin (Eggers 2011). Dies könnte erklären, warum Infektionen während der Schwangerschaft 20 oder 30 Jahre später zur Erkrankung führen: Das Immunsystem un-terliegt einer Reifung bis ins Erwachsenenalter hinein. Auch später auftretende Infektio-nen sowie das Vorliegen von Autoimmunstörungen erhöhen das Risiko, eine Schizophrenie zu entwickeln. Psychotische Symptome bessern sich durch immunmodulierende Substanzen, bei negativen Symptomen besteht ein Glycinmangel, und Glycin wirkt entzündungshemmend. Die durch diese Hinweise angeregte Forschung führte 2009 zu einem interessanten Ergebnis, Söderlund und sein Team fanden im Liquor Cerebrospinalis von Menschen im Anfangsstadium einer Schizophrenie erhöhte Konzentration von Interleukin-1beta, das entzündungsfördernd wirkt. Möglicherweise ist dies der erste laboranalytischen Befund, der spezifisch ist für Schizophrenie. Entsprechende weitere Untersuchungen stehen jedoch noch aus. Erhöhte Interleukin-1beta-Werte bei älteren Betroffenen, die nicht auf eine antipsychotische Medikation reagierten, sind schon seit 2005 bekannt (Schmitt et al. 2005). Es wird diskutiert, ob nicht zumindest ein Teil der schizophrenen Störungen auf eine Autoimmunstörung des zentralen Nervensystems zurückzuführen ist (Der Spiegel 32/2012). Diese Befunde sind für Betroffene von Interesse, da andere Ergebnisse den starken Einfluss zeigen, den die Psyche auf das Immunsystem hat. Goebel (et al. 2002) konnten zeigen, dass die im Tierversuch bereits bekannt gewesene Konditionierbarkeit von Immunreaktionen auch bei Menschen möglich ist. Sie gaben gesunden Versuchspersonen sechsmal an drei Tagen Ciclosporin, ein Immunsuppressivum, wie es nach Organtransplantationen verabreicht wird, um die Abstoßung körperfremden Gewebes zu vermeiden. Dazu gaben sie jeweils 150 ml Erdbeermilch mit einem Tropfen Lavendelöl, einen Geschmack, den die Versuchspersonen zuvor noch nicht zu sich nahmen. Anschließend wurden wie erwartet verringerte Serumspiegel von Interleukin-2 und InterferonGamma gefunden. Eine Woche darauf erhielten die Versuchspersonen wiederum Erdbeermilch mit Lavendelöl, dazu jedoch ein Placebo. Die Laboranalyse zeigte wiederum erniedrigte Serumspiegel von Interleukin-2 und Interferon-Gamma. Dabei wussten die Versuchspersonen nicht einmal, was eigentlich untersucht wurde. Unser Immunsystem lernt also ohne unser bewusstes Zutun. Es bleibt zu untersuchen, inwiefern ähnliche Effekte durch psychische Einflüsse auf das Immunsystem bewirkt werden. Auch wenn dies noch weiter untersucht werden muss, so wird die Hoffnung, dass Schizophrenie durch psychische Einflüsse gebessert werden kann, gestärkt, wenn Prozesse des Immunsystems eine Rolle spielen. Antipsychotische Medikation Nach 60 Jahren Erfahrung werden derzeit derzeit die Chancen und Risiken psycho-pharmakologischer antipsychotischer Behandlung intensiv diskutiert, vor allem auch bei dem Verdacht auf eine prodromale Phase einer Schizophrenie. Dazu ein kleiner Rückblick auf die Geschichte der Antipsychotika. Nach der Entdeckung der antipsychotischen Wirkung des Haloperidols und Chlorpro-mazins ab 1952 traten damals vor allem schon von Gaetano Benedetti und seinen Schü-lern angewendete psychoanalytische Vorgehensweisen, deren langfristige Erfolge wieder Beachtung finden (Benedetti 1998) in den Hintergrund, man setzte ganz auf die Wirkung der bis vor kurzem Neuroleptika genannten Substanzen. Auch der Umstand, dass eine dauerhafte Hospitalisierung damit oft nicht vermieden werden konnte, änderte daran nichts. Erst in den 80iger Jahren des letzten Jahrhunderts wurden wieder neue psychotherapeutische Verfahren entwickelt, z. B. das „Integrierte psychologische Therapieprogramm für schizophrene Patienten (IPT)“ (Roder et al. 1992). Ziel war es, an Schizophrenie leidenden Menschen, die auf Langzeitstationen der psychiatrischen Kliniken lebten, wieder zu einem selbständigeren Leben zu verhelfen, zumindest in einem Wohnheim in ihrer Herkunftskommune. Die zweite Generation antipsychotischer Medikamente (SGA) beginnend mit Clozapin im Jahre 1972 verhieß zunächst einen weiteren Durchbruch, da sie teilweise eine bessere Wirkung, vor allem aber weniger sichtbare Nebenwirkungen zeigten. Da SGA die Zahl der Suizide verringern (Aguilar/Siris 2007) sind sie zu einem unverzichtbaren Be-standteil der Behandlung geworden. Dennoch muss die Verordnung dieser Medikamente heute auf das unbedingt Notwendige beschränkt werden. Die nun 40-jährige Erfahrung mit SGA zeigt, dass langfristige Behandlung mit antipsychotischen Medikamenten der zweiten Generation häufig zu Veränderungen des Fettstoffwechsels mit einer Erhöhung des Cholesterolspiegels im Blut, Übergewicht, Gefäßveränderungen und koronaren Herzerkrankungen führen. Es besteht der Verdacht, dass die Lebenserwartung unter einer Dauerbehandlung mit Antipsychotika, vor allem solchen der zweiten Generation, sinkt (Weinmann et al. 2009). Der vielfach replizierte Befund, dass ein länger währendes Auftreten schizophrener Symptome vor einer antipsychotischen Medikation mit einem schlechteren Verlauf der Störung einhergeht, führte zu der Auffassung, dass eine regelmäßige und frühzeitige Einnahme von Antipsychotika sich günstig auf den Verlauf einer Schizophrenie auswirkt. Bei differenzierter Betrachtung aller Forschungsergebnisse muss diese Auffassung relativiert werden. Als Prädiktoren eines ungünstigen Verlaufes haben sich eine schlechte prämorbide Anpassung betreffend Kontakten, Interessen und Aktivitäten, das Vorliegen negativer Symptome und ein schleichender Beginn herausgestellt (z.B. Röpcke/Eggers 2005). Von einem schleichenden Beginn spricht man, wenn mindestens vier Wochen vor der akuten Schizophrenie bereits unspezifische Symptome vorlagen. Dies ist in etwa 50% der Erkrankungen der Fall. Die Bedeutung eines schleichenden Beginns ist in den Untersuchungen zur Dauer der unbehandelten Psychose meist nicht diskutiert worden, obwohl ja nur bei einem schleichenden Beginn überhaupt eine sogenannte Phase unbehandelter Psychose auftreten kann. Röpcke hat in einer Verlaufsstudie über etwa 15 Jahre sowohl die Art des Beginns, als auch die Dauer der unbehandelten Störung erhoben und mittels partieller Korrelation den Einfluss beider Variablen statistisch betrachtet. Dabei war der Zusammenhang mit der Dauer der unbehandelten Psychose nicht mehr signifikant, nur das Vorliegen eines schleichenden Beginns. Dieser Einfluss ist durch den Zeitpunkt des Beginns einer antipsychotischen Medikation nicht zu verringern. Die Auffassung, dass akute Schizophrenie rasch und hochdosiert antipsychotisch behandelt werden muss, ist also fraglich. Auch Ciompi, der akute Schizophrenie ohne Medikamente behandelte zeigte, dass eine Verschlechterung des Verlaufes dadurch nicht eintritt. Da ein nicht geringer Anteil akuter Psychosen mit schizophrener Symptomatik ohnedies unbehandelt vorübergeht (Straube/Oades 1992) kann mit einer Medikation gewartet werden, wenn das Ausmaß des Leidens es erlaubt. Ein weiteres Ergebnis zum Verlauf von Schizophrenie ist, dass das Vorliegen positiver Symptome für den Verlauf ohne Bedeutung ist, wozu Straube und Oades bereits 1992 in ihrer leider nur auf Englisch erschienen Veröffentlichung verschiedene Untersuchungen zitieren konnten. Im Gegenteil steht die rasche, hoch dosierte und nicht selten gegen den Willen der Betroffenen verabreichte antipsychotische Medikation bei akuter Schizophrenie im Verdacht, den Verlauf durch Nebenwirkung ungünstig zu beeinflussen. Antipsychotische Medikamente sind unentbehrlich, um die bei einer Schizophrenie häufig entstehenden Ängste zu lindern und Betroffene vor Suizidalität zu schützen. Nur bei einer kontinuierlichen, intensiven und spezialisierten therapeutischen Betreuung war es möglich, auf solche Medikamente zu verzichten. Dies zeigten die Erfahrungen von Luc Ciompi und Dan Mosher in den Soteria-Projekten (Ciompi et al. 2001). Leider ließen sich solche Bedingungen nicht dauerhaft verwirklichen. Der Verlauf der Schizophrenie war ohne Medikation nicht schlechter. Weitere wichtige Aufschlüsse ergab die Früherkennungs- und Interventionsforschung. Sie zeigte, dass bei Vorliegen eines Prodromalstadiums der Ausbruch einer akuten Schizophrenie durch kognitive Verhaltenstherapie ebenso gut verhindert werden konnte wie durch eine antipsychotische Medikation (Klosterkötter 2008). Daneben zeigte sich, dass der Versuch einer Früherkennung auch in den besten Studien zu Vorhersagequoten für den Ausbruch einer akuten Schizophrenie von lediglich 40% kam. Prodromalstadien sind unspezifisch, es gibt keine eindeutigen Symptome, die einer Schizophrenie vorausgehen – leider jedoch oft viele unspezifische Symptome. Es erscheint daher vertretbar, Antipsychotika in Absprache und wenn möglich mit Einwilligung der Betroffenen zu verordnen, aber damit auch zu warten, bis die Betroffenen einverstanden sind. Wird dieses Einverständnis einmal übergangen, ist das Vertrauen zum Arzt oft verloren, die Betroffenen berichten nicht mehr über positive Symptome, auch, wenn sie sehr leiden. Übernimmt man die psychotherapeutische Behandlung eines Betroffenen, der bereits andernorts in Behandlung war, muss un-bedingt nach solchen Erfahrungen gefragt werden. Manchmal lässt sich das Vertrauen mit der Zusage wieder herstellen, ein solches Vorgehen zu vermeiden. Dabei können Krisenpässe helfen, in denen zu Zeiten guten Befindens festgehalten wird, wie, womit, unter welchen Bedingungen und von wem bei Auftreten einer akuten Schizophrenie behandelt werden soll. Formulare hierfür sind bei Selbsthilfeverbänden erhältlich. Eine gute therapeutische Beziehung zu Betroffenen ist wichtiger als eine rasche Einnahme von Antipsychotika. Übrigens ist seit 20 Jahren bekannt, dass bei Antipsychotika eine Testdosis Aufschluss über die Wirksamkeit gibt (Straube und Oades 1992). Wenn eine solche Testdosis keine Entlastung bewirkt, ist auch bei längerer Einnahme nicht mit einer Wirkung zu rechnen. Auch dieses Ergebnis könnte in der Praxis häufiger berücksichtigt werden und könnte helfen, Fragen nach therapeutischer Beziehung, notwendiger Behandlung und Au-tonomie der Betroffenen besser zu vereinbaren. Im Verlauf der Erkrankung sollte immer wieder sorgfältig darauf geachtet werden, im Gespräch mit Betroffenen die antipsychotische Medikation so rasch und so weit wie mög-lich zu reduzieren. Wenn eine gute therapeutische Beziehung besteht und ein funktionales Störungsbild entwickelt werden konnten ist dies oft möglich, dann wird die Medikation als Hilfe erlebt und darauf zurückgegriffen, wenn sich das Befinden verschlechtert. Diese Aspekte verdeutlichen, dass die Gabe antipsychotischer Medikamente hohe psychotherapeutische Anforderungen umfasst. Daher gehört auch das Thema Medikation zu einer multimodalen Verhaltenstherapie. Therapeutische Vorgehensweisen Arbeit mit Familien und Angehörigen Alle oben genannten Informationen können selbstverständlich auch den Angehörigen vermittelt werden. Schon bei der ersten Begegnung mit ihnen, vor allem mit den Eltern, sind ihre durchgehend großen Schuldgefühle zu bedenken. Solche Schuldgefühle entstehen immer, wenn Kinder an einer schweren Erkrankung leiden, vor allem, wenn eine psychische Ursache möglich erscheint. Im Falle von Schizophrenie werden Schuldgefühle verstärkt durch Konzepte wie das der „schizophrenogenen Mutter“ oder des „Double Bind“. Mütter geraten durch diese Konzepte in Gefahr, suizidal zu werden. Noch heute werden Zitate von Bruno Bettelheim veröffentlicht, dass Kinder, die im Kibbuz aufwachsen, keine Schizophrenie bekommen. Keines dieser Konzepte konnte empirisch bestätigt werden. Außer dem Leid der Eltern haben sie keine Wirkung gezeigt. Auch die systemischen Konzepte von Pallazoli (1977) haben die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. Es gibt keinen Trick zur Behandlung von Schizophrenie, es bleibt eine langwierige und aufwändige Arbeit. Im akuten Stadium einer Schizophrenie kann die Kommunikation betroffener Familien gestört sein, umso stärker, je ausgeprägter die negative Symptomatik des Erkrankten ist. Bei der langfristigen Begleitung von Familien mit Betroffenen kann erlebt werden, dass dies nicht Ursache, sondern Folge der ausgeprägten Defizite ist, die in diesem Stadium auftreten, wofür es auch empirische Belege gibt (King 2000). Betroffene können sich kaum etwas merken und sind nicht in der Lage, sich zu behaupten. Sie können nicht einmal mitteilen, dass sie nicht in der Lage sind, eine von ihnen verlangte Absprache nicht einzuhalten. Sie stellen hundertmal die gleiche Frage, ziehen sich vollkommen zurück oder sind albern, läppisch und distanzlos. Vorher waren sie vielleicht begabte Schülerinnen und Schüler. Es ist gut nachvollziehbar, wenn auch ausgeglichene und belastbare Eltern in dieser Situation nicht mehr zu einer geduldigen, verständnisvollen Haltung in der Lage sind. Sie brauchen Zeit und Hilfe, um eine solche Haltung wieder zu entwickeln. Diese Hilfe ist wichtig, da eine dysfunktionale Kommunikation in der Familie für einen Rückfall tatsächlich mit auslösend sein kann. In der Familienarbeit ist es immer wieder eine große Freude, mitzuerleben, wie anfangs unter großem Druck stehende, schwierig erscheinende Eltern zu den liebenswürdigsten Menschen werden, wenn es ihrem Kind besser geht. Eltern brauchen also Verständnis und Unterstützung für ihre Situation. Sie sind keine Patienten und müssen als gleichberechtigte Partner gesehen werden. Meist haben sie wertvolle Erfahrungen mit ihren kranken Kindern gesammelt, die es verdienen, aufgegrif-fen und ernst genommen zu werden. Ein Störungsbild, Ziele der Behandlung sowie Interventionen müssen gemeinsam entwickelt werden. Der Einfluss der Eltern – auch auf erwachsene Betroffene – wird immer größer sein als der Einfluss des Therapeuten. Bemühungen von therapeutischer Seite bleiben daher oft zwecklos, wenn nicht die Eltern als Kotherapeuten gewonnen werden. Die dafür notwendige Zeit ist gut investiert, auch wenn es ein Jahr und mehr dauern kann. Bis dahin tut der Therapeut gut daran, sich der Auffassung der Eltern anzuschließen, auch wenn sie falsch ist. Bestehen die Eltern z.B. auf eine Fortsetzung des Schulbesuches, obwohl deutlich ist, dass dies nicht gelingen kann, ist ein gescheiterter Versuch meist weniger schädlich als ein Machtkampf mit den Eltern. Wenn der Therapeut rechtzeitig auf Zeichen einer erneuten Verschlechterung des Zustandes hinweisen kann und im Anschluss eine neue Perspektive sowie Mut und Hoffnung vermittelt, ist oft viel gewonnen. Man kann dies als Verhaltensexperiment im Rahmen einer kognitiven Therapie verstehen. Viele Einstellungen sind nur durch eigene Erfahrungen modifizierbar. Die Eltern sollen so weit wie möglich in die Therapie und die Verantwortung einbezogen werden. Die Wirksamkeit dieses Vorgehens hat Katschnig mit der Pension Bettina, einer Fünf-Tages-Gruppenbetreuung in Wien, gezeigt. Hier waren Eltern an der Organisation und Durchführung von Unternehmungen beteiligt und haben sogar Nachtbereitschaftsdienste übernommen. (Katschnig et al. 1989). Familienarbeit senkt die Rückfallrate um ca. 20%, erhöht die Compliance, verbessert die soziale Anpassung und verringert die Belas-tung der Familie. Sie ist unabhängig von Setting (Eltern- oder Familiengespräche, Multieltern- oder Multifamiliengruppen, Telefonkontakte, gemeinsame Aktivitäten) und sollte phasenspezifische Belange der Familien beachten (Vauth 2009). Wenn erforderlich – und nur dann – können den Familien kommunikative und emotionale Kompetenzen sowie Problemlösestrategien vermittelt werden (Hahlweg et al. 2006, Vauth et al. 2009). Führt man die hierzu bestehenden Programme standardmäßig vollständig durch, vermittelt man Familien den Eindruck, Fehler an einer Stelle zu machen, wo dies gar nicht der Fall ist. Dies kann die ohnehin bestehende Demoralisierung verstärken. Kognitive Therapie Nach der Aufklärung und Informationsvermittlung, der Vermittlung von Hoffnung und dem Abbau von (Selbst-)Stigmatisierung sowie der Frage einer Medikation ist das Thema Belastungsmanagement wichtiger Teil der kognitiven Therapie. Eine akute Schizophrenie geht mit einem Verlust intellektueller Fähigkeiten und Einbußen der Abgrenzung gegen Sinnesreize einher. Betroffene ziehen sich zurück und werden inaktiv. In den Soteria-Projekten kamen sie in diesem Zustand in ein sogenanntes weiches Zimmer, das größtmögliche Reizarmut bot und alles zur Verfügung stellte, um die Betroffenen zu beruhigen und ihnen Sicherheit zu vermitteln – einschließlich einer 24-Stunden Einzelbetreuung. Wenn sich der Zustand wieder etwas stabilisiert hat, ist es von entscheidender Bedeutung, Anforderungen behutsam zu beginnen und langsam zu steigern. Schwankungen des Befindens und Rückfälle sind Folge einer zu frühen intellektuellen, sozialen, sensorischen oder auch körperlichen Überforderung. Zwischen der Belastungsgrenze und dem notwendigen Maß an Übung zum Erhalt bzw. Wiederaufbau der verlorenen Fähigkeiten öffnet sich ein anfangs schmaler Korridor, der für eine erfolgreiche Rehabilitation unbedingt eingehalten werden muss. Sozial- und arbeitstherapeutische Maßnahmen müssen unbedingt psychotherapeutisch begleitet werden, um Verschlechterungen des Befindens in Zusammenhang mit erlebter Überforderung zu stellen. Betroffene müssen lernen, die Grenze der eigenen Belastbarkeit selbst wahrzunehmen und stärker werdende Symptome als Früh-warnzeichen zu deuten, um dann Ruhe zu suchen. Selbst der Aufenthalt in einer Innenstadt wird für Betroffenen noch über einen langen Zeitraum nach ein bis zwei Stunden meist zu viel. So wichtig es ist, Innenstädte zu besuchen, um seine Belastbarkeit zu steigern, so wichtig ist es, die Grenze zu beachten und nicht zu über-schreiten. Auch schöne Dinge, also positive Aktivitäten, überschreiten die Belastungsgrenze. Zu lernen, seine Belastungsgrenze in eigener Verantwortung zu beachten ist eine entscheidende Voraussetzung für eine erfolgreiche Rehabilitation und wichtige Aufgabe der kognitiven Therapie. Es ist nicht immer leicht, Gelegenheiten zum Lernen und Arbeiten zu finden, wo Verständnis von Betreuern, Lehrern, Ausbildern und Vorgesetzten besteht. Auslöser für Rückfälle ist häufig die zu rasche Rückkehr in Schule oder Beruf, wo die volle Leistungsfähigkeit erwartet wird. Einerseits wollen sich Betroffene vor allem nach der ers-ten akuten Phase beweisen, dass sie es wieder schaffen, andererseits fehlen immer noch Angebote, die eine gestufte Rückkehr in den Alltag über einen ausreichend langen Zeitraum ermöglichen. Weitere Techniken kognitiver Therapie sind das Entpathologisieren positiver Symptome: Stimmen zu hören ist ein gar nicht so seltenes Phänomen, das auch bei fünf Prozent gesunder Menschen bei emotionalem Stress auftritt. Auch Wahngedanken sind durchaus bei sonst gesunden Menschen zu finden. Die Vermittlung von Co-pingstrategien bzw. Skills zur Bewältigung emotionaler Krisen ist auch bei Menschen mit Schizophrenie wichtig, wobei hier meist der Rückzug und die Sorge für Ruhe und Erholung Mittel der Wahl sind. Wichtig ist, kommunikative Kompetenzen zu entwickeln, um dies seinen Mitmenschen verständlich machen zu können. Auch eine Exposition ist manchmal in kleinen Schritten möglich, wenn Ängste vor bestimmten Erlebnissen bestehen. Die Veränderung von MetaKognitionen hat in letzter Zeit Beachtung gefunden, also die Art, wie Betroffene über ihre Symptome denken. Schon die Frage, ob jemand den Stimmen, die er hört, glaubt, kann Veränderungsprozesse initiieren, an deren Ende die Distanz zu den Stimmen deutlich zunimmt. Bei Wahngedanken können Verhaltensexperimente wie bei jeder anderen dysfunktionalen Einstellung weiter führen. Hilfreich ist auch das positive Umdeuten von Symptomen als Warnsignal für eine Über-forderung und Überschreitung der Belastungsgrenze (Frühwarnsymptome). Insgesamt ist kognitive Therapie bei Schizophrenie anwendbar, wenn auch nicht in jedem Fall. In den letzten Jahren wurden verschiedene Manuale dazu veröffentlicht (Klingberg et al. 2008, Lincoln 2006, Vauth et al. 2006, 2008, 2009). Häufig ist es entscheidend, den richtigen Zeitpunkt für solche Interventionen zu finden bzw. immer wieder Probeinterventionen zu versuchen. Oft kommt im Verlauf der Störung der Zeitpunkt, wo kognitive Interventionen möglich sind, wenn auch erst nach mehreren Jahren. Kognitive Therapie umfasst auch den Aufbau kommunikativer und emotionaler Kompetenzen. Hier liegt der Schwerpunkt weniger auf der Verbesserung der Fähigkeit, sich selbst zu behaupten, sondern darauf, sich abzugrenzen, zu schützen und sich mit seinen Eigenschaften und Verwundbarkeiten verständlich zu machen. Kognitive Therapie als Versuch der Modifikation dysfunktionaler Einstellungen ist ab-zugrenzen von kognitivem Training, dessen Ziel die Verbesserung intellektueller Fähigkeiten ist. Beides ist bei Schizophrenie wichtig und sollte parallel erfolgen. Im Idealfall wirken vorbereitende Maßnahmen für die Rückkehr in Schule, Ausbildung oder Beruf als kognitives Training. Sport Eine weitere wirksame Intervention bei Schizophrenie ist Konditionstraining. Pajonk et al. (2010) konnten zeigen, dass innerhalb von drei Monaten durch Fahrradergometertraining der bei Schizophrenie typischer Weise verkleinerte Hippocampus an Volumen zunahm, während in einer Vergleichsgruppe, die Tischfußball spielte, das Volumen – wenn auch nicht signifikant - abnahm. Dies zeigt, wie rasch das Gehirn sogar morphologisch auf Verhaltensänderungen reagiert. Auch in der Vergleichsgruppe gesunder Teilnehmer wuchs der Hippocampus. Dies wirft wiederum die Frage auf, ob die Verringerung seiner Größe und vielleicht auch andere morphologische Veränderungen, die sich in den Gehirnen von Menschen mit Schizophrenie finden, gar nicht Ursache der Störung, sondern Folge der durch eine Schizophrenie bedingten Inaktivität sind. Ein weiterer Hinweis dafür ist der Befund, dass der Hippocampus bei hyperaktiven Kindern im Mittel vergrößert ist und sich seine Größe unter einer Behandlung mit Methylphenidat normalisiert – vielleicht nicht direkt durch die Wirkung des Methylphenidats, sondern durch die verringerte Aktivität unter dieser Behandlung. Jedenfalls rechtfertigt die heute bekannte Plastizität des zentralen Nervensystems sowohl morphologisch als auch funktional die Hoffnung auf eine Heilung trotz aller bei Menschen mit Schizophrenie gefundenen abweichenden Befunde. Dies macht alle diese Ergebnisse für die Psychoedukation interessant. Es bleibt natürlich eine Herausforderung, Betroffene tat-sächlich zu einem Konditionstraining zu motivieren. Hier ist wiederum die Ermutigung durch alle Bezugspersonen gefragt, was leider auch nicht in allen Fällen zum Erfolg führt. Spezielle Angebote hierfür sind hilfreich, natürlich auch für andere Störungsbilder (z. B. Depression, Abhängigkeit). Kunsttherapie Gut etabliert ist meist kreatives Arbeiten mit Betroffenen, vor allem Malen. Dazu besteht meist hohe Bereitschaft, es wird als entlastend erlebt, Ressourcen werden entdeckt, da viele Menschen mit Schizophrenie sehr kreativ sind. Die Art der Darstellung gibt dia-gnostische Aufschlüsse. Rückmeldungen zu den Bildern müssen immer positiv sein und der Stabilisierung der Identität dienen. Benedetti (2004) und seine Schüler haben das Malen intensiv in die von ihnen durchgeführten Psychoanalysen einbezogen und z. B. auch Antwortbilder gemalt. Auch dieses Vorgehen wird von einer multimodalen Verhaltenstherapie aufgegriffen. Tierbegleitete Aktivitäten Für tierbegleitete Aktivitäten werden Erfolge bei Schizophrenie wie bei vielen anderen Störungsbildern berichtet (Chu et al. 2009). Auch in dem unten genannten Projekt wirk-ten Hunde mit. Voraussetzung dafür war, dass Mitglieder des Teams einen geeigneten Hund anschafften und zur Arbeit mitbrachten. Eine Therapiehundeausbildung, die hier von den Mitarbeitern selbst übernommen wurde, muss sicherstellen, dass von den Hunden keine Gefahr ausgeht. Es konnte gut erlebt werden, wie wohltuend es für Betroffene war, wenn ein Tier auf sie zuging. Dies konnten sie annehmen, auch wenn es ihnen noch nicht möglich war, auf Menschen einzugehen. Manche gingen mit dem Hund spazieren oder spielten mit ihm, was die erste freiwillig ausgeführte positive Aktivität sein konnte. Evaluation Multimodaler Verhaltenstherapie bei Schizophrenie Alle genannten Vorgehensweisen wurden für eine eigene Untersuchung im Rahmen eines Projekt zur Intensivbetreuung Jugendlicher und junger Erwachsener mit Schizophrenie für zwei Jahre im Anschluss an die erste stationäre psychiatrische Aufnahme seit 2002 angewendet (Hemmerle et al. 2010). Nach zweijähriger intensiver Betreuung und Förderung hatten sich sowohl positive, als auch negative Symptome bei den Betreuten stärker gebessert als bei einer Vergleichsgruppe, die nicht in diesem Projekt betreut wurde. Die Lebensqualität konnte hinsichtlich des Erlebens der Qualität familiärer Beziehungen gesteigert werden, was prognostisch ein gutes Zeichen ist, da ein dysfunktionales Familienklima zu Rückfällen führen kann. Der Suchtmittelgebrauch verringerte sich. Das soziale Funktionsniveau der Teilnehmer war der Vergleichsgruppe überlegen hinsichtlich selbständiger Wohnformen und Teilnahme an schulischen, berufsbildenden oder tagesstrukturierenden und therapeutischen Maßnahmen. Trotz niedrigerer handlungsorientierter Teilfähigkeiten als bei der Vergleichsgruppe konnten die Teilnehmer zu einem vergleichbaren Anteil einen Schulabschluss erzielen. Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit und einige exekutive Funktionen entwickelten sich bei ihnen positiv, während es in der Vergleichsgruppe im Mittel zu einem Rückgang kam. Die Vergleichsgruppe polarisierte sich zwischen denjenigen, die eine für sie zu be-wältigende regelmäßige Tätigkeit gefunden hatten und denjenigen, bei denen dies nicht der Fall war. Die Lebenssituation Letzterer zeigte in mancher Hinsicht eine therapeutische, soziale und intellektuelle Vernachlässigung. Ihre Angehörigen waren mit ihrer Betreuung überfordert. Sie waren von einem chronischen Verlauf der Schizophrenie bedroht. Wenn eine regelmäßige Tätigkeit im Anschluss an eine stationäre Behandlung nicht aufgenommen werden kann, besteht die Indikation für eine weitere stationäre Betreuung in einer spezialisierten Einrichtung. Diese Ergebnisse werfen die Frage auf, ob die in Übersichtsarbeiten (Frangou 2010) festgestellte Stagnation intellektueller Fähigkeiten besonders bei Schizophrenie mit frühem Beginn auf eine unzureichende und zu kurze Betreuung nach dem Beginn einer Schizophrenie zurückzuführen ist. Die Ergebnisse zeigen, dass Psychotherapie bei Schizophrenie möglich, aber aufwändig ist. Intensive Interventionen zu Beginn der Störung können die dauerhaft notwendige Betreuung verringern. Im Interesse der Betroffenen und ihrer Familien bleibt zu hoffen, dass die gewonnenen Erkenntnisse breitere Anwendung finden. Literatur Aguilar, E. J., Siris, S.G. (2007): Do antipsychotic drugs influence suicidal behavior in schizophrenia? Psychopharmacol 40(3), 128-42. Amering, M., Schmolke, M. (2007): Recovery. Das Ende der Unheilbarkeit. Bonn (Psychiatrie-Verlag). Amering, M (2007): Ethik in der Psychiatrie. URL: www.univie.ac.at/ierm/php/cms/uploads/Lehre%20WS%202006_07/ethik%20psychiatrie/ameringierm06-3.teil-170107.ppt (Stand: 16.12.2011). Benedetti, G. (1998): Psychotherapie als existentielle Herausforderung. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht). Benedetti, G. (2004). Mirror Image Experiences in Psychosis Therapy. In: Bürgin, D., Meng H. (Hrsg.) Childhood and Adolescent Psychosis. Basel (Karger). Caspi, A., Moffitt, T. E., Cannon, M., McClay, J., Murray, R., Harrington, H., Taylor, A., Arseneault, L., Williams, B., Braithwaite, A., Poulton, R., Craig, I. W. (2005): Moderation of the effect of adolescentonset cannabis use on adult psychosis by a functional polymor-phism in the catechol-Omethyltransferase gene: longitudinal evidence of a gene X envi-ronment interaction. Biol Psychiatry 15;57(10), 1117-27. URL: http://www.drugabuse.gov/tib/comorbid.html (Stand: 19.12.2011) Chu, C. I., Liu, C. Y., Sun, C. T., Lin, J. (2009): The effect of animal-assisted activity on inpatients with schizophrenia. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv 47 (12), 42-8. Ciompi, L., Hoffmann, H., Broccard M. (Hrsg., 2001): Wie wirkt Soteria? Eine atypische Psychosenbehandlung kritisch durchleuchtet. Bern (Huber). Eggers, C., Hemmerle, M. J., Kremer, F. (2010): Intensive Betreuung von jungen Menschen mit Psychosen, die Drogen konsumieren, in einer pädagogisch-therapeutischen Wohngruppe. Bonn (Psychiatrie Verlag). Eggers, C. (2011): Schizohrenie des Kindes- und Jugendalters. Berlin (Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft) S. 263-269. Goebel, M. U., Trebst, A. E., Steiner, J., Xie, Y. F., Exton, M. S., Frede , S., Canbay, A. E., Michel, M.C., Heemann, U., Schedlowski, M. (2002): Behavioral conditioning of im-munosuppression is possible in humans. FASEB J.16 (14), 1869-73. Gogtay, N., Lu, A., Leow, A. D., Klunder, A. D., Lee, A. D., Chavez, A., Greenstein, D., Giedd, J. N., Toga, A. W., Rapoport, J. L., Thompson, P. M. (2008): Three-dimensional brain growth abnormalities in childhood-onset schizophrenia visualized by using tensor-based morphometry. Proc Natl Acad Sci USA. 105 (41),15979-84. Hahlweg, K., Dürr, K., Dose, M., Müller, U. (2006): Familienbetreuung schizophrener Patienten. Göttingen (Hogrefe). Hemmerle, M. (2008): Psychologische Behandlung und Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen mit Schizophrenie. In: Plume, E., Adams, G., Beck, N., Reichert, A., Warnke, A. (Hg.): Psychisch auffällig, krank, behindert – Was nun? Lengerich (Pabst Science Publishers). Hemmerle, M. J., Röpcke, B., Eggers, C., Oades, R. D. (2010): Evaluation einer zweijährig-en Intensivbetreuung von Jugendlichen mit Schizophrenie. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 38 (5), 361-369. Frangou, S. (2010): Cognitive function in early onset schizophrenia: a selective re-view.Front Hum Neurosci 29 (3), 79. Gaebel, W., Falkai, P. (Redaktion) (2006): S3 Praxisleitlinie der Psychiatrie, Bd. 1, Behandlungsleitlinie Schizophrenie. Darmstadt (Steinkopff Verlag). http://www.kns.kompetenznetzschizophrenie.info/?q=node/6 (Stand: 19.12.2011) Karow, A., Pajonk, F. G. (2006): Insight and quality of life in schizophrenia: recent findings and treatment implications. Curr Opin Psychiatry 19, 637-641. Katschnig, H., Konieczna, H., Michelbach, H., Sint, P. P. (1989): Intimität und Distanz – ein familienorientiertes Wohnheim für schizophrene Patienten. In: Katschnig, H. (Hg.): Die andere Seite der Schizophrenie. Patienten zu Hause. München (Psychologie-Verlags-Union). Kay, S. R. (1987): The Positive and Negative Syndromes Scale (PANSS) for schizophrenics: development and standardization. Schizophr Bull, 13, 261-7. King, S. (2000): Is expressed emotion cause or effect in the mothers of schizophrenic young adults? Schizophrenia Research 45 (1-2), 65-78. Kircher, T., Gauggel S. (2008): Neuropsychologie der Schizophrenie. Heidelberg (Springer). Klingberg, S., Wittdorf, A., Buchkremer, G. (2008): Kognitive Verhaltenstherapie bei schizophrenen Störungen. Einfluss auf Symptome und Kognition. In: Kircher T, Gauggel S. (Hg.): Neuropsychologie der Schizophrenie. Heidelberg (Springer). Klosterkötter, J. (2008): Indizierte Prävention schizophrener Erkrankungen. Deutsches Ärzteblatt 105, 532-539. Lauveng, A. (2005, deutsche Übersetzung 2008): Morgen bin ich ein Löwe. München (btb Verlag). Lincoln, T. (2006): Kognitive Verhaltenstherapie der Schizophrenie. Göttingen (Hogrefe). McGrath JJ (2007): The surprisingly rich contours of schizophrenia epidemiology. Arch Gen Psychiatry 64,14–16. Nordt, C., Rössler, W., Lauber, C. (2006): Attitudes of mental health professionals toward people with schizophrenia and major depression. Schizophr Bull. 32 (4), 709-14. Pajonk, F. G., Wobrock, T., Gruber, O., Scherk, H., Berner, D., Kaizl, I., Kierer, A., Müller, S., Oest, M., Meyer, T., Backens, M., Schneider-Axmann, T., Thornton, A. E., Honer, W. G., Falkai, P. (2010): Hippocampal plasticity in response to exercise in Schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 67(2),133-43. Reichenberg, A., Caspi, A., Harrington, H., Houts, R., Keefe, R. S. E., Murray, R. M., Poulton, R., Moffitt, T. E. (2010): Static and dynamic cognitive deficits in childhood prece-ding adult schizophrenia: a 30-year study. Am J Psychiatry 167, 160–169. Röpcke, B., Eggers, C. (2005): Early-onset schizophrenia – a 15-year follow-up. Eur Child Adolesc Psychiatry 14, 341- 350. Roder, V., Brenner, H. D., Kienzle, N., Hodel, B. (1992): Integriertes Psychologisches Therapieprogramm für schizophrene Patienten (IPT). Weinheim (Psychologie Verlags Union). Schmitt, A., Bertsch, T., Tost, H., Bergmann, A., Henning, U., Klimke, A., Falkai, P. (2005): Increased serum interleukin-1beta and interleukin-6 in elderly, chronic schizophrenic patients on stable antipsychotic medication. Neuropsychiatr Dis Treat. 1(2), 171-7. Selvini-Palazzoli, M., Boscolo, L., Cecchin, G., Prata G. (1977): Paradoxon und Ge-genparadoxon. Stuttgart (Klett – Cotta). Söderlund, J., Schröder, J., Nordin, C., Samuelsson, M., Walther-Jallow, L., Karlsson, H., Erhardt, S., Engberg, G. (2009): Activation of brain interleukin-1b in schizophrenia. Mo-lecular Psychiatry 14, 1069–1071. Straube, E. R., Oades, R. D. (1992): Schizophrenia: Empirical Research and Findings. San Diego (Academic Press). Vauth, R., Stieglitz, R. D. (2006): Chronisches Stimmenhören und persistierender Wahn. Göttingen (Hogrefe). Vauth, R., Stieglitz, R. D. (2008): Training Emotionaler Intelligenz bei schizophrenen Störungen. Ein Therapiemanual. Göttingen (Hogrefe). Vauth, R., Bull, N., Schneider, G. (2009): Emotions- und stigmafokussierte Angehörig-enarbeit bei psychotischen Störungen: Ein Behandlungsprogramm. Göttingen (Hogrefe). Weinmann, S., Read, J., Aderhold, V. (2009): Influence of antipsychotics on mortality in schizophrenia: systematic review. Schizophr Res 113 (1),1-11.