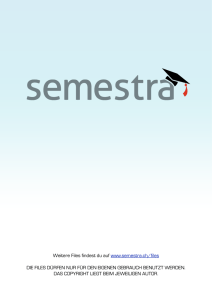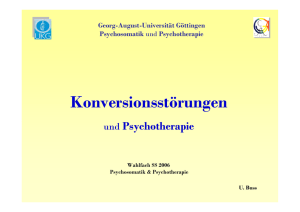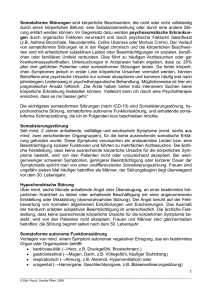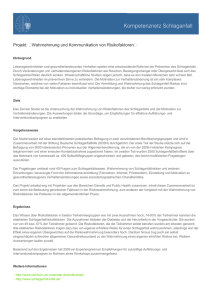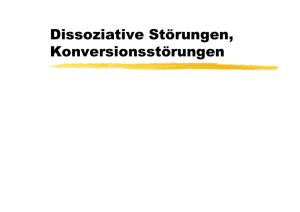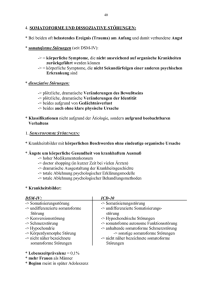(Konversionsstörungen): Ätiologie/Bedingungsanalyse
Werbung
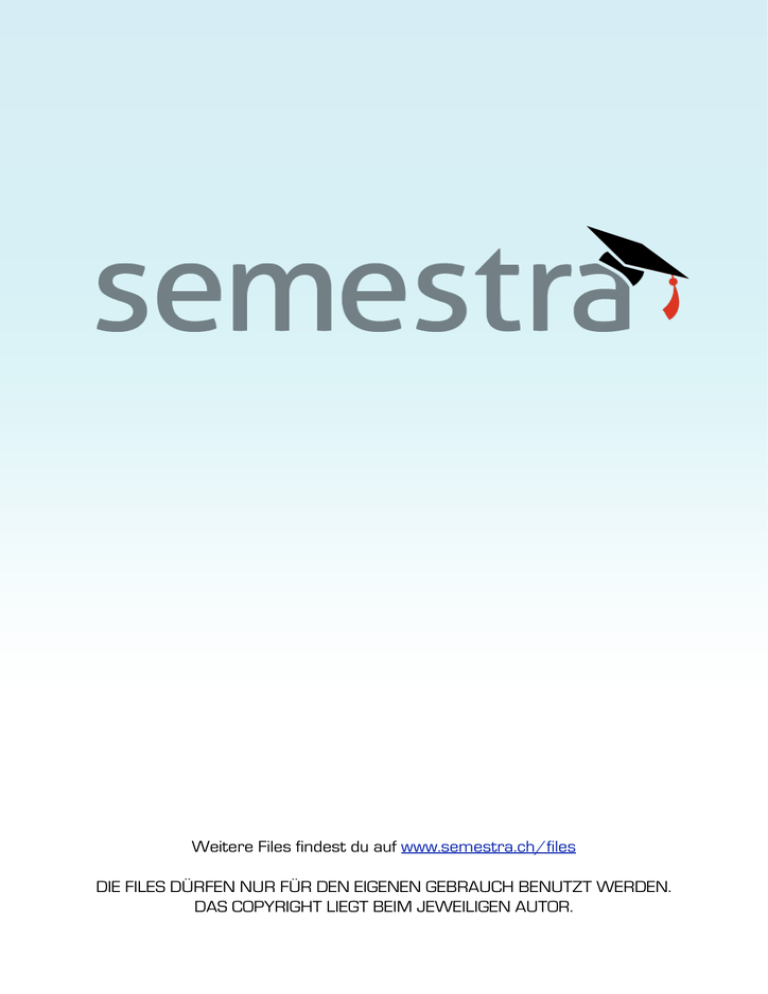
Weitere Files findest du auf www.semestra.ch/files DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR. Somatoforme und dissoziative Störungen (Konversionsstörungen): Ätiologie/Bedingungsanalyse [email protected] Seite 1 von 5 Rief, W. (1998). Somatoforme und dissoziative Störungen (Konversionsstörungen): Ätiologie/Bedingungsanalyse. In Baumann, U. & Perrez, M. (Hrsg.). Klinische Psychologie – Psychotherapie (2. Aufl.) (S. 924-930). Bern: Verlag Hans Huber. Kapitel 38.2 Somatoforme und dissoziative Störungen (Konversionsstörungen): Ätiologie/Bedingungsanalyse Zusammengefasst von: Claudia Heldner Rue d’Or 24 1700 Fribourg 026 321 29 35 [email protected] Somatoforme und dissoziative Störungen (Konversionsstörungen): Ätiologie/Bedingungsanalyse [email protected] Seite 2 von 5 Einleitend kann gesagt werden, dass es keine uniformen Prozesse gibt, die zu einer somatoformen Störung führen. 1. Genetische Aspekte (S. 931) Auch bei den somatoformen Störungen ist von einer genetischen Disposition auszugehen, die jedoch schwächer ausgeprägt ist, als bei anderen psychischen Störungen (Schizophrenie). Die Zwillingsstudie von Torgersen (1986) konnte zeigen, dass eineiige Zwillinge zu 29 Prozent bezüglich der Diagnose somatoforme Störung konkordant waren, während zweieiige Zwillinge eine Rate von 10 Prozent ereichten (Aber: Kleine Stichprobe, so dass Aussagekraft beschränkt ist!). Dabei zeigte keines der untersuchten Zwillingspaare identische Untergruppen von somatoformen Störungen. In einer Untersuchung von 800 adoptierten schwedischen Frauen, zeigten sich ebenfalls genetische Risikofaktoren: Bei den biologischen Vätern fand sich eine erhöhte Rate an Personen mit Alkoholproblemen sowie soziopathischen Verhaltensweisen. Es können auch Verbindungen bestehen zu frühen Gewalterfahrungen. Die genetische Komponente ist als nicht spezifisch für Somatisierungsverhalten, sie schliesst viel mehr antisoziales Verhalten und Alkoholprobleme mit ein. 2. Biologische Aspekte zur Ätiologie somatoformer Störungen (S. 932) 2.1 Biochemische Aspekte (S. 932) Zentralnervöse, endokrine und immunologische Prozesse beeinflussen die Wahrnehmung körperlicher Empfindungen. So wurde für Cortisol Besonderheiten bei Somatisierungssyndromen gefunden. Es liegen Studien vor, die beim chronischen Erschöpfungssyndrom und bei Frauen mit chronischen Unterbauchschmerzen einen erniedrigten Cortisolspiegel fanden. Weiter zeigte eine Studie, dass Patienten mit chronifizierten multiplen körperlichen Beschwerden einen erhöhten Morgencortisolspiegel aufweisen. Auch Depressive weisen einen erhöhten Morgencortisolspiegel auf. 2.2 Neurophysiologische Aspekte (S. 932) Bei der Verteilung der Symptome scheint die linke Körperhälfte bevorzugt zu sein. Damit kann ein Zusammenhang zur Hemisphärenspezialisierung angenommen werden. Bei der Bearbeitung visuo-spatialer Aufgaben (rechts-hemisphärisch aktiv) zieht sich eine deutlichere rechtshemisphärische Aktivierung bei Somatisierungspatienten las bei Kontrollpersonen. Weiter fand man eine ausgeprägtere N1-Amplitude im evozierten Potenzial als bei Gesunden, was als Störung in der Reizfilterung bzw. Aufmerksamkeitsfokussierung interpretiert werden kann. Somatisierungspatienten zeigen weiter vor allem zentral und parietal eine geringere “mismatch negativity“, was wiederum auf Schwierigkeiten der Aufmerksamkeit gewertet werden kann. 2.3 Psychophysiologische Aspekte (S. 933) Es gibt Anhaltspunkte für ein erhöhtes psychophysiologisches Aktivierungsniveau. Dieses kann dazu beitragen, dass körperliche Signale verzerrt wahrgenommen und leichter fehlinterpretiert werden. Auch mit Einzelsymptomen gehen spezifische physiologische Veränderungen einher. So führen beispielsweise chronische Hyperventilation zu physiologischen Veränderungen, die Einzelsymptome verstärken. Somatoforme und dissoziative Störungen (Konversionsstörungen): Ätiologie/Bedingungsanalyse [email protected] Seite 3 von 5 3. Umweltkonzepte (S. 933) 3.1 Sozialisation (S. 933) Scheinbar wurde bei Somatisierungspatienten in der Kindheit Kranksein zu einem bedeutenden Familienthema (Elternteil schwer krank). Livingston et al. (1995) konnten zeige, dass Kinder von Somatisierungspatienten deutlich erhöhte Fehlzeiten in der Schule und Arztbesuche aufzeigen: Erfahrungen oder Modelle spielen als eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund wurde der Begriff “chronisches Krankheitsverhalten“ geprägt (gehäuftes Aufsuchen von ärztlichen Diagnosen, Selbstmedikation,...). Solche Verhaltensweisen können vom Umfeld verstärkt werden. 3.2 Sozialpsychologische Konzepte (S. 933) Folgende Einstellungen sind für typisch für Somatisierungspatienten: Tabelle 1: Einstellungen von Somatisierungspatienten (S. 934) 1. Katastrophisierende Bewertung körperlicher Empfindungen: 2. Intoleranz gegenüber körperlichen Beschwerden: 3. Körperliche Schwäche: Hinter Übelkeit steckt häufig ein nicht-erkanntes Magengeschwür. Plötzlich auftretende Gelenkschmerzen können eine Lähmung ankünden. Fühle ich mich körperliche schlapp, hat dies oft etwas schlimmeres zu bedeuten. Ich kann Schmerzen nur scher aushalten. Bei körperlichen Beschwerden hohle ich möglichst sofort ärztlichen rat ein. Größere Anstrengungen muss ich vermeiden, um meine Kräfte zu schonen. Wenn ich schwitze wird mir klar, dass mein Organismus einfach nicht belastbar ist. Somit neigen Somatisierungspatienten dazu, bereits Bagatellempfindungen als Krankheitszeichen zu bewerten. Dies geht oft einher mit einer geringen Toleranz für körperliche Belastung. Dabei dominieren Selbstbilder wie „ich bin schwach und wenig belastbar“ oder „ich muss meinen Körper schonen“. 3.3 Belastung/Stress (S. 934) Es gibt eine Serie von Belegen, dass traumatisierende Lebensereignisse die Entwicklung von Somatisierungssymptomen fördern (Kriege ziehen “Konversionsphänomene“ nach sich). Auch Opfer von Gewalttaten und sexuellen Übergriffen weisen eine erhöhte Somatisierungsrate auf. Die Rate an traumatischen Ereignissen ist bei Somatisierungspatienten höher als bei anderen klinischen Gruppen. Der Einfluss von sexuellen Übergriffen scheint besonders bei dissoziativen Störungen (Konversionsstörungen) ausgeprägt. 3.4 Soziologische Aspekte (S. 934) Bei den Frauen treten Somatisierungsstörungen häufiger auf. Das kann zum Teil dadurch erklärt werden, dass sie häufiger von den Risikofaktoren betroffen sind. Ungeklärt ist, inwieweit genetische und biologische Variablen von Bedeutung sind. Das typische Alter bei Erstauftreten der Symptome liegt von 15 bis 25 Jahren. Nach DSM-IV werden Somatoforme und dissoziative Störungen (Konversionsstörungen): Ätiologie/Bedingungsanalyse [email protected] Seite 4 von 5 Somatisierungsstörungen nicht mehr diagnostiziert, wenn die Symptome erst nach 30 auftreten. Weiter gibt es Hinweise darauf, dass Personen aus unteren Schichten und städtischen Gegenden häufiger somatoforme Symptome entwickeln. Dabei muss berücksichtigt werden, dass diese Risikofaktoren mit andern Risikobedingungen (Alkohol) konfundiert sind. 4. Persönlichkeitskonzepte (S. 935) Als wichtigstes Merkmal beschreiben Barsky und Wyshak (1990) die “somatosensory amplification“. Dabei handelt es sich um ein stabiles Körpermerkmal, körperliche Symptome verstärkt zu beachten und Aufmerksamkeit zu fokussieren was dazu führt, dass körperliche Missempfindungen als krankhaft fehlinterpretiert werden. Weiter soll die “Alexithymie“ bedeutend sein. Es zeichnet sich aus durch die Unfähigkeit, Emotionen korrekt wahrzunehmen und verbal auszudrücken, einen konkreter realitätsorientierter Denkstil, reduzierte Fähigkeit zu Tagträumereinen und Phantasiearmut. Diese Konzept konnte als Risikofaktor bislang nicht ausreichend belegt werden. So sind erhöhte Alexithymie-Werte nicht spezifisch für Somatisierung oder psychosomatische Krankheiten. Es kann sich um einen allgemeinen Risikofaktor für psychische Krankheiten oder um eine Folge von anderen Risikofaktoren handeln. Auch das Persönlichkeitsmodell “the big five“ wird in Betracht gezogen. Als mögliche direkte Risikofaktoren werden dabei repressive Persönlichkeitsmerkmale, einen somatisch orientierten Attributionsstil und Alexithymie genannt. Negative Affektivität kann zu höheren Belastungen sowohl somatischer als auch emotionaler Art führen. 5. Die “somatisierte Depression“ und andere psychische Störungen als Risikofaktoren für die Entwicklung von Somatisierungssyndromen (S. 936) Es gibt eine hohe Komorbidität zwischen Somatisierungssyndromen und Depression. Deshalb wurde immer wieder vermutet, dass es sich bei der Somatisierung um das körperliche Äquivalent von Depressionen handelt, deren affektive Komponente im Hintergrund steht (somatisierte Depression). Sowohl Somatisierung und Depression können aber unabhängig voneinander auftreten. Auch muss die erhöhte Komorbidität zwischen Somatisierung und Angststörungen berücksichtigt werden. Somatisierung, Angst und Depression fungieren damit als gegenseitige Risikofaktoren. 6. Interozeption und externale Stimulierung (S. 937) Zwei Faktoren beeinflussen die Wahrnehmung und Bewertung körperlicher Missempfindungen: Erstens die Signalstärke des interozeptiven Reizes (Stärke des Herzklopfens, Ausmaß der muskulären Verspannung) und zweites das Ausmaß der externen Stimulation (monotone Umgebung, stimulierende Umgebung). Diese Aspekte sind aber bei Somatisierung noch unzureichend wissenschaftlich überprüft. 7. Verhaltensmerkmale bei somatoformen Störungen (S. 937) Verhaltensmerkmale sind vor allem bei der Aufrechterhaltung der Störung von Bedeutung. Die zwei Merkmale Schonverhalten/Vermeidungsverhalten und Kontrollverhaltensweisen spielen dabei eine große Rolle. Schonverhalten führt dazu, dass der körperliche Trainingszustand sich weiter reduziert, was zu stärker wahrnehmbaren körperlichen Veränderungen führt. Durch Schonverhalten werden aber auch vermehrt reizarme Somatoforme und dissoziative Störungen (Konversionsstörungen): Ätiologie/Bedingungsanalyse [email protected] Seite 5 von 5 Umgebungsbedingungen aufgesucht. Viele Somatisierungspatienten wollen ihren Körper ständig kontrollieren. Der Körper wird ständig “gescannt“, was kurzfristig zu einer Angstreduktion herbeiführt, langfristig aber eine Bewältigung der Ängste verhindert. 8. Zusammenwirken möglicher Risikofaktoren bei somatoformen Störungen (S. 938) Verschiedene Risikofaktoren tragen zur Entstehung und Aufrechterhaltung somatoformer Störungen bei. Zentral ist dabei ein Regelkreis von perzeptiven Prozessen (Wahrnehmung körperlicher Missempfindungen), kognitiven Bewertungsprozessen („Dies sind Zeichen einer möglichen Krankheit.“) und Verhaltensweisen (Rückzug aus sozialen Verpflichtungen, Ärzte aufsuchen). Die Verhaltensweisen führen wiederum dazu, dass die Aufmerksamkeit auf körperliche Prozesse fokussiert wird. Biologische Aspekte, psychische Dispositionen und Umweltfaktoren können den Regelkreis beeinflussen.