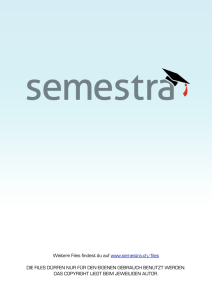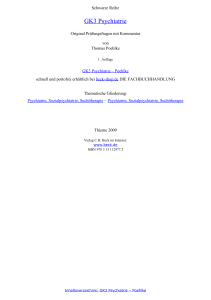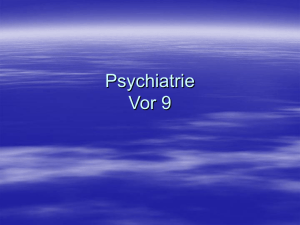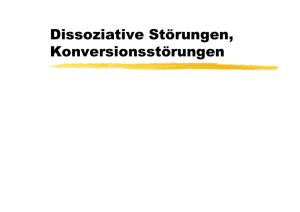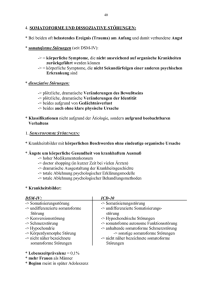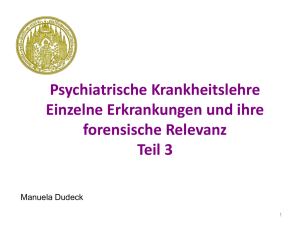(Konversionsstörungen): Intervention
Werbung
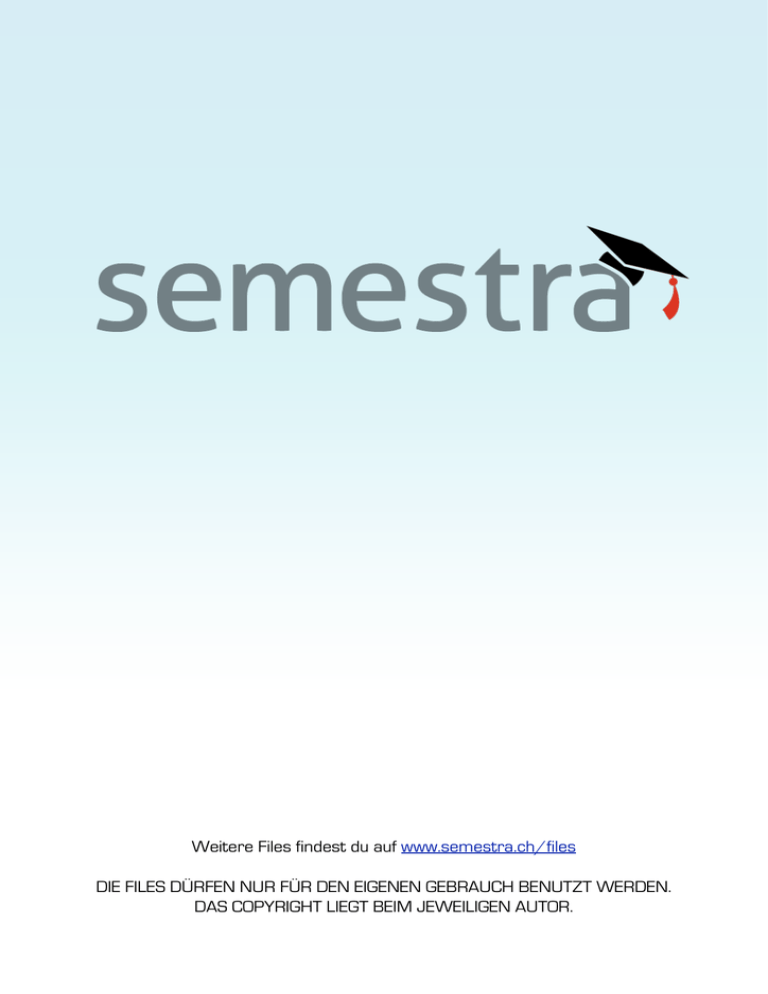
Weitere Files findest du auf www.semestra.ch/files DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR. Somatoforme und dissoziative Störungen (Konversionsstörungen): Intervention [email protected] Seite 1 von 4 Rief, W. (1998). Somatoforme und dissoziative Störungen (Konversionsstörungen): Intervention. In Baumann, U. & Perrez, M. (Hrsg.). Klinische Psychologie – Psychotherapie (2. Aufl.) (S. 941951). Bern: Verlag Hans Huber. Kapitel 38.3 Somatoforme und dissoziative Störungen (Konversionsstörungen): Intervention Zusammengefasst von: Claudia Heldner Rue d’Or 24 1700 Fribourg 026 321 29 35 [email protected] Somatoforme und dissoziative Störungen (Konversionsstörungen): Intervention [email protected] Seite 2 von 4 1. Empirische Basis klinisch-psychologischer Interventionen bei somatoformen Störungen und dissoziativen Störungen (S. 942) Hypochondrie Zu dieser Untergruppe liegen mehr Vorschläge zu klinisch-psychologischen Interventionen vor als zu multiplen somatoformen Störungen. Keller (1983): Zentrale inhaltliche Belastungsmerkmale: Ausführliche Information über das Entstehen der Symptomatik durch psychophysiologische Prozesse, Herausarbeiten der Bedeutung von selektiver Wahrnehmung auf Körperempfindungen, Massnahmen zur Angstbewältigung Depressionsbewältigung. Das Vorliegen von Persönlichkeitsstörungen geht mit schlechteren Therapieverläufen einher. Visser und Bouman (1992): Ihre Therapie lehnt sich stark an die Angstbehandlung an. Die Therapie beinhaltete verhaltenstherapeutische Massnahmen (Exposition in vivo) und eine Phase der kognitive Therapie (Ableitung angstauslösender Kognitionen, Beurteilung derer Glaubwürdigkeit, erarbeiten von Alternativerklärungen, Förderung nichtkathastrophisierender Bewertungsprozesse). Der Abbau der hypochondrischen Ängste ging während der Expositionstherapie schneller voran. Stern und Fernandez (1991): In ihrem Gruppenprogramm setzten sie zwei Schwerpunkten: Aufdecken der symptomaufrechterhaltenden Funktionen (Suchen nach Rückversicherung bei medizinischem Personal oder bei der Familie) und die Funktion der Aufmerksamkeitsfokussierung auf körperliche Prozesse. Salkovskis (1995) (einzige randomisierte Studie und genügend grosser Stichprobe): Die Gruppen mit kognitiver Verhaltenstherapie (irrationale Annahmen erarbeiten) und die Gruppe mit einem Stressmanagementprogramm (Bewältigung von möglichen Auslösesituationen) schnitten im Vergleich zu einer Wartegruppe erfolgreicher ab. Gemeinsame Merkmale psychologischer Therapieansätze bei Hypochondrie sind: • Prozesse der Umattribution der Bewertung von körperlichen Empfindungen • Adäquate Informationen liefern (besonders in der Anfangsphase) • Beruhigungen mit der Zeit unterlassen (der Patient kann so selbstständig Strategien zur Beruhigung entwickeln) • Verhaltensexperimente einsetzten • Expositionstherapie in angstauslösenden Situationen • Einbezug von Familienmitglieder (wegen inadäquater Rückmeldung) Barsky et al. (1988) nennen vier Interventionsebenen bei Hypochondrie: • Aufmerksamkeitsfokussierung und Entspannung (Aufmerksamkeitslenkung als mögliche Copingstrategie) • Kognitionen und Symptomattribution (Mechanismen der selbsterfüllten Prophezeiung, Einfluss persönlicher Ursachenmodelle auf die Wahrnehmung und Bewertung körperlicher Missempfindungen) • Situative Aspekte (Abhängigkeit der Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse vom situativen Kontext) • Dysphorischer Affekt (Erarbeitung aktiver Maßnahmen zur Selbstverstärkung und der Stimmungsaufhellung) Somatoforme Störungen allgemein Rief et al. (1995): Durch einen psychotherapeutischen Ansatz kann selbst bei einer hoch chronifizierten Stichprobe eine Verbesserung in der somatoformen Symptomatik als auch bei Somatoforme und dissoziative Störungen (Konversionsstörungen): Intervention [email protected] Seite 3 von 4 komorbiden Erkrankungen (Depression, Angst) erreicht werden. Als negativer Prädiktor zeigte sich jedoch Komorbidität. Smith et al. (1995): Entwickelten einen Leitfaden. Darin enthalten sind folgende Aufforderungen: Informationen zum Verlauf der Störung liefern, regelmäßige ärztliche Behandlung in festen Zeitabständen realisieren, stationäre Einweisungen und operative Eingriffe vermeiden. Weiter boten Rief et al. ein Kurzzeittherapieprogramm (8 Sitzungen) an. Diese zeigte ebenfalls deutliche Verbesserungen. Dissoziative Störungen (Konversionsstörungen) Bei der Entstehung dieser Störung spielen traumatische Erfahrungen eine wichtige Rolle. Interventionsansätze, wie sie für die posttraumatische Belastungsstörung von Relevanz sind, können deshalb auch hier eingesetzt werden. Der wissenschaftliche Beleg steht aber noch aus. 2. Empirische Basis psychopharmakologischer Interventionen (S. 945) Psychopharmakologische Medikamente: • Hoher Einsatz von niedrig-potenten Neuroleptika (Fluspirilen). Die Gefahr von Langzeitschäden (z.B. Spätdyskinesien) ist noch unklar. • Tranquilizer (z.B. vom Benzodiazepin-Typus). Hier besteht die Gefahr der körperlichen und psychischen Abhängigkeit. • Antidepressiva zur Zeit am häufigsten verschrieben (da hohe Komorbidität zu depressiven Erkrankungen) 3. Ein Therapiemodell zur psychologischen Behandlung beim Somatisierungssyndrom (S. 945) Der Therapieleitfaden zur psychologischen Behandlung umfasst fünf Aspekte. 3.1 Beziehungsaufbau und diagnostische Maßnahmen (S. 945) Behandlerseite: Hilflosigkeit und Unklarheit über das Störungsbild Patientenseite: erhöhte Klagsamkeit und negative Beziehungserwartungen Warwick (1995) nennt vier Punkte der Unzufriedenheit beim Patienten: 1. Die Patienten mit Hypochondrie und Somatisierung haben zahlreiche medizinische Untersuchungen hinter sich. In der Diagnostikphase sollte deshalb immer wieder betont werden, dass eine zufriedenstellende Erklärung der Probleme gesucht wird (nicht nach Ausschlussdiagnostik vorgehen). 2. Die Patienten nehmen nach der Behandlung eine selektive Interpretation der Aussagen des Fachmannes vor (negativer Bewertungsprozess). Die Patienten sollten deshalb mündlich und schriftlich eine Zusammenfassung der Sitzung geben. 3. Den Patienten wird oft das Gefühl vermittelt, sie seien Simulanten. 4. Patienten beginnen die Behandlung oft fremdmotiviert. Deshalb ist es wichtig, zu Beginn die Ängste und Erwartungen an eine psychologische Therapie zu thematisieren. Der Patient kommt erst dann zu einer vertauensvollen therapeutischen Beziehung, wenn er wahrnimmt, dass sein Behandler alle körperlichen Beschwerden und Behandlungsversuche kennt. Wichtig ist auch die Exploration der subjektiven Krankheitsattributionen und des Gesundheitsbegriffs des Patienten. Wichtig ist weiter, etwas über die zusätzlichen Komponenten und Konsequenzen der Erkrankung zu erfahren (körperliches Schonverhalten, checking behavior, Einstellungen und Verhaltensweisen von Personen des sozialen Umfelds, Somatoforme und dissoziative Störungen (Konversionsstörungen): Intervention [email protected] Seite 4 von 4 Selbstbild des Patienten) und die Stärken und Schwächen auf Seiten des Patienten als auch seines sozialen Umfelds zu berücksichtigen (Kommunikationsverhalten, soziales Stützsystem). Wichtig in der Diagnostikphase sind Symptomtagebücher (körperliches Wohlbefinden, Aktivitäten, emotionale Befindlichkeit, Gedanken). Daraus lassen sich störungsrelevante Informationen gewinnen. 3.2 Zieldefinitionen (S. 947) Es ist wichtig, realistische Zieldefinitionen vorzunehmen, die sowohl wichtige Lebensbereiche als auch verschiednen Abstufungen umfassen. 3.3 Umattribution des organischen Krankheitsmodells des Patienten (S. 947) Es gilt, dass organische Krankheitsmodell des Patienten zu bestätigen, ihn jedoch aufzufordern dieses kritisch zu hinterfragen und weitere Krankheitsmodelle zu überprüfen. Es gibt verschiedene Techniken, auf das Krankheitsmodell Einfluss zu nehmen: • Symptomtagebuch: Veranschaulicht, dass die Beschwerden nicht immer gleich schlimm sind und das sie mit der emotionalen Befindlichkeit zusammenhängen. • Verhaltensexperimente: Durch Beispiele soll der Patient zur Einsicht gelangen, dass viele körperliche Empfindungen entstehen, die nicht ein schweres Krankheitszeichen sind. Fokussierung der Aufmerksamkeit auf einfache Körperbelastungen soll verdeutlichen, wie viel schwieriger solche Vorgänge werden, wenn man seine Aufmerksamkeit darauf fokussiert. So auch die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf körperinnere Prozesse. • Biofeedback: Dabei werden dem Patienten körperliche Signale (z.B. Herzrate) so zurückgemeldet, dass er am Computer direkte Veränderungen wahrnehmen kann (z.B. bei Entspannung). 3.4 Verhaltensänderungen (S. 948) • • • • Die Häufigkeit der Arztbesuche zurückschrauben oder diese wenigstens zeitkontingent (nach einem festen Zeitplan) durchführen. Das soziale Umfeld und der Behandler sollten nicht das Bedürfnis nach Rückversicherung erfüllen, sondern mit dem Patienten selbständige Bewältigungsmöglichkeiten besprechen. Es kann sinnvoll sein, nicht zu früh auf eine Reduktion der Kontrollverhaltensweisen zu drängen, sondern diese einleitend noch verstärken. Vor der eigentlichen Verhaltensänderung sollte eine Phase der kognitiven Vorbereitung und Herstellung der motivationalen Voraussetzung erfolgen. Hierzu sollte der Krankheitskreislauf aufgezeigt und mit dem Patienten bearbeitet werden (Bewertung als krankErhöhung von SchonverhaltenReduktion der körperlichen Belastbarkeiterhöhte Neigung zum Erleben körperlicher Missempfindungen). 3.5 Weitere Maßnahmen zur psychischen Stabilisierung (S. 949) Kommunikationsverfahren sowie Verfahren zum Erwerb von sozialer Kompetenz sind ebenfalls wichtig, um den Aufbau eines adäquaten sozialen Stützsystems zu fördern. Da oft traumatische Erlebnisse in der Krankheitsvorgeschichte vorzufinden sind, ist es ein Ziel, die belastenden Erinnerungen in der Intensität als auch in der Häufigkeit des Sich-Aufdrängens zu reduzieren, wie auch die Generalisierungsphänomene zu verringern.