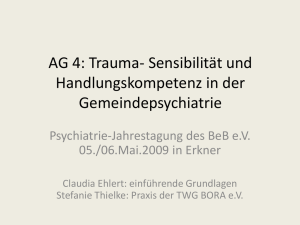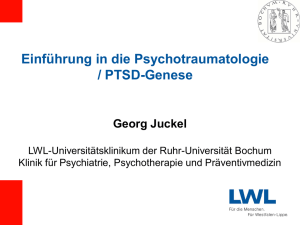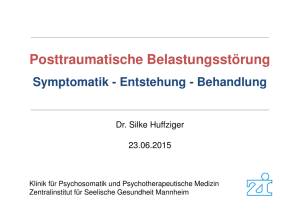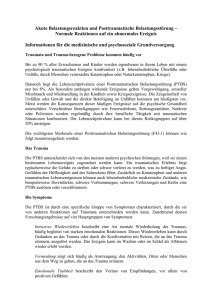Komorbidität von Posttraumatischer Belastungsstörung bei
Werbung
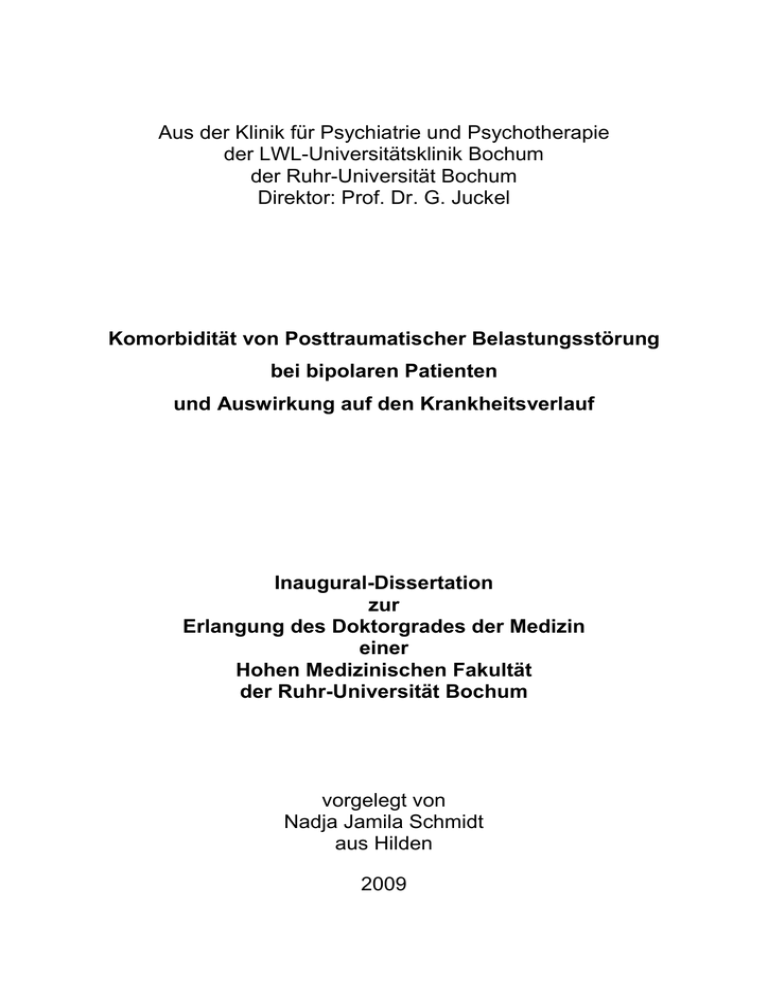
Aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der LWL-Universitätsklinik Bochum der Ruhr-Universität Bochum Direktor: Prof. Dr. G. Juckel Komorbidität von Posttraumatischer Belastungsstörung bei bipolaren Patienten und Auswirkung auf den Krankheitsverlauf Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Medizin einer Hohen Medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum vorgelegt von Nadja Jamila Schmidt aus Hilden 2009 Dekan : Prof. Dr. med. G. Muhr Referent : PD Dr. med. H.-J. Assion Koreferent: PD Dr. med. M.-W. Agelink Tag der mündlichen Prüfung: 01.12.2009 meinen Patienten Inhaltsverzeichnis I. Einleitung 1.1. Bipolar affektive Störung 1.1.1. Geschichtlicher Abriss 1.1.2. Definition, Klassifikation 1.1.3. Ätiologie 1.1.4. Epidemiologie 1.2. Posttraumatische Belastungsstörung 1.2.1. Traumadefinition 1.2.2. Symptomatik, Diagnosekriterien und Differentialdiagnosen der PTBS 1.2.3. Ätiologie und geschichtliche Entwicklung 1.2.4. Epidemiologie 1.3. Fragestellung der Arbeit 5 7 11 15 18 20 22 24 25 II. Methodik 2.1. Studiendesign 2.1.1. Probanden 2.1.2. Aufklärung, Einwilligung und Ethik 2.2. Untersuchungsablauf 2.2.1. Basisdaten und Parameter der Bipolaren Störung 2.2.2. Psychometrische Testverfahren 2.2.3. PDS 2.2.4. CAPS 2.3. Statistik 27 28 28 29 31 32 34 III. Ergebnisse 3.1. Demographische Basisdaten 35 3.2. Art des Traumas 36 3.3. Soziale Basisdaten 38 3.4. Klinische Basisdaten 40 IV. Diskussion 43 V. Zusammenfassung 48 VI. Literaturverzeichnis 50 1 VII. Anlagen A 1: Anamnesebogen Bipolare Störung 62 A 2: PDS-Fragebogen, komplett 65 A 3: CAPS-Fragebogen, Auszug 69 2 Abbildungs- und Tabellenübersicht Abbildung 1: Schema der Einteilung traumatischer Ereignisse und der Risikograde für die Ausbildung einer PTBS S.19 Abbildung 2: Ausgewählte Variablen bipolarer Patienten ohne Trauma, mit Trauma und mit PTBS S.42 Tabelle 1: Studien zur Epidemiologie bipolarer Störungen, Lebenszeitprävalenzen S.16 Tabelle 2: Kategorien A-F nach DSM-IV zur Diagnose der PTBS S.21 Tabelle 3: Demographische Basisdaten bipolarer Patienten ohne Trauma, mit Trauma und mit Trauma und PTBS S.36 Tabelle 4: Art des Traumas bei bipolaren Patienten mit Trauma und mit Trauma und PTBS S.37/38 Tabelle 5: Soziale Basisdaten von bipolaren Patienten ohne Trauma, mit Trauma und mit Trauma und PTBS S.39 Tabelle 6: Klinische Basisdaten von bipolaren Patienten ohne Trauma, mit Trauma und mit Trauma und PTBS S.40/41 3 Abkürzungen ANOVA Analysis of Variances CAPS Clinician Administered PTSD Scale CGI Clinical Global Impression Scale CRF Corticotropin Releasing Factor DSM ECA Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Epidemiological Catchment Area Study EKT Elektrokrampftherapie GAF Global Assessment of Functioning Scale HAM-D Hamilton Depression Rating Scale ICD-10 International Classification of Diseases, 10. Revision ICH International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use MRT Magnetresonanztomographie NCS National Comorbidity Survey NEMESIS The Netherlands Health Survey and Incidence Study PDS Posttraumatic Diagnostic Scale PET Positronen-Emissions-Tomographie PTBS Posttraumatische Belastungsstörung SD Standardabweichung SPECT Einzelphotonen-Emissions-Tomographie SPSS Statistical Package for Social Sciences SSRI Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer WHO World Health Organisation YMRS Young Mania Rating Scale 4 I. EINLEITUNG 1.1. Bipolar affektive Störung 1.1.1. Geschichtlicher Abriss Erste Beschreibungen der bipolaren Störung finden sich bereits in der Antike und tauchen in den griechischen Mythen, z. B. der Odyssee, auf, wobei aber der bipolare, also zu zwei entgegengesetzten Polen ausgerichtete Verlauf der Gefühlsstörung noch nicht dargestellt wird. Differenziertere Darlegungen hinterließ der Arzt Hippokrates von Kos (460-370 v. Chr.). Er stellte seelische Erkrankungen mit einem körperlichen Ungleichgewicht in Zusammenhang und nannte vier Temperamente entsprechend von Körpersäften: Blut (sanguis), gelbe Galle (cholé), schwarze Galle (melas cholé) und Schleim (phlegma) finden sich noch heute in den Bezeichnungen Sanguiniker, Choleriker, Melancholiker und Phlegmatiker wieder. Nach dieser Vorstellung war die Melancholie, heute Depression genannt, auf einen Überschuss an „schwarzer Galle“, der über das Blut bis ins Gehirn eindringe, verursacht. Auch der Begriff der Manie wurde von Hippokrates bereits genannt (griech.: mania = Raserei) und beschrieb einen furiosen Zustand von Unruhe und Aufregung bis hin zum Toben. Der Philosoph Sokrates (470-399 v.Chr.) verwandte „Manie“ noch als eine eher allgemeine Bezeichnung für Geisteskrankheit. Im Mittelpunkt der Therapie standen entsprechend der Vier-Säfte-Lehre eine Umstellung der Lebensweise (Ernährung, Bewegung) und Aderlässe. Eine erste Beschreibung der bipolaren Störung mit Erkennen einer Zusammengehörigkeit der beiden extremen Zustände Manie und Depression findet sich bei dem aus Kappadokien stammenden Arzt Aretaeus (81-138 n.Chr.). Wie auch Galenus (129-199 n.Chr.) sah er die Ursache psychischer Störungen in somatischen Zuständen basierend auf dem Konzept der Körpersäfte, die Manie wurde jedoch bei ihm nicht mehr als entgegengesetztes Krankheitsbild, sondern als Steigerungsform der Melancholie beurteilt: „Meiner Ansicht nach ist die Melancholie ohne Zweifel Anfang oder sogar Teil der Krankheit, die Manie genannt wird…Die Entwicklung einer Manie ist vielmehr eine Zunahme der Krankheit als 5 ein Wechsel in eine andere Krankheit.“ Aretaeus erkannte damit die Basis des heute gültigen Modells der Bipolaren Störung (Marneros, 1999). Besonders der Einfluss der katholischen Kirche in Europa brachte im Mittelalter eine weitere rationale Forschung zum Erliegen; Erkrankte wurden als „Besessene“ verfolgt, die Ursache der Erkrankung schrieb man Hexen oder Dämonen zu. In den Sieben Todsünden spiegeln sich Symptome der Bipolaren Erkrankung wieder: Hochmut, Zorn, Wollust für die Manie, Trägheit (früher sogar „Traurigkeit“) für die Depression. Das Konzept von Aretaeus wurde im 19. Jahrhundert wieder aufgegriffen und konkretisiert. Hierbei war die französische Medizin mit Philippe Pinel (17451826) führend, der den Umgang mit psychisch Kranken humaner gestalten wollte und Vererbung als eine Ursache von Geisteskrankheit ansah. Einen multifaktoriellen Ansatz verfolgte auch sein Schüler Jean E. D. Esquirol (1772-1840) und erwähnte die „période maniaque et mélancholique“ (Esquirol, 1838). Als eigenständige Erkrankung benannte schließlich Jean-Pierre Falret (1794-1870) die „folie circulaire“, das „zirkuläre Irresein“ (Falret, 1851). Etwa gleichzeitig publizierte Jules Baillarger (1809-1890) Fallberichte unter der Bezeichnung „folie à double forme“ (Baillarger, 1854). Im Gegensatz zu Falret maß er den euthymen, also stimmungsneutralen Intervallen weniger Bedeutung zu. Dies führte damals zu fachlichen Kontroversen (Pichot, 1995) und auch aus heutiger Sicht der bipolaren Störung lag Falret richtig, der symptomfreie Abschnitte als Teil der Erkrankung und nicht als Gesundung interpretierte. Auch für den deutschen Psychiater Emil Kraepelin (1856-1926) waren Manie und Depression Ausdruck ein- und derselben Krankheit, welche er 1899 in seinem Psychiatrie- Lehrbuch „manisch-depressives Irresein“ nannte. Zuvor hatte Kraepelin noch zwischen periodischen Psychosen und „circulärem Irresein“ unterschieden und stimmte damit mit Wilhelm Griesinger (1817-1868) und Karl Ludwig Kahlbaum (1828-1899) überein, die zwar eine Abhängigkeit der Phasen voneinander feststellten, jedoch noch nicht im Sinne eines einheitlichen Krankheitsbildes. In seinem neuen Krankheitskonzept grenzte Kraepelin nun die psychotische Einheit ab von der „Dementia praecox“ als andere Psychosegruppe, die einen ungünstigeren Verlauf bis hin zur „Verblödung“ hatte. Die Trennung von „circulärer Depression“ und „Melancholie“ entfiel und damit die Unterscheidung zwi6 schen unipolarer und bipolarer Depression; der von Ewald Hecker (Hecker, 1877) und Kahlbaum (Kahlbaum, 1882) geprägte Begriff der „Cyklothymie“ für affektive Schwankungen stellte für Kraepelin nur eine abgemilderte Form der manisch-depressiven Störung dar. Im Gegensatz dazu vertraten Kraepelins Zeitgenosse Carl Wernicke (18481905) und später sein Schüler Karl Kleist (1879-1960) eine Theorie zweier eigenständiger, nicht ineinander übergehenden Krankheitsbilder (Kleist, 1928, Wernicke, 1906); ein Konzept, das von Karl Leonhard (1904-1988) weiterverfolgt wurde. Dieser unterschied „reine“ monopolar phasische Krankheitsbilder (reine Melancholie, reine Manie) von „vielgestaltigen“ phasischen Formen (Leonhard, 1957) und grenzte sie von den zykloiden Psychosen ab. Die heutige Unterscheidung in uni- und bipolare affektive Störungen geht auf spätere katamnestische und erbbiologische Untersuchungen zurück (Angst, 1966, Neele, 1949). Wie auch der Schweizer Jules Angst konnte der Amerikaner Carlo Perris diese Einteilung mit Unterschieden im Erkrankungsrisiko von Verwandten, in der Geschlechterverteilung der Betroffenen und ihrer Charaktereigenschaften sowie im Beginn und Verlauf der Erkrankung begründen (Perris, 1966). George Winokur und Paula Clayton untermauerten diese Trennung der Krankheitsbilder (Winokur und Clayton, 1967). Eine reine Manie erweist sich nahezu immer als Erstmanifestation einer bipolaren Erkrankung und nicht als eigenständiges Syndrom. Andersherum ist die Einschätzung des klinischen Verlaufs einer Depression – als unipolare oder bipolare Form – schwierig und birgt die Gefahr einer Fehldiagnostizierung von bipolaren Patienten, die erst spät manische Phasen entwickeln („falsch-unipolare Depression“). 1.1.2. Definition, Klassifikation Die bipolar-affektive oder auch manisch-depressive Störung ist durch wiederholte Episoden extremer Auslenkung der Stimmungslage gekennzeichnet. Man unterscheidet Phasen der Depression, Manie, Hypomanie, Mischbilder und Remission, die Antrieb und Aktivität, Denken und Wahrnehmung beeinflussen. Voraussetzung für die Diagnosestellung ist das mindestens zweimalige Auftreten einer affektiven Episode, wovon mindestens eine davon eine manische Episode sein muss. Daher muss die klinische Bewertung neben dem aktuellen 7 psychopathologischen Befund auch immer den Krankheitsverlauf einschließen (Querschnitt- und Längsschnittdiagnose). Die diagnostischen Kriterien sind im ICD-10 unter F31.x aufgeführt. Mittlerweile wird das Konzept einer euthymen, also „krankheitsfreien“ stimmungsausgeglichenen Phase angezweifelt, da auch in diesem Intervall Defizite in Bezug auf Aufmerksamkeit, Gedächtnis und kognitive Flexibilität nachzuweisen sind (Martinez-Aran et al., 2004, Nehra et al., 2006, Robinson et al., 2006). Bipolare Depression In der Symptomatik unterscheidet sich die bipolare Depression erst einmal nicht von der unipolaren Depression. Formal ist eine Dauer von zwei Wochen Voraussetzung, während denen folgende emotionale, physiologisch-vegetative, imaginativ-kognitive und motivationale Hauptsymptome vorliegen: • Depressive Verstimmung bis hin zu einem „Gefühl der Gefühllosigkeit“ • Vermindertes Interesse, wenig Aktivität, Antriebslosigkeit • Gewichtsverlust oder Gewichtszunahme • Schlafstörungen • Starke Ermüdbarkeit, Energieverlust • Gefühl der Wertlosigkeit, Schuldgefühle • Psychomotorische Unruhe • Konzentrationsstörungen, Grübelneigung • Verminderte Entschlusskraft • Suizidgedanken Manie In der manischen Episode kommt es zu einer klinisch relevanten Anhebung der Stimmungslage und Aktivität über eine Dauer von mindestens einer Woche. Manische Phasen treten deutlich seltener auf als depressive Phasen und muten wie ein umgekehrtes Spiegelbild der Depression an. Auch die Symptome der Manie betreffen die Kognitions-, Emotions-, Wahrnehmungs- und Verhaltensebene: 8 • Gehobene oder gereizte Stimmung • Übersteigertes Selbstwertgefühl • Stark gesteigerte Aktivität • Ungewöhnliche Unternehmungen mit möglichen nachteiligen Konsequenzen • Rededrang (Logorrhoe) • Ideenflucht, Sprunghaftigkeit, Gedankenrasen • Erhöhte Ablenkbarkeit • weniger Hemmungen, mehr Geldausgaben • vermindertes Schlafbedürfnis • übertriebener Optimismus • mögliche psychotische Wahnsymptome (Größenwahn, Halluzinationen) Hypomanie Die Hypomanie ist in ihrer Ausprägung leichter als die Manie und hat mit ihr die gehobene Stimmungslage und gesteigerten Antrieb gemeinsam, jedoch kommen psychotische Symptome nicht vor. Die Bezeichnung geht auf Emmanuel Mendel zurück (Mendel, 1881) und erhielt durch das Konzept der Bipolar IIStörung (s. u.) vermehrt an Gewicht (Dunner et al., 1976). Trotz häufig hoher Leistungsfähigkeit kann es zu einer deutlichen Beeinträchtigung der Berufstätigkeit oder der sozialen Funktion bis zur Hospitalisierung kommen. Die erforderliche Dauer beträgt nach DSM-IV vier Tage und nach ICD-10 „einige Tage“; ist die Beeinträchtigung vollständig, muss eine Manie und keine Hypomanie diagnostiziert werden. Mischzustände Nach ICD-10 und DSM-IV sind Mischzustände („mixed states“) durch eine Mischung oder durch einen schnellen Wechsel – im Allgemeinen innerhalb weniger Stunden – von manischen, hypomanischen und depressiven Symptomen gekennzeichnet. Dabei müssen Symptome beider Extreme gleichermaßen die meiste Zeit über mindestens zwei Wochen (ICD-10) bzw. eine Woche (DSM-IV) hinweg bestehen. Die eng gefassten Kriterien gaben schon mehrfach Anlass zu Kritik (Akiskal, 1992, Marneros, 2004, Perugi et al., 1997) und führten zur Ent- 9 wicklung „weicherer“ Definitionen wie den „Cincinatti-Kriterien für die dysphorische Manie“ (McElroy et al., 1992), den „Pisa-Kriterien“ (Perugi et al., 1997) und den „Wiener Diagnostischen Kriterien“ (Marneros, 2004a). Klassifikation der bipolaren Störungen Die Unterscheidung der Formen Bipolar I und Bipolar II ging zunächst auf ein unterschiedliches Ansprechen auf Therapie zurück (Dunner et al., 1976). Der heute entscheidende Unterschied zwischen den Störungen ist das Vorliegen mindestens einer manischen Episode im Verlauf bei Bipolar I, während bei Bipolar II niemals manische, sondern nur hypomane Phasen vorgekommen sind (Dunner et al., 1976). Diese Trennung ist im DSM-IV vorhanden, das ICD-10 klassifiziert lediglich die hypomane Episode, ohne eine eigene Kategorie für die Bipolar II-Störung einzurichten. Trotzdem sollte die Bipolar II-Störung aufgrund eigener typischer Merkmalshäufungen und Komorbiditäten nicht als leichte Form der Bipolar I-Störung angesehen werden. Eine in den Ausschlägen schwächere Verlaufsform, die allerdings immer noch deutlich über den normalen Stimmungsschwankungen liegt, ist die Zyklothymia. Die Betroffenen sind anhaltenden, mindestens zwei Jahren bestehenden, wechselnd (sub)depressiven oder hypomanischen Stimmungsschwankungen ausgesetzt. Nach ICD-10 F34.0 darf jedoch keine dieser Perioden „ausreichend schwer oder andauernd genug gewesen sein, um die Beschreibungen und Leitlinien für bipolare affektive Störungen (F31) oder rezidivierende depressive Störungen (F33) zu erfüllen“. Andere affektive und psychische Krankheiten treten oft zusätzlich auf (Hantouche et al., 2003). Eine Besonderheit im Verlauf der bipolaren Erkrankung stellt das Rapid Cycling dar, womit ein Episodenwechsel mit mindestens vier abgrenzbaren Episoden innerhalb von 12 Monaten bezeichnet wird. Nach DSM-IV kann die Zusatzcodierung „Rapid Cycling“ auf Bipolar I und Bipolar II Störungen angewandt werden und wurde auch bei unipolarer Depression beschrieben (Goodwin und Jamison, 1990, Zisook, 1988). Es stellt offensichtlich keine eigene Krankheitsform, sondern eine schwerer zu behandelnde Verlaufsform der bipolaren Erkrankung dar und findet im ICD-10 keine Berücksichtigung. Auffällig ist die Geschlechterverteilung mit 80% Frauen; der Anteil von Rapid Cycling an bipolaren Störungen schwankt in der Literatur zwischen 5% und 20% (Coryell et al., 1992, Mar10 neros, 2004, McElroy und Keck, 1993). Auch die Rolle von Antidepressiva als Auslöser der schnellen Episodenwechsel wird kontrovers diskutiert (Arnold und Kryspin-Exner, 1965, Coryell et al., 2003, Goodwin und Jamison, 1990, Marneros, 2004, Wehr et al., 1988). 1.1.3. Ätiologie Das Wissen um die Ursachen der bipolaren Störung ist begrenzt. Speziell die so gegensätzlichen Pole der Krankheit und das Fehlen eines überzeugenden Tiermodells – abgesehen von den existierenden Modellen zur Depression – erschweren das Verständnis dieser komplexen Erkrankung. Man geht von einer multifaktoriellen Entstehung aus, deren Komponenten unter anderem Vererbung, Temperament und Neurobiologie in Verbindung mit psychosozialen Bedingungen und Stress darstellen. Genetik Die Bedeutung genetischer Faktoren in der Ätiologie der bipolaren Störung wird durch deren im Hinblick auf geographische und kulturelle Unterschiede stabile Häufigkeitsangaben unterstrichen (s. Kap. Epidemiologie). Die klinische Genetik beschäftigt sich im Wesentlichen mit Familienuntersuchungen, Zwillingsuntersuchungen, Adoptionsuntersuchungen und Untersuchungen zum Erbgang; auf molekularer Ebene unterscheidet man Kopplungsund Assoziationsstudien. Mehreren Familienstudien zufolge haben Angehörige ersten Grades eines bipolaren Patienten ein 7-fach erhöhtes Risiko, ebenfalls an einer bipolaren Störung zu erkranken (Craddock et al., 1995). Das Lebenszeitrisiko ist auch für klinisch ähnlich verlaufende Erkrankungen wie die schizoaffektive Störung, Zyklothymie und Hypomanie erhöht (Maier et al., 1998). Dies ist nicht zwingend auf Vererbung zurückzuführen, da soziale Faktoren oder Traumatisierungen innerhalb einer Familie ebenfalls gleich sein können, wird aber durch Zwillings- und Adoptionsstudien unterstützt. Eineiige Zwillinge erkranken viermal häufiger als zweieiige Zwillinge an einer bipolaren Störung, die Konkordanz beträgt 62% (Bertelsen et al., 1977) und damit hat ein eineiiger Zwilling eines bipolar Erkrankten ein etwa 60-fach erhöhtes Erkrankungsrisiko im Vergleich zur Allge11 meinbevölkerung. Der Einfluss genetischer Faktoren wird mit 59% (Bertelsen et al., 1977), 79% (Kendler et al., 1995) und 87% (Cardno et al., 1999) angegeben, was einerseits für den Einfluss der Vererbung, andererseits aber auch für die Rolle von Umweltfaktoren spricht, da eineiige Zwillinge ein fast zu 100% gleiches Genom haben, die Heritabilität jedoch nicht 100% beträgt. Adoptionsuntersuchungen fanden ein höheres Risiko für bipolare Störungen bei den biologischen Angehörigen adoptierter erkrankter Kinder (31%) als bei ihren Adoptivangehörigen (12%) (Mendlewicz and Rainer, 1977, Wender et al., 1986) und stützen damit ebenfalls die These der Bedeutung genetischer Faktoren. Im Erbgang konnte kein eindeutiges Muster nach den Mendelschen Gesetzen gefunden werden, was für einen komplexen Erbgang mit multiplen Genen spricht. Es kann also kein „kausales Gen“ verantwortlich gemacht werden, sondern „Vulnerabilitäts- und Risikogene“ in Interaktion mit Umweltfaktoren (Potash and DePaulo, 2000). In molekulargenetischen Kopplungsuntersuchungen, die bestimmte Varianten genetischer Marker im Vergleich gesunder und kranker Familienangehöriger überprüfen, konnte das Zusammenwirken mehrerer Gene bestätigt werden. Assoziationsuntersuchungen vergleichen die Häufigkeit des Auftretens bestimmter Varianten eines „Kandidatengens“ zwischen Patienten- und Kontrollgruppe. Mehrfach positive Assoziationen fanden sich unter anderem für Polymorphismen in Genen des Serotonin-, Tyrosin-, Monoaminooxidase- und Dopamin-Stoffwechsels. In neuerer Zeit wurden zudem in durch Kopplungsuntersuchungen definierten Kopplungsregionen „positionelle Kandidatengene“ untersucht, wobei sich unter anderem Assoziationen mit Genen auf den Chromosomen 18 und 22 zeigten (Barrett et al., 2003, Sjoholt et al., 2004, Washizuka et al., 2003). Die genetische Ursachenforschung gilt heute als der vielversprechendste wissenschaftliche Ansatz für die Entwicklung neuer (Pharmako-) Therapien (Deckert und Arolt, 2000), auch wenn sich Aussagen prädiktiver Art- also etwa pränataldiagnostisch- nicht auf dieser Basis treffen lassen werden. Neurobiologie Auch pathophysiologisch lässt sich die bipolar affektive Erkrankung noch nicht erklären. Gesichert sind mittlerweile Abweichungen in der intrazellulären und 12 neuronalen Signaltransduktion; die hierzu formulierten Hypothesen stützen sich vor allem auf Rückschlüsse aus pharmakologischen Wirkungen. So zeigen bipolar depressive Patienten analog zu unipolar Depressiven eine verminderte Verfügbarkeit der Neurotransmitter Serotonin und Noradrenalin und eine veränderte Dichte serotonerger und noradrenerger Rezeptoren (Maes und Meltzer, 1995). Gegen diese etwas einfache Erklärung des gesamten Krankheitsbildes spricht die Fähigkeit des Organismus zur Autoregulation, also beispielsweise eine Erhöhung der Rezeptorendichte bei Erniedrigung der Transmitterkonzentration. Neben Serotonin und Noradrenalin in depressiven Episoden wird bei der bipolaren Störung dem Dopamin eine Rolle in manischen Episoden zugeschrieben, da dopaminantagonistische Neuroleptika wie Clozapin und Haloperidol wirkungsvoll gegen Manie eingesetzt werden. Wie unvollkommen das Wissen über neurophysiologische Mechanismen in der Ätiologie affektiver Störungen noch ist, zeigt sich im mittlerweile jahrzehntelangen Einsatz von Lithium als klassisches Phasenprophylaktikum und Antimanikum ohne wirklich genaues Wissen über dessen Wirkungsweise. Möglicherweise trägt auch eine Fehlregulation der funktionellen und strukturellen Plastizität des Zentralen Nervensystems zur Pathophysiologie bei. Lernprozesse und morphologische Veränderungen werden durch Up- oder Downregulation synaptischer Übertragungen beeinflusst, was auch Angriffspunkt verschiedener Psychopharmaka (Lithium, SSRI) ist (Normann et al., 2000). Der neurotrophe Faktor BDNF (brain-derived neurotrophic factor) ist unter Stress vermindert und spielt eine Schlüsselrolle z.B. bei degenerativen Axonveränderungen (Einat et al., 2003). Dies ist insofern entscheidend, als dass bipolare Patienten oft ein hohes Anspannungsniveau und Angst aufweisen und psychosozialer Stress als ein Auslösefaktor für Episoden angesehen wird. In der funktionellen Bildgebung (PET, funktionelles MRT, SPECT) konnten bei bipolaren Patienten Abweichungen bezüglich des Glukosestoffwechsels und des regionalen Blutflusses in bestimmten Hirnregionen gefunden werden (Soares und Innis, 2000) und auch andere Studien weisen auf lokale Abbauprozesse hin. Die Bedeutung dieser Veränderungen ist jedoch bisher als spekulativ anzusehen und schnelle Stimmungsänderungen wie etwa beim Rapid Cycling sind dadurch nicht erklärbar. 13 Temperament Über Jahrhunderte hat die Temperamentskonzeption das medizinische Denken geprägt (s.o.) und in den letzten Jahren zunehmend wieder an Bedeutung in der psychiatrischen Forschung gewonnen (Akiskal et al., 2002). Die Encyclopaedia Britannica definiert Temperament als einen „Aspekt der Persönlichkeit, der emotionale Anlagen und Reaktionen umfasst sowie deren Geschwindigkeit und Intensität“ und spiegelt die Vorstellung Kraepelins wieder, Temperamente könnten „Verdünnungen“ bipolar affektiver Störungen sein (Kraepelin, 1913). Temperament kann als prädestinierender und verlaufsmodifizierender Faktor bei bipolaren Störungen verstanden werden. Es gibt Hinweise auf bestimmte Temperamentszüge (hypomanisch, hyperthym) und Persönlichkeits-Cluster bei Menschen mit bipolarer Störung (Brieger et al., 2002). Allerdings unterliegt dieser Forschungsansatz methodischen Schwierigkeiten und umfassendere empirische Studien stehen noch aus. Psychosoziale Bedingungen und Stress Traumatische Ereignisse, beispielsweise sexueller oder körperlicher Missbrauch in Kindheit und früher Adoleszenz, werden als schwerwiegende Risikofaktoren für die Entstehung verschiedener psychiatrischer Störungen angesehen. Für bipolare Patienten ist ein Zusammenhang zwischen solchen Erfahrungen und frühem Erkrankungsbeginn, höherer psychiatrischer Komorbidität einschließlich Substanzmissbrauch, höherer Phasenhäufigkeit und höherem Ausmaß suizidalen Verhaltens beschrieben (Leverich et al., 2002, Post et al., 2003). Belastende Lebensereignisse sind außerdem mit dem Episodenbeginn bei bipolaren Patienten assoziiert (Ellicott et al., 1990). Die Neurobiologie von Stress spielt eine wichtige Rolle in der aktuellen Forschung zur Pathophysiologie affektiver Erkrankungen (McEwen, 2000); in Tierversuchen wurden Hinweise gefunden, dass Stress in frühen Lebensphasen (z.B. Deprivation vom Muttertier) zu einer dauerhaft erhöhten Ausschüttung des Corticotropin-ReleasingFactors (CRF) führen könnte, infolgedessen die Tiere depressionsähnliche Verhaltensweisen zeigten (Heim and Nemeroff, 2001). Hyperkortisolismus ist eine gut belegte Auffälligkeit bei depressiven Störungen und wurde auch bei Manien gefunden. 14 Psychosoziale Stressoren bei Kindern, die mit einer erhöhten Vulnerabilität für psychische Störungen einhergehen, sind zum Beispiel: • niedriger sozialer Status, chronische Armut • Alkohol-, Drogenmissbrauch und Kriminalität der Eltern • Niedriges Bildungsniveau der Eltern • Psychische Erkrankung eines Elternteils • Trennung der Eltern („broken home“) • Außerfamiliäre Unterbringung • Traumatisierung Empirische Untersuchungen ergaben, dass ein einzelner Risikofaktor selten zu einer signifikanten Erhöhung von psychischen Störungen führt, jedoch zwei Risikofaktoren mit einer 4-fach und vier Risikofaktoren sogar mit einer 10-fach höheren Wahrscheinlichkeit einhergehen. Ohne eine Kausalität herstellen zu können, gibt dies deutliche Hinweise auf das Zusammenwirken aller genannten Teilbereiche in der Ätiologie der bipolaren Störung. Jedoch haben die Umweltfaktoren, zu denen außer belastenden Lebensereignissen auch soziale Kontakte, sozialer Status und der Tagesrhythmus gehören, geringeren Einfluss auf die Erstmanifestation einer bipolaren Erkrankung als eher auf deren Verlauf (Lish et al., 1994, Robins und Regier, 1991). 1.1.4. Epidemiologie Die umfassendsten Arbeiten zur Epidemiologie psychiatrischer Krankheiten in den USA stellen die „Epidemiological Catchment Area Study“ (ECA) (Robins und Regier 1991) und der „National Comorbidity Survey “(NCS) (Kessler et al., 1994) dar. Die ECA gibt eine Prävalenz von 0,9% an, nach NCS sind es 1,6% bei vergleichbarem Erkrankungsalter (18 bzw. 21 Jahre). Im internationalen Vergleich von 10 verschiedenen Ländern mit insgesamt etwa 38.000 Teilnehmern werden Prävalenzen zwischen 0,3% (Taiwan) und 1,5% (Neuseeland) angegeben (Weissman et al., 1996). In Europa stellte „The Netherlands Health 15 Survey and Incidence Study“ (NEMESIS) in einer Erhebung über drei Jahre eine Lebenszeitprävalenz von 1,9% fest, davon entfallen 1,3% auf Bipolar I (ten Have et al., 2002). Die Häufigkeit der Bipolar II-Störung ist insgesamt in allen Studien weniger gut erfasst, da es an expliziten Diagnosemanualen mangelt. Erst neuere Studien orientieren sich an der heute gültigen Klassifikation der DSM-IV mit eigenen Kriterien für die Bipolar II-Störung. Wie bei der amerikanischen NCS wurde bei NEMESIS als Diagnoseinstrument das „Composite International Diagnostic Interview“ (CIDI) verwendet und die Diagnose nach DSM-IIIR gestellt. Für Deutschland wurde eine Prävalenz von 0,5% gefunden bei einem durchschnittlichen Erkrankungsalter von 29 Jahren (Wittchen et al., 1992). (Zur Übersicht siehe Tabelle 1.) Tab. 1: Studien zur Epidemiologie bipolarer Störungen, Lebenszeitprävalenzen Land USA, ECA Studie (Robins u.. Regier, 1991) USA, NCS (Kessler et al., 1994) Kanada, (Orn et al., Edmonton 1988) Puerto Rico (Canino et al., 1987) Deutschland (Wittchen et al., 1992) Taiwan (Hwu et al., 1989) Korea (Lee et al., 1990) Neuseeland (Wells et al., 1989) Niederlande (ten Have et al., 2002) Prävalenz DiagnoseManual 0,9% 1,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,3% 0,4% 1,5% 1,9% DSM-III, DIS DSM-III-R, CIDI DSM-III, DIS DSM-III, DIS DSM-III, DIS DSM-III, DIS DSM-III, DIS DSM-III, DIS CIDI StichF/M Probenumfang 20.291 1,2:1 Ersterkrankung (Jahre) 18,1 8.098 0,9:1 21 3.258 0,7:1 17,1 1.513 0,6:1 27,2 1.356 29 11.004 1:1 22,5 5.100 0,3 23 1.498 0,7 18,2 7.076 1,4:1 In Bezug auf das Geschlechterverhältnis stimmen alle Studien darin überein, dass Männer und Frauen etwa gleichermaßen betroffen sind. Damit unterscheidet sich die bipolare Störung von der mehr Frauen betreffenden unipolaren Depression, die im Gegensatz zur Bipolarität weitaus stärker auch regionale und kulturelle Differenzen aufweist. 16 Das Manifestationsalter liegt zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr; früheres Auftreten (vor dem 15. Lebensjahr) ist möglich, spätes Auftreten nach dem 40. Lebensjahr eher unwahrscheinlich. 17 1.2. Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) 1.2.1. Traumadefinition Eine schwere psychische Traumatisierung ist Voraussetzung zur Entwicklung einer PTBS und bedarf daher einer genaueren Definition. Die WHO beschreibt im ICD-10 (1993) ein Trauma als „ein belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde“. Die Verfasser des DSMIV (1994) versuchten die Definition zu präzisieren und bezogen sich dabei auf Studienergebnisse, die ein „Gefühl der Lebensbedrohung“ als entscheidend erachteten (March, 1993). Es kann sich dabei auch um das Leben anderer, dem Betreffenden nahe stehender Menschen handeln: Zu den Traumata gehören Naturereignisse oder „von Menschen verursachte Katastrophen, Kampfhandlungen, ein schwerer Unfall oder Zeuge eines gewaltsamen Todes anderer oder selbst Opfer von Folterung, Terrorismus, Vergewaltigung oder anderer Verbrechen zu sein“ (ICD-10). Bei Kindern werden nach DSM-IV weiterhin dem Entwicklungsstand unangemessene sexuelle Erfahrungen eingeschlossen. Auch lebensbedrohliche Krankheiten und medizinische Eingriffe können traumatisch sein, etwa eine sehr gefährlich verlaufende Entbindung oder eine Operation bei unvollständiger Narkose. Wichtig ist, ein Trauma nicht nur objektiv allein anhand der Situation zu beurteilen, sondern die subjektive Reaktion. Da Traumata charakteristischerweise plötzlich und unerwartet auftreten, ist die Reaktion des Betroffenen ein Gefühl des Entsetzens, der Hilflosigkeit und der intensiven Furcht. Der Kontrollverlust spielt hierbei eine entscheidende Rolle; der Betroffene ist ausgeliefert und von dem Ereignis überwältigt. Das Risiko, eine PTBS zu entwickeln, ist nicht bei allen Traumaarten gleich. Neben der Einteilung in Typ-I-Trauma (kurz dauernd und einmalig) und Typ-II-Trauma (lang dauernd und/oder mehrfach) lässt sich auch nach der Ursache unterscheiden: Akzidentell (zufällig) vs. intendiert/interpersonell (absichtlich, „man made“). Das höchste Risiko für eine PTBS besteht für intendierte Typ-II-Traumen (Übersicht und Beispiele siehe Abb.1). 18 Typ I-Traumen Einteilung nach Erstreckung Einteilung nach Verursachung Akzidentelle Traumen Intendierte/ Interpersonelle Traumen • Schwere Verkehrsunfälle • Sexuelle Übergriffe (z.B. Vergewaltigung) • Berufsbedingte Traumen (z.B. Polizei, Rettungs• Kriminelle bzw. körperkräfte) liche Gewalt • Kurz dauernde Katastro- • Ziviles Gewalterleben phen (z.B. Wirbelsturm, (z.B. Banküberfall) Brand) • Typ II-Traumen • Lang dauernde Naturkatastrophen (z.B. Erdbeben, Überschwemmung) Technische Katastrophen (z.B. Giftgaskatastrophen) mit anhaltenden Folgen • • • • Sexueller und körperlicher Missbrauch in der Kindheit bzw. im Erwachsenenalter Kriegserleben Geiselhaft Folter, politische Inhaftierung (z.B. KZ-Haft) Geringes Risiko für eine PTBS Mittleres Risiko für eine PTBS Hohes Risiko für eine PTBS Abb.1: Schema der Einteilung traumatischer Ereignisse und der Risikograde für die Ausbildung einer PTBS (nach (Maercker et al., 1998) 19 1.2.2. Symptomatik, Diagnosekriterien und Differentialdiagnosen der PTBS DSM-IV und ICD-10 stimmen hinsichtlich der Kernsymptomgruppen der PTBS überein, unterscheiden sich jedoch in der Gewichtung der Symptome. Insgesamt sind die DSM-IV-Kriterien strenger und stellen die Diagnose weniger schnell (Peters et al., 1999). Das PTBS-Syndrom ist im Wesentlichen durch folgende Symptomgruppen gekennzeichnet: 1. Wiedererleben (Intrusionen) Ungewollte, sich wiederholt aufdrängende Erinnerungen an das Trauma einschließlich sensorischer Eindrücke (Bilder, Geräusche, Geschmack, Körperempfindungen); Betroffene können das Gefühl haben, sich wieder in der traumatisierenden Situation zu befinden („Flashback“), oft durch bestimmte Reize ausgelöst (Trigger); Albträume 2. Vermeidungsverhalten Situationen oder Personen, die mit dem Trauma in Verbindung stehen, werden aufgrund der starken Belastung gemieden; Amnesien für das Trauma oder Teile dessen; Gefühl der „Abstumpfung“ 3. Übererregung (Hypervigilanz) Allgemein erhöhtes Erregungsniveau mit Konzentrations- und Schlafstörungen, Reizbarkeit, psychomotorischer Unruhe, starker Schreckhaftigkeit Im DSM-IV stellen diese Symptome die Kategorien B, C und D zur Diagnose dar (s. Tabelle 2). 20 Tab.2: Kategorien A-F nach DSM-IV zur Diagnose der PTBS A Trauma (Lebensgefahr, Angst, Hilflosigkeit, Entsetzen) B Wiedererleben (Albträume, Intrusionen, Flashbacks, psychische u. körperliche Reaktionen bei Konfrontation) C Vermeidungsverhalten (Abflachung der emotionalen Reagibilität, Entfremdung, Erinnerung unvollständig) D Übererregbarkeit (Störungen von Schlaf und Konzentration, Schreckhaftigkeit, Reizbarkeit) E Dauer >1 Monat F Psychosoziale Beeinträchtigung Differentialdiagnostisch ist die PTBS vor allem von der Anpassungsstörung abzugrenzen, bei der die Symptomatik infolge eines leichteren Traumas (Verletzung des sozialen Netzes wie z.B. Trennung, Trauerfall, Emigration) schwächer ist und die Kriterien A-F nicht alle trifft. Auch muss zur Diagnose der PTBS die Symptomatik über mindestens einen Monat bestehen. Bei kürzeren Verläufen ist eher von einer akuten Belastungsreaktion auszugehen (ICD-10: F43.0). Besonders bei schweren, langanhaltenden, intendierten Traumatisierungen wie Folter, Konzentrationslagerhaft, physischem und sexuellem Missbrauch in der Kindheit oder organisierter sexueller Ausbeutung, kann es zu einer „andauernden Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung“ (ICD-10: F62.0) bis hin zur dissoziativen Identitätsstörung kommen (Huber, 2003). Charakteristisch sind eine feindliche misstrauische Haltung gegenüber der Welt, sozialer Rückzug, ein andauerndes Gefühl der Leere, Nervosität oder Bedrohung ohne äußere Ursache, über einen Zeitraum von mindestens 2 Jahren. Hierzu existiert auch das Konzept der „Komplexen PTBS“ (Herman, 1993), das aber bisher noch nicht in die internationalen Klassifikationssysteme aufgenommen wurde und außerdem vielfache Überschneidungen mit der Borderline-Störung aufweist. Eine Schwierigkeit besteht auch in der Differenzierung von anderen psychischen Störungen, die sich komorbid oder als alleinige Traumafolge manifestieren können. Hier sind vor allem Angststörungen, Depressionen, Zwangsstörungen und Substanzmissbrauch zu nennen. 21 1.2.3. Ätiologie und geschichtliche Entwicklung Beschreibungen von PTBS-Symptomen existieren seit Ende des 19. Jahrhunderts durch Überlebende schwerer Eisenbahnunglücke, Soldaten der beiden Weltkriege und Überlebende des Holocaust, damals als „Schreckneurose“, „Kampf- oder Kriegsneurose“ (combat/war neurosis), „Granatenschock“ (shell shock) oder „Überlebenden-Syndrom“ (survivor syndrome) bezeichnet (Übersichten bei (Gersons and Carlier, 1992, Kinzie and Goetz, 1996). Das psychische Trauma selbst wurde als wesentliche Ursache lange angezweifelt, an seine Stelle traten physische Erklärungen (z.B. Eindringen kleinster Teilchen explodierter Bomben ins Gehirn, große Luftdruckschwankungen durch nahe Einschläge) und die Diffamierung Betroffener als Simulanten mit dem Wunsch nach finanzieller Entschädigung („Kompensationsneurose“). Besonders die Beobachtung großer seelischer Belastung bei unerwartet vielen Vietnamkriegs-Veteranen trug dazu bei, dass man heute im Gegensatz zu früher nicht mehr von einer schon vor dem Trauma zwingend labilen Persönlichkeit der Betroffenen ausgeht. Jedoch hat man Risikofaktoren für die Entwicklung einer PTBS nach einem Trauma identifiziert (Watson and Shalev, 2005). Nach Effektstärke sortiert (stärkster Risikofaktor zuerst) nennt eine Metaanalyse über 77 Studien (Brewin, 2003): • Mangelnde soziale/familiäre Unterstützung • Posttraumatische Lebensbelastungen, z.B. finanziell/beruflich • Traumaschwere • Belastete Kindheit, z.B. frühe Trennungserlebnisse • Geringer Intelligenzquotient • Missbrauch in der Kindheit • Geringer sozioökonomischer Status • Weibliches Geschlecht • Psychiatrische Vorerkrankungen • Geringer Bildungsstand 22 Es wird angenommen, dass Menschen mit PTBS im Gegensatz zu denen, die sich von einem Trauma psychisch erholen, das traumatische Erlebnis globalnegativ und nicht zeitbegrenzt interpretieren (beispielsweise: „Ich ziehe Unglück an“, „Ich bin nirgends sicher“). Dieser negative Attributionsstil findet sich auch bei Depressionen. Bei Menschen mit einer Familiengeschichte von psychischen Störungen führt schon eine geringere Belastung zu einem hohen Anteil an PTBS (Foy et al., 1987). Als protektiver Faktor zeigte sich ein hohes Maß an Kohärenzgefühl, also der Fähigkeit des Individuums, Gedanken in nachvollziehbaren, logischen Zusammenhang zu bringen und damit das traumatische Erlebnis besser einordnen und mit den Folgen umgehen zu können (Antonovsky, 1987, Frommberger et al., 1999). Auch die Anerkennung als Traumaopfer senkt die Rate chronischer Verläufe (Maercker and Muller, 2004). Lerntheoretisch handelt es sich um eine klassische Konditionierung der Angst und die PTBS ist ein Beispiel für das Vermeidungslernen (Foy et al., 1990). Auch gibt es Hinweise auf eine biologisch erklärbare Vulnerabilität, etwa andauernd erhöhte Stressparameter bei frühen negativen Bindungserfahrungen. In einer Vielzahl von Tierversuchen konnten die erheblichen biochemischen Veränderungen durch fürsorgliches mütterliches Verhalten in den ersten Lebenstagen und -wochen gezeigt werden (Review Vermetten and Bremner, 2002). Die Zahl der Glucocorticoidrezeptoren im Hippocampus ist bei elterlicher Vernachlässigung geringer. Es kommt zu einem Ungleichgewicht und zu Dysfunktionen in den Rückkopplungskreisen zwischen Cortisol und Noradrenalin; PTBS ist assoziiert mit höheren Katecholaminspiegeln (Young and Breslau, 2004). Weiterhin wurden bei PTBS-Patienten Auffälligkeiten in verschiedenen Hirnregionen gefunden (Amygdala, Hippocampus, Cingulum, orbitofrontaler Kortex, Thalamus, Insel, Broca-Region) (Jatzko et al., 2005). Nach einer Zwillingsstudie an Vietnamveteranen ist ein anlagemäßig kleinerer Hippocampus ein genetisches Risiko für eine PTBS (Gilbertson et al., 2002). Grundsätzlich muss festgestellt werden, dass es sich - wie auch bei der bipolaren Störung - bei der Entstehung der PTBS ätiopathogenetisch um einen multikausalen Vorgang handelt, bei dem sich die zuvor genannten Faktoren wechselseitig beeinflussen (Frommberger et al., 2004). 23 1.2.4. Epidemiologie Nach epidemiologischen Daten aus den USA erleben 81% der Männer und 74% der Frauen im Laufe ihres Lebens mindestens ein traumatisches Ereignis, das die Kriterien nach DSM-IV erfüllt (Stein et al., 1997). Die Prävalenz der PTBS liegt allerdings bei nur 1-9%, was verdeutlicht, dass Traumatisierte nicht zwangsläufig eine PTBS entwickeln. Entscheidend ist vor allem die Art des Traumas. Zu besonders hohen PTBS-Raten führen Kampfeinsätze im Krieg, Kindesmisshandlung und sexueller Missbrauch/Vergewaltigung (Kessler et al., 1995). Bestätigt wird dies unter anderem durch Untersuchungen an einer großen Stichprobe von Vietnamveteranen mit einer PTBS-Rate von 15,2% (Keane et al., 1992) und in einer Studie mit Veteranen des Libanonkrieges 1982, welche eine 6,6 fach höhere Prävalenz der PTBS aufwiesen (Solomon and Mikulincer, 2006). Vergewaltigung führt bei 65% der Männer und 46% der Frauen zu einer PTBS (Kessler et al., 1995), es finden sich aber auch Angaben bis zu 90%. Das erklärt teilweise, warum die PTBS insgesamt doppelt so häufig bei Frauen wie bei Männern auftritt: Männer erleben zwar häufiger ein Trauma, die Opfer sexueller Gewalt mit deren besonders hoch traumatisierender Wirkung sind jedoch überwiegend weiblich. Zum anderen scheinen Frauen nach einem Trauma eher eine PTBS zu entwickeln, was auch bei Kindern und Jugendlichen zutrifft (Giaconia et al., 1995). Kessler et al. geben eine allgemeine Lebenszeitprävalenz von 10% für Frauen und 5% bei Männern an. Nach einem traumatischen Erlebnis steigt das PTBS-Risiko bei Männern nur auf 8%, bei Frauen jedoch auf 20% an. Eine andere Studie nennt ein Risiko von 13% beziehungsweise 30% (Breslau et al., 1997). Zu einem chronischen Verlauf kommt es bei etwa einem Drittel der Personen (Kessler et al., 1995); das Risiko hierfür steigt mit der Schwere der anfänglichen Symptome (Ehlers et al., 1998). 24 1.3. Fragestellung der Arbeit Es finden sich mehr und mehr Hinweise darauf, dass traumatische Erlebnisse einen negativen Einfluss auf den Verlauf einer psychiatrischen Erkrankung haben können. In der gegenwärtigen Literatur wird traumatischen Erlebnissen wie Kindesmissbrauch eine erhebliche Rolle bei Psychosen und Schizophrenie zugeschrieben (Read et al., 2005). Traumaerfahrungen sind häufig bei Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen. Bei Garno werden schwere Traumatisierung in der Kindheit bei etwa der Hälfte einer Auswahl von bipolaren Patienten angegeben (Garno et al., 2005). Darüber hinaus wurden in Studien mit bipolaren Patienten Kindesmissbrauch und Vernachlässigung einem früheren Krankheitsbeginn, Anzahl und Schwere der Manien, klinischem Verlauf und einer höheren Rate von Selbstmordversuchen zugeordnet (Read et al., 2005). In der Folge negativer Erfahrungen entwickelt ein Teil der Betroffenen eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS). Entsprechend der Durchsicht der Literatur liegt die geschätzte Prävalenz von PTBS bei bipolaren Patienten in USamerikanischen Studien bei 16% (Otto et al., 2004). Als Risikofaktoren für eine PTBS werden verschiedene Achse I- Störungen (Zustandsstörungen, schwere mentale Fehlstörung und Lernunfähigkeiten), Dauer der Traumatisierung, Neurotizität, und geringerer Grad an Extroversion, sozialer Einbindung und sozioökonomischem Status angesehen, die Vulnerabilität bipolarer Patienten zu erhöhen. Zudem kann ein manischer Zustand selbst einen Risikofaktor für die Entwicklung einer PTBS nach einer Traumatisierung darstellen (Otto et al., 2004, Pollack et al., 2006). Schlussendlich zeigt sich, dass der Verlauf einer bipolaren Störung von komorbiden Angststörungen mit PTBS negativ beeinflusst wird (Otto et al., 2006). Die Häufigkeiten von Traumatisierungen und die Prävalenzen der PTBS differieren in verschiedenen Ländern. Deutsche Studien zeigten Prävalenzraten von 2-4% bei jüngeren Probanden (Maercker et al., 2004, Perkonigg et al., 2000) im Vergleich zu 8% in der US-Bevölkerung (Kessler et al., 1995) (s. Kap. 1.2.4). Nach unserem Wissen gibt es bisher keine Daten über die Prävalenzrate von Trauma oder PTBS bei bipolaren Patienten in Deutschland oder Europa. Unser Studienziel war daher die Erfassung von traumatischen Erfahrungen und PTBS bei bipolaren Patienten und die Überprüfung der Hypothese einer höheren Rate 25 von PTBS bei bipolaren Patienten; des Weiteren wollten wir die ersten klinischen Daten zu den Auswirkungen von Traumata auf den Krankheitsverlauf bei bipolarer Störung in der deutschen bzw. europäischen Bevölkerung erheben. 26 II. METHODIK 2.1. Studiendesign 2.1.1. Probanden Voraussetzung für die Aufnahme in die Untersuchungsgruppe war die vorbestehende Diagnose einer bipolar affektiven Störung gemäß ICD-10. Zur Rekrutierung der Probanden wurden hauptsächlich Daten der LWL-Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum genutzt, des Weiteren nahmen Patienten der LWL-Klinik Dortmund-Aplerbeck teil. Ein Teil des Kollektivs stammt aus Selbsthilfegruppen in Bochum, Dortmund und Witten. Wichtigstes Einschlusskriterium neben der Diagnose Bipolar I (ICD-10 F 31x) war das Vorliegen der Erkrankung in einem remittierten Stadium zum Zeitpunkt der Befragung, weshalb eine akut manische sowie eine akut depressive Episode mittels standardisierter Testverfahren, der Hamilton Depression Rating Scale (HAMD) und der Young Mania Rating Scale (YMRS), ausgeschlossen wurden. Jeder Patient wurde einem ca. 60-minütigen Einzelgespräch unterzogen; bei 11 Patienten erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt eine erneute, ca. 60-minütige Befragung mittels der Clinician Administered PTSD Scale (CAPS) aufgrund positiver Testergebnisse in der Posttraumatic Diagnostic Scale (PDS) als Hinweis für eine Posttraumatische Belastungsstörung. An der vorliegenden Untersuchung nahmen im Zeitraum September 2006 bis August 2007 insgesamt 74 Patienten teil (30 Männer, 44 Frauen, entsprechend 40,5% und 59,5%). Das Mindestalter lag bei 18 Jahren, wobei das Durchschnittsalter 48,3 Jahre betrug bei einer Altersspanne von 20-82 Jahren. 37 der 74 Probanden (50%) gaben in der PDS-Life-Event-Scale eine Traumatisierung an (12 Männer, 25 Frauen, entsprechend 32,4% zu 67,6%). Von diesen 37 hatten wiederum 15 ein positives Testergebnis für eine Lebenszeit-PTBS (40,5% der Traumatisierten bzw. 20,3% der Gesamtgruppe). Verglichen wurden die Parameter für die Schwere der Bipolaren Störung der Untergruppe ohne Trauma (n=37) sowohl mit der Untergruppe mit Trauma (n=37) als auch mit der Untergruppe Trauma und PTBS (n=15). 27 Insgesamt schied eine Patientin aus der Studie aus. Vier der 15 PTBS-positiv getesteten Patienten brachen die Studie nach der Erstbefragung ab und nahmen nicht an der CAPS teil. 2.1.2. Aufklärung, Einwilligung und Ethik Vor Beginn der Befragung wurden die Patienten mündlich und mittels eines Aufklärungsbogens über Art, Umfang, Nutzen und Bedeutung der klinischen Studie informiert. Die Einwilligung zur freiwilligen Teilnahme gaben alle Probanden auf einem Einverständnisbogen. Die Patienten wurden auf ihr Recht hingewiesen, die Studie jederzeit und ohne Angabe von Gründen abbrechen zu können, ohne dass sich dieser Entschluss nachteilig auf eine spätere Behandlung durch die LWL-Universitätsklinik Bochum auswirken würde. Die Einhaltung ethischer Grundsätze erfolgte in Anlehnung an die Deklaration von Helsinki und den aktuellen ICH-Good Clinical Practice-Richtlinien. Das positive Votum der Ethikkommission der Ruhr-Universität Bochum wurde vor Beginn der Studie eingeholt. 2.2. Untersuchungsablauf 2.2.1. Basisdaten und Parameter der Bipolaren Störung Zur Erfassung von Basisdaten wurde ein mehrteiliger Anamnesebogen erstellt. Neben Personendaten (Name, Geschlecht, Alter, Nationalität, Herkunft) und biographisch-sozialen Daten (Schulbildung, Beruf, Familienstand, Herkunftsfamilie, Psychische Erkrankungen in der Verwandtschaft, „broken home“- Erfahrung) lag das Hauptaugenmerk auf Fragen zum Krankheitsverlauf (Anzahl der Manien, Anzahl der Depressionen, Art der letzten Episode, Psychiatrische Erstdiagnose, Zeitraum seit bipolarer Diagnose, Anzahl stationärer Klinikaufenthalte, Komorbidität, Drogenmissbrauch, Suizidversuche). Diese Parameter dienten neben der Anzahl der verschiedenen aktuell eingenommenen psychiatrischen Medikamente sowie weiterer Therapieansätze (Psychotherapie, Elektrokrampftherapie) als Hauptkriterien zur Einschätzung der Schwere der Bipolaren Stö28 rung. Wir gingen in unseren Hypothesen von einer positiven Korrelation dieser Faktoren mit der Krankheitsschwere aus. Mit der Frage nach der Regelmäßigkeit der Medikamenteneinnahme in Verbindung mit der Überzeugung von deren Wirkung versuchten wir Hinweise auf die Compliance zu bekommen. Weiterhin erfolgte die Anamnese somatischer Störungen (hirnorganische Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, andere chronische Erkrankungen) und eines Substanzmissbrauchs (Alkohol, Nikotin, Drogen). Mittels einer Selbstbewertungsskala wurde zudem das Selbstwertgefühl der Patienten erfragt. 2.2.2. Psychometrische Testverfahren Global Assessment of Functioning Scale (GAF) und WHO-Disablement-Scale (WHO-DS) Beide Skalen dienen der Einschätzung der psychosozialen Funktionsfähigkeit, die im DSM-IV mit der Global Assessment of Functioning Scale (GAF) und in der ICD-10 mit der WHO-Disablement-Scale (WHO-DS) vorgenommen wird. Übereinstimmend erfassen ICD-10 und DSM-IV (mit der Achse IV) psychosoziale und Umgebungsfaktoren, Ereignisse oder Lebensprobleme, die im DSMIV mit einer Störung auf Achse I (Klinische Störungen / Diagnosen) im Zusammenhang stehen können. Die GAF-Skala entspricht der Achse V des DSM-IV und beurteilt nur die psychischen, sozialen oder beruflichen Funktionsbereiche, während Funktionsbeeinträchtigungen aufgrund von körperlichen oder umgebungsbedingten Einschränkungen ausdrücklich nicht einbezogen werden sollen. Der von uns erhobene Skalenwert spiegelt das aktuelle Funktionsniveau zum Zeitpunkt der Befragung durch einen Punktwert von 100 bis 1 wider, wobei von einem hypothetischen Kontinuum von psychischer Gesundheit bis schwerer Krankheit ausgegangen wird. Die WHO-Disablement-Scale (WHO-DS) entspricht ebenfalls der Achse V der ICD-10 und umfasst als Globaleinschätzung die Selbstfürsorge, Alltagsbewältigung, berufliche und familiäre Funktionsfähigkeit, wobei in jedem Bereich 0 29 (keine Beeinträchtigung) bis 4 (sehr starke Beeinträchtigung) Punkte erreicht werden können (Höchstwert der Gesamtsumme = 20). Clinical Global Impression Scale (CGI-BP) Die Clinical Global Impression-Skala (CGI) stellt ein störungsübergreifendes Verfahren zur klinischen Fremdbeurteilung des Schweregrades der Erkrankung dar. Dafür steht eine 7-stufige Antwortskala zur Verfügung von 1 = “nicht krank“ bis 7 = „extrem schwer krank“. In der Originalfassung der Skala wird in einem zweiten Item die Zustandsänderung nach einer Behandlung und in einem dritten Item ein Wirksamkeits-Index ermittelt. Da es uns um die Beschreibung des aktuellen Zustandes ging, beurteilten wir nur den Schweregrad, allerdings getrennt nach Depression, Manie und Gesamteindruck entsprechend den klinischen Ausprägungen einer bipolaren Störung (CGI-BP). Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D) Die 1960 von Max Hamilton publizierte “Hamilton-Depression-Rating-Scale” (HAM-D) ist bis dato das weltweit meist verwendete psychometrische Bewertungsverfahren für depressive Syndrome (Hamilton, 1960). Der Untersucher bewertet gemäß seines klinischen Eindrucks anhand eigen- und fremdanamnestischer Angaben 17 bzw. 21 klinische Symptombereiche, die sich auf den Zeitraum der letzten Woche beziehen. Alle Items sind dabei drei- bis fünfstufig skaliert, d.h. bei 8 Items werden bis 2, bei den übrigen 9 Items 0 bis 4 Punkte vergeben (HAM-D 17); der höchste zu erreichende Wert liegt bei 54. Ein oft angewandter Cut-Off-Score (z.B. Diagnose einer schweren Depression bei mehr als 25 Punkten) ist bedingt empfehlenswert, da die HAM-D vor allem änderungssensitiv konzipiert worden ist. Wir verwendeten die HAM-D zur orientierenden Einschätzung des Schweregrades bzw. zum Ausschluss einer aktuell vorliegenden schweren depressiven Episode. 30 Young Mania Rating Scale (YMRS) Die 1978 von R.C. Young entwickelte “Young Mania Rating Scale” (YMRS) gilt als “Goldstandard” in der Psychometrie der Manie (Young et al., 1978). Der Untersucher bewertet dabei gemäß seines klinischen Eindrucks 11 Items bezogen auf die vergangene Woche. Die Items werden fünfstufig mit 0 bis 4 Punkten, jeweils einfach (gehobene Stimmung, motorische Aktivität, sexuelle Aktivität, Schlafverhalten, formaler Gedankengang, äußeres Erscheinungsbild, Krankheitseinsicht) oder doppelt (Irritabilität, Sprechweise, Denkinhalte, Anspannung) gewertet. Bei maximal 60 möglichen Punkten gelten mehr als 20 Punkte als Hinweis auf eine manische Symptomatik. Reliabilität und Validität des Verfahrens sind gut untersucht. Uns diente die YMRS zum Ausschluss einer aktuell vorliegenden manischen Episode. 2.2.3. Posttraumatic Stress Diagnostic Scale (PDS) Die 4-teilige Posttraumatic Stress Diagnostic Scale (PDS) spiegelt die DSM-IVDiagnosekriterien für eine PTBS in Form eines Selbst - Ratings wider. Dabei wird dem Probanden zuerst eine Life Events-Checkliste vorgelegt, auf der selbst oder als Zeuge - erlebte belastende Ereignisse markiert werden (Teil 1). Die weiteren Fragen beziehen sich immer auf das als am Schlimmsten empfundene Erlebnis; Teil 2 des Ratings überprüft, ob der Begriff des Traumas erfüllt wurde. Teil 3 sondiert in 17 Fragen gezielt die PTBS-Symptomatik (Wiedererleben, Vermeidung, Hypervigilanz), wobei als Zeitrahmen der letzte Monat gefasst wird. Da wir uns vor allem mit länger zurückliegenden Traumatisierungen konfrontiert sahen, bezogen wir uns auf einen einmonatigen Zeitraum direkt nach der Traumatisierung bzw. auf den Monat der stärksten Symptomausprägung. Pro Frage wurden 0 („überhaupt nicht oder nur einmal im Monat“) bis 3 („5 mal oder öfter pro Woche/fast immer“) Punkte vergeben. Symptomdauer (gefordert zur Diagnose PTBS: 1 Monat oder länger) und –beginn wurden zusammenfassend erfragt. In Teil 4 der PDS wird die berufliche und soziale Funktionsbeeinträchtigung durch die PTBS-Symptomatik beurteilt. 31 Neben der abschließenden Diagnose (PTSD ja/nein) floss auch die Symptomanzahl sowie die Symptomschwere – basierend auf dem erreichten Häufigkeitsscore – in die Auswertung ein. 2.2.4 Clinician Administered PTSD Scale (CAPS) Die CAPS ist ein halbstrukturiertes, klinisches Interview, das die 17 im DSM-IV beschriebenen Symptome der Posttraumatischen Belastungsstörung sowie 5 assoziierte Merkmale (z.B. Schuldgefühle im Sinne des „survivor guilt“) erfasst. In einer Reihe psychometrischer Studien hat sich die CAPS als verlässliches Instrument in Bezug auf Interraterreliabilität, Retestreliabilität und interner Konsistenz erwiesen und gilt als validestes Messinstrument der PTBS. Das Interview ist für verschiedene Zeitspannen nach dem Trauma konzipiert (letzte Woche/ letzter Monat/ Lebenszeit) und beinhaltet folgende Komponenten: Kriterium A = Erfassung von Lebensereignissen bzw. traumatischen Erfahrungen Kriterium B (Items 1-5) = Wiedererleben des Traumas Kriterium C (Items 6-12) = Vermeidung und Affektverflachung Kriterium D (Items 13-17) = anhaltend erhöhtes Erregungsniveau Kriterium E (Item 18) = Dauer der Störung Kriterium F (Item 19) = Belastung durch die Symptomatik Globale Ratings (Items 20-25) = Gesamtvalidität, Gesamtschwere, berufliche und soziale Funktionsfähigkeit Assoziierte Merkmale (Items 26-30) = Schuldgefühle, Wirklichkeitsverlust, Depersonalisation. Zusätzlich zur Erfassung der Symptomhäufigkeit auf einer 5-Punkte-Skala (von 0=nie bis zu 4=täglich) bietet die CAPS auch die Erfassung der Symptomintensität bzw. des Schweregrades der Beeinträchtigung, ebenfalls auf einer 5Punkte-Skala kodiert. Wenn die Symptomhäufigkeit mit „0“ beurteilt wird, so wird das Intensitätsrating unterlassen und ebenfalls mit „0“ kodiert. Von den 9 32 möglichen Auswertungsvarianten entschieden wir uns für die dichotome, am DSM-IV orientierte Auswertung (Kriterium vorhanden: Ja/Nein). Danach gilt ein PTBS-Symptom als erfüllt bei einem Häufigkeitswert ≥1 und einem gleichzeitigen Intensitätswert von ≥2. Die Diagnose PTBS wird gestellt, wenn alle Kriterien A-F zutreffen. In Ergänzung zur zweiwertigen Auswertung wird geprüft, in welche der folgenden Kategorien der Summenrohwert fällt: 0-19: Minimale Ausprägung: Keine oder nur einzelne PTBS – Symptome 20-39: Leichte PTBS: nicht krankheitswertig ausgeprägt 40-59: Mittlere PTBS: krankheitswertig ausgeprägt 60-79: Schwere PTBS-Symptomatik 80-136: Extrem schwere PTBS-Symptomatik Die CAPS ist im Gegensatz zur PDS ein Fremdrating-Instrument. Wir führten die CAPS bei den Patienten durch, die in der PDS als positiv für eine PTBS getestet worden waren, um die Diagnose zu sichern und eine genauere Einschätzung des Schweregrades zu erlangen. Dabei unterschieden wir die aktuelle Symptomatik (Zeitraum: letzter Monat vor dem Interview) und die Lebenszeitdiagnose PTBS. 33 2.3. Statistik Für die statistischen Berechnungen verwendeten wir das Statistical Package for Social Sciences Version 15.0 (SPSS, Chicago Illinois, 60606). Die Analysen wurden für 3 getrennte Gruppen durchgeführt. Die erste Gruppe beinhaltete alle Patienten mit bipolarer Störung ohne Trauma in Bezugnahme auf die PDS (BD-). Patienten mit Angabe eines Traumas, aber ohne die Diagnose PTBS wurden der zweiten Gruppe zugeordnet (BP+). Die dritte Gruppe bildeten die bipolaren Patienten mit der Diagnose PTBS (BP+P). Sämtliche eingeschlossenen Patienten wurden mittels PDS auf eine PTBS gescreent und im Falle eines positiven Ergebnisses einer weiteren Befragung durch die CAPS unterzogen. Alle Kategorien wurden auf Normalverteilung getestet, und die Varianzenkonsistenz wurde mittels Levene´s Test überprüft. Die kategorialen Variablen aller analysierten Gruppen verglichen wir mit dem Kruskal-Wallis-Test. Der Vergleich von fortlaufenden Variablen in den 3 Gruppen erfolgte mit einer one-wayanalysis of variance (ANOVA) mit einem two-tailed post hoc mean comparison test (Newmann Keuls and Scheffée Test). Wir beschrieben signifikante Ergebnisse mit einem kritischen Wert von p<0,05. 34 III. ERGEBNISSE Insgesamt wurden 74 Patienten in die Studie aufgenommen, davon 30 Männer (41%) und 44 Frauen (59%), die alle die genannten Einschlusskriterien erfüllten. Das Durchschnittsalter lag bei 48,3 (±13,8) Jahren mit einer Altersspanne von 20 bis 82 Jahren. Ein Patient lehnte die Einwilligung ohne Angabe von Gründen ab. 4 Patienten mit einer PTBS - Lebenszeit - Diagnose nach PDS verweigerten das CAPSInterview. Sie wurden als Drop-outs eingestuft und die erhobenen Daten flossen nicht in die statistische Berechnung ein. 3.1 Demographische Basisdaten Nahezu alle Patienten waren deutscher Staatsangehörigkeit (n=73) und Kaukasier. 12,1% der Herkunftsfamilien der Patienten hatten einen Migrationshintergrund. Bezüglich des Bildungsstandes gab es keine Unterschiede zwischen nichttraumatisierten, traumatisierten und PTBS-positiven bipolaren Patienten. 40,5% der Patienten waren verheiratet (n=30) und die Mehrheit der Patienten war arbeitslos (n=46; 62,2%). Es gab keine weiteren statistisch relevanten Unterschiede zwischen den 3 untersuchten Gruppen mit Ausnahme der mittleren Anzahl von Geschwistern. Bipolare Patienten mit PTBS hatten signifikant mehr Geschwister (2,7 im Mittel, SD±1,6, p=0,003) als die Gruppen der nichttraumatisierten und traumatisierten Patienten (1,2±0,9, bzw. 1,5±1,3) (Tabelle 3). 35 Tab.3: Demographische Basisdaten bipolarer Patienten ohne Trauma (BD-), mit Trauma (BD+) und mit Trauma und PTBS (BD+P) nach Diagnose mit PDS Alter (Jahre), SD Kinder (Durchschnitt), SD Geschwister (Durchschnitt), SD *1 Geschlecht (Männer/Frauen) Nationalität (Deutsch/andere) Schulbildung (Hauptschule/ Realschule/Abitur) Berufsausbildung (keine/Lehre/Studium) Erwerbstätigkeit (nein/ja) Familienstand (ledig/verheiratet/ geschieden/verwitwet) Partnerschaft (nein/ja) Body Mass Index (Durchschnitt), SD BD- (N=37) BD+ (N=22) BD+P (N=15) 51,4±14,0 45,0±13,0 45,8±12,5 Signifikanzniveau n.s. 1,1±1,0 1,2±1,8 1,1±1,4 n.s. 1,5±1,3 1,2±0,9 2,7±1,6 18/19 7/15 5/10 F=6,239 df=73 p=0,003 n.s. 37/0 21/1 15/0 n.s. 11/4/22 3/3/16 2/7/6 n.s. 1/26/10 1/12/9 0/12/3 n.s. 25/12 13/9 8/7 n.s. 10/19/7/1 9/6/6/1 4/5/5/1 n.s. 12/25 12/10 5/10 n.s. 26,9 28,2 27,5 n.s. *1: Statistisch signifikante Variablen nach Diagnose mit CAPS Geschwister (Durchschnitt), SD BD- (N=37) BD+ (N=22) BD+P (N=9) 1,5±1,3 1,2±0,8 3,0±1,6 Signifikanzniveau F=4,714,df=73 p=0,005 3.2 Art des Traumas 37 von 74 Patienten (50% aller bipolaren Patienten) gaben ein der PDS-lifeevent-Skala entsprechendes Trauma an (12 Männer, 25 Frauen), wobei 15 Patienten die Kriterien für eine Lebenszeit - PTBS nach PDS erfüllten (41% der Patienten mit Angabe eines Traumas). Die mittlere Anzahl von Traumata zeigte keine statistischen Unterschiede zwischen der Gruppe BD+ (2,18±1,18) und der Gruppe BD+P (2,33±1,23). Im Vergleich der Art des Traumas innerhalb der Gruppe traumatisierter Patienten ohne PTBS zu den Patienten mit PTBS deckten wir ein signifikant höheres Risiko für sexuelle Übergriffe durch Familienmit36 glieder oder Bekannte (χ=6,546, df=1, p=0,011) oder andere Traumata (χ=5,727, df=1, p=0,017) in der PTBS-Gruppe auf. 4 Patienten mit PTBSLebenszeit-Diagnose nach PDS verweigerten die weitere Teilnahme am CAPSInterview. Zusammenfassend erfüllten 9 von 11 Patienten (81%) mit PTBS gemäß PDS die CAPS-Kriterien für eine PTBS-Lebenszeit-Diagnose. Die Gesamtprävalenz einer Lebenszeit-PTBS in dieser Kohorte von Bipolar I-Patienten war 20% unter Verwendung der PDS und 12% unter Verwendung der CAPS. Es gab keine statistisch signifikanten Unterschiede bezüglich anderer ausgewerteter Variablen zwischen den Gruppen BD+ und BD-. Im Falle statistisch signifikanter, durch die PDS gewonnener Resultate, erreichten wir mit der CAPS ebenfalls signifikante Ergebnisse, obwohl 4 Patienten ausschieden und 2 Patienten gemäß CAPS keine PTBS aufwiesen (Tabelle 4). Tab.4: Art des Traumas bei bipolaren Patienten mit Trauma (BD+) und mit Trauma und PTBS (BD+P) nach Diagnose mit PDS Art des Traumas Schwerer Unfall (ja/nein) Naturkatastrophe (ja/nein) Zeuge schwerer Verletzung anderer (ja/nein) Körperlicher Angriff durch Verwandte/n (ja/nein) Sexueller Übergriff durch Verwandte/n oder Bekannte/n (ja/nein) *2 Sexueller Übergriff durch Fremde/n (ja/nein) Tod oder Trennung von sehr nahe stehender Person (ja/nein) Anderes Trauma (ja/nein) *2 BD+ (N=22) 8/14 BD+P (N=15) 4/11 Signifikanzniveau n.s. 1/21 1/14 n.s. 9/13 4/11 n.s. 5/17 7/8 n.s. 3/19 8/7 χ=6,546 df=1 p=0,011 7/15 5/10 8/14 6/9 7/15 0/15 χ=5,727 df=1 p=0,017 37 *2: Statistisch signifikante Variablen nach Diagnose mit CAPS Art des Traumas Sexueller Übergriff durch Verwandte/n oder Bekannten/n (ja/nein) Anderes Trauma (ja/nein) BD+ (N=22) 3/19 BD+P (N=9) 6/3 7/15 0/9 Signifikanzniveau χ=8,437 df=1 p=0,004 n.s. (p=0,058) 3.3 Soziale Basisdaten Der größte Teil der Patienten war bei den Eltern aufgewachsen (n=69; 93%). Die sozialen Charakteristika zeigten signifikante Unterschiede zwischen BDund BD+ auf der einen Seite und BD+P auf der anderen. 8 von 15 Patienten (53%) mit PTBS (χ=6,993, df=2, p=0,03) hatten mindestens ein alkoholabhängiges Elternteil verglichen mit 6 von 37 (16%) der BD- Patienten und 7 von 22 (31,8%) der BD+ Patienten. Darüber hinaus erfuhren bipolare Patienten mit komorbider PTBS (χ=11,897, df=2, p=0,003) signifikant häufiger schwere körperliche Gewalt durch die Eltern als jene in den Vergleichsgruppen. Ebenso war die emotionale Vernachlässigung durch die Eltern signifikant häufiger (χ=13,498, df=2, p=0,001) in der Gruppe BD+P (9 von 15 Patienten, 60%) im Vergleich zu BD- (4 von 37 Patienten, 11%) und BD+ (5 von 22 Patienten, 23%). Alle anderen psychosozialen Charakteristika zeigten keine relevanten Unterschiede. 20% der Patienten hatten eine/n Verwandte/n ersten Grades mit der Diagnose Bipolare Störung (Tabelle 5). 38 Tab.5: Soziale Basisdaten von bipolaren Patienten ohne Trauma (BD-), mit Trauma (BD+) und mit Trauma und PTBS (BD+P) nach Diagnose mit PDS Alkoholabhängigkeit der Eltern (ja/nein) *3 Ort des Aufwachsens (Eltern/andere Familienmitglieder/Heim/Pflegefamilie) Abstammung der Eltern (deutsch/anderes) Beruf des Vaters (arbeitslos/ungelernter Arbeiter/Lehrberuf/Akademiker) Beruf der Mutter (arbeitslos/ungelernte Arbeiterin/Lehrberuf/Akademikerin) Psychiatrische Erkrankungen in der Familie (keine/Angehörige1.Grades/ Angehörige 2.Grades) Verwandte mit bipolarer Störung (keine/Angehörige 1.Grades/ Angehörige 2.Grades) Eltern geschieden (ja/nein) Körperliche Gewalt durch die Eltern (nein/leicht/schwer) *3 Vernachlässigung durch die Eltern (ja/nein) *3 BD(N=37) 6/30 BD+ (N=22) 7/15 BD+P (N=15) 8/7 Signifikanzniveau 34/0/2/1 21/1/0/0 14/0/1/0 χ=6,993 df=2 p=0,03 n.s. 32/5 19/3 14/1 n.s. 0/3/24/9 0/1/15/6 1/1/12/1 n.s. 17/5/12/2 8/4/9/1 11/0/4/0 n.s. 17/15/5 10/10/2 2/13/0 n.s. 28/5/3 15/5/2 10/5/0 n.s. 4/32 3/19 5/10 n.s. 26/10/0 11/8/3 5/3/7 4/32 5/17 9/6 χ=11,897 df=2 p=0,003 χ=13,498 df=2 p=0,001 *3: Statistisch signifikante Variablen nach Diagnose mit CAPS Alkoholabhängigkeit der Eltern (ja/nein) Körperliche Gewalt durch die Eltern (nein/leicht/schwer) Vernachlässigung durch die Eltern (ja/nein) BD(N=37) 6/30 BD+ (N=22) 7/15 BD+P (N=9) 3/6 26/10/0 11/8/3 2/2/5 4/32 5/17 2/7 Signifikanzniveau χ=8,918 df=2 p=0,012 χ=13,212 df=2 p=0,001 χ=17,365 df=2 p=0,000 39 3.4 Klinische Basisdaten Klinische Daten der 3 Gruppen sind in Tabelle 6 zusammengefasst. Gegensätzlich zu unserer Eingangshypothese korrelierte der Krankheitsverlauf der Bipolaren Störung in allen analysierten Gruppen statistisch nicht signifikant mit Trauma oder PTBS, mit Ausnahme von der Schwere einer akuten Depression, dem PDS-Grading und dem Punktwert in der Clinical Global Functioning Scale. Der HAMD-Punktwert in der Gruppe BD+P war signifikant höher (16,6±10,4, F=7,853, p=0,001) als in den beiden anderen Patientengruppen, was auf einen schwereren Grad der Depression bei den bipolaren Patienten mit PTBS schließen lässt. Korrespondierend mit diesen Ergebnissen war der GAF-Punktwert signifikant niedriger in der Gruppe BD+P (60±11,5, F=3,317, p=0,042) im Vergleich zu beiden anderen Gruppen (BD-, 72±17,5, BD+, 68±13,7) als Hinweis auf ein geringeres psychosoziales Funktionsniveau (Abbildung 2). Es zeigte sich keine relevante Beeinflussung der Variablen „Körperliche Erkrankungen“ und „Drogenmissbrauch“ im Gruppenvergleich, wie auch nicht für die Anzahl eingenommener Psychopharmaka, Elektrokonvulsionstherapie, Psychotherapie oder Compliance der Patienten. Zudem unterschieden sich die Punktwerte von CGI-BD und Subkategorien nicht signifikant in den Gruppen (Tab.6). Tab.6: Klinische Basisdaten von bipolaren Patienten ohne Trauma (BD-), mit Trauma (BD+) und mit Trauma und PTBS (BD+P) nach Diagnose mit PDS. Wenn nicht anders angegeben, Mittelwerte±Standardabweichung. BD(N=37) BD+ (N=22) BD+P (N=15) Signifikanzniveau YMRS HAMD-21 5,0±6,1 7,7±6,4 4,6±4,5 9,6±6,2 3,7±3,1 16,6±10,4 Alter bei psychiatrischer Erstdiagnose in Jahren Alter bei Diagnose Bipolar in Jahren Anzahl stationärer Klinikaufenthalte Dauer stationärer Klinikaufenthalte in Wochen Dauer letzte Episode in Wochen Anzahl manischer Episoden Anzahl depressiver Episoden Anzahl Suizidversuche Anzahl verschiedener aktueller psychiatrischer Medikamente 36,3±13,7 31,1±11,7 32,6±13,3 n.s. F=7,853 df=73 p=0,001 n.s. 42,5±14,9 34,6±11,1 43,2±12,1 n.s. 4,8±5,3 5,3±4,7 5,3±7,5 n.s. 32,4±31,5 50,8±54,9 37,2±32,9 n.s. 11,1±9,7 6,1±6,7 9,4±11,7 0,65±0,9 2,4±1,1 13,0±16,1 8,3±8,1 11,0±8,2 0,82±1,0 2,0±0,7 14,6±10,5 9,4±10,9 14,4±12,9 1,27±1,9 2,9±1,7 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 40 Überzeugung von Wirksamkeit der Medikation (ja/nein) CGI-BP Depression CGI-BP Manie CGI-BP gesamt GAF *4 27/10 18/4 12/3 n.s. 1,8±1,3 1,7±1,3 2,2±1,5 72±17,5 1,5±0,8 1,3±1,0 1,9±1,1 68±13,7 2,3±1,7 1,7±0,6 2,1±1,7 60±11,5 WHO Disablement Scale Art der letzten Episode (Manie/Depression/gemischt) Psychiatrische Erstdiagnose (Bipolar/Depression/andere) Weitere psychiatrische Diagnosen (ja/nein) Drogenabusus in der Vergangenheit (ja/nein) Neurologische Erkrankungen (ja/nein) Stoffwechselerkrankungen (ja/nein) Andere chronische Krankheiten (ja/nein) Nikotinabusus (nein/ <20/d/ ≥20/d) Alkoholabusus (nein/sporadisch/täglich) Aktueller Drogenabusus (ja/nein) Psychotherapie (ja/nein) Elektrokrampftherapie (ja/nein) Regelmäßige Medikamenteneinnahme (ja/nein) PDS-Grading (leicht/mäßig/ Mäßig bis schwer/schwer) *4 8,5±4,9 15/18/4 10,3±4,7 7/9/6 12±4,9 3/11/1 n.s. n.s. n.s. F=3,317 df=73 p=0,042 n.s. n.s. 14/12/10 7/6/9 1/10/4 n.s. 3/34 3/19 4/11 n.s. 4/33 2/20 3/12 n.s. 0/37 1/21 1/14 n.s. 9/28 5/17 5/10 n.s. 10/27 8/14 4/11 n.s. 16/13/8 15/17/5 9/7/6 7/15/0 6/5/4 6/7/2 n.s. n.s. 1/36 23/13 3/33 33/4 0/22 15/7 1/21 20/2 0/15 13/2 1/14 13/2 n.s. n.s. n.s. n.s. 5/12/3/2 0/3/8/4 2,18±1,18 4/4/2/12 2,33±1,23 4/1/5/5 χ=10,621 df=2 p=0,001 n.s. n.s. 14/8 10/5 n.s. Anzahl erlebter Traumata *4 Alter bei Traumabeginn (0-6 Jahre/ 7-12 Jahre/13-18 Jahre/ >18 Jahre) Dauer des traumatischen Ereignisses (einmalig/mehrfach) *4: Variablen bei Diagnose mit CAPS BD(N=37) BD+ (N=22) BD+P (N=9) Signifikanzniveau HAMD-21 7,6±6,4 9,5±6,2 15,7±9,8 GAF 72±17,5 68±13,7 60±11,5 PDS-Grading (leicht/mäßig/ mäßig bis schwer/schwer) 5/12/3/2 0/1/5/3 Anzahl erlebter Traumata 2,18±1,18 2,66±1,4 F=5,274 df=73 p=0,005 F=2,687 df=73 p=0,053 χ=9,571 df=1 p=0,002 n.s. 41 Abb. 2: Ausgewählte Variablen bipolarer Patienten (BD) ohne Traumaerfahrung, mit Traumaerfahrung und mit PTBS 42 IV. DISKUSSION Nach unserem Wissen ist dies die erste veröffentlichte Studie zur Prävalenzrate von PTBS in einer Auswahl europäischer bzw. deutscher Patienten mit bipolar affektiver Störung. Als Folge des Studiendesigns und der speziellen Charakteristika besteht die aktuelle Stichprobe aus einer homogenen Studienpopulation und die Untersuchung folgt strengen Einschluss- und Ausschlusskriterien. Weiterhin ist dies die erste veröffentlichte Untersuchung, die drei verschiedene Gruppen von bipolaren Patienten vergleicht; die erste ohne Traumaerfahrung (BD-), die zweite mit Trauma ohne Diagnose einer PTBS (BD+) und die dritte Gruppe mit der eindeutigen Diagnose einer Posttraumatischen Belastungsstörung (BD+P), gesichert durch PDS und CAPS. Die Einteilung wurde vorgenommen, um prädisponierende bzw. protektive Faktoren für die Entwicklung einer PTBS nach Traumatisierung bei bipolaren Patienten zu erkennen. Wir fanden mit Ausnahme der Geschwisteranzahl keine statistischen Unterschiede bezüglich der soziodemographischen Basisdaten in den drei Gruppen und ermittelten zwei Personen, deren PTBS-Diagnose laut PDS durch die CAPS nicht bestätigt wurde, was ein Ergebnis der auch in der Literatur genannten Überbewertung von PTBS durch die PDS ist (Griffin et al., 2004). Dies war zu erwarten, da das CAPS-Interview auf der Angabe von Häufigkeit und Intensität der Symptome beruht, wogegen die PDS auf einer einfachen Zustimmung zu dargestellten Symptomen basiert. Des Weiteren erfolgt die CAPS durch die klinische Beurteilung von einem geschulten Interviewer. Zusammenfassend hat die PDS eine höhere Sensitivität bei geringerer Spezifität verglichen mit der CAPS (Griffin et al., 2004). Die bisherigen Studien erfassen eine größere Heterogenität hinsichtlich der Rasse in ihren Stichproben und veranschaulichen beispielsweise ein erhöhtes Risiko für PTBS unter den farbigen amerikanischen Erwachsenen mit bipolarer Störung (Goldberg and Garno, 2005). In der vorliegenden Studie war es uns möglich, eine ethnische Inhomogenität als Störvariable auszuschließen. Diese Untersuchung unterscheidet sich grundlegend von den bisher veröffentlichten amerikanischen Erhebungen. Die Prävalenz einer Lebenszeit-PTBS lag in unserer Studie bei 20% nach PDS und bei 12% nach Korrektur durch die CAPS, was mit den Forschungsergeb43 nissen in der amerikanischen Bevölkerung übereinstimmt (Otto et al., 2004). PTBS war in unserer Stichprobe doppelt so häufig wie die zu erwartende angegebene Lebenszeit-Prävalenzrate von PTBS in der Allgemeinbevölkerung (Kessler et al., 1995). Trotzdem wurde laut Patientenakten bei keinem unserer Patienten zuvor die Diagnose PTBS gestellt, was den Ergebnissen früherer Studien entspricht. Mueser et al. führten eine Studie mit schwer psychisch kranken (schizophrenen, bipolaren, borderlinegestörten) Patienten durch und fanden eine Lebenszeit-PTBS von 2% entsprechend der Krankenakten, aber bei 43% eine gegenwärtige PTBS (Mueser et al., 1998). Darüber hinaus lag die Lebenszeit-Exposition gegenüber mindestens einem traumatischen Ereignis in unserer Population bei 50%, was sich mit anderen Studien deckt (Goldberg and Garno, 2005, Otto et al., 2004), und entspricht einer ähnlichen Traumahäufigkeit wie in der Allgemeinbevölkerung (Kessler et al., 1995, Otto et al., 2004). Die Diskrepanz zwischen der vergleichbaren, zu erwartenden Traumarate einerseits und der höheren PTBS-Prävalenz bei Patienten mit bipolarer Störung andererseits deutet auf eine besondere Vulnerabilität bipolarer Patienten für eine Traumaexposition hin. In der vorliegenden Studie konnten wir in Anlehnung an die PDS acht Traumamodi unterscheiden. Bemerkenswerterweise bezogen sich 50% aller Traumaarten auf körperliche Gewalt oder sexuelle Übergriffe. Mittels des strukturierten Interviews minimierten wir eine Erinnerungsverzerrung bei Missbrauch in der Vergangenheit oder eine zu niedrige Angabe sexuellen Missbrauchs bei männlichen Probanden. Belastungen durch Traumata und traumatischen Stress scheinen eine erhöhte Anfälligkeit für Depression oder PTBS zu erzeugen (Goldberg and Garno, 2005, Shalev et al., 1998). Im Vergleich zu den anderen Gruppen fanden wir in der Gruppe BD+P signifikant höhere Werte für Depressivität. Diese Ergebnisse unterstützen die Hypothese, dass die Lebenszeitdiagnose einer PTBS, jedoch nicht das angegebene Trauma an sich, den klinischen Verlauf einer bipolaren Störung verschlechtert. Bisherige Studien mit bipolaren Patienten fanden einen Zusammenhang zwischen komorbider PTBS und einer erhöhten Anzahl manischer oder depressiver Episoden, häufigerer Selbstmordversuche, einer erhöhten Rate zusätzlicher psychiatrischer oder somatischer Störungen, und einer höheren Inzidenz von Alkohol- oder Drogenmissbrauch (Brown et al., 2005, Garno et al., 2005, Lev44 erich et al., 2002). Im Gegensatz dazu hat unsere Untersuchung diese Ergebnisse nicht bestätigen können, wenngleich der Eindruck entsteht, dass bei höherer Fallzahl ein solches Ergebnis herausgearbeitet werden könnte. In unserer homogenen Stichprobe hatte eine PTBS keinen signifikanten Einfluss auf diese Variablen, bemerkenswerterweise jedoch auf die gegenwärtige klinische Symptomatik und die Schwere der bipolaren Störung. Dementsprechend deuten ein signifikant höherer Level depressiver Symptome, ein niedrigeres psychosoziales Funktionsniveau und eine höhere Bewertung von PDS-Symptomen auf einen schlechteren klinischen Verlauf bei bipolaren Patienten mit PTBS hin. Simon et al. beschrieben gleichermaßen ein erniedrigtes soziales Funktionsniveau als Einflussvariable für die Schwere der bipolaren Erkrankung (Simon et al., 2004). In neueren Studien bestand für bipolare Patienten mit PTBS-LebenszeitDiagnose eine höhere Wahrscheinlichkeit einer Suchterkrankung, und im Vergleich zu bipolaren Patienten ohne PTBS hatten sie eine erhöhte Selbstmordversuchrate (Dilsaver et al., 2007, Simon et al., 2004). Unsere Daten bestätigen die Annahme einer erhöhten Selbstmordversuch- oder Drogenmissbrauchsrate hingegen nicht. Nur 1 % unserer Kohorte nahm aktuell Drogen, 12 % nahm Drogen in der Vergangenheit. Im Gegensatz dazu gaben bis zu 61 % der Bipolar I-Patienten in amerikanischen Kohorten komorbiden Drogenmissbrauch an (Regier et al., 1990), was möglicherweise auf differierende Rekrutierungs- und Bewertungsmethoden zurückzuführen ist. In früheren Untersuchungen steht ein schlechtes funktionales Ergebnis im Zusammenhang mit Drogensucht oder Angststörungen (Simon et al., 2004). Wir wiesen eine signifikante positive Korrelation zwischen einer Alkoholabhängigkeit bei den Eltern der Patienten und der Lebenszeitdiagnose einer PTBS bei den Patienten selbst nach. Angesichts dieses Befundes interpretierten wir elterliche Alkoholabhängigkeit als Vulnerabilitätsfaktor für eine erhöhte Traumaexposition bei bipolaren Patienten. Darüber hinaus hatten die BD+P-Testpersonen signifikant mehr schwere körperliche Gewalt und mehr emotionale Vernachlässigung durch die Eltern erfahren. Man kann davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit von Traumatisierung in Familien mit einem alkoholabhängigen Elternteil höher ist (Brown et al., 2005, Hall and Webster, 2002, Thompson, 2007). 45 Ein neues Ergebnis unserer Studie war die Korrelation zwischen PTBS bei bipolaren Patienten und der Anzahl von Geschwistern. PTBS-Patienten hatten signifikant mehr Geschwister. Eine erhöhte Geschwisterzahl trägt möglicherweise zu einem emotional belastenderen Familienklima bei, was wiederum die Wahrscheinlichkeit einer Traumatisierung erhöhen könnte (Hoffmann, 2006). Die vorliegende Studie zeigte keine erhöhte Traumatisierungsrate bei BD+PPatienten, was sie von bisherigen Studien unterscheidet. Allerdings beziehen sich die meisten Studien nicht auf diese Frage. Mueser et al. beschrieben eine durchschnittliche Rate von 3,5 verschiedenen Traumata (Leverich and Post, 2006, Leverich et al., 2002, Mueser et al., 1998). Fast die Hälfte der angegebenen traumatischen Erfahrungen hatte sich in der Kindheit zugetragen (BD+ 45%, BD+P 66%) und stand am häufigsten mit Familienmitgliedern in Beziehung, wie körperlicher Angriff oder sexueller Übergriff (BD+ 40%, BD+P 46%). Überdies wird PTBS mit neurobiologischen Langzeitveränderungen assoziiert (Bremner et al., 2008, Nutt and Malizia, 2004), und die derzeitige Forschung stellt eine hohe Komorbidität zwischen PTBS und anderen psychiatrischen Störungen heraus (Neria et al., 2006). Psychische Störungen sind bei Patienten mit PTBS häufiger assoziiert als bei Patienten ohne PTBS, 80% vs. 30% (Mueser et al., 1998). Möglicherweise tragen Trauma und PTBS, besonders im jungen Alter, zu einer Anfälligkeit für die Manifestation einer komorbiden psychiatrischen Störung bei. Auf der anderen Seite könnten Menschen mit einer psychiatrischen Erkrankung anfälliger für die Entwicklung einer PTBS nach traumatischen Erfahrungen sein. Unsere Ergebnisse leisten zu dieser These keinen Beitrag, da die Rate psychischer Störungen bei den PTBS-Patienten nicht erhöht war. Im Gegensatz zu unseren Ergebnissen wurde in einer Studie der Nachweis erbracht, dass komorbide PTBS zu einem früheren Erkrankungsalter bei bipolaren Patienten beiträgt, was mit einem schwereren Krankheitsverlauf einhergeht (Leverich et al., 2002). Dies wurde jedoch in einer anderen Untersuchung nicht repliziert, was unseren Ergebnissen entspricht (Brown et al., 2005). Eine Beschränkung unserer Studie war die kleine Stichprobengröße verglichen mit der publizierten Meta-Analyse (Otto et al., 2004). Bisherige Studien mit ähnlich engen Einschluss- und Ausschlusskriterien und vergleichbarem Studiendesign erfassen aber gleich große Stichproben (Goldberg and Garno, 2005). Wir un46 tersuchten eine klinische Stichprobe bereits behandelter bipolarer Patienten im Gegensatz zu einer Zufallsstichprobe in der Bevölkerung, was die allgemeinen Schlussfolgerungen in Bezug auf die Prävalenzraten von Trauma und PTBS begrenzt. Dieses Phänomen ist durch den sogenannten Berkson-Bias (Berkson, 1946) beschrieben, der auf die Gefahr der Überrepräsentation von Patienten mit Komorbidität in klinischen Stichproben hinweist. Im Gegensatz dazu unterschied die rekrutierte Stichprobe sich nicht statistisch signifikant bezüglich Komorbidität innerhalb der drei analysierten Gruppen. Eine weitere Limitierung unserer Studie war die retrospektive Bewertung von traumatischen Erfahrungen in einem Querschnittsstudiendesign, welches es nicht erlaubt, eine Kausalität herzustellen. Es muss bemerkt werden, dass ein methodischer Ansatz, der rückblickende Berichte von Traumata verwendet, für die Genauigkeit der Erfassung weniger vorteilhaft sein könnte, obwohl Längsschnittstudien mit PDS oder CAPS als standardisierte Messinstrumente insgesamt eine gute Reliabilität bei der Bewertung von Traumaereignissen gezeigt haben (Goodman et al., 1999). Es bedarf weiterer klinischer Studien, um klinische Einflussvariablen auf die PTBS und protektive psychosoziale und pharmakologische Faktoren hinsichtlich der Komorbidität mit bipolarer Störung auszumachen. Eine gezielte und frühzeitige Behandlung der PTBS könnte sich beispielsweise auf den Krankheitsverlauf einer später auftretenden psychiatrischen Erkrankung positiv auswirken. Durch den erfassenden, nicht bewertenden Charakter der vorliegenden Arbeit lassen sich jedoch Ursache und Wirkung nicht festlegen. 47 V. ZUSAMMENFASSUNG Zahlreiche epidemiologische Studien weisen auf den Zusammenhang zwischen psychiatrischen Erkrankungen und psychosozialen Bedingungen, Stress sowie traumatischen Erfahrungen hin. Im Allgemeinen werden diese Faktoren mit einem früheren Erkrankungsbeginn, höherer psychiatrischer Komorbidität, verstärktem Substanzmissbrauch, häufigeren Krankheitsphasen und vermehrt suizidalem Verhalten assoziiert. Das Ziel unserer Untersuchung war die Überprüfung der Hypothese einer höheren Rate Posttraumatischer Belastungsstörungen bei Patienten mit einer bipolar-affektiven Störung in einer deutschen Kohorte, sowie die Auswirkungen einer komorbiden PTBS auf den manischdepressiven Krankheitsverlauf. Im Gegensatz zu den bisherigen Studien aus den USA bestand unser Kollektiv aus bereits behandelten bipolaren Patienten und stellte zudem eine ethnisch homogene Gruppe dar. Zur Evaluation des Verlaufs und der Schwere der bipolaren Störung wurden neben der Anamnese psychometrische Testverfahren angewandt, um die Einhaltung von Ein- bzw. Ausschlusskriterien zu gewährleisten, insbesondere jedoch zur Objektivierung der Symptomschwere. Die Befragung zu traumatischen Erfahrungen erfolgte anhand der Verfahren PDS und CAPS, nach deren Auswertung wir die Diagnose einer PTBS stellten. Zur Analyse der gesammelten Daten teilten wir alle Patienten in drei Gruppen auf: Bipolare Patienten ohne Traumaerfahrungen, bipolare Patienten mit Traumaerfahrungen (jedoch ohne PTBS) und bipolare Patienten mit Trauma und komorbider PTBS. Die Auswertung zeigte mit Ausnahme der Geschwisterzahl bemerkenswerterweise keine relevanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen mit/ohne Trauma und ohne PTBS. Die Gruppe der Patienten mit komorbider PTBS dagegen unterschied sich in mehreren Punkten signifikant von den anderen beiden. So gab es keine statistischen Unterschiede bezüglich der soziodemographischen Basisdaten. Der Einfluss einer PTBS auf die klinischen Variablen, wie etwa die Phasenhäufigkeit, konnte nicht bestätigt werden. Jedoch zeigten die bipolar erkrankten Patienten mit PTBS deutlich höhere Depressionswerte, ein deutlich niedrigeres psychosoziales Funktionsniveau und eine stärkere Bewertung von PTBS-Symptomen, was die Hypothese eines schwereren Krankheitsverlaufes der bipolaren Störung anzeigt. 48 Bezüglich der Art des Traumas zeigte sich, dass etwa 50% der angegebenen Traumata in sexuellen Übergriffen durch Verwandte oder Bekannte, körperlicher Gewalt oder Vernachlässigung durch die Eltern bestanden, und damit größtenteils Kindheitserfahrungen darstellen. Hierbei bestätigt sich das hohe Risikopotential dieses Traumatyps (intendiert-interpersonell) zur Entwicklung einer PTBS. Weiterhin fand sich bei den PTBS-Patienten signifikant häufiger eine Alkoholabhängigkeit bei den Eltern sowie interessanterweise eine höhere Anzahl von Geschwistern. Es ist zu vermuten, dass diese Faktoren durch verstärkten familiären Stress die Wahrscheinlichkeit einer Traumaexposition erhöhen. Insgesamt war eine Posttraumatische Belastungsstörung in unserer Stichprobe doppelt so häufig wie die Lebenszeit-Prävalenz in der Allgemeinbevölkerung nach aktueller Studienlage. Angesichts dessen ist es alarmierend, dass bei keinem der teilnehmenden Patienten zuvor die Diagnose einer PTBS gestellt wurde. Hier besteht Forschungsbedarf, um eine gezieltere Behandlung und Krankheitsprophylaxe für bipolar erkrankte Menschen auf den Weg zu bringen. Da es sich um eine retrospektive Bewertung der Traumatisierung handelte, darf keine Kausalität hergestellt werden. Die Behandlung einer bestehenden komorbiden PTBS erscheint jedoch sinnvoll und würde sich wahrscheinlich positiv auf den Verlauf der bipolaren Störung auswirken. 49 VI. LITERATURVERZEICHNIS Akiskal, H. S. (1992). The distinctive mixed states of bipolar I, II, and III. Clin Neuropharmacol 15 Suppl 1 Pt A, 632A-633A Akiskal, H. S., Brieger, P., Mundt, C., Angst, J. and Marneros, A. (2002). [Temperament and affective disorders. The TEMPS-A Scale as a convergence of European and US-American concepts]. Nervenarzt 73, 262-271 American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed. American Psychiatric Association Washington DC Angst, J. (1966). Zur Ätiologie und Nosologie endogener depressiver Psychosen. Eine genetische, soziologische und klinische Studie. Springer Berlin Antonovsky, A. (1987). Salutogenese. Dt. Übersetzung 1997 von Antonovsky Unraveling the mystery of health. Hrsg. A. Franke. dgtv-Verlag Tübingen Arnold, O. H., Kryspin-Exner, K. (1965). Zur Frage der Beeinflussung des Verlaufs des manisch-depressiven Krankheitsgeschehens durch Antidepressiva. Wien Med Wochenschr 115, 929-934 Assion, H.-J., Vollmoeller, W. (2006). Handbuch Bipolare Störungen. Kohlhammer Stuttgart Assion, H.-J., Reinbold, H. (2007). Bipolaricum. PsychoGen Verlag Dortmund Baillarger, J. (1854). De la folie à double forme. Lecons faites à la Salpêtriere dans le semestre d´été de 1854. Ann Med Psychol 6, 369-391 Barrett, T. B., Hauger, R. L., Kennedy, J. L., Sadovnick, A. D., Remick, R. A., Keck, P. E., McElroy, S. L., Alexander, M., Shaw, S. H. and Kelsoe, J. R. (2003). Evidence that a single nucleotide polymorphism in the promoter of the G protein receptor kinase 3 gene is associated with bipolar disorder. Mol Psychiatry 8, 546-557 Berkson, S. (1946). Limitations of the application of fourfold table analysis to hospital data. Biometric Bulletin 2, 47-53 Bertelsen, A., Harvald, B. and Hauge, M. (1977). A Danish twin study of manicdepressive disorders. Br J Psychiatry 130, 330-351 50 Bremner, J. D., Elzinga, B., Schmahl, C. and Vermetten, E. (2008). Structural and functional plasticity of the human brain in posttraumatic stress disorder. Prog Brain Res 167, 171-186 Breslau, N., Davis, G. C., Andreski, P., Peterson, E. L. and Schultz, L. R. (1997). Sex differences in posttraumatic stress disorder. Arch Gen Psychiatry 54, 1044-1048 Brewin, C. (2003). Posttraumatic Stress Disorder: Malady or myth? Yale University Press New Haven Brieger, P., Ehrt, U., Roettig, S. and Marneros, A. (2002). Personality features of patients with mixed and pure manic episodes. Acta Psychiatr Scand 106, 179-182 Brown, G. R., McBride, L., Bauer, M. S. and Williford, W. O. (2005). Impact of childhood abuse on the course of bipolar disorder: a replication study in U.S. veterans. J Affect Disord 89, 57-67 Canino, G. J., Bird, H. R., Shrout, P. E., Rubio-Stipec, M., Bravo, M., Martinez, R., Sesman, M. and Guevara, L. M. (1987). The prevalence of specific psychiatric disorders in Puerto Rico. Arch Gen Psychiatry 44, 727-735 Cardno, A. G., Marshall, E. J., Coid, B., Macdonald, A. M., Ribchester, T. R., Davies, N. J., Venturi, P., Jones, L. A., Lewis, S. W. and Sham, P. C. (1999). Heritability estimates for psychotic disorders: the Maudsley twin psychosis series. Arch Gen Psychiatry 56, 162-168 Coryell, W., Endicott, J. and Keller, M. (1992). Rapidly cycling affective disorder. Demographics, diagnosis, family history, and course. Arch Gen Psychiatry 49, 126-131 Coryell, W., Solomon, D., Turvey, C., Keller, M., Leon, A. C., Endicott, J., Schettler, P., Judd, L. and Mueller, T. (2003). The long-term course of rapidcycling bipolar disorder. Arch Gen Psychiatry 60, 914-920 Craddock, N., Khodel, V., Van Eerdewegh, P. and Reich, T. (1995). Mathematical limits of multilocus models: the genetic transmission of bipolar disorder. Am J Hum Genet 57, 690-702 Deckert, J., Arolt, V. (2000). Genetische Forschung in der Psychiatrie: Fortschritt und ethische Verantwortung. In: Raem, A., Braun, R., Fenger, H., Michaelis, W., Nikol, S., Winter, S. (eds.). Genmedizin. Springer Berlin 51 Diagnostisches und statistisches Manual Psychischer Störungen, DSM-IV (1996). Dt. Bearbeitung von Sass, H., Wittchen, H.-U. und Zaudig, M. Hogrefe Göttingen Dilsaver, S. C., Benazzi, F., Akiskal, H. S. and Akiskal, K. K. (2007). Posttraumatic stress disorder among adolescents with bipolar disorder and its relationship to suicidality. Bipolar Disord 9, 649-655 Dunner, D. L., Gershon, E. S. and Goodwin, F. K. (1976). Heritable factors in the severity of affective illness. Biol Psychiatry 11, 31-42 Dunner, D. L., Lipschitz, A., Pitts, C. D. and Davies, J. T. (2005). Efficacy and tolerability of controlled-release paroxetine in the treatment of severe depression: post hoc analysis of pooled data from a subset of subjects in four doubleblind clinical trials. Clin Ther 27, 1901-1911 Ehlers, A., Mayou, R. A. and Bryant, B. (1998). Psychological predictors of chronic posttraumatic stress disorder after motor vehicle accidents. J Abnorm Psychol 107, 508-519 Einat, H., Yuan, P., Gould, T. D., Li, J., Du, J., Zhang, L., Manji, H. K. and Chen, G. (2003). The role of the extracellular signal-regulated kinase signaling pathway in mood modulation. J Neurosci 23, 7311-7316 Ellicott, A., Hammen, C., Gitlin, M., Brown, G. and Jamison, K. (1990). Life events and the course of bipolar disorder. Am J Psychiatry 147, 1194-1198 Esquirol, J. E. D. (1838). Des maladies mentale. Baillière Paris Falret, J. P. (1851). Marche de la folie. Gaz Hopitaux 24, 18-19 Foa, E. B. and Tolin, D. F. (2000). Comparison of the PTSD Symptom ScaleInterview Version and the Clinician-Administered PTSD scale. J Trauma Stress 13, 181-191 Foy, D. W., Resnick, H. S., Carroll, E. M. and Osato, S.S. (1990). Behavior therapy. In: Bellack, A. S. and Hersen, M. (eds.). Handbook of comparative treatments for adult disorders. Wiley New York 52 Foy, D. W., Carroll, E. M. and Donahoe, C. P., Jr. (1987). Etiological factors in the development of PTSD in clinical samples of Vietnam combat veterans. J Clin Psychol 43, 17-27 Frommberger, U., Nyberg, E., Angenendt, J., Lieb, K., Berger, M. (2004). In: Berger, M. (Hrsg.): Psychiatrie und Psychotherapie. Urban & Fischer München Frommberger, U., Stieglitz, R. D., Straub, S., Nyberg, E., Schlickewei, W., Kuner, E. and Berger, M. (1999). The concept of "sense of coherence" and the development of posttraumatic stress disorder in traffic accident victims. J Psychosom Res 46, 343-348 Garno, J. L., Goldberg, J. F., Ramirez, P. M. and Ritzler, B. A. (2005). Impact of childhood abuse on the clinical course of bipolar disorder. Br J Psychiatry 186, 121-125 Gersons, B. P. and Carlier, I. V. (1992). Post-traumatic stress disorder: the history of a recent concept. Br J Psychiatry 161, 742-748 Giaconia, R. M., Reinherz, H. Z., Silverman, A. B., Pakiz, B., Frost, A. K. and Cohen, E. (1995). Traumas and posttraumatic stress disorder in a community population of older adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 34, 13691380 Gilbertson, M. W., Shenton, M. E., Ciszewski, A., Kasai, K., Lasko, N. B., Orr, S. P. and Pitman, R. K. (2002). Smaller hippocampal volume predicts pathologic vulnerability to psychological trauma. Nat Neurosci 5, 1242-1247 Goldberg, J. F. and Garno, J. L. (2005). Development of posttraumatic stress disorder in adult bipolar patients with histories of severe childhood abuse. J Psychiatr Res 39, 595-601 Goodman, L. A., Thompson, K. M., Weinfurt, K., Corl, S., Acker, P., Mueser, K. T. and Rosenberg, S. D. (1999). Reliability of reports of violent victimization and posttraumatic stress disorder among men and women with serious mental illness. J Trauma Stress 12, 587-599 Goodwin, F. K., Jamison, K. R. (1990). Manic-Depressive Illness. Oxford University Press New York Oxford Griesel, D., Wessa, M. and Flor, H. (2006). Psychometric qualities of the German version of the Posttraumatic Diagnostic Scale (PTDS). Psychol Assess 18, 262-268 53 Griesinger, W. (1876). Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten für Ärzte und Studierende. Wreden Braunschweig Griffin, M. G., Uhlmansiek, M. H., Resick, P. A. and Mechanic, M. B. (2004). Comparison of the posttraumatic stress disorder scale versus the clinicianadministered posttraumatic stress disorder scale in domestic violence survivors. J Trauma Stress 17, 497-503 Hall, C. W. and Webster, R. E. (2002). Traumatic symptomatology characteristics of adult children of alcoholics. J Drug Educ 32, 195-211 Hamilton, M. (1960). A rating scale for depression. J Neurol Neurosurg Psychiatry 23, 56-62 Hantouche, E. G., Angst, J. and Akiskal, H. S. (2003). Factor structure of hypomania: interrelationships with cyclothymia and the soft bipolar spectrum. J Affect Disord 73, 39-47 Hecker, E. (1877). Zur klinischen Diagnostik und Prognostik der psychischen Krankheiten. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie 33, 602-620 Heim, C. and Nemeroff, C. B. (2001). The role of childhood trauma in the neurobiology of mood and anxiety disorders: preclinical and clinical studies. Biol Psychiatry 49, 1023-1039 Herman, J. L. (1993). Die Narben der Gewalt. Traumatische Erfahrungen verstehen und überwinden. Kindler München Hoffmann, B. U. and Meier, T. D. (2006). Mood fluctuations in people putatively at risk for bipolar disorders. Br J Clin Psychol 45, 105-110 Huber, M. (2003). Trauma und die Folgen. Junfermann Paderborn Hwu, H. G., Yeh, E. K. and Chang, L. Y. (1989). Prevalence of psychiatric disorders in Taiwan defined by the Chinese Diagnostic Interview Schedule. Acta Psychiatr Scand 79, 136-147 Jatzko, A., Schmitt, A., Kordon, A. and Braus, D. F. (2005). [Neuroimaging findings in posttraumatic stress disorder: review of the literature]. Fortschr Neurol Psychiatr 73, 377-391 54 Kahlbaum, K. L. (1882). Ueber cyklisches Irresein. Der Irrenfreund 24, 145-157 Keane, T. M., Gerardi, R. J., Quinn, S. J., Litz, B.T. (1992). Behavioral treatment of post-traumatic stress disorder. In: Turner S. M., Calhoun, K. S., Adams, H. E. Handbook of clinical behaviour therapy 2nd ed.: 87-97. Wiley New York. Kendler, K. S., Pedersen, N. L., Neale, M. C. and Mathe, A. A. (1995). A pilot Swedish twin study of affective illness including hospital- and populationascertained subsamples: results of model fitting. Behav Genet 25, 217-232 Kessler, R. C., Sonnega, A., Bromet, E., Hughes, M. and Nelson, C. B. (1995). Posttraumatic stress disorder in the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry 52, 1048-1060 Kessler, R. C., McGonagle, K. A., Zhao, S., Nelson, C. B., Hughes, M., Eshleman, S., Wittchen, H. U. and Kendler, K. S. (1994). Lifetime and 12-month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States. Results from the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry 51, 8-19 Kinzie, J. D. and Goetz, R. R. (1996). A century of controversy surrounding posttraumatic stress stress-spectrum syndromes: the impact on DSM-III and DSM-IV. J Trauma Stress 9, 159-179 Kleist, K. (1928). Über zykloide, paranoide und epileptoide Psychosen und über die Frage der Degenerationspsychosen. Schweiz Arch Neurol Psychiatr 23, 337 Kraepelin, E. (1921). Mixed states. In: Robertson, G. M. Manic-depressive insanity and paranoia. E & S Livingston Ltd. Edinburgh Kraepelin, E. (1913). Psychiatrie. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. 8. Aufl. J. A. Barth Leipzig Lee, C. K., Kwak, Y. S., Yamamoto, J., Rhee, H., Kim, Y. S., Han, J. H., Choi, J. O. and Lee, Y. H. (1990). Psychiatric epidemiology in Korea. Part I: Gender and age differences in Seoul. J Nerv Ment Dis 178, 242-246 Lee, C. K., Kwak, Y. S., Yamamoto, J., Rhee, H., Kim, Y. S., Han, J. H., Choi, J. O. and Lee, Y. H. (1990). Psychiatric epidemiology in Korea. Part II: Urban and rural differences. J Nerv Ment Dis 178, 247-252 55 Leonhard, K. (1957). Aufteilung der endogenen Psychosen. Akademie Verlag Berlin Leverich, G. S. and Post, R. M. (2006). Course of bipolar illness after history of childhood trauma. Lancet 367, 1040-1042 Leverich, G. S., McElroy, S. L., Suppes, T., Keck, P. E., Jr., Denicoff, K. D., Nolen, W. A., Altshuler, L. L., Rush, A. J., Kupka, R. and Frye, M. A. (2002). Early physical and sexual abuse associated with an adverse course of bipolar illness. Biol Psychiatry 51, 288-297 Lish, J. D., Dime-Meenan, S., Whybrow, P. C., Price, R. A. and Hirschfeld, R. M. (1994). The National Depressive and Manic-depressive Association (DMDA) survey of bipolar members. J Affect Disord 31, 281-294 Maercker, A. and Muller, J. (2004). Social acknowledgment as a victim or survivor: a scale to measure a recovery factor of PTSD. J Trauma Stress 17, 345351 Maercker, A., Bonanno, G. A., Znoj, H. and Horowitz, M. J. (1998). Prediction of complicated grief by positive and negative themes in narratives. J Clin Psychol 54, 1117-1136 Maercker, A., Michael, T., Fehm, L., Becker, E. S. and Margraf, J. (2004). Age of traumatisation as a predictor of post-traumatic stress disorder or major depression in young women. Br J Psychiatry 184, 482-487 Maes, M., Meltzer, H. Y. (1995). The serotonin hypothesis of major depression. In: Bloom, F. E., Kupfer, D. J. (eds.). Psychopharmacology. The fourth generation of progress. Raven Press New York Maier, W., Schwab, S., Rietschel, M. (1998). Genetik Affektiver Störungen. In: Helmchen, H., Henn, F., Lauter, H., Sartorius, N. (eds.) Psychiatrie der Gegenwart. Springer Heidelberg March, J. S. (1993). What constitutes a stressor? The "Criterion A" issue. In: J. R. T. Davidson and E. B. Foa (eds). Post-traumatic stress disorder. DSM-IV and beyond. American Psychiatric Press Washington Marneros, A. (ed.) (1999). Handbuch der unipolaren und bipolaren Erkrankungen. Thieme Stuttgart 56 Marneros, A., Goodwin, F. K. (2004a). Mixed states, rapid cycling and atypical bipolar disorders. University Press Cambridge Marneros, A. (2004b). Das Neue Handbuch der Bipolaren und Depressiven Erkrankungen. Thieme Stuttgart New York Martinez-Aran, A., Vieta, E., Reinares, M., Colom, F., Torrent, C., SanchezMoreno, J., Benabarre, A., Goikolea, J. M., Comes, M. and Salamero, M. (2004). Cognitive function across manic or hypomanic, depressed, and euthymic states in bipolar disorder. Am J Psychiatry 161, 262-270 McElroy, S. L., Keck, P. E. Jr. (1993). Rapid Cycling. In: Dunner, D. L. (ed.) Current psychiatry therapy. W. B. Saunders Philadelphia McElroy, S. L., Keck, P. E., Jr., Pope, H. G., Jr., Hudson, J. I., Faedda, G. L. and Swann, A. C. (1992). Clinical and research implications of the diagnosis of dysphoric or mixed mania or hypomania. Am J Psychiatry 149, 1633-1644 McEwen, B. S. (2000). The neurobiology of stress: from serendipity to clinical relevance. Brain Res 886, 172-189 Mendel, E. (1881). Die Manie. Urban und Schwarzenberg Wien Leipzig Mendlewicz, J. and Rainer, J. D. (1977). Adoption study supporting genetic transmission in manic--depressive illness. Nature 268, 327-329 Michels, R., Siebel, U., Freyberger, H. J., Stieglitz, R. D., Schaub, R. T. and Dilling, H. (1996). The multiaxial system of ICD-10: evaluation of a preliminary draft in a multicentric field trial. Psychopathology 29, 347-356 Mueser, K. T., Goodman, L. B., Trumbetta, S. L., Rosenberg, S. D., Osher, C., Vidaver, R., Auciello, P. and Foy, D. W. (1998). Trauma and posttraumatic stress disorder in severe mental illness. J Consult Clin Psychol 66, 493-499 Neele, E. (1949). Die phasischen Psychosen nach ihrem Erscheinungs- und Erbbild. J. A. Barth Leipzig Nehra, R., Chakrabarti, S., Pradhan, B. K. and Khehra, N. (2006). Comparison of cognitive functions between first- and multi-episode bipolar affective disorders. J Affect Disord 93, 185-192 57 Neria, Y., Gross, R., Olfson, M., Gameroff, M. J., Wickramaratne, P., Das, A., Pilowsky, D., Feder, A., Blanco, C. and Marshall, R. D. (2006). Posttraumatic stress disorder in primary care one year after the 9/11 attacks. Gen Hosp Psychiatry 28, 213-222 Normann, C., Peckys, D., Schulze, C. H., Walden, J., Jonas, P. and Bischofberger, J. (2000). Associative long-term depression in the hippocampus is dependent on postsynaptic N-type Ca2+ channels. J Neurosci 20, 8290-8297 Nutt, D. J. and Malizia, A. L. (2004). Structural and functional brain changes in posttraumatic stress disorder. J Clin Psychiatry 65 Suppl 1, 11-17 Orn, H., Newman, S. C. and Bland, R. C. (1988). Design and field methods of the Edmonton survey of psychiatric disorders. Acta Psychiatr Scand Suppl 338, 17-23 Otto, M. W., Perlman, C. A., Wernicke, R., Reese, H. E., Bauer, M. S. and Pollack, M. H. (2004). Posttraumatic stress disorder in patients with bipolar disorder: a review of prevalence, correlates, and treatment strategies. Bipolar Disord 6, 470-479 Otto, M. W., Simon, N. M., Wisniewski, S. R., Miklowitz, D. J., Kogan, J. N., Reilly-Harrington, N. A., Frank, E., Nierenberg, A. A., Marangell, L. B. and Sagduyu, K. (2006). Prospective 12-month course of bipolar disorder in out-patients with and without comorbid anxiety disorders. Br J Psychiatry 189, 20-25 Perkonigg, A., Kessler, R. C., Storz, S. and Wittchen, H. U. (2000). Traumatic events and post-traumatic stress disorder in the community: prevalence, risk factors and comorbidity. Acta Psychiatr Scand 101, 46-59 Perris, C. (1966). A study of bipolar (manic-depressive) and unipolar recurrent depressive psychoses. Acta Psychiatr Scand 194, 1-89 Perugi, G., Akiskal, H. S., Micheli, C., Musetti, L., Paiano, A., Quilici, C., Rossi, L. and Cassano, G. B. (1997). Clinical subtypes of bipolar mixed states: validating a broader European definition in 143 cases. J Affect Disord 43, 169180 Peters, L., Slade, T. and Andrews, G. (1999). A comparison of ICD10 and DSMIV criteria for posttraumatic stress disorder. J Trauma Stress 12, 335-343 Pichot, P. (1995). The birth of the bipolar disorder. Eur Psychiatry 10, 1-10 58 Pollack, M. H., Simon, N. M., Fagiolini, A., Pitman, R., McNally, R. J., Nierenberg, A. A., Miyahara, S., Sachs, G. S., Perlman, C. and Ghaemi, S. N. (2006). Persistent posttraumatic stress disorder following September 11 in patients with bipolar disorder. J Clin Psychiatry 67, 394-399 Post, R. M., Leverich, G. S., Altshuler, L. L., Frye, M. A., Suppes, T. M., Keck, P. E., Jr., McElroy, S. L., Kupka, R., Nolen, W. A., Grunze, H. and Walden, J. (2003). An overview of recent findings of the Stanley Foundation Bipolar Network (Part I). Bipolar Disord 5, 310-319 Potash, J. B. and DePaulo, J. R., Jr. (2000). Searching high and low: a review of the genetics of bipolar disorder. Bipolar Disord 2, 8-26 Read, J., van Os, J., Morrison, A. P. and Ross, C. A. (2005). Childhood trauma, psychosis and schizophrenia: a literature review with theoretical and clinical implications. Acta Psychiatr Scand 112, 330-350 Regier, D. A., Farmer, M. E., Rae, D. S., Locke, B. Z., Keith, S. J., Judd, L. L. and Goodwin, F. K. (1990). Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse. Results from the Epidemiologic Catchment Area (ECA) Study. Jama 264, 2511-2518 Robins, L. N., Regier, D. A. (1991). Psychiatric Disorders in America: The Epidemiologic Catchment Area Study. Free Press New York Robinson, L. J., Thompson, J. M., Gallagher, P., Goswami, U., Young, A. H., Ferrier, I. N. and Moore, P. B. (2006). A meta-analysis of cognitive deficits in euthymic patients with bipolar disorder. J Affect Disord 93, 105-115 Schnyder, U. and Moergeli, H. (2002). German version of ClinicianAdministered PTSD Scale. J Trauma Stress 15, 487-492 Shalev, A. Y., Freedman, S., Peri, T., Brandes, D., Sahar, T., Orr, S. P. and Pitman, R. K. (1998). Prospective study of posttraumatic stress disorder and depression following trauma. Am J Psychiatry 155, 630-637 Sheehan, D. V., Lecrubier, Y., Sheehan, K. H., Amorim, P., Janavs, J., Weiller, E., Hergueta, T., Baker, R. and Dunbar, G. C. (1998). The Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.): the development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview for DSM-IV and ICD-10. J Clin Psychiatry 59 Suppl 20, 22-33;quiz 34-57 59 Simon, N. M., Otto, M. W., Wisniewski, S. R., Fossey, M., Sagduyu, K., Frank, E., Sachs, G. S., Nierenberg, A. A., Thase, M. E. and Pollack, M. H. (2004). Anxiety disorder comorbidity in bipolar disorder patients: data from the first 500 participants in the Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar Disorder (STEP-BD). Am J Psychiatry 161, 2222-2229 Sjoholt, G., Ebstein, R. P., Lie, R. T., Berle, J. O., Mallet, J., Deleuze, J. F., Levinson, D. F., Laurent, C., Mujahed, M. and Bannoura, I. (2004). Examination of IMPA1 and IMPA2 genes in manic-depressive patients: association between IMPA2 promoter polymorphisms and bipolar disorder. Mol Psychiatry 9, 621629 Soares, J. C., Innis, R. B. (2000). Brain Imaging findings in bipolar disorder. In: Soares, J. C., Gershon, S. (eds.). Bipolar disorders. Marcel Dekker New York Solomon, Z. and Mikulincer, M. (2006). Trajectories of PTSD: a 20-year longitudinal study. Am J Psychiatry 163, 659-666 Spearing, M. K., Post, R. M., Leverich, G. S., Brandt, D. and Nolen, W. (1997). Modification of the Clinical Global Impressions (CGI) Scale for use in bipolar illness (BP): the CGI-BP. Psychiatry Res 73, 159-171 Stein, M. B., Walker, J. R., Hazen, A. L. and Forde, D. R. (1997). Full and partial posttraumatic stress disorder: findings from a community survey. Am J Psychiatry 154, 1114-1119 ten Have, M., Vollebergh, W., Bijl, R. and Nolen, W. A. (2002). Bipolar disorder in the general population in The Netherlands (prevalence, consequences and care utilisation): results from The Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). J Affect Disord 68, 203-213 Thompson, S. J., Maccio, E. M., Desselle, S. K., Zittel-Palamara, K. (2007). Predictors of posttraumatic stress symptoms among runaway youth utilizing two service sectors. J Trauma Stress 20, 553-563 Vermetten, E. and Bremner, J. D. (2002). Circuits and systems in stress. II. Applications to neurobiology and treatment in posttraumatic stress disorder. Depress Anxiety 16, 14-38 Washizuka, S., Kakiuchi, C., Mori, K., Kunugi, H., Tajima, O., Akiyama, T., Nanko, S. and Kato, T. (2003). Association of mitochondrial complex I subunit gene NDUFV2 at 18p11 with bipolar disorder. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 120B, 72-78 60 Watson, P. J. and Shalev, A. Y. (2005). Assessment and treatment of adult acute responses to traumatic stress following mass traumatic events. CNS Spectr 10, 123-131 Wehr, T. A., Sack, D. A., Rosenthal, N. E. and Cowdry, R. W. (1988). Rapid cycling affective disorder: contributing factors and treatment responses in 51 patients. Am J Psychiatry 145, 179-184 Weissman, M. M., Bland, R. C., Canino, G. J., Faravelli, C., Greenwald, S., Hwu, H. G., Joyce, P. R., Karam, E. G., Lee, C. K. and Lellouch, J. (1996). Cross-national epidemiology of major depression and bipolar disorder. Jama 276, 293-299 Wells, J. E., Bushnell, J. A., Hornblow, A. R., Joyce, P. R. and Oakley-Browne, M. A. (1989). Christchurch Psychiatric Epidemiology Study, Part I: Methodology and lifetime prevalence for specific psychiatric disorders. Aust N Z J Psychiatry 23, 315-326 Wender, P. H., Kety, S. S., Rosenthal, D., Schulsinger, F., Ortmann, J. and Lunde, I. (1986). Psychiatric disorders in the biological and adoptive families of adopted individuals with affective disorders. Arch Gen Psychiatry 43, 923-929 Wernicke, C. (1906). Grundrisse der Psychiatrie in klinischen Vorlesungen. Thieme Leipzig Winokur, G., Clayton, P. J. (1967). Family history studies: I. Two types of affective disorders separated according to genetic and clinical factors. In: Wortis, J. (ed) Recent advances in biological psychiatry. Plenum New York Wittchen, H. U., Essau, C. A., von Zerssen, D., Krieg, J. C. and Zaudig, M. (1992). Lifetime and six-month prevalence of mental disorders in the Munich Follow-Up Study. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 241, 247-258 Young, E. A. and Breslau, N. (2004). Cortisol and catecholamines in posttraumatic stress disorder: an epidemiologic community study. Arch Gen Psychiatry 61, 394-401 Young, R. C., Biggs, J. T., Ziegler, V. E. and Meyer, D. A. (1978). A rating scale for mania: reliability, validity and sensitivity. Br J Psychiatry 133, 429-435 Zisook, S. (1988). Cyclic 48-hour unipolar depression. J Nerv Ment Dis 176, 53-56 61 VII. ANHANG Anamnesebogen Bipolare Störung -A1- I. Personendaten Name: Vorname: Geschlecht: m w Adresse: Telefon: Geburtsdatum: Geburtsort: Alter: Nationalität: Herkunft: deutsch Deutschland andere: andere: II. Biographie, soziale Situation Schulabschluss: keiner Realschule Sonderschule FH Hauptschule Abitur Beruf/Ausbildung: Derzeitige Tätigkeit, Arbeitsstelle: Familienstand: Partnerschaft: Kinder: Berufe der Eltern: Geschwister: ledig ja nein verheiratet nein ja Anzahl: Vater: Brüder:_______ Körperliche Gewalt in der Erziehung: Vernachlässigung durch die Eltern: verwitwet Mutter: Schwestern:_______ Psychische Erkrankungen in der Familie: Alkoholabhängigkeit der Eltern: Scheidung/Trennung der Eltern: Aufgewachsen bei: geschieden nein ja, bei: Mutter ja Eltern Heim Mutter Geschwister Vater andere Vater nein anderen Familienmitgliedern anderes: ja ja nein nein 62 III. Diagnose und Krankheitsverlauf Diagnose: Letzte Episode: Bipolar I Bipolar II Rapid Cycling Manie Depression Gemischt Dauer (Tage):_________ Anzahl Episoden bis heute: Manien:_____ Depressionen:_____ Psychiatrische Erstdiagnose: ________________________________Jahr:____ Diagnose Bipolare Störung (Jahr):_____________ Klinikaufenthalte (Psych.): Jahr __________ Dauer _______ Jahr __________ Dauer _______ Jahr __________ Dauer _______ Jahr __________ Dauer _______ Jahr __________ Dauer _______ Anzahl insgesamt: _________ Ambulante Behandlung: seit (Jahr): ________________ Weitere psychiatrische Erkrankungen: Diagnose:__________________ Jahr:____ Diagnose:__________________ Jahr:____ keiner einmal Suizidversuch: Drogenmissbrauch in der Vorgeschichte: nein mehrfach: _______ mal ja, Substanzen:_______________ IV. Somatische Störungen Hirnorganische Erkrankungen: Stoffwechselerkrankungen: Andere Erkrankungen: Größe(cm): ___________ Gewicht(kg): ___________ Nikotinabusus: Alkohol: Drogen aktuell: nein nein nein nein nein nein ja, Diagnose: ja, Diagnose: ja, Diagnose(n): ja, Menge und Dauer: ja, Menge und Dauer: ja, Substanz und Dosis: __ __ __ __ __ __ V. Therapie Aktuelle psychiatrische Medikation: Substanz 1:_______________________________ Substanz 2:_______________________________ Substanz 3:_______________________________ Substanz 4:_______________________________ Substanz 5:_______________________________ nein Psychotherapie: Elektrokrampftherapie (ECT): nein Regelmäßige Medikamenteneinnahme?: Überzeugt von Wirksamkeit der Medikation?: ja, Dauer: ____________ ja ja nein ja nein 63 VI. Clinical Global Impression bezogen auf Bipolare Erkrankung (CGI-BP) 0 = nicht beurteilbar 1 = nicht krank 2 = grenzwertig krank 3 = leicht krank 4 = mäßig krank 5 = deutlich krank 6 = schwer krank 7 = extrem schwer krank Depression: Manie: Gesamteindruck: _______Punkte _______Punkte _______Punkte VII. Selbstwertgefühl–Skala (modifiziert nach Rosenberg, 1965) Stimmt gar nicht Stimmt wenig Stimmt größtenteils Stimmt vollständig Ich habe eine positive Einstellung zu mir selber. Ich neige zu der Annahme, dass ich ein Versager bin. Ich glaube, dass ich eine Reihe guter Eigenschaften habe. Manchmal denke ich, dass ich zu nichts tauge. 64 65 66 67 68 -A3- 69 70 Danksagung Bedanken möchte ich mich bei PD Dr. Assion für die Überlassung dieses interessanten Themas und die freundliche und geduldige Betreuung, sowie bei allen Mitarbeitern der Kliniken in Bochum und in Dortmund-Aplerbeck für ihre Hilfsbereitschaft, die gute Zusammenarbeit und die angenehme Arbeitsatmosphäre. Weiterhin bedanke ich mich bei Prof. Frommberger, der mich in seiner Offenburger Klinik mit der CAPS vertraut gemacht hat, und bei Dr. Thomas Aubel und Dr. Ulrike Wortmann-Grohé für ihre Hilfe bei der Patientensuche. Ein besonderer Dank gilt allen Patienten, die an dieser Studie teilgenommen haben und mich an ihrer Geschichte teilhaben ließen, für ihre Offenheit und und ihren Einsatz. Nadja Jamila Schmidt Geboren: 21.07.1978 in Hilden Familienstand: ledig Schulbildung: 1985-1989 Gemeinschaftsgrundschule, Düsseldorf-Urdenbach 1989-1994 Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Düsseldorf 1994-1998 Ernst-Barlach-Gymnasium, Kiel Juli 1998 Abitur in Kiel Beruflicher Werdegang August 1998 - August 1999: November 1999 - April 2000: Oktober 2000: seit November 2001: September 2004: April 2009: Freiwilligenjahr in Ghana/Westafrika Mitarbeit bei Global 2000, einem Projekt des Gesundheitsministeriums zur Ausrottung des Guinea-Wurmes Studienaufenthalt in Gent/Belgien Niederländisch-Sprachkurse an der Mercator-Hogeschool und der Universität Gent Beginn des Studiums der Medizin Ruhr-Universität Bochum Arbeit als Aushilfe in der Krankenpflege Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke 1. Abschnitt der ärztlichen Prüfung 2. Abschnitt der ärztlichen Prüfung Famulaturen: März, April 2005: Innere Medizin Knappschaftskrankenhaus Bochum August 2005: Chirurgie Amppipal Hospital, Nepal März 2006: Kinder- und Jugendmedizin Praxis Dr.Collin, Bochum Februar, März 2007: Orthopädie Praxis Dr. Heussen, Mönchengladbach Praktisches Jahr: August 2007 - August 2008: 1. Tertial Gynäkologie Augusta-Krankenanstalt Bochum 2. Tertial Innere Medizin Augusta-Krankenanstalt Bochum 3. Tertial Chirurgie Muhimbili National Hospital Dar es Salaam, Tansania