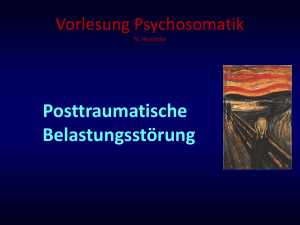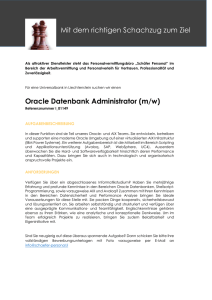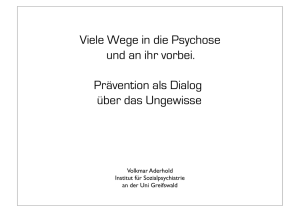Kraus
Werbung
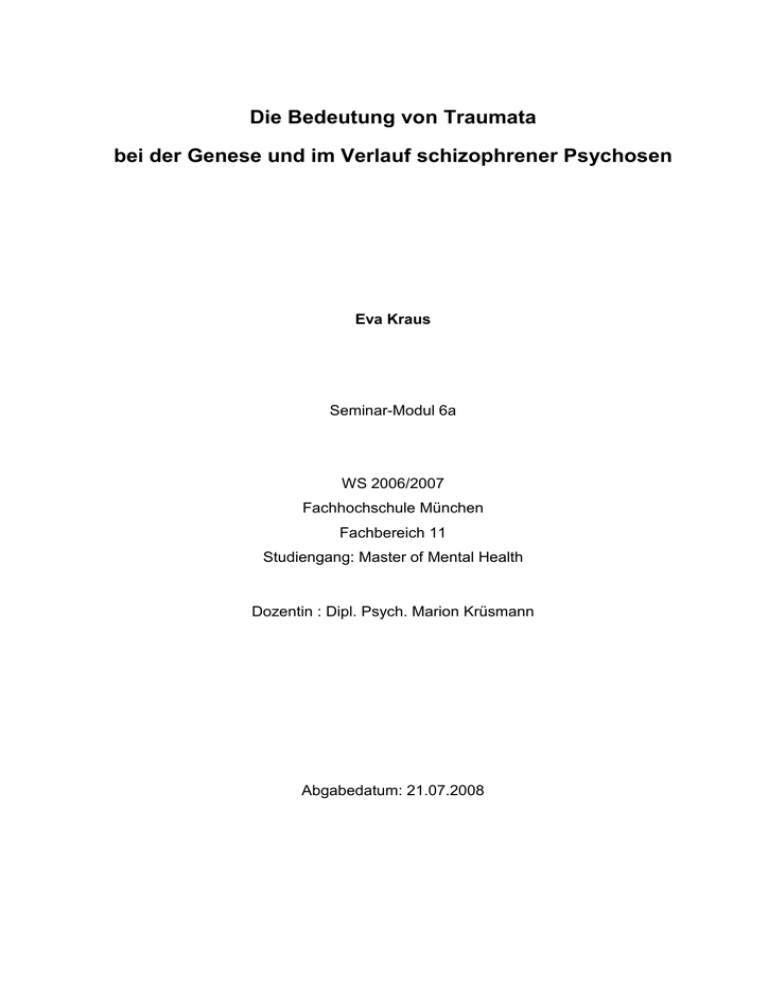
Die Bedeutung von Traumata bei der Genese und im Verlauf schizophrener Psychosen Eva Kraus Seminar-Modul 6a WS 2006/2007 Fachhochschule München Fachbereich 11 Studiengang: Master of Mental Health Dozentin : Dipl. Psych. Marion Krüsmann Abgabedatum: 21.07.2008 Inhalt EINLEITUNG.......................................................................................................... 1 1. BEZÜGE ZWISCHEN PSYCHOSE UND TRAUMA.......................... 2 1.1 Psychose als Folge von Traumatisierung.......................................... 2 1.2 PTSD als Folge psychotischen Erlebens .......................................... 8 1.3 Sancutary Trauma – PTSD als Folge psychiatrischer Behandlung. 10 1.4 PTSD als Chronifizierungsfaktor für schizophrene Symptome........ 11 2. HERAUSFORDERUNGEN FÜR PSYCHIATRISCHE KLASSIFIKATION UND DIAGNOSTIK ....................................................................................................... 12 2.1 Symptom Overlap............................................................................ 13 2.2 Komorbide Störungen oder diagnostische Artefakte? ..................... 14 2.3 Auswirkungen auf die Diagnostik .................................................... 16 3. KONSEQUENZEN FÜR KONZEPTBILDUNG UND KLINISCH- THERAPEUTISCHE PRAXIS............................................................................... 17 3.1 Erweiterung des Vulnerabilität-Stress-Modells................................ 18 3.2 Traumasensible und traumaspezifische Psychotherapie ................ 19 3.3 Psychiatrische Behandlung und Pharmakologie ............................. 22 4. SCHLUSSWORT ............................................................................................. 25 LITERATUR ......................................................................................................... 26 EINLEITUNG Dass traumatische Erlebnisse gravierende psychische Folgen haben gehört zum Alltagswissen und ist in der psychiatrischen und psychotherapeutischen Wissenschaft und Praxis fast schon ein Allgemeinplatz. Welcher Art allerdings die möglichen psychischen Folgen sind, wird in letzter Zeit wieder kontrovers diskutiert. Dabei ist die Debatte um psychische Folgen psychotraumatischer Erlebnisse keineswegs neu. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts setzte in Deutschland OPPENHEIM mit seinem Konzept der TRAUMATISCHEN NEUROSE den Anfangspunkt für einen theoretischen Diskurs (vgl. Berger 2004; Priebe et al. 2002). Sein Bemühen, die TRAUMATISCHE NEUROSE als anerkanntes eigenständiges Krankheitsbild zu etablieren scheiterte letztlich allerdings an der Schwierigkeit einen kausalen Zusammenhang zwischen Trauma und psychischen Folgebeeinträchtigungen anatomisch nachzuweisen, an der mangelnden Objektivierbarkeit der Symptome und an gegenläufigen (sozial-)politischen Interessen1 (vgl. Priebe et al. 2002:3f.). Wenngleich Arbeiten von Freud und Janet zu posttraumatischen Störungen von Psychiatern nahezu unbeachtet blieben, verebbte in den folgenden Jahrzehnten in Deutschland der Diskurs um posttraumatische psychische Folgen nicht gänzlich. Z.B. fand durchaus, wenn auch eher partiell, eine wissenschaftliche Beschäftigung mit den psychischen Folgen von KZ-Haft statt. Allerdings blieb diese eher unspezifisch und es gingen daraus keine eigenständigen Trauma-Konzepte hervor. Im letzten Jahrzehnt wurde in Deutschland – angestoßen durch das in den USA entwickelte Konzept der POSTTRAUMAISCHEN BELASTUNGSSTÖRUNG (posttraumatic stress disorder, PTSD) – wieder ein intensiverer Diskurs angestoßen (vgl. Berger 1 OPPENHEIMER stütze sein Konzept zunächst vornehmlich auf Erfahrungen mit Opfern von Eisenbahn- und Industrie-Unfällen, wodurch der Eindruck entstand, die TRAUMATISCHE NEUROSE beträfe überwiegend die Arbeiterschaft. Da durch diese Diagnose die Möglichkeit der Berentung eröffnet wurde, unterstellte ein Teil der begutachtenden Ärzteschaft den betroffenen Arbeitern Simulantentum zum Zwecke der Berentung, was in Bezeichnungen wie „Begehrungsneurose“ oder „Rentenneurose“ (Priebe et al. 2002: 4) zum Ausdruck kommt. Das ohnehin stark in Zweifel gezogene Konzept wurde im Zuge des ersten Weltkrieges völlig an den Rande gedrängt: Anders als in England oder Frankreich war es in Deutschland unerwünscht die individuellen psychischen Folgen traumatischer Kriegserfahrungen (Kriegsneurosen) zu thematisieren und schließlich verlor die TRAUMATISCHE NEUROSE ihren Status als rentenberechtigende Erkrankung (vgl. ebd.: 5). 1 2004:716 ff.; Priebe et al. 2002). Vor diesem Hintergrund entwickelte sich in den letzten Jahren eine kontroverse wissenschaftliche Diskussion bezüglich traumatogener Aspekte bei Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis (vgl. Dümpelmann 2003). Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die wesentlichen Diskussionslinien nachzuzeichnen und somit einen Überblick über den aktuellen Sachstand zum Thema zu geben. Die verschiedenen Bezüge zwischen Trauma und schizophrenen Psychosen werden herausgearbeitet (Kapitel 1), und die damit implizierten Herausforderungen für psychiatrische Klassifikation und Diagnostik verdeutlicht (Kapitel 2). Wenn Zusammenhänge zwischen Traumata und Psychose anerkannt werden, hat dies Konsequenzen für die klinisch- therapeutische Praxis. Diese werden am Ende der Arbeit skizziert (Kapitel 3). 1. BEZÜGE ZWISCHEN PSYCHOSE UND TRAUMA Die Lebenszeitprävalenz für PTSD bei schizophrenen Erkrankungen wird mit 29%43% angegeben und ist damit etwas geringer als bei anderen schweren psychischen Krankheiten (z.B. Depression), aber höher als in der Allgemeinbevölkerung (8 - 9%) (vgl. Vauth & Nyberg 2007, Vauth 2007). Dies lässt auf Zusammenhänge zwischen Traumata und Psychose schließen. Dabei ist es nahe liegend, Psychosen als eine mögliche Folge von Traumatisierungen zu ergründen, wie dies auch in der Mehrzahl einschlägiger Studien geschieht. Daneben gibt es weitere, möglicherweise unterschätzte, Bezüge zwischen Trauma und Psychose, die nachfolgend ebenfalls skizziert werden. 1.1 Psychose als Folge von Traumatisierung Bislang fokussieren Studien über schwere psychische Störungen infolge von Traumatisierung überwiegend auf Diagnosen wie Major Depression, Suchtmittelabhängigkeit, Angst- und Zwangstörungen. Über Zusammenhänge mit Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis liegen bisher weniger Befunde vor (vgl. Schäfer & Aderhold 2005; Read et al. 2005b:331). DÜMPELMANN (2003) weist zu Recht darauf hin, dass in der deutschen Lehr-Psychiatrie die Rolle von Traumata in der Vorgeschichte von Psychosen zumindest bis vor kurzem nahezu 2 ausgeblendet wurde2. Im Gegensatz dazu mehren sich in den letzten Jahren allmählich Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen (v. a. frühen) traumatischen Erfahrungen und schizophrenen Psychosen (vgl. Schäfer & Aderhold 2005). Angestoßen wurde diese Entwicklung u. a. durch das Forscherteam um READ (vgl. Gresch o. D.). Auf der Basis ihrer Analyse einschlägiger, zwischen 1872 und 2005 publizierter Literatur kommen sie zu dem Ergebnis, dass schwere psychische Traumatisierungen ein wesentlicher Faktor bei der Genese schizophrener Erkrankungen sind. Forschungs-Beispiele Die meisten der bislang publizierten einschlägigen Arbeiten weisen hinsichtlich ihres Forschungsgegenstandes zwei Gemeinsamkeiten auf: Erstens befassen sie sich überwiegend mit dem gesamten Spektrum schwerer psychischer Erkrankungen, was neben Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis auch Depression, Suchtmittelabhängigkeit und andere Diagnosegruppen einschließt3 (vgl. Schäfer & Aderhold 2005:58; Vauth & Nyberg 2007; Read et al. 2005b). Zweitens werden fast ausnahmslos auf Erlebnisse vom TRAUMA-TYP II fokussiert4, insbesondere auf mehrfachen sexuellen und/oder körperlichen Missbrauch in der Kindheit, mitunter spezifisch auf Frauen bezogen (vgl. z.B. Rosenberg et al. 2001:1454). Etwas seltener wird psychischer Missbrauch (z.B. extreme Vernachlässigung, Parentifizierung) und mitunter Traumatisierung durch Kriegserlebnisse 2 Schlägt man in klassischen Lehrbüchern unter ‚Posttraumatischer Belastungsstörung’ nach, so wird dort zwar auf die Vielfältigkeit physischer und psychischer Trauma-Reaktionen hingewiesen jedoch werden Psychosen als mögliche Folgen nicht aufgeführt. Umgekehrt werden als mögliche auslösende bzw. begünstigende Faktoren für das ‚Störungsbild Schizophrenie’ zwar psychischer Stress – so z.B. Familienklima (Expressed Emotion), sozialer Status, Life Events – benannt und kritisch diskutiert. Die Rolle von Traumata wird in diesem Faktorenbündel, wenn überhaupt, am Rande und dann lediglich in Zusammenhang mit psychischem Stress als möglichem Auslöser für Psychosen erwähnt (vgl. z.B. Berger 2004, Davison & Neale 2002, Tölle & Windgassen 2006, Vetter 2001). 3 Eine Ausnahme hiervon ist INGO SCHÄFER (2007), der im Rahmen eines Projektes an der Uniklinik in Hamburg schizophrene PatientInnen zu frühen traumatischen Erfahrungen interviewt hat. 4 Eine Ausnahme ist die Studie von NORTH ET AL. (2008) zu psychischen Belastungen bei Opfern des HURRICANE KATRINA. Sie werteten die über 2 Wochen hinweg dokumentierten Kontakte einer ‚Krisenstation’ in Dallas aus. Insgesamt sind 503 Kontakte bei 421 PatientInnen dokumentiert. Neben den dominanten Diagnosen wie Depression und Suchtmittelabhängigkeit wurde immerhin bei 7,1% eine Psychose diagnostiziert. Die Autoren geben zwar zu bedenken, dass es sich bei den Opfern des HURRICANE KATRINA um eine besonders vulnerable Bevölkerungsgruppe handelt, was die hohe Prävalenzrate erklären könnte. Gleichwohl tut sich die Frage auf, ob nicht die Bedeutung von Traumata des Typ I (gegenüber Typ II) für die Entstehung und den Verlauf von Psychosen unterschätzt wird. 3 bei älteren Psychose-PatientInnen untersucht (vgl. Schäfer & Aderhold 2005:60; Read et al. 2005b:331). GOODMAN ET AL. (1997) fanden als Ergebnis einer Übersicht über 13 Untersuchungen bei als psychotisch diagnostizierten Menschen eine Prävalenz für sexuellen Missbrauch bzw. Misshandlung zwischen 42% und 92%5 (vgl. Schäfer & Aderhold 2005). Noch höher liegt die Prävalenzrate bei der häufig zitierten (von GOODMAN ET AL. nicht einbezogenen) Untersuchung von Mueser et al. Von den befragten schizophrenen und anderweitig als psychotisch diagnostizierten Menschen berichteten 98% über traumatische Ereignisse in der Vorgeschichte (vgl. Gunkel 2005:14). Weit darunter liegen die von SCHÄFER (2007) angegebenen Prävalenzraten. Er befragte 107 Personen mit diagnostizierten Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis zu frühen Traumatisierungen und differenzierte dabei zwischen sexuellem Missbrauch und körperlicher Misshandlung. Bei 35% der Befragten (33% Männer, 38% Frauen) fand sich mindestens eine Form traumatischer Erfahrung. Ebenfalls niedriger als in der o. g. Übersicht, aber höher als bei SCHÄFER liegen die Prävalenzraten einer 2001 publizierten Studie von GOODMAN ET AL. (vgl. Schäfer & Aderhold 2005). Zugrunde liegt dieser Untersuchung eine relativ große Stichprobe (N=752) sowie strenge diagnostische Kriterien. GOODMAN ET AL. fanden in der Vorgeschichte psychotischer PatientInnen frühen sexuellen Missbrauch bei 49% der Frauen und 29% der Männer. Über körperliche Misshandlungen im Kindesalter berichteten 54% der weiblichen und 58% der männlichen Patienten. Ähnliche Ergebnisse lieferte ROSS 1992 mit einer Untersuchung in der Allgemeinbevölkerung (vgl. Read et al. 2005b:336). Bei 46% der Personen mit drei oder mehr Schizophrenie-Symptomen lag ein sexueller und/oder körperlicher Missbrauch in der Kindheit vor; dagegen nur bei 8% der Personen ohne Schizophrenie-Symptome. 5 Die große Varianz der Ergebnissen wird auf methodische Unterschiede, z. B verschiedene Erhebungsinstrumente, qualitative und quantitative Unterschiede in den Stichproben etc. zurückgeführt (vgl. Dümpelmann 2003, Vauth & Nyberg 2007). 4 Auch die Ergebnisse der von JANSEN ET AL. 2004 in den Niederlanden durchgeführte prospektive NEMESIS-STUDIE weist auf einen Zusammenhang zwischen frühen Traumatisierungen und Psychosen hin (vgl. Read et al. 2005b: 31; Schäfer & Aderhold 2005). In einer Bevölkerungsstichprobe von 4045 Personen wurde prospektiv das Auftreten von (späteren) psychischen Störungen bei Kindesmissbrauch untersucht. JANSEN ET AL. fanden ein ca. 7fach erhöhtes Risiko psychotische Symptome zu entwickeln bei Menschen, die als Kinder sexuell missbraucht wurden. Ein interessantes Ergebnis ist der so genannte „dose-effect“ (Read et al. 2005b:339) für diese Zusammenhänge: Je schwerer (qualitativ und quantitativ) der Missbrauch war, umso höher war das Risiko psychotische Symptome zu entwickeln6. Ein weiterer interessanter Befund stammt aus der bereits erwähnten Untersuchung von GOODMAN ET AL. (vgl. Schäfer & Aderhold 2005; Gunkel 2005). Personen mit Psychosen, die in ihrer Lebensgeschichte durch Missbrauch/Misshandlung traumatisiert wurden, waren einem deutlich erhöhten Risiko für erneute Viktimisierung im Erwachsenen-Alter ausgesetzt. So berichteten 20% der weiblichen und 8% der männlichen Patienten im letzten Jahr (vor der Befragung) Opfer sexueller Übergriffe gewesen zu sein. Opfer physischer Gewalt waren 25% der weiblichen und 34% der männlichen Patienten. Schließlich sei noch die 2002 publizierte Studie von NERIA ET AL. (vgl. Schäfer 2007:13) erwähnt, die explizit auf PTSD-Symptomatik bei psychotischen PatientInnen fokussiert. Von 426 Personen, die erstmalig aufgrund einer psychotischen Erkrankung stationär aufgenommen wurden, wiesen 14% eine akute PTSD auf, die sehr häufig in Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch in der Kindheit stand. Verschiedene Autoren weisen zudem auf inhaltliche Zusammenhänge zwischen traumatischen Erlebnissen und psychotischen Symptomen hin (vgl. Read et al 2005a; Schäfer 2007). So enthalten Wahninhalte und Halluzinationen häufig (jedoch nicht zwingend) konkrete Details der traumatischen Erfahrung. Diese sind 6 JANSEN ET AL. unterschieden drei ‚Schweregrade’ des Missbrauchs. Personen mit ‚Schweregrad 1’ waren einem 2fach höherem Risiko ausgesetzt psychotische Symptome zu entwickeln; Personen mit ‚Schweregrad 2’ hatten bereits ein 10,6fach erhöhtes Risiko und Personen mit ‚Schweregrad 3’ ein 48,4fach höheres Risiko. 5 z.B. sexuell getönte Wahninhalte bei Frauen mit Inzesterfahrungen oder die Stimme des Täters, die zu selbstschädigendem Verhalten auffordert. Wenngleich die oben genannten Studien teilweise zu recht unterschiedlichen Ergebnissen kommen, so zeigt sich doch insgesamt die deutliche Tendenz einer erhöhte Prävalenzrate für sexuellen Missbrauch/Misshandlungen in der Lebensgeschichte psychotischer Menschen gegenüber der Allgemeinbevölkerung, die zum Teil auch eine PTSD nach sich ziehen7. Studien zu Traumatisierung durch Krieg und Gewaltherrschaft in der Vorgeschichte psychotischer Menschen sind weniger zahlreich vorhanden. Es lassen sich aber auch hier ähnliche Tendenzen aufzeigen. So wurde z.B. bei Kriegsgefangenen aus dem Zweiten Weltkrieg eine markante Häufung von schizophrenen Psychosen konstatiert, bei einem Fünftel von untersuchten KriegsFlüchtlingen aus Somalia eine Psychose diagnostiziert oder bei Flüchtlingen aus Kambodscha die Koexistenz von PTSD und Psychosen festgestellt (vgl. Read et al. 2005b: 333). BÖWING ET AL. (2007) befassten sich mit der Frage, ob kriegstraumatisierte gerontopsychiatrische PatientInnen die Kriterien für eine ‚late onset PTSD’ erfüllen. In diesem Zusammenhang stießen sie auf die Häufung psychotischer Symptome bei traumatisierten PatientInnen (bei 13 von 33 untersuchten Fällen), was sie zu einer Folgeuntersuchung (vgl. Böwing et al. 2008) veranlasste. 7 Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle die in Australien durchgeführte prospektive Studie von SPATARO ET AL. genannt, die eine solche Tendenz nicht bestätigt (vgl. Read et al. 2005b: 337 f.). Untersucht wurden 1612 dokumentierte Fälle sexuellen Kindes-Missbrauchs (gemeldet beim VICTORIAN INSTITUTE OF FORENSIC MEDICINE) hinsichtlich der Frage, ob bei den Opfern später eine behandlungsbedürftige psychische Störung diagnostiziert wurde. Im Vergleich dieser Gruppe mit der Allgemeinbevölkerung zeigte sich kein signifikanter Unterschied: missbrauchte Männer wurden lediglich 1,3 mal häufiger wegen Schizophrenie behandelt, missbrauchte Frauen 1,5 mal häufiger. Allerdings weist die Studie erhebliche methodische Einschränkungen auf, die z. T. von den Forschern selbst kritisch reflektiert wurden. Z.B. lag das Durchschnittsalter der untersuchten Gruppe bei 20 Jahren (das der Allgemeinbevölkerung lag höher); das Risiko an einer schizophrenen Psychose zu erkranken besteht aber durchschnittlich erst in einem höheren Lebensalter. Zudem ist davon auszugehen, dass nach dem Bekanntwerden des Missbrauchs (die Fälle waren ja dokumentiert) entsprechende Interventionen stattfanden, der Missbrauch also nicht fortgesetzt werden konnte und die traumatischen Erlebnisse möglicherweise bereits aufgearbeitet werden konnten. Insgesamt waren die methodischen Unwägbarkeiten in dieser Studie so dominant, dass sogar für den allgemein gut belegten Zusammenhang zwischen sexuellem Missbrauch und Alkohol-/Suchtmittelmissbrauch keine Hinweise gefunden wurden. 6 Ein bemerkenswertes Ergebnis dieser Untersuchung ist unter anderem der enge inhaltliche Bezug von Psychosen und erlebten Traumata: „Eine nicht seltene Kombination besteht aus Vergewaltigung und Schwangerschaftswahn […]. Optische Halluzinationen in Form junger Männer, welche die Patientinnen verfolgen, von außen durchs Fenster ins Zimmer blicken oder gar in ihrem Bett liegen, können in diesen Zusammenhang gestellt und so verständlich werden“. (vgl. Böwing et al. 2008:78) Diskussion Ergebnisse von Studien, die Psychosen als eine mögliche Folge traumatischer Erfahrungen konstatieren – insbesondere Untersuchungen zu sexuellem Missbrauch/Misshandlung in der Kindheit und Psychose – werden z. T. sehr kritisch hinterfragt. Die hauptsächliche Kritik richtet sich gegen die große Varianz der Ergebnisse (s. o.), die vor allem auf methodische Differenzen und ‚Schwächen’ zurückgeführt wird, so z.B. Inhomogenität des untersuchten Personenkreises oder zu kleine Stichproben. Zudem mangele es mitunter an anerkannten zugrunde gelegten Definitionen und etablierten diagnostischen Instrumenten (vgl. Schäfer & Aderhold 2005:63; Vauth & Nyberg 2007:469). Darüber hinaus wird die Einengung der Forschungsfragen auf Traumata durch sexuellen und körperlichen Missbrauch im frühen Kindesalter problematisiert (vgl. Schäfer & Aderhold 2005:63). Dies verweist auch auf die moralische Dimension entsprechender Untersuchungen bzw. Diskussionen. Befürchtungen, die Angehörigen psychotischer Menschen könnten unter „Generalverdacht“ (Schäfer 2007:9) geraten, ähnlich wie es beim – überwundenen – Konzept der „schizophrenogenen Mutter“ (ebd.) der Fall war mögen hier eine Rolle spielen (vgl. auch Read et al. 2005b:331). Nicht zuletzt wird die Reliabilität der Untersuchungen in Frage gestellt. Studien, die nach frühen Traumatisierungen fragen, basieren häufig auf Aussagen und Erinnerungen der betroffenen Menschen. Gerade bei psychotischen Menschen wird die Zuverlässigkeit dieser Erinnerungen immer wieder angezweifelt (vgl. Rosenberg et al. 2001:1456). Verschiedene Autoren (z.B. Read et al. 2005b:334; Vauth & Nyberg 2007:470) halten solche Einwände nicht für gerechtfertigt und verweisen auf Befunde, die die Reliabilität von Selbstauskünften bzgl. sexuellem Missbrauch in der Kindheit belegen: sie liege sowohl bei psychisch kranken Menschen als auch in der Allgemeinbevölkerung zwischen 74% bis 82%. 7 Abschließend sei erwähnt, dass auch diejenigen Autoren, die einen deutlichen Zusammenhang von traumatischen Erfahrungen, PTSD und Psychose postulieren, Traumata lediglich als einen möglichen Faktor für die Entstehung von Psychosen sehen: „It is also important to remember that there are multiple pathways to psychosis, and while trauma is clearly involved for some people with psychosis, there are many others with no history of trauma.“ (Read et al. 2005a:328) 1.2 PTSD als Folge psychotischen Erlebens Dass schwere körperliche Krankheiten oder Unfallverletzungen traumatische Qualität haben und behandlungsbedürftige psychische Folgen wie z.B. PTSD nach sich ziehen können ist mittlerweile recht gut belegt (vgl. Gunkel 2005:9ff.). Inwiefern dies auch auf psychotische Krankheiten übertragbar ist, wird aktuell wieder diskutiert. Bereits vor über 30 Jahren konstatierte JEFFRIES, dass Menschen im Anschluss an akute Psychosen Beschwerden entwickeln können, die phänomenologisch der heutigen Beschreibung einer PTSD gleichen (vgl. Schäfer & Aderhold 2005:61). Dies führte zu der Annahme, dass im Rahmen einer Psychose die von den Betroffenen als real erlebten Halluzinationen und Wahninhalte ihr Selbst- und Weltbild gleichermaßen erschüttern können, wie dies für reale Traumata beschrieben wurde. Diese Annahme wird allerdings nicht von allen Fachleuten geteilt. Kritiker wie z.B. BOTTLENDER (2007) sind der Ansicht, die inneren Erlebniswelten im Rahmen einer Psychose seien nicht mit realen Traumata vergleichbar und erfüllten v. a. nicht die geforderten Trauma-Kriterien nach DSM IV8: „Hier möchte man einwenden, dass zwischen beiden Arten traumatischer Ereignisse (real vs. psychotisch) wie auch zwischen den subjektiven Erlebens- und Verarbeitungsmodi beider Traumata so erhebliche qualitative Unterschiede bestehen, dass es fraglich erscheint, ob diesbezüglich eine Gleichsetzung ohne weiteres möglich ist“. (Bottlender 2007:56) 8 Im Kriterium A1 der DSM IV wird das traumatische Erlebnis definiert als „Ereignis, das mit plötzlichem, unerwarteten oder gewaltsamen Tod Nahestehender verbunden oder für den Patienten selbst lebensbedrohlich war, eine schwere Verletzung oder andere Bedrohung der körperlichen Integrität darstellte“ (Vauth & Nyberg 2007: 468) 8 Selbst wenn man dies bejahe, so stelle sich die Frage „warum nicht auch andere schwere psychische Erkrankungen oder z. B. auch Albträume zu PTSD führen können“ (ebd.). Diesem Einwand stehen jedoch empirische Belege entgegen (vgl. Gunkel 2005:16 ff.): So „kann die paranoid-halluzinatorische Psychose wegen damit einhergehender subjektiv penetranter Symptome geradezu als Prototyp eines Psychotraumas gesehen werden.[…] Für viele Betroffene ist das […] psychotische Angsterleben derart leibnah und echt, dass sie in solchen Situationen sogar aus Verzweiflung einen ‚Selbstmordversuch’ unternehmen, um einem quälenden Gedanken oder einer vermeintlichen Todesgefahr zu entkommen.“ (ebd.:18f.) Auch VAUTH & NYBERG (2007:465) kommen zu dem Schluss, dass psychotisches Erleben wie Verfolgungswahn oder das Hören imperativer Stimmen durchaus Gefühle akuter Lebensbedrohung auslösen kann. Selbst wenn das psychotische Erleben streng genommen das A1-Kriterium nach DSM IV nicht erfüllt sei zu bedenken, dass die DSM IV (im A2 Kriterium) explizit die Subjektivität des traumatischen Erlebens (Ängste, Kontrollverlust) berücksichtigt (vgl. hierzu auch Priebe et al. 2002:6). Generell plädieren VAUTH & NYBERG (ebd.) dafür, das A1Kriterium nicht über zu bewerten, sofern die übrigen Kriterien erfüllt sind. Dies sei bei präpsychotischen PatientInnen z.B. bzgl. der PTSD typischen Meidung erinnerungsprovozierender Situationen zu beobachten, was wiederum (so das Ergebnis einer 2004 publizierten Studie von HARRISON & FOWLER) nicht selten zu Ablehnung psychiatrischer Behandlung führt (vgl. Gunkel 2005:18). Auch könne die Krankheitsverarbeitung mit Gefühlen extremer Identitätsbedrohung einhergehen, die ebenfalls zum Störungsbild der PTSD gehöre (vgl. Vauth & Nyberg 2007:465). Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die publizierten Untersuchungen zu Fragen nach ‚psychoseinduzierter PTSD’ qualitativ und quantitativ noch unzureichend sind und es an empirisch hinreichend gesicherten Erkenntnissen fehlt (ebd.:468). Kritisiert wird unter anderem, dass zu wenig zwischen ‚psychoseinduzierten’ und iatrogenen traumatisierenden Effekten differenziert wurde (vgl. Bottlender 2005). Dies wird sich allerdings auch über methodisch elaboriertere Untersuchungen kaum bewerkstelligen lassen, da psychotisches Erleben und psychiatrische Behandlung in einer „komplexen und 9 intensiven Gesamterfahrung“ (Gunkel 2005:17) münden. Gleichwohl ist es sinnvoll diese beiden Aspekte zumindest theoretisch voneinander zu trennen, weshalb im nachfolgenden Kapitel traumatische Qualitäten psychiatrischer Behandlung gesondert diskutiert werden. 1.3 Sancutary Trauma – PTSD als Folge psychiatrischer Behandlung Spätestens seit der PSYCHIATRIE-ENQUETE ist bekannt, dass psychiatrische Behandlung traumatisierende Qualitäten haben kann. Fraglos wurde seitdem Vieles zu Gunsten der PatientInnen verbessert: Restriktionen wurden abgebaut, Rahmenbedingungen und Möglichkeiten stationärer psychiatrischer Behandlung verbessert. Gleichwohl können insbesondere psychotische PatientInnen durch psychiatrische Behandlung traumatisiert werden und psychische „iatrogene Schäden“ (Gunkel 2005:25) erleiden (vgl. z.B. Bottlender 2005; Schäfer & Aderhold 2005; Vauth & Nyberg 2007), was unter dem Begriff des SANCTUARY TRAUMA9 diskutiert wird. Dies ist bei psychotischen PatientInnen durch ein ‚doppeltes Ausgeliefertsein’ gekennzeichnet, nämlich sowohl an die Krankheit als auch an die psychiatrische Behandlung (vgl. Gunkel 2005:25). Zu nennen sind neben der Bedrohung durch schwer gestörte und aggressive Mitpatienten bis hin zu sexueller Gewalt (vgl. Rosenberg et al. 2001:1454) insbesondere mit physischer und psychischer Gewalt verbundene Maßnahmen wie Unterbringung durch Polizei, Fixierung, Isolierung und Zwangsmedikation, die – verstärkt durch psychotisches Erleben – zu Todesängsten führen können. Exemplarisch beschreibt GUNKEL (2005:25 ff.) sehr plastisch, wie von PatientInnen im Zusammenhang mit Fixierungen Ärzte als Folterer, Vergewaltiger, Organdiebe und Beruhigungsspritzen als Todesspritzen ‚identifiziert’ wurden. Nicht selten kommt es dabei zur Reaktualisierung früherer realer traumatischer Erlebnisse (vgl. ebd.:29). 9 Der Begriff wurde zuerst von Silver (1986) in Zusammenhang mit kriegstraumatisierten Vietnamheimkehrern verwendet, die in auf ‚Heilung’ ausgerichteten amerikanischen Einrichtungen „Erfahrungen von Ungastlichkeit, Unsicherheit und Despektierlichkeit“ (Gunkel 2005:27) machten. 10 Für einen beträchtlichen Teil der PatientInnen sind die mit psychiatrischer Hospitalisierung verbundenen Erlebnisse so erschütternd, dass sie zu einer PTSD führen, was verschiedene Untersuchungen belegen (vgl. Schäfer & Aderhold 161f.). So fanden z.B. MC GORRY ET AL., die 36 ersterkrankte Psychose- PatientInnen untersuchten, 4 Monate nach der Entlassung bei 46% die Kriterien für eine PTSD erfüllt. Etwa ein Jahr nach der akuten Episode waren es noch 36% (vgl. Schäfer & Aderhold 161f.; Vauth & Nyberg 2007:465). FRAME & MORRISON kommen zu etwas höheren Werten: 67% der PatientInnen erfüllten nach 4 Monaten PTSD-Kriterien und noch 50% nach 6 Monaten (vgl. ebd.). Zu ähnlichen Ergebnissen kommen SHAW ET AL. (PTSD bei 52% von 45 PatientInnen) sowie PRIEBE ET AL. (2002; PTSD bei 51% von 105 PatientInnen in stationärer Therapie). Lediglich MEYER ET AL. kommt zu weitaus niedrigeren Zahlen: 8 Wochen nach stationärer Aufnahme erfüllten 11% der PatientInnen die Kriterien einer PTSD. Dabei war der Zusammenhang von PTSD mit der psychiatrischen Behandlung weniger virulent als der Zusammenhang mit der Psychose selbst. Möglicherweise ist dieses abweichende Ergebnis auf die stark selektierte Stichprobe zurückzuführen: viele PatientInnen, die Zwangsmaßnahmen erlebt hatten, verweigerten ihre Teilnahme an der Untersuchung (vgl. Schäfer & Aderhold 161f). Insgesamt lassen die exemplarisch genannten Untersuchungen auf ein SANCTUARY TRAUMA bei einem erheblichen Teil der PatientInnen schließen, wenngleich auch hier wieder angemerkt werden muss, dass die Untersuchungen teilweise methodische Schwächen aufweisen und meist auf eher geringe Stichproben basieren. 1.4 PTSD als Chronifizierungsfaktor für schizophrene Symptome Ein eher indirekter komplexer Zusammenhang zwischen Trauma und Psychose wird hergestellt, wenn PTSD typische Syndrome als wesentlicher Chronifizierungsfaktor für schizophrene Symptome gewertet werden (vgl. Vauth 2007; Vauth & Nyberg 2007). Erstens, so wird vermutet, könne das mit einer PTSD einhergehende anhaltende Hyperarousal bei gleichzeitig vorliegender Psychose zu Chronifizierung und Intensivierung der Positivsymptomatik beitragen, was u. a. 11 bei psychotischen Kriegsveteranen mit diagnostizierter PTSD beobachtet wurde. Zweitens sei der häufig mit PTSD einhergehende soziale Rückzug als Risikofaktor für Rückfälle und Rehospitalisierung einzuschätzen, da er mit Mangel an sozialer Unterstützung, an Überprüfung eigener Einschätzung und an Stimulation verbunden sei. Drittens trage die Vermeidung trauma-assoziierter Erlebnisse, Gedanken und Erinnerungen zu einem auf Leugnung ausgerichteten „Sealing over -Stil der Krankheitsverarbeitung“ (Vauth 2007:55) bei und erschwere die Compliance. Dies wiederum sei mit unzureichender Inanspruchnahme psychiatrischer, therapeutischer und psychosozialer Hilfen verbunden, wodurch sich insgesamt nicht nur das Risiko einer Chronifizierung sondern auch das Risiko der Entwicklung sekundärer Störungen wie Depressionen und Substanzmissbrauch erhöht. Letzteres wiederum könne „im Sinne eines Circulus vitiosus“ (Vauth & Nyberg 2007:466) indirekt die Vulnerabilität für Retraumatisierung steigern, da z.B. durch noradrenerg stimulierende Substanzen das Risiko von Intrusionen erhöht wird VAUTH UND NYBERG (ebd.:267) geben zwar zu bedenken dass für die oben beschriebenen Zusammenhänge bislang keine ‚harten’ empirischen Belege vorliegen, sondern entsprechende Ergebnisse meist auf retrospektiven Querschnitts-Studien beruhen. Gleichwohl konstatieren sie insgesamt eine hohe Plausibilität der Zusammenhänge und regen an, diese zukünftig in prospektiven Längsschnitt-Studien zu überprüfen. 2. HERAUSFORDERUNGEN FÜR PSYCHIATRISCHE KLASSIFIKATION UND DIAGNOSTIK Angesichts der im vorherigen Kapitel dargestellten Bezüge zwischen Trauma, PTSD und schizophrenen Psychosen stellt sich die Frage, inwiefern dies Implikationen für die aktuelle (klinisch-psychiatrische, therapeutische, psychosoziale, versicherungsrechtliche) Versorgungspraxis hat, die ja wesentlich auf Klassifikation und differenzialdiagnostische Zuordnung von Symptomen zu einem der beiden Störungsbildern basiert. Der Erörterung dieser Frage wird ein kurzer Abriss über Symptomüberschneidungen bei beiden Störungsbildern voran gestellt. 12 2.1 Symptom Overlap Nicht selten erhalten PatientInnen verschiedene psychiatrische Diagnosen, z.B. ‚Schizophrenie’, bevor ihnen eine PTSD attestiert wird. Dies verweist unter anderem auf Ähnlichkeiten bzw. Symptom-Überschneidungen in den Störungsbildern, die aktuell unter dem Begriff SYMPTOM OVERLAP erforscht und diskutiert werden (vgl. Schäfer & Aderhold 2005: 60f; Streeck-Fischer 2000; Vauth & Nyberg 2007; Rosenberg et al. 2001:1554). „Epidemiologisch betrachtet weisen rund ein Zehntel (10,9%) aller Personen mit manifester PTSD gleichzeitig auch eine schizophrenieforme oder schizophrene Erkrankung auf [...], während bei klinischen Stichproben ratsuchender PTSD-Patienten etwa ein Drittel (28%40%) auch psychotische Symptome berichtet.“ (Gunkel 2005:5). Phänomenologisch werden insbesondere akustische Halluzinationen und Störungen von Selbst-, Affekt und Impulsregulation beschrieben, die sich einem Positiv- oder Negativ-Cluster zuordnen lassen (vgl. Schäfer & Aderhold 2005: 60f). Bei Menschen mit einer PTSD sind z.B. Betäubung, Apathie, Rückzug, Vermeidung von Reizen entsprechend der ‚Minus-Symptomatik’ bei Schizophrenie beobachtbar sowie Übererregungszustände, Schlafstörungen und paranoide Ideen entsprechend der ‚Plus-Symptomatik’ (vgl. Streeck-Fischer 2000:55 f.). Die im Rahmen einer PTSD auftretenden dissoziativen Zustände grenzen phänomenologisch an floride psychotische Symptome (vgl. Gunkel 2005:5). Aus psychodynamischer Sicht lässt sich sowohl für PTSD als auch für schizophrene Psychosen eine gravierende Destabilisierung der Subjekt-ObjektGrenze und damit eine Störung im Erleben einer eigenen individuellen Identität beschreiben (vgl. Dümpelmann 2003). Auf neurobiologischer Ebene sind sowohl bei Menschen mit PTSD als auch bei Psychotikern gesteigerte Aktivitäten dopaminerger und serotonerger Transmitter sowie der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinde-Achse beobachtbar. Weiter werden Veränderungen der auditorischen Reizschwelle und der langsamen Augenfolgebewegungen sowie Hirnhemisphärengröße und -Funktion genannt, sowie Ventrikelerweiterungen und ein erhöhter Kortisol-Spiegel (vgl. Dümpelmann 2003:2; Schäfer 2007:11; Vauth & Nyberg 2007:467). 13 2.2 Komorbide Störungen oder diagnostische Artefakte? Der SYMPTOM OVERLAP bei schizophrenen Störungen und PTSD mag ein wesentlicher Faktor dafür sein, dass nicht wenige Menschen im Verlauf ihrer ‚Krankenkarriere’ eine Reihe psychiatrischer Diagnosen erhalten, worin sich auch die prinzipielle Schwierigkeit einer differenzialdiagnostischen Zuordnung zu einem der Störungsbilder zeigt10. Man könnte ganz grundsätzlich die Frage stellen, ob es sich in solchen Fällen um Fehldiagnosen, um ‚echte’ Komorbiditäten oder schlicht um durch Klassifikationssysteme konstruierte Unzulänglichkeiten handelt. In der Argumentation von SCHÄFER & ADERHOLD (2005:60) findet sich eher die Annahme von Fehldiagnosen und subtil auch die der diagnostischen Artefakte wieder. Sie weisen darauf hin, dass bei „positiver Traumaanamnese“ (ebd.) psychotischer PatientInnen häufig eine Um-Interpretation der Symptome in ohnehin empirisch umstrittene Konstrukte wie z.B. „Pseudohalluzination“ (ebd.) statt findet (vgl. auch Read et al. 2005b). Eine analoge Symptom-Deutung findet bei PatientInnen mit Erstdiagnose PTSD statt. SCHÄFER & ADERHOLD (2005:61) merken hierzu kritisch an, dies geschehe „nicht aufgrund phänomenologischer Kriterien, sondern ausgehend von der Annahme, dass sie [die Symptome] bei Vorliegen einer offensichtlichen posttraumatischen Symptomatik nicht anders zu deuten seien“. Während SCHÄFER & ADERHOLD den Schluss ziehen, dass aufgrund diagnostischer Unzulänglichkeiten bei PatientInnen mit einer PTSD eine gleichzeitig vorhandene Psychose häufig nicht erkannt werde, argumentiert BOTTLENDER (2007:56) umgekehrt: auch er konstatiert eine „Überlappung der i. R. einer Schizophrenie typischerweise vorkommenden psychotischen, negativen und depressiven Symptome mit jener Symptomatik, die im Kontext einer PTSD zu erwarten ist“. Somit sei eine „reliable Zuordnung der Symptomatik“ zu einer der in Frage 10 U. a. Vauth & Nyberg (2007) schlagen vor als differenzialdiagnostisches Kriterium den inhaltlichen Bezug von Halluzinationen bzw. Intrusionen zum traumatischen Erlebnis heranzuziehen (inhaltlicher Bezug vorhanden = PTSD; inhaltlicher Bezug nicht vorhanden = Psychose). Streeck-Fischer (2000: 52) hält dem entgegen, dass im Rahmen einer PTSD charakteristischerweise konkrete Erinnerungen als Folge von Amnesien und Dissoziationen verloren gehen und im Rahmen von Psychosen Halluzinationen verzerrt sein können. Ebenso wird der Vorschlag Ich-Störungen und Denkstörungen hinsichtlich des Selbst, der Zeit und des Ortes, als differenzialdiagnostisches Kriterium für ‚echte’ Psychosen in Abgrenzung zu traumatisch bedingten ‚Pseudopsychosen’ heranzuziehen (vgl. Vauth & Nyberg 2007:464) von Streeck-Fischer als empirisch nicht haltbar zurück gewiesen (vgl. ebd.:56). 14 stehenden Diagnose nicht möglich. Vor diesem Hintergrund kritisiert BOTTLENDER die Forschungsergebnisse der Studien zu PTSD bei Schizophrenie als konzeptuell einseitig: gehe man von der Annahme aus, dass „eine Psychose ein Trauma in der Konzeptualisierung der PTSD darstellt“ und betrachte man die Symptome losgelöst vom Kontext der Schizophrenie, so ließen sich die Symptomkriterien für eine PTSD ebenso leicht erfüllen wie für andere komorbide Störungen: „So können sich aufdrängende, belastende Gedanken an die Psychose im Sinne intrusiver Gedanken interpretiert werden. Ebenso sind Erinnerungslücken oder bestimmte Übererregungssymptome und insbesondere Vermeidungsverhalten oder emotionale Taubheit im Sinne einer Affektverflachung Symptome, die bei einer Schizophrenie häufig beobachtet werden können“. (Bottlender 2007:56) Aufgrund der Komplexität des schizophrenen Erscheinungsbildes könnten neben einer PTSD zahlreiche weitere komorbide Störungen diagnostiziert werden, was, so BOTTLENDER, in der Praxis auch häufig geschieht11. Angesichts der aktuell favorisierten „rein deskriptiven, atheoretischen und im Prinzip anosologischen Diagnostik“ und der empirisch nicht ausreichend gesicherten Krankheits-Konzepte warnt er jedoch vor „zu ausufernder Polydiagnostik komorbider Erkrankungen und spekulativen Interpretationen“ (ebd.). Vielmehr sei diagnostische Bescheidenheit geboten. DÜMPELMANN (2003) konstatiert bei der Diagnostik von PTSD und schizophrenen Störungen einen „paradigmatischen Filter“ (ebd.:1), der dazu führe entweder eine „echte“ oder eine „hysterische“ (ebd.) Psychose zu diagnostizieren und die jeweils andere Möglichkeit auszublenden. Den Grund hierfür sieht er in der erzwungenen kategorialen Trennung gängiger psychiatrischer Klassifikationssysteme, die ihrem Anspruch rein deskriptiv und theoriefrei zu sein nicht gerecht werden. So wird z.B. in der ICD-10 differenziert zwischen „biologisch gedachten psychotischen (Gruppe F2) und neurotischen Krankheitsbildern (Gruppe F4), zu denen auch dissoziative Symptome bis hin zu den so genannten hysterischen Psychosen gerechnet werden“ (ebd.). Diese Trennung hat, so Dümpelmann weit reichende Folgen für 11 Dasselbe gilt bei der ‚Hauptdiagnose’ PTSD: Neuere Untersuchungen geben komorbide Störungen, insbesondere Major Depression, Angststörungen und Substanzmissbrauch mit 80% an (vgl. Priebe et al. 2002: 7). 15 die Entwicklung diagnostischer Instrumente, therapeutischer Verfahren und für die Versorgungspraxis sowie für die wissenschaftliche Forschung. READ ET AL. (2005a:328), weisen auf die Subgruppe von PatientInnen mit drogeninduzierten Psychosen und PTSD hin. READ ET AL. werten sowohl PTSD als auch Substanzmittelmissbrauch und sekundär Psychosen als „response of trauma“ (ebd.). Vor diesem Hintergrund sei die klassifikatorische Konzeption von Psychosen zu überdenken und hinsichtlich traumatischer Wirkungen zu erweitern. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in der aktuellen Diskussion um PTSD und Schizophrenie einerseits PTSD als komorbide Störung bei PatientInnen mit Psychosen aufgefasst wird. Andererseits werden psychotische Syndrome als eine von vielen möglichen Reaktionen auf Traumatisierung (u. a. neben PTSD) postuliert. Dabei entsteht der Eindruck, dass die komplexen Störungsbilder mit den vorhandenen Klassifikationen und Konzepten nicht hinreichend erfasst werden können (vgl. Priebe et al. 2002). 2.3 In Auswirkungen auf die Diagnostik engem Zusammenhang mit der zugrunde gelegten psychiatrischen Klassifikation steht die Frage der Diagnostik, wie bereits in Kapitel 1.2 bezogen auf ‚psychoseinduzierte PTSD’ deutlich wurde. Zugespitzt könnte man fragen: Darf es eine ‚psychoseinduzierte PTSD’ nicht geben (obwohl empirische Befunde dafür sprechen), weil sie nicht ‚sauber’ diagnostiziert werden kann, so lange entsprechende Kriterien in DSM IV oder ICD10 dafür fehlen? Und wie ist im diagnostischen Prozess mit solchen ‚Unschärfen’ umzugehen? VAUTH & NYBERG (2007) warnen indirekt vor einer allzu starren Anwendung von KlassifikationsKriterien. Sie könne mitunter dazu führen, dass den PatientInnen, die nicht ‚ins Raster passen’ die adäquate Hilfe versagt bleibt. 16 In ähnlicher Weise kritisieren READ ET AL. – hier im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch in der Vorgeschichte von Psychosen – psychiatrische Klassifikationen: „If we where not constrained by the need for a diagnostic nomenclature we might not need to separate abuse sequelae into seemingly discrete categories such as PTSD, dissociative dissorders, schizophrenia, borderline personality disorder etc. We might be able to understand all these abuse-related symptoms, scattered throughout our diagnostic manuals as related components.” (Read et al. 2005b:340) Aus dieser Perspektive sollte der diagnostische Prozess, so fraglos eine Klassifikation heutzutage u. a. versorgungsrechtlich notwendig sein mag, nicht von dieser dominiert werden. Vielmehr gilt es das Bemühen um ein Verständnis der Gesamtzusammenhänge in den Vordergrund zu stellen. Dazu gehört es auch, in der diagnostischen Abklärung schizophrener Störungen regelhaft mögliche Traumatisierungen im Blick zu haben, um zu prüfen ob gezielte therapeutische Interventionen angebracht sind. Dies gilt insbesondere für PatientInnen mit mangelnder Compliance, häufigen Rückfällen, Positivsymptompersistenz und Suchtstörungen (vgl. Vauth & Nyberg 2007; Vauth 2007:56). 3. KONSEQUENZEN FÜR KONZEPTBILDUNG UND KLINISCH-THERAPEUTISCHE PRAXIS „It is important that policy makers services system administrators and providers recognize the prevalence and impact of trauma in the lives of people who have severe mental illnes.“ (Rosenberg et al. 2001:1459) Es wird eine systematische Berücksichtigung von Traumatisierungen bei psychotischen Menschen sowohl in der Konzeptbildung als auch in der klinischen Praxis gefordert (vgl. Schäfer 2007). Dies scheint besonders notwendig, angesichts der Tatsache, dass sich die Psychiatrie offensichtlich wieder in Richtung biologischer Modelle entwickelt, weniger nach psychosozialen und noch weniger nach lebensgeschichtlichen Einflüssen fragt (vgl. Schäfer 2007:14; Gresch o. D.; Dümpelmann 2003). 17 3.1 Erweiterung des Vulnerabilität-Stress-Modells In ätiologischen Psychose-Modellen wurden Traumatisierungen bis vor kurzem überwiegend als Faktoren betrachtet, die zwar zur Exazerbation einer Psychose, nicht aber zu ihrer Entstehung beitragen können. So gelten im Rahmen des Vulnerabilitäts-Stress-Modells (auch Diathese-Stress-Modell12) die Symptome einer PTSD wie z.B. flash-backs und Intrusionen oder die ständige Alarmbereitschaft des anhaltend erhöhten Erregungsniveaus als unspezifische13 interne Stressquelle (vgl. Schäfer & Aderhold 2005:60; Vauth & Nyberg 2007:464). Neuerdings wird eine Erweiterung des Vulnerabilitäts-Stress-Modells angemahnt, in dem Sinne, dass Vulnerabilität nicht nur als biologisch, sondern auch als traumatisch erworben aufgefasst wird (vgl. z.B. Schäfer 2007; Schäfer & Aderhold 2005:59 f; Dümpelmann 2003). SCHÄFER (2007:11) verweist auf psychologische und biologische Auswirkungen von Beziehungs-Traumatisierungen, die sich weitgehend mit der Konzeptualisierung von Vulnerabilität decken: „Dazu zählen kognitive Schemata, Selbstwert, Kontrollüberzeugungen und Attributionsstile oder auch die Regulation von Affekten. Auf neurobiologischer Ebene können […] frühe Erfahrungen anhaltende Effekte auf die sog. ‚Hypothalamus-Hypophysen- Nebennierenrinde-Achse’ haben, die eine wesentliche Rolle bei der Stress-Regulation spielt.“ (ebd.) Es scheint zu kurz gegriffen, traumatische Erfahrungen rein als Stressoren – also Psychose auslösende Faktoren – zu betrachten. 12 Das von ZUBIN & SPRING, CIOMPI, NUECHTERLEIN u. a. publizierte Modell basiert auf der Annahme, dass bei der Entwicklung einer schizophrenen Störung Diathese und Stress zusammenwirken: gefährdete Personen zeichnen sich durch eine besondere Vulnerabilität aus, was bei akut auftretenden Stressoren oder chronischer Belastung zum Ausbruch einer Psychose führt. 13 Unspezifisch insofern, als der moderierende Einfluss von Umweltfaktoren (z. B. unterstützendes soziales Umfeld, psychiatrische und psychotherapeutische Hilfen), Attributions- und Bewältigungsmuster für den weiteren Verlauf eine Rolle spielen (vgl. Vauth 2007: 55f.) 18 Vielmehr sei davon auszugehen, dass bereits der ‚Boden’ – die Vulnerabilität – durch Traumata entstehen kann, die somit ein Faktor im möglichen Ursachenbündel für Psychosen darstellen14: “Negative beliefs about self, world an others (such as ‚I am vulnerable’ and ‘Other people are danerous’) have been shown to be associated with the development of psychotic experiences. ” (Read et al 2005a) Mit dem Vorschlag, das Vulnerabilitäts-Stress-Modell in diesem Sinne zu erweitern ist die Intention verbunden der Interaktion biologischer, psychischer und sozialer Faktoren eine weitere Perspektive hinzu zu fügen, damit überwiegend biologisch fundierte Annahmen zu relativieren, ohne genetische Krankheitsfaktoren auszublenden. Vielmehr geht es um die Frage „what type of realationship genes and environment may have in shaping the risk for psychosis“ (Read et al. 2005b:344). ‚Neu’ an diesem Zugang ist der konkrete und direkte Bezug zur Lebensgeschichte traumatisierter und psychotischer Menschen (vgl. Dümpelmann 2003:4). Dies bedeutet eine Abkehr von „Neuro- oder Psychomythen“, die das „Eigentliche von Krankheitsursachen […] hinter und unter den Dingen oder in der Tiefe“ (ebd.) verorten. 3.2 Traumasensible und traumaspezifische Psychotherapie Offensichtlich wird in der Behandlung und Therapie psychotischer PatientInnen möglichen traumatischen Erlebnissen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt (vgl. z.B. Schäfer & Aderhold 2005:60; Read et al 2005a; Gunkel 2005:40 f.). So ergab eine Untersuchung von RESNICK ET AL. dass ein Drittel der von ihnen befragten PatientInnen im Interview zum ersten Mal über ihre Traumatisierung gesprochen haben. 36% hatten darüber nie mit der Familie oder im Freundeskreis, 38% darüber nie mit ihren TherapeutInnen gesprochen (vgl. Vauth & Nyberg 2007:469). Es wird daher gefordert, therapeutische 14 Angebote für Menschen mit Hierzu wird angemerkt, dass es zwar noch an einschlägigen prospektiven Studien fehle und die meisten bisherigen Befunde als Korrelationen zu verstehen sind. Somit sei ein stringenter oder gar monokausaler Zusammenhang zwischen Trauma bzw. PTSD und Psychose nicht nachweisbar (vgl. Vauth & Nyberg 2007: 465; Dümpelmann 2003: 3). Allerdings gebe es vielfache Belege dafür, dass „Traumatisierungen die psychische Entwicklung erheblich stören und auch arretieren können, […] gerade auch die Entwicklung solcher Funktionen, die für Entstehung und Verlauf psychotischer Störungen relevant sind und deshalb deren Auftreten wahrscheinlicher machen“ (Dümpelmann 2003: 3). 19 schizophrenen Psychosen generell „traumasensibler“ (Schäfer 2007:14) zu gestalten. Erstens sollen alle therapeutischen und psychiatrischen Interventionen so gestaltet werden, dass, wo immer möglich, eine Retraumatisierung vermieden wird (vgl. auch Kapitel 3.3). Zweitens sollte das therapeutische Setting ausreichend äußere und innere Sicherheit bieten, z.B. durch die Übernahme von Eigenverantwortung bei Therapie-Entscheidungen oder das setzen von Grenzen sowie die Ermöglichung von Rückzug. Drittens sollten in diesem Rahmen Therapeutinnen und ÄrztInnen systematisch Gesprächsangebote zu traumatischen Erfahrungen machen (vgl. hierzu auch Read et al 2005a). Die Berücksichtigung der „Traumaperspektive“ (Schäfer 2007:14) in der Therapie ermöglicht es den Betroffenen, ihre Symptome besser zu verstehen und ihre Selbstwirksamkeit zu erhöhen15 (vgl. Read et al. 2005a:328). Den Profis hilft es zu einer differenzierteren Interpretation und besseren Orientierung an den Bedürfnissen der Betroffenen. Verhaltenstherapeutische Programme „There is a consensus, that the field needs to develop evective interventions for people who have severe mental illnes and a history of trauma.“ (Rosenberg et al. 2001:1458) Verschiedene Autoren weisen auf die Notwendigkeit hin, neben traumasensibler Behandlung auch traumaspezifische Angebote – z.B. verhaltenstherapeutisch orientierte Verfahren – für psychotische Menschen mit PTSD zu entwickeln und zu evaluieren. Es gebe bislang keine Belege dafür, dass diese bei Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen generell riskant oder nicht einsetzbar sind16 (vgl. Schäfer 2007:15; Vauth & Nyberg 2007:467; Rosenberg et al. 2001:1457). Zwar liegen bislang keine evidenzbasierten Programme für traumatisierte Psychotiker vor (vgl. Gunkel 2005:42). Allerdings finden sich Ansätze für entsprechende 15 READ ET AL. (2005b: 344) merken hierzu an, dass nicht jeder traumatisierte/psychotische Mensch psychotherapeutische Unterstützung braucht oder wünscht. In diesem Fällen könnte es einen erheblichen positiven Effekt haben, jenseits von Psychotherapie, die Symptome vor dem Hintergrund der Lebensgeschichte verständlich zu machen. 16 VAUTH & NYBERG (2007: 467) und GUNKEL (2005: 41 f.) weisen allerdings darauf hin, dass die Trauma-Exposition therapeutisch sehr vorsichtig eingesetzt werden soll, da diese meist eine psychische bzw. affektive Destabilisierung mit sich bringt. Bei schweren Depressionen, massiven Ängsten, genereller Verunsicherung (z.B. Umbrüche in Lebenssituationen) sollte deshalb ihrer Ansicht nach auf eine Trauma-Exposition verzichtet werden. Auch massive formale Denkstörungen könnten den therapeutischen Prozess erschweren. 20 therapeutische Angebote z.B. in dem Programm TERM, das auf Stabilisierung und Aufbau von Bewältigungsstrategien, v. a. bei früh Traumatisierten ausgerichtet ist (vgl. Schäfer 2007:15). Ein anderes Beispiel ist das von FRUEH ET AL. entwickelte Manual, von dem allerdings bislang bei Menschen mit Psychosen nur einzelne Bausteine evaluiert wurden. Das gesamte Programm erstreckt sich mit 30 bis 40 Sitzungen über 9 bis 12 Monate und umfasst Psychoedukation, Angstbewältigungs- und soziales Kompetenztraining sowie eine traumaspezifische Expositionsbehandlung. Mit Ausnahme der Expositionsbehandlung, die am Ende der Behandlung steht, sind die Bausteine gruppentherapeutisch ausgerichtet (vgl. Vauth & Nyberg 2007:467). READ ET AL. (2005a:328) erwähnen zudem den Einsatz von „voice diaries“ mit Coping-Strategien zum rationalen Umgang mit Halluzinationen. Psychoanalytische Ansätze DÜMPELMANN (2003) und STREECK-FISCHER (2000) befassen sich mit der Frage der Konsequenzen für die psychoanalytische Therapie, wenn anerkannt wird, dass viele psychotische Menschen in ihrer Lebensgeschichte interpersonale Traumata erlebt haben und dies in Zusammenhang mit der Psychose steht. Ausgangspunkt der Überlegungen von DÜMPELMANN ist das KONZEPT DER KONTINGENZ- ERFAHRUNGEN: „Kontingenzen sind prozedurale Schemata, die Ursache-Wirkungs-Relationen folgen […]. Was ist passiert, was habe ich erlebt, wie habe ich gehandelt, wenn mein Gegenüber so agiert hat? Und wie war es umgekehrt? Der Akzent liegt auf dem konkreten Ablauf des Handlungs- und Affektdialogs, nicht auf psychodynamischen Annahmen zur Verarbeitung“ (ebd.:7f.) Anhand von Fallbeispielen beschreiben DÜMPELMANN und STREECK-FISCHER, wie sich im Falle früher Traumatisierungen ungünstige frühkindliche Handlungsdialoge manifestieren, (Dümpelmann zu „massiven 2003:6) führen Störungen und damit der Subjekt-Objekt-Grenzen“ Psychosen begünstigen. Zum Verständnis der psychotischen Symptome sei daher weniger tiefenpsychologische Interpretation gefragt als vielmehr ein empathisches Begreifen im konkreten Bezug auf die Lebensgeschichte mit dem Ziel „traumatische Kontingenzen“ (ebd.) zu erfassen und „eine Symbolwelt zu schaffen, die das Unfassbare fassbar macht 21 und in der die Patienten ihr Weiterleben zurechtrücken können“ (Streeck-Fischer 2000:68). Eine solche psychoanalytische Herangehensweise bedeutet nicht nur die Relativierung klassischer libidotheoretischer und struktureller Konzepte. Sie erfordert von den TherapeutInnenen auch die Konfrontation mit „Anstößigem und Abschreckendem“ (Dümpelmann 2003:4) auszuhalten und zu akzeptieren, dass „Erlebnisse von seelischem Tod, Zerfall, Auflösung und Vernichtung in vielen Fällen eben kein ‚Nichts’, sondern erlebte Geschichte sind“ (ebd.:10) 17. 3.3 Psychiatrische Behandlung und Pharmakologie In Kapitel 1.3 wurde (stationäre) psychiatrische Behandlung als Risikofaktor für die (Re-)Traumatisierung psychotischer PatientInnen beschrieben. Folgerichtig zielen Empfehlungen zur ‚traumasensiblen’ psychiatrischen Behandlung vorrangig auf Maßnahmen zur Vermeidung von SANCTUARY TRAUMA. In diesem Zusammenhang wird auch der Einsatz ‚erinnerungsmodifizierender’ Substanzen diskutiert. Vermeidung von SANCTUARY TRAUMA Psychiatrische Interventionen sollen so gestaltet werden, dass, wo immer möglich, eine (Re-)Traumatisierung der PatientInnen vermieden wird (vgl. Schäfer 2007:14; Read et al. 2005a:328). Dies beginnt bei der „Gewaltprophylaxe“ (Gunkel 2005:33) sowohl auf Seiten der PatientInnen als auch auf Seiten des Personals. Angesprochen sind hier in erster Linie Rahmenbedingungen, die ein positives und gewaltfreies Behandlungsklima in psychiatrischen Kliniken ermöglichen. Dazu gehört ein ausreichender Personalschlüssel, die Vermeidung von Überbelegung (insbesondere auf Akutstationen) sowie die Qualifizierung und Sensibilisierung des Personals, z.B. durch Deeskalations-Trainings (vgl. ebd. 33 ff.; Schäfer 2007:15). 17 Streeck-Fischer (2000: 53 ff.) wertet die klassisch psychoanalytische Interpretation unerträglicher Schilderungen von PatientInnen als Abwehrversuch der TherapeutInnen: „Wir reagieren mit Seelenblindheit und Betäubung, um Verwirrung, Grauen und Erschütterung zu entgehen, ähnlich wie die Patienten selbst“ (ebd.:53). Dabei bedienten sich TherapeutInnen theoretischer Annahmen als „Schutzschild gegen Unbekanntes und Beängstigendes“ (ebd.:54). Diese Reaktion sei zwar verständlich, verhindere letztlich aber ein tieferes Verständnis traumatisierter Menschen sowie adäquate therapeutische Interventionen. 22 Gleichwohl lassen sich im klinischen Behandlungsalltag mit Gewalt verbundene Maßnahmen nur bedingt vermeiden, insbesondere dann, wenn sie dem Schutz anderer PatientInnen dienen. Belastende oder potenziell traumatische Interventionen sollten später mit den Betroffenen thematisiert und aufgearbeitet werden, sofern und sobald diese hierzu in der Lage und bereit sind. In diesem Zusammenhang kommen Behandlungsvereinbarungen eine wichtige präventive Funktion zu. In der gemeinsam von BehandlerIn und PatientIn ausgehandelten insbesondere Vereinbarung mit Zwang werden verbundene zukünftige Interventionen Maßnahmen. Dadurch geregelt, werden Interventionen für den/die PatientIn einschätzbarer und das traumatische Potenzial zumindest gesenkt (vgl. Gunkel 2005:35 f). Spezifische Empfehlungen werden in Bezug auf sexuell traumatisierte Patientinnen formuliert, die im Rahmen einer psychiatrischen Behandlung nicht selten der Gefahr einer Retraumatisierung aufgrund (angedrohter oder tatsächlich ausgeübter) sexueller Übergriffe durch männliche Mitpatienten ausgesetzt sind (vgl. Rosenberg et al. 2001:1454). Hier gilt es u. a. besondere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, die den Frauen einen Schutzraum ermöglichen. Eine sehr vulnerable Patientengruppe sind gerontopsychiatrisch erkrankte kriegstraumatisierte Frauen, die ihre traumatischen – häufig in Zusammenhang mit Vergewaltigung stehende – Erlebnisse wahnhaft verarbeiten. Hier soll v. a. beim Pflegepersonal eine Sensibilisierung herbeigeführt werden, da z.B. Waschungen im Genitalbereich als Teil der Pflege zum Trigger für das traumatische Erlebnis und zum Auslöser psychotischer Erregungszustände werden können (vgl. Böwing et al. 2008:78). Pharmakologische Behandlung Empfehlungen zur spezifischen medikamentösen Behandlung von Menschen mit Psychose und PTSD sind insgesamt nicht sehr zahlreich vorhanden. VAUTH & NYBERG (2007:467) schlagen eine neuroleptische Basistherapie (z.B. Risperidon) vor, da dies sowohl auf psychotische als auch auf PTSD-Symptome ‚dämpfend’ wirkt. Verwiesen wird auch auf positive Erfahrungen mit dem Einsatz atypischer Neuroleptika zur Verminderung der PTSD-Symptomatik. Allerdings beschränken 23 sich die bisherigen Befunde rein auf PatientInnen mit diagnostizierter PTSD (vgl. ebd.). Eine breitere Diskussion hat sich unter dem Stichwort THERAPEUTIC FORGETTING (vgl. Davis o. D.) um den Einsatz von Propranolol und Cortisol und deren moderierende Wirkung auf die Qualität traumatischer Erinnerungen entfacht. Im Zusammenhang mit invasiven medizinischen Eingriffen, der Behandlung von Angsterkrankungen und PTSD bei Kindern und Kriegsveteranen wurde festgestellt, dass durch die Zuführung dieser Substanzen eine Reduktion der Symptome bei traumatischen Belastungsstörungen erreicht, insbesondere die Intensität traumatischer Erinnerungsfragmente abgeschwächt werden kann18. Bezogen auf ‚behandlungsinduzierte’ PTSD stellt sich die Frage, nach dem Einsatz von Propranolol und Cortisol sozusagen als Sekundärprävention bei schizophrenen PatientInnen (vgl. Gunkel 2005:36). Mit anderen Worten: Durch medizinische Strategien könnte die ‚Heftigkeit’ einschießender Erinnerungen abgepuffert, somit die Ausbildung von Stress-Symptomen und letztlich das Risiko der Exazerbation von Psychosen ebenso wie das einer Chronifizierung der Schizophrenie reduziert werden. Allerdings sind mit solchen ‚Behandlungsstrategien’ ethische Fragen verbunden, da es sich dabei um einen tief greifenden Eingriff in die Persönlichkeit handelt und das ‚Recht auf Erinnerung’ tangiert ist. Auch ist es durchaus kritisch zu werten, wenn die Folgen iatrogener Traumatisierungen – vielleicht sogar vom selben Personal, das an der Traumatisierung beteiligt war – mittels der angesprochenen Substanzen abgemildert werden und somit z.B. Zwangsmaßnahmen im Nachhinein von PatientInnen als weniger drastisch erinnert werden. Möglicherweise behindert dies eine kritische Auseinandersetzung mit und die oben angemahnte Weiterentwicklung von stationären Behandlungssettings. 18 Die hirnorganischen Wirkzusammenhänge werden u. a. bei Gunkel (2005:36) skizziert. 24 4. SCHLUSSWORT In dieser Arbeit wurden verschiedene, zum Teil gegensätzliche, Diskussions- und Argumentationslinien zum Themenkomplex ‚Psychose und Trauma’ aufgegriffen. Dabei wurde deutlich, dass im aktuell geführten Diskurs zwar plausible Zusammenhänge und Vorschläge eingebracht werden, diese jedoch überwiegend noch zu wenig auf gesicherten empirischen Erkenntnissen fußen. Wie bereits mehrfach erwähnt weisen die bisherigen Studien häufig methodische Schwächen auf und beruhen meist auf kleinen, teilweise stark selektierten Stichproben. Hieraus ergeben sich Anforderungen an zukünftige Forschungsvorhaben in verschiedener Hinsicht. Methodisch sollte u. a. die Homogenität des untersuchten Personenkreises sicher gestellt, etablierte diagnostische Instrumente eingesetzt (vgl. Schäfer & Aderhold 2005:63) und unterschiedliche Behandlungs-Settings (ambulant, stationär) berücksichtigt werden (vgl. Vauth & Nyberg 2007). Konzeptionell scheint ein hoher Bedarf an prospektiven Längsschnitt-Studien zu verschiedenen Forschungsfragen zu bestehen, z.B. zu möglichen Zusammenhängen zwischen Suchterkrankungen schizophrenen Störungen und PTSD (vgl. Vauth 2007: 56). Insgesamt wird die Überwindung der Einengung auf Traumata durch sexuellen und körperlichen Missbrauch im frühen Kindesalter angemahnt. Vielmehr sollte das gesamte Spektrum möglicher Traumatisierungen in den Blick genommen werden (vgl. Schäfer & Aderhold 2005: 63), wozu auch Erlebnisse des Trauma-Typ I zählen. Ein Forschungsdesiderat besteht im Bereich der Prävention. Forschungsfragen sind z.B. ob frühe Intervention bei sexuellem Missbrauch präventive Wirkung gegenüber schizophrener Psychosen haben (vgl. Read et al. 2005b:331) oder ob behandlungsbedingte Traumata durch Krisendienste oder den vorrangigen Einsatz von Atypika sowie Verhaltenstherapie in der Akutbehandlung reduziert werden können (vgl. auch Read et al. 2005a: 328). Nicht zuletzt besteht Bedarf an fundierten Erkenntnissen über spezialisierte Interventionen für Menschen mit schizophrenen Psychosen und PTSD. Diese sollten über Praxisforschung zukünftig (weiter-)entwickelt und evaluiert werden (vgl. Schäfer & Aderhold 2005:63; Rosenberg et al. 2001:1454). 25 LITERATUR BERGER M. (Hrsg.) (2004): Psychische Erkrankungen. Klinik und Therapie. Urban & Fischer. München Jena BÖWING G., SCHMIDT K.U.R. & SCHRÖDER S.G. (2007): Erfüllen kriegstraumatisierte, gerontopsychiatrische Patienten PTSD-Kriterien? In: Psychiatrische Praxis 2007; 34:122 - 128. BÖWING G., SCHMIDT K.U.R., JUCKEL G. & SCHRÖDER S.G. (2008): Psychotische Syndrome bei kriegstraumatisierten älteren Patienten In: Der Nervenarzt 2008; 1:73 - 79. BOTTLENDER R. (2007): Posttraumatische Belastungsstörungen: Keine typische Folge von Schizophrenie. In: Vauth R. & Bottlender R.: Posttraumatische Belastungsstörungen bei Schizophrenie. Psychiatrische Praxis 2007; 34: 55 – 57 DÜMPELMANN M. (2003): Traumatogene Aspekte bei psychotischen Krankheitsbildern. Selbstpsychologie 12: 184-206 Im Internet: www.sbpm.de/?Literatur:Psychotraumatologie. 13 Seiten [25.06.2008] DAVIS J.L. (o. D.): Forget Something? We Wish We Could. ‘Therapeutic forgetting’ helps trauma victims endure their memories. Im Internet: www.webmd.com/anxiety-panic/features/forget-something-we-wish-we-could. 1 Seite [09.06.2008] DAVISON G.C. & NEALE J.M. (2002): Klinische Psychologie. Ein Lehrbuch. Beltz PVU. Weinheim GRESCH H.U. (O. D.): Traumata und Schizophrenie. Im Internet: www.herz-hirnund-hand.de/psychiatrie/schizophrenie-trauma.htm.htm. 2 Seiten [25.06.2008] 26 GUNKEL S. (2005): Psychotisches Erleben und psychiatrische Behandlungsbedingungen als sekundär traumatisierende Welten. In: Gunkel S. & Kruse G. (Hg.) (2005): „Um-Welten“ – Psychotherapie und Kontext. Reihe „Impulse für die Psychotherapie“, Band 10: 81 - 148. Hannoversche Ärzte Verlags Union. Hannover NORTH C.S. ET AL. (2008): Psychiatric Disorders among Transported Hurricane Evacuees: Acute-phase Findings in a Large Receiving Shelter Site. In: Psychiatric Annals 2008; 38: 104 - 113 PRIEBE S., BRÖKER M. & GUNKEL S. (1998). Involuntary admission and posttraumatic stress disorder symptoms in schizophrenia patients. In: Comprehensive Psychiatry 1998; 39(4): 220-224 PRIEBE S., NOWAK M. & SCHMIEDEBACH H.-P. (2002): Trauma und Psyche in der deutschen Psychiatrie seit 1889. Psychiatrische Praxis 2002; 29: 3-9 READ J. ET AL. (2005a): Trauma and : theoretical and clinical implications. In: Acta Psychiatrica Scandinavia 2005; 112: 327 - 329 READ J. ET AL. (2005b): Childhood trauma, psychosis and schizophrenia: a literature review with theoretical and clinical implications. In: Acta Psychiatrica Scandinavia 2005; 112: 330 - 350 ROSENBERG S.D. ET AL. (2001): Developing Effective Treatments for Posttraumatic Disorders Among People With Severe Mental Health Illnes. In: Psychiatric Services 2001; 52(11): 1453 - 1461 SCHÄFER I. (2007): Einfluss von Traumatisierungen auf psychische Erkrankungen. Vortrag, gehalten auf der 11. Fachtagung des Landesverbandes PsychiatrieErfahrener Rheinland-Pfalz e.V. am 28.09. in Mayen. Im Internet: www.lvperlp.de/pdf/_Dokumentation_11FT_komplett_fertig.pdf. Seite 9 - 19 [25.06.2008] 27 SCHÄFER I. & ADERHOLD V. (2005): Traumaforschung bei Menschen mit psychotischen Störungen. Schizophrenie 21 (2005). 58 - 66. STREECK-FISCHER A. (2000): Psychose und Trauma – Verrückungen als Traumafolge. In: Müller T. & Matejek N. (2000): Forum der analytischen Psychosentherapie 3: 48 - 70 TÖLLE R. & W INDGASSEN K. (2006): Psychiatrie. Springer. Berlin VAUTH R. (2007): Unterschätzter Einfluss posttraumatischer Belastungsstörungen auf Schizophrenie. In: Vauth R. & Bottlender R.: Posttraumatische Belastungsstörungen bei Schizophrenie. Psychiatrische Praxis 2007; 34: 55 - 57 VAUTH R. & NYBERG E. (2007): Unbehandelte Posttraumatische Belastungsstörungen bei schizophrenen Störungen: eine Hypothek auf die Zukunft? In: Fortschritt Neurologie und Psychiatrie 200; 75: 463 - 472 VETTER B. (2001): Psychiatrie. Ein systematisches Lehrbuch für Heil-, Sozial- und Pflegeberufe. Urban & Fischer. München Jena 28 Erklärung Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und außer den angeführten keine weiteren Hilfsmittel benutzt habe. Soweit aus den im Literaturverzeichnis angegebenen Werken einzelne Stellen dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, sind sie unter Angabe der Entlehnung kenntlich gemacht. Dies bezieht sich auch auf die in der Arbeit enthaltenen Tabellen und Abbildungen. Ich versichere, dass diese Hausarbeit bis jetzt bei keiner anderen Stelle veröffentlicht wurde. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ein Verstoß hier gegen zum Ausschluss von der Prüfung führt oder die Prüfung ungültig macht. München, .2008 ......................................................................... (Eva Kraus) 29