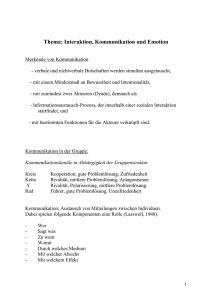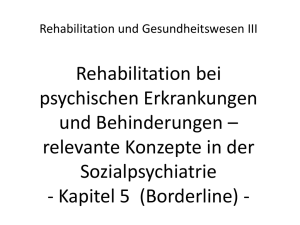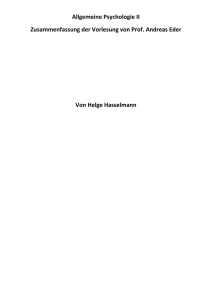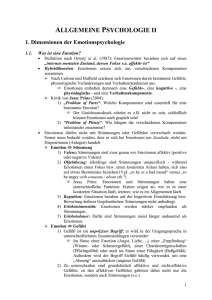ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE II
Werbung
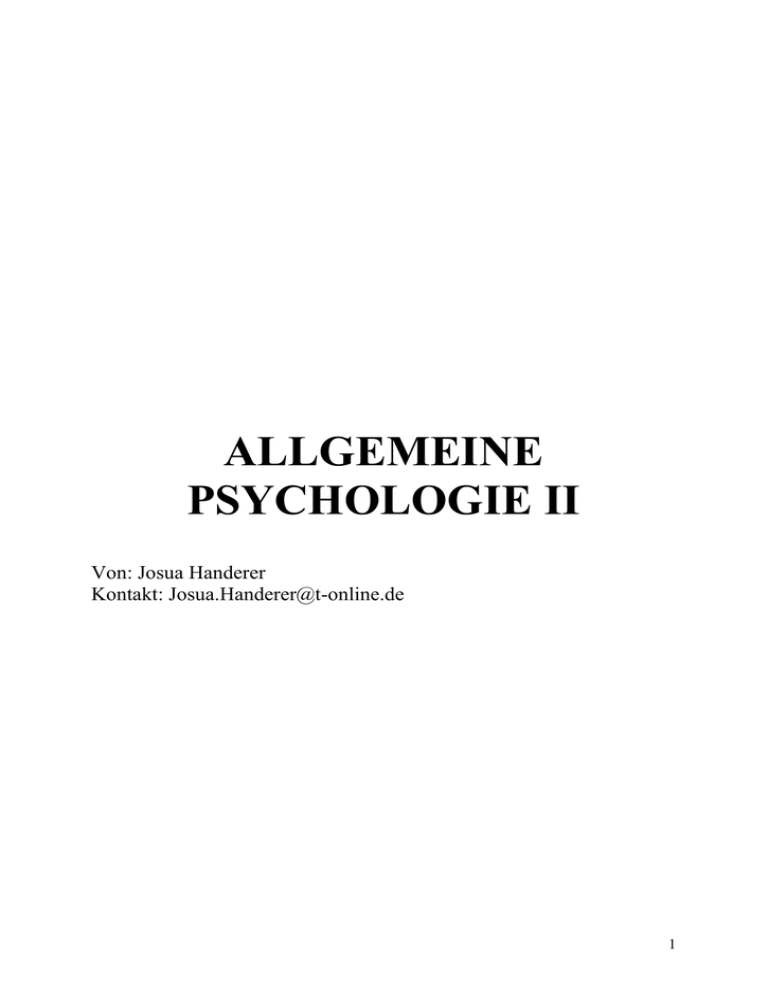
ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE II Von: Josua Handerer Kontakt: [email protected] 1 1. Dimensionen der Emotionspsychologie 1.1. Was ist eine Emotion? Definition nach Ortony et al. (1987): Emotionswörter beziehen sich auf einen „internen mentalen Zustand, dessen Fokus v.a. affektiv ist“ Hybridtheorien: Emotionen setzen sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Nach Carlson und Hatfield zeichnen sich Emotionen durch bestimmte Gefühle, physiologische Veränderungen und Verhaltenstendenzen aus. Emotionen enthalten demnach eine Gefühls-, eine kognitive -, eine physiologische - und eine Verhaltenskomponente. Kritik von Jessy Prinz (2004): 1) „Problem of Parts“: Welche Komponenten sind essentiell für eine bestimmte Emotion? Der Gesichtsausdruck scheint es z.B. nicht zu sein, schließlich können Emotionen auch gespielt sein! 2) “Problem of Plenty”: Wie hängen die verschiedenen Komponenten miteinander zusammen? Emotionen dürfen nicht mit Stimmungen oder Gefühlen verwechselt werden. Ferner muss bedacht werden, dass es sich bei Emotionen um Zustände, nicht um Dispositionen (Anlagen) handelt. Emotion Stimmung 1) Valenz: Stimmungen sind zwar genau wie Emotionen affektiv (positive oder negative Valenz) 2) Objektbezug: allerdings sind Stimmungen unspezifisch - während Emotionen einen Fokus bzw. einen konkreten Anlass haben, sich also auf etwas Bestimmtes beziehen (Vgl: „to be in a bad mood“ versus „to be angry with someone / about sth.“) Jessy Prinz: Emotionen und Stimmungen haben eine unterschiedliche Funktion: Erstere zeigen an, wie es in einer konkreten Situation läuft, letztere, wie es im Allgemeinen läuft. 3) Kognition: Emotionen beruhen auf der kognitiven Einschätzung bzw. Bewertung äußerer Gegebenheiten; Stimmungen nicht unbedingt. 4) Erlebnisintensität: Emotionen werden stärker empfunden als Stimmungen. 5) Erlebnisdauer: Dafür sind Stimmungen meist länger andauernd als Emotionen. Emotion Gefühl 1) Gefühl ist ein unpräziser Begriff; er wird in der Umgangssprache in unterschiedlichsten Zusammenhängen verwendet: Im Sinne einer Emotion (Angst, Liebe,…), einer „Empfindung“ (Wärme- oder Schmerzgefühl), einer Charaktereigenschaften (Pflichtgefühl) oder auch im Sinne einer Fähigkeit (Ballgefühl). Außerdem wird der Begriff Gefühl häufig verwendet, um eine „Ahnung“ auszudrücken (ungutes Gefühl) 2) Zu unterscheiden sind grundsätzlich affektive und nicht-affektive Gefühle; zu den affektiven Gefühlen gehören dabei nicht nur die Emotionen, sondern auch Stimmungen (s.o.) 2 3) Nach Ortony & Clore verhält sich das Gefühl zur Emotion wie ein Symptom zur Krankheit: Gefühl als eine notwendige, aber keineswegs hinreichende Voraussetzung von Emotion! Emotion = Zustand; Dispositionen ( wie z.B. Optimismus/Pessimismus; konservativ/liberal,…) sind zwar häufig affektiv, aber keine Emotion! 1.2. Einteilung der Emotionen Valenz: Emotionen lassen sich grob nach ihrer Valenz einteilen: positive Emotionen versus negative Emotionen Frijda: angenehm – unangenehm Lazarus: zielkongruent – zielinkongruent MacLean: Annäherung – Vermeidung Tomkins: Aufmerksamkeit nach innen – Aufmerksamkeit nach außen Prinz: positiver innerer Verstärker (mehr davon) – negativer innerer Verstärker (weniger davon) Dimensionsansätze (z.B. Wundt, Russell): Laut Wundt weisen alle Emotionen zwei grundlegende Dimensionen auf, nach denen sie sich unterscheiden und einteilen lassen: die Valenz (Lust/Unlust) und die Erregung (Erregung/Ruhe) Vgl. hierzu den Circumplex von Russell (1980): die beiden konstatierten Dimensionen werden als orthogonale Achsen dargestellt, wobei die verschiedenen Emotionen kreisförmig um den Schnittpunkt dieser Achsen angeordnet sind. Kategoriale Ansätze (z.B. Shaver): Die verschiedenen Emotionsbegriffe werden bestimmten Kategorien zugeordnet (u.a. Liebe, Freude, Überraschung, Ärger,…) Basisemotionen (z.B. Ekman, Friesen, Plutchik): Zahlreiche Theorien gehen von sog. Basisemotionen aus. Kennzeichen von Basisemotionen: 1) sie besitzen ein spezifisches physiologisches Grundmuster, 2) sind universal (kommen also in allen Kulturen vor), 3) treten ontogenetisch früher auf, 4) besitzen einen höheren evolutionären Anpassungswert Ekman: Freude, Ekel, Überraschung, Trauer, Angst, Ärger (insgesamt 6) Plutchik: Freude, Erwartung, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer, Ekel, Akzeptanz (insgesamt 8) Plutchik vergleicht die Emotionen mit einer Farbpalette, wobei die Basisemotionen die Grundfarben darstellen und die übrigen Emotionen durch die Kombination bzw. Mischung dieser entstehen (Liebe als eine Mischung aus Freude und Akzeptanz). Siehe: EXKURS Auch durch kulturelle Einflüsse könnten aus wenigen Basisemotionen neue Emotionen entstanden sein. Stolz könnte z.B. als eine kulturell bedingte Form von Freude angesehen werden, schließlich ist es z.B. im östlichen Kulturraum in der Tat unüblich, auf eigene Leistungen stolz zu sein. Scherer vergleicht Emotionen mit einem Kaleidoskop; er geht also nicht von Basisemotionen aus, sondern davon, dass sich die einzelnen Emotionen aus verschiedenen Basiskomponenten zusammensetzen. 3 Kritik am Konzept der Basisemotionen durch Ortony u. Turner: Uneineinigkeit über die Anzahl der Basisemotionen Unklarheit über die spezifischen physiologischen Grundmuster Viele Komponenten (wie z.B. der Korrugator) sind Teil mehrerer Emotionen Fehlende Kriterien für Reduzierbarkeit (Warum sollten die postulierten Basisemotionen nicht zu noch „basaleren“ Emotionen zusammengefasst werden können?!) Kritik am Konzept der Basisemotionen durch Prinz: Z.B.: Ärger = Mischung aus Frustration + Absicht Emotionen können folgendermaßen unterschieden werden: Psychometrisch (anhand der eigenen Wahrnehmung bzw. Selbsteinschätzung, d.h. mit Hilfe von Fragebögen) Physiologisch (anhand physiologischer Merkmale, z.B. der Herzrate usw.) Expressiv (anhand des Gesichtsausdrucks, z.B. mit Hilfe des FACS) Kognitiv (anhand der Situation - bzw. deren Bewertung – durch welche die jeweilige Emotion hervorgerufen wird) 1.4. Das Messen von Emotionen Emotionen sind nicht direkt -, sondern lediglich anhand bestimmter Indikatoren zu erfassen. Zu unterscheiden sind dabei 3 Methoden. Emotionen können (1) mit subjektiven Verfahren, (2) mittels physiologischer Maße oder (3) durch Verhaltensbeobachtung „gemessen“ werden. Subjektive (introspektive) Verfahren: Menschen haben Zugang zu ihren Emotionen und können sie dementsprechend beschreiben. Selbstbericht-Fragebögen dienen v.a. dazu, relativ dauerhafte Persönlichkeitszüge im Sinne emotionaler Dispositionen zu erfassen. Likert-Skala (von „lehne entschieden ab“ bis „stimme stark zu“); BorgSkala Adjektiv-Checklisten sind eher dazu geeignet, momentane emotionale Zustände zu erfassen. MAACL (misst drei Emotionen, nämlich anxiety, depression, angerhostility); MACL (Mood Adjective Checklist – misst alle Emotionen) Kritik: Geringer Aufwand, relativ reliabel – wie alle Fragebögen allerdings stark abhängig von der Ehrlichkeit der VP (mögliches Problem: soziale Erwünschtheit) Physiologische Maße: Zusammenhang zwischen bestimmten Biosignalen (Herzfrequenz, Atmung, Schweißabsonderung,…) und der kognitiven Aktivität bzw. dem emotionalen Erleben EMG (Elektromyogramm): Ableitung elektronischer Potentiale auf der Haut, die von der Aktivität des darunter liegenden Muskels herrühren (z.B. „Korrugator“ = „Stirn runzeln“) EEG (Elektroenzephalogramm): Messung der neuronalen Aktivität im Gehirn EKG (Elektrokardiogramm): Messung der Herzfrequenz /-rate SPR (Skin Potential Response): Messung der Aktionspotentiale, die für die Aktivierung der Schweißdrüsen verantwortlich sind SCR (Skin Conductance Response) / GSR (Galvanic Skin Response): Messung der elektrischen Leitfähigkeit der Haut (insbes. an den Handflächen) Strom wird durch die Haut geleitet. Je aktiver die Schweißdrüsen, desto leitfähiger die Haut, desto größer die emotionale Erregung 4 Kritik: Zusammenhang zwischen Biosignalen und einer bestimmten Emotion nicht immer eindeutig (es kann daher weniger die Emotionsqualität, als viel mehr deren Quantität erfasst werden); experimentell induzierte Emotionen sind problematisch Verhaltensbeobachtung: Bestimmte Emotionen lösen bestimmte Verhaltenstendenzen aus (Angst > Flucht > Schutz; Ärger > Angriff > Zerstörung; Freude > Geselligkeit > Reproduktion; Trauer > Weinen > Reintegration; Ekel > Ausspucken> Zurückweisung) Verhaltensbeobachtung ist besonders bei Kindern (die sich noch nicht mitteilen können) und Tieren (bei Versuchen, die aus ethischen Gründen an Menschen unvertretbar wären) relevant. Pavlov: „experimentelle Neurose“ bei Hunden (UV: die Schwierigkeit, Ellipse und Kreis voneinander zu unterscheiden; von leicht bis unmöglich / AV: Verhalten der Tiere) Kritik: zeitaufwändiges Beobachtertraining; Inter-Rater-Reliabilität „Triangulation“: Am besten ist es, alle drei Emotionskomponenten (subjektives Empfinden; physiologische Reaktion und Verhalten) zu berücksichtigen, um zu einer möglichst differenzierten Messung zu gelangen. 5 EXKURS: Evolutionäre und behavioristische Psychologie 1. Evolutionäre Psychologie vs. behavioristische Psychologie Evolutionäre Psychologie: Es gibt verschiedene psychologische Mechanismen (dazu gehören auch Emotionen), die im Laufe der Evolution in Folge von speziellen Anpassungsproblemen entstanden sind. Solche sog. EP-Mechanismen haben eine große Ähnlichkeit mit Instinkten. Sie sind angeboren und dienen der Lösung spezieller Anpassungsprobleme. Der Behaviorismus geht dagegen von einigen wenigen Allzweckmechanismen aus, mit deren Hilfe eine Vielzahl von Problemen gelöst werden kann. Die wichtigsten Mechanismen sind laut dem Behaviorismus Konditionierungs- bzw. Lernprozesse! Beispiele für evolutionäre Emotionsmodelle: 1. Liebe (Kap.6.1.) 2. Angst als Evolutionsvorteil (sichert Überleben) 3. Eifersucht: Bei Männern äußert sich Eifersucht anders als bei Frauen. Während letztere v.a. bei emotionaler Untreue eifersüchtig werden, sind es Männer v.a. bei sexueller Untreue. Ursache hierfür sind die unterschiedlichen Fortpflanzungsstrategien bzw. die verschiedenen Anpassungsprobleme von Männern und Frauen. Ersteren geht es darum, die eigene Vaterschaft zu sichern, letzteren um die Unterstützung des Partners bei der Aufzucht des Nachwuchses. Kritik: die Unterschiede müssen nicht unbedingt genetisch bedingt sein, sondern können auch auf unterschiedlicher Sozialisation und Erziehung beruhen („sexueller Erfolg“ als männliche Tugend, emotionale Verbundenheit als weibliche Tugend?!) 2. Plutchiks psychoevolutionäre Emotionstheorie Plutchik stellt insgesamt 10 Postulate auf: Dabei geht er davon aus, dass Emotion, Verhalten und Evolution eng miteinander verknüpft sind. Um genau zu sein, hält er Emotionen für vererbte, adaptive Verhaltensmuster, die sich im Laufe der Evolution herausgebildet haben. Insgesamt gibt es laut Plutchik 8 Basisemotionen (s.o.), die jeweils Gegensatzpaare bilden und spezifische Anpassungsvorteile mit sich bringen: Freude vs. Trauer Ärger vs. Angst Akzeptanz vs. Ekel Überraschung vs. Erwartung Bei den übrigen Emotionen handelt es sich laut Plutchik um Mischformen dieser Basisemotionen. Dyade: Mischung zweier Basisemotionen Triade: Mischung dreier Basisemotionen 6 Die verschiedenen Emotionen können dabei hinsichtlich ihrer Intensität und ihrer Ähnlichkeit variieren. Dementsprechend gliedert Plutchik die Emotionen in einem dreidimensionalen „Emotion Solid“: Die Basisemotionen sind dabei kreisförmig angeordnet, wobei ähnliche Emotionen näher beieinander und gegensätzliche einander gegenüber liegen (Ärger liegt z.B. neben Ekel und gegenüber von Akzeptanz). Nach oben hin nimmt die Intensität der jew. Emotion zu (so dass z.B. aus Ärger Wut wird), nach unten hin ab. Nach Plutchik umfasst jede Emotion 3 Aspekte: das subjektive Gefühl, ein bestimmtes Verhalten und die Funktion dieses Verhaltens. Je nachdem, auf welchen Aspekt der Schwerpunkt gelegt wird, kann eine Emotion bzw. eine emotionale Situation dementsprechend auf versch. Weise beschrieben werden: subjektive Sprache (das Gefühl beschreibend: „Ich hatte Angst.“) verhaltensbezogene Sprache (die Reaktion beschreibend: „Ich rannte weg.“) funktionale Sprache (das Ergebnis der Reaktion beschreibend: „Ich entkam.“) 3. Millensons Verhaltensanalyse Millensons Ansatz ist anders als Plutchiks nicht evolutionär, sondern behavioristisch. Es gibt 3 angeborene Basisemotionen (Angst, Ärger und Begeisterung), die durch unkonditionierte Stimuli ausgelöst werden. Angst: ausgelöst durch negativen Verstärker Begeisterung: ausgelöst durch positiven Verstärker Ärger: ausgelöst durch das Wegfallen eines positiven Verstärkers Die übrigen Emotionen leiten sich aus diesen Basisemotionen ab. Sie entstehen durch klassische Konditionierung. Laut Millenson gibt es folgende Methoden zur Kontrolle der eigenen Emotionen (werden von erwachsenen bzw. reifen Menschen besser beherrscht als von unreifen): 1. Habituation bzw. Adaption Gewöhnung durch Wiederholung (sozusagen eine bewusste Abstumpfung) 2. Maskierung Verzicht auf Emotionsausdruck bzw. Vortäuschung einer falschen Emotion (lachen statt weinen) 3. Vermeidung Die Vermeidung derjenigen Verstärker, durch die die Emotion ausgelöst wird. 7 2. Emotion und der Körper 2.1. Wie werden Emotionen ausgelöst? 2.1.1. William James (1884) Perspektivwechsel: Die körperlichen Reaktionen sind keine Folge der Emotion, sondern deren Voraussetzung. Emotion ist demnach nur indirekt die Folge eines Außenreizes, vielmehr handelt es sich bei einer Emotion um die Empfindung der körperlichen Reaktionen auf diesen Außenreiz. Man weint nicht, weil man traurig ist, sondern ist traurig, weil man weint! Schematische Abfolge: Situation bzw. emotional relevanter Reiz (z.B. Bär) Physische Reaktion (Laufen, Herzrasen,…) Sensorisches Feedback ans Gehirn Emotion (Angst) James’ Modell beruht auf 3 Grundannahmen: 1) Die Wahrnehmung einer Situation ist hinreichend für die körperlichen Veränderungen. 2) Physische Veränderungen sind emotionsspezifisch und können bewusst werden. 3) Das bewusste Erleben der (spezifischen) körperlichen Veränderungen ist die Emotion. 2.1.2. Walter Cannon (1927) Kritik am Ansatz von William James: 1) Autonome (vom autonomen, genauer: vom sympathischen Nervenssystem ausgehende) Reaktionen sind zu unspezifisch, um spezifische Emotionen auslösen zu können. 2) Autonome Reaktionen (wie z.B. die Ausschüttung bestimmter Hormone) sind zu langsam, um den Emotionen vorauszugehen. 3) Tierversuche zeigen: Emotionales Erleben ist trotz der Abtrennung der viszeralen Rückmeldung vom ZNS möglich. 4) Künstliches Herbeiführen typischer viszeraler Veränderungen führt nicht zur Auslösung der entsprechenden Emotionen. Maranon: Die Induktion von Adrenalin führt zu keinen einheitlichen Emotionen. Konzept der „Notfallreaktion“: Die vom Sympathikus ausgehenden physischen Reaktionen sind adaptiv; sie dienen sozusagen der ökonomischen Krafteinteilung: Bestimmte Organe werden je nach Bedarf besser oder schlechter mit Blut versorgt. Fazit: Die körperlichen Reaktionen (ANS- Aktivität) sind laut Cannon lediglich für die Ausprägung/Intensität der Emotionen verantwortlich, nicht für deren Qualität! 2.1.3. Behaviorismus Emotionen = Handlungen in bestimmten Situationen. Was zwischen Reiz und Reaktion liegt, ist der wissenschaftlichen Untersuchung unzugänglich und wird daher als „Black Box“ betrachtet. 8 2.2. Zweifaktorentheorien 2.2.1. Schachter und Singer (1962) Wie James halten auch Schachter und Singer die physiologischen Reaktionen für einen wesentlichen Bestandteil jeder Emotion. Allerdings sind die wie Cannon der Auffassung, dass die physiologische Rückmeldung zu unspezifisch ist, um spezifische Emotionen auszulösen; es bedarf daher zunächst der kognitiven Deutung der Rückmeldung. Der unspezifische Erregungszustand gibt lediglich an, dass ein emotionaler Zustand vorliegt – und wie stark dieser ist. Um welche Emotion es sich konkret handelt, wird aus der jeweiligen Situation geschlossen, in der die Erregung auftritt. Kognitive Attribution = Die Erregung wird auf eine emotionale Ursache zurückgeführt. Schematische Abfolge: Reiz Unspezifische Erregung bzw. physiologische Rückmeldung Kognition (Attribution) Emotion Fazit: Die physiologische Erregung bestimmt die Intensität der Emotion, die Kognition deren Qualität! EXPERIMENT: UV – Manipulationen: 1) Erregung: Injektion von Adrenalin vs. Placebo Coverstory: Angeblich soll der Einfluss eines „Vitamins“ auf die Sehleistung überprüft werden. 2) Erklärungsbedürfnis: Vpn werden über die Nebenwirkung des „Vitamins“ entweder richtig informiert, falsch informiert oder gar nicht informiert. 3) Kognitive Attribution: angenehmes vs. unangenehmes Umfeld (eine angebliche andere VP („Verbündeter“ des VL) verhält sich entweder euphorisch oder verärgert). AV: Emotionales Empfinden der VP (Selbsteinschätzung und Verhalten) Hypothesen: Die nicht bzw. falsch informierten VPs sollten die durch das Adrenalin ausgelöste Erregung je nach Situation anders deuten. Entsprechend dem Verhalten der anderen „VP“ sollten sie entweder ärgerlich oder euphorisch werden. In der Placebogruppe und bei den informierten VPn sollte dieser Effekt nicht auftreten. Ergebnisse: Die Ergebnisse scheinen das Modell von Schachter und Singer zu bestätigen. Kritik: Experiment konnte nicht repliziert werden Grundsätzliche Kritik am Modell von Schachter und Singer: Beta-Blocker-Untersuchungen geben keinen Hinweis auf verringerte emotionale Empfindung. Dabei hemmen Beta-Blocker die physischen Reaktionen. Untersuchungen zur Emotionalität bei Querschnittsgelähmten ergeben keinen eindeutigen Hinweis darauf, dass physiologische Erregung eine notwendige Voraussetzung für Emotionalität ist. 9 2.2.2. Zillmann (70er) Erregungstransfereffekt: Die physische Erregung ist unspezifisch und klingt nur langsam ab; daher wird vom Menschen nicht immer die richtige Quelle der Erregung erkannt. Erregung, die eigentlich aus einer vorhergehenden Situation resultiert, wird auf eine gegenwärtige Situation zurückgeführt. Zillmann zeigte in diesem Zusammenhang z.B., dass sexuelle Erregung Aggression steigern kann. 2.2.3. Stuart Valins (70er) Weniger die physiologische Erregung selbst, als vielmehr deren kognitive Repräsentation ist notwendig für das Emotionsempfinden. D.h.: Die Erregung muss erst bewusst wahrgenommen werden, um das emotionale Erleben zu beeinflussen. EXPERIMENT: VPn bekommen ein falsches Feedback über ihre Herzfrequenz beim Betrachten von Aktfotos. Bei der anschließenden Beurteilung der Fotos zeigt sich, dass die Personen attraktiver eingeschätzt werden, bei denen eine höhere Herzfrequenz rückgemeldet wurde, selbst wenn die tatsächliche Herzfrequenz dem gar nicht entsprochen hatte. Kritik: Attraktvitätseinschätzungen sind nicht mit Emotionen gleichzusetzen; das falsche Feedback kann die autonome Erregung beeinflusst haben. Kognitive Repräsentation der Physiologie + Interpretation = Emotion Vorwegnahme von Damasios As-if-Loops 2.3. Moderne physiologische Ansätze 2.3.0. Grundsätzliches: Zentrales Nervensystem (ZNS): Gehirn + Rückenmark Peripheres Nervensystem (PNS): Autonomes Nervensystem (ANS): bestehend aus Sympathikus (überwiegend aktivierend) und Parasympathikus (überwiegend hemmend) für die inneren Organe (z.B. Herzrate, Schweißdrüsen,…) zuständig dem Bewusstsein unzugänglich und daher nicht willentlich steuerbar. 3. – 12. Hirnnerv somatisches Nervensystem bewusst und willkürlich steuerbar Hypophyse für die Hormonausschüttung zuständig Afferente Nervenbahnen (von der Peripherie bzw. dem Körper zum ZNS): sensorische Information Efferente Nervenbahnen (vom ZNS zur Peripherie): motorische Befehle an die Muskeln usw. Limbisches System: wird von vielen Forschern als der zentrale Sitz der Emotionen angesehen. 10 2.3.1. Der Papez-Loop (1937) Papez unterscheidet zwischen einem „stream of feeling“ (Thalamus => Hypothalamus), einem „stream of movement“ (Thalamus => Basalganglien) und einem „stream of thought“ (Thalamus => Kortex) Grundsätzlich gibt es im Gehirn 2 Möglichkeiten der Informationsverarbeitung: 1. Entweder die Information wird direkt vom Thalamus zum Hirnstamm weitergeleitet: auf diese Weise wird durch emotionale Reize direkt emotionales Verhalten ausgelöst 2. Oder die Information wird über den Kortex („stream of thought“) weitergeleitet: dort werden die emotionalen Reize kognitiv verarbeitet, was wiederum Einfluss auf das emotionale Verhalten hat. Dieser Weg der Informationsverarbeitung wird als „Papez-Loop“ bezeichnet. Auf diesem Papez-Loop baut auch LeDoux’ Ansatz auf! 2.3.2. LeDoux (2-Stufen-Modell, 1996) Traditionell ging man davon aus, dass die sensorischen Informationen (z.B. vom Auge oder Ohr) über den Thalamus zum Neokortex weitergeleitet werden, wo sie semantisch interpretiert werden, bevor sie schließlich in der Amygdala die physischen Reaktionen hervorrufen. LeDoux hat allerdings entdeckt, dass die sensorischen Informationen vom Thalamus auch direkt und ohne die Vermittlung über den Neokortex an die Amygdala weitergeleitet werden können. Demnach gibt es 2 Arten der emotionalen Informationsverarbeitung. 1) Low Road: In einfachen Situationen, die eine schnelle Reaktion erfordern, werden die emotional relevanten Informationen vom Thalamus direkt zum limbischen System - genauer: zur Amygdala – geleitet, wo sie das entsprechende Verhalten (wie z.B. Flucht) auslösen, ohne vorher im Neokortex kognitiv verarbeitet worden zu sein. Auf diese Weise werden automatische, mehr oder minder unbewusste emotionale Reaktionen ausgelöst. So kann es z.B. passieren, dass wir vor einer vermeintlichen „Schlange“ flüchten und erst im Nachhinein erkennen, dass es sich dabei lediglich um einen harmlosen Ast gehandelt hat. Die sensorische Information wird zunächst nur oberflächlich verarbeitet, während die Amygdala bereits die entsprechende Fluchtreaktionen einleitet. 2) High Road: In komplexen Situationen wird die Information zusätzlich zum Neokortex geleitet, wo sie kognitiv verarbeitet und dadurch bewusst wird. Das neurophysiologische Modell LeDoux’ deckt sich mit Schachter’s und Singer’s 2-Faktorentheorie (ist gewissermaßen deren neurophysiologische Grundlage)! LeDoux betont die Bedeutung der Amygdala, der seiner Ansicht nach eine zentrale Rolle bei der affektiven Bewertung von Reizen zukommt. Affen ohne Amygdala können Objekte zwar noch perfekt wahrnehmen, aber nicht mehr deren emotionale Valenz einschätzen. Sie zeigen z.B. keine Angst mehr vor Menschen. 11 2.3.3. Damasio „Somatic-Marker-Hypothesis“: Rationale Entscheidungen werden durch emotionale somatische Reaktionen beeinflusst, die ihrerseits auf vorangegangene Konditionierungsprozesse zurückzuführen sind. „As-if-Loops“: Körperliche Rückmeldungen können auch ohne tatsächliche physische Erregung im Gehirn generiert werden. Wir können in unserem Gehirn also die Vorstellung körperlicher Erregung erzeugen, ohne dass eine solche Erregung tatsächlich vorliegen muss (Vgl. Stuart Valins). Indem Damasio die neuronalen Grundlagen der Körperwahrnehmung untersucht, handelt es sich bei seinem Ansatz gewissermaßen um eine Erweiterung von William James. EXPERIMENT: VPn sollten sich in eine selbst erlebte emotionale Situation versetzen. Währenddessen wurde mittels moderner Bildgebungsverfahren ihre Gehirnaktivität gemessen. Dabei zeigte sich, dass v.a. die Areale aktiv waren, die für die Körperrückmelddung zuständig sind. Auf diese Weise kann auch der mangelnde Effekt von Beta-Blockern sowie die Emotionalität von Querschnittsgelähmten erklärt werden. 12 3. Der Einfluss von Kognitionen auf Emotionen 3.1. Kognitive Emotionsmodelle 3.1.0. Allgemeines zu den kognitiven Ansätzen Grundfrage: Welche Arten von Ereignissen, Handlungen oder Objekten lösen welche Emotionen aus? Welche kognitive Interpretation löst welche spezifische Emotion aus? Schematische Gliederung der verschiedenen Emotionen! Methoden: 1) Vignetten (Situationsbeschreibungen und deren Auswirkung auf die emotionale Befindlichkeit der VP) 2) Prototypen (Sammeln, sortieren und kategorisieren der verschiedenen Emotionsbegriffe) 3) Künstliche Erzeugung von Emotionen (z.B. durch Bilder oder Filme) 4) Erinnerung an emotionale Situationen Hauptproblem: alle Methoden beruhen auf Introspektion. Es ist allerdings fraglich, ob überhaupt alle kognitiven und emotionalen Prozesse dem Bewusstsein und damit der Introspektion zugänglich sind. Die meisten kognitiven Emotionstheorien gehen von Zielen aus. Fortschritte im Hinblick auf ein persönliches Ziel führen zu positiven Emotionen. Rückschritte im Hinblick auf ein solches Ziel führen zu negativen Emotionen. Ortony, Clore und Collins unterscheiden dabei zwischen 3 Arten von Zielen: 1) Aktiv angestrebte Ziele (Dinge, die man durch eigenes Handeln beeinflussen kann) 2) Passive Interessensziele (Dinge, die man sich zwar wünschen würde, die man aber nicht beeinflussen kann) 3) „Natürliche“ Ziele (z.B. biologische Bedürfnisse wie schlafen, essen,…) Die Intensität positiver und negativer Emotionen hängt u.a. von folgenden Faktoren ab (Wyer u. Srull): Der subjektiven Wichtigkeit des Ziels Der Distanz zum Ziel Der bisher aufgebrachten Energie (dem Aufwand /„Investment“) Kriterien zur Bewertung kognitiver Emotionstheorien: Formalisierungsgrad (mathematisch) Testbarkeit (Einbeziehung der Emotionsintensität?!) Verhalten beachtet (ja – nein?!) Erklärung aller Emotionen?! 13 3.1.1. Magda Arnold (60er) Damit ein Reiz eine Emotion auslösen kann, muss das Gehirn zunächst die Bedeutung dieses Reizes bewerten. Diese Bewertung erfolgt bewusst oder unbewusst; im Nachhinein allerdings haben wir bewussten Zugang zu den Bewertungsprozessen! Die Bewertungs- bzw. Appraisaldimensionen sind dabei laut Arnold: (1) gut oder schlecht für uns?! (2) Sind die Objekte anwesend oder abwesend?! (3) Schwierig bzw. einfach zu erreichen / zu vermeiden?! Die Bewertung des Reizes führt zu entsprechenden Handlungstendenzen (Annäherung oder Ablehnung). Anders als James setzt Arnold die tatsächliche Handlung nicht voraus; die bloße Tendenz genügt, um die entsprechende Emotion auszulösen. Dabei ist die bewusste Emotion, ähnlich wie bei Schachter und Singer, nicht mit der Handlungstendenz gleichzusetzen, sondern deren Deutung. Schematischer Ablauf: Reiz Bewertung Handlungstendenz Gefühl Damit kann erklärt werden, warum schon kleine Variationen der Situation bzw. des Reizes unsere Emotion drastisch verändern können (ein freier Bär wird völlig anders bewertet als einer hinter Gittern). 3.1.2. Richard Lazarus (90er) Nicht die objektive Situation ist emotionsauslösend, sondern die subjektive Interpretation der Situation, d.h. deren subjektive Bewertung bzw. Einschätzung. Lazarus unterscheidet folgende Appraisaldimensionen: 1) Primary Appraisal: beziehen sich auf die Bewertung eines Reizes im Hinblick auf das eigene Wohlergehen. Zielrelevanz (Ist der Reiz für meine Ziele relevant?) Zielkongruenz (Ist der Reiz für meine Ziele nützlich oder hinderlich?) Art der Selbstinvolviertheit 2) Secondary Appraisal: beziehen sich auf die momentanen Ressourcen im Umgang mit dem entsprechenden Reiz (Ereignis/Handlung) Wer oder was ist verantwortlich? Coping Möglichkeit Zukunftserwartung 3) Reappraisal: beziehen sich auf fortlaufende Neueinschätzungen durch die Veränderung der Umwelt. EXPERIMENT: VPn wird ein brutaler Film über Beschneidungen gezeigt. Variiert wird lediglich der Kommentar zum Film. UV: positiver bzw. verharmlosender Kommentar vs. negativer Kommentar AV: emotionales Empfinden der VPs (physische Reaktionen + Selbstauskunft) Ergebnis: die unterschiedlichen Kommentare bzw. unterschiedlichen Bewertungen des Films führten in der Tat dazu, dass der Film unterschiedliche Emotionen auslöste. 14 3.1.3. Smith u. Ellsworth EXPERIMENT: Erinnern und Einschätzen emotionaler Erlebnisse. Die Einschätzung sollte anhand vorgegebener Kriterien erfolgen: z.B.: Erfreulichkeit; Anstrengung; Kontrollierbarkeit;… Ziel: die Ermittlung relevanter Appraisaldimensionen (Welche Bewertungskriterien hängen mit welchen Emotionen zusammen?!) 3.2. Kritik an kognitiven Ansätzen 3.2.1. Robert Zajonc (1980) Zajonc wendet sich gegen die Auffassung, dass Emotionen immer auf kognitiven Prozessen beruhen. Er weist entschieden auf die Unterschiede hin, die zwischen Emotion und Kognition bestehen und betrachtet Denken und Fühlen als 2 voneinander unabhängige Systeme (Separate System Modell). 1) Emotionen kommen phylogenetisch und ontogenetisch vor Kognitionen. 2) Emotionen und Kognitionen sind getrennten neuroanatomischen Strukturen zuzuordnen. 3) Appraisals und Affekt, d.h. die Einschätzung eines Reizes und wie wir darauf reagieren, sind nicht immer kongruent. Vgl. Höhen- oder Spinnenangst: obwohl man weiß, dass nichts passieren kann, hat man Angst! 4) Emotionen können ohne vorhergehende Appraisals auftreten. Schematischer Ablauf: Reiz => unbewusster Affekt => Gefühl bzw. Emotion EXPERIMENT I: Effekt der bloßen Darbietung Die Vorliebe für chinesische Schriftzeichen steigt mit der Anzahl ihrer Darbietung („mere exposure“-Effekt). Das gilt auch bei unterschwelliger Darbietung der Schriftzeichen. Ergo: Die emotionale Verarbeitung von Reizen kann auch unbewusst stattfinden. Daraus schließt Zajonc, dass die emotionale Verarbeitung von Reizen ohne Kognition auskommt. Diese Schlussfolgerung ist allerdings problematisch, schließlich können auch kognitive Prozesse unbewusst ablaufen. Nichtsdestotrotz werden durch Zajoncs Untersuchungen die kognitiven Modelle zumindest in Frage gestellt. Schließlich gehen die meisten dieser Modelle davon aus, dass der Mensch bewussten Zugang hat zu den Prozessen und Kriterien, die der Bewertung eines emotional relevanten Reizes zugrunde liegen. Aber ist Introspektion tatsächlich eine verlässliche Datengrundlage?! Sind die Bewertungsmechanismen überhaupt introspektiv zugänglich? Zwar werden wir uns meistens über das Ergebnis unserer Bewertungen bewusst – nicht aber über die Grundlagen dieser Bewertung (Warum ist uns der eine sympathisch, der andere dagegen nicht?!). Vgl. hierzu auch: John Bargh, der die Existenz unbewusster Einstellungen, Ziele und Absichten nachgewiesen hat (unbewusste Vorurteile). Kritik: Lazarus bestreitet, dass es sich bei denen von Zajonc untersuchten Phänomenen (=Präferenzen) um Emotionen handelt. EXPERIMENT II: „affective priming“ Die subliminale Darbietung emotionaler Gesichtsausdrücke beeinflusst die Einschätzung nachfolgend gezeigter chinesischer Schriftzeichen. 15 3.2.2. Joseph LeDoux Hirnphysiologische Erklärung dafür, warum Emotion nicht mit Kognition gleichzusetzen ist. 1) Wahrnehmung und emotionale Bewertung eines Reizes werden im Gehirn getrennt verarbeitet. 2) Emotionale Reizbewertung erfolgt schneller als die kognitive Reizbewertung (siehe: sensorische Information vom Thalamus direkt zur Amygdala) 3) Die emotionale Bewertung eines Reizes ist enger an bestimmtes Verhalten geknüpft als dessen kognitive Bewertung. 4) Emos sind im Gegensatz zu Kognitionen eng an physische Reaktionen geknüpft. 3.3. Weitere kognitive Emotionstheorien 3.3.1. Bernard Weiner’s Attributionstheorie (1985) Wie Schachter und Singer geht Weiner davon aus, dass Attributionsprozesse bei der Entstehung von Emotionen eine wichtige Rolle spielen. Allerdings misst er dabei der physiologischen Erregung (Arrousal) keine Bedeutung bei. Nach Weiner handelt es sich bei emotionalen Episoden um sequentielle Prozesse (daher auch „2-Stufen-Modell“): 1) Valenz: In einem ersten Schritt wird jedes emotional relevante Ereignis hinsichtlich seiner Konsequenzen als positiv oder negativ bewertet. Es geht also ganz allgemein darum, ob ein Ereignis positiv oder negativ zu bewerten ist. 2) Ursachenattribution: In einem zweiten Schritt wird nach der Ursache des Ereignisses gefragt. Man versucht sozusagen, sich die eigene Emotion zu erklären. Dabei wird die Ursache nach folgenden Kriterien (Dimensionen) beurteilt: 1) Lokus der Verursachung (selbst- oder fremdverursacht?!) 2) Stabilität (stabil oder variabel?! / Konsequenzen gewiss oder ungewiss?!) 3) Kontrollierbarkeit (Inwiefern hat man selbst/ der andere Einfluss auf das Ereignis?!) Beispiele dafür, welche kognitiven Interpretationen zu welchen Emotionen führen (genauso ist es möglich, von den Emotionen auf deren Ursache zu schließen): Schuld: selbstverursacht - kontrollierbar Scham: selbstverursacht - nicht kontrollierbar Ärger: fremdverursacht - kontrollierbar Mitleid: fremdverursacht – nicht kontrollierbar 3.3.2. Tory Higgins’ Selbstdiskrepanztheorie (1987) Ursache für negative Emotionen sind nach Higgins Diskrepanzen aktivierter Selbstschemata, genauer: Diskrepanzen zwischen dem „ought self“, dem „ideal self“ und dem „actual self“. Widerspricht das ideale Selbst dem tatsächlichen Selbst, führt das zu Emotionen wie Niedergeschlagenheit, Trauer und Entmutigung. Bestehen Diskrepanzen zwischen dem „ought self“ und dem „actual self“, entspricht man selbst also nicht dem, wie man glaubt, sein zu müssen, resultieren daraus Emotionen der Aufregung, wie z.B. Angst, Besorgnis und Scham. Kritik: Keine Erklärung für positive Emotionen; zu allgemein, heißt: keine detaillierte Beschreibung konkreter Emotionen; vieles bleibt offen: z.B. was passiert, wenn „ideal-“ und „ought self“ im Widerspruch zueinander stehen 16 3.3.3. Ira Roseman’s « Motivation-Plus-Cognition-Theory » (1989) Nach Roseman wird unser emotionales Erleben durch Kognition und Motivation beeinflusst. Unser Wollen und Denken bestimmt, was wir fühlen. Dabei ergeben sich die einzelnen Emotionen aus 5 verschiedenen „Appraisaldimensionen“. Dabei handelt es sich gewissermaßen um Kriterien, nach denen eine emotional relevante Situation bewertet wird. 1) Durch Ereignis oder Person verursacht (person- vs. event caused)?! 2) Positive oder negative Konsequenzen?! 3) Gewisse oder ungewisse (überraschende) Konsequenzen?! 4) Annäherungs- oder Vermeidungsmotivation (Ist die Motivation Belohnung oder die Vermeidung einer Bestrafung)?! 5) Starkes oder schwaches Selbst (Sind die Konsequenzen potentiell kontrollierbar oder nicht)?! Beispiele: Hoffnung: ereignisbezogen – positiv – ungewiss Freude: ereignisbezogen – positiv – gewiss – Annäherung Angst: ereignisbezogen – negativ – ungewiss – Vermeidung – nicht kontrollierbar Trauer: ereignisbezogen – negativ – gewiss – Vermeidung Ärger: handlungsbezogen (fremdverursacht) – negativ – gewiss – kontrollierbar Scham: handlungsbezogen (selbstverursacht) – negativ – kontrollierbar 3.3.4. Frijda’s Handlungsbereitschaftsmodell (1986) Verhaltenstendenzen bzw. Handlungsbereitschaften sind Teil einer Emotion – und nicht bloß deren Folge! Insofern können Emotionen auch dadurch bestimmt werden, an welche Handlungsbereitschaften sie geknüpft sind. Vgl. hierzu: William James! Beispiel: Ekel und Ärger unterscheiden sich laut Frijda lediglich bezüglich der Verhaltenstendenzen, an die sie geknüpft sind, nicht aber bezüglich der kognitiven Bewertung. Sowohl Ekel als auch Ärger wird durch negative Ereignisse hervorgerufen, die durch andere verursacht worden sind (kognitive Bewertung). Unterschieden werden können die beiden Emotionen lediglich mittels der unterschiedlichen Handlungsbereitschaften: „sich entgegenstellen“ (Ärger) vs. „sich wegbewegen“ (Ekel) 3.3.5. Orthony, Clore u. Collins’ hierarchisches Emotionsmodell (1988) Ganz allgemein resultieren Emotionen aus der positiven bzw. negativen Bewertung einer Situation. Welche spezifische Emotion ausgelöst wird, hängt davon ab, welcher Aspekt der Situation bewertet wird. Bewertet werden können entweder die Konsequenzen eines Ereignisses, die Auswirkungen einer Handlung oder die Eigenschaften einer Person / eines Objektes. Jeder dieser 3 Aspekte führt dabei zu unterschiedlichen Formen der Bewertung und damit zu unterschiedlichen Emotionen: Über die Konsequenzen eines Ereignisses kann man erfreut oder nicht erfreut sein: mögliche Emotionen sind z.B. Hoffnung, Angst oder Freude. Eine Handlung kann man entweder für gut oder für schlecht halten: mögliche Emotionen sind Stolz, Scham oder Ärger. Objekte bzw. Personen kann man mögen oder nicht mögen: mögliche Emotionen sind z.B. Liebe oder Hass. 17 4. Der Einfluss von Gefühlen auf Kognitionen 4.0. Kognitive Folgen bzw. „Nebenwirkungen“ von Emotion Das emotionale Empfinden bzw. der affektive Zustand einer Person hat Einfluss auf… 1. die Steuerung der Aufmerksamkeit 2. die Enkodierung (Aufnahme) von Information 3. die Erinnerung von Information, d.h. deren Abruf aus dem Gedächtnis 4. die Bewertung der Umwelt (evaluative Urteile) 5. die Auswahl von Heuristiken (Verarbeitungsstrategien) Die wichtigsten Theorien und Befunde hierzu sind: 1. Resource Allocation Model (Aufmerksamkeit) 2. Assoziatives Netzwerkmodell (Enkodierung und Abrufen von Informationen) 3. Gefühle als Information (Urteilsbildung) 4. Cognitive Tuning Model (Denkstile / Heuristiken / Verarbeitungsstrategien) 5. Selbst- und Affektregulation (Motivation) 4.1. Resource Allocation Model (Ellis & Ashbrook, 1988) Negative affektive Zustände reduzieren die Elaboration und Organisation von Material beim Enkodieren und verschlechtern die Erinnerungsleistung. Kurz: Schlechte Laune lenkt ab / vermindert die kognitive Kapazität! Negative Stimmung führt zur Aktivierung negativer Gedanken. Außerdem ist man stärker auf sich selbst fixiert und denkt über die Ursachen der eigenen Laune nach. Die Folge ist mangelnde Aufmerksamkeit; man wird von der eigentlichen Aufgabe abgelenkt! EMPERIMENTE: Tatsächlich zeigen mehrere Experimente, dass schlecht gelaunte VPn in Gedächtnistests schlechter abschneiden als solche, bei denen vorher kein negativer Affekt induziert wurde. Kritik: Watts & Cooper (1989): Depressive Personen merken sich die zentralen Aspekte einer Geschichte weniger gut als gesunde VPn, da sie den Inhalt nicht sinnvoll strukturieren. zu detailorientierter Fokus statt mangelnder Aufmerksamkeit?! Hertel et al.: Das Problem depressiver VPn ist nicht mangelnde Aufmerksamkeit, sondern fehlende Initiative (unzureichende Anwendung von Strategien bei unstrukturierten Aufgaben) Noch einmal die möglichen Erklärungen: 3) fehlende Aufmerksamkeitsressourcen (Resource Allocation Model)?! 4) zu detailorientierter Fokus (Watts & Cooper)?! 5) fehlende Initiative (Hertel et al.)?! 18 4.2. Das Assoziative Netzwerk Modell (Gordon Bower, 1973) Im Gedächtnis ist Wissen in Form von assoziativen Netzwerken abgespeichert. Auch Emotionen sind Bestandteil dieses Netzwerkes: Sie sind mit kongruenten Inhalten verknüpft. Daraus folgt, dass in einem bestimmten emotionalen Zustand, bestimmte, zu der jeweiligen Emotion passende, Inhalte leichter ins Bewusstsein gerufen werden als andere. Folgende Phänomene sprechen für dieses Modell: 1) State-dependent Recall (zustandsabhängiges Erinnern) Stimmung beim Lernen = Stimmung beim Erinnern 2) Mood-congruent Recall (stimmungskongruentes Erinnern) Valenz des Gedächtnisinhalts = Stimmung beim Erinnern 3) Mood-congrunent Encoding (stimmungskongruente Enkodierung) Stimmung beim Lernen = Valenz des zu lernenden Materials 4) Stimmungskongruente Urteile (1) State-dependent Recall: Ist der Kontext bzw. der emotionale Zustand beim Lernen derselbe wie beim Erinnern, erleichtert das den Abruf des Gelernten. (2) Mood-congruent Recall: Stimmt die Valenz des Inhalts mit der Valenz der Stimmung beim Abrufen dieses Inhalts überein, erleichtert das den Abruf. Kurz: Die gerade empfundene Stimmung beeinflusst, welche Inhalte erinnert werden. Dieser Effekt ist experimentell v.a. anhand autobiographischer Erinnerung nachgewiesen worden (selbstreferentielles, unstrukturiertes Material): Gut gelaunte VPn erinnerten sich eher an positive Ereignisse als an negative; schlecht gelaunte eher an negative Ereignisse. Kritik: Stimmungskongruentes Erinnern ist nur schwer vom zustandsabhängigen Erinnern zu trennen. Meistens fällt beides zusammen. Schließlich stimmt die Valenz des Gedächtnisinhalts meistens mit der Stimmung zum Zeitpunkt der Enkodierung zusammen. Instabil: Schlechte Laune erschwert zwar offenbar die Erinnerung an positive Ereignisse, allerdings führt schlechte Laune nicht dazu, sich dafür negative Ereignisse leichter ins Gedächtnis zu rufen. (negative Stimmung = weniger positive Erinnerungen, aber auch nicht mehr negative Erinnerungen); mögliche Erklärung: „mood repair efforts“ (zur Vermeidung weiterer negativer Gedanken) (3) Mood-congruent Encoding: Je nachdem, in welcher Stimmung man ist, ist man für bestimmte (und zwar kongruente) Inhalte empfänglicher und merkt sie sich dementsprechend besser. Kurz: die Stimmung beeinflusst die Auswahl/Speicherung der Information. EXPERIMENTE: Affektkongruente Details fallen leichter auf (Bower, 1981) Es wird mehr Zeit darauf verwendet, stimmungskongruente Inhalte zu lesen (Forgas, 1995) Mehrdeutige Information wird im Sinne der gerade empfundenen Stimmung interpretiert (Martin et al., 1986) Widerspruch zu 4.1.: Demnach dürfte das Resource Allocation Model wenn, nur für neutrale Reize zutreffen. 19 4.3. „Feeling as Information“ (4) Stimmungskongruente Urteile: Stimmung beeinflusst die Urteilsbildung: positive Stimmung = positives Urteil negative Stimmung = negatives Urteil Mögliche Erklärungen: 1. Assoziatives Netzwerk (Gordon Bower): Urteile gründen auf Informationen. Da stimmungskongruente Inhalte stärker ins Bewusstsein treten (mood-congruent memory), spielen diese auch eine größere Rolle bei der Urteilsbildung. 2. “Feeling as Information”-Ansatz (Schwarz und Clore): Die Gefühle selbst haben direkten Einfluss auf die Urteilsbildung. Sie dienen dem Organismus als Informationsquelle und erleichtern so die Urteilsbildung. In diesem Sinn erfüllen Gefühle dieselbe Funktion wie kognitive Inhalte. Assoziatives Netzwerk vs. Gefühle als Informationen 1. Assoziatives Netzwerk: Eine Abwertung des Gefühls als irrelevant sollte keinen Einfluss auf das Urteil haben (schließlich kommt es nicht auf das Gefühl selbst, sondern auf die mit dem Gefühl verknüpften Inhalte an)! Der Inhalt dessen, womit die Stimmung induziert wird, sollte das Urteil zusätzlich beeinflussen. Stimmt z.B. die Ursache der Stimmung mit dem Urteil inhaltlich überein, sollte der Effekt verstärkt werden. 2. Gefühle als Informationen: Normalerweise wird das Gefühl als Reaktion auf die gerade bearbeitete Aufgabe betrachtet – und deshalb berücksichtigt. Wird das Gefühl allerdings auf eine irrelevante Quelle zurückgeführt, hat es keinen Einfluss mehr auf das Urteil. Solange es sich bei dem Gefühl um eine diffuse Stimmung handelt, ist es egal, ob es einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen Stimmungsinduktion und Urteil gibt oder nicht. EXPERIMENT (Schwarz & Clore, 1983): In Telefoninterviews werden VPn nach ihrer allgemeinen Lebenszufriedenheit gefragt. Dabei wird ihre Aufmerksamkeit vorher entweder auf das Wetter gelenkt oder nicht. Nur wenn die VPn vorher nicht auf das Wetter aufmerksam gemacht wurden, lassen sie sich von ihm in ihrem Urteil beeinflussen. Bei schlechtem Wetter wird dann eine niedrigere -, bei schönem Wetter eine höhere Lebenszufriedenheit berichtet. Sobald man auf das Wetter aufmerksam macht, wird es als irrelevant erkannt und deshalb in der Urteilsbildung nicht länger berücksichtigt. Das widerspricht dem Netzwerkmodell und stützt den „Feeling as Information“ – Ansatz! 20 EXPERIMENT (Johnson & Tversky): VPn, denen durch das Lesen von Berichten über Krebs eine negative Stimmung induziert wurde, schätzten das Risiko für Unfälle oder Ehescheidungen genauso erhöht ein wie das Risiko für Krebs. Inhaltlich muss es also keinen Zusammenhang geben zwischen der Stimmungsursache und dem zu treffenden Urteil. Auch dieser Befund widerspricht dem Netzwerkmodell und stützt den „Feeling as Information“-Ansatz! Feeling as Information: Stimmung vs. Emotion Da Stimmungen unspezifisch sind, können sie Urteile aller Art beeinflussen; entscheidend ist die Valenz der Stimmung, nicht ihre Ursache bzw. ihr „Inhalt“. Emotionen dagegen wirken sich nur auf solche Urteile aus, deren Gegenstand inhaltlich zum Auslöser der Emotion passt. (z.B.: Angst beeinflusst Risikourteile und keine Schuldzuweisungen – Ärger dagegen Schuldzuweisungen und keine Risikourteile) Unter welchen Bedingungen Gefühle zur Urteilsbildung herangezogen werden: 1. Bei affektiven / evaluativen Urteilen (z.B. wer einem sympathisch ist und wer nicht) 2. Wenn nur wenig Information zur Verfügung steht 3. Wenn das zu treffende Urteil zu komplex ist bzw. zu viel Information vorliegt 4. Wenn die kognitive Kapazität durch Zeitdruck oder Zweitaufgaben eingeschränkt ist. Verwandte Phänomene: Zillmans Erregungstransfereffekt Verfügbarkeitsheuristik von Tversky und Kahneman 4.4. Cognitive Tuning Model Stimmungen beeinflussen die Art und Weise der Informationsverarbeitung! Zwischen Situation und Emotion besteht eine Wechselwirkung: Einerseits informieren Emotionen über die jeweilige Situation (ob diese gut oder schlecht ist), andererseits entstehen die Emotionen ja erst aus der Bewertung einer solchen Situation. Negative Emotionen informieren darüber, dass Verhalten initiiert werden muss, um die jeweilige Situation zu ändern. Positive Emotionen dagegen informieren darüber, dass die jeweilige Situation wünschenswert ist und insofern kein Handlungsbedarf besteht. Daraus ergeben sich verschiedene Denkstile bzw. verschiedene Strategien, die gegebenen Informationen zu verarbeiten. Negative Emotionen: Geringe Risikobereitschaft; Anwendung bewährter Strategien (verstärktes Bedürfnis nach Kontrolle) Detail-orientiertes und systematisches Vorgehen Bildung schmalerer Kategorien (sorgfältiges Vorgehen) Enger Aufmerksamkeitsfokus Genaues Überprüfen der Argumente 21 Positive Emotionen: Risikobereitschaft; Ausprobieren kreativer u. neuer Lösungsansätze Verstärkte Anwendung von Heuristiken (Vereinfachungen): z.B. lässt man sich in seinen Urteilen stärker von Vorurteilen u. Stereotypen leiten; Bildung breiter Kategorien (weniger sorgfältiges Vorgehen) Breiter Aufmerksamkeitsfokus Unzureichendes Überprüfen der Argumente Das Cognitive Tuning Model widerspricht dem Ressource Allocation Model EXPERIMENTE: Forgas zeigte, dass schlechtgelaunte Augenzeugen genauer beobachten als gutgelaunte. Der Effekt verschwindet, wenn den VPn bei der Aufgabenlösung keine Zeitvorgaben gemacht werden oder sie explizit zu Genauigkeit angehalten werden. 22 5. Der Ausdruck von Emotionen 5.1. Sind emotionale Ausdrücke universell? Emotion kann durch die Mimik, die Stimme, die Körperhaltung, Gestik,… zum Ausdruck gebracht werden. Die evolutionäre Psychologie geht davon aus, dass bestimmte Emotionen (Basisemotionen) sowie deren Ausdrucksformen biologisch bedingt und damit universell sind. Für diese These sprechen: 1. Interkultureller Vergleich des Emotionsausdrucks Ekman (1973) zeigte VPn aus verschiedenen Kulturen Fotos, auf denen der mimische Ausdruck von insgesamt 6 Basisemotionen zu sehen war. Aufgabe der VPn war es, diesen Bildern die passenden Emotionsbegriffe (vorgegeben waren Freude, Ekel, Überraschung, Trauer, Ärger und Angst) zuzuordnen. Tatsächlich wählten die VPn, trotz ihres unterschiedlichen kulturellen Hintergrundes, überwiegend dieselben Begriffe für dieselben Mimiken. Ergo: Der Emotionsausdruck scheint also universell zu sein! 2. Vergleich zwischen Mensch und Tier Bestimmte emotionale Ausdrucksformen stimmen bei Menschen und anderen Lebewesen überein: Darwin zufolge ist z.B. die menschliche Gänsehaut ein Überbleibsel der Piloarreaktion (des Fellsträubens). 3. Beobachtung des Emotionsausdrucks bei Kindern und Säuglingen Schon bei Säuglingen lassen sich typische Gesichtsausdrücke beobachten; da sie diese nicht gelernt haben können, müssen sie angeboren sein. Gleiches gilt für den Emotionsausdruck bei Blindgeborenen (s.u.). 4. Beobachtung des Emotionsausdrucks bei Blindgeborenen 5. Vererbungsstudien (z.B. zur Vererbung von affektiven Störungen) Z.B. können furchtsame und weniger furchtsame Ratten gezüchtet werden (Indikator für Furchtsamkeit: Defäkation in potentiell gefährlichen Situationen) 6. Physiologische Emotionstheorien Sozialer Konstruktivismus vs. klassische Evolutionstheorie Kritiker (z.B. James Averill) bestreiten die Existenz universaler Emotionen und Ausdrucksformen. Sie halten Emotionen für ein rein gesellschaftlich bedingtes Phänomen; bei Emotionen handelt es sich ihrer Ansicht nach nicht um biologische, sondern um soziale Zustände (deshalb: sozialer Konstruktivismus) In der Tat lassen sich zahlreiche Beispiele für kulturell bedingte Unterschiede finden. Das japanische Wort „amae“ (~ Abhängigkeit) z.B. bezeichnet einen emotionalen Zustand, der im westlichen Kulturraum gar nicht bekannt ist! Liebe als eine Erfindung/Konstruktion des Mittelalters (Minnesang)?! Ortony & Turner glauben zwar nicht an angeborene Emotionen, dafür aber an angeborene Reaktionskomponenten (wie Zittern, Weinen,…), die in verschiedener Weise zu einem Ganzen zusammengefügt werden können. Prinz (2004): V.a. die Gewohnheiten des Körpers, Emotionsmischungen und die Emotionsauslöser sind stark kulturell geprägt. 23 Letztlich gibt es bezüglich des Emotionsausdruckes sowohl kulturbedingte Unterschiede, als auch universale Gemeinsamkeiten. Eckman unterscheidet daher zwischen universalen Ausdrucksformen (die insbes. die Mimik betreffen) und sonstigen körperlichen Bewegungen (Embleme = Kopfnicken, Achselzucken,… + Illustratoren = Füllwörter, Gesten,…). Letztere können von Kultur zu Kultur verschieden sein. Ferner geht Eckman von sog. „Display Rules“ (Regeln der Darbietung) aus. Diese Regeln beruhen auf gesellschaftlichen Normen und Konventionen; sie bestimmen darüber, in welcher Weise Emotionen in der Öffentlichkeit ausgedrückt werden (dürfen). EXPERIMENT (Ekman & Friesen, 1972): Amerikaner und Japaner wurden beim Schauen eines Films beobachtet; ein Teil der VPn schaute dabei den Film alleine, während der andere Teil zu mehreren schaute. Dabei zeigte sich: Im Privaten ist der emotionale Ausdruck bei Japanern und Amerikanern gleich (= Universalität der Basisemotionen), in der Öffentlichkeit dagegen recht verschieden (=Display Rules); die Japaner waren in ihrem Emotionsausdruck weitaus zurückhaltender als die Amerikaner, wenn andere Personen beim Schauen des Films anwesend waren! 5.2. Die Funktionen des emotionalen Ausdrucks Wozu hat sich der emotionale Ausdruck überhaupt entwickelt? Grundsätzlich lässt sich zwischen zwei Funktionen unterscheiden: 1. Kommunikative Funktion Der emotionale Ausdruck dient der Mitteilung des eigenen Befindens, der eigenen Absichten und damit der Regelung der sozialen Beziehungen (Fremdregulation) 2. Regulative Funktion Gleichzeitig dient der emotionale Ausdruck der Selbstregulation: er informiert uns selbst über unsere Emotionen, verstärkt bzw. hemmt sie (facial feedback) und hilft unserem Organismus, sich möglichst schnell an die Anforderungen der jeweiligen Situation anzupassen (das ängstliche „Aufsperren“ der Augen => erhöhte Wachsamkeit). 5.2.1 Die kommunikative Funktion Über unser Ausdrucksverhalten können wir unsere emotionalen Zustände schnell an andere kommunizieren. Das ist wichtig, da auf diese Weise u.a.… Hilfe mobilisiert -, soziale Nähe geschaffen -, Übertragung von Emotionen (emotionale Ansteckung) Besseres Erkennen von Emotionen (durch Imitation) und die Gruppe gewarnt werden kann (Alarmfunktion) Emotionale Ansteckung: LeBon (1896): Emotionale Suggestion in der Masse Neumann & Strack (2000): VPn hören über einen Kopfhörer eine aufgezeichnete Philosophievorlesung, die entweder neutral, traurig oder fröhlich vorgetragen wird. Ein Teil der VPn wird gebeten, den Text beim Hören nachzusprechen. Ergebnis: in der Tat wird dabei der vokale Ausdruck des Sprechers imitiert! 24 Ferner wird die Stimmung der VPn durch die Art des Vortrages beeinflusst. Emotionale Ansteckung findet also statt! Die emotionale Beeinflussung durch die Art des Vortrages ist den VPn dabei nicht bewusst. Fragt man sie nämlich, ob sich ihre Stimmung durch den Vortrag verändert habe, wird dies überwiegend mit nein beantwortet. Fragt man dagegen nach dem momentanen Zustand der VPn, zeigt sich, dass ein fröhlicher Vortrag mit guter Stimmung korreliert, während ein trauriger zu schlechterer Stimmung führt. Emotionale Ansteckung als zweistufiger Prozess: 1. Imitation: Das Ausdrucksverhalten anderer wird spontan imitiert (MotorMimikry) Zajonc, Adelman & Murphy (1987) zeigten, das der habituelle Gesichtsausdruck von Ehepaaren sich im Laufe der Jahre aneinander anpasst. Bereits Neugeborene imitieren die Gesichtsausdrücke anderer! Dimberg et al. (2000) konnte mittels EMG nachweisen, dass selbst subliminal dargebotene Gesichtsausdrücke von VPn imitiert werden. Vaughan & Lanzetta (1980): VPn werden dabei gefilmt wie sie Leute beobachten, deren Gesicht aufgrund von E-Schocks schmerzverzerrt ist. Ergebnis: VPn imitieren die Gesichtsausdrücke! 2. Feedback: Das imitierte Ausdrucksverhalten induziert ein kongruentes Gefühl (Facial-, Postural- oder Vocal-Feedback) Siehe unten! Kritik an einem solchen „Ansteckungsmodell“: Empathie statt Feedback?! Vielleicht wirken die Emotionen einer Person A auch deshalb ansteckend auf eine Person B, weil Person B Rückschlüsse auf die Situation von Person A zieht und nicht weil sie dessen Gesichtsausdruck imitiert! Perspektivenübernahme statt Feedback, d.h. Übernahme des Emotionsauslösers und nicht des Emotionsausdruckes! Imitation erleichtert das Erkennen von Emotionen! Wallbott (1991): VPn sollten Emotionsausdrücke auf Fotos kategorisieren. Wenn die VPn die Gesichtsausdrücke dabei imitierten, gelang ihnen diese Aufgabe besser als ohne Imitation. Niedenthal et al. (2001): In Filmen sollte der Wechsel von einem Emotionsausdruck zum anderen bestimmt werden. Gab man den VPn dabei die Möglichkeit zum Imitieren, erkannten sie den Wechsel früher als diejenigen, die einen Stift quer im Mund hatten und dadurch vom Imitieren abgehalten wurden. Imitation fördert soziale Nähe! 25 5.2.2. Die regulative Funktion Einige Vertreter: William James: Emotion wird allein durch Verhalten ausgelöst. Der emotionale Ausdruck ist insofern nicht Folge, sondern Ursache des emotionalen Erlebens. Charles Darwin: Das Verhalten beeinflusst (sprich: verstärkt bzw. schwächt) die Intensität des emotionalen Erlebens. Daryl Bem (Selbstwahrnehmungstheorie): Sogar man selbst wird sich seiner eigenen Emotionen nur anhand äußerer Hinweise bewusst. Facial feedback ist einer dieser Hinweise. Es gibt: facial-, postural- und vocal feedback Tomkins: Die Intensität einer Emotion wird durch die ANS-Aktivität bestimmt; ihre Qualität durch die Wahrnehmung des Facial feedback. Facial feedback Hypothese: Die Kontraktion von Muskeln, die am Emotionsausdruck beteiligt sind, verstärkt das emotionale Erleben oder schwächt es ab. Z.B.: Zygomaticus = mehr Freude / Corrugator = mehr Trauer Laird nimmt an, dass Schlussfolgerungsprozesse die entscheidende Rolle spielen: „Ich lächle – also muss es mir gut gehen.“ Belege für die Facial feedback Hypothese: 1. Studien an Schauspielern Schauspieler berichten oft, die Emotionen, die sie auf der Bühne spielen, tatsächlich zu fühlen. 2. Studien an Personen, die nicht wissen, dass ihr Gesichtsausdruck manipuliert wird (künstlich arrangierte Gesichtsausdrücke) Strack & Stepper (1993): Der Computer, an dem die VPn arbeiten sollten, war entweder leicht erhöht über ihnen oder unter ihnen auf dem Boden positioniert. Es zeigte sich: In aufrechter Haltung (Bedingung 2) empfanden die VPn mehr Stolz als in zusammengekauerter Körperhaltung (Bedingung1) Strack, Martin & Stepper (1988): VPn, die einen Stift zwischen den Zähnen hielten, zeigten sich amüsierter über Cartoons als solche, die den Stift zwischen den Lippen halten sollten. In der einen Versuchsbedingung diente der Stift dazu, eine Kontraktion des Zymatikus herbeizuführen, ohne dass die VPn sich darüber bewusst werden konnten, in der zweiten Bedingung wurde die Kontraktion durch den Stift verhindert (Lippen). Ergo: Schlussfolgerungsprozesse scheinen beim Facial feedback keine Rolle zu spielen! 3. Studien zur emotionalen Ansteckung Gesichtsausdruck und ANS-Aktivität: Ekman, Levenson & Friesen (1983) geben William James recht. Sie vertreten die These, jede Basisemotion sei an einen spezifischen Gesichtsausdruck geknüpft - und dieser wiederum an eine spezifische ANS-Aktivität. Ekman & Co (1983) ließen VPn emotionale Gesichtsausdrücke nachstellen und maßen dabei die Aktivität des Autonomen Nervensystems (Schweißdrüsen, Herzrate,…). Tatsächlich zeigte sich, dass die gestellten Mimiken mit entsprechenden physiologischen Reaktionen einhergingen. Z.B. führte ein ärgerlicher Gesichtsausdruck zu erhöhter Temperatur und einer schnelleren Herzfrequenz. 26 Ergebnis: Emotionales Erleben, Facial Feedback und ANS-Aktivität sind also tatsächlich eng miteinander verbunden und scheinen einander zu beeinflussen. Ob die ANS-Aktivität allerdings spezifisch genug ist, um die Emotionsqualität zu bestimmen (James, Ekman,…) oder ob sie unspezifisch ist und insofern lediglich die Intensität der Emotion beeinflusst (Cannon), kann durch das Experiment nicht abschließend geklärt werden. LeDoux schlägt einen Kompromiss vor. Er geht davon aus, dass es sowohl unspezifische als auch spezifische Aktivitätsmuster des ANS geben kann; letztere konnten bisher allerdings nur unzureichend nachgewiesen werden. Albert Ax (1953): Angst und Ärger sind an unterschiedliche physiologische Reaktionen geknüpft: Angst geht mit dem Ausstoß von Adrenalin einher, während bei Ärger Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet wird. George Hohmann (1966): Läsionsstudien an Soldaten: Rückenmarksverletzungen vermindern lediglich die Intensität der Emotionen. Ergo: Bei Abtrennung des viszeralen Feedbacks vom Gehirn wird zwar die Intensität der Emotionen beeinträchtigt, aber nicht die Emotionsqualität! 5.2.3. Integration Im Alter zwischen 6 und 8 Jahren kommt es zu einer Miniaturisierung des emotionalen Ausdrucks (Manfred Holodynski, 2004). Anfänglich dient der Emotionsausdruck ausschließlich der Fremdregulation, d.h. der Kommunikation mit den Bezugspersonen, später kommt die Funktion der Selbstregulation hinzu. Dabei unterscheiden Kinder zunehmend stärker zwischen der Emotion und dem Ausdruck dieser Emotion. Mit letzterem wird zunehmend ökonomisch umgegangen. EXPERIMENT: VPn sind Kinder zwischen 6 und 8 Jahren. UV: VP ist allein im Versuchsraum oder mit Bekanntem; 3 Emotionsintensitäten durch Süßigkeitenautomat (Schwache Freude durch Süßigkeit; Enttäuschung durch leere Packung; starke Freude durch neue Münze) AV: Intensität des Emotionsausdrucks Ergebnis: Je älter die VPn sind, desto weniger Emotionen zeigen sie, wenn sie alleine im Versuchsraum sind. Ein eindeutiger Beleg für Miniaturisierung. Dient der emotionale Ausdruck nicht der Kommunikation, ist er bei älteren Kindern (ca. ab 8 Jahren) weniger intensiv. Man spart ihn sich gewissermaßen! Bei Erwachsenen werden Emotionen häufig internalisiert, d.h. es wird auf einen Emotionsausdruck verzichtet. Je nach sozialem Kontext lässt man den eigenen Emotionen in unterschiedlichem Maß freien Lauf. Je weniger bekannt die Anwesenden Personen, desto verhaltener der Emotionsausdruck. Paul Ekman geht davon aus, dass auch vermeintlich internalisierte Emotionen ausgedrückt werden: und zwar mittels sog. Mikroausdrücke, die nur wenige Millisekunden andauern und z.B. verraten können, wenn jemand bewusst lügt. 27 6. Spezifische Emotionen: Liebe, Trauer, Angst, Ekel 6.1. Liebe Laut Helen Fisher ist Liebe eine angeborene Emotion, die sich evolutionär erklären lässt. Liebe führt zur festen Bindung an den Geschlechtspartner und ermöglicht dadurch die Aufzucht des Nachwuchses (=Anpassungsvorteil) Liebe besteht aus 3 Komponenten bzw. Systemen: 1. Sexualtrieb (Testosteron) 2. Leidenschaftliche Liebe / Sucht (Dopamin) 3. Bindung (Oxytocin / Vasopressin) Frauen während des Zyklus: Haben erhöhtes sexuelles Verlangen Sind bezüglich ihrer Sexualpartner wählerischer Haben einen verbesserten Geruchssinn Usw. usw. 6.3. Trauer Trauerphasen nach Verena Kast: 1. die Phase des Nicht-wahrhaben-Wollens 2. die Phase der aufbrechenden Emotionen 3. die Phase des Suchens und Sich-Trennens 4. die Phase des neuen Weltbezugs 6.4. Angst EXPERIMENT: Phobischen VPn werden verschiedene emotionale Reize dargeboten, darunter neutrale und angstauslösende Reize (z.B. Schlangen, Spinnen,…). In der einen Bedingung werden die Reize subliminal dargeboten, in der anderen so, dass sie ins Bewusstsein dringen können. Es zeigt sich, dass die Furchtreaktion bei subliminaler Darbietung stärker ist als wenn der betreffende Reiz von den Pbn bewusst wahrgenommen werden kann. Stützt LeDoux’ 2-Stufen-Modell (low route) 6.5. Ekel Hat eine moralische Dimension Exkurs: Wie werden moralische Urteile gefällt? 1. Rationalistische Auffassung: Situation => erster Affekt => Begründung des eigenen Urteils (Abwägung der Argumente) => Urteil 2. David Hume: Leidenschaft/Affekt => Urteil => Begründung Befragungen zeigen, dass bei moralischen Dilemmata zunächst die verschiedenen Argumente abgewogen, bevor das eigene moralische Urteil gefällt wird. Die Begründung geht hier in der Tat dem Urteil voraus. Auf Tabuverletzungen dagegen folgt die unmittelbare Ablehnung. Zuerst wird das Urteil gefällt, dann erst folgt die Begründung, meist ohne mögliche Gegenargumente überhaupt zu berücksichtigen. 28 7. Klassische Theorien der Motivationsforschung 7.0. Begriffsklärungen Motivation = Prozess, der zielgerichtetes Verhalten auslöst und aufrechterhält. Die Motivation bestimmt, wie wir handeln, wann wir handeln, in welchem Ausmaß wir handeln und mit welcher Ausdauer! Bestimmt werden also Art, Latenz(zeit), Intensität, Persistenz (Dauer) und Häufigkeit einer Handlung. In manchen Theorien wird der Begriff „Motiv“ bzw. „Motivation“ durch Begriffe wie „Einstellung“, „Bedürfnis“ oder „Trieb“ ersetzt. Motiv = Beweggrund Rudolph unterscheidet zwischen „effektiven Ursachen“ und „finalen Ursachen; kurz: zwischen Ursachen und Gründen. effektive Ursachen (Ursachen): Ereignisse in der Vergangenheit; z.B. ein früherer Misserfolg, der dazu motiviert, es dieses Mal besser zu machen. finale Ursachen (Gründe): antizipierte Zustände in der Zukunft; z.B. eine erhoffte Belohnung Ziel = ein gewünschtes Handlungsergebnis bzw. ein wünschenswerter Zustand, der prinzipiell erreichbar ist. Bedürfnis = physiologisch oder gesellschaftlich bedingt (z.B. Hunger, aber auch Bedürfnis nach Anerkennung) Anreiz = ergibt sich aus einem Bedürfnis und der jeweiligen Situation (Umweltbedingung); hängt von individuellen Vorerfahrungen und der Attraktivität des Ziels ab (Erwartung x Wert); meist allgemein, mehrere Unterziele umfassend z.B.: Bedürfnis (Hunger) + Umweltbedingung (Restaurant) = Anreiz (in diesem Restaurant essen zu gehen) => (konkretes) Ziel (ein Steak essen) => Handlung (Bestellung aufgeben) Die Motivationspsychologie fragt nach den Ursachen und Funktionen des Verhaltens: Psychoanalyse (Freud): Verhalten wird durch unbewusste Triebe motiviert. Behaviorismus (Hull): Verhalten als gelernte Reaktion auf einen Stimulus. Evolutionäre Theorien: Verhalten ist im Laufe der Evolution entstanden – als Anpassung an spezifische Probleme (z.B.: McDougall’s Instinkttheorie) Kognitive Theorien: Kognitive Inhalte und Prozesse steuern das Verhalten. Feldtheorie (Lewin) Theorie der Leistungsmotivation (Atkinson) Attributionstheorie (Weiner) Entscheidungstheorie Unterscheidung der verschiedenen Ansätze: Wird von homöostatischen Prozessen ausgegangen? (z.B.: Psychoanalyse: ja / Attributionstheorie: nein) Inwiefern werden Emotionen und das Bewusstsein (Kognition) berücksichtigt? (z.B.: Psychoanalyse, Attributionstheorie: ja / Behaviorismus: nein) Experimenteller oder klinischer Ansatz? (die meisten Theorien: experimentell / Psychoanalyse: klinisch) Berücksichtigung inter-individueller Unterschiede? (z.B.: Leistungsmotivation: ja / Behaviorismus…: nein) Ein Problem der Motivationsforschung liegt in der Zirkularität: Motive werden einerseits aus dem Verhalten erschlossen, andererseits erklärt sich das Verhalten erst aus den dazugehörigen Motiven. Motive sind also nicht ohne entsprechendes Verhalten -, das Verhalten nicht ohne plausible Motive zu erklären. 29 7.1. Psychologischer Hedonismus Philosophische Grundlage: Epikur Der psychologische Hedonismus erklärt das menschliche Handeln mit dem Lustprinzip (auch: „Pleasure-pain-principle“): Alle Handlungen dienen entweder der Vermeidung von Schmerz oder der Maximierung der Lust. zu unterscheiden vom ethischen Hedonismus, dessen Gegenbewegung u.a. das Christentum ist. 7.2. Freud’s Psychoanalyse Unser Verhalten ist durch biologisch fundierte, meist unbewusste Triebe motiviert. Dabei ist unser Verhalten häufig Ausdruck innerpsychischer Konflikte (siehe: Instanzenmodell)! Triebdualismus: Unser gesamtes Verhalten lässt sich auf 2 Grundtriebe zurückführen. Eros Thanatos (Todestrieb) Instanzenmodell: Das „ES“, das „ÜBER-ICH“ und die Realität („Realitätsprinzip“) stellen verschiedene Anforderungen an das ICH, zwischen denen ein Ausgleich geschaffen werden muss. Ziel ist die Schaffung eines Gleichgewichts (Homöostase). Methoden: Hypnose, freie Assoziation, Traumdeutung Empirische Überprüfung: 1. Lässt sich Wahrnehmungsabwehr bzw. Verdrängung nachweisen?! McGinnies (1949): den VPn werden Tabuwörter (z.B. „Penis“) und neutrale Wörter (z.B. „Apfel“) dargeboten. Darüber hinaus wird die Darbietungsdauer der Wörter variiert. Ergebnis: Neutrale Wörter werden schneller wahrgenommen als Tabuwörter. Außerdem steigt bei Tabuwörtern die galvanische Hautreaktion. Kritik: (1) Nicht die Wahrnehmung, sondern die Wiedergabe könnte gehemmt sein: man schämt sich schlicht, die Tabuwörter auszusprechen (2) Statt des Inhalts könnte auch die Worthäufigkeit für die verlangsamte Wahrnehmung der Tabuwörter verantwortlich sein: da sie seltener auftreten, werden sie langsamer wahrgenommen (3) Wahrnehmungsparadox: Wie soll man etwas abwehren können, bevor man es wahrgenommen hat?! Constans et al. (2004) : Vietnamveteranen mit posttraumatischer Belastungsstörung sollen die Farbe von Wörtern nennen und dabei ihren Inhalt ignorieren. UV: Variiert wurde der Inhalt der Wörter (sozialer Inhalt; kriegerischer Inhalt; neutraler Inhalt). AV: Gemessen wurde die Reaktionszeit der VPn (bei der Nennung der Farbe). Ergebnis: Bei Wörtern, deren Inhalt mit Kampf bzw. Krieg zu tun hatte, brauchten die Pbn am längsten, bei neutralen Wörtern am kürzesten, um die Farbe zu nennen. Traumata gehen mit erhöhter Aufmerksamkeit für TraumaAuslöser einher! 2. Gibt es so etwas wie Katharsis (eine Art „Reinigung“ der „Seele“ von bestimmten Trieben)?! Die theoretischen Grundannahmen: 1. Ziele führen zu ansteigender kognitiver Verfügbarkeit zielbezogener Konzepte (hat man Hunger sind essensbezogene Inhalte besonders präsent) 2. Die Erfüllung des Ziels führt zur Hemmung dieser Konzepte (=Katharsis) 30 Liberman & Förster (2005): Der Vorgabe eines Eifersuchtsszenarios (Phase 1) folgt entweder die Vorstellung einer Rachemöglichkeit oder die Blockade der Rachepläne (Phase 2). Ergebnis: Nach der 1. Phase lässt in beiden Gruppen eine erhöhte Verfügbarkeit aggressionsbezogener Wörter beobachten. Während der 2. Phase steigt die Verfügbarkeit solcher Wörter bei der blockierten Gruppe weiter an, während die Verfügbarkeit in der Rachegruppe nach der 2. Phase niedriger ist als nach der ersten. Die Katharsis von Trieben ist möglich, insbesondere der Abbau von Aggressionen durch Handlungen, die als zielerfüllend erlebt werden! Dawson & Schell (1982): 1. Phase: In einer ersten Phase wurden bestimmte Wörter bei der auditiven Darbietung mit einem Schock verknüpft (Schockkonditionierung). 2. Phase: Danach wurden diese „Schockwörter“ entweder dem linken oder rechten Ohr zugespielt, während dem jeweils anderen Ohr neutrale Wörter dargeboten wurden. Die VPn wurden entweder dazu aufgefordert, jeweils nur die Wörter im rechten Ohr oder nur die im linken zu beachten („Shadowing“). Ausgangsfrage war, ob „Schockwörter“ eine Angstreaktion auslösen, auch wenn sie nicht beachtet werden. Die Messung der Hautleitreaktion ergab, dass es offenbar tatsächlich eine semantische Verarbeitung unterhalb der Bewusstseinsschwelle gibt, die entsprechende Emotionen auslöst. Wurden den VPn die Schockwörter nämlich im linken Ohr dargeboten – und bewusst nicht beachtet, konnten die entsprechenden Wörter zwar nicht in die linke Gehirnhälfte gelangen und dementsprechend nicht bewusst „erkannt“ werden, trotzdem führten sie zu einer entsprechenden Angstreaktion, da die emotionale Verarbeitung in der rechten Gehirnhälfte stattfindet. Kein Beleg für Wahrnehmungsabwehr! 7.3. McDougall’s Instinkttheorie McDougall (1908) führt alle Motive und damit das gesamte Verhalten auf angeborene Instinkte zurück, die im Lauf der Evolution zur Lösung spezifischer Anpassungsprobleme entstanden sind (=evolutionäre Motivationstheorie). Problematisch: die Unterscheidung von erworbenen – und angeborenen Auslösemechanismen (EAM <=> AAM): Was ist genetisch bedingt- und was ist erlernt (im Sinne einer Gewohnheit)?! Die Gegenposition zum behavioristischen Ansatz (siehe: 7.5.) Ein Instinkt umfasst: 1. eine Disposition zur selektiven Wahrnehmung 2. einen entsprechenden emotionalen Impuls 3. und eine entsprechende instrumentelle Aktivität (=Verhalten) McDougall geht anfänglich von 12 -, später von 18 Instinkten aus. Die wichtigsten sind der Fluchtinstinkt, der Abstoßungsinstinkt, der Neugierinstinkt, der Kampfinstinkt, der Dominanzinstinkt, der Unterordnungsinstinkt und der Elterninstinkt. Außerdem geht McDougall von Primär- und Sekundäremotionen aus. Erstere stellen nicht mehr weiter zerlegbare Emotionsqualitäten dar, während letztere durch die Kombination verschiedener Emotionsqualitäten entstehen. Damit ist McDougall einer der Wegbereiter für das Konzept der Basisemotionen (später: Plutchik, Ekman) 31 7.4. Hull’s behavioristische Triebtheorie Unser Verhalten wird weniger durch Instinkte, als vielmehr durch Lern- und Konditionierungsprozesse bestimmt: Die Frequenz vorangegangener ReizReaktions-Kombinationen sagt die Wahrscheinlichkeit zukünftigen Verhaltens voraus. Bentler & Speckart (1979): Die Frequenz früheren Alkohol- oder Marihuanakonsums ist ein besserer Prädiktor für den zukünftigen Konsum als die Einstellung gegenüber diesen Drogen. Zu unterscheiden ist zwischen klassischen- und operanten Konditionierungsprozessen: Klassische Konditionierung (Pawlow): Ein unbedingter Reiz wird durch einen neutralen Reiz ersetzt. Dadurch entsteht eine neue Reiz-ReaktionsBeziehung. Operante Konditionierung (Thorndike, Skinner): Mittels positiver und negativer Verstärkung wird zu einem bestehenden Reiz ein neues Verhalten konditioniert. Allgemeines zu Triebtheorien: Lernvorgänge sind von unbefriedigten, inneren Bedürfniszuständen abhängig. Triebe sind die motivationale Komponente dieser Bedürfnisse. Die Triebreduktion wirkt verstärkend. Hull’s Triebtheorie (1943): Trieb = Motor (energetisiert Verhalten) 1. Hull geht nicht von mehreren spezifischen Trieben aus, sondern von einem unspezifischen Trieb, der allen Verhaltensweisen zugrunde liegt und eine allgemein energetisierende Wirkung hat. 2. Ziel allen Verhaltens ist die Triebreduktion. Gewohnheit (habit) = Lenkung (generiert Verhalten) 1. Die Art des Verhaltens wird durch Gewohnheiten bestimmt. 2. Eine Gewohnheit ist eine konditionierte bzw. gelernte ReizReaktionsverbindung, die um so öfter auftritt, je öfter sie in der Vergangenheit zu Erfolg (Bedürfnisbefriedigung) geführt hat. 3. Gezeigt wird also immer das Verhalten, das in der Vergangenheit am häufigsten verstärkt wurde! => Lernen findet nur bei Verstärkung statt! 4. Fazit: Die Auswahl und Steuerung des Verhaltens erfolgt durch assoziatives Lernen. Triebstärke x Gewohnheit = Stärke der Verhaltenstendenz Empirische Überprüfung: 1) Trieb x Gewohnheit?! Perin (1942): Ratten werden für die Betätigung eines Hebels mit Nahrung belohnt. Variiert werden dabei die Gewohnheit (Anzahl der Verstärkungen) und der Trieb (langer vs. kurzer Nahrungsentzug). Gemessen wird die Löschungsresistenz des Verhaltens. 1. Ergebnis: Je länger die Deprivation und je regelmäßiger die Verstärkung, desto höher die Löschungsresistenz. Tatsächlich bestimmen Trieb und Habit das Verhalten! Das Yerkes-Dodson-Gesetz (1908): Mäuse werden für die falsche Lösung einer Diskriminationsaufgabe mit Elektroschock bestraft. Variiert werden Aufgabenschwierigkeit und Schockintensität. 1. Ergebnis: Bei einfachen Aufgaben erzielen Mäuse mit zunehmender Schockintensität (Aktivation) bessere Leistungen, bei schwierigen Aufgaben dagegen sinkt die Leistung mit zunehmender Schockintensität. 32 2. Automatische Prozesse werden unter Erregung erleichtert, komplexere Prozesse werden dagegen durch zunehmende Erregung erschwert! 3. Lösung: Verhalten = Trieb x Habit x Anreiz (Attraktivität des Ziels) Zajonc (1980): Die Anwesenheit anderer führt bei einfachen Aufgaben zu Leistungsverbesserung, bei schwierigen Aufg. zu Leistungsverschlechterung. 2) Lernen nur bei Verstärkung?! Tolman & Honzig (1930): UV: keine Futterbelohnung für Aufgabenlösung – kontinuierliche Futterbelohnung (Verstärkung) – Futterbelohnung ab dem 11.Tag. 1. Ergebnis: Die Tiere, die nicht verstärkt wurden, schneiden bei der Lernaufgabe insgesamt zwar deutlich schlechter ab als die beiden anderen Gruppen, allerdings lösen auch sie die Aufgabe am Ende des Experiments (17.Tag) besser als am Anfang. 2. Es muss also ein Lernprozess stattgefunden haben – trotz der ausbleibenden Verstärkung. Latentes Lernen durch Explorationstrieb?! 3) Ist das Ziel immer die Triebreduktion?! Olds & Milner (1954): Erlaubt man Affen oder Ratten, Teile ihres Zwischenhirns über implantierte Elektroden selbst zu stimulieren, tun sie es bis zu 7000 mal pro Stunde! 1. Nicht nur die Triebreduktion scheint für die Verstärkung eines bestimmten Verhaltens verantwortlich zu sein. 7.5. Aktivationstheorien Oberstes Ziel ist nicht die Triebreduktion, sondern ein optimales Erregungsniveau! Daher bemühen sich Menschen häufig um die Intensivierung des Stimulus (Extremsport = Nervenkitzel) Heron (1957): Sensorisches Deprivationsexperiment VPn liegen in einem weißen, im wahrsten Sinne des Wortes „reizlosen“ Raum und tragen eine Brille, die nur diffuses Licht durchlässt. 1. Ergebnis: Trotz hoher Bezahlung baldiger Abbruch des Experiments! 2. Wirkt zu niedrige Stimulierung auch aktivierend?! 3. Gibt es ein Streben nach optimaler Aktivierung? 4. Verhalten weniger durch Triebreduktion bestimmt, als vielmehr durch das Streben nach positiven- und die Vermeidung von negativen Emotionen?! 33 8. Selbst- und Handlungsregulation 8.0. Einleitung: Oftmals besteht eine Diskrepanz zwischen den Absichten und dem Verhalten. Sich Ziele zu setzen, bedeutet noch nicht, diese auch umzusetzen. Kuhl unterscheidet daher zwischen „Selektionsmotivation“ (Zielauswahl) und „Realisationsmotivation“ (Zielumsetzung). 8.1. Zielauswahl („Selektionsmotivation“) 8.1.1. Erwartung x Wert Theorien Edward Tolman: Unser Verhalten wird durch 2 Faktoren bestimmt, die Erfolgserwartung und den Wert des betreffenden Handlungsziels. Erwartung = Erfolgserwartung (Wahrscheinlichkeit, das Ziel zu erreichen) Wert = Wert des Ziels; abhängig vom zu erbringenden Aufwand (ergo: Aufgabenschwierigkeit) und der persönlichen Zielbindung bzw. Selbstverpflichtung (ergo: Öffentlichkeit, Belohnung,…) Sowohl die Erwartung, ein Ziel zu erreichen, als auch der Wert, der diesem Ziel beigemessen wird, sind damit zu einem großem Teil subjektiv bedingt. Eine Handlung erfolgt nur dann… …wenn dadurch etwas Positives erreicht oder etwas Negatives vermieden werden kann (Wert). …wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass der positive Zustand erreicht oder der negative vermieden werden kann (Erwartung). Erwartungs x Wert Theorien stellen eine grundlegende Wende in der Motivationspsychologie dar. - Anders als in behavioristischen Lerntheorien wird davon ausgegangen, dass auch schon die kognitive Vorwegnahme einer Belohnung (=Erwartung) motivierend wirken kann. Diese Annahme setzt die kognitive Repräsentation von Zielen und Plänen voraus (Einbeziehung kognitiver Prozesse)! Habit x Trieb = push-Theorie (Motivation und Verhalten hängen v.a. von Lernprozessen ab) 1. Habit: Erst einmal muss gelernt werden, dass- und auf welches Verhalten eine Belohnung erfolgt. Durch häufige Wiederholung (sprich Lernen) wird das jeweilige Verhalten dann verstärkt (Habit = Konditionierung einer bestimmten Reaktion). 2. Trieb: Der Trieb speist sich aus einem Bedürfniszustand (Deprivation; Stimulation) und ist unspezifisch. Erwartung x Wert = pull-Theorie (Motivation und Verhalten hängen primär von kognitiven Prozessen ab, die die Einschätzung des Wertes und der Erfolgserwartung betreffen) 1. Erwartung: Dass auf ein bestimmtes Verhalten eine Belohnung erfolgt, muss nicht unbedingt gelernt-, sondern kann auch kognitiv vorweggenommen werden. Durch häufige Wiederholung (sprich Lernen) wird lediglich die Erwartung erhöht, die Belohnung erneut erlangen zu können. Gelernt wird eine höhere Erfolgserwartung! 2. Wert: Anders als der Trieb hängt der Wert nicht nur vom eigenen Bedürfniszustand ab, sondern auch vom Zielobjekt bzw. der intendierten Handlung. 34 Empirische Überprüfung (Kritik am rein behavioristischen Ansatz) Versuch zum latenten Lernen (s.o.): Lernen (Zielerwartung) und Motivation (Zielverlangen) sind unabhängig voneinander! Elliott (1928): Wird während eines Lernprozesses der Wert der Belohnung heruntergesetzt (z.B. durch weniger begehrtes Futter) verschlechtert sich die Leistung. Durch unterschiedliche Lernprozesse ist dieses Phänomen nicht zu erklären, da Trieb und Gewohnheit unverändert bleiben! Anwendungen und Vertreter des Erwartungs x Wert Ansatzes: Geen’s Motivationsmodell: Am Anfang steht ein Bedürfnis, aus dem sich im Zusammenspiel mit einer bestimmten Situation (Umweltbedingung) ein (unspezifischer) Anreiz ergibt. Dieser Anreiz wiederum determiniert konkrete Ziele, die dann funktionales Handeln auslösen. Bspl.: Das Bedürfnis nach Anerkennung + die eigene Lebenssituation (man ist Student; die Erwartungen der Eltern und Dozenten) ergeben den Anreiz (gute Noten zu schreiben) => daraus resultiert das konkrete Ziel (in der nächsten Statistikklausur eine eins zu schreiben) und die Handlung (am Wochenende durchzulernen) Brehm spricht von „Potential Motivation“: höchster Motivationsgrad, den eine Person in einer bestimmten Situation erfahren kann; abhängig von: Erwartung x Wert Lewins Feldtheorie (s.u.) Atkinsons Leistungstheorie (siehe: Kap. 10) Kritik am Erfahrungs x Wert Ansatz: Da sowohl der Wert als auch die Erwartung in hohem Maße subjektiv sind, ist Verhalten auch mit der Erwartungs x Wert Theorie nur bedingt vorhersagbar! Erklärung irrationalen Verhaltens (z.B. Rauchen)?! Oft scheinen die beiden Faktoren - Erwartung und Wert – unterschiedlich gewichtet zu werden (z.B. beim Glücksspiel, wo der Wert zwar äußerst hoch, die Erwartung aber nahezu 0 ist)! 8.1.2. Der Wert von Zielen und sein Einfluss auf das Handeln Beschaffenheit des Ziels: Die Schwierigkeit, Spezifität und Komplexität von Zielen beeinflusst das Handeln bzw. die Leistung: Schwierigkeit: Je schwieriger ein Ziel zu erreichen ist, desto besser die Leistung (=> mehr Anstrengung und Ausdauer); gilt nur, wenn die Erreichung des Ziels prinzipiell möglich-, die Aufgabe also machbar ist. Spezifität: Je spezifischer die Aufgabenstellung, d.h. je klarer das Ziel, desto besser die Leistung (=> Fokussierung der Aufmerksamkeit); gilt nur in Kombination mit entsprechender Aufgabenschwierigkeit. Komplexität: Je komplexer die Aufgabenstellung, desto mehr Strategien werden angewendet. Auch ein Feedback der Ergebnisse erhöht zusammen mit entsprechender Aufgabenschwierigkeit und –spezifität die Motivation und damit die Leistung. Goal Commitment: Je höher die Zielbindung bzw. Selbstverpflichtung, desto besser die Leistung (=> mehr Anstrengung bzw. größere Energieaufwendung). Die Zielbindung bzw. Selbstverpflichtung hängt u.a. von folgenden Faktoren ab: Öffentlichkeit: Je mehr Menschen von dem Ziel wissen, desto wichtiger wird es, dieses zu erreichen. Belohnung: Je größer die Belohung, desto attraktiver das Ziel Wahlfreiheit bzw. Legitimität der zielgebenden Person Wahrgenommene Kontrolle 35 Brehm: Die Anstrengungsmobilisierung ist ein Indikator für die Attraktivität bzw. den Wert des Ziels. Dabei beeinflussen sich Attraktivität und Anstrengung gegenseitig. Je attraktiver ein Ziel, desto größer die Bereitschaft, Energie aufzuwenden - je größer die aufzubringende Anstrengung, desto attraktiver das Ziel! Neben dem aufzubringenden Aufwand, der sich aus der Schwierigkeit der Aufgabe ergibt, ist die persönliche Zielbindung bzw. Selbstverpflichtung (Öffentlichkeit…) entscheidend für die Attraktivität eines Ziels. Ziele und Weiner’s Attributionstheorie: Zur Erinnerung: Situationen werden nach folgenden Kriterien (Dimensionen) bewertet: 1. Lokus der Verursachung (selbstverursacht - fremdverursacht) 2. Stabilität (Situation ist stabil – instabil) 3. Kontrollierbarkeit Motivation = Erwartung x Wert 1. Erwartung: wird durch die Stabilität beeinflusst 2. Wert: wird durch den Lokus und die Kontrollierbarkeit beeinflusst Fazit: Attributionen (Schlussfolgerungen) bestimmen die Motivation für zukünftiges Handeln. 8.1.3. Die Erfolgserwartung und ihr Einfluss auf das Handeln Bandura: Erwartung = Kompetenzerwartung (Selbstwirksamkeit) + Handlungs- Ergebnis-Erwartung Die Kompetenzerwartung beeinflusst die Zielsetzung und die Leistung (direkt und indirekt über die Zielsetzung) 1. Je höher die Kompetenzerwartung, desto höhere Ziele setzt man sich und umso mehr Ausdauer und Anstrengung bringt man auf. 2. Positive Auswirkung auf das Erleben von Stress u. auf das Copingverhalten 3. Unrealistische Erwartungen können aber auch zu Misserfolg und weniger Anstrengung führen. Informationsquellen über die Selbstwirksamkeit (self-efficacy): 1. Leistungsergebnisse 2. Beobachtete Leistungen 3. Verbale Überzeugung 4. Physiologisches Feedback 5. Kognitive Bewertungen Carol Dweck: Die Attribution (Ursachenzuschreibung) von Misserfolg beeinflusst die Erfolgserwartung und damit die Motivation. Entity Theory: Die eigene Leistung bzw. Fähigkeit wird auf eine festgelegte Eigenschaft zurückgeführt (attribuiert): z.B. Intelligenz Incremental Theory: Die eigene Leistung bzw. Fähigkeit wird auf eine trainierbare Eigenschaft zurückgeführt: z.B. Fleiß Einem Teil der Kinder wird gesagt, die Lösung bestimmter Aufgaben sei eine Frage der Intelligenz (Entity Theory), einem anderen Teil wird gesagt, es sei eine Frage der Anstrengung (Incremental Theory). Die Kinder, die die Leistung gemäß der Instruktion auf ihre Intelligenz zurückführen, zeigen nach Misserfolg weniger Spaß und Ausdauer bei der weiteren Bearbeitung der Aufgaben. Ergo: Misserfolg und Entitätstheorie führen zu geringer Erwartung und damit zu weniger Motivation! 36 8.1.4. Kurt Lewin’s Feldtheorie Laut Lewin wird unser Verhalten durch Person- und Umweltvariablen determiniert. Dabei bezeichnet Lewin die Summe aller Person- und Umweltvariablen, die zu einem gegebenen Zeitpunkt eine Rolle spielen, als „Feld“. Anders als z.B. die Psychoanalyse ist Lewins Theorie ahistorisch: lediglich das gegenwärtige „Feld“ bestimmt unser Verhalten. Motivation wird zurückgeführt auf eine Wechselwirkung von Anreiz (Umwelt) und Bedürfnis (Person). Phänomenologischer Ansatz: Entscheidend für die Variablen der Umwelt ist die subjektive Wahrnehmung der Person. So ist zum Beispiel trockenes Brot für eine hungrige Person anziehender als für eine satte! Lewins Personenkonstrukte: Innerhalb einer Person gibt es „Bereiche“, die bestimmten Bedürfnissen (z.B. Hunger) und „Quasibedürfnissen“ (z.B. unerledigte Ziele) entsprechen. Benachbarte Bereiche entsprechen ähnlichen Bedürfnissen; die Grenzen zwischen solchen Bereichen sind durchlässig. Die Aktivierung eines Bedürfnisses stellt sich Lewin als „Spannung“ vor. Diese Spannung wird erst abgebaut, wenn das entsprechende Bedürfnis oder wenigstens ein ähnliches Bedürfnis („Ersatzhandlung“) befriedigt wird. Lewins Umweltkonstrukte: Die Umwelt stellt sich Lewin als hodologischen Raum mit Pfaden und Hindernissen vor. Die verschiedenen „Bereiche“ dieses Konstruktes stellen dabei Aktivitäten bzw. Teilhandlungen dar, die vom Ausgangspunkt zum jeweiligen Ziel führen. Die Grenzwände zwischen den einzelnen Bereichen entsprechen den Hindernissen, die auf diesem Weg überwunden werden müssen. Objekte, Handlungen und Ereignisse in unserer Umwelt können eine positive oder negative Valenz annehmen. Die Valenz ist abhängig vom Spannungszustand des korrespondierenden Personbereiches und den Merkmalen des zur Zielerreichung geeigneten Objektes. Valenz = Merkmale des Zielobjektes x Spannung Je intensiver das Bedürfnis (Hunger) und je geeigneter die Merkmale des Zielobjektes (Salamipizza), desto positiver die Valenz. Außerdem geht Lewin von „Kräften“ aus, die die Person bei einem Ziel mit positiver Valenz zu diesem Ziel hin -, bei einem Ziel mit negativer Valenz von diesem Ziel wegführen. Die Kraft ist dabei abhängig von der Valenz des Objektes und der subjektiven Entfernung zu diesem Objekt/Ziel (= Erfolgserwartung). Kraft = Valenz / Entfernung vom Ziel Je näher man einem Objekt ist, desto stärker die Kraft: Mit zunehmender Nähe steigt bei negativer Valenz die Vermeidungstendenz, bei positiver Valenz die Annäherungstendenz. Bspl.: Je näher Versuchstiere in einem Labyrinth der Futterstelle kommen, desto schneller werden sie. Der Vermeidungsgradient ist steiler als der Annäherungsgradient: die Vermeidungstendenz steigt also mit größerer Nähe zum Ziel stärker an als die Annäherungstendenz. 37 Unterschiedliche Bedürfnisse bzw. ähnliche Umweltvariablen können zu Konflikten führen. Ein möglicher Ausweg ist dabei immer, „aus dem Feld zu gehen“, d.h. weder das eine, noch das andere zu tun. Annäherungs-Annäherungs-Konflikt Mindestens zwei Bedürfnisse oder ein Bedürfnis mit mehreren möglichen Objekten/Handlungsalternativen Z.B.: Lernen oder Feiern? /Eis oder Pizza?! Instabiler Zustand, da schon die kleinste Annäherung an eines der Objekte die Kräfteverhältnisse zugunsten dieses Objektes verändert (Wird die Entfernung zum Ziel kleiner kommt es zur Annäherung). Vermeidungs-Vermeidungs-Konflikt Mindestens zwei Handlungsalternativen mit negativer Valenz Z.B.: Pest oder Cholera?! / im Text: Indiana Jones Relativ stabiler Zustand, da eine Annäherung an das eine Ziel zu einer stärkeren Vermeidung führt und damit die Ausgangssituation wieder hergestellt wird. Handlungsunfähigkeit?! Annnäherungs-Vermeidungs-Konflikt Umweltvariable mit positiver und negativer Valenz Z.B.: Leistungsverhalten und Aufgabenwahl (siehe: Kap.10) Schematischer Ablauf: Bedürfnis bzw. Ziel => gespanntes System => Spannung induziert in der Umwelt eine entsprechende Valenz => Valenz + Entfernung zum Ziel => Kraft, die dem Verhalten Antrieb und Richtung gibt (= Motivation) => Bedürfnisbefriedigung / Erreichung des Zielbereichs => Spannungsabbau => Ende des Verhaltens Lewin im Vergleich mit anderen Ansätzen: „Gelernt“ wird nicht das Verhalten an sich (behavioristischer Ansatz), sondern lediglich die Entfernung zum Ziel, die bei neuen Zielen sicherlich als größer empfunden wird, als bei bekannten und geübten Handlungszielen. Lewin steht zw. behavioristischem und kognitivem Ansatz: einerseits ein stark formalisiertes Modell, andererseits wird von kognitiven Prozessen ausgegangen. Interindividuelle Unterschiede werden nicht erklärt! Empirische Überprüfung: Zeigarnik (1927), der „Zeigarnik-Effekt“: Die Erinnerung an unterbrochene Handlungen ist besser als die Erinnerung an Handlungen, die abgeschlossen werden konnten. VPn werden bei der Bearbeitung bestimmter Aufgaben unterbrochen, bei der Bearbeitung anderer nicht. Ergebnis: Die Aufgaben, die abgebrochen werden mussten, werden in etwa doppelt so gut erinnert wie die abgeschlossenen Aufgaben. Erklärung: Die durch diese Aufgaben induzierte „Spannung“ bzw. das Bedürfnis, sie zu lösen, konnte nicht gestillt werden, daher bleiben sie präsent! Kritik: Aufmerksamkeitslenkung durch Unterbrechung?! Bearbeitungszeiteinfluss?! Ovsiankina (1928): Die Wiederaufnahme unterbrochener Handlungen VPn werden vom VL von der vollständigen Bearbeitung einer Aufgabe abgehalten, haben aber in einer späteren Pause die Möglichkeit, sie doch noch zu beenden - was tatsächlich 80% der VPn tun, ohne dazu aufgefordert worden zu sein! 38 Diese Wiederaufnahmetendenz ist abhängig von… 1. der Unterbrechungsdauer (je länger, desto geringer) 2. dem Unterbrechungszeitpunkt (je näher am Ziel, desto höher) 3. der Aufgabenart (je klarer, desto höher) 4. der inneren Einstellung (je ehrgeiziger, desto höher) Von äußeren Anreizen ist die Wiederaufnahmetendenz weitestgehend unabhängig (keine Aufforderung): auch hier also scheint ein innerer Spannungszustand vorzuliegen, der abgebaut werden will! „Ersatzhandlungen“: Spannungsabbau bei unerledigten Handlungen durch ähnliche Handlungen Der „Ersatzwert“ einer Aufgabe wird durch deren Schwierigkeit, Valenz, Realitätsgrad und die Ähnlichkeit zur unterbrochenen Aufgabe bestimmt. Ferdinand Hoppe (1930): Anspruchsniveau und Wiederaufnahme; typische und untypische Anspruchsniveauverschiebungen Erfolg und Misserfolg hängen vom subjektiven Anspruchsniveau ab 1. Zieldiskrepanz: zw. Ausgangs- und Anspruchsniveau 2. Zielerreichungsdiskrepanz: zw. Anspruchsniveau und tatsächlicher Leistung => führt zu affektiver Reaktion Typische Anspruchsniveauverschiebungen: Erfolg => Erhöhung des Anspruchsniveaus; Misserfolg => Senkung des Anspruchsniveaus Untypische Anspruchsniveauverschiebungen: Bei manchen VPn ist es auch umgekehrt: Erfolg führt zur Senkung-, Misserfolg zur Erhöhung des Anspruchsniveaus. 1. Erklärung: siehe Kap. 10 8.2. Zielumsetzung („Realisationsmotivation“) 8.2.1. Wille und Handlungsregulation Theorien zur Handlungskontrolle befassen sich mit den psychologischen Prozessen, die nach der Zielsetzung (s.o.) zur Zielerreichung beitragen und ein bestimmtes Ziel gegen rivalisierende Ziele abschirmen. Narziss Ach (1905): Willensakte sind dafür verantwortlich, dass und wie ein gefasster Entschluss in die Tat umgesetzt wird („Determinierung“). Vgl. hierzu: volitionale Bewusstseinslage (Heckhausen & Gollwitzer) 8.2.2. Das Rubikonmodell (Heckhausen & Gollwitzer) Handlungsphasen: Heckhausen & Gollwitzer gehen von 4 Handlungsphasen aus. Am Anfang einer jeden Handlung steht ein Bedürfnis oder Wunsch (z.B. etw. für die körperliche Fitness zu tun). Vorentscheidungsphase (prädezisional): 1. Die sog. Vorentscheidungsphase dient der Intentionsbildung. Dabei werden die verschiedenen Handlungsalternativen bezüglich ihres Wertes und ihrer Erfolgserwartung* gegeneinander abgewogen (z.B. joggen, Fußball, Tanzkurs,…). * Erwartung x Wert (s.o.): Ist die Handlungsalternative realisierbar (Erwartung) und ist sie attraktiv (Wert)?! 2. Am Ende dieser Phase steht ein Entschluss (Fazittendenz): Aus dem allgemeinen Wunsch (etw. für die körperliche Fitness zu tun) ist eine konkrete Handlungsabsicht (Zielintention) geworden (Fußball spielen). 39 Vorhandlungsphase (präaktional): 1. Die Vorhandlungsphase dient der Erstellung eines Handlungsplans; es geht also um die Erwägung konkreter Umsetzungsmöglichkeiten (Wo, wie und wann wird Fußball gespielt?). 2. Fiattendenz: Am Ende dieser Phase steht ein Plan bzw. ein konkreter Vorsatz (Implementierungsintention), der festlegt, wie und wann die Handlung realisiert werden soll. Handlungsphase (aktional): 1. Die Handlungsphase dient der Ausführung des Handlungsplans, der dabei fortwährend mit den aktuellen Gegebenheiten verglichen wird. 2. Am Ende dieser Phase steht der Abschluss der Handlung, im idealen Fall bedeutet das zugleich die Erreichung des Ziels (fit zu sein). Nachhandlungsphase (postaktional): 1. Die Nachhandlungsphase dient der Bewertung des Erreichten. Es geht also darum, für sich zu entscheiden, ob die Handlung erfolgreich war oder nicht. 2. Am Ende dieser Phase steht evtl. eine Neubewertung der ursprünglichen Handlungsalternativen oder gar der eigenen Standards. (Rudern statt Fußball? Oder ist Erfolg im Studium doch wichtiger als körperliche Fitness?!) Bewusstseinslagen: Die verschiedenen Phasen zeichnen sich durch unterschiedliche Bewusstseinslagen aus. Die motivationale Bewusstseinslage: Zur motivationalen Bewusstseinslage gehören die Vorentscheidungsund Nachhandlungsphase: Zielsetzung! Um eine möglichst breite Vielfalt von Handlungsalternativen erfassen zu können, ist diese Bewusstseinlage durch Offenheit und Objektivität gekennzeichnet. Es gilt, möglichst viele Informationen aufzunehmen und sie möglichst objektiv bezüglich ihres Wertes und der Erfolgserwartung zu bewerten (realitätsorientierte Informationsverarbeitung). Die volitionale Bewusstseinslage: Zur motivationalen Bewusstseinslage gehören die Vorhandlungsund die Handlungsphase: Initiierung und Aufrechterhaltung des Handelns! In dieser Bewusstseinslage wird die Aufmerksamkeit auf die konkrete Absicht, deren Umsetzung und Ausführung fokussiert. Es gilt, sich nicht durch andere Handlungsabsichten ablenken zu lassen und die Konzentration ganz auf zielrelevante Infos und Reize zu richten. Realisierungsorientierte, statt realitätsorientierte Informationsverarbeitung, d.h. man ist weitaus optimistischer und blendet negative Rückmeldungen z.T. aus, um sich bei der Umsetzung nicht entmutigen zu lassen. 40 Empirische Überprüfung (Bewusstseinslagen): VPn werden in Bezug auf eigene Handlungsprobleme in Vorentscheidungsoder Vorhandlungsphase versetzt. Anschließend sollen sie ein unvollständiges Märchen zu Ende erzählen. Ergebnis: Die „prädezisionalen“ VPn schreiben dem Protagonisten mehr abwägendes Verhalten zu, die „präaktionalen“ mehr planendes Verhalten. Konkrete Vorsätze (Implementierungsintentionen) lenken die Aufmerksamkeit automatisch auf zielrelevante Reize bzw. Informationen und machen damit die Umsetzung einer allgemeinen Absicht (Zielintention) wahrscheinlicher. „Shadowing“-Experiment: VPn, die einen konkreten Vorsatz haben, werden beim dichotischen Hören durch Wörter, die sich auf diesen Vorsatz beziehen, abgelenkt. Sobald nämlich solche Wörter eingespielt werden, verlangsamt sich ihre Reaktionszeit! 41 9. Motivation und Kognition 9.1. Selbstkontrolle 9.1.1. Belohnungsaufschub (Walter Mischel) Ausgangsproblem: Die Verwirklichung langfristiger Ziele, wenn kurzfristig konkurrierende Ziele auftreten. Belohnungsaufschubparadigma: Wenn es gelingt, auf kurzfristige Belohnung zu verzichten, kann eine größere langfristige Belohnung erzielt werden. Mischel (1970): Experiment zum Einfluss der visuellen Präsenz der Belohnung Kinder konnten, je nachdem ob sie auf den VL warteten oder nach ihm klingelten, entweder eine langfristige (2 Schokoriegel) oder eine kurzfristige Belohnung (1 Schokoriegel) erlangen. UV: Variiert wurde dabei die visuelle Präsenz der Belohnung: die VPn hatten während des Experiments entweder einen, zwei oder keinen Schokoriegel vor Augen. Ergebnis: Die Kinder konnten am längsten warten, wenn sie keine Belohnung vor Augen hatten - am kürzesten, wenn sie beide Belohnungen vor Augen hatten. Der Belohnungsaufschub ist deshalb so oft problematisch, weil die unmittelbare Belohnung sensorisch differenzierter repräsentiert ist als die relativ abstrakte langfristige Belohnung! Anblick der Belohnung (Schokolade) => Aktivierung des „heißen Systems“ => sensorisch reiche Repräsentation => Druck zur Verhaltensausübung => Belohnungsaufschub schwierig Selbstkontrolle: Die Aufmerksamkeit muss von den Produkten des „heißen Systems“ weggelenkt werden. In einem anderen Experiment konnten z.B. Kinder, die instruiert wurden, nicht an die Belohnung, sondern ganz allgemein an „Spaß“ zu denken, die Belohnung am längsten aufschieben. 9.1.2. Handlungskontrolle und Persönlichkeitsunterschiede (Julius Kuhl) Die Realisierung einer einmal getroffenen Entscheidung wird durch Prozesse der Handlungskontrolle ermöglicht. Dazu gehören nach Julius Kuhl: Selektive Aufmerksamkeit (auf zielrelevante Infos gerichtet) Enkodierkontrolle (tiefere Verarbeitung zielrelevanter Infos) Emotionskontrolle (Bevorzugung förderlicher Emotionen) Motivationskontrolle (Betonung zielkonkruenter Anreize) Sparsame Infoverarbeitung (auf Realisierung bezogene Infos) Umweltkontrolle (Vermeidung von äußerer Ablenkung) Misserfolgsbewältigung (Verdrängung von Misserfolgen) Kuhl unterscheidet zwischen Lageorientierung und Handlungsorientierung: dabei handelt es sich einerseits um situationsbedingte Einstellungen (Vgl. hierzu die Bewusstseinslagen von Heckhausen & Gollwitzer), andererseits um feste Charaktereigenschaften. Lageorientierung: tritt auf, wenn die Realisierung der eigenen Vorsätze behindert wird, kann also durch Misserfolge ausgelöst werden (gelernte Hilflosigkeit) ist gekennzeichnet durch die langsame Verarbeitung negativer Emotionen und leichte Ablenkbarkeit; Grübeln über Misserfolg führt zu Entmutigung, Ablenkung und einem Mangel an Elan 42 Handlungsorientierung: Ist gekennzeichnet durch eine schnelle Handlungsinitiierung und rasche Affektregulation (Misserfolgserlebnisse werden zur Seite geschoben, um sich ganz der Aufgabe widmen zu können) ermöglicht schnelle Entscheidungen sowie konzentriertes und ausdauerndes Arbeiten 9.1.3. Roy Baumeister und der Selbstkontrollmuskel Die Selbstregulation (z.B. das Aufschieben einer Belohnung) kostet Energie und ist damit abhängig von Kraftressourcen (Selbstkontrollmuskel). Diese Ressource wird durch Selbstkontrolle verbraucht, kann aber auch trainiert werden. Verbraucht wird die Ressource z.B.: beim Widerstehen von Versuchungen (z.B. Bedürfnisaufschub) bei der kognitiven Kontrolle (Unterdrückung von Stereotypen und Affekten) bei der Aufmerksamkeitskontrolle bei physischer oder mentaler Anstrengung bei Wahlentscheidungen Baumeister (1998): Nachdem VPn dem Essen von Keksen widerstehen mussten (UV), sind sie beim Bearbeiten eines unlösbaren geometrischen Rätsels weniger ausdauernd. 9.2. Gedankenkontrolle 9.2.1. Terror Management Theorie (Greenberg & Pyszczynski) Die menschliche Todesangst führt zu dem Wunsch nach Unsterblichkeit in der Kultur. Dementsprechend geht die Erinnerung an den eigenen Tod mit dem Bedürfnis nach kulturellen Werten einher. Die Erinnerung an den eigenen Tod begünstigt konservative Einstellungen. EXPERIMENTE: Landau et al. (2004): Die Experimentalgruppe wird instruiert, sich gedanklich mit dem eigenen Tod auseinander zu setzen, die Kontrollgruppe soll sich intensiven Schmerz vergegenwärtigen. In der anschließenden Befragung zeigt sich, dass diejenigen, die mit dem Todesgedanken konfrontiert wurden, tatsächlich den konservativeren Kandidaten Bush bevorzugen, während die Kontrollgruppe eine eindeutige Präferenz für John Kerry zeigt. Interviews vor Friedhöfen führen zu konservativeren Ansichten! 9.2.2. Motiviertes Stereotypisieren (Sinclair & Kunda) Der Wunsch, ein positives Selbstbild aufrecht zu erhalten, kann zu einer verzerrten Informationsverarbeitung führen: motivierte Stereotypisierung! EXPERIMENT: Sinclair & Kunda (1999): Bei positiver Rückmeldung eines schwarzen Arztes wird das positive Arztstereotyp aktiviert, bei negativer Rückmeldung dagegen das negative Schwarzenstereotyp! 43 9.3. Automatische Zielaktivierung 9.3.1. Automatische Zielaktivierung (John Bargh) John Bargh (2001): Häufig verfolgte Ziele können durch ziel- oder mittelbezogene Wörter geprimt werden und haben dann die gleichen Konsequenzen wie bewusste Ziele, sprich: sie führen zu denselben affektiven Reaktionen (mystery mood), zu einer Wiederaufnahmetendenz,… Lakin & Chartrand (2003): UV: Durch subliminal dargebotene Wörter wie „Freund“, „Partner“, „zusammen“ wird bei einem Teil der VPn das Ziel der Zugehörigkeit geprimt, einem anderen Teil ist dieses Ziel bewusst, der Rest der VPn hat kein Ziel. AV: Nachahmung einer Person. Ergebnis: Zugehörigkeitsziele führen zu mehr Nachahmung, unabhängig davon, ob sie bewusst oder unbewusst aktiviert wurden. 9.4. Gelernte Hilflosigkeit 9.4.1. Gelernte Hilflosigkeit (Seligman) Nach mehreren Misserfolgserlebnissen in einer unkontrollierbaren Situation (z.B. durch willkürliche Elektroschocks) stellt sich das Phänomen der gelernten Hilflosigkeit ein. Gelernte Hilflosigkeit = die Erwartung, Ereignisse nicht kontrollieren zu können (Generalisierung der Hilflosigkeit) => führt zu späteren Lerndefiziten (motivationale, kognitive und emotionale Defizite) Auch in kontrollierbaren Situationen, in denen die Elektroschocks durch entsprechendes Verhalten vermieden werden können, zeigen sich die Tiere, die zuvor unkontrollierbaren Schocks ausgesetzt waren, unfähig, adäquat zu reagieren. Kritik: Interindividuelle Unterschiede (GH tritt nicht bei allen Individuen auf, dauert unterschiedlich lang und ist unterschiedlich stark ausgeprägt) können mit Seligmans Modell nicht erklärt werden! 9.4.2. Attributionale Theorie (Abramson et al.) Ob und wie stark das Phänomen der gelernten Hilflosigkeit auftritt hängt davon ab, auf was die Nicht-Kontingenz bzw. Unkontrollierbarkeit der Ereignisse zurückgeführt wird. GH tritt nur bei einem pessimistischen Attributionsstil auf: Lokation: Nur bei internaler Ursachenzuschreibung macht sich das Individuum selbst für den Misserfolg verantwortlich. Globalität: Nur bei globaler Ursachenzuschreibung wird die Misserfolgserwartung generalisiert. Stabilität: Nicht-Kontingennz wird auf stabile Ursachen zurückgeführt Die Art der Ursachenzuschreibung beeinflusst das Selbstwertgefühl und damit den affektiven Zustand einer Person. depressiver bzw. pessimistischer Erklärungsstil (negative Ereignisse werden auf internale, globale u. stabile-, positive Ereignisse auf externale, spezifische u. variable Ursachen zurückgeführt) => Depression 44 9.4.3. Gelernte Hilflosigkeit = Lageorientierung (Kuhl) Erwartungsgeneralisierung (Seligman) kann nicht zutreffen, da normalerweise zwischen verschiedenen Situationen differenziert werden kann. Stattdessen begünstigt permanenter Misserfolg den Zustand der Lageorientierung (s.o.): Man beschäftigt sich gedanklich mit den vorangegangenen Misserfolgen und wird dadurch von der Lösung der aktuellen Aufgabe abgelenkt. Die Ursachenattribution (Abramson et al.) ist demnach nicht die Ursache, sondern die Folge der „gelernten Hilflosigkeit“. Die Lageorientierung führt zu handlungsirrelevanten Attributionen, die von der Aufgabenlösung ablenken. 45 10. Leistungsmotivation 10.1. Das Leistungsmotiv 10.1.1. Henry Murray (1938) Murray postuliert 20 Bedürfnisse, die sich u.a. in entsprechenden Emotionen und Projektionen äußern. Eines dieser Bedürfnisse ist nach Murray das Bedürfnis nach Leistung! Leistungsbedürfnis = „Bedürfnis nach Bewältigung von Aufgaben, die als herausfordernd erlebt werden“. Weitere Bedürfnisse sind z.B. das Autonomiebedürfnis, das Zugehörigkeitsbedürfnis oder das Bedürfnis nach Dominanz. Der von Murray entwickelte „Thematische Apperzeptionstest“ (TAT) ist ein projektives Testverfahren, bei dem mehrdeutige Bilder, meist sozialen Inhalts, vom Pbn interpretiert werden sollen, um auf dessen Persönlichkeit bzw. Bedürfnisse und Motive zu schließen. Eine Weiterentwicklung dieses Tests von McClelland dient v.a. der Messung des Leistungsmotivs. 10.1.2. Lewins Beitrag zur Motivationsforschung Motivation = Funktion aus Erwartung und Wert (Erwartung x Wert) Leistungssituation = Annäherungs-Vermeidungskonflikt Die Kraft, Erfolg anzustreben, ergibt sich multiplikativ aus der Valenz für Erfolg und der Erfolgserwartung bzw. –wahrscheinlichkeit. Die Kraft, Misserfolg zu vermeiden ergibt sich dementsprechend aus der negativen Valenz für Misserfolg und die Misserfolgserwartung. Resultierende Kraft = Kraft (Erfolg) – Kraft (Misserfolg) Da sowohl die Valenz - als auch die Erwartung von Erfolg und Misserfolg subjektiv bedingt sind, können sie nur posthoc erschlossen werden. Interindividuelle Unterschiede, die u.a. in untypischen Verschiebungen des Anspruchsniveaus (Hoppe) zum Ausdruck kommen, erklärt Lewin mit der Subjektivität der postulierten Größen: v.a. der subjektiven Erfolgswahrscheinlichkeit („Potenz“) 10.1.3. Atkinsons Risikowahlmodell Atkinson, dessen Modell zu großen Teilen auf Lewins Feldtheorie beruht, geht von zwei entgegengesetzten Motivationstendenzen aus. Einerseits hängt die Leistungsmotivation von der Hoffnung auf Erfolg (Erfolgsmotiv), anderseits von der Furcht vor Misserfolg (Misserfolgsmotiv) ab. Beide Motive sind handlungsleitend; wie Lewin betrachtet Atkinson eine Leistungssituation also als Annäherungs-Vermeidungskonflikt. Welches dieser beiden Motive ausgeprägter ist, hängt nach Atkinson aber nicht nur von der Situation, sondern v.a. von der jew. Persönlichkeit ab, ist also individuell verschieden. 46 Zentrale Annahmen: Das Erfolgsmotiv (Me) und das Misserfolgsmotiv (Mm) sind demnach überdauernde Eigenschaften der Person (messbar durch TAT). Die einzige Theorie die von stabilen Persönlichkeitsfaktoren ausgeht und nicht nur die momentane Befindlichkeit als Motivationsquelle ansieht (=> Erklärung für interindividuelle Unterschiede). Der Anreiz einer Aufgabe hängt von der Aufgabe selbst ab (wie leicht bzw. wie schwierig sie ist) und entspricht der emotionalen Reaktion auf Erfolg bzw. Misserfolg, sprich Stolz oder Scham. Der Anreiz von Erfolg ist umso größer, je schwieriger die Aufgabe bzw. je geringer die Erfolgserwartung: Ae = 1- Erfolgswahrscheinlichkeit Der Anreiz von Misserfolg ist dagegen umso größer, je leichter die Aufgabe bzw. je geringer die Misserfolgserwartung. Am = 1 – Misserfolgswahrscheinlichkeit Einfach ausgedrückt: Je schwieriger die Aufgabe, desto befriedigender der Erfolg (stolz) – je leichter eine Aufgabe, desto enttäuschender bzw. peinlicher ein Misserfolg (Scham)! Die Tendenz, einen Erfolg anzustreben (Te), ergibt sich aus der multiplikativen Verknüpfung des Erfolgsmotivs (Me), der Erfolgserwartung (We) und dem Anreiz von Erfolg (Ae). Die Tendenz, einen Misserfolg zu vermeiden (Tm), ist dementsprechend das Produkt aus Misserfolgsmotiv (Mm), Misserfolgserwartung (Wm) und Misserfolgsanreiz (Am). Te = Me x We x Ae Tm = Mm x Wm x Am Resultierende Tendenz: Tr = Te – Tm Hinzu kommt der Einfluss extrinsischer Motive (wie z.B. äußere Zwänge, materielle Belohnung,…), die es ermöglichen, dass auch stark misserfolgsmotivierte Personen sich Leistungssituationen stellen. Tr + Tex Schlussfolgerungen u. Hypothesen: Wenn das Misserfolgsmotiv größer ist als das Leistungs- bzw. Erfolgsmotiv sollten Leistungssituationen, sofern keine extrinsischen Motive vorliegen, grundsätzlich gemieden werden; im umgekehrten Fall sollten sie aufgesucht werden. Wenn das Misserfolgsmotiv überwiegt, sind Aufgaben mittlerer Schwierigkeit mit der größten Vermeidungstendenz verbunden; es sollten eher leichte (geringe Misserfolgserwartung) oder schwere (geringer Misserfolgsanreiz) Aufgaben gewählt werden. Umgekehrtes gilt für ein stärker ausgeprägtes Erfolgsmotiv; hier sollten überwiegend Aufgaben mittlerer Schwierigkeit gewählt werden 47 Empirische Überprüfung: Aufgabenwahl (Atkinson): Bei einer Ringwurfaufgabe, bei der der Abstand zum Ziel frei gewählt werden konnte, wählten VPn mit hohem Erfolgsmotiv (TAT) tatsächlich überwiegend Aufgaben mittlerer Schwierigkeit. Für VPn mit hohem Misserfolgsmotiv konnte die Ausgangshypothese allerdings nicht bestätigt werden. Sie wählten alle Aufgabenschwierigkeiten in etwa gleich oft. Anspruchsniveau-Setzung (Moulton): Bei VPn mit hohem Erfolgsmotiv zeigt sich eine typische Anspruchsniveausetzung (nach Erfolg Erhöhung -; nach Misserfolg Senkung des Anspruchsniveaus) VPn mit hohem Misserfolgsmotiv wählen gleichermaßen typischeund atypische AN-Setzungen (nach Erfolg Senkung -, nach Misserfolg Erhöhung des Anspruchsniveaus) Kritik (Trope & Brickman): Alternativerklärung: Nicht die Aufgabenschwierigkeit, sondern deren Diagnostizität ist entscheidend für die Aufgabenwahl. Anders ausgedrückt: es geht nicht darum Scham zu vermeiden bzw. Stolz zu maximieren (Atkinson), sondern darum, möglichst viel bzw. wenig Informationen über die eigene Leistungsfähigkeit zu bekommen. Aufgaben mittlerer Schwierigkeit haben die höchste Diagnostizität: sie sagen am meisten über die eigene Leistungsfähigkeit aus. „Erfolgsmotivierte“ Personen bevorzugen diagnostische Aufgaben, um mehr über die eigene Leistungsfähigkeit zu erfahren, während „misserfolgsmotivierte“ aus Angst vor negativen Rückschlüssen auf die eigene Person solche Aufgaben eher meiden. 10.2. Regulatorischer Fokus (Tory Higgins, 1997) Das Leistungsmotiv kann entweder auf die Erreichung eines Minimalziels oder eines Maximalziels richten. Das Erreichen des Maximalziels wird dabei als positives Erlebnis empfunden; das Verfehlen des Maximalziels als nicht-positives Erlebnis. Das Erreichen des Minimalziels wird als nicht-negatives Erlebnis empfunden, die Verfehlung des Minimalziels als negatives Erlebnis. Higgins unterscheidet demnach zwischen 2 Systemen der Selbstregulation. Je nachdem auf welches Ziel man das eigene Handeln ausrichtet, liegt entweder ein „Prevention-“ oder „Promotion Fokus“ vor. Welche dieser beiden „Strategien“ angewandt wird, ist zum Teil situationsbedingt, zum Teil persönlichkeitsabhängig (je nachdem, ob in der Erziehung eher Soll-Ziele oder Ideale vorgegeben wurden; positiv oder negativ verstärkende Erziehung). Prevention Fokus: Vigilanz 1. 2. 3. 4. Fokus liegt auf dem Minimalziel Verbunden mit Sicherheitsbedürfnissen Strategie ist Vermeidung (Vgl.: Misserfolgsmotiv) Langsames, genaues und vorsichtiges Arbeiten; analytisches Vorgehen 5. Die in Leistungssituationen empfundenen Emotionen sind entweder ängstliche Anspannung oder Erleichterung 48 Promotion Fokus: Strebsamkeit 1. 2. 3. 4. Fokus liegt auf Maximalziel Verbunden mit Wachstumsbedürfnissen Strategie ist Annäherung (Vgl. Erfolgsmotiv) Schnelles, weniger genaues und vorsichtiges Arbeiten; mehr Kreativität 5. Die in Leistungssituationen empfundenen Emotionen sind entweder Freude oder Enttäuschung Empirische Überprüfung (Friedman & Förster, 2001): Nach Promotion-Priming zeigen VPn bei Wiedererkennungsaufgaben eine stärkere Ja-Sage-Tendenz (weniger vorsichtigeres Arbeiten), finden ungewöhnlichere Verwendungsarten für einen Ziegelstein und schneiden in Wortstammergänzungsaufgaben besser ab (Kreativität) 10.3. Stereotype Threat (Steele & Aronson, 1995) Definitionen: Stereotyp: die erwartete Korrelation zwischen bestimmten Eigenschaften einer Person und ihrer Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Stereotype Threat: Die Angst, ein negatives Stereotyp über die eigene Gruppe durch persönliches Versagen bei einer schwierigen Aufgabe zu bestätigen. führt tatsächlich zu schlechteren Leistungen (das Stereotyp als „selffullfilling Proficy“). In mehreren Experimenten konnte nachgewiesen werden, dass Leistungsunterschiede situativ manipulierbar sind und daher keineswegs immer auf stabilen Defiziten beruhen müssen. Durch die Aktivierung bestimmter Stereotype kann die Leistung der von diesen Stereotypen betroffenen VPn verschlechtert werden. Gezeigt werden konnte dieser Effekt z.B. bei Frauen und deren mathematischem Leistungsvermögen oder bei der Testung verbaler Intelligenz farbiger Studenten! Wie kommt es zu diesem Effekt?! Mögliche Mediatoren sind… erhöhte Bewertungserwartung (= erhöhter Leistungsdruck) geringere Leistungserwartung bzw. Misserfolgserwartung Prevention Fokus 49 10.4. Leistung in Gruppen Der Einfluss der Gruppe: Soziale Erleichterung bei einfachen Aufgaben (bessere Leistung unter der Anwesenheit anderer) – soziale Hemmung bei schwierigen Aufgaben (schlechtere Leistung unter der Anwesenheit anderer) Bewertungserwartung (Yerkes-Dodson-Gesetz) Aufmerksamkeitskonflikt Der Einfluss der Gruppengröße: Je größer die Gruppe, desto mehr reduziert der einzelne seinen Beitrag („Soziales Faulenzen“ – Bspl.: Tauziehen) Nichtidentifizierbarkeit und Nichtbewertung Relative Unwichtigkeit des eigenen Beitrags Verantwortungsdiffusion Empfundene Unausgewogenheit der Beiträge Individualistischer kultureller Hintergrund (Einzelleistung wird als höherwertig betrachtet als Gruppenleistung) Effektivitätshindernisse in der Gruppe (Brainstorming funktioniert z.B. in der Gruppe besser als allein) Rücksicht (den anderen auch mal sprechen lassen) Bewertungsangst Lösungen: Einzelleistungen bei einfachen Aufgaben identifizierbar machen, bei schwierigen eher nicht Identifikation mit der Gruppe stärken (gegen Individualismus) Bewertung der Gruppenleistung Brainstorming allein und nicht in der Gruppe Expertenrollen zuordnen (gegen die Verantwortungsdiffusion) 10.5. Zusammenfassung Die Leistungsmotivation ist abhängig von… individuell überdauernden Motiven Atkinson: Erfolgs- vs. Misserfolgsmotiv Aufgabentyp und strategischer Neigung Higgins: Prevention- vs. Promotion Fokus Situativem Druck Steele & Aronson: Stereotype Threat Yerkes-Dawson Gesetz: Anwesenheit Anderer Kompetenzerwartung und Zielsetzung Bandura: „Selfefficacy“ Vorherigen Kontrollverlusterfahrungen Seligman: gelernte Hilflosigkeit Fähigkeitstheorien (fix oder veränderbar) Dweck: Entity vs. Incremental Theory Gruppenprozessen Synergieeffekte vs. Prozessverluste (z.B. Identifizierbarkeit) durch mangelnde 50 11. Pro- und antisoziales Verhalten 11.0. Einleitung Echter Altruismus ist per definitionem um seiner selbst Willen motiviert. Altruismus Egoismus / Hedonismus Empathie: Nachempfinden eines emotionalen Zustands einer anderen Person, in einer konkreten Situation durch Perspektivübernahme ausgelöst! Aus evolutionärer Sicht betrachtet, dürfte es keinen „echten Altruismus“ geben. Einziges Ziel dürfte die Genweitergabe und damit die Steigerung der eigenen Fitness sein. Prosoziales Verhalten tritt also aus evolutionärer Sicht nur dann auf, wenn es sich auch für den Helfer lohnt: „kin selection“: daher wird z.B. vorrangig Verwandten geholfen (gleiche Gene) Reziproker Altruismus („Hilfst du mir, helf’ ich dir“): Wechselseitige Hilfe auch unter nicht-verwandten Individuen; tritt v.a. in sozialen Gruppen auf, deren kollektives Überleben von Kooperation abhängt. 1. Gouldner (1960): Empfangene Hilfe nicht „zurückzugeben“ ist emotional aversiv (Helfen dient der Stimmungsverbesserung). 11.1. Kognitives Modell der Hilfeleistung (Latané & Darley) Helfen als sequentieller Entscheidungsprozess, bei dem 5 Barrieren überwunden werden müssen, bevor die Handlung initiiert werden kann. 1) Es muss registriert werden, dass ein Notfall vorliegt (Aufmerksamkeitslenkung bzw. -kapazität) 2) Es muss entschieden werden, dass Hilfe nötig ist (Interpretation) Soziale Vergleichsprozesse: Nur wenn die anderen reagieren, reagiert man selbst. Latané & Darley (1968): Beim Bearbeiten eines Fragebogens kam Rauch aus der Lüftung. Waren die VPn allein im Versuchsraum, suchten 75% nach Hilfe; wenn ein Verbündeter weiterarbeitete, nur 10%! 3) Die Verantwortlichkeit für die Hilfeleistung muss übernommen werden (Verantwortungsübernahme) Verantwortungsdiffusion: „Das kann auch ein anderer machen!“ Latané & Darley (1968): Über Kopfhörer und Mikrophon wird eine anonyme Gruppendiskussion geführt. Dabei täuscht einer der Teilnehmer einen epileptischen Anfall vor. Ergebnis: Je größer die Gruppe war (2,3 oder 6 Personen), desto weniger Leute versuchten zu helfen. 4) Die angemessene Reaktion muss bekannt sein (Kompetenz) VPn, die einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert hatten, halfen bei medizinischen Notfällen eher. 5) Die Entscheidung muss umgesetzt werden (Umsetzung) Dabei machen konkurrierende Ziele helfendes Handeln unwahrscheinlicher. Darley (1973): Theologiestudenten sollten Referat zum guten Samariter halten – auf dem Weg zum Hörsaal halfen diejenigen, die unter Zeitdruck standen, einem Bettler seltener als die ohne Zeitdruck. 51 11.2. Emotionale Erregung und Kosten-Nutzen-Abwägung Piliavin (1981) erweiterte die Entscheidungssequenz von Latané & Darley um 2 Aspekte: Die emotionale Erregung: wird durch Notfall ausgelöst kann durch helfende Intervention, Flucht oder das Ignorieren des Notfalls reduziert werden. Eine Kosten-Nutzen-Abwägung Welche dieser Alternativen gewählt wird, hängt von einer KostenNutzen-Abwägung ab: Welche Kosten und Nutzen bringt das Helfen bzw. Nichthelfen für einen selbst und den anderen mit sich?! 11.3. Stimmungen und Hilfeverhalten Ob jemand gut oder schlecht gelaunt ist, hat Einfluss auf dessen Hilfeverhalten. Gute Stimmung erhöht Hilfsbereitschaft: Isen (1970): Nach positiver Rückmeldung halfen Studierende einer Frau, die sich mit einem Stapel Bücher abmühte, häufiger als Studierende, die keine positive Rückmeldung erhalten hatten. Mögliche Erklärungen: 1. Stimmungskongruente Urteile und Gedanken (die Mitmenschen werden positiver wahrgenommen) 2. Bedürfnis, die eigene Stimmung aufrechtzuerhalten (“Mood maintenance hypothesis“) 3. Aufmerksamkeit eher nach außen gerichtet Auch schlechte Stimmung und negative Emotionen können die Hilfsbereitschaft erhöhen: z.B. Schuldgefühle! Katholiken sind vor der Beichte eher bereit zu spenden als nach der Beichte! „Negative state relief“- Theorie: Für Effekte negativer Stimmung ist entscheidend, ob Helfen die Stimmung verbessern kann bzw. ob die Person an eine solche Verbesserung glaubt. Fazit: Gutgestimmte VPn helfen generell mehr als neutralgestimmte; schlechtgestimmte helfen nur dann mehr als neutralgestimmte, wenn sie nicht glauben, dass ihre Stimmung fixiert ist. 11.4. Die Empathie-Altruismus-Hypothese (Daniel Batson) Grundsätzlich gibt es zwei Reaktionen auf das Leiden anderer: „personal distress“ (unangenehme Erregung, selbstbezogen) Empathie (Mitgefühl, auf das Opfer bezogen) Daniel Batson: Es gibt„echten“ Altruismus, der durch Empathie ermöglicht wird! EXPERIMENT (Batson et al., 1981): VPn beobachten das Leiden einer „Mitversuchsperson“, der angeblich Elektroschocks verabreicht werden. Möglichkeit zur Hilfe: Platz tauschen. Variiert wird zum einen die Möglichkeit zur Flucht (leicht vs. schwer) und der Grad an Empathie (wenig vs. große Ähnlichkeit zw. den VPn). Ergebnis: Bei hoher Empathie ist die Bereitschaft zur Hilfe generell hoch, bei niedriger Empathie wird nur dann geholfen, wenn keine leichte Fluchtmöglichkeit besteht. 52 12. Aggressives Verhalten 12.1. Definitionen Panksepp: Es gibt 3 angeborene neurophysiologische Aggressionszentren oder – typen: 1. Affektive Aggression (ausgelöst durch Frustration) 2. Jagdaggression 3. Intermale-Aggression (Kampf um Reproduktionsressourcen, sprich Weibchen) McDougall: Aggression als einer von 18 Instinkten; aggressives Verhalten ist demnach das Produkt eines Aggressionstriebs Freud: Thanatos => ein auf Lebenszerstörung gerichteter Trieb; Abbau durch „abreagieren“ (Katharsis) Lorenz: Aggression als angeborene Verhaltensdisposition, die der Anpassung an die Umwelt dient; Aggression als verhaltensspezifische Energie, die sich regelmäßig entladen muss und in etwa den gleichen Gesetzmäßigkeiten folgt wie wiederkehrende physiologische Bedürfnisse. 12.2. Die Frustrations-Aggressions-Hypothese Frustration ist eine Folge der Unterbrechung zielgerichteter Handlung. Ursprungsthese (Dollard et al.): Frustration führt immer zu irgendeiner Form von Aggression! Kritik: Auch andere Reaktionen auf Frustration sind denkbar: z.B. Weinen oder Apathie Abgeschwächte These: Frustration produziert Reaktionen. Eine davon ist Aggression. Aggression als dominante „Reaktionstendenz“ auf Frustration Berkowitz (1974): Frustration ruft emotionale Erregung (Ärger) hervor. Diese führt nur in Kombination mit entsprechenden Hinweisreizen zu Aggression. Hinweisreize, die aggressives Verhalten hervorrufen, sind alle Reize, die mit Ärger assoziiert werden (z.B. Waffen) Kritik: Trotz aggressiver Hinweisreize muss Frustration nicht immer zu Aggression führen! Aggressives Verhalten nach Frustration wird begünstigt durch: den Attributionsstil einer Person: je nachdem, auf welche Ursache die Frustration zurückgeführt wird, ob dem Frustrationsauslöser z.B. eine Absicht unterstellt wird oder nicht Erziehung/ Lernprozesse (Bandura): je nachdem, ob Aggression als Mittel zur Erregungsreduktion gelernt wurde oder nicht 12.3. Die Wirkung von Mediengewalt Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Konsum aggressiver Fernsehsendungen/ Videospielen und aggressiven Verhaltensweisen! Anderson & Dill (2000): Videospiele mit aggressiven Inhalten aktivieren mehr aggressionsbezogene kognitive Inhalte und führen dadurch zu mehr aggressiven Handlungen. 53 54