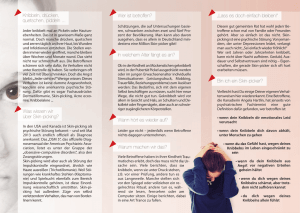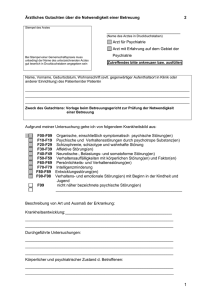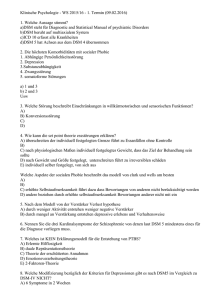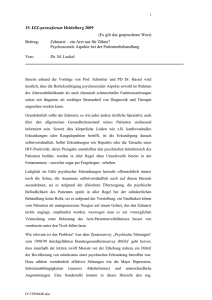Lebenszeitrisiko mehr als 50 Prozent
Werbung

W I S S E N S C H A F T Psychische Erkrankungen in Europa Lebenszeitrisiko mehr als 50 Prozent Metaanalyse der Technischen Universität Dresden: 27 Studien mit mehr als 150 000 Teilnehmern untersucht D epression, bipolare Störung, Schizophrenie,Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Sozialphobie, Panikstörung, generalisierte Angst, Zwangsstörungen, somatoforme Störungen oder Demenz – psychische Störungen dieser Art sind bei Europäern keine Seltenheit. Nach einer in European Neuropsychopharmacology (2005: 15: 357–76) publizierten Metaanalyse entwickelt jeder vierte Europäer (27 Prozent) wenigstens einmal pro Jahr eine der genannten psychischen Störungen. Das Lebenszeitrisiko liegt sogar bei mehr als 50 Prozent. Am häufigsten sind Angststörungen, Substanzstörungen und somatoforme Störungen. Prof. Dr. med. Hans-Ulrich Wittchen und Dr. Frank Jacobi von der Technischen Universität Dresden fassten in der Metaanalyse die Ergebnisse von 27 Studien mit mehr als 150 000 Teilnehmern zusammen. Die Prävalenz von 27 Prozent macht psychische Störungen zu einer Zivilisationskrankheit wie Hypertonie und Diabetes mellitus. Wie diese kommen die Störungen nicht isoliert vor. Viele Menschen leiden häufig in verschiedenen Lebensphasen an unterschiedlichen Störungen. Eine „reine Depression“ oder eine „reine Panikstörung“ trete verhältnismäßig selten auf, erklärt Wittchen. Die häufigsten Muster seien frühe Angststörungen, an die sich im weiteren Verlauf oft somatoforme, Sucht- und depressive Erkrankungen anschließen. Höheres Risiko für Frauen Die Mehrheit der psychischen Störungen manifestiere sich im wichtigen Zeitabschnitt für eine erfolgreiche gesundheitliche Entwicklung und Sozialisation – nämlich in der Kindheit und Adoleszenz. In dieser Zeit würden häufig die Weichen für einen lebenslangen Leidensweg gestellt, der dann auch andere Lebensbereiche (zum Beispiel berufli- Geschätzte Zahl psychisch Kranker und 12-Monats-Prävalenz (%) in der Europäischen Union Essstörung Substanzstörung Zwangsstörung psychotische Störung biopolare Störung Agoraphobie generalisierte Angststörung Panikstörung soziale Phobie Alkoholabhängigkeit somatoforme Störung spezifische Phobie Major Depression 1,1 Mio. 2,0 Mio. 2,6 Mio. 3,6 Mio. 2,4 Mio. 3,9 Mio. 5,8 Mio. 5,2 Mio. 7,1 Mio. 18,9 Mio. 18,4 Mio. 18,5 Mio. 0 1 2 ⏐ PP⏐ ⏐ Heft 1⏐ ⏐ Januar 2006 Deutsches Ärzteblatt⏐ 3 4 5 Prozent 6 7 8 9 Quelle: Technische Universität Dresden 6,6 Mio. PP che Karriere, Partnerschaft und Familienleben) beeinträchtigte. Frauen haben nach den Erkenntnissen der Wissenschaftler ein höheres Risiko, an psychischen Störungen wie Angst, Depression und somatoformen Störungen zu erkranken, als Männer. Ausnahmen gebe es nur bei der Substanzabhängigkeit, bei Psychosen und bipolaren Störungen. Frauen hätten zudem ein erhöhtes Risiko, komplexe komorbide Störungsmuster zu entwickeln. Frauen würden überwiegend in den gebärfähigen Jahren erkranken, was sich wiederum negativ auf die Entwicklung ihrer Kinder auswirke. Nur selten würden psychische Störungen früh erkannt und adäquat behandelt. 26 Prozent der Betroffenen erhielten eine unspezifische und noch weniger eine adäquate Behandlung. Ausnahmen seien Psychosen, schwere Depressionen und komplexe komorbide Muster. Unbehandelt verlaufen viele psychische Störungen häufig chronisch mit zunehmenden Komplikationen.Auf die Folgen machte kürzlich ein Green Paper der EU-Kommission aufmerksam, das sich ebenfalls auf die Untersuchung aus Dresden berief. In der Europäischen Union würden sich jedes Jahr 58 000 Menschen das Leben nehmen. Das seien mehr Todesfälle als infolge von Verkehrsunfällen, Morden und Aids. Mentale Erkrankungen verursachen nach Schätzungen der EU Kosten in Höhe von drei bis vier Prozent des Bruttosozialproduktes, vor allem durch Produktivitätsverluste. Mentale Erkrankungen seien auch die häufigste Ursache von Frühberentungen. Wittchen schätzte die Kosten auf fast 300 Milliarden Euro pro Jahr, von denen allein 132 Milliarden Euro auf indirekte Kosten (krankheitsbedingte Ausfalltage, früher Ruhestand, vorzeitige Sterblichkeit und verringerte Arbeitsproduktivität) entfallen. Nur 110 Milliarden Euro würden demgegenüber für direkte Kosten (Hospitalisierung und Hausbesuche von Patienten) ausgegeben. Die Kosten für die medikamentöse Therapie – als die am häufigsten eingesetzte Behandlungsart – würden dagegen nur vier Prozent der Gesamtausgaben betragen. Die Kosten für psychotherapeutische Leistungen lägen bei weit unter Rüdiger Meyer einem Prozent. 25