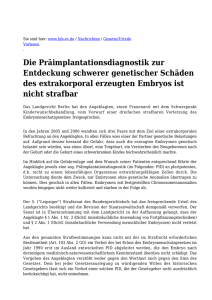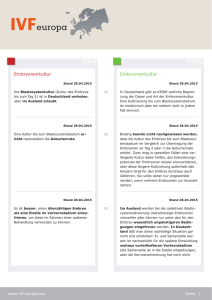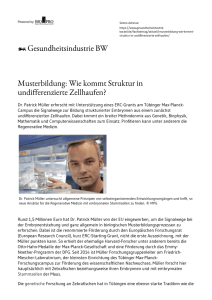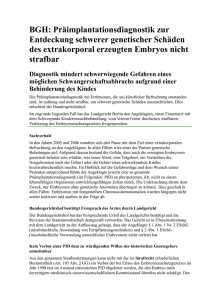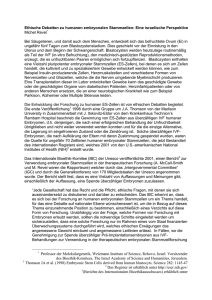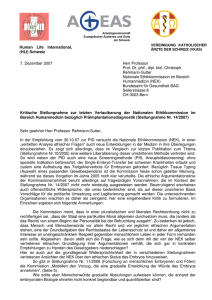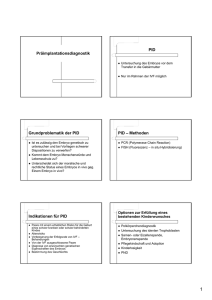PID, PND, Forschung an Embryonen
Werbung
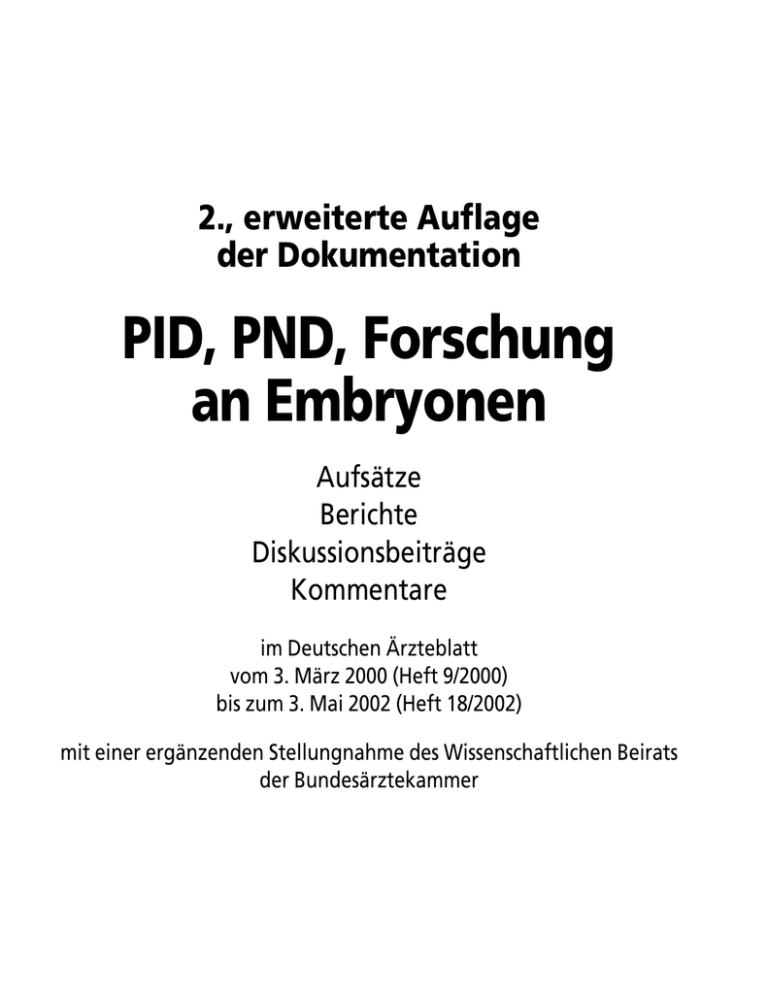
2., erweiterte Auflage der Dokumentation PID, PND, Forschung an Embryonen Aufsätze Berichte Diskussionsbeiträge Kommentare im Deutschen Ärzteblatt vom 3. März 2000 (Heft 9/2000) bis zum 3. Mai 2002 (Heft 18/2002) mit einer ergänzenden Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer I N H A L T Vorwort zur zweiten Auflage Ethisches Dilemma der Fortpflanzungsmedizin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 V Unterschiedliche Schutzwürdigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 or genau einem Jahr hat die Redaktion des Deutschen Ärzteblattes in einem Sonderdruck Beiträge zur Präimplantationsdiagnostik (PID) und verwandten Themen zusammengefasst. Schon damals, mitten in einer heißen Diskussion, war klar, dass der Themenkreis auch im Deutschen Ärzteblatt längst nicht ausdiskutiert war. Unmerklich hat sich inzwischen der Schwerpunkt der Diskussion und auch der politischen Willensbildung verlagert: Von der Präimplantationsdiagnostik zur Forschung an und mit Embryonen und zur Gewinnung von Stammzellen. Die Meinungsbildung in der Ärzteschaft und in der Öffentlichkeit spiegelt sich in der Berichterstattung und Kommentierung des Deutschen Ärzteblattes wider, wie diese erweiterte Materialsammlung beweist. DÄ, 17. Mai 2002 Gisela Klinkhammer Gisela Klinkhammer Zunehmendes Lebensrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ministerialrat a. D. Dr. jur. Rudolf Neidert Diskussion: Zunehmendes Lebensrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Gibt es das Recht auf ein gesundes Kind? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Dr. theol. Mirjam Zimmermann, Dr. theol. Ruben Zimmermann Beiträge aus dem Jahr 2001 Medizinische Ethik: Weiterhin Diskussionsbedarf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Gisela Klinkhammer Embryonenschutz: Englische Verführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Norbert Jachertz Dokumentation in chronologischer Reihenfolge Beiträge aus dem Jahr 2000 Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Präimplantationsdiagnostik: Am Rande der schiefen Bahn . . . 9 Bioethik: CDU lotet noch Grenzen aus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Meinungsaustausch mit dem Bundeskanzler: Kurskorrekturen bei den Budgets im Gespräch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Sabine Rieser Gentechnik: Der Zweck heiligt die Mittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Norbert Jachertz Dr. med. Eva A. Richter Präimplantationsdiagnostik: Auftakt des öffentlichen Diskurses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Medizinethik: Irritationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Sabine Rieser Plädoyer für eine unvoreingenommene, offene Debatte . . . . . . 12 Gisela Klinkhammer Fortpflanzungsmedizin: Die Gewichte verschieben sich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Ulrike Riedel Dr. med. Eva A. Richter Präimplantationsdiagnostik: Mensch von Anfang an . . . . . . . . . . . 14 Medizinische Ethik: Auf Schlingerkurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Joachim Kardinal Meisner Gisela Klinkhammer Präimplantationsdiagnostik: Kein Blick aufs Ganze . . . . . . . . . . . . . 14 Sabine Rieser Biomedizin: Kein „Hirtenwort“, sondern Diskussionsanstoß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Diskussion zu dem Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie der Bundesärztekammer und den dazu erschienenen Berichten und Kommentaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Bischofskonferenz: Warnung vor Missbrauch der Gentechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Wissenschaftlicher Beirat der Bundesärztekammer: Von richtigen rechtlichen Voraussetzungen ausgehen . . . . . . . . . 25 Prof. Dr. Dr. med. h. c. H.-L. Schreiber Dr. med. Eva A. Richter Gisela Klinkhammer Ärztinnenbund: Dammbruch befürchtet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Präimplantationsdiagnostik als Verantwortung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Fortschritt der Biomedizin: Die Politik steht vor der Quadratur des Kreises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Der Vorstand des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer Andreas Kuhlmann Schöne Neue Welt: Muss man alles machen, was man kann? . . 28 PID: „Glasklare Regelung“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Dr. med. Frank Ulrich Montgomery Präimplantationsdiagnostik – medizinische, ethische und rechtliche Aspekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Prof. Dr. med. Hermann Hepp Medizinethik: Mindestmaß an Schutz für die Zukunft . . . . . . . . . . 37 Präimplantationsdiagnostik: Ganz am Anfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Dr. med. Eva A. Richter Einmal Gott spielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Gisela Klinkhammer, Dr. phil. Thomas Gerst Streit um die Embryonen: Was tun, wenn man sich nicht einigen kann? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Fortpflanzungsmedizin: Absage an jede Art eugenischer Zielsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Prof. Dr. med. Dr. phil. Urban Wiesing Gisela Klinkhammer Embryonenforschung in Europa: Gesundheit ist nicht das höchste Gut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Nochmals: Öffentlicher Diskurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Prof. Dr. theol. Ulrich Eibach 2 I N H A L T Diskussion: Gesundheit ist nicht das höchste Gut . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 PID: „Ein Verfahren zur Selektion“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 PID: Motivsuche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Dr. med. Frank Ulrich Montgomery Stammzellen-Import: Druck von allen Seiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Dr. med. Eva A. Richter Stammzellforschung: Perfektes Timing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Norbert Jachertz Diskussion: PID: Motivsuche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Stammzellforschung (I): Abschied von der Menschenwürde? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Zum 104. Deutschen Ärztetag: „Eine Sieger-Besiegten-Stimmung darf nicht aufkommen“ . . . 83 Priv.-Doz. Dr. med. Santiago Ewig DÄ-Interview mit Prof. Dr. med. Jörg-Dietrich Hoppe Gestaffeltes Schutzkonzept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Dokumentation: Stellungnahme der Zentralen Ethikkommission zur Stammzellforschung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Dr. jur. Tade M. Spranger Stammzellforschung (II): Menschenrecht auf Gesundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 104. Deutscher Ärztetag: Gespanntes Abwarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Prof. Dr. theol. Hartmut Kreß Norbert Jachertz Gesundheits- und Sozialpolitik: Freiheit und Verantwortung in der modernen Medizin . . . . . . . . . 86 Beiträge aus dem Jahr 2002 TOP I: Ethik: Die Unverfügbarkeit menschlichen Lebens . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Forschung und Ethik: Die Weichen sind gestellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Gisela Klinkhammer Stammzellen: „Rohstoff“ für die regenerative Medizin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Entschließungen: Gesundheits-, Sozial- und ärztliche Berufspolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Dr. med. Eva A. Richter, Gisela Klinkhammer Prof. Dr. med. Anthony D. Ho Diskussion: 104. Deutscher Ärztetag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Stammzellforschung: Erfolg versprechende Therapieansätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Gentechnikdebatte im Bundestag: Wo ist die Grenze? . . . . . . . . . . 93 Dr. med. Eva A. Richter Gisela Klinkhammer Embryonale Stammzellforschung: Die Mechanismen entschlüsseln und auf adulte Zellen anwenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Stammzellforschung: Durch- oder Dammbruch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Norbert Jachertz DÄ-Interview mit Prof. Dr. med. Oliver Brüstle Embryonenforschung und PID: „Ethik des Heilens“ versus „Ethik der Menschenwürde“ . . . . . . 122 Bioethik-Diskussion: Gespaltene Fraktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Prof. Dr. med. Dr. phil. Heinz Schott Dr. med. Eva A. Richter Stammzellen: Was Forscher wollen, was sie dürfen . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Dr. med. Peter Bartmann Embryonale Stammzellen: Entscheidung über Import vertagt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Gisela Klinkhammer, Dr. med. Eva A. Richter Embryonenschutz: Keine Entscheidung ohne qualifizierte Beratung . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Stammzellforschung: Das Argument des Sokrates . . . . . . . . . . . . . . 126 Dr. med. Dr. theol. Alfred Sonnenfeld Stammzellenimport: Unter Auflagen zugelassen . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Dr. med. Eva A. Richter Präimplantationsdiagnostik: „Verfassungsrechtlich unzulässig“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Dr. med. Eva A. Richter Priv.-Doz. Dr. med. Wolfram Henn et al. Deutsche (Gesundheits-)Politik: Ein klares Jein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Stammzellforschung: „Ethik des Heilens“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Thomas Gerst Gisela Klinkhammer Humanismusstreit: Vom Überschreiten des Rubikon. . . . . . . . . . . . 104 Gisela Klinkhammer Embryonale Stammzellforschung: Unterschiedliche Wertvorstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Gisela Klinkhammer Deutsche Bischofskonferenz: Kein „Zellhaufen“ . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Gisela Klinkhammer Reproduktionsmedizin: Fachgesellschaften für klare Regelungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Dr. Renate Leinmüller Präimplantationsdiagnostik: Anfang ohne Ende . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Embryonenforschung: Machtproben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Norbert Jachertz Symposium in der Kaiserin-Friedrich-Stiftung: Solidarität mit den „fortpflanzungswilligen Schichten“ . . . . . . 132 Dr. med. Eva A. Richter Stammzellgesetz: Tauziehen um Definitionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Dr. med. Eva A. Richter Kirchen: Absage an PID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Gisela Klinkhammer Stammzellgesetz: Klarheit oder Kompromiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Dr. med. Eva A. Richter Stammzellen-Import: Signal auf Stopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Entscheidung zum Stammzellgesetz: Die Tür steht einen Spalt offen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Dr. med. Eva A. Richter Dr. med. Eva A. Richter 3 D O K U M E N T A T I O N Vorwort zur 1. Auflage Beiträge zum Diskurs Als der Vorstand der Bundesärztekammer den „Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik“ vorlegte, rief er zugleich zu einem öffentlichen Diskurs auf. Der läuft seit nunmehr rund eineinhalb Jahren und hat einen kaum noch fassbaren Niederschlag in der Presse gefunden. Inzwischen bringen auch Funk und Fernsehen fast täglich Diskussionen nicht mehr nur zur Präimplantationsdiagnostik (PID), sondern auch zur Embryonenforschung. Das Deutsche Ärzteblatt hat sich von Anfang an an dem Diskurs beteiligt und die unterschiedlichsten Stimmen zu Wort kommen lassen. In diesem Sonderdruck sind diese Beiträge, beginnend mit dem Diskussionsentwurf, zusammengefasst. Die Redaktion hat sich sehr um Vollständigkeit bemüht, gleichwohl kann nicht ausgeschlossen werden, dass vielleicht ein Leserbrief oder eine kleinere Notiz fehlen. Die Diskussion ist im Übrigen keineswegs abgeschlossen. Weitere Beiträge für spätere Hefte des Deutschen Ärzteblattes sind in Satz – Stoff genug für eine allfällige erweiterte Auflage des Sonderdrucks. Der Dokumentation der im Deutschen Ärzteblatt erschienenen Beiträge sind vorangestellt ein Interview mit dem Präsidenten der Bundesärztekammer und des Deutschen Ärztetages, geführt im Vorfeld des in diesen Tagen beginnenden 104. Deutschen Ärztetages, sowie der Bericht über die einschlägige Diskussion beim vorangegangenen 103. Deutschen Ärztetag. Im Grunde genommen müsste eine vollständige Dokumentation über die Auffassungen der Ärzteschaft in der mit Präimplantationsdiagnostik zusammenhängenden Thematik weitaus früher beginnen, zumindest mit dem 88. Deutschen Ärztetag, der 1985 in Lübeck-Travemünde seine Haltung zur In-vitro-Fertilisation (IVF) formulierte. Bereits damals wurden die daraus entstehenden Probleme der Embryonenforschung klar erkannt, der Umgang mit den so genannten überzähligen Embryonen diskutiert. Der Ärztetag sprach sich schließlich mit großer Mehrheit zugunsten von IVF aus. Zur Embryonenforschung stellte er fest: „Experimente mit Embryonen sind grundsätzlich abzulehnen, soweit sie nicht der Verbesserung der Methode oder dem Wohle des Kindes dienen.“ Diese Formulierung war ein wenig strenger als die Vorstandsvorlage, entsprach aber noch einer zugleich vorgelegten Richtlinie des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer zur IVF (veröffentlicht in Heft 22/1985), die der Ärztetag pauschal „begrüßte“. In einer weiteren Richtlinie äußerte sich der Wissenschaftliche Beirat später, ohne Zutun des Ärztetages, zur Forschung an frühen menschlichen Embryonen (veröffentlicht in Heft 50/1985). Danach dürfen menschliche Embryonen „grundsätzlich“ nicht mit dem Ziel der Verwendung zu Forschungszwecken erzeugt werden. Mit der Formel „grundsätzlich“ wurden Impressum Chefredakteur: Chefs vom Dienst: Redaktion: Technische Redaktion: Schlussredaktion: 4 erhebliche Spannungen innerhalb des Beirates zu dieser Frage überdeckt. Die Richtlinien sprechen sich hingegen eindeutig für Untersuchungen, die der Verbesserung der Lebensbedingungen des jeweiligen Embryos und gleichzeitig dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dienen, aus, sofern Nutzen und Risiken miteinander sorgfältig abgewogen werden. Der 91. Deutsche Ärztetag beschloss 1988 in Frankfurt eine Änderung der (Muster-)Berufsordnung. Die Delegierten entschieden sich für einen Mittelweg: Die Erzeugung von Embryonen für Forschungszwecke wurde untersagt und dem ein weiterer Satz hinzugefügt: „Grundsätzlich verboten ist auch die Forschung an menschlichen Embryonen.“ Bei Einhaltung strikter Kriterien wurden allerdings Forschungen für zulässig gehalten, sofern sie der Deklaration von Helsinki entsprechen. Machen wir einen Sprung zum 100. Deutschen Ärztetag 1997 in Eisenach. Die damals neu strukturierte, bis heute geltende (Muster-)Berufsordnung verbietet gleichfalls die Erzeugung von menschlichen Embryonen zu Forschungszwecken.Verboten sind ferner diagnostische Maßnahmen an Embryonen, „es sei denn, es handelt sich um Maßnahmen zum Ausschluss schwerwiegender geschlechtsgebundener Erkrankungen im Sinne § 3 Embryonenschutzgesetz“. Und das gehört der Vollständigkeit halber dazu: Seit 1991 gilt das Embryonenschutzgesetz mit seinen strengen Regeln – strengeren als sie 1985 von der ärztlichen Selbstverwaltung und ihren wissenschaftlichen Beratern formuliert worden waren. Norbert Jachertz Dokumentation „PID, PND, Forschung an Embryonen“ vom 23. Mai 2002 Norbert Jachertz, Köln (verantwortlich für den Gesamtinhalt im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen) Gisela Klinkhammer, Herbert Moll Norbert Jachertz, Gisela Klinkhammer Jörg Kremers, Manfred Röhrig Helmut Werner Verlag: Deutscher Ärzte-Verlag GmbH, Köln Druck: L. N. Schaffrath, Geldern D O K U M E N T A T I O N Heft 9, 3. März 2000 Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik Mit dem vorliegenden „Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik“ beabsichtigt die Bundesärztekammer, einen Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Diskussion auf diesem so schwierigen und sensiblen Gebiet der Fortpflanzungsmedizin zu leisten. Die besonderen ethischen Konflikte, die mit der Präimplantationsdiagnostik verbunden sind, können nur dann vermieden werden, wenn betroffene Paare bewusst auf Kinder verzichten oder sich zu einer Adoption entschließen. Wie Gespräche mit Paaren mit hohen genetischen Risikofaktoren zeigen, werden diese Alternativen häufig jedoch nicht akzeptiert. In zehn Staaten der Europäischen Union ist die Präimplantationsdiagnostik bereits heute zulässig. Weltweit wurde die Methode bei mehr als 400 Paaren durchgeführt; bis heute wurden über 100 Kinder nach Präimplantationsdiagnostik geboren. Deshalb muss die Gesellschaft im öffentlichen Diskurs entscheiden, ob und inwieweit die Präimplantationsdiagnostik in Deutschland Anwendung finden soll. Die ethische Diskussion umfasst im Kern den Konflikt, dass nach einer künstlichen Befruchtung zur Herbeiführung einer Schwangerschaft der invitro gezeugte Embryo im Falle des Nachweises einer schweren genetischen Schädigung unter Umständen nicht in die Ge- bärmutter transferiert wird. Diese schwerwiegende grundsätzliche ethische Entscheidung liegt im Falle der Präimplantationsdiagnostik zunächst in der Verantwortung des betroffenen Paares und dann – aufgrund des durchzuführenden medizinischen Verfahrens – gleichermaßen auch beim Arzt. Die Ärzteschaft muss sich daher mit dem Thema „Präimplantationsdiagnostik“ befassen: Wenn die Gesellschaft die Präimplantationsdiagnostik mehrheitlich möchte, dann sind Rechtssicherheit und ein hohes Schutzniveau nur über Zulassungskriterien zu erreichen, die streng und äußerst restriktiv zu fassen sind. Dies wäre berufsrechtlich nur auf dem Wege einer Richtlinie zu erreichen, die eine Einzelfallbegutachtung vorschreibt. Darüber hinaus ist es unverzichtbar, dass die nicht rein medizinischen Aspekte dieses Verfahrens im Zivil- und Strafrecht durch den Bundesgesetzgeber geregelt werden müssen. Die Bundesärztekammer will mit dem vorgelegten Diskussionsentwurf zur Schärfung des Problembewusstseins im gesamtgesellschaftlichen Meinungsbildungsprozess beitragen und nicht das Ergebnis einer breiten gesellschaftlichen Diskussion über die Anwendung dieses neuen medizinischen Verfahrens in Deutschland präjudizieren. Zum Hintergrund Vorwort Die assistierte Reproduktion bei Störungen der Fertilität ist heute ein fester Bestandteil der Reproduktionsmedizin und hilft vielen Paaren, den dringenden Kinderwunsch zu erfüllen. Mit Hilfe zyto- und molekulargenetischer Methoden können im Rahmen der In-vitroFertilisation (IVF) schon in einer sehr frühen Phase der Entwicklung menschlichen Lebens Veränderungen (Mutationen) im Erbgut untersucht und erkannt werden, die auch zu schweren körperlichen und geistigen Fehlbildungen führen (Präimplantationsdiagnostik, englisch: preimplantation genetic diagnosis = PGD). Mit der IVF – ohne Vorliegen einer Fertilitätsstörung – als Voraussetzung für eine PGD stößt die Medizin in Grenzbereiche ärztlichen Handelns vor. Mit der PGD werden schwerwiegende und kontrovers diskutierte rechtliche und ethische Probleme aufgeworfen, die auf der ethischen Seite gekennzeichnet sind durch Sachverhalte, die schwierig miteinander zu vereinbaren sind: Auf der einen Seite wird durch aktives ärztliches Handeln mit der IVF die Entwicklung menschlichen Lebens mit dem Ziel einer Schwangerschaft eingeleitet, und auf der anderen Seite wird zugelassen, dass ein so gezeugter Embryo unter Umständen nicht in die Gebärmutter transferiert wird und mit ihm nicht die Entstehung einer Schwangerschaft angestrebt wird (bedingte Zeugung). Die Frage, ob es sich dabei um eine Ausnahme vom Tötungsverbot handelt, zum Beispiel vor dem Hintergrund eines abgestuften Schutzkonzepts, oder keine Tötung vorliegt, wird unterschiedlich beantwortet und bedarf noch einer abschließenden rechtlichen Diskussion und Würdigung. Die Bundesärztekammer hielt es vor diesem Hintergrund für geboten, durch ihren Wissenschaftlichen Beirat einen Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur PGD erarbeiten zu lassen. Damit soll versucht werden, den ethischen Normen, den gesetzlichen Regelungen, dem Stand der Wissenschaft und der Diskussion auf dem Gebiet der PGD gleichermaßen gerecht zu werden. Die Bioethik-Kommission des Landes Rheinland-Pfalz hat in ihrem Bericht „Präimplantationsdiagnostik – Thesen zu den medizinischen, rechtlichen und ethischen Problemstellungen“1 zu diesem Thema Stellung genommen und hält unter eng beschriebenen Voraussetzungen die PGD für zulässig. Dieser Bericht enthält eine ausführliche Darle- gung der Problematik sowie ein umfangreiches Literaturverzeichnis. Die außer Frage stehende Schutzbedürftigkeit des ungeborenen Lebens setzt dem Umgang mit Embryonen Schranken, die unter anderem gekennzeichnet sind durch das Verbot von Untersuchungen an Embryonen im Stadium der zellulären Totipotenz und das Verbot der „fremdnützigen“ Verwendung von Embryonen, also jeglicher verbrauchender Embryonenforschung und -diagnostik. Das Embryonenschutzgesetz verbietet die PGD an totipotenten Zellen; dieser gesetzlichen Vorgabe wird im Richtlinienvorschlag gefolgt. Diese Beschränkung gilt unabhängig von einem möglicherweise sich verändernden Kenntnisstand, ab wann embryonale Zellen nicht mehr als totipotent einzustufen sind. Nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft gelten Zellen nach Abschluss des Acht-Zell-Stadiums als nicht mehr totipotent. Basierend auf dieser wissenschaftlichen Erkenntnis, distanziert sich der Richtlinienvorschlag unmissverständlich von allen Gedanken,Vorstellungen und unter Um1 Bericht der Bioethik-Kommission des Landes RheinlandPfalz vom 20. 7. 1999: „Präimplantationsdiagnostik – Thesen zu den medizinischen, rechtlichen und ethischen Problemstellungen“. Ministerium der Justiz RheinlandPfalz 5 D O K U M E N T A T I O N ständen Absichten zur Erzeugung von Menschen durch jede Art von Klonierung, auch solche aus totipotenten embryonalen Zellen. Die Indikation für eine PGD ist insbesondere im Hinblick auf die sich daraus ergebenden Konsequenzen äußerst eng zu stellen und bedarf einer sorgfältigen Güterabwägung, bei der das grundsätzliche Primat des Schutzes ungeborenen Lebens, der Schweregrad, die Prognose und die Therapiemöglichkeiten der infrage stehenden Erkrankung und die gesundheitliche Gefährdung der zukünftigen Schwangeren oder Mutter berücksichtigt werden müssen. Dies beinhaltet auch, dass die Indikation für eine PGD deutlich enger zu stellen ist als für eine Pränataldiagnostik. Die PGD kann allerdings im Einzelfall die spätere Pränataldiagnostik ersetzen und damit zu einer Konfliktreduzierung beitragen, weil sie Entscheidungen über einen eventuellen Abbruch einer fortgeschrittenen Schwangerschaft vermeidet. Die Bundesärztekammer orientiert sich an einem Menschenbild, das nicht reduktionistisch auf der Summe genetischer Informationen beruht, sondern vielmehr von Respekt vor allen Menschen, einschließlich denen mit geistigen, seelischen und körperlichen Beeinträchtigungen, geprägt ist. Auch dies schlägt sich in der Forderung nach einem sehr restriktiven Einsatz der PGD nieder und begründet gleichzeitig eine deutliche Absage an jede Art eugenischer Selektion und Zielsetzung. Die derzeitige Praxis der IVF ist es, bis zu drei Eizellen zu befruchten. Bei gemäß den strengen Kriterien des Richtlinienvorschlags vorliegender Indikation für eine PGD ist es sinnvoll, alle drei Embryonen nach Abschluss des Acht-Zell-Stadiums der PGD zu unterziehen. Der Umgang mit einem aus der PGD resultierenden pathologischen Befund fordert von allen Beteiligten, dem betroffenen Paar wie den beratenden und den behandelnden Ärzten, eine große Fähigkeit und Bereitschaft zu hinreichend konfliktarmen Lösungen. Für diese gibt es keine allgemein gültigen Regeln, sondern nur verantwortungsbewusste Einzelfallentscheidungen, die auf der Basis 6 umfassender Aufklärung und Beratung getroffen werden müssen. Die Entscheidung über den Transfer eines jeden einzelnen Embryos in die Gebärmutter beruht in Würdigung des Lebensrechts des Kindes auf den einzelfallbezogenen Abwägungen der befürchteten gesundheitlichen Gefährdung der Frau und der zu erwartenden Erkrankung des Kindes. Hierbei geht es ausschließlich um das Risiko einer schweren genetischen Erkrankung, nicht um eine eugenisch orientierte Nachkommensplanung. Eine Hilfe für die an einer PGD beteiligten Ärzte, aber auch gleichzeitig ein Schutz vor Missbrauch der PGD sind die unabdingbare Forderung nach frühzeitiger Einschaltung einer bei der Landesärztekammer gebildeten Kommission sowie die Institutionalisierung einer ebenfalls im Einzelfall einzuschaltenden zentralen „Kommission Präimplantationsdiagnostik“ bei der Bundesärztekammer. Dies soll sicherstellen, dass in Deutschland eine PGD nach einheitlichen Grundsätzen erfolgt und Fehlentwicklungen rechtzeitig erkannt und abgestellt werden können. Mit Vorlage dieses Diskussionsentwurfes zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik strebt die Bundesärztekammer einen Diskurs mit den gesellschaftlichen Gruppen an und erhofft sich dabei einen offenen und sachlichen, gleichwohl kritischen Dialog. Sie hält eine Regelung für angemessen, die einerseits die Möglichkeiten der modernen Diagnostik nicht unsachgemäß einengt, zum anderen aber auch das Schutzbedürfnis des menschlichen Lebens und die Achtung der Menschen ernst nimmt, die an der Furcht vor einem genetisch bedingt schwerstkranken Kind gesundheitlich zu zerbrechen drohen. Der Entwurf soll einen Beitrag zu dieser notwendigen Diskussion leisten und dazu dienen, eine sachgerechte Regelung herbeizuführen. Prof. Dr. med. Jörg-Dietrich Hoppe, Präsident der Bundesärztekammer und des Deutschen Ärztetages Prof. Dr. med. Karl-Friedrich Sewing, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer 1. Definition Unter Präimplantationsdiagnostik (englisch: preimplantation genetic diagnosis = PGD) versteht man die Diagnostik an einem Embryo in vitro vor dem intrauterinen Transfer hinsichtlich der Veränderung des Erbmaterials, die zu einer schweren Erkrankung führt. 2. Indikationsgrundlage Die Indikation zur Präimplantationsdiagnostik kann nur bei solchen Paaren gestellt werden, für deren Nachkommen ein hohes Risiko für eine bekannte und schwerwiegende, genetisch bedingte Erkrankung besteht. Bei einer PGD darf nur auf diejenige Veränderung des Erbmaterials untersucht werden, die zu der infrage stehenden schweren genetischen Erkrankung führt, für die das Paar ein hohes genetisches Risiko hat. Von daher ist bei beiden Partnern eine kompetente molekulargenetische und/oder zytogenetische Untersuchung hinsichtlich des bei der Präimplantationsdiagnostik zu ermittelnden Erkrankungsrisikos unabdingbare Voraussetzung. Der Anwendungsbereich der PGD liegt nach derzeitigem Kenntnisstand bei monogen bedingten Erkrankungen und bei Chromosomenstörungen. Von entscheidender Bedeutung sind dabei der Schweregrad, die Therapiemöglichkeiten und die Prognose der infrage stehenden Krankheit. Ausschlaggebend ist, dass diese Erkrankung zu einer schwerwiegenden gesundheitlichen Beeinträchtigung der zukünftigen Schwangeren beziehungsweise der Mutter führen könnte. Eugenische Ziele dürfen mit der Präimplantationsdiagnostik nicht verfolgt werden. Keine Indikation für eine Präimplantationsdiagnostik sind insbesondere die Geschlechtsbestimmung ohne Krankheitsbezug, das Alter der Eltern sowie eine Sterilitätstherapie durch assistierte Reproduktion. Auch spät manifestierende Erkrankungen gelten in der Regel nicht als Indikation. Die Präimplantationsdiagnostik erfordert eine assistierte Reproduktion. Sie ist damit eine zusätzliche Indikation D O K U M E N T A T I O N für die assistierte Reproduktion (Vergleiche: Richtlinien zur Durchführung der assistierten Reproduktion, Dt Ärztebl 1998; 95: A-3166–3171 [Heft 49]). > eine Aussage zur ethischen und rechtlichen Vertretbarkeit. 3. Zulassungsbedingungen für die Präimplantationsdiagnostik Die Präimplantationsdiagnostik kann im Einzelfall erst dann durchgeführt werden, nachdem zuvor ein zustimmendes Votum der bei der jeweiligen Landesärztekammer gebildeten Kommission eingeholt wurde. Von dieser Kommission sollen Vertreter der fallbezogenen Fachrichtungen hinzugezogen werden. Darüber hinaus soll sie vor Abgabe ihres Votums eine Stellungnahme der „Kommission Präimplantationsdiagnostik“ der Bundesärztekammer einholen und sich mit dieser in der Beurteilung des Antrages ausdrücklich auseinander setzen. Die bei der Landesärztekammer gebildete Kommission teilt das Ergebnis der „Kommission Präimplantationsdiagnostik“ der Bundesärztekammer mit. 3.1. Berufsrechtliche Voraussetzungen Bei der Präimplantationsdiagnostik handelt es sich um ein spezielles medizinisches Verfahren, bei dem die Empfehlungen von § 13 Abs. 1 der (Muster-)Berufsordnung eingehalten werden müssen². Soweit in diesen Richtlinien nichts Abweichendes bestimmt ist, gelten die Richtlinien zur Durchführung der assistierten Reproduktion. Die beabsichtigte Durchführung der Präimplantationsdiagnostik ist der Ärztekammer mit dem Nachweis anzuzeigen, dass die in diesen Richtlinien festgelegten berufsrechtlichen Anforderungen erfüllt sind. Änderungen der berufsrechtlichen Voraussetzungen sind der Ärztekammer unverzüglich anzuzeigen. Kein Arzt kann gegen sein Gewissen verpflichtet werden, an einer Präimplantationsdiagnostik mitzuwirken. 3.1.1. Antragsverfahren Der verantwortliche Leiter des Präimplantationsdiagnostik-Vorhabens legt der bei der jeweiligen Landesärztekammer gebildeten Kommission den Antrag mit einem zusätzlichen Exemplar zur Weiterleitung an die „Kommission Präimplantationsdiagnostik“ der Bundesärztekammer vor. Der Antrag muss enthalten: > eine ausführliche, anonymisierte Fallbeschreibung, > die zugrunde liegende medizinische Indikation nach Beratung, > Erörterung der befürchteten schwerwiegenden gesundheitlichen Beeinträchtigung der Frau, > Darlegung der geplanten Vorgehensweise, ² § 13 Abs. 1 MBO (1997): „Bei speziellen medizinischen Maßnahmen oder Verfahren, die ethische Probleme aufwerfen und zu denen die Ärztekammer Empfehlungen zur Indikationsstellung und zur Ausführung festgelegt hat, hat der Arzt die Empfehlungen zu beachten.“ 3.1.2. Bei der Landesärztekammer gebildete Kommission 3.1.3. „Kommission Präimplantationsdiagnostik“ der Bundesärztekammer Die „Kommission Präimplantationsdiagnostik“ wird als beratender Ausschuss der Bundesärztekammer eingerichtet. Die „Kommission Präimplantationsdiagnostik“ soll: > das Votum gegenüber der bei der Landesärztekammer gebildeten Kommission abgeben, > auf eine Vereinheitlichung der Begutachtungspraxis hinwirken, > die nationale und internationale Entwicklung beobachten und bewerten, > jährlich auf der Grundlage ihrer Dokumentation einen Bericht erstellen und veröffenlichen. In der „Kommission Präimplantationsdiagnostik“ sollen die Disziplinen Humangenetik, Gynäkologie, Andrologie, Pädiatrie, Ethik und Recht vertreten sein. Psychosoziale Aspekte sollen berücksichtigt werden. 3.2. Fachliche, personelle und technische Voraussetzungen Die Durchführung einer Präimplantationsdiagnostik muss Einrichtungen vorbehalten sein, in denen routinemäßig Invitro-Fertilisation gemäß den Richtlinien zur Durchführung der assistierten Reproduktion durchgeführt wird. Die Entnahme einer Blastomere setzt entsprechende Erfahrung des Durchführenden, zum Beispiel durch ICSI, voraus, die gewährleistet, dass einerseits eine diagnostisch verwertbare Blastomere gewonnen wird, andererseits der Embryo durch den Eingriff nicht geschädigt wird. Hierfür sind umfangreiche tierexperimentelle Erfahrungen Voraussetzung. Insbesondere müssen die verantwortlichen Mitarbeiter über folgende Kenntnisse und Erfahrungen verfügen: Alle Bereiche gemäß den Richtlinien zur Durchführung der assistierten Reproduktion müssen abgedeckt sein sowie zusätzlich: > Humangenetik, > Molekulargenetik beziehungsweise Zytogenetik an Einzelzellen. Der Reproduktionsbiologe der Arbeitsgruppe muss über spezielle Kenntnisse verfügen im Bereich der > Einzelzellentnahme aus mehrzelligen Embryonen, > Verarbeitung von einzelnen Blastomeren zum Zweck der genetischen Diagnostik. Die Molekulargenetiker beziehungsweise Zytogenetiker, welche die genetische Diagnostik durchführen, müssen über entsprechende Erfahrungen in der speziellen zur Diagnostik anstehenden molekularen beziehungsweise zytogenetischen Aberration in der Pränatalmedizin und an Einzelzellen verfügen. 3.2.1. Qualifikation des Arbeitsgruppenleiters Die Leitung der Arbeitsgruppe „Präimplantationsdiagnostik“ obliegt einem Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, der spezialisiert ist in gynäkologischer Endokrinologie und Fortpflanzungsmedizin gemäß Weiterbildungsrecht der Landesärztekammern. Der in der Arbeitsgruppe tätige Facharzt für Humangenetik ist für die Durchführung der molekular- und zytogenetischen Untersuchungen verantwortlich. Die Zusatzbezeichnung Medizinische Genetik ist dieser Spezialisierung nicht gleichwertig. Dem Leiter der Arbeitsgruppe obliegt die verantwortliche Überwachung 7 D O K U M E N T A T I O N der in diesen Richtlinien festgeschriebenen Maßnahmen. 3.2.2. Sachliche Voraussetzungen Neben den sachlichen Voraussetzungen gemäß den Richtlinien zur Durchführung der assistierten Reproduktion muss zusätzlich ein molekulargenetisches und zytogenetisches Labor als ständige Einrichtung verfügbar sein. 4. Durchführungsbedingungen 4.1. Aufklärung, Beratung und Einwilligung Voraussetzung für die Durchführung von PGD ist eine ausführliche Aufklärung und Beratung des Paares über das Verfahren, seine Vor- und Nachteile sowie mögliche Folgen der Methode. Dem Paar muss eine psychosoziale Beratung angeboten werden. Die Beratung und Aufklärung durch den Humangenetiker und den Gynäkologen muss sich auf mögliche Alternativen erstrecken, wie zum Beispiel > Adoption oder Verzicht auf eigene Kinder, > im Falle einer Schwangerschaft die Möglichkeit zur pränatalen Diagnostik der infrage kommenden genetisch bedingten Erkrankung. Gegenstand der Beratung und Aufklärung durch Gynäkologen und Humangenetiker müssen darüber hinaus sein: > die bei der assistierten Reproduktion notwendigen Maßnahmen, > der Hinweis auf den zeitlichen Aufwand des Verfahrens, > der Hinweis auf die Risiken der Methode (Operations- und Narkoserisiko, Überstimulationssyndrom, Mehrlingsschwangerschaften), > die Erörterung der Erfolgschancen hinsichtlich einer Schwangerschaft und der Geburt eines nicht von der infrage stehenden genetisch bedingten Erkrankung betroffenen Kindes, > der Umgang mit gegebenenfalls nicht transferierten Embryonen. Es ist die schriftliche Einwilligung beider Partner für die Durchführung der PGD sowie deren grundsätzliche Einwilligung für den anschließenden 8 Transfer erforderlich. Zur Absicherung des Ergebnisses der PGD sollte mit dem Paar auch die spätere Möglichkeit der pränatalen Diagnostik erörtert werden. Nach PGD ist in einem erneuten Aufklärungs- und Beratungsgespräch mit dem Paar zu klären, ob und gegebenenfalls welche der Embryonen transferiert werden sollen; für den Transfer ist die Einwilligung der Frau erforderlich. 4.2. Gewinnung von Blastomeren und Transfer von Embryonen Totipotente Zellen, die im Sinne von § 8 des Embryonenschutzgesetzes als Embryo gelten, dürfen für die Diagnostik nicht verwendet werden. Die Entnahme von Blastomeren darf nur nach dem Acht-Zell-Stadium durchgeführt werden, da sie nach dem derzeitigen Kenntnisstand dann nicht mehr totipotent sind. Bei einer Entnahme im Rahmen einer Präimplantationsdiagnostik muss gewährleistet sein, dass die weitere Entwicklung des Embryos nicht beeinträchtigt wird. 4.3. Nicht transferierte Embryonen Embryonen, die nicht transferiert werden sollen, dürfen nicht kultiviert, kryokonserviert oder anderweitig verwendet werden. 4.4. Verfahrens- und Qualitätskontrolle Jede Maßnahme der Präimplantationsdiagnostik ist dem Deutschen IVF-Register (DIR) zu melden. Es müssen die Anzahl untersuchter Embryonen, die Gesamtzahl der Blastomeren, die Anzahl der entnommenen Blastomeren sowie die jeweilige Diagnose des individuellen Embryos mitgeteilt werden. Jeder Transfer und dessen Ergebnis ist mitzuteilen. Der Schwangerschaftsverlauf ist detailliert zu dokumentieren. Die geborenen Kinder sind einem Pädiater vorzustellen. Im Falle einer Fehlgeburt sind die zur Klärung erforderlichen Untersuchungen durchzuführen. Das Deutsche IVF-Register informiert regelmäßig die „Kommission Präimplantationsdiagnostik“ der Bundesärztekammer. Literatur ESHRE PGD Consortium Steering Committee; ESHRE Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD) Consortium: preliminary assessment of data from January 1997 to September 1998. Hum Reprod, 1999; 14: 3138–3148. Handyside AH, Scriven PN, Ogilvie CM: The future of preimplantation genetic diagnosis. Hum Reprod, 1998; 13 (Suppl 4): 249–255. Kress H: Personwürde am Lebensbeginn: Gegenwärtige Problemstellungen im Umgang mit Embryonen. Zeitschr Evangel Ethik, 1999; 43: 36–53. Liebaers I, Sermon K, Staessen C, Joris H, Lissens W, Van Assche E, Nagy P, Bonduelle M, Vandervorst M, Devroey P,Van Steirteghem A: Clinical experience with preimplantation genetic diagnosis and intracytoplasmic sperm injection. Hum Reprod, 1998; 13 (Suppl 1): 186–195. Lissens W, Sermon K: Preimplantation genetic diagnosis: current status and new developments. Hum Reprod, 1997; 12: 1756–1761. Ludwig M, Al-Hasani S, Diedrich K: Präimplantationsdiagnostik: preimplantation genetic diagnosis (PGD). In:Weibliche Sterilität: Ursachen, Diagnostik und Therapie. (Ed.: K. Diedrich) Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1998; Vol. 1: 692–722. Weiterführende Literatur siehe unter Bioethik-Kommission des Landes RheinlandPfalz (Hrsg.: Caesar P): Präimplantationsdiagnostik – Thesen zu den medizinischen, rechtlichen und ethischen Problemstellungen. Bericht vom 20. 6. 1999. Hepp H: Präimplantationsdiagnostik – in Deutschland nicht erlaubt – aber notwendig? 2000, im Druck. Mitglieder der Arbeitsgruppe Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. H. M. Beier, Direktor des Instituts für Anatomie und Reproduktionsbiologie der Medizinischen Fakultät der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule, Aachen Prof. Dr. med. K. Diedrich, Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Medizinische Universität zu Lübeck Prof. Dr. med. W. Engel, Direktor des Instituts für Humangenetik der Universität Göttingen Prof. Dr. med. H. Hepp, Direktor der Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Klinikum Großhadern, München (federführend) Prof. Dr. theol. M. Honecker,Abteilung für Sozialethik und systematische Theologie, Evangelisch-theologisches Seminar, Bonn Prof. Dr. med. E. Nieschlag, Direktor des Instituts für Reproduktionsmedizin, Zentrum für Frauenheilkunde, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster Prof. Dr. jur. Dr. h. c. mult. H.-L. Schreiber, Direktor des Juristischen Seminars der Universität Göttingen Prof. Dr. med. K.-F. Sewing, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer, Hannover RA U. Wollersheim, Rechtsabteilung der Bundesärztekammer, Köln Dr. med. C. Woopen, Institut für Geschichte und Ethik der Medizin, Universität zu Köln, Institut für Wissenschaft und Ethik, Bonn Prof. Dr. med. H.-B. Wuermeling, em. Direktor des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Erlangen-Nürnberg Geschäftsführung: B. Heerklotz, Dezernat Wissenschaft und Forschung, Bundesärztekammer, Köln (bis 30. Juni 1999) Priv.-Doz. Dr. med. S. Winter, Dezernat Wissenschaft und Forschung, Bundesärztekammer, Köln D O K U M E N T A T I O N Heft 9, 3. März 2000 Präimplantationsdiagnostik Embryonen, etwa mit der Argumentation: Weshalb Embryonen, die sich als „defekt“ erwiesen haben, vernichten, können sie doch für weitergehende Forschung noch gute Dienste leisten. Mit PGD wird schließlich die schiefe Bahn zur Eugenik beschritten, wird zudem ein Tabu gebrochen, das nach den NS-Untaten errichtet wurde. Der Wisanz restriktiv soll die Präimplan- PGD-Befürworter interpretieren die senschaftliche Beirat und die Bundestationsdiagnostik (PGD = preim- zwar zu ihren Gunsten, es gibt aber ge- ärztekammer erklären zwar ausdrückplantation genetic diagnosis) ein- wichtigere Argumente, wonach PGD in lich, sie hätten Eugenik nicht im Sinn; gesetzt werden; nur wenigen Paaren Deutschland verboten ist. Nicht umsonst doch wenn Embryonen nach genetimit hohem genetischem Risikofaktor suchen die mit der Methode befassten schen „Defekten“ untersucht und gegesoll sie zugute kommen, ein komplizier- Kreise ja nunmehr mittels öffentlicher benenfalls ausgesondert werden, dann tes Genehmigungsverfahren ist allem Diskussion und einer Richtlinie der ist der Weg eingeschlagen. Und er wird vorangestellt. So sieht es der Richt- Bundesärztekammer zu Rechtssicherheit immer breiter. Man wird erwarten dürlinienentwurf des Wissenschaftlichen zu kommen. Die wird es letzten Endes nur fen, dass der Katalog von Krankheiten, Beirats der Bundesärztekammer vor, mit Hilfe des Gesetzgebers geben; der zö- die mit PGD diagnostiziert werden könder vom BÄK-Vorstand nach längerem gert – aus gutem Grund. nen, immer weiter ausgedehnt wird, alDie Absichten der wohlwollenden lein schon weil die wissenschaftlichen Ringen als „Diskussionsentwurf“ für die öffentliche Diskussion freigegeben Ärzte, die ihren Patientinnen und Pa- Erkenntnisse wachsen. Aber auch, weil tienten zu einem von Krankheit mög- die Vorstellungen darüber, was „defekt“ wurde. Bereits im Vorfeld kam es freilich zu lichst nicht belasteten Kind verhel- oder was „gesund“ ist, weit auseinander gehörigen Missverständnissen. In der fen wollen, sind glaubhaft. Doch wenn gehen. Der Wissenschaftliche Beirat hat Presse war davon zu lesen, die Ärzte- mit PGD die Grenze zur Selektion un- sich nicht getraut, und zwar aus guten schaft gestatte nunmehr die PGD.Zu hof- geborenen Lebens überschritten wird – Gründen, einen Indikationskatalog auffen ist,dass ein Presseseminar der Bundes- und das wird sie, man mag noch so ver- zustellen. Das heißt aber auch, dass man ärztekammer, das wenige Tage nach Be- hüllende Bezeichnungen wählen –, im Einzelfall demnächst unterschiedlich kanntwerden des Diskussionsentwurfes dann wird die Entwicklung von den entscheiden wird, ob beispielsweise in Berlin stattfand (dazu der Leitartikel), wohlwollenden, wohlmeinenden Wis- beim Down-Syndrom der Embryo verdie Positionen wieder etwas zurecht- senschaftlern und Ärzten nicht mehr zu worfen werden kann oder nicht. Und gerückt hat. Die Bundesärztekammer steuern sein. Mit PGD kommt, man mag wer will eigentlich verhindern, dass neund auch ihr Wissenschaftlicher Beirat das bedauern oder insgeheim befürwor- benbei auch nach dem Geschlecht gesind nämlich keineswegs entschieden in ten, die verbrauchende Forschung an sucht und entschieden wird? Sachen PGD. Bei dem einen Die Diskussion um PGD oder anderen Wissenschaftler trifft in eine seit Jahren von phiTabelle mag die Entscheidung viellosophischer Seite angestoßene Präimplantationsdiagnostik im europäischen Vergleich leicht gefallen sein, nicht aber Debatte über Selektion von Lebei den Verantwortlichen für ben, erinnert sei etwa an Singer PGD PGD Gesetz Gesetzeszulässig unzulässig vorhaben den Richtlinienentwurf. Die oder jüngst Birnbacher. Mit der Großbritannien ja ja freilich haben durch die Form Diskussion um PGD werden Dänemark ja ja einer fix und fertig formulierauch die Forderungen nach ten Richtlinie, die alsdann verbrauchender EmbryonenNorwegen ja ja zum Diskussionsentwurf erforschung wieder belebt werSchweden ja ja klärt wurde, einiges dazu beiden, die seinerzeit zu den strenItalien ja ja getragen, dass ein falscher gen Regelungen des EmbryoSpanien ja ja Eindruck entstehen konnte. nenschutzgesetzes führten. In Portugal ja ja Der wird jetzt hoffentlich korder Diskussion um PGD in Frankreich ja ja rigiert sein. Deutschland wird mit Sicherheit Belgien ja PGD ist im Ausland, sodas Argument hochkommen, im fern hier die aufwendigen Ausland sei das aber alles erNiederlande ja technischen Vorrichtungen laubt. Folgt man diesem ArguGriechenland ja gegeben sind, durchaus im ment, dann wird man auf die Österreich ja ja Einsatz (siehe Tabelle). In Dauer mit dem ethischen MiSchweiz ja ja Deutschland nicht, jedennimum nicht nur bei der AusDeutschland fraglich ja falls ist nichts bekannt. Die wahl ungeborenen Lebens leben Quelle:Vortrag Priv.-Doz. Dr. med. Stefan Winter modifiziert nach Simon 1999* Norbert Jachertz Rechtslage spricht dagegen. müssen. Am Rande der schiefen Bahn G ´ C ´ 9 D O K U M E N T A T I O N Heft 9, 3. März 2000 Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie der Bundesärztekammer Präimplantationsdiagnostik: Auftakt des öffentlichen Diskurses Die Bundesärztekammer hat eine vorläufige Stellungnahme zur Präimplantationsdiagnostik vorgelegt. Kritiker werfen ihr vor, der Richtlinienentwurf verstoße gegen das Embryonenschutzgesetz. Viele befürchten zudem, dass das Verfahren, gedacht für einige wenige, rasch zur Erzeugung von „Babys nach Maß“ bei vielen führt. E s soll in Deutschland keiner mehr sagen können, die Gesellschaft habe nicht gewusst, worum es geht.“ Mit diesen Worten beendete Prof. Dr. med. Christoph Fuchs, Hauptgeschäftsführer der Bundesärztekammer (BÄK), seinen Vortrag während eines BÄK-Seminars zum Thema „Präimplantationsdiagnostik“ in der vergangenen Woche in Berlin. Zuvor hatte er begründet, warum die Ärzteschaft die gesellschaftliche Diskussion sucht: „Die Abwägung fundamentaler Lebenswerte wie Gesundheit, Menschenwürde, Daseinsrecht und Forschungsfreiheit kann nicht allein durch den Rat von Einzelexperten gelöst werden.“ Betroffen: Paare mit hohem genetischen Risiko Worum geht es? Die Bundesärztekammer hat vor wenigen Tagen ihren „Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik“ (PGD*) vorgelegt (siehe Dokumentation in diesem Heft). Konzipiert hat ihn der Arbeitskreis „Präimplantationsdiagnostik“ des Wissenschaftlichen Beirates der Kammer.An der Entscheidungsfindung waren Ärzte, Juristen, speziell mit Ethik befasste Wissenschaftler und Theologen beteiligt. Der katholische Theologe wolle „aus kirchenpolitischen Gründen“ nicht namentlich genannt werden, hieß es. Im Kern geht es bei dem RichtlinienEntwurf um den Verfahrensablauf und die Voraussetzungen, unter denen Ärztinnen und Ärzte Paaren mit hohen ge- 10 netischen Risikofaktoren zu einem gesunden Kind verhelfen dürfen. Im Ausland, wo die PGD teilweise zulässig ist, wird folgender Weg gewählt: Ein Paar, das die schwere genetische Schädigung eines Kindes aufgrund eigener hoher Risikofaktoren befürchtet, unterzieht sich einer künstlichen Befruchtung, obwohl keine Unfruchtbarkeit vorliegt. An dem im Reagenzglas gezeugten Embryo wird nach drei Tagen in einem Kulturmedium die Biopsie von einem oder zwei Blastomeren vorgenommen. Sie werden molekulargenetisch untersucht. Die Blastomere gilt nach dem Acht-Zell-Stadium nicht mehr als totipotente Zelle – ein vermeintliches Detail, das freilich für die Entscheidung bedeutsam ist, ob sich diese Diagnostik mit dem Embryonenschutzgesetz vereinbaren lässt. Die ethische Diskussion umfasst im Kern den sich anschließenden Konflikt. Ist eine schwere genetische Schädigung nachzuweisen, wird der Embryo vermutlich nicht in die Gebärmutter eingesetzt. Schließlich will man durch das gewählte diagnostische Verfahren die Geburt eines schwerstgeschädigten Kindes gerade verhindern. Doch es gibt weitere Fragen: Ist es ethisch zu rechtfertigen, auf die sehr frühe PGD zu verzichten, um dann viel später einen Fetus abzutreiben, weil mit Hilfe der Pränataldiagnostik schwerste Behinderungen nachgewiesen wurden? Ist es konsequent, frühestes Leben im Reagenzglas durch das Embryonenschutzgesetz kategorisch zu schützen und die PGD zu verbieten, diesen * PGD steht für „preimplantation genetic diagnosis“. Als Abkürzung wird auch PID verwendet. Schutz aber im Rahmen des § 218 StGB zu lockern? Scheint es realistisch, dass man ein Verfahren auf wenige Paare begrenzen kann, oder werden immer mehr Eltern, Unternehmen, Staaten auf den Geschmack der frühen Auswahl kommen und sich über die Bedenken hinwegsetzen, die gegen Selektion und Eugenik bestehen? PGD ja, aber in engen Grenzen Die Autoren der Richtlinie schlagen vor, die PGD in Deutschland zu erlauben, allerdings nur in sehr engen Grenzen. Jede Art eugenischer Selektion und Zielsetzung müsse vermieden werden. Der Anwendungsbereich liege derzeit bei monogen bedingten Erkrankungen und bei Chromosomenstörungen. Die Entscheidung soll stets im Einzelfall getroffen werden. Eine Liste von infrage kommenden Krankheiten, bei denen die PGD angewendet werden darf, enthält der Entwurf nicht. Um Ärztinnen und Ärzte bei ihrer Entscheidung zu unterstützen, aber auch, um Missbrauch zu verhindern, sollen zwei Kommissionen in die Abwägung einbezogen werden, eine auf Ebene der jeweiligen Landesärztekammer, eine bei der Bundesärztekammer. Reicht das aus? Im Bundesministerium für Gesundheit ist man skeptisch. Zwar wird der Richtlinien-Vorschlag als wertvoller Beitrag zur Diskussion gewertet. Doch am Anfang hätte besser eine Regelung durch den Gesetzgeber gestanden als eine Richtlinie der Ärzte- D O K U M E N T A T I O N schaft, heißt es. Was schwerer wiegt, ist Präimplantationsdiagnostik und Direk- Weg zu einer gewünschten Schwangerdie Einschätzung, dass die Bundesärz- tor der Klinik und Poliklinik für Frau- schaft. tekammer mit ihrem Vorschlag gegen enheilkunde und Geburtshilfe des In der ausführlichen Diskussion das Embryonenschutzgesetz verstößt Münchner Klinikums Großhadern. während des Presseseminars der BÄK (siehe Kasten). Im Ministerium bewer- Hepp sprach das Thema „Selektion“ di- in Berlin ließ Hepp jedoch erkennen, ten es Fachleute schon als kritisch, dass rekt an, als er die Unterschiede zwi- dass er die vielfältigen Gefahren der ein Verfahren wie die künstliche Be- schen einer In-vitro-Fertilisation mit PGD sieht. Durch ihre Erlaubnis könne fruchtung, die für sterile Paare gedacht Embryonentransfer und einer PGD er- man in die Eugenik hineinschlittern. ist, ausgeweitet wird. Der eigentliche läuterte. Erstere sei ein Therapieverfah- Deswegen habe sich der WissenschaftliVerstoß gegen das Embryonenschutz- ren, um einem ungewollt kinderlosen che Beirat beispielsweise dagegen entgesetz wird aber darin gesehen, dass ein Paar zu einer Empfängnis und einer schieden, eine Liste von Krankheiten Embryo nicht gezeugt werde, um eine Schwangerschaft zu verhelfen. Anders aufzustellen, bei deren Verdacht risikoSchwangerschaft herbeizuführen, son- die PGD: Sie „hat zum Ziel, ein mit ho- behafteten Paaren der Einsatz der PGD dern in Wirklichkeit erst einmal für dia- hen Risikofaktoren belastetes Paar ermöglicht werden soll. Durch den Vergnostische Zwecke – was verboten ist. nach einer ,Zeugung auf Probe‘ und der zicht entstünden aber ebenfalls ProbleIm Ministerium akzepme – so könnte die Methode tiert man auch nicht den Einin der Praxis auf immer wand von manchen PGDmehr Erkrankungen ausgeBefürwortern, es handele weitet werden. sich doch lediglich um eine Wie man verhindern wol§ 1 Abs. 1 Nr. 2: „Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder vorgezogene Pränataldiale, dass alle Paare, die eine mit Geldstrafe wird bestraft, wer es unternimmt, eine Eizelgnostik (PND). Hier wird arkünstliche Befruchtung vorle zu einem anderen Zweck künstlich zu befruchten, als eigumentiert, im Fall der PND nehmen ließen, nach der ne Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die liege eine Schwangerschaft PGD verlangten, wurde geEizelle stammt . . .“ § 2 Abs. 1: „Wer einen extrakorporal erzeugten oder einer bereits vor. Dabei handele es fragt. Wenn es nicht möglich Frau vor Abschluss seiner Einnistung in der Gebärmutter sich um eine Situation, in der sei, die Anwendung sehr eng entnommenen menschlichen Embryo veräußert oder zu sich der Embryo sowohl unzu begrenzen, dann sei er einem nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck abgibt, ter dem Schutz des Rechts eher für ein Verbot dieses erwirbt oder verwendet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu wie dem Schutz der Frau beVerfahrens, stellte Hepp klar. drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ finde. Dem stehe auch § 218 Er gab jedoch zu bedenken, StGB nicht entgegen, denn dass es schon heute Ansätze eine Abtreibung sei rechtszu Selektion gebe: Paare nutwidrig und nur unter bestimmten Be- Diagnostik . . . im Falle eines pathologi- zen offenbar die Möglichkeiten der Prädingungen straffrei. Ein Embryo in schen Befundes durch Selektion, das nataldiagnostik zu „Schwangerschaften vitro stehe dagegen nur unter dem heißt durch Sterbenlassen des in Warte- auf Probe“. Nach Einschätzung Hepps Schutz des Rechts. position stehenden Embryos, vor einem ist dies rechtlich möglich, wenn auch Prof. Dr. med. Karl-Friedrich Se- kranken Kind zu bewahren“. Dieses ethisch bedenklich. In der Gesellschaft wing, der Vorsitzende des Wissen- Verfahren wird inzwischen weltweit in sei das Bewusstsein über solche Mögschaftlichen Beirats der Bundesärzte- 29 Zentren erprobt, zehn davon liegen lichkeiten gewachsen, bis hin zum Ankammer, hat solchen Einwänden und in den USA. Bisher nutzten rund 400 spruch auf ein unbehindertes Kind. Und dem Vorwurf von Selektion und Eu- Paare diese diagnostische Möglichkeit; die Rolle der Ärzte? „Es gibt kein genik widersprochen. Das Ziel der die Zahl der nach PGD geborenen Kin- schuldfreies Arztsein, weder bei der In-vitro-Fertilisation mit Präimplanta- der liege bei 100. Präimplantationsdiagnostik noch bei der Sabine Rieser tionsdiagnostik sei zweifellos die Wie Sewing urteilte aber auch Hepp, Pränataldiagnostik.“ Schwangerschaft, erklärte er in Berlin. dass der Richtlinien-Entwurf der BÄK Er verwies zudem auf § 218 StGB, der zur Präimplantationsdiagnostik mit festlegt, dass „Handlungen, deren Wir- dem Embryonenschutzgesetz vereinbar kung vor Abschluss der Einnistung des ist. Denn er gibt vor, dass die Diagnobefruchteten Eis in der Gebärmutter stik nur an einer nicht mehr totipoteneintritt, nicht als Schwangerschaftsab- ten Blastomere vorgenommen wird. bruch im Sinne dieses Gesetzes“ gelten. Auch sei das Ziel eine Schwangerschaft Es sei schwierig zu verstehen, warum der Frau. Hepp schloss sich hier der dann die Unterlassung eines Transfers Sicht jener Juristen an, die argumentieeines in vitro gezeugten Embryos straf- ren, dass die „Verwerfung“ eines Embar sein sollte. bryos nicht Ziel der künstlichen BeAuf die zahlreichen Konflikte ging fruchtung beziehungsweise der PGD Prof. Dr. med. Hermann Hepp ein. Er sei. Sie sei eher eine unerwünschte Neist Federführender des Arbeitskreises benfolge oder ein Fehlschlag auf dem Gesetz zum Schutz von Embryonen 11 D O K U M E N T A T I O N Heft 10, 10. März 2000 Präimplantationsdiagnostik Plädoyer für eine unvoreingenommene, offene Debatte Die Bundesärztekammer hat, erarbeitet durch ihren Wissenschaftlichen Beirat, einen „Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik“ vorgelegt; er wurde in Heft 9/2000 veröffentlicht. Die Verfasserin nimmt zu den damit angesprochenen ethischen Fragen der medizinischen Forschung und ihrer möglichen Anwendung aus Sicht des Bundesgesundheitsministeriums Stellung. D ie Präimplantationsdiagnostik (preimplantation genetic diagnosis = PGD) steht im Widerspruch zum Embryonenschutzgesetz, wonach eine Eizelle nur zum Zweck der Herbeiführung einer Schwangerschaft bei der Frau, von der die Eizelle stammt, künstlich befruchtet werden darf; ein Embryo darf auch nur zu diesem Zweck extrakorporal weiterentwickelt werden; ein extrakorporal erzeugter Embryo darf zu keinem anderen Zweck als zu seiner Erhaltung verwendet werden, siehe § 1 Abs. 1 Nr. 2, § 2 Abs. 1 und 2 ESchG. Ziel der Regelung der künstlichen Befruchtung im Embryonenschutzgesetz ist die Behandlung von Fertilitätsstörungen, also die Erfüllung des Kinderwunsches einer Frau oder eines Paares. Grundrechtschutz kommt bereits dem Embryo zu Bei der PGD wird die Eizelle aber zunächst nur zu diagnostischen Zwecken künstlich befruchtet. Stellt sich dabei heraus, dass der Embryo mit der vermuteten genetischen Erkrankung belastet ist, wird er verworfen. Die künstliche Befruchtung verlässt hier also den Rahmen des Embryonenschutzgesetzes. Die Indikation für eine fortpflanzungsmedizinische Maßnahme wird ausgeweitet. Embryonen werden künstlich erzeugt, ohne dass Fertilitätsstörungen bei der Frau oder dem Paar vorliegen, um bereits vor Beginn der Schwangerschaft eine genetische Untersuchung der extrakorporal vorlie- 12 genden Embryonen zu ermöglichen und eine Auswahl im Hinblick auf eine genetische Erkrankung des zukünftigen Kindes treffen zu können. Teilweise wird die PGD bereits jetzt als – in engen Grenzen – nicht durch das Embryonenschutzgesetz verboten angesehen, weil auch bei der PGD der Gesamtvorgang letztlich die Erfüllung des Wunsches nach einem – gesunden – Kind zum Ziel habe und dies nur unter der Voraussetzung geschehe, dass dabei keine totipotenten Zellen, also solche, aus denen noch ein ganzer Mensch entstehen kann, betroffen werden. Aber auch bei dieser Haltung ist zu berücksichtigen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes der Gesetzgeber verpflichtet ist, in grundlegenden gesellschaftlichen Fragen, zumal im Bereich der Grundrechtsberührung, alle wesentlichen Entscheidungen selbst – durch Gesetz – zu treffen. Menschenwürde und Grundrechtsschutz kommen bereits dem ungeborenen menschlichen Leben von Anbeginn seiner Existenz an zu, und damit auch dem Embryo. Die Präimplantationsdiagnostik bedarf wegen ihrer grundlegenden ethischen Bedeutung und schwerwiegenden gesellschaftlichen Folgen vor ihrer Einführung eines Grundkonsenses in der Gesellschaft und damit einer Regelung durch den Gesetzgeber. Auch wenn die BÄK ihren Entwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik als Diskussionsentwurf vorlegt, halte ich es unter der vorstehend beschriebenen Ausgangslage für nicht unproblematisch, dass der Dis- kussionsentwurf zum jetzigen Zeitpunkt vorgelegt wird, zumal es im Vorwort zum Entwurf heißt, dass mit dem Entwurf versucht werden soll, unter anderem den gesetzlichen Regelungen auf dem Gebiet der PGD gerecht zu werden. Damit entsteht der Eindruck einer einseitigen Interpretation des Embryonenschutzgesetzes und einer bereits festgelegten Position zur PGD, bevor die öffentliche Diskussion hierzu begonnen hat. Auch wird die PGD in Deutschland aus den vorerwähnten rechtlichen Gründen nicht praktiziert, sodass Eile nicht geboten ist. Auch die Bioethik-Kommission des Landes Rheinland-Pfalz, auf die der Diskussionsentwurf in seinem Vorwort Bezug nimmt, hat in ihren Thesen zu den medizinischen, rechtlichen und ethischen Problemstellungen der Präimplantationsdiagnostik wegen der grundlegenden Bedeutung der PGD ebenfalls eine rechtliche Regelung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit der PGD gefordert. International sind die Regelungen zur PGD unterschiedlich. Im nahen Ausland ist die PGD zum Teil zugelassen, wie zum Beispiel in Belgien und Großbritannien. Für die Erhaltung oder Festlegung von ethischen und rechtlichen Prinzipien kann dies jedoch nicht entscheidend sein. Denn der Staat, der für das Wohl seiner Bürgerinnen und Bürger und die Beachtung der Grundrechte verantwortlich ist, kann sich nicht mit Blick auf das Ausland seiner eigenen Verantwortung entziehen. Er muss in den grundlegenden Fragen eine eigene innerstaatlich begründete Entscheidung treffen. D O K U M E N T A T I O N Begründet wird die PGD damit, dass auf diese Weise der Frau eine spätere Abtreibung nach Pränataldiagnostik erspart werden könne. Aber so verständlich der Wunsch von Eltern ist, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen, und das Bestreben der Ärzte, Eltern dabei zu helfen – so muss man doch auch sehen, dass mit dem Verwerfen eines genetisch belasteten Embryos ein Mensch im frühen Stadium seiner Entwicklung vernichtet wird. Ein genetisch kranker Embryo wird geopfert, um einem unbelasteten Embryo zum Leben zu verhelfen. Menschen beispielsweise mit Mukoviszidose, die ein lebenswertes Leben führen, verurteilen diese Methode zu Recht. Gefahr einer „Erwartungshaltung für gesunde Kinder“ Das Recht auf Leben eines behinderten Menschen gerät in Gefahr, wenn man im Zusammenhang mit der PGD eine Auswahl zugunsten des nicht behinderten Lebens vornimmt. Es besteht die Gefahr, dass in der Gesellschaft eine Erwartungshaltung für gesunde Kinder entsteht und es Eltern schwer gemacht wird, sich für ein behindertes Kind zu entscheiden. Der oft ins Feld geführte Einwand, die PGD als vorgezogene Pränataldiagnostik zu bewerten, ist zu hinterfragen. Auch bei durchgeführter PGD bleibt wegen der hohen Fehlerquote eine Pränataldiagnostik erforderlich. Vor allem aber sind beide Situationen nicht miteinander vergleichbar. Gesetzentwurf zur Fortpflanzungsmedizin Die Schwangerschaft ist eine einzigartige Situation, die unvergleichbar mit anderen Situationen ist und die durch die körperliche Verbindung von Embryo und Frau gekennzeichnet ist. Der Fetus, Embryo in vivo, ist ohne die Frau nicht lebens- und entwicklungsfähig. Die Schwangerschaft hat für die Frau weitreichende Konsequenzen. Daher wird die – gesetzlich verbotene – Abtreibung unter bestimmten Bedingungen nicht bestraft. Hieraus können keine Rechtfertigungsgründe für andere, nicht vergleichbare Situationen abgeleitet werden. Der Embryo in vivo steht unter dem realen Schutz der Frau, der Embryo in vitro auf dem Labortisch steht nur unter dem rechtlichen Schutz und ist daher darauf besonders angewiesen. Daher ist auch eine parallele Regelung der Voraussetzungen von PGD und Schwangerschaftsabbruch hinsichtlich gesundheitlicher Beeinträchtigungen der zukünftigen Schwangeren beziehungsweise der wirklich Schwangeren, wie dies in dem Diskussionsentwurf vorgenommen wird, fragwürdig. Seit 1994 hat der Bundesgesetzgeber die Gesetzgebungskompetenz für die Fortpflanzungsmedizin. In den letzten Jahren haben das Bundesministerium für Gesundheit, andere Bundesministerien und die Länder in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe bereits Vorarbeiten für ein solches Gesetz geleistet. Diese Arbeitsgruppe endete 1998 mit dem Diskussionsergebnis, am Verbot der PGD festzuhalten. Die Konferenz der Gesundheitsminister der Länder hat im Juni 1999 die Bundesregierung aufgefordert, ein Fortpflanzungsmedizingesetz vorzulegen und darin neben anderen rechtlich nicht geklärten Fragen der Fortpflanzungsmedizin auch die Frage der PGD zu klären. Das Bundesministerium für Gesundheit als federführendes Ressort beabsichtigt, einen solchen Gesetzentwurf vorzulegen. In Anbetracht der grundlegenden ethischen Fragen und schwerwiegenden gesellschaftlichen Folgen, die mit einem solchen Gesetz berührt werden, ist es aber unerlässlich, dass vor der Entscheidung über die Regelungen eines solchen Gesetzentwurfes eine intensive und offene gesellschaftliche Diskussion über alle wichtigen Fragen stattfindet. Das Bundesministerium für Gesundheit wird daher vom 24. bis 26. Mai 2000 in Berlin ein Symposium zu den aktuellen medizinischen, ethischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Fragen der Fortpflanzungsmedizin und den damit in Zusammenhang stehenden Fragen des Embryonenschutzes, auch zur PGD, durchführen. Auf der für die Öffentlichkeit zugänglichen Veranstaltung mit Fachreferaten, Podiums- und Plenumsdiskussionen soll der derzeitige Meinungsstand der medizinischen Wissenschaft und Praxis, der Forschung, Ethik, Rechts- und Sozialwissenschaften zum Thema dargestellt und kontrovers diskutiert werden. Endgültige Position erst nach breiter Diskussion Die durch den Entwurf einer Richtlinie zur PGD ausgelöste Diskussion in der Ärzteschaft wird mit Sicherheit neben den von mir vorgebrachten Gesichtspunkten noch andere hinzufügen. Und auch von den anderen Professionen und der Öffentlichkeit müssen deren Sachverstand und Überzeugungen in die Debatte eingebracht werden. Ich halte es für wünschenswert, dass die Ärzteschaft ihre endgültige Position erst nach einer solchen breiten und offen geführten Diskussion festlegt. Ulrike Riedel Leiterin der Abteilung Gesundheitsvorsorge und Krankheitsbekämpfung Bundesministerium für Gesundheit Am Probsthof 78 a, 53108 Bonn E-Mail: [email protected] 13 D O K U M E N T A T I O N Heft 14, 7. April 2000 Präimplantationsdiagnostik Mensch von Anfang an Stellungnahme des Erzbischofs von Köln zum Diskussionsentwurf der Bundesärztekammer zur Präimplantationsdiagnostik D em im Deutschen Ärzteblatt (Heft 9/2000) veröffentlichten „Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie der Bundesärztekammer zur Präimplantationsdiagnostik“ (preimplantation genetic diagnosis; PGD) muss aus katholischer Sicht entschieden widersprochen werden. Die Kirche respektiert die Eigenständigkeit der medizinischen Wissenschaft, und sie beansprucht ausdrücklich nicht, der ärztlichen Selbstverwaltung in ihre eigenen Angelegenheiten hineinzureden. Der genannte Text betrifft aber Grundlagen unserer Werteordnung, und es darf nicht verschwiegen werden, dass er dabei eindeutig eine unaufgebbare moralische Grenze überschreitet. Obwohl dies gewiss nicht beabsichtigt ist, stellt er im Ergebnis eine Aufforderung zur Verletzung der Würde des Menschen dar, indem er ärztliche Hilfe zur Identifizierung und anschließenden Tötung angeblich lebensunwerten (wenn auch dieser Begriff im Diskussionsentwurf nicht fällt) menschlichen Lebens anbietet, sodass nur Kinder ohne befürchtete Schädigung die Chance auf ein weiteres Leben haben. Die Bezugnahme der Bundesärztekammer auf „sorgfältige Güterabwägung“, „Einzelfallentscheidung“, „umfassende Aufklärung und Beratung“, „äußerst restriktive“ Zulassungskriterien, „Würdigung des Lebensrechts des Kindes“ kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbstverständlich kein unschuldiger und hilfloser Mensch nach „sorgfältiger Güterabwägung“, „Einzelfallentscheidung“, „umfassender Aufklärung und Beratung“, bei „äußerst restriktiven“ Zulassungskriterien und unter „Würdigung seines Lebensrechts“ getötet werden darf. Der Richtlinienentwurf der Bundesärztekammer widerspricht im Übrigen der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland und dem von der gleichen Bundesärztekammer 1996 ver- 14 öffentlichten ärztlichen Gelöbnis, das den Arzt „jedem Menschenleben von der Empfängnis an (!) Ehrfurcht“ entgegenzubringen verpflichtet. Als katholischer Bischof habe ich mit großem Respekt die intensiven Bemühungen sensibler Teile der deutschen Ärzteschaft beobachten können, die traurige Geschichte der Mitwirkung von Ärzten an der „Verhütung erbkranken Nachwuchses“ aufzuarbeiten. Dabei erlebten es diese Ärzte als besonders erschütternd, dass die verhängnisvollen Ideen und praktischen Vorschläge damals von ärztlichen Kollegen ausgingen und von einer menschenverachtenden Politik erst später aufgegriffen und umgesetzt wurden. Was der jetzige Richtlinienentwurf der deutschen Bun- desärztekammer beschreibt und offensichtlich ermöglichen will, ist recht besehen nichts anderes als ein erneuter Versuch der „Verhütung erbkranken Nachwuchses“ mit den technischen Mitteln des 21. Jahrhunderts. Ich bin daher gewiss, dass aus der Mitte der deutschen Ärzteschaft selbst solchen Entwicklungen entschieden widerstanden wird. Die Christen in diesem Lande werden das nach Kräften unterstützen. Leider gibt der von der Bundesärztekammer zur Diskussion gestellte Text einer weitverbreiteten dumpfen Mentalität nach, für die lebenswert vor allem das gesunde, nicht behinderte und kräftige Leben ist. Was den Anfang des menschlichen Lebens betrifft, sinkt bei uns die öffentliche Empörung über die Tötung menschlichen Lebens tendenziell, je hilfloser ein Mensch ist, das heißt, je näher der Zeitpunkt der Tötung an den Lebensbeginn rückt: von der Tötung geborener Kinder über Spätabtreibungen bis zu Frühabtreibungen. Christen, die an einen Gott glauben, der den Schwachen und Hilflosen besonders nahe ist, sind umgekehrt aufgerufen, sich gerade um die Schwächsten der Schwa- Heft 16, 21. April 2000 Präimplantationsdiagnostik Kein Blick aufs Ganze Präimplantationsdiagnostik – Ärzte als Wegbereiter der Embryonenselektion? Unter dieser Überschrift lud die Ärztekammer Berlin Mitte April zu einem Symposium ein. Es war gedacht als Kontrapunkt zu einer Ver-anstaltung der Bundesärztekammer (BÄK), bei der diese ihren Diskussionsentwurf zu einer PGD-Richtlinie vorgestellt hatte. Die BÄK schlägt vor, die PGD (= preimplantation genetic diagnosis) in sehr engen Grenzen zu erlauben. Die Berliner Kammer hingegen hatte angeregt, über das „Ob“ der PGD nachzudenken, bevor man Überlegungen zum „Wie“ anstelle. Trotz der kritischen Einladungsworte waren Befürworter der Methode zum Vortrag eingeladen. Zudem äußerten sich ihre Verfechter unter den Zuhörern. Sie alle argumentieren auf zwei Ebenen: Eine Gesellschaft, die den § 218 StGB toleriere und die pränatale Diagnostik, könne die PGD im Grunde nicht mehr ablehnen. Als zwei- tes Argument dienen drastische Einzelfallschilderungen. Wer so argumentiert, der wolle die PGD immer nur mit Blick auf eine einzelnes Paar sehen. Sie habe darüber hinaus aber eine gesellschaftliche Dimension, wandte Prof. Dr. rer. nat. Regine Kollek ein, Vorsitzende des Ethikbeirats des Bundesgesundheitsministeriums. Diese Kritik ist zutreffend. PGD bedeutet für eine Gesellschaft Selektion, und seien die Gründe noch so wohl überlegt und die Anwendung auf Einzelfälle beschränkt. Die Befürworter dieser Methode leugnen das letztlich nicht, zögern dieses Eingeständnis aber gern hinaus, indem sie entsprechende Begriffe aussparen oder etwas beleidigt anmerken, man höre sie nicht gern. Zur gesellschaftlichen Dimension gehört zudem, dass die Begrenzung der PGD ein Wunsch bleiben wird. Ihr Einsatz wird zunehmen, und ihre Möglichkeiten werden rasch, ähnlich wie die der Pränataldiagnostik, viele Frauen mit Kinderwunsch beeinflussen. Jede schwangere Frau sei besorgt, suggerierte ein Arzt während des Symposiums und begründete so indirekt, warum entsprechende Untersuchungsund Kontrollmöglichkeiten positiv zu bewerten sind. Wie schön, wenn man heute noch glauben kann, das Besorgtsein habe allein mit der naturgegebenen Befindlichkeit von Schwangeren zu tun – und nichts mit dem Angebot von Ärzten oder der Erwartungshaltung einer Gesellschaft. Sabine Rieser D O K U M E N T A T I O N Heft 17, 28. April 2000 chen besonders zu sorgen. Das menschliche Leben im Reagenzglas ist nicht geschützt durch die spontane emotionale Tötungshemmung, die ein Kindergesicht auslöst. Dennoch belehrt uns gerade die moderne Medizin, dass es „Mensch von Anfang an“ ist. So hilflos und ausgeliefert es ist, bedarf es unseres besonderen Schutzes. Hier zeigt sich im Übrigen, dass die auf den ersten Blick bisweilen schwer verständliche kirchliche Ablehnung der künstlichen Befruchtung sehr ernste Gründe hat. Die Kirche sieht die Entstehung menschlichen Lebens in der ganzheitlichen Geborgenheit der ehelichen Liebe beheimatet. Der technische Eingriff, so nachvollziehbar die Motive auch sein mögen, macht dagegen den gezeugten Menschen zum manipulierbaren Objekt. Grenzen der Manipulation sind bei fortschreitender Technik, wie wir bei den attraktiven Möglichkeiten der Präimplantationsidagnostik sehen können, kaum mehr plausibel zu machen.Auch die von wichtigen Vertretern der Ärzteschaft kritisierte Tatsache, dass in Deutschland die Feststellung einer Behinderung de facto eine legale Abtreibung bis zur Geburt ermöglicht, führt nun zu der menschenverachtenden, allerdings scheinbar logischen Frage, warum man dann nicht schon früher töten dürfe.Auf diese Weise wird deutlich, dass dann, wenn bestimmte Grenzen überschritten werden, es kein Halten mehr gibt. Bedenklicher Vorgang Bedenklich ist nicht, dass über derlei Fragen diskutiert wird, können doch solche Debatten die Öffentlichkeit besser informieren und alarmieren.Bedenklich ist allerdings, dass die offizielle Vertretung der deutschen Ärzteschaft, die Bundesärztekammer selbst, einen Text mit solch unerträglicher Aussage des von ihr selbst berufenen Wissenschaftlichen Beirats der Öffentlichkeit zur Diskussion empfiehlt. Ein derartiger Vorgang ist im Übrigen eine deutliche Warnung, dass hochrangig besetzte „Ethikkommissionen“, die auch in dem Papier vielfältig gefordert werden, keinesfalls Garanten für ethisch vertretbare Entscheidungen Joachim Kardinal Meisner sind. DISKUSSION zu dem Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie der Bundesärztekammer und den dazu erschienenen Berichten und Kommentaren German disease Die Stellungnahme des BMG, das deutsche Embryonenschutzgesetz verbiete die Präimplantationsdiagnostik, ist in dieser verkürzten Form schlicht falsch. Vielmehr haben maßgebliche Stimmen in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung seit geraumer Zeit darauf hingewiesen, dass diese Aussage nur für das frühe Stadium bis zum Ende der Totipotenz gilt. Bemerkenswert ist im Übrigen, dass man sich im BMG nicht einmal an die Position des früheren Leiters des Referats „Grundsatzfragen des Gesundheits- und Medizinrechts“1 erinnern kann oder will, der sich der Thematik noch mit der gebotenen Differenziertheit genähert – und die PID mit gewissen Einschränkungen für zulässig gehalten hat. Richtig ist allerdings, dass § 8 Abs. 1 Embryonenschutzgesetz (ESchG) die befruchtete, entwicklungsfähige menschliche Eizelle vom Zeitpunkt der Kernverschmelzung an und jede einem Embryo entnommene totipotente Zelle, die sich bei Vorliegen der dafür erforderlichen weiteren Voraussetzungen zu teilen und zu einem Individuum zu entwickeln vermag, als Embryo im Sinne des Gesetzes definiert. Danach ist es eindeutig unzulässig, eine totipotente Zelle einem Embryo zu entnehmen, an ihr die Präimplantationsdiagnostik durchzuführen und von deren Ausgang das weitere Schicksal des „Rest-Embryos“ abhängig zu machen. Durch das Zerstören der noch totipotenten Zelle zu Diagnosezwecken würde § 2 Abs. 1 ESchG verletzt, da die Diagnosemethode nicht dem Erhalt des Embryos dient. Um in der Systematik des Embryonenschutzgesetzes zu verbleiben, wäre diese Art der Präimplantationsdiagnostik die Klonierung eines Zwillings zur verbrauchenden Diagnostik. Diese noch im Diskussionsentwurf (§ 7) vorgesehene Möglichkeit ist zu Recht gestrichen worden, da ansonsten ein unlösbarer Normwiderspruch zu § 2 Abs. 2 Diskussionsentwurf aufgetreten wäre2. Im Umkehrschluss untersagt das Embryonenschutzgesetz aber nicht die Präimplantationsdiagnostik an bereits nicht mehr im Sinne von § 8 ESchG totipotenten Zellen des Trophoblasten3, durch deren Verbrauch § 2 Abs. 1 ESchG nicht mehr verletzt wird4. Die dagegen zum Teil früher vorgebrachten Bedenken5 beruhen überwiegend auf der heute widerlegten Vermutung, die Kryokonservierung des Rest-Embryos sei mit hohen Lebensrisiken verbunden; außerdem sei zu befürchten, dass derartige Methoden Screening-Charakter bekämen. Letzteres ist aber nicht Gegenstand des Embryonenschutzgesetzes, sofern nicht die dort enthaltenen Tatbestände verletzt werden. Dies wäre vielmehr Aufgabe des ärztlichen Berufsrechts oder eines noch zu verabschiedenden Fortpflanzungsmedizingesetzes. § 2 Abs. 2 ESchG wird durch die Diagnostik an bereits ausdifferenzierten Zellen des Trophoblasten nicht verletzt, wenn nach Lage der Dinge eine Übertragung des Embryos im selben Zyklus noch möglich ist. Tauchen unvorhergesehene Hindernisse auf, ist ohnehin eine weitere Kryokonservierung zulässig, ohne dass alleine deswegen das Embryonenschutzgesetz verletzt wäre6. Des Kunstgriffes, die Präimplantationsdiagnostik an ausdifferenzierten Zellen des Trophoblasten als Heilversuch zugunsten des übrigen Embryos anzusehen7, bedarf es somit nicht. Schließlich wird im Falle geplanter Präimplantationsdiagnostik auch nicht zu einem anderen – und damit illegitimen – Zweck die Eizelle künstlich befruchtet (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 ESchG) beziehungsweise die extrakorporale Weiterentwicklung des Embryos bewirkt (§ 2 Abs. 2 ESchG), als zur Herbeiführung einer Schwangerschaft der Frau, von der die Eizelle stammt, wenn grundsätzlich die Voraussetzungen für einen Transfer gewährleistet werden. Auch wenn feststeht, dass ein belasteter Embryo nicht übertragen werden 15 D O K U M E N T A T I O N soll, ist die Verwerfung dieses Embryos doch nicht Ziel der künstlichen Befruchtung beziehungsweise der Weiterentwicklung des Embryos. Im Gegenteil ist die etwaige spätere Verwerfung des Embryos wegen einer Verwirklichung des drohenden Risikos höchst unerwünscht. Von einer Absicht im Sinne zielgerichteten Wollens8 kann aber nicht die Rede sein, wenn der eingetretene Erfolg sich lediglich als eine dem Täter höchst unerwünschte Nebenfolge beziehungsweise als Fehlschlag gegenüber dem eigentlich von ihm erstrebten Ziel darstellt9. Bei jeder In-vitro-Fertilisation wird der Embryo-Transfer von verschiedenen Faktoren, deren Vorliegen erst nach der Zeugung festgestellt werden kann, abhängig gemacht. Dies gilt dafür, dass seitens der Frau keine körperlichen Probleme auftreten, insbesondere die hormonelle Stimulation wie geplant läuft. Auch seitens des Embryos müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, deren Vorliegen im Zeitpunkt seiner Zeugung nicht sicher ist. Ein Embryo mit bereits optisch wahrnehmbaren Fehlentwicklungen wird nicht übertragen. Auch an dieser Stelle müss1 2 3 4 5 6 7 8 9 R. Neidert, MedR 1998, 347, 352. H.-L. Günther, Pränatale Diagnose und Pränatale Therapie genetischer Defekte aus strafrechtlicher Sicht, in: H.-L. Günther/Rolf Keller (Hrsg.), Fortpflanzungsmedizin und Humangenetik – Strafrechtliche Schranken?, 2. Aufl. 1991, S. 237. Insoweit wird vorausgesetzt, dass der erforderliche naturwissenschaftliche Beweis erbracht werden kann. Jenseits des Acht-ZellStadiums wird ein Verlust der Totipotenz angenommen, hierzu Krebs, Lexikon der Bioethik 1998, Stichwort „Embryonenforschung“. Weitere Nachweise bei M. Ludwig, Präimplantationsdiagnostik, Alternative zur pränatalen Diagnostik?, Ärztliche Praxis Gynäkologie 1998, 387 ff.; M. Ludwig, S. AIHasani, K. Diedrich, Präimplantationsdiagnostik, in: K. Diedrich (Hrsg.), Weibliche Sterilität. Springer 1998, S. 692 ff. R. Keller/H.-L. Günther/P. Kaiser, Kommentar zum Embryonenschutzgesetz, 1992, Einführung A VIII Rz. 15, § 2 ESchG Rz. 56, 63. R. Neidert, Brauchen wir ein Fortpflanzungsmedizingesetz?, MedR 1998, 347 (allerdings eine Änderung der Berufsordnung anmahnend). Vgl. z. B. H.-L. Günther, Strafrechtlicher Schutz des menschlichen Embryos über § 218 ff. StGB hinaus?, in: Günther/Keller, Fortpflanzungsmedizin, a.a.O. (Fn. 15), S. 170. Keller/Günther/Kaiser, a.a.O. § 2 ESchG Rz. 63. Keller/Günther/Kaiser, a.a.O. (Fn. 17), § 2 ESchG Rz. 56. Keller/Günther/Kaiser, a.a.O. (Fn. 17), § 1 Abs. 1 Nr. 2 ESchG Rz. 15. Vgl. BGHSt 16, 6. 16 ten sich die Gegner der Präimplantationsdiagnostik fragen lassen, warum ein Embryo mit äußerlich erkennbaren Fehlern zweifellos verworfen werden darf, es aber verboten sein soll, nach „inneren“ Fehlern zu suchen. Demnach bleibt es dabei: Die bloße Inkaufnahme des Untergangs gezeugter Embryonen führt nicht zur Strafbarkeit der künstlichen Befruchtung, solange das Motiv des Handelns die Herbeiführung der Schwangerschaft ist. Die jetzige Reaktion ist ein schönes Beispiel für das, was man im Ausland „german disease“ nennt. Treue Anhänger der „political-correctness-Fraktion“ schwingen sich zum Bewahrer der einzig wahren Moral auf und sind sich der allgemeinen Entrüstung sicher. Angesichts dieser mentalen Immobilität möchte man leise an ein sehr altes, aber bewährtes Prinzip erinnern: die Gefahr des Missbrauchs rechtfertigt nicht das Verbot des rechten Gebrauchs. Dr. Rudolf Ratzel Rechtsanwalt Maximiliansplatz 12/IV 80333 München Wir befinden uns mitten auf der schiefen Bahn Leider lässt dieser Entwurf die Möglichkeit, vonseiten der Ärzteschaft auf PID überhaupt zu verzichten, außer Acht und setzt im Grunde – nach grundsätzlicher Entscheidung für die PID – erst bei einer mehr oder minder restriktiven Regelung des Verfahrens an. Der unselige Synergismus zwischen ärztlichem Omnipotenzdenken und komplementärer Anspruchshaltung aufseiten der Patienten hat auch hier dazu geführt, dass das Nicht-akzeptierenKönnen der „alternativen“ Adoption beziehungsweise Verzicht auf Kinder durch betroffene Paare offensichtlich ausreicht, sich über schwerstwiegende ethische Einwände hinwegzusetzen und Kinder auf Probe zu zeugen – mit der erklärten „Option“, diese im Falle genetischer Defekte nicht weiterleben zu lassen. Ich frage mich wirklich, ob es noch denkbare Ansprüche vonseiten der Gesellschaft an die Ärzte gibt, die diese auf Dauer und kategorisch zurückweisen. Wenn der dringende Kinderwunsch eines Paares ausreicht, Menschen zu zeugen und nachher im wahrsten Sinne des Wortes wegzuwerfen, warum soll der doch sicher höher zu bewertende dringende Wunsch eines Schwer- oder gar Todkranken, durch Transplantation geholfen zu bekommen, nicht als Rechtfertigung fragwürdiger Organbeschaffung dienen? Was man mit dem (nicht in dem Entwurf, aber andernorts in diesem Zusammenhang verwendeten) Argumentationsmuster: „Erstens, die Leute wollen es, zweitens, verhindern kann man es sowieso nicht, drittens, sonst gehen sie ins Ausland“ noch alles begründen könnte, will ich hier gar nicht ausmalen. Das zur Zeit noch politisch korrekte kategorische Nein gegenüber dem Klonen von Menschen wird dann mit Sicherheit auch irgendwann einem „Klonen ja, aber in engen Grenzen“ weichen. Die „deutliche Absage an jede Art eugenischer Selektion und Zielsetzung“ („eugenische Ziele dürfen mit der Präimplantationsdiagnostik nicht verfolgt werden“) ist wohl eher der Versuch eines moralischen Feigenblattes. Präimplantationsdiagnostik mit dem erklärten Ziel, den Embryo nur bei genetischem Normalbefund weiterleben zu lassen, ist eugenische Selektion. Das heißt, wir befinden uns nicht am Rande, sondern bereits mitten auf der schiefen Bahn, mit einem Neigungswinkel, der ein weiteres Abrutschen unausweichlich macht. Die unbedingte Unverfügbarkeit des Menschen hat offensichtlich ausgedient; man hat eher den Eindruck, dass auf der Basis einer grundsätzlichen Verfügbarkeit die Nicht-Verfügbarkeit erst im Einzelfall begründet werden muss. So wird zeitgemäß konsenstheoretisch argumentiert: „deshalb muss die Gesellschaft im öffentlichen Diskurs entscheiden . . .“, „wenn die Gesellschaft die Präimplantationsdiagnostik mehrheitlich möchte . . .“ usw.Was ist eigentlich, wenn die Gesellschaft mehrheitlich die Positionen eines Peter Singer oder Dieter Birnbacher übernimmt und Geschlechtsselektion durch Abtreibung oder Tötung von Kindern bis zur Geburt und danach wünscht? Sollen D O K U M E N T A T I O N wir auch aktive Euthanasie, Klonen von Menschen oder die Tötung Behinderter erlauben? Und unser Gewissen mit der entschuldigenden Feststellung „es gibt kein schuldfreies Arztsein“ (H. Hepp) beruhigen? Ich hoffe sehr, dass wir nicht noch einmal so weit kommen, die Einsicht in grundlegende Menschenrechte (deren Missachtung die Gesellschaft auch mehrheitlich nicht wollen darf) erst über die Erfahrung schlimmster Menschenrechtsverletzungen zurückgewinnen zu müssen. Priv.-Doz. Dr. med. W. Wagner Claudiusweg 21 64285 Darmstadt Kein moralischer Protest wird Fortschritt stoppen Mit der Präimplantationsdiagnostik (PGD) werde – so die Autoren – über Lebensrecht und Lebenswert geurteilt und ein immer breiterer Weg zu einer Eugenik von unten beschritten; bestimmte Krankheiten und ihre Träger würden diskriminiert und ein gesellschaftlicher Konsens über die Vermeidbarkeit behinderten Lebens riskiert. Grundsätzlich: wer aus den heiltechnischen Möglichkeiten der modernen Medizin das Recht, ja die ethische Pflicht ableitet, auch schwer behinderte Föten dysgenisch zum Leben zu verurteilen, der hat damit auch das „Recht“ des eugenischen Fötozids usurpiert. Zur Eugenik: „Steigerung der Fähigkeiten“ ist das erklärte Ziel auch anderer (nicht gentherapeutischer) Interventionen in der Medizin. Warum sollte dann eine genetisch optimierte Gesundheit, Intelligenz und Schönheit die Würde des Menschen verletzen? Das Tabu ist jedenfalls gebrochen und die historische Kontinuität seit Aristoteles und Plato, seit Luther und Nietzsche wiederhergestellt. Nicht nur Nobelpreisträger der Medizin, wie Watson und Crick, fordern eine eugenische Selektion, auch aufgeklärte Philosophen, wie Sir Julian Huxley, Peter Singer, Dieter Birnbacher, Peter Sloterdijk, Ronald Dworkin und andere. Die Drift zur Eugenik von unten wird zudem zunehmen: Kein Gesetz, keine Ethik und keine Staatsgrenze wird dem Druck der Eltern standhalten, genetische Gesund- heitsprogramme in ihre Kinder einbauen zu lassen. Der PGD-Tourismus nach London und Brüssel zeigt es heute schon. Zur Gentherapie nach PGD: Was soll unmoralisch daran sein, einen genetischen Defekt so früh wie möglich zu korrigieren? Mit ethischem Rigorismus und irrationalen Glaubenssätzen lässt sich das Problem sicherlich nicht lösen. Schon haben amerikanische Gerichte ein Recht des Kindes formuliert, körperlich und geistig gesund geboren zu werden. Alles andere erfülle den Tatbestand einer Kindesmisshandlung. Man verfügt ja auch dann über künftig Lebende, wenn man nichts tut, wenn man genetische Programmierfehler a priori heilig spricht und a posteriori gutes Geld an schlechte Gene verschwendet. Zur Diskriminierung Behinderter durch PGD: Kein Behinderter will selbst behinderte Kinder! Natürlich muss einem behinderten Kind, das geboren wurde, alle erdenkliche Liebe und Zuwendung zuteil werden. Aber: Muss in Deutschland alle 90 Minuten ein geistig behindertes Kind geboren werden? Braucht die Gesellschaft Behinderte um ihrer eigenen Menschlichkeit willen, wie Behindertenvertreter und Greenpeace-Aktivisten (wohl auch im Blick auf ihre eigene Existenzberechtigung) beteuern? Robert L. Sinsheimer meint dagegen, dass eine Gesellschaft ohne Behinderte „zwar weniger menschlich, dafür aber humaner sein könnte“. Zum Schluss: Die Stimmen für eine PGD und Keimbahntherapie werden immer gewichtiger. Ich gehe jede Wette ein, dass das Verbot über kurz oder lang aufgehoben wird.Wer noch dagegen argumentiert, hat schon verloren. Kein moralischer Protest wird den Fortschritt stoppen. Gendiagnostik und Gentherapie werden noch in diesem Jahrhundert zur Selbstverständlichkeit werden, von jedermann bejaht und gewollt. Die „political“ und „moral correctness“ von heute wird sich als der politische und moralische Irrtum von morgen erweisen. Und die Deutschen sind dabei, den Anschluss an die Zukunft wieder einmal zu verschlafen. Dr. med. Egon Kehler Salzstraße 1 83404 Ainring Notwendiger Impuls Die Stellungnahme aus dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) zum Richtlinienentwurf der BÄK fordert zu einigen Anmerkungen heraus, das ist offensichtlich von der Autorin auch gewollt. Frau Riedel leitet ihre Gegenposition zum BÄK-Entwurf mit einer provokativ wirkenden Feststellung ein: „Die Präimplantationsdiagnostik (PGD) steht im Widerspruch zum Embryonenschutzgesetz“ (ESG). Dies ist eine unbewiesene Meinung, die sich das BMG offenbar zu Eigen gemacht hat. Dagegen lässt die BÄK die Frage offen, ob PGD im Widerspruch zum ESG steht oder ob lediglich aus dem ESG eine Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der PGD nicht zweifelsfrei abzuleiten ist, sie neigt zu der letztgenannten Einschätzung und sieht gesetzgeberischen Handlungsbedarf, um die PGD aus der gesetzlichen Grauzone herauszubringen. Aus Sicht der BÄK könnte durch Gesetzespräzisierung oder -ergänzung schneller eine Klärung möglich sein als aus Sicht des BMG, daran aber scheint dem BMG nicht gelegen zu sein („Eile [ist] nicht geboten“). Frau Riedel kritisiert, dass der Richtlinienentwurf der BÄK zum jetzigen Zeitpunkt, ihrer Meinung nach zu früh, vorgelegt wurde, „bevor die öffentliche Diskussion hierzu begonnen hat“. Diese hat längst begonnen und ist seit Monaten in den Medien in vollem Gange. Nach meinem Ermessen war es höchste Zeit, dass die BÄK mit einer klaren und klar begründeten Stellungnahme in die Öffentlichkeit gegangen ist. Frau Riedel kritisiert den Blick auf die Regelungen in unseren europäischen Nachbarstaaten, die auch in der Präambel des BÄK-Entwurfes erwähnt werden. Diese Kritik erscheint mir aus mehreren Gründen fragwürdig. Mit diesem Blick will sich keiner der „eigenen Verantwortung entziehen“ oder einer „eigenen, innerstaatlichen Entscheidung“ aus dem Wege gehen. Das Verhalten von zehn uns eng verbundenen Nachbarstaaten mit vergleichbaren gesellschaftlichen und sozialen Strukturen sagt sehr viel über die gesellschaftliche Realität und das gesellschaftliche Bewusstsein in unserem Kulturbereich 17 D O K U M E N T A T I O N und damit auch bei uns aus und sollte deshalb bei unserer Entscheidungsfindung mit einfließen. Im Übrigen sind „innerstaatliche“ diesbezügliche Unterschiede bei uns selbst nicht geringer als die gegenüber unseren Nachbarn. Es wäre politische Kurzsichtigkeit, das nicht wahrnehmen zu wollen. Frau Riedel argumentiert mit der Meinung von Mucoviscidosiskranken: „Menschen beispielsweise mit Mucoviscidose, die ein lebenswertes Leben führen, verurteilen diese Methode zu Recht.“ Es geht nicht um die Frage nach lebenswertem oder lebensunwertem Leben, alles Leben ist lebenswert. Das wird insbesondere von den Verfassern des BÄK-Entwurfes so gesehen, darauf gründet sich auch der ganz bewusste Verzicht auf einen Indikationenkatalog. Die ethische Verantwortung bei der PGD bezieht sich auf die von der Mutter für sie als unzumutbar empfundene Belastung durch ein zu erwartendes in der Regel weiteres schwerstbehindertes Kind. Dieses der Mutter als Diskriminierung behinderten Lebens anzulasten ist Hybris. Dass ein Mukoviscidosiskranker das nur schwer differenzieren kann, muss man ihm zugestehen, deswegen kann man aber seine Meinung nicht zum Maßstab machen. Frau Riedel schreibt: „Es besteht die Gefahr, dass in der Gesellschaft eine Erwartunghaltung für gesunde Kinder entsteht und es Eltern schwer gemacht wird, sich für ein behindertes Kind zu entscheiden.“ Die Erwartungshaltung für ein gesundes Kind ist so alt wie die Menschheit. Sie ist – aus welchen Gründen auch immer – in unserer Gesellschaft sehr hoch, was beispielsweise an der häufigen Inanspruchnahme der Pränataldiagnostik zum Ausschluss einer Trisomie 21 erkennbar ist. Diese Grundhaltung mag man bedauern, aber man muss sie zur Kenntnis nehmen. Die bei der in der BÄK-Richtlinie vorgesehenen restriktiven Handhabung der Methode durch PGD hinzukommenden wenigen Fälle, bei denen außerdem für jeden erkennbar ist, dass es sich um AusnahmeSituationen handelt oben unter , ändern an dieser Erwartungshaltung in unserer Gesellschaft nichts. Im Richtlinienentwurf der BÄK erkenne ich einen notwendig gewordenen Impuls von großem Gewicht, der die 18 ethische Verantwortung im Gebrauch des technisch Möglichen erkennen lässt. Das wird unterstrichen durch die von Sabine Rieser in ihrem Kommentar zitierten Aussagen von Herrn Kollegen Hepp, dem federführenden Mitglied der Arbeitsgruppe. Prof. Dr. med. Theodor Luthardt Scheuergasse 4 79271 St. Peter Was soll dieser Umweg? Ich habe die bisherigen Beiträge zur Präimplantationsdiagnostik mit Interesse verfolgt. Die Formulierung „Der Embryo in vivo steht unter dem realen Schutz der Frau, der Embryo in vitro . . . steht nur unter dem rechtlichen Schutz“ lässt mich jedoch aufmerken. Über das, was in der Frau geschieht, hat die Frau selbst Einfluss/Zugriff. Was ist außerhalb derselben tabu (?). Im Klartext: Wird im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung eine mögliche Schädigung festgestellt, darf die Frau (werdende Mutter) straffrei abbrechen. Wird am Embryo in vitro eine Schädigung festgestellt, dürfte nicht interveniert werden. Nach Implantation (in vivo!) dürfte die Mutter nach geltendem Gesetz wieder abbrechen. Was soll dieser Umweg? Oder will der Gesetzgeber behinderten Nachwuchs? Michael Rost Oberstraße 4 54293 Trier Müssen wir alles machen? . . . Seinem Kommentar hat Herr Jachertz die Überschrift „Am Rande der schiefen Bahn“ gegeben und damit wohl isoliert die Präimplantationsdiagnostik gemeint. In Wahrheit sind wir schon längst drauf auf der schiefen Bahn, die Tötung unerwünschten Lebens bedeutet: De-facto-Freigabe der Abtreibung in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten; – Pränatale Diagnostik mit der Folge, dass heute Neugeborene mit früher häufigen Missbildungen, wie Down-Syndrom oder Spina bifida, kaum noch vorkommen; – In-vitro-Fertilisation mit Hinnahme des „Verwerfens“ überschüs- siger Embryonen. – Jetzt das Vorhaben, die assistierte Reproduktion im Sinne der „Präimplantationsdiagnostik“ zu erweitern. Schon dieses Wort ist ein Euphemismus. Man bemüht sich keineswegs nur um Erkenntnisgewinn, sondern ausdrücklich darum, zwischen lebenswerten und lebensunwerten Embryonen zu unterscheiden und danach zu handeln.Dass man dazu die Behauptung aufstellt, es gehe nicht um eugenisch orientierte Nachwuchsplanung, kann nur als dreiste Lüge und als Lippenbekenntnis angesehen werden mit dem Ziel, der Öffentlichkeit Sand in die Augen zu streuen.An die ersterwähnten Eingriffe haben sich viele schon gewöhnt, achselzuckend geht man über die Rechte der Embryonen hinweg, und unser Parlament hat das mit dem reformierten § 218 StGB teilweise gesetzlich abgesegnet. Was hat es zu bedeuten, wenn ein Schwangerschaftsabbruch rechtswidrig, jedoch bei Einhaltung bestimmter Regeln straffrei ist? Mich erinnert das an Pontius Pilatus. Ist es wirklich ethisch zu rechtfertigen, dass wir durch Budgets allenthalben an die Grenzen der dem Medizinbetrieb zugestandenen Mittel stoßen und gleichwohl extrem hohe Kosten für High Med in Form von assistierter Reproduktion akzeptieren, wo doch gleichzeitig sozial nicht passende Embryonen getötet werden. Müssen wir alles machen, was die anderen im Ausland tun, aus Angst, dass wir wissenschaftlich zurückbleiben? Es ist in Deutschland gesellschaftlicher Konsens, dass die Abschaffung der Todesstrafe einen ethischen Fortschritt bedeutet, obwohl sie in anderen Ländern weiter in Gebrauch ist. Warum wird dann die Tötung am Beginn des Lebens akzeptiert? Weil Embryonen sich nicht äußern und angeblich auch nicht leiden? Weil es sich, wie manche sagen, nicht um menschliches Leben, sondern um empfindungslose Zellklumpen handelt? Die Präimplantationsdiagnostik ist nichts als ein weiterer Schritt auf dem bereits eingeschlagenen Weg, der gekennzeichnet ist durch Rechtsunsicherheit und rücksichtslose Anwendung wissenschaftlich-technischen Fortschritts. . . . Dr. med. Wolfram Kirmeß Kleine Geest 3–5 31592 Stolzenau D O K U M E N T A T I O N Moralisten werden die Entwicklung nicht aufhalten Alles ist gut, wenn es gut ist. Auch die Präimplantationsdiagnostik, wenn sie mit Vernunft und Augenmaß erfolgt. Ich stimme mit Herrn Jachertz überein. Er schreibt: „ . . . dann wird man auf Dauer mit der Auswahl ungeborenen Lebens leben müssen.“ Die Wissenschaft hat dem Menschen geholfen, ungewollte Schwangerschaft zu vermeiden. Sie wird auch helfen, dem genetisch bedingten „Defekt“, also dem Ungesunden vorzubeugen – sozusagen als Methode der Wahl. Natürlich werden die Moralisten aller Konfessionen und Fraktionen ihr Verdikt verkünden, wie immer lauthals und mit allen Mitteln. Aber sie werden die Entwicklung nicht aufhalten, nur verzögern. Die Wissenschaft ist keine Glaubensgemeinschaft, das weiß man, und das ist gut so. Wenn der Mensch mit seinen Irrungen und Wirrungen noch eine kleine Chance hat, dann wird es die Wissenschaft sein. Dr. med. Alfons Werner Reuke Sommerhalde 42 71672 Marbach Orientierung verloren Mehr noch als der eigentliche Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik (PGD) fordert das Vorwort dazu zu einer Stellungnahme heraus. Dem Leser stockt der Atem, wenn indirekt die Frage formuliert wird, ob es sich um eine Ausnahme vom Tötungsverbot handelt oder gar keine Tötung vorliegt. Wie anders soll man es denn nennen, wenn einem Lebewesen die Voraussetzungen zum Weiterleben entzogen beziehungsweise vorenthalten werden? Und wodurch sollte eine Ausnahme vom Verbot – für den Arzt insbesondere – zu töten begründet sein? Tatsächlich kann eine Ausnahme vom Tötungsverbot oder das Nichtvorliegen einer Tötung nur (an)erkennen, wer den Beginn menschlichen Lebens und damit seiner Schutzwürdigkeit entgegen wissenschaftlicher Erkenntnis nicht mit dem Zeitpunkt der Verschmelzung von Eiund Samenzelle identisch sehen will. Eine Definition aber, wann denn das Leben dann beginnt, steht aus, dürfte heiß umstritten sein und birgt jede Menge Gefahren in sich. Der Konflikt der PGD mit dem Embryonenschutzgesetz (ESchG) wird auf das Verbot von Untersuchungen an Embryonen im Stadium zellulärer Totipotenz und das Verbot der fremdnützigen Verwendung von Embryonen reduziert. Dabei soll doch die PGD für Paare bereitstehen, „für deren Nachkommen ein hohes Risiko für eine bekannte und schwerwiegende, genetisch bedingte Erkrankung besteht“. Das heißt: Embryonen mit „Veränderung des Erbmaterials“, die zur Tötung anstehen, werden zwangsläufig auftreten,sie sind zwar nicht das Ziel der PGD, aber auch nicht „unerwünschte Nebenfolge oder ein Fehlschlag“, wie Prof. Hepp zitiert wird. Die PGD steht daher eindeutig im Widerspruch zum ESchG § 1 Abs. l Nr. 2 und § 2 Abs. l. Auch eine Konfliktreduzierung durch PGD, indem nämlich „eine Entscheidung über einen eventuellen Abbruch einer fortgeschrittenen Schwangerschaft vermieden“ würde, kann ich nicht erkennen. Es ist derselbe Mensch, der getötet wird, freilich in einer anderen Phase seines Lebens. Seine Gestaltlosigkeit und die mögliche Vielzahl von Embryonen durch IVF täuschen nur eine Konfliktreduzierung vor! Gänzlich der Nachvollziehbarkeit entzieht sich das Vorwort, wenn von einer „Absage an jede Art eugenischer Selektion und Zielsetzung“ die Rede ist, geht es doch gerade um die Feststellung veränderten Erbmaterials durch die PGD und anschließende Aussonderung menschlicher Individuen aufgrund dieser Veränderungen. Wenn voranstehend betont wird, die Bundesärztekammer orientiere sich an einem Menschenbild, das „von Respekt vor allen Menschen, einschließlich denen mit geistigen, seelischen und körperlichen Beeinträchtigungen, geprägt ist“, muss leider anhand der Unvereinbarkeit der PGD mit dieser Grundhaltung festgestellt werden, dass die Bundesärztekammer hier offenbar die Orientierung verloren hat. Mit Einführung der PGD aber wird zweifelsohne nach und nach der Respekt vor den Menschen mit derartigen Beeinträchtigungen verloren gehen. Eine weitere Formulierung hinterlässt den Eindruck von Orientierungslosigkeit und mich rat- los: Was nämlich soll „eine große Fähigkeit und Bereitschaft zu hinreichend konfliktarmen Lösungen“ sein und hervorbringen? Gibt es etwas zwischen dem elterlich-ärztlichen Entscheid über „leben dürfen“ oder „sterben müssen“? Dr. med. G. Haasis Max-Reger-Straße 40 28209 Bremen Wo bleibt die Achtung? Allgemein: Das DÄ widmet Themen der Reproduktionmedizin in den letzten Monaten mehr Raum, als ihrer Bedeutung im tatsächlichen Medizinbetrieb entspricht. Cui bono? In welche Richtung sollen wir beeinflusst werden? Obwohl über die Einführung der PGD in Deutschland keineswegs Einvernehmen besteht, legt die Bundesärztekammer bereits einen Entwurf zu einer Richtlinie für dieses Verfahren vor, als ob mit der Einführung fest zu rechnen wäre. Dieses Vorgehen kann als Versuch der Manipulation gedeutet werden. Der Versuch, die Indikationen für die PGD durch Richtlinien und Kommissionen zu begrenzen, ist sicher zum Scheitern verurteilt, wie die Vergangenheit lehrt. Man denke nur an die Geschichte der Schwangerschaftsverhütung oder an die des Schwangerschaftsabbruchs. Also ist, wenn die PGD eingeführt wird, mit zunehmender Ausweitung des Indikationsbereichs zu rechnen. Wir sollten uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass Richtlinien hier nur eine Feigenblatt-Funktion haben. Die Erlaubnis, einen Embryo mit den genetischen Merkmalen einer schweren genetisch bedingten Krankheit zu „verwerfen“, enthält eine Botschaft an alle geborenen Träger dieser Krankheit: „Wir hielten es für besser, du wärest nicht geboren.“ Dieses Gedankengut kennen wir doch aus dem Dritten Reich. Ob wir einen Behinderten in einer Anstalt umbringen oder einen Embryo im 16-Zellen-Stadium „verwerfen“ – die Geisteshaltung ist die gleiche. Wo bleibt die Achtung vor dem Menschen und seinem Schöpfer? Dr. med. Winfrid Gieselmann Finkenwiesenstraße 1 75417 Mühlacker 19 D O K U M E N T A T I O N Ärztliche Entscheidungen im Einzelfall unter Ausnahmebedingungen Als Mitglied der zitierten Bioethikkommission des Justizministers in Rheinland-Pfalz begrüße ich den Diskussionsentwurf der Bundesärztekammer zu einer „Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik“. 55 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Zusammenbruch des verbrecherischen Hitler-Regimes muss endlich auch in Deutschland eine Debatte über ethische Grundfragen an den Grenzen des menschlichen Lebens möglich sein, die – wie Frau Riedel sie fordert – unvoreingenommen und offen geführt werden sollte. Ausgangspunkt aller Betrachtungen sollte im Falle der PGD das Rat suchende Paar sein, das ein genetisches Risiko für die Vererbung einer schwerwiegenden chromosomalen oder molekularen Störung beziehungsweise Fehlbildung trägt und einen fortbestehenden Kinderwunsch hat. So war der Ausgangsfall gelagert, der die behandelnden Ärzte veranlasste, die Ethikkommission der Medizinischen Universität in Lübeck anzurufen. Nach Anhörung mehrerer Sachverständiger gab sie das Votum ab, dass die Maßnahme einer PGD als medizinisch vertretbar anzusehen ist, die Kommission sich jedoch wegen der bestehenden Rechtslage – Verbot durch das Embryonenschutzgesetz – an der Abgabe eines positiven Votums gehindert sieht. Aus der Sicht der behandelnden Ärzte fassten Ludwig und Diedrich (1) alle für und gegen die Einführung dieser medizinischen Maßnahme sprechenden Argumente zusammen. Die Thesen der Bioethikkommission im Bericht vom 20. Juni 1999 (2) gehen von derselben sehr engen, restriktiven Indikationsstellung zur PGD aus, die auch der Richtlinienentwurf übernommen hat. Ausgehend von der derzeitigen Rechtslage des Verbotes der Entnahme von totipotenten Blastomeren aus dem – überlebensfähigen – Embryo und dem sehr engen Zeitfenster zwischen verlorener Totipotenz der Blastomere und noch Erfolg versprechender Implantation des Embryos handelt es sich bei der PGD an nicht mehr totipotenten Blastomeren um eine wahre medizinische Hightechme- 20 thode mit großer psychischer Belastung der betroffenen Eltern, die nicht ohne Not angewendet werden dürfte. Entscheidend ist und bleibt der Gesichtspunkt, dass die Eizelle ausschließlich zur Herbeiführung einer – weniger belasteten – Schwangerschaft bei genetisch belasteten Paaren befruchtet wird und nicht, wie Frau Riedel schreibt, die Eizelle „zunächst nur zu diagnostischen Zwecken künstlich befruchtet wird“. Die Bioethikkommission hat sich weder dazu entschließen können, der Frau ein Recht auf ein gesundes Kind zuzusprechen noch ihr den Verzicht auf – weitere, gegebenenfalls unbelastete – Kinder abzuverlangen. Diesen besonderen Schutz des Kindes durch die Frau, nämlich die Mutter, erkennt auch Frau Riedel in ihrem Aufsatz an. Sie übersieht allerdings, dass in dem – bislang in Deutschland einzigen – Beispielsfall die Eltern schon ein behindertes Kind haben, zwei Schwangerschaften wegen Feststellung der Genmutante abgebrochen wurden und das Paar sich die Nöte und Belastungen mit einem weiteren behinderten Kind nicht mehr zutraute. Insofern kann eine PGD in dem von der Richtlinie vorgezeichneten sehr engen Rahmen auch nicht als Argument dafür herhalten,damit würde behindertes Leben möglicherweise diskriminiert. Frau Riedel dürfte auch nicht erkannt haben, dass die Entscheidung zu einem weiteren Kind durch das Rat suchende Paar und erst in letzter Konsequenz durch die Frau getroffen werden kann. In These 11.9 stellt die Bioethikkommission fest, dass es ein Wertungswiderspruch wäre, würde man Paaren mit dem Risiko der Übertragung eines Gendefektes die PGD aus Rechtsgründen verwehren, gleichwohl aber die spätere Pränataldiagnostik mit möglichem Schwangerschaftabbruch nach festgestellter Indikationslage erlauben. In These III. 2 b) stellt die Kommission fest, dass die psychische und physische Belastung durch einen Schwangerschaftsabbruch, bei dem es auch zu Spätfolgen für die Frau kommen kann, ungleich größer ist als die Belastung durch die Entscheidung, einen Embryo nicht zu transferieren. Dieses Argument macht sich der Richtlinienentwurf in Analogie zu der medizinischen Indikation in § 218a StGB zu Eigen. Diese Analogie hält Frau Riedel für fragwürdig. Eine Erklärung hierfür mag in der Tatsache begründet sein, dass es sich bei jenem Kollektiv von Frauen, die den beratenen, aber rechtswidrigen Abbruch anstreben, das Frau Riedel im Blick haben dürfte, um ein von den Rat suchenden Paaren, die eine PGD wünschen, völlig verschiedenes Kollektiv handelt. Der Grundgedanke der Bioethikkommission und des Diskussionsentwurfes, dass es um ärztliche Entscheidungen im Einzelfall und unter besonderen Ausnahmebedingungen geht, die in die erhöhte Sorgfaltspflicht des Arztes gestellt sind, wird in der Stellungnahme von Frau Riedel nicht ausreichend deutlich. In ihren Thesen III, 3 hat sich die Kommission aber auch sehr eingehend mit verschiedenen Argumenten auseinander gesetzt, die alle auf die „Dammbruchgefahr“ hinauslaufen, die schon zu den derzeit gültigen Ausschlussbedingungen des Embryonenschutzgesetzes geführt haben. 1. Ludwig, M und Diedrich, K. „Embryonenforschung in Deutschland?“ in Rittner Ch. et al. (Hrg.) „Genomanalyse und Gentherapie: Medizinische, gesellschaftspolitische, rechtliche und ethische Aspekte“, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1997. 2. Präimplantationsdiagnostik: Thesen zu den medizinischen, rechtlichen und ethischen Problemstellungen, Bericht der BioethikKommission des Landes Rheinland-Pfalz vom 20. Juni 1999. Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz. Prof. Dr. med. Ch. Rittner Institut für Rechtsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Am Pulverturm 3, 55131 Mainz Anregungen Ein entscheidender Unterschied zwischen Präimplantationsdiagnostik (PGD) und Pränataldiagnostik (PND) besteht für mich in dem Umstand, dass die Pränataldiagnostik in der Regel eine Janein-Entscheidung zu einem einzelnen Kind darstellt. Dagegen ermöglicht die Präimplantationsdiagnostik in der Regel eine Auswahl aus einer größeren Zahl an Embryonen (zur Zeit noch durch das Embryonenschutzgesetz beschränkt auf drei).Wenn man genug Embryonen ohne ein bestimmtes Merkmal zur Verfügung hat, besteht dadurch eine latente Versuchung, auch noch auf andere Merkmale zu testen. In Belgien scheint dies durchaus gängige Praxis zu D O K U M E N T A T I O N sein, indem den Eltern außer der Abklärung der ursprünglichen Fragestellung zusätzlich im Vorfeld der PGD aktiv ein Screening auf häufigere rezessive Anlageträgereigenschaften angeboten wird, um dann ein eventuelles weiteres Risiko ebenfalls zu testen.Aber auch ohne weitere Untersuchungen ergibt sich bei rezessiven Erkrankungen ganz von allein die Schwierigkeit, wie mit heterozygoten Embryonen (also ohne eigenes Erkrankungsrisiko) umgegangen werden soll, wenn auch homozygot unauffällige Embryonen zur Verfügung stehen. Der Verweis auf die Eltern als darüber bestimmende Personen kann zu schwierigen Situationen führen, da ein heterozygoter Befund in der Pränataldiagnostik in aller Regel nicht als Argument für eine unzumutbare Belastung der Schwangeren anerkannt würde. Mit welcher Begründung sollte er es dann in der Präimplantationsdiagnostik sein? Ich möchte daher die Frage in den Raum stellen, ob es nicht möglich wäre, bei PGD immer nur eine einzelne Eizelle zu befruchten, zu diagnostizieren und dann über diesen Embryo eine Ja-neinEntscheidung zu treffen. Dies würde sowohl bei den Ärzten als auch bei den Eltern natürliche Hemmschwellen erhalten, mit dem „Embryonenmaterial“ nicht allzu großzügig und entpersonalisiert umzugehen. Es hätte außerdem den wichtigen Vorteil, dass auf diese Weise möglichst wenig Embryonen verworfen werden müssten, denn es leuchtet unmittelbar ein, dass umso mehr Embryonen das gesuchte genetische Merkmal aufweisen werden, je mehr pro Elternpaar erzeugt werden. Dies scheint mir auch dem Geist des Embryonenschutzgesetzes noch am ehesten nahe zu kommen. Viele Reproduktionsmediziner werden praktische Einwände gegen diesen Vorschlag erheben und insbesondere eine Verminderung der Schwangerschaftrate beziehungsweise eine Erhöhung der dafür notwendigen Zyklenzahl befürchten. Dies müsste möglichst gründlich und ohne Vorurteile untersucht werden. Die Daten, die anhand künstlicher Befruchtung (IVF und ICSI) gewonnen wurden, können jedoch nicht ohne weiteres dazu herangezogen werden, da es sich hierbei um Paare mit Fruchtbarkeitsstörungen gehandelt hat, was bei PGD in der Regel nicht der Fall wäre. Möglicherweise wird eine Frau auf diese Weise mehr Punktionen benötigen, dafür könnte eventuell auf die Stimulationsbehandlung verzichtet werden (?). Der Trend scheint aber in der Reproduktionsmedizin ohnehin zur Reduzierung der Embryonenzahl zu gehen, um die belastenden Mehrlingsschwangerschaften zu vermindern. Die neuen Richtlinien sehen deshalb bereits bei IVF und ICSI vor, einer Frau unter 35 Jahren nur noch maximal zwei Embryonen zu übertragen (Richtlinien zur assistierten Reproduktion, DÄ Heft 49/ 1998). Falls diese – nach meiner Ansicht optimale – Verbindung eines möglichst sicheren Embryonenschutzes bei gleichzeitiger Vermeidung von Schwangerschaftsabbrüchen (als das wesentliche Argument für PGD) nicht realisierbar sein sollte, müsste zumindest die Grenze von zwei oder drei Embryonen, die gleichzeitig erzeugt und untersucht werden dürfen, unbedingt eingehalten werden. Es sollte auch eindeutig geregelt werden, wie mit heterozygoten Embryonen bei rezessiven Erkrankungen umgegangen wird. Das ist keine akademische Diskussion ohne praktische Relevanz: In Belgien wird bei X-chromosomal rezessiven Erkrankungen auf Wunsch der Eltern bereits eine Selektion gegen weibliche verdeckte Anlageträger vorgenommen (Liebaers, persönliche Mitteilung). Da kein Embryo einer Frau gegen ihren Willen übertragen werden kann, wird jede vorherige Vereinbarung umgehbar bleiben. Analog zu der Geschlechtsmitteilung bei PND vor der 12. Schwangerschaftswoche könnte deshalb erwogen werden, einen heterozygoten Befund grundsätzlich nicht anders als einen homozygot unauffälligen Befund mitzuteilen (worauf die Eltern bereits im Vorfeld hingewiesen würden). Ärztliches Ziel der PGD kann nur die Hilfestellung bei einem bestehenden elterlichen Konflikt sein, nicht die möglichst effiziente Verhinderung von Menschen mit genetischen Erkrankungen. Insofern ist der Absatz: „Bei einer PGD darf nur auf diejenige Veränderung des Erbmaterials untersucht werden, die zu der infrage stehenden schweren genetischen Erkrankung führt, für die das Paar ein hohes genetisches Risiko hat.“ ausdrücklich zu begrüßen. Um das darin angestrebte Ziel der eigenen Beschrän- kung zu gewährleisten, sollte aber auch ein Screening der Eltern auf weitere genetische Veränderungen im Vorfeld der PGD abgelehnt werden. Der Qualität wäre es sicherlich zuträglich, wenn nur wenige, wissenschaftlich ausgerichtete Zentren für PGD entstehen dürften: Jede Technik muss ausreichend geübt werden, um möglichst zuverlässig zu sein. Schließlich werden die genannten Grenzen der PGD nur so lange wirksam bleiben, wie eine kommerzielle Nutzung auf Dauer verhindert werden kann, da eine Anschaffung der benötigten Ressourcen unter dem Druck steht, sich auch den entsprechenden Bedarf zu erzeugen. Dr. med. Barbara Leube Institut für Humangenetik und Anthropologie Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Universitätsstraße 1 40225 Düsseldorf Euphemismus Die novellierte Fassung des § 218 ermöglicht es nach chromosomalen oder genetischen Defekten jeglicher Art zu untersuchen und anschließend die Schwangerschaft abzubrechen – und zwar zu jedem Zeitpunkt. Grundsätzlich ist auch eine Untersuchung auf das Geschlecht möglich. Damit hat der Gesetzgeber festgestellt, dass die „positive Eugenik“ im Rahmen der Schwangerschaft rechtens ist und die alleinige Entscheidung darüber bei der Frau liegt. Und tatsächlich ist dies in der Bundesrepublik jährlich zigtausendfache Praxis, und jeder tätige Frauenarzt und Humangenetiker weiß, dass die Vorstellungen darüber, was „defekt“ oder was „gesund“ ist, von Frau zu Frau sehr unterschiedlich sind. Einen gewissen Einhalt bieten die Richtlinien der Humangenetiker (im Hinblick auf die Geschlechtsmitteilung), doch sind dies Selbstverpflichtungen der behandelnden und diagnostizierenden Ärzte – der Gesetzgeber schreibt dies keineswegs vor. Es ist kaum anzunehmen, dass der Gesetzgeber in der jahrelangen Diskussion über die Novellierung des § 218 es „übersehen“ hat, dass durch die jetzige Formulierung des § 218 der pränatalen Diagnostik nach allen erdenklichen Gesichtspunkten mit der Möglichkeit des 21 D O K U M E N T A T I O N nachfolgenden Schwangerschaftsabbruches de facto Tür und Tor geöffnet wurde. Die Präimplantationsdiagnostik würde diese Prinzipien, wie sie im Rahmen einer Schwangerschaft als legal erachtet werden, auf den Embryo vor seiner Einnistung übertragen. Mehr nicht.Wenn also schon „am Rande der schiefen Bahn“, dann hätte dieser Aufschrei im Rahmen der Novellierung des § 218 kommen müssen. Ist er aber nicht. Die vorgeschlagenen Richtlinien des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer nehmen sich im Gegensatz zur Praxis des novellierten § 218 ausgesprochen restriktiv aus. Der jetzige Aufschrei der Empörung hat deshalb euphemistische Züge, denn: wie will man es noch verstehen, dass ein und dieselbe Diagnostik und Vorgangsweise am Embryo vor seiner Einnistung verboten sein soll, während sie nach seiner Einnistung de facto ohne Einschränkung und in allen Lebensaltern (also auch an lebensfähigen Feten) zulässig ist. Nicht vergessen werden darf, dass das Verfahren der Pränataldiagnostik eine Befruchtung außerhalb des Körpers (Invitro-Fertilisation) voraussetzt, also vergleichsweise aufwendig ist. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die betroffenen Paare, sofern sie normal fertil sind, auch weiterhin auf die PGD verzichten, ihre Kinder auf normalem Wege zeugen und die Untersuchungen dann in der Schwangerschaft vornehmen lassen werden. Doch was ist mit solchen Ehepaaren, die auf eine In-vitro-Fertilisation angewiesen sind (zum Beispiel aufgrund beidseits fehlender Eileiter der Frau) und bei denen gleichzeitig eine bekannte genetische Vorerkrankung besteht? Muss man dann sehenden Auges auf die entsprechende Diagnostik bei dem Embryo-in-vitro verzichten, um ihn anschließend einzusetzen, und im Rahmen der Schwangerschaft exakt dieselbe Untersuchung durchzuführen – freilich mit der Konsequenz eines dritten Eingriffs, nämlich dem des Schwangerschaftsabbruches? Geht diese absichtliche Zumutung von zwei zusätzlichen Körperverletzungen (Pränataldiagnostik und Schwangerschaftsabbruch) ethisch wirklich in Ordnung, oder ist das nicht auch schon längst „auf der schiefen Bahn“? Geist und Buchstabe des Gesetzes vereinbar ist: Ist Kinderlosigkeit tatsächlich als so schwere Beeinträchtigung des Gesundheitszustands anzusehen, dass dafür der Schutz des ungeborenen Lebens zurückstehen muss? Mit der Zulassung der PID würde von ärztlicher und gesetzgeberischer Seite auch dieser kalkulierte Einsatz der FD moralisch positiv sanktioniert; dies entspräche einem Paradigmenwandel der moralischen Rechtfertigung von PD sowie der Interpretation des § 218a Abs. 2 StGB. Sowohl die PID als auch sämtliche Verfahren der PD sind vor diesem Hintergrund kritisch zu hinterfragen, und die implizit im Raum stehende Frage „Gibt es ein Recht auf (gesunde) Kinder?“ ist explizit zu diskutieren. Prof. Dr. Dr. W. Würfel Deutsche Gesellschaft für Gynäkologische Endokrinologie und Fortpflanzungsmedizin in der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG), c/o Frauenklinik Dr. Wilhelm Krüsmann Schmiedwegerl 2–6 81241 München Dr. med. Hans-Jürgen Pander Institut für Klinische Genetik Städtische Frauenklinik Obere Straße 2, 70190 Stuttgart Gibt es ein Recht auf (gesunde) Kinder? auf eine Schwangerschaft zu verzichten und damit ein Risiko für ihren Gesundheitszustand aufgrund einer genetischen Erkrankung eines zukünftigen Kindes zu vermeiden; sie hat somit alternative Möglichkeiten, nicht „an der Furcht vor einem genetisch bedingt schwerstkranken Kind gesundheitlich zu zerbrechen“ (1). Die Abwägung besteht in dieser Situation somit zwischen dem bewussten Verzicht auf biologisch eigene Kinder und den Grundrechten des Gezeugten. Die meisten in genetischer Beratung und PD Tätigen können andererseits nicht an der Tatsache vorbeisehen, dass – vergleichbar einer zukünftigen Nutzung der PID – zunehmend die Entscheidung für die Durchführung einer PD schon primär mit dem Entschluss zu einer Schwangerschaft gefällt wird. Wir bezweifeln jedoch, dass diese Nutzung der PD und der medizinischen Indikation zum Schwangerschaftsabbruch – im Sinn einer „Schwangerschaft auf Probe“ – mit Dr. med. K. Mennicke Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Universitätsklinikum Lübeck Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck In der Diskussion ethischer und juristischer Aspekte der Präimplantationsdiagnostik (PID) wird meist der Bezug zu den entsprechenden Regelungen im Rahmen der Pränataldiagnostik (FD) und des § 218a StGB Abs. 2 hergestellt (vgl. 1). Dieser Vergleich ist jedoch nicht zulässig. Bei der moralischen und juristischen Rechtfertigung eines Schwangerschaftsabbruchs aus medizinischer Indikation findet eine Abwägung zwischen dem Schutz des ungeborenen Lebens und dem Lebensrecht der Frau statt.Von zentraler Bedeutung ist hierbei auch, dass die Schwangere „unschuldig“ in diese Konfliktsituation hineingeriet (hierzu 2). Im Fall der PID findet demgegenüber diese Abwägung definitiv nicht statt, da eine Schwangerschaft noch nicht besteht. Die noch nicht Schwangere hat zum Beispiel die Möglichkeit, bewusst 22 1. Hoppe, J.-D., und K.-F. Sewing, Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik – Vorwort, DÄ Heft 9/2000. 2. Böckle, F., Schwangerschaftsabbruch – 1. Ethik, in: Eser, A. et al. (Hg.), Lexikon Medizin, Ethik, Recht, Freiburg 1989, Sp. 963– 969. Dr. med. Monika Hagedorn-Greiwe Institut für Humangenetik Universitätsklinikum Lübeck Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck Wir alle sind gefordert Eindeutige Stellungnahmen von Ärzten/ Ärztinnen und gesellschaftlichen Organisationen sind dringend gefordert: Selektion der Eltern: Entgegen allen sprachlichen Verschleierungs- und Verharmlosungstendenzen der Mitglieder des Beirates bleibt festzuhalten: Die Ehepaare, bei denen – obwohl keine Unfruchtbarkeit vorliegt – vor extrakorporaler Befruchtung eine genetische Untersuchung der befruchteten Eizelle vorgenommen werden kann, werden ausgesucht – bestimmt – selektioniert – wie immer dies bezeichnet werden soll. Sie werden selektioniert nach ihrem Erbgut und der daraus resultierenden Krankheitsgefährdung des gewünschten Kindes. D O K U M E N T A T I O N Selektion der Kinder: Die Entscheidung, ob die „geschädigte Eizelle“ implantiert oder „verworfen“ wird, richtet sich nach oberflächlichem Lesen nach der Beeinträchtigung der Mutter. De facto aber ist einzig und alleine das Ergebnis der genetischen Untersuchung entscheidend, denn warum sonst sollte sich ein Ehepaar dem Stress der künstlichen Befruchtung unterziehen, wenn das Ergebnis der Untersuchung für die Entscheidung der Implantation unerheblich wäre? Herabsetzung der Tötungsschwelle: Im Vorwort des Entwurfes ist es eindeutig beschrieben: „Die PGD kann allerdings im Einzelfall die spätere Pränataldiagnostik ersetzen und damit zu einer Konfliktreduzierung beitragen, weil sie Entscheidungen über einen eventuellen Abbruch einer fortgeschrittenen Schwangerschaft vermeidet.“ Mit anderen Worten: Ein totipotentes Acht-ZellStadium „verwirft“ man – mit weniger Bedenken –, bei einem Schwangerschaftsabbruch im dritten bis fünften Monat ist der Tod des sich entwickelnden Menschen greifbarer und führt sicherlich zu stärkeren Konflikten. Der Mechanismus der Konfliktreduktion durch Herabsetzung der Tötungsschwelle ist ein Mechanismus, der uns aus der Zeit des Nationalsozialismus gut bekannt ist und Werteänderungen nach sich zieht, die im Nationalsozialismus zur Vergasung Tausender behinderter Menschen geführt hat. Eigeninteresse der Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirates: Die Mitglieder des Beirates sind auch Forscher, die eigene Interessen an der Aufweichung von Forschungsgrenzen haben, die eventuell auch weitergehende eigene Forschungsvorhaben entwickeln. Wer sagt uns denn, ob nicht nach Durchsetzung der PGD der nächste Schritt die genetischen Reparationsversuche an den „kranken“ befruchteten Eizellen sein werden? Natürlich wieder zum Wohle des sich entwickelnden Menschen, den man dann nach „Reparatur“ ja doch implantieren könnte? Wer will denn letztlich verhindern, dass an den „verworfenen“ Zellen weitere Versuche gemacht werden? Das Interesse von Wissenschaftlern und deren Wunsch nach Anerkennung ist viel zu groß, als dass von dieser Seite eigene Sanktionen gegen Missbrauch greifen könnten. Die Zusammensetzung der Ethikkommissionen, die Beratung und Aufklärung: Die Beratung und Aufklärung unterliegt laut Entwurf dem Humangenetiker und dem Gynäkologen (die ausschließlich männliche Form ist auch so im Entwurf enthalten). Wie immer sind nicht-ärztliche Gruppen in den Regelberatungen nicht vorgesehen, sondern können zusätzlich angeboten werden. Dabei gilt festzuhalten, dass auf sozialpsychologischer Ebene – auf der zunächst der Konflikt überhaupt besteht – Mediziner/innen nach Aus- und Weiterbildung über keinerlei besondere Kompetenz verfügen, eine Beratung adäquat durchführen zu können. Das Gleiche gilt für die Zusammensetzung der Ethik-Kommissionen. Wir alle sind gefordert, der Aufweichung des Embryonenschutzgesetzes und dem Aufbau weiterer selektionierender Maßnahmen entgegenzutreten. Wer glaubt, durch Nichteinmischung der Verantwortung für ethische Fragen entgehen zu können, der irrt. Cornelia Femers Kühlenberg 20 58644 Iserlohn Erklärung Aus jahrzehntelanger weit überwiegend positiver Erfahrung als Patient und als jahrzehntelanger berufspolitischer Wegbegleiter der deutschen Ärzteschaft fühle ich mich zu einer Erklärung verpflichtet: Ich stimme der Stellungnahme von Joachim Kardinal Meisner voll inhaltlich zu. Dazu darf ich bemerken, dass ich der lutherischen Kirche angehöre, ohne mich wirklich als Christ bezeichnen zu können. Ich muss mich heute fragen, ob ich bei der damaligen Diskussion zur künstlichen Insemination meine grundsätzliche Ablehnung deutlich genug in den Gremien der Bundesärztekammer vertreten habe. Nach meinen Aufzeichnungen wäre die erste Stellungnahme anlässlich der Vorbereitungen und der Durchführung des 62.Deutschen Ärztetages 1959 in Lübeck fällig gewesen. Der Deutsche Ärztetag hielt damals eine homologe intrauterine künstliche Insemination in besonderen Ausnahmefällen mehrheitlich für ethisch vertretbar. Der 73. Deutsche Ärztetag 1970 in Stuttgart erhob dann mehrheitlich keine generellen Einwände mehr. Er bezeichnete diese nicht mehr als standeswidrig, aber empfahl sie auch nicht ausdrücklich. Ich entsinne mich sehr deutlich, dass ich damals bereits der Auffassung war, hier verletze der Mensch unter Missbrauch des naturwissenschaftlich-technischen Fortschritts eine ihm von der Natur selbst errichtete Grenze, einen kategorischen Imperativ des menschlichen Seins. Ich entsinne mich dieser meiner damaligen Auffassung um so deutlicher, als ebenfalls in die Siebzigerjahre eine lebhafte Diskussion zum Thema „Sterbehilfe als Lebenshilfe“ fällt, in der ich mich eindeutig gegen die Straffreiheit auch von „passiver“ Sterbehilfe ausgesprochen habe. Das geschah mit dem Hinweis, dass der Mensch gegebenenfalls, seinem Gewissen folgend, auch gegen geltendes Strafrecht handeln müsse. Er könne dann lediglich auf einen einsichtigen Richter hoffen, der wohl wissen sollte, dass als unverzichtbarer Bestandteil jeder sittlichen Rechtsordnung auch Gnade zu gelten habe. Prof. Dr. h. c. J. F. Volrad Deneke Axenfeldstraße 16 53177 Bonn Armutszeugnis Scham und Mitleid erfüllen einen, wenn man liest, was die Herren Hoppe und Sewing sowie die Arbeitsgruppe „Präimplantationsdiagnostik“ der Bundesärztekammer unter ihrem „Beitrag zur Schärfung des Problembewusstseins“ zur Präimplantationsdiagnostik verstehen. Mitnichten wird hier irgendeine ethische Problematik angeschnitten. Der vorgelegte „Diskussionsentwurf“ ist indes ein bloßes Abwicklungspapier, welches die genaueren Modalitäten der Präimplantationsdiagnostik festzulegen versucht. Besonders wertvoll erscheint mir dabei die Erkenntnis, dass „kein Arzt gegen sein Gewissen verpflichtet werden kann, an einer Präimplantationsdiagnostik mitzuwirken“, oder aber die Feststellung, dass die involvierten Ärzte über entsprechende Kenntnisse und Erfahrung verfügen müssen. Hierüber besteht in der Tat ein ganz erheblicher Diskussionsbedarf. Der Umstand, dass in den einleitenden Worten eine Präjudiz explizit ausgeschlossen wird, täuscht den intelligenten 23 D O K U M E N T A T I O N Leser und Herrn Kardinal Meisner nicht darüber hinweg, dass selbstverständlich ein Ergebnis vorweggenommen wird. Indem nämlich darüber lamentiert wird, unter welchen organisatorischen Rahmenbedingungen die bereits bejahte Präimplantationsdiagnostik letztendlich vorgenommen werden soll. Mit Spannung erwarte ich den „Diskussionsentwurf“, der sich damit beschäftigen wird, unter welchen Kautelen dann schließlich die Unterscheidung zwischen „krank“ und „gesund“ getroffen wird und welches Antragsverfahren für die nachfolgende Elimination des „Kranken“ erforderlich ist. Der „Diskussionsentwurf“ ist ein bemerkenswertes Armutszeugnis der deutschen Ärzteschaft und trägt nichts zu der inhaltlichen, das heißt sittlichen Auseinandersetzung mit der beschriebenen Problematik bei.Vielmehr scheint die Chance vertan, aus ärztlicher Sicht gerade im Hinblick auf den rasanten Zuwachs an diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten auf die sehr umfangreichen ethischen Folgeprobleme hinzuweisen. Dass ein Theologe uns auf die immer schwierigeren Grenzen zwischen medizinisch Machbarem und sittlich Zulässigem hinweisen muss, ist bitter. Man darf es getrost als eine Zumutung bezeichnen, auf welchem Niveau Thema verfehlt Zu der Stellungnahme von Kardinal Meisner ...gibt es nur einen Kommentar: Thema verfehlt. Dr. Konrad Ringleb Brunnenstraße 97, 99974 Mühlhausen Ausweg: Adoption Im Vorwort zum Diskussionsentwurf der BÄK-Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik steht, dass die damit verbundenen ethischen Konflikte nur dann zu vermeiden sind, wenn „betroffene Paare bewusst auf Kinder verzichten oder sich zu einer Adoption entschließen“. Jedoch würden diese Alternativen von Paaren mit hohen genetischen Risikofaktoren „häufig nicht akzeptiert“. Aus früherer andrologischer Praxis wohl bekannt sind mir viele Vorbehalte gegen eine Adoption, die bei spermatologisch gesicherter Infertilität zur Erfül- 24 sich Kardinal Meisner mit den deutschen Ärzten beziehungsweise ihren repräsentativen Gremien verständigen muss. Dass er hierbei einen direkten Vergleich zum ärztlichen Mitwirken an der historischen „Verhütung erbkranken Nachwuchses“ heranzieht, ist völlig zutreffend und legitim. So wie damals Ärzte es waren, die ihr Wissen in den Dienst einer verwerflichen Weltanschauung stellten, ist es auch heute wieder unser Berufsstand, der eine vermeintlich ethische Pragmatik zur Verfügung stellt, um ein im Grunde unethisches Vorgehen zu ermöglichen. Heute wie damals wird sich unser Stand jedoch letztlich nicht seiner Verantwortung entziehen können. Unter diesen Umständen ist zu überlegen, inwieweit Stellungnahmen und so genannte Diskussionsentwürfe der Bundesärztekammer zu derlei Dingen überhaupt noch sinnvoll sind. Zur „Schärfung des Problembewusstseins im gesamtgesellschaftlichen Meinungsbildungsprozess“ tragen sie jedenfalls sicherlich nicht bei. Dr. med. Karl-Anton Kreuzer Abteilung für Innere Medizin Medizinische Fakultät Charité der Humboldt-Universität zu Berlin, Campus Virchow-Klinikum Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin ters – und die Chance der freien Wahl eines Wunschkindes unter verschiedenen Kleinkindern (nur zu Kleinkindern wurde geraten) im Waisenhaus klar gemacht wird. Dies und nicht zuletzt die mit der Adoption gegebene „Gleichberechtigung“ hinsichtlich der Rechte und Pflichten zur Erziehung und Förderung des Kindes lässt die Adoption dann in neuem Licht erscheinen, nicht mehr als bloßen Notbehelf. Selbstverständlich setzt eine Beratung, die auch das Selbstvertrauen und die (durch die Wartefrist oft belastete) Frustrationstoleranz des Paares stützen soll, ein taktvoll-hilfsbereites Verhalten der Behördenpersonen voraus, um präsumptive Adoptiveltern nicht zu verunsichern. Möglicherweise beruht die geringe Akzeptanz des Adoptionsangebots auf mehreren Gründen. Zu geringes ärztliches Interesse an einer „nur“ sozio-therapeutischen (aber oft glücklichen) – statt einer instrumentell machbaren – Erfüllung des Kinderwunsches, unpersönlicher Formalismus bei Behörden, falsche Scham vor dem „Makel“ einer ungewollt kinderlosen Ehe usw. Hätten hier nicht die Jugendämter, die Kirchen und die „Medien“ eine wertvolle, gegenüber der uninformierten Öffentlichkeit viel zu lange vernachlässigte Aufgabe? Professor Dr. med. Otto P. Hornstein Danziger Straße 5, 91030 Uttenreuth lung des Kinderwunsches damals einzig offen stand (abgesehen von der ethisch und [Personenstands-]rechtlich absolut unzulässigen anonym-heterologen Insemination). Verständliche Ängste oder Vorurteile („Blamage“ für das Paar beziehungsweise den Mann, befürchtete Unterschiebung „minderwertiger“ Kinder durch die Gesundheitsämter u. a.) waren aber durch einfühlsame Aufklärung des Paares zu mildern oder zu entkräften. Auch heute noch könnte sachkundige Adoptionsberatung viel erreichen, wenn zum Beispiel auch die langwierige, oft als Zumutung empfundene Gründlichkeit der für beide Seiten – Adoptiveltern und Kind – gleichermaßen verantwortlichen Behörden erläutert wird, andererseits dem Paar die Minimierung von Risiken – Ausschluss erbkranker oder erkennbar belasteter Kinder durch pädiatrische Voruntersuchung, gesundheitsamtliche Überprüfung des sozialen Milieus und der Gesundheit der Mutter sowie (nach Möglichkeit) des Va- Dank an Kardinal Meisner . . . Die ethische Verrohung geht einher mit marktförderlichem Mechanismus. Der Utilitarismus eines Herrn Lenin lässt grüßen, ebenso der Sozialdarwinismus aller Schattierungen. Die Bundesärztekammer sollte im Wissen um das üble Erbe der Reichsärztekammer konsequente Hüterin des Lebens sein! Will man in 50 Jahren wieder behaupten, die katholische Kirche hätte zu leise gewarnt? Wer das 20. Jahrhundert unter Marktaspekten gleich Ideologieaspekten betrachtet, kommt zu der Feststellung,dass insbesondere die katholische Kirche ein Markthemmungsfaktor ist, den das 20. Jahrhundert erfolgreich beseitigt hat. Dem Deutschen Ärzteblatt ist für die Veröffentlichung der Stellungnahme von Kardinal Meisner außerordentlich zu danken. Dr. med. Stephan Kunze Friedrich-Hegel-Straße 31, 01187 Dresden D O K U M E N T A T I O N Heft 17, 28. April 2000 Wissenschaftlicher Beirat der Bundesärztekammer Von richtigen rechtlichen Voraussetzungen ausgehen Zur rechtlichen Bewertung der Präimplantationsdiagnostik D er vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer vorgelegte „Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik“ hat unterschiedliche Resonanz in der Öffentlichkeit gefunden. Dabei ist immer wieder die Frage nach der Vereinbarkeit der Präimplantationsdiagnostik mit dem Embryonenschutzgesetz aufgeworfen worden, so auch von Riedel (DÄ Heft 10/2000), die feststellt, die Präimplantationsdiagnostik stehe im Widerspruch zum Embryonenschutzgesetz. Es überrascht, wie apodiktisch und vehement zugleich Riedel zur Einleitung ihres Plädoyers für eine unvoreingenommene Debatte behauptet, eine Zulassung der Präimplantationsdiagnostik sei mit dem Embryonenschutzgesetz (EschG) nicht vereinbar, ohne dass eine nähere Auseinandersetzung mit dem Gesetzestext stattgefunden hat. Ihrem Beitrag, in dem sie die durchaus nachvollziehbare Forderung einer gesetzlichen Regelung erhebt, stellt Riedel die These voran, die Präimplantationsdiagnostik stehe im Widerspruch zum ESchG. Diesem zufolge, so heißt es, dürfe eine Eizelle nur zum Zweck der Herbeiführung einer Schwangerschaft bei der Frau, von der die Eizelle stammt, künstlich befruchtet werden;ein Embryo dürfe auch nur zu diesem Zweck weiterentwickelt und ein extrakorporal erzeugter Embryo dürfe zu keinem anderen Zweck als zu seiner Erhaltung verwendet werden, siehe § 1 l Nr. 2, § 2 l und II ESchG. Ziel der Regelung der künstlichen Befruchtung im ESchG sei die Behandlung von Fertilitätsstörungen, also die Erfüllung des Kinderwunsches einer Frau oder eines Paares. Dieses von Riedel so betonte Ziel wird im ESchG jedoch gerade nicht ausdrücklich benannt. Riedels Aussagen zeigen vielmehr, dass hier der Wunsch des Bestehens eines Verbotes Mutter der Argumentation ist, mehr jedoch nicht. Ein allgemeines Verbot der Präimplantationsdiagnostik könnte sich aus § 1 l Nr. 2 ESchG herleiten. Dort heißt es, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe werde bestraft, wer es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich zu befruchten, als eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt. Wenn ein Arzt im Rahmen einer Invitro-Fertilisation (IVF) eine Eizelle befruchtet und diese durch Entnahme einer nicht mehr totipotenten Zelle auf bestimmte genetische Defekte untersucht, um je nach Befund den Embryo zu transferieren oder nicht, ist fraglich, ob der Arzt die Eizelle gemäß § 1 l Nr. 2 EschG – wie Riedel behauptet – zu einem anderen Zweck künstlich befruchtet, als die Schwangerschaft einer Frau herbeizuführen – nämlich vielmehr, um eine „Selektionsmöglichkeit“ zu eröffnen. Tatbestandslos handelt, wer mit der Absicht handelt, eine Schwangerschaft herbeizuführen. Riedel scheint der Ansicht zu sein, dass eine solche Absicht bei der Präimplantationsdiagnostik zum Zeitpunkt der Befruchtung noch nicht besteht. Diese Auffassung wird den tatsächlichen Gegebenheiten jedoch nicht gerecht, da sie eine künstliche Aufteilung eines einheitlichen Vorganges vornimmt. Die Betroffenen handeln von Beginn der IVF mit dem Bewusstsein, dass die gesamte Behandlung auf Herbeiführung einer Schwangerschaft ausgerichtet ist. Dass die Schwangerschaft noch von einer Bedingung abhängig gemacht wird, stellt dabei ein separat zu behandelndes Problem dar. So ist die Frage, ob die Absicht deshalb verneint werden könnte, weil ein später vorzunehmender Teilakt noch von einer weiteren Bedingung, das heißt der Entscheidung der Mutter zum Transfer, abhängig gemacht werden soll. Die Absicht wird allein nach der voluntativen Beziehung zwischen Täterpsyche und Taterfolg definiert. Bewusst herbeigeführte und erwünschte Erfolge sind immer beabsichtigt, auch wenn ihr Eintritt nicht sicher ist (Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, Band l, 3. Auflage, § 12 Rdnr. 11; Cramer in: Schönke/Schröder, 25. Auflage, § 15 Rdnr. 67, m. w. N.). Das Abhängigmachen der Vornahme eines zukünftig vorzunehmenden Teilaktes von einem Bedingungsschritt, hier der Annahme zur Übertragung eines Embryos auf die Mutter, schließt die Absicht, eine Schwangerschaft herbeizuführen, gerade nicht aus. Eine Strafbarkeit nach § 1 l Nr. 2 ESchG kann daher nicht bejaht werden, wenn die Fertilisation erfolgt. Dieses Ergebnis ist naheliegend, bedenkt man, dass auch bei der Vornahme einer regulären IVF ohne Präimplantationsdiagnostik der Arzt den anschließenden Embryotransfer stets von der Bedingung abhängig macht, dass sich die Patientin auch später noch bereit erklärt, diesen vornehmen zu lassen (hierzu und im Folgenden demnächst Schneider in MedR 2000. Auf dem Weg zur Selektion – Strafrechtliche Aspekte der Präimplantationsdiagnostik). Weiterer Anknüpfungspunkt für eine mögliche Strafbarkeit nach § 1 l Nr. 2 ESchG kann sein, die „Ausschließlichkeit“ der Zweckverfolgung in Zweifel zu ziehen. Die Frage ist, ob nur derjenige tatbestandslos handelt, der die Eizelle ausschließlich deshalb künstlich befruchtet, um eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der der Embryo stammt, oder ob der Täter auch einen anderen Nebenzweck mit der künstlichen Befruchtung verfolgen kann, ohne tatbestandsmäßig zu handeln. Aus dem Gesetzestext geht nicht hervor, dass die Absicht der Herbeiführung einer Schwangerschaft durch die gleichzeitige absichtliche Verfolgung eines anderen Zweckes – nämlich zuvor die genetische Struktur des Embryos zu prüfen – ausgeschlossen ist. Dieses Ergebnis ließe sich nur im Wege unzulässiger erweiternder Interpretation oder Analogie gewinnen. Die äußerste Auslegungsgrenze markiert jedoch nach der Rechtsprechung des BVerfG (BVerfGE 73, 25 D O K U M E N T A T I O N 206 [234 ff.]; 92, 1 [12]) und vorherrschender Ansicht im Schrifttum (Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Auflage, S. 323 m. w. N.) der mögliche Wortsinn eines gesetzlichen Begriffs. Im Strafrecht gilt ferner das Verbot der strafbarkeitsbegründenden oder -schärfenden Analogie (Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band l, 3. Auflage, § 5 Rdnr. 26 ff., m. w. N.). Art. 103 II GG macht die Strafbarkeit einer Tat von einer gesetzlichen Regelung abhängig und verbietet eine Ausdehnung der Strafbarkeit über den Gesetzeswortlaut hinaus auf ähnlich strafbedürftig und strafwürdig erscheinende Verhaltenweisen. Diese engen Grenzen verkennt Riedel. Für die Annahme einer „Ausschließlichkeit“ des verfolgten Zwecks im Sinne des Verbotes eines Nebenzwecks sind im Gesetz keine Anhaltspunkte ersichtlich. Von Riedel wird ferner der mit „Missbräuchliche Verwendung“ überschriebene § 2 l EschG als Argument für ein Verbot genannt. Dort heißt es, dass derjenige, der einen extrakorporal erzeugten [. . .] menschlichen Embryo [. . .] zu einem nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck [. . .] verwende, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werde. Fraglich ist, ob es eine „missbräuchliche Verwendung“ darstellt, den Embryo nach erfolgter Biopsie und der Feststellung von bestimmten genetischen Defekten nicht zu transferieren, sondern in der Petrischale liegen zu lassen, bis er sich nicht weiterentwickeln kann und daraufhin abstirbt. Dies setzt zunächst voraus, dass die „Verwendung“ im Sinne von § 2 l EschG auch durch Unterlassen begehbar ist (andere Auffassung Günther, in: Keller/ Günther/Kaiser, § 2 Rn. 34). Unterstellt man dies, ist im Falle der Vornahme eine Präimplantationsdiagnostik – welche im Einverständnis und auf Bitten des betroffenen Ehepaares durchgeführt wird – § 2 l ESchG in Form des Unterlassens deshalb nicht einschlägig, weil dem Arzt die Einsetzung der „selektierten“ Eizelle entweder gar nicht möglich ist oder es ihm nicht zuzumuten wäre, gegen den Willen der Patientin und entgegen dem Ziel der Behandlung die Eizelle dennoch 26 – etwa unter Täuschung der Patientin – zu transferieren. Im Fall der Präimplantationsdiagnostik ist die Erfüllung des Tatbestandes von § 2 l ESchG durch Nichtübertragung des Embryos, sondern Liegenlassen, wenn die Patientin einen Transfer der belasteten Zelle ablehnt, nicht strafbar. Ein Verstoß gegen § 2 l ESchG wäre ferner denkbar, wenn man in der Entnahme und Untersuchung einer Zelle eine Verwendung des Embryos sehen würde, die einem nicht seiner Erhaltung dienenden Zwecke gewidmet ist, das heißt mit anderen Worten, wenn man argumentiert, „das Untersuchen“ diene nicht der Erhaltung und würde somit eine missbräuchliche Verwendung darstellen. Entnimmt der Arzt dem Embryo eine Zelle und beeinträchtigt das die späteren Weiterentwicklungschancen nicht, insofern als der Embryo noch mit den regulären Erfolgsaussichten auf Herbeiführung einer Schwangerschaft in den Mutterleib übertragen werden kann, ist die Behandlung als „neutrale Handlung“ zu werten. Die Untersuchung ist zwar nicht notwendig für die Erhaltung, zugleich beeinträchtigt sie eine solche Erhaltung auch nicht. Schon der objektive Tatbestand scheint nicht erfüllt zu sein. § 2 l ESchG verlangt jedoch weiter als spezielles subjektives Tatbestandsmerkmal die Absicht des Täters, einen nicht der Erhaltung des Embryos dienenden Zweck zu verfolgen. Eine solche Absicht in Form zielgerichteten Wollens ist jedoch nicht gegeben. Es kommt dem Arzt nicht darauf an, mit der Handlung einen Zweck zu verfolgen, der nicht der Erhaltung des Embryos dient. Ein Verstoß gegen § 2 l ESchG ist daher auch durch die Untersuchung nicht gegeben. Was den § 2 II ESchG betrifft, in dem es heißt:„Ebenso wird bestraft,wer zu einem anderen Zweck als der Herbeiführung einer Schwangerschaft bewirkt,dass sich ein menschlicher Embryo extrakorporal weiterentwickelt“, so muss auch hier auf das Erfordernis der Absicht, das heißt des dolus directus ersten Grades, hingewiesen werden. Ein solches zielgerichtetes Wollen ist nicht gegeben. Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass der Ausgangspunkt Riedels, die Präimplantationsdiagnostik stehe im Widerspruch zum ESchG, nicht richtig ist. Welche Konsequenz die fehlende Regelung der Präimplantationsdiagnostik in Zukunft haben wird und ob der Gesetzgeber sie regeln sollte, ist damit jedoch noch keineswegs geklärt. Den Autoren des Diskussionsentwurfs eine einseitige Fehlinterpretation des Embryonenschutzgesetzes und eine schon deshalb falsche Position zur Präimplantationsdiagnostik vorzuwerfen, ist verfehlt. Der Entwurf dient gerade dazu, die öffentliche Diskussion anzuregen. Die in ihm vertretene Position ist rechtlich jedenfalls möglich. Man sollte bei der Beurteilung von richtigen rechtlichen Voraussetzungen ausgehen. Prof. Dr. Dr. med. h. c. H.-L. Schreiber Direktor des Juristischen Seminars Postfach 37 44 37027 Göttingen D O K U M E N T A T I O N Heft 17, 28. April 2000 Präimplantationsdiagnostik als Verantwortung Dass die Fortpflanzungsmedizin ein problem- und konfliktbeladenes Feld ärztlicher Tätigkeit darstellt, ist unverkennbar. So war es nahezu unvermeidbar, dass sich der Wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer dieses schwierigen Terrains angenommen hat, um den Stand der Wissenschaft in ein berufsrechtliches Regelwerk oder Vorschläge dazu einzubetten. Die „Richtlinien zur Durchführung der assistierten Reproduktion“ (1998), die „Richtlinien zur pränatalen Diagnostik von Krankheiten und Krankheitsdispositionen“ (1998), die „Erklärung zum Schwangerschaftsabbruch nach Pränataldiagnostik“ (1998) sind als Niederschlag dieser Bemühungen zu verstehen. In den „Richtlinien zur Pränataldiagnostik von Krankheiten und Krankheitsdispositionen“ wurde der Komplex Präimplantationsdiagnostik ausgeklammert, da klar geworden war, dass diese wegen der Sensibilität des Themas eines eigenständigen Papiers bedurfte. Die intensive Bearbeitung durch einen multidisziplinär – in seinen Anschauungen keinesfalls uniform – besetzten Arbeitskreis hat ihren Niederschlag gefunden in der vom Wissenschaftlichen Beirat einstimmig gebilligten Form eines „Entwurfs für eine Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik“. Der Wissenschaftliche Beirat ist ein Beratungsgremium der Bundesärztekammer. Dem Vorstand der Bundesärztekammer steht es frei, wie er Vorschläge des Wissenschaftlichen Beirats umsetzt. Von diesem Recht hat der Vorstand der Bundesärztekammer Gebrauch gemacht und die Vorlage des Wissenschaftlichen Beirats ohne textliche oder inhaltliche Änderungen als „Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik“ zustimmend zur Kenntnis genommen und zur Veröffentlichung freigegeben. Erklärte Absicht sowohl des Wissenschaftlichen Beirats als auch des Vorstands der Bundesärztekammer war es, einen „Diskurs mit den gesellschaftlichen Gruppen“ (nicht gegen sie!) im Sinne eines „offenen und sachlichen, gleichwohl kritischen Dialog“(s) zu führen. Der Wissenschaftliche Beirat hat sich in einem ausführlichen Vorwort mit den Problemen der Präimplantationsdiagnostik auseinander gesetzt und die Konfliktfelder offen benannt. Bei der Gestaltung des Richtlinienentwurfs war der Wissenschaftliche Beirat getragen von dem Bemühen, einerseits dem Schutz des ungeborenen Lebens, andererseits aber auch gezielt Paaren gerecht zu werden, die „an der Furcht vor einem genetisch bedingt schwerstkranken Kind gesundheitlich zu zerbrechen drohen“. Der verständliche Wunsch nach einem gesunden Kind ist eine sittliche Norm und kann aus der Diskussion nicht dadurch ausgeblendet werden, dass in der Gesellschaft eine Erwartungshaltung für gesunde Kinder als Gefahr gebrandmarkt wird. Einem Dammbruch im Sinne einer Öffnung der Präimplantationsdiagnostik für nicht ausschließlich der Erkennung einer bekannten, schwerwiegenden, unbehandelbaren, genetisch bedingten Erkrankung dienende Indikationen kann und muss man am ehesten dadurch begegnen, dass man von einem schematisierten Indikationskatalog Abstand nimmt zugunsten einer verantwortungsbewussten Einzelfallbegutachtung, die durch Einschaltung von zwei hierarchisch nacheinander angeordneten Kommissionen untermauert wird. Es geht an der Sache völlig vorbei und verlässt den Boden eines an wissenschaftlichen Maximen orientierten Meinungsaustauschs, wenn der Eindruck erweckt wird,aus gutem Grund geschlossene Schleusen gegenüber nationalsozialistischen Gräueltaten seien durch den Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer wieder geöffnet worden und wenn die Präimplantationsdiagnostik in die gedankliche Nähe einer Eugenik nationalsozialistischer Prägung gerückt wird. Letztere stellt den Vollzug eines von einem verbrecherischen Regime staatlich verordneten und praktizier- ten Rassenwahns dar, der vor zwangsweisen Sterilisationen,Tötungen und anderen Gräueltaten nicht zurückschreckte. Das Begehren nach einer Präimplantationsdiagnostik wird demgegenüber freiwillig und aus eigenem Antrieb von einem einzelnen Paar aus einer berechtigten individuellen Sorge heraus an einen Arzt herangetragen, was einen intensiven Beratungs- und Zustimmungsprozess in Gang setzt, bevor ein Präimplantationsdiagnostik-Verfahren überhaupt aktiv eingeleitet werden könnte. Zentrales rechtliches Thema ist die Frage nach der Vereinbarkeit der Präimplantationsdiagnostik mit dem Embryonenschutzgesetz.Anders als das Bundesministerium für Gesundheit sind sowohl die Bioethik-Kommission des Landes Rheinland-Pfalz unter dem Vorsitz des (verstorbenen) Justizministers Peter Caesar als auch der Wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer nach eingehender rechtlicher Prüfung zu dem Ergebnis gelangt, dass die Präimplantationsdiagnostik nicht mit dem Embryonenschutzgesetz kollidiert (siehe dazu Schreibers vorangehenden Beitrag). Begründet wird diese Einschätzung dadurch, dass – in Übereinstimmung mit dem Embryonenschutzgesetz – das erklärte und einzige Ziel einer In-vitroFertilisation als Voraussetzung einer Präimplantationsdiagnostik die Herbeiführung einer Schwangerschaft ist. Erst wenn nach einer Präimplantationsdiagnostik „ein hohes Risiko für eine bekannte und schwerwiegende, genetisch bedingte Erkrankung“ der Nachkommen erkennbar wird, stellt sich für die betroffenen Paare die Frage nach dem Transfer aller zum Zwecke der Herbeiführung einer Schwangerschaft befruchteten Eizellen. Die BioethikKommission Rheinland-Pfalz mahnt zwar an, dass „die Grundvoraussetzungen der Präimplantationsdiagnostik als wesentlich für die Grundrechte gesetzlich geregelt werden“ (müssen). Sie stellt aber die Legalität der Präimplantationsdiagnostik damit nicht grundsätzlich infrage, sondern sagt vielmehr: „Damit dem (gesetzliche Regelung der Grundrechte, Verfasser) Rechnung getragen wird, sollen folgende Voraussetzungen gelten: 27 D O K U M E N T A T I O N > hohes genetisches Risiko (als normativer Begriff ohne Festlegung eines Katalogs bestimmter Erkrankungen) > Beratung eines Paares über Chancen, Risiken und Alternativen durch den Arzt > Einwilligung des Paares. Die darüber hinausgehenden Modalitäten und Details sollen in Richtlinien der Bundesärztekammer festgelegt werden, um sie den jeweiligen medizini- schen Entwicklungen angemessen anpassen zu können.“ Der Vergleich des Diskussionsentwurfs der Bundesärztekammer mit diesen Desideraten sollte eigentlich erkennen lassen, dass der Vorschlag der Bundesärztekammer eine gesetzliche Regelung nicht präjudiziert, sondern vielmehr geeignet ist, eine angemessene gesetzliche Rahmenregelung inhaltlich auszufüllen. Wenn allerdings kategorisch festgestellt wird, die Präim- plantationsdiagnostik stehe im Widerspruch zum Embryonenschutzgesetz, dann ist die von der Bundesärztekammer angestrebte unvoreingenommene offene Debatte zumindest erheblich erschwert, wenn nicht gar unmöglich. Der Vorstand des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer Herbert-Lewin-Straße 1, 50931 Köln Korrespondenzadresse: Prof. Dr. med. K.-Fr. Sewing Berliner Allee 20 (Ärztehaus), 30175 Hannover Heft 18, 5. Mai 2000 Schöne Neue Welt Muss man alles machen, was man kann? Fortschritt allein genügt nicht, es kommt auch auf die Richtung an. D ie Wissenschaft bewegt sich mit gewaltigen Schritten voran, natürlich nur nach vorne . . .? Wer hätte vor einigen Jahrzehnten von Gentherapie, Klonierung oder Präimplantationsdiagnostik (PGD = preimplantation genetic diagnosis) zu träumen gewagt? Doch, diese Träumer gab es. Es lohnt einmal wieder, Aldous Huxleys „Schöne Neue Welt“ aus dem Bücherschrank zu nehmen. Eine Gruselfiktion der Zwanzigerjahre, visionär aus heutiger Sicht. Die Klonierung ist dort Routine, als „Bokanowsky-Verfahren“ standardisiert und gesellschaftlich (angeblich) akzeptiert. Einen Schönheitsfehler hat das Ganze natürlich; anders als in der heutigen Realität verliert der Organismus beim Klonieren Kompetenz. Das Ideal also ist der ungeklonte Mensch, der, der nicht dem „Bokanowsky-Verfahren“ unterzogen wurde und seine Individualität erhalten durfte. Je mehr Klon-Kopien es gibt, desto niedriger die soziale und intellektuelle Intelligenz der Individuen – so weit Huxley. Dahinter steht eine intellektuelle Attitüde, die der Individualität und dem Unterschied Raum lässt. Nicht die unterschiedslose Schönheit ist wahrhaft schön, sondern Schönheit kann man erst an der Bandbreite von hässlich bis 28 göttlich wirklich ermessen. Von diesem Ideal entfernen wir uns zusehends. Uniformität ist gefragt, Krankheit anstößig und absondernd; nicht die Bandbreite menschlicher Individualität, sondern ihre Konformität mit gesellschaftlichen Normen soll mit Technikeinsatz erzeugt werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist der „Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik“, den der Vorstand der Bundesärztekammer (BÄK) unlängst vorgelegt hat. Nun wäre es sicher unfair, der BÄK vorzuwerfen, sie fördere an dieser Stelle den Technikeinsatz in der Medizin. Das tut sie nicht – sie reagiert lediglich auf wissenschaftliche Entwicklungen und versucht sie in ethische Dimensionen vor dem Hintergrund rasanter gesellschaftlicher Veränderungen zu stellen. Der Antrieb, der Impuls kommt von woanders – aus Forschertrieb, aus der Überlegung, kranken Menschen helfen zu wollen, aus Zukunftsgläubigkeit und auch aus materiellen Interessen. Das Embryonenschutzgesetz verbietet die Präimplantationsdiagnostik; die Manipulation an totipotenten Zellen ist verboten. Zusätzlich ist es nicht zulässig, erzeugte Embryonen nicht zu übertragen, also zu verwerfen. Eine groteske Ironie wäre es also, in der PGD als „krank“ erkannte Embryonen gleichwohl übertragen zu müssen. Bei wenigen erbgebundenen Krankheitsbildern könnte PGD helfen. Notwendig wäre eine Änderung des Embryonenschutzgesetzes. Der Diskussionsentwurf schlägt darüber hinaus „Ethikkommissionen“ der Selbstverwaltung vor, die Genehmigungen zur PGD erteilen. Forschertrieb und Technikgläubigkeit Seit einiger Zeit versucht die Wissenschaft, den Zeitraum der Totipotenz von Zellen für kürzer und kürzer zu erklären. Forschergruppen behaupten, schon ab dem 4-Zell-Stadium sei eine Totipotenz nicht mehr sicher. Zugleich gewinnt die moderne Fortpflanzungsmedizin immer mehr Spielräume zum erfolgreichen Übertragen von Embryonen, ein Fenster tut sich auf, die Zellen sind (angeblich) nicht mehr totipotent, die Übertragung ist noch möglich. Altruistische Ideale Unter dem Eindruck der großen Trauer von Familien, die das Risiko genetischer Fehler in sich tragen und oftmals D O K U M E N T A T I O N schreckliche Leidensgeschichten von kranken oder sterbenden Kindern, späten Abtreibungen oder gar intrauterinen Fetoziden hinter sich haben, wollen Ärzte helfen und diesen Familien das Idealbild „gesunde Kinder“ erfüllen. Es handelt sich dabei um nur circa 100 Paare per annum bundesweit, bei denen unter dieser Indikation eine PGD infrage käme. Sie müssten, obwohl sie auf natürlichem Wege zeugungsfähig sind, eine im Reagenzglas erzeugte Schwangerschaft – mit allen Risiken – ertragen, nur um den Embryo einer PGD unterziehen zu können.Verkürzt gesagt: Die technischen Risiken der In-vitro-Fertilisation (IVF) und PGD stehen hier den menschlichen (und auch ethischen) Problemen einer späten Abtreibung entgegen. Wahrlich, eine Auswahl zwischen Beelzebub und Teufel! Auf die einfache Idee, den Paaren von weiteren Schwangerschaften abzuraten, kommt man offensichtlich nicht. Kinderwunsch ist ein alle Mittel heiligendes Ziel – auch das ist angesichts der Irrationalitäten unserer Welt eine groteske gesellschaftliche Entwicklung. Finanzielle Auswirkungen Und natürlich tut sich in der PGD ein gewaltiges ökonomisches Potenzial auf. IVF und PGD sind aufwendige und teure Verfahren; sie werden in anderen Ländern, wo sie zulässig sind, auch unter ökonomischen Aspekten sehr gewinnbringend angeboten. Ethischer Deichbruch! Würde der Diskussionentwurf zu einer Richtlinie zur PGD verabschiedet und Wirklichkeit, käme dies in meinen Augen einem ethischen Deichbruch gleich. Auch wenn ich sicher bin, dass die Autoren sich nur von den edelsten Motiven haben leiten lassen, so halte ich es doch für ausgeschlossen, die PGD auf die Paare begrenzen zu können, die erbgebundene Krankengeschichten vorweisen können. Vielmehr wird im Rahmen aller IVF-Maßnahmen die Frage gestellt werden müssen, inwieweit das Risiko der iatrogenen Übertragung „fehlerhafter“ Embryonen überhaupt vertretbar ist. Über kurz oder lang werden bei allen IVF-Maßnahmen PGDs nötig sein. Und: Wie verweigert ein Arzt Paaren die PGD im Rahmen einer IVF? Müssen diese Paare erst selbst eine „genetische Leidensgeschichte“ vorweisen, um in den „Genuss“ der gewünschten exakteren Diagnostik zu kommen? Wäre es nicht – unter denselben pseudoaltruistischen Maximen – unmenschlich, ihnen diese Diagnostik vorzuenthalten? Hier tut sich nicht nur ein gewaltiger Markt für Ärzte auf – hier entstehen auch gewaltige Risiken für unsere Gesetzliche Krankenversicherung – es wird auf Dauer nicht möglich sein, IVF zwar zu bezahlen, PGD aber nicht. Schließlich: Sie haben es alle gelesen, die Entschlüsselung des menschlichen Genoms steht kurz vor ihrer Vollendung. Damit aber liegt eine mindestens abstrakte Genkarte vor, in der Aberrationen, Variationen und Strickmusteranomalien des Menschen beschrieben sind. Wer glaubt, diese Karte prognostiziere mit hundertprozentiger Sicherheit erbgebundene Krankheiten, der irrt. Einige wenige Krankheiten und ihre Ausprägung sind heute schon erkennbar, ganz überwiegend aber vermögen wir zwar die „Strickmusterfehler“ der Natur zu erkennen, ihre Relevanz für das lebende Individuum aber nicht einzuordnen. Jeder von uns ist Träger solcher Anomalien – auch der Gesündeste! Der Grundgedanke der genetischen Selektion aber, dieses „Nichts-mehr-demSchicksal-überlassen-Wollen“, der dem gesamten Verfahren nun einmal innewohnt, wird zu einer natürlichen Ausmerzung aller Anomalien führen. Wir sind auf dem direkten Weg zum „qualitätsgesicherten Kind“. Welchem Arzt könnte man einen Vorwurf machen, wenn er Eltern eher zur Abtreibung (oder in unserem Fall zur Nichtübertragung des Embryos) raten wird, als sie zu bestärken, die Risiken im Vertrauen auf eine starke Natur in Kauf zu nehmen? Der Bundesgerichtshof hat uns in seiner Rechtsprechung klargemacht, dass fehlerhafte genetische Beratung schadensersatzpflichtig macht. Das kranke Kind wird zum „Schadensfall“ – nicht der bedauernswerten Eltern, sondern des Arztes! Fortpflanzungsmedizingesetz Der Diskussionentwurf der BÄK geht deswegen einen falschen Weg; in fehlgeleitetem Altruismus sprengt er ethische Dämme. Eine Begrenzung auf wenige Paare – wie vorgesehen – wird sich nicht durchhalten lassen. Ungewollt wird der genetischen Selektion die Tür geöffnet. Fortschrittsgläubigkeit macht blind vor den Risiken. Noch ist es an der Zeit gegenzusteuern. Deswegen hat der Vorstand der BÄK auch lediglich einen „Diskussionsentwurf“ vorgelegt. Am Ende der Diskussion kann also durchaus auch das Einstampfen des Papiers stehen. Die Bundesregierung plant, das Embryonenschutzgesetz im Lichte neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse zu überarbeiten. In einem Fortpflanzungsmedizingesetz müssten dann auch Fragen der IVF und der PGD geregelt werden. Ich plädiere für ein Verbot der Präimplantationsdiagnostik. Dr. med. Frank Ulrich Montgomery Präsident der Ärztekammer Hamburg Vorsitzender des Marburger Bundes 29 D O K U M E N T A T I O N Heft 18, 5. Mai 2000 Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie der Bundesärztekammer Präimplantationsdiagnostik – medizinische, ethische und rechtliche Aspekte Der von der Bundesärztekammer vorgelegte „Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik“, dokumentiert in Heft 9/2000, wurde von einem Arbeitskreis des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer ausgearbeitet. Dessen Vorsitzender, Prof. Dr. med. Hermann Hepp, Verfasser des nachfolgenden Artikels, hat Inhalt und Hintergründe des Richtlinienentwurfes vor dem Vorstand der Bundesärztekammer und später auch in einem BÄK-Presse-Seminar erläutert. Auf diese Ausführungen geht der Artikel zurück. Hermann Hepp 1. Definition und Methode Jede Schwangerenvorsorgeuntersuchung ist eine pränataldiagnostische Maßnahme. Pränataldiagnostik (PND) und/ oder -therapie definieren als pränatalmedizinische Verfahren die fötomaternale Medizin der Geburtshilfe. Die Präimplantationsdiagnostik ist im Gegensatz zur invasiven und noninvasiven Pränataldiagnostik nur im weiteren Sinne ein pränatalmedizinisches Verfahren, da die Diagnostik vor der Implantation des Embryos, das heißt vor Beginn der Schwangerschaft, ansetzt. Unter Präimplantationsdiagnostik versteht man die Diagnostik nach Invitro-Fertilisation (IVF) an einem Embryo vor dem intrauterinen EmbryoTransfer (ET). Anstelle der für den deutschen Sprachraum sich anbietenden Abkürzung PID wird das englische Kürzel PGD bevorzugt (englisch: preimplantation genetic diagnosis = PGD), da PID durch Pelvic inflammatory disease besetzt ist und der Hinweis auf „genetic“ in der Definition eine Eingrenzung des diagnostischen Verfahrens signalisiert. Im Übrigen ist PGD in der internationalen Wissenschaftssprache etabliert. Die PGD zur Aufklärung des genetischen Status des Embryos hat zur Vor- 30 aussetzung eine In-vitro-Fertilisation (IVF). Edwards, einer der „Väter“ der IVF, hatte bereits 1965 – lange vor der Geburt des ersten Kindes nach IVF (1978) – die Idee, aus Trophoblastzellen der Blastozyste über eine Geschlechtsbestimmung x-chromosomal gebundene Erkrankungen diagnostizieren zu können. Durch die Fortschritte der modernen Reproduktionsmedizin wurde diese Vision zur Wirklichkeit. Es entwickelten sich zwei Indikationsebenen: die Therapie der Sterilität und die Diagnostik am Embryo. Beide Verfahren – Diagnostik und Therapie – verfolgen unterschiedliche Ziele. Die IVF mit ET hat als Therapieverfahren zum Ziel, einem ungewollt kinderlosen Paar zu einer Empfängnis und einer erfolgreich verlaufenden Schwangerschaft zu verhelfen. Die PGD hat zum Ziel, ein mit hohen Risikofaktoren belastetes Paar nach einer „Zeugung auf Probe“ (in vitro) und der Diagnostik an einer entnommenen Blastomere im Falle eines pathologischen Befundes durch Selektion, das heißt durch Sterbenlassen des in Warteposition stehenden Embryos, vor einem kranken Kind zu bewahren. Der mittels IVF entstandene Embryo befindet sich drei Tage in einem Kulturmedium. Danach erfolgt die Biopsie von einer oder zwei Blastomeren, an denen die molekulargenetische Untersuchung mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) oder Fluoreszenzin-situ-Hybridisierung (FISH) vorgenommen wird. Bei der zur Diagnostik entnommenen Blastomere handelt es sich nach dem 8-Zell-Stadium nicht mehr um eine totipotente Zelle (Embryo). Die Diagnostik erfolgt demnach nicht an einem Embryo im Sinne einer einen Embryo verbrauchenden Diagnostik. Da das Ergebnis der Gendiagnostik nach etwa drei bis acht Stunden vorliegt, bedarf es keiner Kryokonservierung des in Warteposition befindlichen Embryos. Als eine Alternative zur PGD wird die Präkonzeptions- beziehungsweise Präfertilisationsdiagnostik, also die Untersuchung des Polkörpers der nicht fertilisierten Eizelle diskutiert. Sie lässt lediglich eine indirekte Aussage über den genetischen Status der Eizelle zu. Nur das mütterliche Genom ist beurteilbar. Problematisch scheint auch das Phänomen des Crossing-Over zu sein, bei dem sich sowohl im Polkörper als auch in der Eizelle selbst ein betroffenes Allel befinden kann (Ludwig et al., 1998). Von der erfolgreichen Anwendung einer PGD berichteten erstmals Handyside et al. (1990). Nach jetzigem D O K U M E N T A T I O N Kenntnisstand scheint das Verfahren in geübter Hand sowohl in der Durchführung wie auch in der Diagnostik sicher zu sein. Es ist in weltweit 29 Zentren, davon 10 in den USA, erprobt. Auch wenn die Zahl der an mehr als 400 Paaren durchgeführten PGD und der mehr als 100 geborenen Kinder nach PGD noch bei weitem für eine endgültige Aussage hinsichtlich der Risiken des Verfahrens selbst wie auch hinsichtlich der durch das Verfahren verursachten Fehlbildungsrate zu klein ist, so kann vorläufig doch konstatiert werden, dass die Schwangerschaftsrate nach PGD mit 26 Prozent derjenigen nach konventioneller IVF-Therapie entspricht (Ludwig und Diedrich, 1999). Eine Indikation zur PGD wird derzeit bei anamnestisch stark belasteten Paaren gesehen, für deren Nachkommen ein hohes Risiko für eine bekannte und schwerwiegende, genetisch bedingte Erkrankung besteht, zum Beispiel Muskeldystrophie Duchenne, FragilesX-Syndrom und andere. 2. Rechtliche und ethische Aspekte Es besteht Konsens, dass mit der PGD schwerwiegende rechtliche und ethische Probleme aufgeworfen werden. Die juristische Diskussion kreist um zwei Komplexe: 1. Besteht ein Wertungswiderspruch zwischen dem seit 1991 gültigen Embryonenschutzgesetz (ESchG) und dem 1995 erneut reformierten § 218 StGB? 2. Ist die PGD mit dem ESchG kompatibel? Die ethische Diskussion kreist, unabhängig von der rechtlichen Entscheidung, um den Konflikt, dass mittels IVF die Entwicklung menschlichen Lebens mit dem Ziel einer Schwangerschaft eingeleitet, der so gezeugte Embryo unter Umständen jedoch nicht in die Gebärmutter transferiert wird und so – nach einer Zeugung unter Vorbehalt – im Falle einer schweren, genetischen Erkrankung eine gezielte Selektion des Embryos erfolgt. Mit diesem ethischen Problemkreis in unmittelbarem Zusammenhang steht schließlich die Frage, ob die PGD lediglich eine zeitlich vorgezogene PND sei? Diese vier die PGD be- stimmenden Fragen sollen im Folgenden besprochen und vorläufigen Antworten zugeführt werden. 2.1 ESchG und reformierter § 218 StGB – ein Wertungswiderspruch? Von den Befürwortern der PGD wird auf den Wertungswiderspruch zwischen dem seit 1991 gültigen ESchG und dem am 29. Juni 1995 im Deutschen Bundestag mehrheitlich verabschiedeten § 218 StGB verwiesen. Es könne doch wohl nicht sein, dass dem Embryo in vitro eine höhere Schutzwürdigkeit zuerkannt würde als dem Embryo in vivo, der seit In-Kraft-Treten der Fristenlösung bis 12 Wochen p. c. nach Pflichtberatung straffrei getötet werden dürfe. Diese Argumentation greift insofern zu kurz, als der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichtes mit seinem Urteil vom 28. Mai 1993 gegen den Mehrheitsbeschluss des Deutschen Bundestages vom 27. Juli 1992 erneut festgeschrieben hat, dass der Schwangerschaftsabbruch für die ganze Dauer der Schwangerschaft grundsätzlich als Unrecht, also als rechtswidrig angesehen wird und demgemäß rechtlich verboten bleiben muss. Die im Bundestag beschlossene „reine“ Fristenlösung (1992) wurde als Bruch mit der gültigen Verfassung bezeichnet und mit Streichung des Wortes „nicht“ (rechtswidrig) die nicht rechtswidrige Fristenlösung verworfen und somit dem Leben des Ungeborenen Vorrang vor der Selbstbestimmung der Mutter eingeräumt. Die Bewertung der Abtreibung als grundsätzlich rechtswidrige Tötung menschlichen Lebens wurde erneut festgeschrieben. Im § 8 Abs. 1 des am 1. Januar 1991 in Kraft getretenen ESchG wird der Rechtsstatus des menschlichen Embryos erneut bestätigt: „Als Embryo im Sinne dieses Gesetzes gilt bereits die befruchtete, entwicklungsfähige menschliche Eizelle vom Zeitpunkt der Kernverschmelzung an, ferner jede einem Embryo entnommene totipotente Zelle, die sich bei vorliegenden, dafür erforderlichen weiteren Voraussetzungen zu teilen und zu einem Individuum entwickeln vermag.“ Die Schutzpflicht des Staates gegenüber dem Embryo „von Anfang an“ ist in diesem Rechtsstatus des Embryos begründet. Der Grundgedanke des ESchG ist erneut, das Leben und die Integrität der befruchteten, entwicklungsfähigen menschlichen Eizelle vom Zeitpunkt der abgeschlossenen Kernverschmelzung an strafrechtlich zu schützen. Das heißt auch – es gibt keinen Raum (Zäsur) für die Annahme einer rechtlich ungeschützten Frühphase des Menschen. Handlungen gegen den Embryo in vitro sind danach rechtswidrig und unter Strafe gestellt, während in vivo – nach der Implantation – das Strafgesetz (§ 218 StGB) zugunsten einer Beratungspflicht zurücktritt.* Das ESchG gibt darüber hinaus dem Lebensrecht des Embryos grundsätzlich Vorrang vor dem Grundrecht der Forschungsfreiheit. Die juristische Argumentation beim § 218 StGB basiert auf dem Rechtsstatus der Mutter, der in Konflikt zum Lebensrecht des Embryos oder des Fötus treten kann. Danach ist der legale Schwangerschaftsabbruch lediglich wegen Unzumutbarkeit des Austragens der Schwangerschaft für die Mutter straflos (keine Rechtfertigung), während zum Beispiel die Verwendung beziehungsweise der Verbrauch von Embryonen für die Forschung oder die Diagnostik nicht aus einer subjektiven Notlage des Einzelnen heraus erfolgt. Das konkurrierende Gut, welches den Konflikt definiert und Straffreiheit begründet, ist nicht die subjektive Not des Einzelnen, sondern etwa das gesundheitspolitische Ziel der Allgemeinheit, zum Beispiel die Verbesserung der Ergebnisse der Sterilitätstherapie. Auch zum § 219 d StGB, welcher die Nidationsverhütung straffrei lässt, wurde eine Analogie entwickelt. Mit Verzicht auf Strafbewährung der Präimplantationsphase in vivo redet der Gesetzgeber nicht der willkürlichen Verfügbarkeit dieser Phase das Wort, sondern er verzichtet nur für eine durchaus besondere Kollision der Rechtsgüter – prinzipielle Schutzwürdigkeit des Embryos und Familienplanung der Frau durch Hormone oder Spirale – während der frühesten Phase der Schwangerschaft auf Strafrechtschutz (Laufs, 1989). Diese Position wird auch durch den Kommen*Die Präimplantationsphase in vivo ist nicht durch den § 218 StGB erfasst. 31 D O K U M E N T A T I O N tar zum ESchG von Keller et al., 1992, die sich auf Deutsch und Eser beziehen, bestätigt und gestützt: „Bezüglich eines generellen Wertungswiderspruchs zwischen kategorischen strafbewehrten Verboten der Embryonenforschung einerseits, der strafrechtlichen Duldung der Nidationsverhütung und des Schwangerschaftsabbruches andererseits sind die Unterschiede der jeweiligen Interessenkollisionen zu bedenken. Dem Schwangerschaftsabbruch zugrunde liegt eine aus der symbiotischen Verbindung zwischen schwangerer Frau und ungeborenem Kind erwachsene, höchst persönliche und gegenwärtige Konfliktsituation. Diese Lage lässt sich nicht mit der des Forschers vergleichen, der ohne persönliche Not zur Mehrung seines Wissens und Ansehens um möglicher zukünftiger Vorteile für die Menschheit willen fremdes Leben aufopfern will. Dass die Rechtsordnung darauf verzichtet, schwangere Frauen mit dem Mittel des Strafrechts zu zwingen, Mutter zu werden, taugt deshalb nicht als Argument dafür, dem Forscher Embryonen verbrauchende Experimente zu ermöglichen.“ Es ist wohl davon auszugehen, dass dieser Kommentar von Keller et al. nicht nur die verbrauchende Embryonenforschung in die Wertungsdiskussion rückt, sondern auch die aus diagnostischen Gründen gezielte Schaffung eines nicht unter allen Umständen zu transferierenden Embryos in vitro und damit das Problem der Embryo-Selektion. Persönlich meine ich, dass man zum § 219 StGB, der mit Verzicht auf rechtliche Sanktionierung der Präimplantationsphase in vivo die Nidationsverhütung ermöglicht, wohl einen Wertungswiderspruch zum hohen Schutzanspruch des Embryos in vitro sehen kann. Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass zunächst zwischen der im § 218 a Abs. 2 StGB i. d. F. des Schwangeren- und Familienhilfegesetzes (1992) im Bundestag geregelten und als nicht strafbar und nicht rechtswidrig deklarierten Fristenlösung und dem ESchG (1991) zweifellos ein tiefer Wertungswiderspruch bestand. Dieser wurde erst durch die im Urteil des Bundesverfassungsgerichtes wiederhergestellte Rechtswidrigkeit des Schwangerschafts- 32 abbruchs aufgehoben: Die Tötung eines Embryos in vivo ist straffrei und rechtswidrig. Die Tötung eines Embryos in vitro ist rechtswidrig und strafbewehrt. Bei der Tötung in vivo (nach der Implantation) sieht der Gesetzgeber lediglich wegen einer subjektiven Notlage der Einzelnen nach Pflichtberatung von Strafe ab – ein Konflikt, der beim Embryo in vitro, das heißt in der Hand Dritter (Biologe und/oder Arzt), in der Regel nicht existiert. Ob bei schwerer genetischer, anamnestischer Belastung der die Straffreiheit im § 218 StGB begründende Konflikt vor einer geplanten Präimplantationsdiagnostik antizipierbar ist und auf diese Weise ein Verbot dieser Diagnostik tatsächlich einen Wertungswiderspruch zum gültigen § 218 a bewirken würde und ob der zu Recht aufgebaute besondere Schutz des Embryos in vitro in eng einzugrenzenden und zu beschreibenden Indikationen für eine PGD aufzuheben ist, wird später (Kapitel 3) hinterfragt. 2.2 PGD und ESchG Man kann das durch die Etablierung der PGD neue Machbare mit Blick auf das ESchG gleichsam positivistisch entscheiden und ohne die vorhergehende Prüfung einer etwaigen Kompatibilität fordern, das Gesetz habe sich dem neuen Machbaren anzupassen und sei gegebenenfalls zu ändern. Dieser Ansatz ist nach meiner Überzeugung ebenso wenig für das Zusammenleben der Menschen in einer Gesellschaft akzeptabel wie jenes in der ethischen Diskussion um die Fortschritte der assistierten Reproduktion erhobene Postulat: „Ethics do not stand still, they have to move with technology“ (Edwards, 1988). Sowohl die Bioethik-Kommission des Landes Rheinland-Pfalz unter der Leitung des damaligen Justizministers, P. Caesar (1999), wie auch die Arbeitsgruppe des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer (BÄK) gingen in ihren Diskussionen von dem in unserem Land gültigen, den Embryonenschutz regelnden Gesetz aus. Zunächst ist festzuhalten, dass die IVF mit anschließendem Embryotransfer als ärztliches Standardverfahren zur Behandlung der Sterilität nach Abs. B IV Nr. 15 in der 1998 überarbeiteten neuen Musterberufungsordnung (MBO) zulässig ist, wenn die nach § 13 MBO maßgebenden Richtlinien der Ärztekammer eingehalten werden. Die Frage, ob die Präimplantationsdiagnostik, die eine IVF als diagnostische Einstiegstechnik zur Voraussetzung hat, mit dem seit 1. Januar 1991 gültigen ESchG kompatibel ist, wird unter Juristen kontrovers diskutiert. Zunächst geht es um die Frage, ob die PGD einen Verstoß gegen § 2 I. ESchG darstellt. Nach diesem Paragraphen ist es verboten, einen extrakorporal erzeugten Embryo zu einem nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck zu verwenden. Würde die Diagnostik an einer noch totipotenten Zelle erfolgen, also an einem zum Zweck der Diagnostik klonierten Zwilling, wodurch dieser vernichtet wird, wäre der Tatbestand des § 2 I. ESchG erfüllt und die PGD schon von diesem Ansatz her strafrechtlich verboten. Jede Zelle, soweit sie noch Totipotenz besitzt, ist über § 8 I. ESchG als Embryo strafrechtlich geschützt. Denn als Embryo im Sinne des § 8 gilt bereits die befruchtete, entwicklungsfähige menschliche Eizelle vom Zeitpunkt der Kernverschmelzung an, ferner jede, einem Embryo entnommene totipotente Zelle, die sich bei Vorliegen der dafür erforderlichen weiteren Voraussetzungen zu teilen und zu einem Individuum zu entwickeln vermag. Der Schutzbereich des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ist also bereits für die befruchtete Eizelle markiert. Erfolgt die Diagnostik nach Entnahme an einer nicht mehr totipotenten Blastomere, die also nach § 8 I. ESchG nicht als „Embryo“ geschützt ist, liegt kein Verstoß gegen § 2 I. ESchG im Sinne einer verbrauchenden Forschung vor (Schreiber u. Schneider, 1999). Die Frage, ab wann eine aus einer befruchteten Eizelle hervorgehende Zelle ihre Totipotenz verliert, scheint mittlerweile wissenschaftlich eindeutig beantwortet. Dies soll spätestens nach Abschluss des Acht-Zell-Stadiums des Embryos der Fall sein (Beier, 1999). Neuere Untersuchungen lassen den Schluss zu, dass wahrscheinlich bereits im Vier-Zell-Stadium nicht mehr alle Blastomeren totipotent beziehungswei- D O K U M E N T A T I O N se soweit differenziert sind, dass sie ihre Totipotenz verloren haben. Eine Biopsie im späteren Teilungsstadium ist im Hinblick auf die optimale Chance der Nidation von Nachteil. Je später der Transfer des in Warteposition stehenden „Restembryos“ erfolgt, desto schlechter wird die Synchronisation mit der hormonalen Situation der Frau und somit die Chance der Nidation. Abschließend ist festzustellen, dass mit der PGD an nicht totipotenten Zellen kein Embryoverbrauch erfolgt, vorausgesetzt, der „Restembryo“ wird aufgrund der genetisch unauffälligen Diagnose im gleichen Zyklus transferiert. Auf den Nichttransfer des Embryos wegen der Feststellung der die PGD indizierten Erkrankung ist später einzugehen. Im Mittelpunkt der juristischen Diskussion hinsichtlich einer Kompatibilität der PGD mit dem ESchG steht die Frage des Verstoßes vor allem gegen § 1 I. Nr. 2 ESchG. Dort heißt es: „Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich zu befruchten, als eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt.“ Für Laufs (1992) ist eine In-vitro-Fertilisation i. S. einer bedingten Zeugung beziehungsweise unter dem „Vorbehalt der Tötung bei Qualitätsmängeln“ unzulässig. In die gleiche Richtung denkt Beckmann (1999), wenn er ausführt, dass bei einer IVF zwecks Durchführung einer PGD diese ausschließlich zum Zweck der präimplantatorischen Qualitätskontrolle geschehe und daher gegen § 1 I. Nr. 2 ESchG verstoße. Ratzel und Heinemann (1998) argumentieren dagegen: „Auch wenn feststeht, dass ein belasteter Embryo nicht übertragen werden soll, ist die Verwerfung dieses Embryos doch nicht Ziel der künstlichen Befruchtung beziehungsweise der Weiterentwicklung des Embryos. Die Verwerfung des Embryos ist lediglich als eine dem Täter höchst unerwünschte Nebenfolge oder als ein Fehlschlag gegenüber dem eigentlich erstrebten Ziel, nämlich dem der Herbeiführung der Schwangerschaft, anzusehen. Eine Absicht im Sinne zielgerichteten Wollens (Keller et al., 1992, Zit. b. Ratzel u. Heinemann) liegt nicht vor. Die durch eine schwer belastete Anamnese betroffenen Eltern entscheiden sich nach eingehender humangenetischer Beratung, die in jedem Falle zu fordern ist, für das Ziel Schwangerschaft. Von Beginn an handeln die Betroffenen in Antizipation des Konflikts mit dem Bewusstsein, dass die IVF mit PGD darauf ausgerichtet ist, eine Schwangerschaft herbeizuführen (Schreiber u. Schneider, 1999). Ratzel und Heinemann (1998) ergänzen diesen Gedankengang mit dem Argument, dass bei jeder IVF der nachfolgende Transfer von Bedingungen abhängt, – zum Beispiel körperliche und psychische Befindlichkeit der Frau und/oder pathologische Veränderungen am Embryo, die keine Nidation erwarten oder eine spontane Fehlgeburt prognostizieren lassen et cetera. „Die bloße Inkaufnahme des Untergangs gezeugter Embryonen führt nicht zur Strafbarkeit der künstlichen Befruchtung, solange das Motiv des Handelns die Herbeiführung der Schwangerschaft ist.“ Das Unterlassen eines Transfers bedeutet demnach keinen Embryonenverbrauch, der nach § 2 I. einen strafbewehrten Tatbestand darstellen würde, und verstößt auch nicht gegen § 1 I. Nr. 2. Auch nach Meinung von Schreiber und Schneider geht aus § 1 I. Nr. 2 nicht hervor, dass die Absicht der Herbeiführung einer Schwangerschaft durch die gleichzeitige absichtliche Verfolgung eines anderen Zweckes ausgeschlossen ist. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die PGD bei Entnahme und Diagnostik an einer nicht mehr totipotenten Zelle nicht nach § 1 I. Nr. 2 ESchG und § 2 I. Nr. 2 verboten und so mit dem seit 1. Januar 1991 gültigen ESchG kompatibel ist. 3. Status des Embryos und ethische Implikationen Im Zentrum der ethischen Diskussion steht der Status des Embryos. Die Rechtsordnung geht im ESchG davon aus, dass die Schutzwürdigkeit des Embryos vom Zeitpunkt der Kernverschmelzung an besteht und begründet diese mit den Wertentscheidungen des Grundgesetzes für Menschenwürde und Lebensschutz. Die Frage ist, ob die PGD die Menschenwürde berührt, nachdem nach unserer Rechtsordnung menschliches Leben bereits mit der Befruchtung unter das Gebot der Achtung der Menschenwürde fällt und daher zu schützen ist. Jede medizinische Diagnostik und Forschung an und mit Embryonen, die – i. S. einer Einstiegstechnik – durch IVF erst möglich wurde, wirft die Frage nach dem Menschen und dem Menschenbild des Forschers auf. Es geht um den Status dessen, an dem wir handeln. Das Problem liegt also nicht in der Forschung selbst, sondern im „Objekt“ der Forschung. Es stellen sich zwei zentrale Fragen: Ab wann ist dem neuen menschlichen Leben „Würde und damit Lebensrecht und Schutz zuzubilligen“? Worin liegt die Begründung, und wie ist der Umfang der zu gewährenden Grundrechte bemessen? 3.1. Naturwissenschaftliche Fakten Nach naturwissenschaftlicher Erkenntnis beginnt neues menschliches Leben mit der Vereinigung des mütterlichen haploiden Chromosomensatzes der Eizelle und des väterlichen haploiden Chromosomensatzes der Samenzelle, das heißt nach Abschluss der Befruchtungskaskade (Beier, 1992). Diese beginnt mit dem Eindringen eines Spermiums in die Eizelle (Imprägnation) und endet mit der Fusion der Zellkerne (Konjugation). In den Zellkernen liegt nach der ersten Teilung das neue Genom in seiner definitiven Form vor. Mit dem neuen diploiden Genom ist der gegenüber väterlichem und mütterlichem Organismus genetisch neue Mensch konstitutiert. Nach Braude (1987) beginnt die erste Genexpression zwischem dem Vierund Acht-Zell-Stadium. Bis zu diesem Stadium hat die einzelne Blastomere, aus dem Verband herausgelöst, die Fähigkeit, sich zu einem neuen Embryo zu entwickeln. Der Vorgang ist identisch mit der spontanen Bildung eines eineiigen Zwillings. Das bedeutet, dass in dieser frühen Phase der Entwicklung die einzelnen Zellen des Embryos noch totipotent sind. In der Diskussion um den Beginn der Schutzwürdigkeit beziehen sich Einzel- 33 D O K U M E N T A T I O N ne auf diese Möglichkeit der Zwillingsbildung und meinen, dass der Terminus a quo personaler menschlicher Existenz frühestens mit dem Ende der orthischen Teilbarkeit gegeben sein kann. So stellt auch der Theologe Fuchs (1989) fest: „Solange Zellen noch teilbar sind, können sie nicht schon menschliches Individuum und Person sein, diese Möglichkeit besteht aber gemäß der Biologie im allgemeinen bis zum 14.Tag.“ Für Fuchs wäre die Eliminierung des Embryos in diesem frühen Stadium oder die Verhinderung der Implantation nicht tötender Abortus, könnte jedoch nur aus wichtigen Gründen gestattet sein; sie stände zwischen Empfängnisverhütung und Schwangerschaftsabbruch. Die „Individuation“ nach der ersten Zellteilung wäre danach potenzielles, aber nicht zwangsläufig in jedem Falle individuelles menschliches Leben, wenngleich auch im Regelfalle die damit ausgelöste Dynamik für die individuelle Menschwerdung bestimmend ist. In philosophischem Sinne besagt Individualität, dass etwas nicht mehr auf kleinere Einheiten rückführbar ist, ohne dass es seine Qualität verliert. Diesen Gedanken führt Wuermeling (1985) konsequent fort und zeigte auf, dass biologisch die Teilung eines frühen Embryos keine Aufteilung in kleinere Einheiten, sondern eine Form der Lebensäußerung „Vermehrung“ darstellt. So auch Rager (1992): „Wenn aus einem Individuum mehrere Individuen hervorgehen können, wie das bei jeder Zellteilung der Fall ist, so folgt daraus, dass das ursprünglich eine Individuum die Möglichkeit für eine Mehrzahl für Individuen in sich trägt.“ Der Zeitpunkt des Ungeteiltseins des Embryos erweist sich danach als unzureichend zur Definition des Beginns individuellen menschlichen Lebens. Über die Frage des Beginns menschlichen Lebens in naturwissenschaftlicher Sicht besteht Konsens. Die Frage nach dem Beginn personalen Lebens ist mit den Denkkategorien der Naturwissenschaft nicht zu denken. Es geht hierbei nach meiner Überzeugung um die Einführung eines Wertaxioms: Ob und inwieweit wir neuem artspezifischen und in seiner Potenzialität auf personales Leben hin angelegten Leben Wertschätzung und damit Schutzwürdigkeit 34 zuerkennen und vor allem, wie absolut wir diese setzen. 3.2 Schutzwürdigkeit des Embryos So besteht auch ein weitgehender Konsens darüber, dass sich die Schutzwürdigkeit des Embryos auf seine Natur als früheste Form einer individuellen menschlichen Existenz gründet. Ebenso besteht weitgehend Übereinstimmung darüber, dass die Schutzwürdigkeit des Embryos mit der Bildung des Genoms beginnt, wenngleich Einzelne für den Umfang der Schutzwürdigkeit und damit des Rechtsschutzes terminologische Abstufungen – Zygote, Konseptus oder Präembryo – einführen, um hiermit im Falle einer gebotenen ethischen Güterabwägung auch Abstufungen des Rechtsschutzes einzufordern. In Art. 2 Abs. 2 S. 1 des GG ist verankert: „Das Leben des Menschen ist von Anfang an in seinen Schutz genommen.“ Bei der Bemessung des Umfanges der Schutzwürdigkeit menschlicher Embryonen sind wir heute im nationalen und vor allem im internationalen Dialog mit zwei Positionen konfrontiert. Die einen erkennen das Lebensrecht und den Schutz im umfassenden Sinne kategorisch an, was jede Güterabwägung hinsichtlich eines Ziels – auch von hohem medizinischen Range – ausschließt. Die anderen relativieren in grundsätzlicher Anerkennung des Lebensschutzes dieses Prinzip im Sinne einer Güterabwägung auf Zwecke hin, was nach sorgfältiger Prüfung eines nachgewiesenen hochrangigen Zieles eine Forschung an und mit Embryonen zulässt. Diese Position beruft sich auf die „prozesshafte“ Verwirklichung individuellen personalen Seins in Realisierungsstufen (Abschluss der zellulären Totipotenz, Möglichkeit zur Mehrlingsbildung etc.) und plädiert daher für einen diesen Stufen entsprechenden abgestuften Rechtsschutz. Die Menschenrechtskonvention zur Biomedizin des Europarates von 1997 („Bioethik-Konvention“) verbietet in Artikel 18, 2 die Herstellung von Embryonen zu Forschungszwecken. Art. 18, 1 fordert von den Mitgliedstaaten, in denen Embryonenforschung zugelassen ist, die Gewährleistung eines „angemesse- nen Schutzes“ des Embryos. Ein explizites Verbot zur verbrauchenden Forschung an Embryonen, die im Deutschen Embryonenschutzgesetz strafrechtlich untersagt ist, enthält die Regelung in 18, 1 nicht, doch betrachtet sie den Embryo als schützenswertes Rechtsgut und schiebt die Beweislast für den Nachweis angemessenen Schutzes dem nationalen Gesetzgeber zu (Honnefelder, 1998). Die Richtlinien zur Forschung an frühen menschlichen Embryonen (1985) des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer, wie auch der Bericht der Benda-Kommission (1986), hatten sich für ein „grundsätzliches“ Verbot der Erzeugung von Embryonen zu Forschungszwecken ausgesprochen. Dieses bedeutete kein kategorisches Nein. Einigkeit bestand darüber, dass über etwaige Ausnahmen – ohne dass seinerzeit die Präimplantationsdiagnostik speziell im Blick war –, sofern überhaupt zulässig, die zentrale Kommission der Bundesärztekammer zu entscheiden hätte. Das Votum der „Benda-Kommission“ bezog sich, wie jenes der MaxPlanck-Gesellschaft und der DFG, vor allem auf die etwaige Zulassung einer Forschung an überzähligen Embryonen. Im Zentrum der ethischen Diskussion über die PGD steht die Tatsache, dass der während der Diagnostik in Warteposition befindliche Embryo wegen seines Geschädigtseins selektiv „stehen gelassen“ und so dem Untergang preisgegeben wird. Konkret auf die PGD abgestellt, heißt daher die Frage, ob mit Rücksicht auf die gesundheitlichen und/oder sozialen Lebensinteressen der Mutter die Schutzwürdigkeit einer positiven Güterabwägung unterworfen werden darf und daraus ein abgestufter Rechtsschutz resultiert. Wie bei der konventionellen PND gibt es bei Einsatz der PGD Argumente für wie auch gegen deren Anwendung. Die im Thesenpapier der BioethikKommission des Landes RheinlandPfalz aufgeführten Pro- und Kontra-Argumente im Umgang mit der Präimplantationsdiagnostik sind in der Tabelle zusammengefasst. Die Argumente definieren den Interessenkonflikt, in den dieser medizinische Fortschritt das betroffene Paar, die betreuenden Ärzte und die Gesellschaft D O K U M E N T A T I O N stürzt. Sowohl die Pro- wie auch die Kontra-Argumente sind von hohem Gewicht und lassen hinsichtlich der ethischen Zulässigkeit der PGD keine Rangordnung zu. Der Interessenkonflikt wird bestimmt durch die Interessen der betroffenen Paare, den Therapieauftrag der behandelnden Ärzte, den in Art. 2 Abs. 2 S. 1 des Grundgesetzes verankerten anerkannten Status des Embryos und den daraus abgeleiteten Lebensschutz „von Anfang an“. Eine klare ethische Lösung des Konflikts ist nur über den Verzicht auf eine weitere Schwangerschaft möglich. Ob der Gesetzgeber mit Rücksicht auf die Interessenkollision eine derartige persönliche Entscheidung verlangen kann, ist zumindest fraglich. Im Zentrum der ethischen Abwägung steht die Frage, ob das für ein friedliches Zusammenleben einer Gesellschaft höchste Gut, nämlich die Achtung des Lebensrechts von Anfang an, in Anerkennung der Antizipation des etwaigen Konfliktes relativiert und eine PGD zugelassen werden darf. Das Lebensrecht würde nicht absolut in Frage gestellt und menschliches Leben nicht generell wegen seiner genetischen Schädigung als lebensunwertes Leben zur Disposition gestellt. Dies setzt voraus, dass die PGD nur für Paare zugelassen wird, die um ihr Risiko der Weitergabe einer unheilbaren genetischen Krankheit wissen und ´ Tabelle C mit Hilfe der Präimplantationsdiagnostik eine „Schwangerschaft auf Probe“ mit Spätabbruch vermeiden wollen. Man kann einwenden, dass hierbei die Befürwortung der PGD über den ethisch zumindest fragwürdigen Ansatz einer PND nach Schwangerschaft auf Probe versucht wird. Nach Hanak (1984) verbietet jedenfalls das geltende Recht der Frau nicht, das Risiko eines kranken Kindes unter den Vorbehalt einer gesetzlichen Korrektur zu stellen. Zugegeben – im ethischen Diskurs ist diese die Tötung beziehungsweise „Stehenlassen“ oder „Aussondern“ in das Therapiekonzept einbeziehende Handlungsweise anders zu beurteilen, als wenn die Patientin durch die PND in Not und Panik gerät und der Abbruch nach § 218 a Abs. 2 die Not wendet (Wuermeling, 1990). Aber, wie schon ge-sagt, für ein Hochrisikopaar ist der Konflikt auch ohne Schwangerschaft antizipierbar, vergleichbar jenem Paar, das erst durch die PND in einen Konflikt gestürzt wird. In der geistigen Vorwegnahme des zu erwartenden schweren Konflikts nimmt das Hochrisikopaar beim Wunsch nach einer PGD das auch nicht vollkommen risikofreie Verfahren der IVF auf sich. Unstrittig ist, dass ein später Schwangerschaftsabbruch für die Betroffenen wie auch für den tötenden Arzt psychisch und kör- ´ Argumente pro und kontra einer Anwendung der PGD an nicht totipotenten Zellen Pro Kontra Wunsch des Paares mit starker genetischer Belastung auf ein gesundes Kind Bewertung embryonalen menschlichen Lebens unter dem Aspekt eventuell gezielter Selektion Psychische und physische Belastung durch späten Schwangerschaftsabbruch nach „Schwangerschaft auf Probe“ Entscheidung zur Selektion unter Umständen leichter in vitro als später in vivo – Reduktion der Ehrfurcht vor dem menschlichen Leben Diagnose einer genetischen Störung des Embryos vor Eintritt der Schwangerschaft Öffnung zur allgemeinen Akzeptanz und Anspruch auf das „Kind nach Maß“ – Dammbruch zur Eugenik Diskriminierung von Leid und Behinderung. Rückzug der Solidargemeinschaft Eventuell Verminderung der Lebenschance des „Restembryos“ durch diagnostische Manipulation Tab. 1 in gekürzter Fassung n. Bioethik-Kommission des Landes Rheinland-Pfalz (1999) perlich eine außerordentliche Belastung darstellt. Die Anerkennung und Zulassung der PGD in streng definierten Indikationsbereichen ist mit Blick auf die Handhabung der PND nur über eine Güterabwägung beziehungsweise über das kleinere anstelle des größeren Übels möglich. Dem schwerwiegenden Argument gegen eine Zulassung der PGD, nämlich die Öffnung einer weiteren Tür zur Selektion und zu einem Dammbruch hin zur verbrauchenden Embryonenforschung, ist durch die gesetzgeberische Festlegung auf eng umschriebene Sonderfälle entgegenzuwirken. Diesem Ziel dienen unter anderem die von der Arbeitsgruppe des Wissenschaftlichen Beirats der BÄK vorgelegten Vorschläge von Richtlinien für die Anwendung der PGD. Die Tatsache, dass die Pro-Argumente einer Einführung der PGD identisch sind mit jenen seinerzeit für die Einführung der PND vorgebrachten Begründungen, führt zur Diskussion der beiden Verfahren. 4. PGD und PND Die PGD kann nicht, wie vielfach geäußert, schlichtweg als eine vorverlegte PND angesehen werden. Zunächst hat die PGD das mit körperlichen und seelischen Risiken für die Mutter behaftete Verfahren der In-vitro-Fertilisation – hormonelle Stimulation, Follikelpunktion und IVF – zur Voraussetzung. Darüber hinaus weist die PGD, wie aus den Pro- und Kontraargumenten ablesbar, eine andere ethische Handlungsqualität auf:Die konventionelle PND hat – in der Regel (s. u.) – nicht primär einen selektiven oder sogar eugenischen Ansatz. Im Zentrum der PND steht der informative, über Beratung nicht selten lebenserhaltende und zunehmend auch intrauterin-therapeutische Ansatz. Pränataldiagnostik mit einem primär und ausschließlich selektiven Ansatz ist ethisch fragwürdig – wenn wohl rechtlich zulässig (s. Hanak). Der Gesetzgeber hat die „embryopathische Indikation“ zum Schwangerschaftsabbruch im reformierten § 218 StGB gerade deshalb gestrichen und deren Inhalte in der medizinischen Indikation „versteckt“ (Hepp, 35 D O K U M E N T A T I O N 1996), da er aus der Gesetzessystematik jeden selektiven Ansatz beziehungsweise jedes Urteil über lebenswert und lebensunwert nehmen wollte – was jedoch, wie von mir mehrfach gezeigt, utopisch ist. Die PND ist heute ein Verfahren, durch das die Eltern – in der Regel – unerwartet in Not und Panik geraten, und der Abbruch der Schwangerschaft ohne primär selektiven Ansatz, das heißt ohne bereits vor der Empfängnis antizipierten Konflikt, erfolgt. Es ist jedoch unbestreitbar, dass mit der Entwicklung immer subtilerer Verfahren der PND in der Gesellschaft das Bewusstsein über die Möglichkeit der Selektion menschlichen Lebens hin zum Anspruch auf das unbehinderte Kind gewachsen ist, auch wenn der Gesetzgeber diesen selektiven Ansatz durch die Subsumierung in die mütterlichmedizinische Indikation verstecken oder verneinen wollte. Die klinische Wirklichkeit lässt uns immer wieder erleben, dass Paare im Wissen um die medizinischen Möglichkeiten der PND, zum Beispiel bei Bestehen eines deutlich erhöhten Altersrisikos für die Empfängnis eines Kindes mit Down-Syndrom, eine „Schwangerschaft auf Probe“ anstreben, erleben und nach „positiver“ PND den Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen. Die so genannte „Altersindikation“ zur PND ist nicht mehr und nicht weniger als die Antizipation dieses Konfliktes. Die im Bereich der PND Handelnden stehen zudem unter dem Druck des Haftungsrechtes. Man kann mit Hilfe der PND die Geburt eines gesunden Kindes gleichsam erzwingen, indem man aufeinander folgende Schwangerschaften so lange abbricht, bis ein nachweislich gesundes Kind empfangen wird. In diesen Fallkonstellationen wird der Konflikt auf dem Boden der Autonomie der Mutter und der ihr durch ein krankes Kind nicht zumutbar erscheinenden Belastung für die Phase nach der Geburt gleichsam antizipiert. Die Antizipation dieses schweren Konfliktes erfolgt für Eltern eines genetisch und auf den Tod hin schwer erkrankten Kindes – im Gegensatz zur allgemeinen „Altersindikation“ – aus der erlebten Wirklichkeit.Aufgrund der anamnestischen Erfahrung eines genetisch schwer kranken Kindes steht das Lebensrecht des Embryos beziehungsweise Fötus gegen die antizi- 36 pierte, gesundheitliche Gefährdung der zukünftigen Mutter und bewirkt so eine Analogie von Embryoselektion in vitro nach PGD und Schwangerschaftsabbruch in vivo nach PND, da . . . „die real existierende Schwangerschaft für das Bestehen des Konfliktes nicht konstitutiv ist“ (Woopen, 1999). Es gibt demnach nicht nur die unter Vorbehalt stehende (bedingte) Zeugung, sondern im Hinblick auf die Möglichkeiten der PND auch die unter Vorbehalt stehende Schwangerschaft. Bei diesem Ansatz ist die PGD tatsächlich eine zeitlich vorverlegte PND – mit anders gearteten und derzeit höheren medizinischen Risiken. Nimmt man diese medizinische Wirklichkeit zur Kenntnis und bejaht für bestimmte Fallkonstellationen die aufgezeigte Analogie von PND zu PGD, dann ist in einem zu erwartenden Fortpflanzungsmedizingesetz die PGD nur dann strafrechtlich zu verbieten, wenn auch eine „Schwangerschaft auf Probe“ expressis verbis als ein Verstoß gegen § 218 a Abs. 2 geahndet wird. Anderenfalls bestünde ein Wertungswiderspruch zwischen § 218 a Abs. 2 und ESchG – wobei die Beweisführung für eine „illegale Schwangerschaft auf Probe“ mit Abbruch der Schwangerschaft wohl sehr schwierig sein dürfte. 5. Schlussbemerkung Der Bedarf und die klinische Notwendigkeit einer PGD sind ebenso wenig ein ethisches Argument wie der Hinweis auf die Praxis in benachbarten Ländern. Der Zweck beziehungsweise das Ziel heiligt nicht das Mittel. Dennoch sind wir durch das neue Machbare herausgefordert, uns mit den medizinischen, ethischen und rechtlichen Aspekten ernsthaft, das heißt ergebnisoffen, auseinander zu setzen. Im Zentrum der ethischen Pro- und Kontra-Diskussion steht der Status des Embryos. In der Präambel des Vorschlags einer Richtlinie zur PGD (2000) hat die Kommission des Wissenschaftlichen Beirates der BÄK die Frage, ob es sich bei „positiver“ PGD und dem von diesem Ergebnis abgeleiteten Nichttransfer des Embryos um eine Ausnahme vom Tötungsverbot handelt, zum Beispiel vor dem Hintergrund eines ab- gestuften Schutzkonzepts, oder ob keine Tötung vorliegt, nicht abschließend beantwortet und eine weitere rechtliche Diskussion und ethische Würdigung gefordert. Der Richtlinienvorschlag wird als wichtiger Beitrag zu dieser notwendigen Diskussion verstanden und soll „dazu dienen, eine sachgerechte Regelung herbeizuführen“. In Berücksichtigung des sehr ernst zu nehmenden Kontra-Arguments eines mit Zulassung der PGD eintretenden Dammbruchs hält die Kommission des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer, wie die Bioethik-Kommission des Landes Rheinland-Pfalz, die PGD nur unter eng gefassten Voraussetzungen für zulässig. Ein Wertungswiderspruch zum ESchG § 1 I Nr. 2 ESchG und § 2 I wird nicht erkannt (s. o.). In dem Vorschlag der Richtlinien wird unmissverständlich gefordert, dass mit der PGD keine eugenischen Ziele verfolgt werden dürfen. Keine Indikation für eine PGD sind insbesondere die Geschlechtsbestimmung ohne Krankheitsbezug, das Alter der Eltern, eine Sterilitätstherapie durch assistierte Reproduktion. Der Richtlinienentwurf geht hiermit weit hinter das Indikationsspektrum für eine PND zurück. Der Vorschlag beschreibt die Zulassungsbedingungen für die PGD mit den berufsrechtlichen Voraussetzungen, gibt Anweisungen für das Antragsverfahren an die bei der Landesärztekammer gebildete Kommission, die ihr Ergebnis der der Bundesärztekammer assoziierten Kommission mitteilt. In dieser „Kommission Präimplantationsdiagnostik“ sollen die Disziplinen Humangenetik, Gynäkologie, Andrologie, Pädiatrie, Ethik und Recht vertreten sein. Neben der Festlegung der fachlichen, personellen und technischen Voraussetzungen sind in einem Kapitel „Durchführungsbedingungen“ die Richtlinien über Aufklärung, Beratung, Einwilligung, Gewinnung von Blastomeren, Transfer und Nichttransfer von Embryonen sowie die Verfahrens- und Qualitätskontrolle beschrieben. „Mit Vorlage dieses Diskussionsentwurfes zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik strebt die Bundesärztekammer einen Diskurs mit den D O K U M E N T A T I O N gesellschaftlichen Gruppen an und erhofft sich dabei einen offenen und sachlichen, gleichwohl kritischen Dialog“ – so Hoppe und Sewing im Vorwort des Diskussionsentwurfes. Unabhängig davon, ob die Gesellschaft sich in einem zu erwartenden Fortpflanzungsmedizingesetz pro oder kontra Zulassung der PGD ausspricht, wird die Debatte über den vorliegenden Diskussionsentwurf eine erneute und, wie ich hoffe, ehrlichere Diskussion über die tatsächlichen Inhalte der PND und ihre Folgen bewirken und so das Problembewusstsein für die medizinische und gesellschaftliche Wirklichkeit der Pränatalmedizin fördern. ❚ Zitierweise dieses Beitrags: Dt Ärztebl 2000; 97: A 1213–1221 [Heft 18] Literatur 1. Beckmann R: Rechtsfragen der Präimplantationsdiagnostik. ZfL. 2/1999, 65 (67). 2. Beier HM: Die molekulare Biologie der Befruchtungskaskade und der beginnenden Embryonalentwicklung. In: Annals of Anatomy 174 (1992), 491. 3. Beier HM: Die Phänomene Totipotenz und Pluripotenz: Von der klassischen Embryologie zu neuen Therapiestrategien. Reproduktionsmedizin 1999; 15: 190. 4. Braude PR: Gene activity in early human development. In: Human Reproduction 2, Suppl. 1 (1987). 5. Bericht der Bendakommission: In-vitroFertilisation, Genomanalyse und Gentherapie. Verlag Schweizer (1986), München. 6. Caesar P: Bericht der Bioethikkommission des Landes Rheinland-Pfalz. Präimplantationsdiagnostik – Thesen zu den medizinischen, rechtlichen und ethischen Problemstellungen. Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz (1999). 7. Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik. Dt Ärztebl 2000; 97: A-525 [Heft 9]. 8. Edwards RG: Maturation in vitro of human ovarian oocytes. Lancet II (1965) 926. 9. Edwards RG: European bioethics conference on human embryo and research. Mainz (1988) 7–9.11. 10. Fuchs J: Seele und Beseelung im individuellen Werden des Menschen. Stimmen der Zeit 1989; 207: 522. 11. Hanak EE: Zum Schwangerschaftsabbruch aus sog. kindlicher Indikation als Grenzproblem. In: Hauser R, Rehberg J, Stratenberth G (Hrsg.): Gedächtnisschrift für Peter Noll, Schulthess, Zürich, 1984. 12. Handyside AH, Lesko JG, Tarin JJ, Winston RLM, Huges M: Birth of a normal girl after in vitro fertilization and preimplantation diagnostic testing for cystic fibrosis. NEJM 1992; 327: 905. 13. Hepp H: Pränatalmedizin – Anspruch auf ein gesundes Kind? Januskopf medizinischen Fortschritts. In: Jahres- und Tagungsbericht der Görresgesellschaft 1997, 75. 14. Honnefelder L: Bioethik in Europa. Orientierungslinien und Desirate. – Thesen – Tagung der Kath. Akademie in Bayern, 27. 11. 1998. 15. Keller R, Günter HL, Kaiser P: Embryonenschutzgesetz. Kommentar zum Embryonenschutzgesetz. Kohlhammer, 1992. 16. Laufs A: Fortpflanzungsmedizin und Arztrecht 1992; 79. 17. Laufs A: Zur rechtlichen Problematik der Fortpflanzungsmedizin. Geburtsh. u. Frauenheilk. 1989; 49: 606. 18. Ludwig M, Al Hasani S, Diedrich K: Präimplantationsdiagnostik, „Preimplantation genetic diagnosis“ (PGD). In: K Diedrich (Hrsg.): Weibliche Sterilität, Ursachen, Diagnostik und Therapie. Springer, 1998. 19. Ludwig M, Diedrich K: Die Sicht der Präimplantationsdiagnostik aus der Perspektive der Reproduktionsmedizin. Ethik Med. (Suppl.) 1999; 11: 38. 20. Rager G: Zur Frage der Individualität und Personalität des Ungeborenen. In: Berg D, Hepp H, Pfeiffer R, Wuermeling HB (Hrsg.): Würde, Recht und Anspruch des Ungeborenen. München, 1992. 21. Ratzel K, Heinemann N: Zulässigkeit der Präimplantationsdiagnostik. Nach Ab- 22. 23. 24. 25. schnitt D.IV Nr. 14, Satz 2 (Muster-)Berufsordnung – Änderungsbedarf? Der Gynäkologe 1998; 31, 364 [Heft 4]. Richtlinien zur Forschung an frühen menschlichen Embryonen. Dt Ärztebl 1985; 50: 3757. Schreiber HL, Schneider S: Embryonenschutzgesetz und Präfertilisations- bzw. Präimplantationsdiagnostik – offene Auslegungsfragen. Referat Köln, 6. 9. 1999 – DFG-Symposium. Woopen C: Präimplantationsdiagnostik und selektiver Schwangerschaftsabbruch. Zur Analogie von Embryonenselektion in vitro und Schwangerschaftsabbruch nach Pränataldiagnostik im Rahmen der medizinischen Indikation des § 218 a Abs. 2 StGB aus ethischer Perspektive. Zeitschrift für Ethik 1999; 45 [Heft 3]. Wuermeling HB: Rechtspflichten der Schwangeren für das neugeborene Kind? Bamberger Symposium, 16.–18. 3. 1990. Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. med. Hermann Hepp Klinikum der Universität München Frauenklinik Großhadern 81366 München Heft 20, 19. Mai 2000 Medizinethik Mindestmaß an Schutz für die Zukunft Über Präimplantationsdiagnostik und die Menschenrechtskonvention zur Biomedizin des Europarats wurde auf dem Ärztetag kontrovers diskutiert. E in eigener Tagesordnungspunkt zum Thema Präimplantationsdiagnostik (PGD = preimplantation genetic diagnosis) war in diesem Jahr beim 103. Deutschen Ärztetag nicht vorgesehen. Dennoch wurde intensiv über die PGD und ihre Folgen diskutiert. Die Debatte um den von der Bundesärztekammer vorgelegten „Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik“ (Heft 9/2000) stehe beispielhaft für die Ethikdiskussionen, die in nächster Zeit geführt werden müssten, sagte Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer auf der Eröffnungsveranstaltung. Sie wies darauf hin, dass nach Auffassung des Bundesgesundheitsministeriums die PGD nicht erlaubt sei. Aber Gesetze ließen sich ändern. Sie sei viel- mehr gegen die Präimplantationsdiagnostik, weil es damit Ärzten und potenziellen Eltern gestatten würde, über lebens- und nicht lebenswertes Leben zu entscheiden. Sie befürchtet, „dass wir von den schweren Einzelfällen rasch zur Verallgemeinerung kommen könnten und damit auf eine gefährliche Bahn, die unseren Blick auf Krankheit und Behinderung dramatisch verändern würde“. Es sei eine Grenze erreicht, die nicht überschritten werden dürfte. Dass die Debatte notwendig sei, betonte auch der Präsident der Bundesärztekammer, Prof. Dr. med. JörgDietrich Hoppe. Schließlich würden die in der Fortpflanzungsmedizin tätigen Ärztinnen und Ärzte regelmäßig mit dem Wunsch nach PGD konfrontiert. 37 D O K U M E N T A T I O N Deshalb müsse eine Entscheidung getroffen werden, ob die Präimplantationsdiagnostik kategorisch abgelehnt werden solle oder man sie bei streng begrenzten Indikationen zulassen wolle. Ein Verbot der PGD würde letztlich dazu führen, dass wieder auf die Möglichkeiten der Pränataldiagnostik verwiesen würde und man sich bei entsprechenden Ergebnissen möglicherweise für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet, sagte Hoppe. Seiner Auffassung nach ist eine isolierte Diskussion der Präimplantationsdiagnostik ohne eine generelle Diskussion über den Paragraphen 218 unvertretbar. Dr. med. Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Ärztekammer Hamburg, befürchtet wie Fischer einen ethischen Deichbruch. Über kurz oder lang würden bei allen In-vitro-Fertilisationsmaßnahmen PGDs nötig sein. Montgomery plädierte deshalb für ein Verbot der Präimplantationsdiagnostik. Ein Entschließungsantrag von Dr. med. HeinzMichael Mörlein wurde zurückgezogen. Darin hatte er vorgeschlagen, die gesetzliche und die berufsrechtliche Regelung der Präimplantationsdiagnostik an die Regelung zur Amniozentese anzulehnen. Von den Anträgen zum Tätigkeitsbericht der Bundesärztekammer, die ethische Fragestellungen berührten, wurde insbesondere die Empfehlung des Vorstands der Bundesärztekammer, die Menschenrechtskonvention zur Biomedizin des Europarats zu ratifizieren, kontrovers diskutiert. Diese so genannte Bioethik-Konvention ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen die Forschung an nicht einwilligungsfähigen Patienten. Prof. Dr. med. Eggert Beleites, Präsident der Landesärztekammer Thüringen, betonte die Notwendigkeit einer völkerrechtlich verbindlichen Konvention, um ein Mindestmaß an Schutz für die Zukunft zu gewährleisten. „Wir dürfen nicht so lange warten, bis wir nicht mehr mitreden dürfen.“ Durch Ratifizierung würden die auf nationaler Ebene geltenden höheren Schutzbestimmungen nicht aufgehoben. Montgomery verwies dagegen auf die Entschließung des 100. Deutschen Ärztetages in Eisenach, mit der die 38 Bundesregierung vor einer Ratifizierung der Menschenrechtskonvention zur Biomedizin gewarnt worden war. Mit dem Verweis auf den Standortnachteil gegenüber den Nachbarländern werde nach einer Ratifizierung der Druck von Industrie und Wissenschaft schon bald dazu führen, „das Schutzniveau bei uns herunterzufahren“. Als blauäugig bezeichnete er die Ansicht von Beleites, die Debatte um Ethik in der medizinischen Forschung etwa in den USA lasse sich durch europäische Konventionen beeindrucken. Der gerade bekannt gewordene Referentenentwurf aus dem Bundesjustizministerium, der vorsehe, Teile menschlicher Gene patentierbar zu machen, zeige zudem deutlich, dass wir auch in Deutschland „bereits auf der schiefen Ebene sind“. Mit knapper Mehrheit lehnten die Delegierten den von Montgomery eingebrachten Änderungsantrag zur Vorstandsvorlage ab. Sie stimmten jedoch einer Änderung zu, wonach die Ratifizierung der Menschenrechtskonvention zur Biomedizin nur unter der Voraussetzung erfolgen soll, dass der Schutz von nicht einwilligungsfähigen Menschen gewährleistet ist. Mit großer Mehrheit sprach sich der Deutsche Ärztetag gegen die Verwendung von Informationen über das menschliche Genom zu kommerziellen Zwecken aus. Die Patentierbarkeit von Genomen zum Schutz von biotechnologischen Erfindungen lehnten die Delegierten ab. Sie wandten sich zudem gegen einen Auskunftsanspruch von Versicherungen auf vorliegende Informationen aus einer Gendiagnostik. Befürchtet wird, dass aus Angst vor versicherungsrechtlichen Nachteilen diese wichtige Diagnostik nicht in Anspruch genommen wird. Gisela Klinkhammer, Thomas Gerst Heft 22, 2. Juni 2000 Fortpflanzungsmedizin Absage an jede Art eugenischer Zielsetzung Bundesgesundheitsministerin Fischer möchte das Embryonenschutzgesetz durch ein neues Fortpflanzungsmedizingesetz ablösen. D ie Geburt des ersten „Retortenbabys“ Louise Joy Brown hatte im Jahr 1978 für weltweites Aufsehen gesorgt. Heute ist die In-vitroFertilisation (IvF) in vielen Ländern Routine. In Deutschland sind den Methoden der Fortpflanzungsmedizin durch das Embryonenschutzgesetz (EschG) Grenzen gesetzt. Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer will dies jedoch durch ein neues Fortpflanzungsmedizingesetz abgelöst sehen, da ihr die Gesetzgebung von 1991 nicht mehr zeitgemäß erscheint. Zur besseren „Entscheidungsfindung“ hatte sie Ende Mai rund 600 Ärzte, Natur- und Geisteswissenschaftler, Juristen sowie Politiker zu einem dreitägigen Symposium nach Berlin eingeladen. Dort zog sich vor allem die Problematik der Präimplantationsdiagnostik (preimplantation genetic diagnosis = PGD), der auch ein eigener Tagesordnungspunkt gewidmet war, wie ein roter Faden durch die Diskussion. Es ging unter anderem aber auch um den Einsatz von Keimzellspenden sowie die Gewinnung und Verwendung humaner embryonaler Stammzellen. Mithilfe der Fortpflanzungsmedizin könne ein Kinderwunsch Realität werden, auch wenn die biologischen Vor- D O K U M E N T A T I O N aussetzungen dagegen sprächen, sagte Fischer zu Beginn der Veranstaltung. „Was jedoch aus Sicht des Einzelnen ein Fortschritt ist, kann Konsequenzen haben, die die Gesellschaft womöglich ganz grundlegend verändern.“ Die Möglichkeit, individuelles Leid zu verhindern, bedeute keine Rechtfertigung dafür, auch alles Machbare zu tun. Durch die neuen Techniken könne ein Klima entstehen, das den perfekten Menschen immer mehr zur Norm werden lasse und das es schließlich als rechtfertigungsbedürftig erscheinen lasse, wenn ein behindertes Kind zur Welt kommt. Diese Auffassung wurde von zahlreichen Teilnehmern des Symposiums geteilt. So sagte Prof. Dr. rer. biol. habil. Elmar Brähler, Leipzig, dass die Entwicklung der medizinischen Technik im Einzelfall zur programmierten Zeugung im Labor unter Einbeziehung von individuellen und sozial akzeptierten Wunschkriterien führen könnte. Die Männer würden zu Statisten degradiert, die Frauen würden zu Objekten der Lust, die Kinder zu Produkten. Mehrere Vertreter von Behindertenverbänden verwahrten sich ebenfalls dezidiert gegen jegliche Form selektiver pränataler Diagnostik. Kritik an PGD Einem „Machbarkeitswahn“ erteilte auch der Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), Prof. Dr. med. JörgDietrich Hoppe, eine Absage. Er warnte aber gleichzeitig davor, die Vorteile der modernen Fortpflanzungsmedizin zu übersehen. So bewerteten kinderlose Ehepaare die Reproduktionsmedizin oft als letzte Möglichkeit, ihrem Leiden mit Hilfe fortpflanzungsmedizinischer Technik begegnen zu können. In Deutschland sei es in den letzten Jahren zu einer enormen Ausweitung im Bereich der Reproduktionsmedizin gekommen. Neue wissenschaftliche Entwicklungen und molekularbiologische Kenntnisse hätten es außerdem möglich gemacht, im Rahmen der In-vitro-Fertilisation die Anlage schwerster genetischer Erkrankungen – allerdings nur solcher – durch die PGD schon in einer sehr frühen Phase der Entwicklung menschlichen Lebens zu erkennen. Bisher keine Richtlinie In Presseberichten zur Präimplantationsdiagnostik ist häufig die Rede davon, die Bundesärztekammer befürworte mittels einer Richtlinie die PGD unter strengen Auflagen. So ist es nicht. Bisher jedenfalls. Die Bundesärztekammer hat lediglich einen Diskussionsentwurf zur einer solchen Richtlinie vorgelegt; der wurde in Heft 9/2000 veröffentlicht. Daran schließt sich bis heute eine kontroverse Diskussion an. Eine Beschlussfassung der Bundesärztekammer DÄ steht aus. Doch gerade diese Art der Diagnostik stieß auf scharfe Kritik zahlreicher Kongressteilnehmer. „Präimplantationsdiagnostik ist de facto Eugenik, unabhängig von den Absichten oder Einstellungen derjenigen, die sie praktizieren“, betonte Privatdozentin Dr. phil. Kathrin Braun, Hannover. Für Dr. med. Dr. phil. Barbara Meier, Salzburg, könnte durch die Anwendung von PGD eine fragwürdige Entwicklung von einem Wunsch nach einem Kind zu einem „Recht“ beziehungsweise einer „Pflicht“ zu einem gesunden Kind die Folge sein. Der Theologe Prof. Dr. theol. Ulrich Eibach, Bonn, sieht die Präimplantationsdiagnostik sogar als mit dem Grundgesetz unvereinbar, nach dem die „Menschenwürde unantastbar und unverlierbar jedem Augenblick des Lebens von der Zeugung bis zum Tod zugeeignet ist“. Mit der PGD werde gegen dieses Verständnis von Menschenwürde verstoßen, „dadurch, dass eine konflikthafte Konkurrenz zwischen dem Leben des Embryos und den Lebensinteressen der Frau beziehungsweise des Paares nicht naturhaft schon vorliegt, sondern erst durch das bewusste Handeln Dritter, der Ärzte, hervorgerufen wird mit dem Ziel, die Embryonen bei mangelnder Qualität zu verwerfen“. PGD öffne die Tore zu weitergehenden Selektionen von und Manipulationen an Embryonen. Hoppe betonte dagegen, dass ein sehr restriktiver Einsatz der Präimplantationsdiagnostik eine deutliche Absage an jede Art von eugenischer Zielsetzung und Selektion begründe. Da die Medizin mit dieser diagnostischen Möglichkeit in Grenzbereiche ärztlichen Handelns vordringe, habe die Bundesärztekammer durch ihren Wissenschaftlichen Beirat einen „Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik“ vorgelegt“ (Heft 9/2000). Darauf, dass im Zusammenhang einer Diskussion über PGD auch über den Paragraphen 218 StGB neu nachgedacht werden müsse, hatte Hoppe bereits auf dem 103. Deutschen Ärztetag in Köln hingewiesen. Der Frankfurter Neonatologe Prof. Dr. med. Volker von Loewenich wies darauf hin, dass der menschliche Embryo im Glase strikten Schutz genieße, während er im Uterus nur sehr eingeschränkt geschützt sei. Beim nicht implantierten Embryo treffe der Tod ein so gut wie nicht ausdifferenziertes Individuum. Die Alternative zum Nichtimplantieren sei die gesetzlich mögliche Abtreibung, bei der ein viel weiter ausdifferenziertes menschliches Wesen getötet würde, über dessen Leidensfähigkeit man nichts Genaues wisse.Vor allem aber für die betroffene Frau sei die Abtreibung die weitaus traumatischere Intervention. Braun vertrat die Auffassung, dass die Schwangerschaft ein einzigartiger „Umstand“ sei, der mit keinem anderen gleichgestellt werden könne. Der Embryo beziehungsweise Fötus könne nicht durch Dritte gegen den Willen der Frau geschützt werden, ohne die Würde der Frau zu verletzen. Da dies bei Embryonen außerhalb des Frauenleibes nicht der Fall sei, könnten und müssten diese geschützt werden. PGD könne nicht mit Verweis auf das Selbstbestimmungsrecht der Frau legitimiert werden. Fischer wendet sich jedenfalls gegen eine neue Diskussion über die Abtreibungsgesetzgebung. Die bestehende Regelung sei Ergebnis einer langwierigen und schwierigen Kompromissfindung. Es gebe keine Veranlassung, diesen Kompromiss wieder infrage zu stellen, da die Möglichkeit der vorgeburtlichen Auswahl von Embryonen nicht mit einer tatsächlich eingetretenen Schwangerschaft verglichen werden könne. Die Gesundheitsministerin ist der Überzeugung, dass eine Verknüpfung mit der strafrechtlichen Bewertung des Schwangerschaftsabbruchs 39 D O K U M E N T A T I O N jedwede Entscheidungsfindung in Sachen Fortpflanzungsmedizin unmöglich machen werde. Konstruktive Diskussion Doch sollte das Embryonenschutzgesetz überhaupt revidiert oder durch ein neues Gesetz abgelöst werden? Ebenso wie bei der PGD gehen auch bei dieser Frage die Meinungen auseinander. Im Bereich der Fortpflanzungsmedizin seien Staat und Ärzteschaft gleichermaßen gefordert, sagte Hoppe. Während die Ärzteschaft „sehr frühzeitig berufsrechtliche Regelungen zur Fortpflanzungsmedizin erlassen hat und laufend aktualisiert, ist es Sache des Bundesgesetzgebers, die vor allem sozialrechtlich erforderlichen Rahmenbedingungen für eine ethisch vertretbare Fortpflanzungsmedizin zu entwickeln“. Der Gesetzgeber wäre gut beraten, „die medizinischen und naturwissenschaftlichen Fragen sowie Fragen der ärztlichen Ethik im System ärztlicher Selbstverwaltung zu belassen“. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hubert Hüppe lehnt jegliche Änderung des Embryonenschutzgesetzes ab. „Über Parteigrenzen hinweg besteht Einigkeit, dass der Schutz menschlicher Embryonen unangetastet bleiben muss.“ Doch eben dieser Schutz ist für Fischer durch das Gesetz offensichtlich nicht mehr eindeutig gewährleistet. Denn zum Beispiel bei der PGD gehen die Rechtsauslegungen auseinander. Während das Bundesgesundheitsministerium die Präimplantationsdiagnostik mit dem EschG für unvereinbar hält, kommt Prof. Dr. med. Hermann Hepp, München, zu dem Schluss, dass die Präimplantationsdiagnostik an einer nicht mehr totipotenten Zelle mit dem Embryonenschutzgesetz vereinbar sei (dazu Heft 18/2000). Am Ende des Symposiums war sich Fischer in diesem Punkt sicher: Sie will in einem neuen Fortpflanzungsmedizingesetz die PGD verbieten.Auch der Genehmigung einer Eizellspende stehe sie nach wie vor skeptisch gegenüber. Der möglicherweise zu regelnde Widerspruch bei der Verwendung embryonaler Stammzellen sei ihr erst auf Heft 30, 28. Juli 2000 Kinderwunsch Zu dem Beitrag „Fortpflanzungsmedizin: Absage an jede Art eugenischer Zielsetzung“ von Gisela Klinkhammer in Heft 22/2000: Gesetzgebung leistet Vorschub Unter eugenischer Zielsetzung versteht man das Bestreben, unter Anwendung medizinischer, insbesondere genetischer Erkenntnisse den Fortbestand günstiger Erbanlagen in einer menschlichen Population zu fördern und zu sichern. Wenn auch im genannten Artikel schon in der Titelzeile vermittelt werden soll, dass es sich hierbei um ein unter allen Umständen aus moralischen Erwägungen abzulehnendes Verhalten handelt, so lautet doch der nüchterne Befund, dass die bundesdeutsche Gesetzgebung ganz eindeutig dieser Zielsetzung Vorschub leistet, indem sie de facto den gezielten Abbruch behinderter Föten straflos lässt. Denn wer wollte bestreiten, dass Fruchtwasseruntersuchungen bei Schwangeren deshalb durchgeführt werden, um Fehlbildungen frühzeitig 40 zu erkennen und den betroffenen Fötus abzutreiben, weswegen von dieser Methode ausgiebig Gebrauch gemacht wird. Der Einwand unserer Gesundheitsministerin, dass die „Möglichkeit der vorgeburtlichen Auswahl von Embryonen nicht mit einer tatsächlich eingetretenen Schwangerschaft verglichen werden könne“, entbehrt jedlicher Beweiskraft . . . Wenn in dem Artikel außerdem die Rede davon ist, dass der Fötus nicht gegen den Willen der Frau geschützt werden könne, ohne ihre Würde zu verletzen, so muss sich der Urheber einer solchen Theorie (Braun) fragen lassen, warum dies nach der Geburt durchaus möglich sein soll: Eine nach der Geburt vom Vater des Kindes verlassene Frau, die daraufhin sich außerstande sieht, das Kind alleine aufzuziehen beziehungsweise dies als gegen ihre Würde gerichtet sieht, hat jedenfalls keine Möglichkeit, ihr Kind straflos zu töten . . . Dr. Martin Klein Hermann-Hesse-Weg 2 97276 Margetshöchheim dem Symposium wirklich deutlich geworden. Diese Problematik hatte Prof. Dr. iur. Dr. h. c. Rüdiger Wolfrum erläutert. Er hatte darauf aufmerksam gemacht, dass die fremdnützige Forschung an Embryonen in Deutschland weitgehender als in anderen Staaten verboten sei. „Bleibt in Deutschland die Herstellung von embryonalen Stammzellen verboten, wäre es dann nicht konsequent, in Deutschland auch die Anwendungen aus den entsprechenden Forschungsarbeiten zu untersagen, um dem Vorwurf der doppelten Moral zu entgehen?“ fragte Wolfrum. In vielen anderen Bereichen soll die Debatte, deren konstruktiven Beginn in Berlin die Ministerin begrüßte, fortgeführt werden. Deutlich wurde bei dem Symposium bereits jetzt, dass eine gesetzliche Regelung der angesprochenen Probleme, die nach dem Willen der Gesundheitsministerin noch in dieser Legislaturperiode durchgesetzt werden soll, nicht nur den Embryonenschutz betrifft, sondern Auswirkungen auf die gesamtgesellschaftliche Wertehaltung haben Gisela Klinkhammer wird. D O K U M E N T A T I O N Heft 28–29, 17. Juli 2000 Präimplantationsdiagnostik Nochmals: Öffentlicher Diskurs Anhaltende Diskussion im Leserkreis: Schwerpunkte sind weiterhin rechtliche und ethische Probleme. Der Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie der Bundesärztekammer zur Präimplantationsdiagnostik, veröffentlicht in Heft 9, hat eine umfangreiche Diskussion in der Öffentlichkeit und nicht zuletzt auch im Deutschen Ärzteblatt ausgelöst. Der Zusage der Redaktion entsprechend, sich nach Kräften am öffentlichen Diskurs zu beteiligen, folgen auf diesen Seiten weitere Stellungnahmen und Kommentare. Sie beziehen sich nicht nur auf die Richtlinien selbst, sondern auf die vorangegangene Leserdiskussion (Heft 17) sowie Berichte und Kommentare unter anderem von Dr. med. Frank Ulrich Montgomery sowie Prof. Dr. med. Hermann Hepp. Einige Stellungnahmen beziehen sich zudem auf Kommentare seitens des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer in Heft 17. Die Redaktion hat gelegentlich unter gleichartigen Zuschriften auswählen müssen. Die nachfolgenden Stellungnahmen geben jedoch insgesamt den Diskussionstand wieder, sofern er die Redaktion erreicht hat. Wir beenden fürs Erste die Aussprache. Kein Grund, das Tor zu öffnen U lrike Riedel, Abteilungsleiterin für Gesundheitsfürsorge und Krankheitsbekämpfung im Bundesgesundheitsministerium, hat in Heft 10/2000 des Deutschen Ärzteblattes den Standpunkt vertreten, die Präimplantationsdiagnostik (PGD ) stehe im Widerspruch zum Embryonenschutzgesetz (ESchG). Auch Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer hat sich in diesem Sinne geäußert. In der Debatte über den Diskussionsentwurf der Bundesärztekammer für eine Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik wird diese Auffassung jedoch angezweifelt. Ferner betont der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer, Prof. Dr. K.-F. Sewing, sowohl die Bioethik-Kommission des Landes Rheinland-Pfalz als auch der Wissenschaftliche Beirat seien „nach eingehender rechtlicher Prüfung zu dem Ergeb- nis gelangt, dass die Präimplantationsdiagnostik nicht mit dem Embryonenschutzgesetz kollidiert“. Der Bericht der Bioethik-Kommission Rheinland-Pfalz kommt zwar in These II 10 zu dem Ergebnis, dass die PGD mit der grundlegenden Vorschrift des § 1 Abs. 1 Nr. 2 ESchG vereinbar sei. Da sich die inhaltliche Begründung für diese Auffassung aber in einem Satz erschöpft, kann von einer eingehenden rechtlichen Prüfung kaum die Rede sein. Der Diskussionsentwurf der Bundesärztekammer für eine Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik enthält selbst auch keine argumentative Auseinandersetzung mit dem ESchG. Allerdings haben sich der Leiter der Arbeitsgruppe, die den Entwurf erarbeitet hat, Prof. Dr. Hermann Hepp, und Prof. Dr. H.-L. Schreiber für den Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer nachträglich zur Vereinbarkeit mit dem ESchG geäußert. Auch unter Berücksichtigung dieser Stellungnahmen führt eine detaillierte Prüfung jedoch zu dem Ergebnis, dass wesentliche Verfahrensschritte der Präimplantationsdiagnostik nach dem Embryonenschutzgesetz strafbar sind. Verbot der IVF zu diagnostischen Zwecken Nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 ESchG macht sich strafbar, wer „es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich zu befruchten, als eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt“. Von den Befürwortern der PGD wird diese Strafbestimmung als nicht einschlägig betrachtet, da das Verfahren schließlich darauf gerichtet sei, eine Schwangerschaft bei der betroffenen Frau herbeizuführen – wenn auch nach Durchführung diagnostischer Maßnahmen. Die Verwerfung von diagnostisch auffälligen Embryo- nen sei lediglich „eine dem Täter höchst unerwünschte Nebenfolge“. Bei genauer Betrachtung des Verfahrens der PGD stellt sich jedoch heraus, dass die „Befruchtung der Eizelle“ – so die tatbestandsmäßige Handlung gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 ESchG – nicht von vornherein mit dem Ziel erfolgt, eine Schwangerschaft bei der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt. Die Befruchtung erfolgt zunächst ausschließlich zum Zweck der präimplantorischen Qualitätskontrolle. Erst dann entscheidet sich, was mit dem Embryo geschehen soll. Die Entscheidung, durch Übertragung des Embryos in die Gebärmutter eine Schwangerschaft anzustreben, fällt nicht vor oder bei der Befruchtung, sondern erst nach der Untersuchung der befruchteten Eizelle. Dies wird auch im Richtlinienentwurf der Bundesärztekammer deutlich: „Nach PGD ist in einem erneuten Aufklärungs- und Beratungsgespräch mit dem Paar zu klären, ob und gegebenenfalls welche der Embryonen transferiert werden sollen . . .“ Das ganze Verfahren wurde schließlich entwickelt, um nicht „irgendeinen“, sondern nur einen auf bestimmte Krankheiten hin getesteten Embryo transferieren zu können. Vor und bei der Befruchtung steht die „Qualität“ des Embryos aber noch nicht fest. Die Herbeiführung einer Schwangerschaft mit dem durch IVF erzeugten Embryo ist im Zeitpunkt der Befruchtung daher nicht beabsichtigt. Wollte man annehmen, dass die genannten Bestimmungen des ESchG die Herbeiführung einer Schwangerschaft nur als „Endziel“ eines Vorgangs mit verschiedenen Teilschritten voraussetzen, wären in der Phase zwischen Befruchtung und Übertragung Manipulationen jedweder Art möglich, solange nur letztendlich wenigstens ein Embryo auf die Frau übertragen werden soll. Eine sachgemäße Interpretation des ESchG 41 D O K U M E N T A T I O N kann aber nur darin bestehen, dass sich das Tatbestandsmerkmal „Herbeiführung einer Schwangerschaft“ auf den einzelnen extrakorporal erzeugten Embryo bezieht. Die Formulierung des ESchG ist insoweit an Eindeutigkeit kaum zu überbieten. Es kommt darauf an, welcher Zweck konkret bei der Befruchtung der Eizelle hinsichtlich genau dieser Eizelle verfolgt wird. Wenn die Herbeiführung einer Schwangerschaft beabsichtigt ist, ist die Befruchtung der Eizelle zulässig. Besteht diese Absicht nicht und erfolgt die Entscheidung über den Transfer erst zu einem späteren Zeitpunkt – nach der Diagnose –, liegt eine nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 ESchG „missbräuchliche Anwendung von Fortpflanzungstechniken“ vor. Der zunächst ausschließlich verfolgte Zweck der künstlichen Befruchtung ist die Selektion genetisch belasteter Embryonen. Der später eventuell hinzukommende Transfer auf die Frau kann den bereits vollendeten Verstoß gegen das ESchG in seiner rechtlichen Bedeutung nicht mehr beeinflussen. Dass die Methode der IVF hier „missbraucht“ wird, ist auch daran erkennbar, dass diejenigen Paare, für die PGD in Betracht kommt, regelmäßig in ihrer natürlichen Fortpflanzungsfähigkeit nicht eingeschränkt sind. Der Hinweis von Schreiber, dass das Ergebnis der Diagnostik nur eine Bedingung der Entscheidung für die Herbeiführung der Schwangerschaft sei und der Arzt auch bei regulärer IVF „den anschließenden Embryotransfer stets von der Bedingung abhängig macht, dass sich die Patientin auch später noch bereit erklärt, diesen vornehmen zu lassen“, geht fehl. Zum einen ändert dies nichts daran, dass der Tatbestand des § 1 Abs. 1 Nr. 2 ESchG bereits verwirklicht ist, wenn die „Bedingung“ für den Embryotransfer eintritt. Zum Zweiten werden hier ersichtlich zwei Situationen verglichen, die unter völlig unterschiedlichen Voraussetzungen stehen. Voraussetzung einer „normalen“ IVF-Behandlung ist die Einwilligung der Frau in die Befruchtung und die Übertragung der Eizellen. Damit ist die „Bedingung“, mit dem Transfer der Embryonen einverstanden zu sein, bei jeder IVF-Behandlung von vornherein gegeben. Bei der PGD ist diese Bedin- 42 gung jedoch im Zeitpunkt der Befruchtung von vornherein nicht gegeben. Sie kommt erst später hinzu. Damit liegt nur im Fall der PGD eine echte „bedingte Zeugung“ vor. Aus dem Ablauf der normalen IVF-Behandlung lässt sich kein Argument für die PGD gewinnen. Verbot der Verwendung totipotenter Zellen zur Diagnostik Weitgehende Einigkeit besteht darin, dass ein Verstoß gegen § 2 Abs. 1 ESchG vorliegt, wenn totipotente Zellen (bis etwa zum 8-Zell-Stadium) zum Zweck der PGD entnommen und „verbraucht“ werden. Die entnommenen totipotenten Zellen sind gem. § 8 Abs. 1 ESchG einem Embryo gleichgestellt. Ihr Verbrauch im Rahmen der Diagnose dient offensichtlich nicht dem Erhalt dieser Zellen und stellt daher einen Verstoß gegen § 2 Abs. 1 ESchG dar. Sachlich könnte man das Verfahren auch als „Klonierung“ eines Zwillings (durch Abspalten einer totipotenten Zelle) beschreiben, der für Diagnosezwecke verbraucht werden soll. Damit ist auch der Straftatbestand von § 6 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 1 ESchG erfüllt. Verwerfung des (Rest-)Embryos bei positivem Befund Wenn die PGD ergibt, dass der getestete Embryo den befürchteten Gendefekt hat, wird er nicht auf die Frau übertragen, sondern „verworfen“. Dies ist wiederum nach § 2 Abs. 1 ESchG strafbar. Denn das „Wegschütten“ oder anderweitige Abtöten des genetisch auffälligen Embryos dient „nicht seiner Erhaltung“ und wird von § 2 Abs. 1 ESchG erfasst. Kann dem entgegengehalten werden, dass die einzige Möglichkeit, sich der Bestrafung zu entziehen, nämlich die Übertragung des Embryos auf eine Frau, ebenfalls strafbar wäre (§ 6 Abs. 2 ESchG)? Kann das Recht jede denkbare Verhaltensalternative unterschiedslos unter Strafe stellen? Die Lösung dieses Problems liegt darin, die Geltung von § 6 Abs. 2 ESchG zu hinterfragen. Wenn das Gesetz ausdrücklich in dieser Vorschrift für geklonte Embryonen eine „Tötungspflicht“ vorsieht,weil sie nicht auf eine Frau übertragen werden dürfen, liegt ein Verstoß gegen Art. 2 Abs. 2 S. 1 i. V. m. Art. 1 GG vor. In dem Bestreben, menschliche Klone zu verhindern, ist der Gesetzgeber offensichtlich über das Ziel hinausgeschossen. Das Verbot, genetisch identische Mehrlinge künstlich herzustellen, ist nachvollziehbar, berechtigt aber nicht dazu, einmal verbotswidrig entstandene menschliche Embryonen per Gesetz zum Tode zu verurteilen. § 6 Abs. 2 ESchG ist daher aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht anzuwenden. § 2 Abs. 1 ESchG bleibt damit auf den Umgang mit denjenigen Restembryonen, die nach der Diagnostik nicht transferiert werden sollen, anwendbar. Wertungswiderspruch und „PGD-Tourismus“ Von den Befürwortern der PGD wird – nicht ganz zu Unrecht – angeführt, dass die Schutzbestimmungen des ESchG in einem Wertungswiderspruch zu der weitgehenden Zulässigkeit von embryopathisch motivierten Abtreibungen stünden. Ferner würden ausländische Forscherteams die Technik ohnehin anwenden. Während de facto das Problem nur ins Ausland verlagert werde („PGD-Tourismus“), führe ein Verbot der PGD zu einer wesentlichen Erschwerung der wissenschaftlichen Weiterentwicklung auf diesem Gebiet. Der Wertungswiderspruch zu den Abtreibungsbestimmungen ist de lege lata hinzunehmen. Er war auch dem Gesetzgeber zum Zeitpunkt der Verabschiedung des ESchG bekannt. Ob die Begründungen für die unterschiedliche Behandlung menschlicher Embryonen im oder außerhalb des Mutterleibes tragfähig sind, kann hier nicht erörtert werden. Differenzierungsgesichtspunkte gibt es durchaus. Jedenfalls ist es nicht zwingend, die Auflösung eines Wertungswiderspruchs in Richtung des niedrigeren Schutzniveaus zu fordern. Aus verfassungsrechtlichen Gründen, dem Benachteiligungsverbot für Behinderte (Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG), wäre vielmehr das Gegenteil angemessen. Hinzu kommt, dass durch die PGD embryopathisch motivierte Schwangerschaftsabbrüche nicht wirklich vermieden werden können, weil „zur Absicherung“ D O K U M E N T A T I O N des Ergebnisses der PGD in der Regel eine spätere Pränataldiagnostik erforderlich ist. Auch der Verweis auf die Praxis im Ausland überzeugt nicht. Der deutsche Gesetzgeber kann nur für den eigenen Zuständigkeitsbereich Regelungen treffen. Abweichende Bestimmungen im Ausland beeinflussen die Begründetheit der nationalen Regelung nicht. Die in Deutschland geltenden Arbeitsschutzbestimmungen können beispielsweise nicht schon deshalb zur Disposition gestellt werden, weil in Japan oder Indien das Schutzniveau niedriger ist. Wenn es vernünftige Gründe für Schutzbestimmungen gibt, sollten sie verwirklicht werden – und möglicherweise anderen Staaten als Beispiel dienen. Das muss auch und vor allem für den Schutz menschlichen Lebens gelten. Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass der Anwendung der PGD in Deutschland gegenwärtig mehrere Strafvorschriften des ESchG entgegenstehen. Dies gilt nicht nur bei der Verwendung totipotenter Zellen. Die PGD stellt nach geltendem Recht generell eine missbräuchliche Anwendung von Fortpflanzungstechniken dar. Die rechtspolitische Frage, ob die bestehenden Schutzvorschriften geändert werden sollten, ist damit zwar nicht beantwortet. Falls sich aber die gesellschaftlichen, ethischen und verfassungsrechtlichen Einschätzungen, die zum ESchG geführt haben, seit dessen Verabschiedung im Jahr 1990 nicht verändert haben, gibt es keinen Grund, das Tor zur bedingten Zeugung mit vorgeplanter Selektion und einkalkulierter Vernichtung menschlicher Embryonen zu öffnen. Literatur beim Verfasser Rainer Beckmann Richter am Amtsgericht Mitglied der Enquete-Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“ des Deutschen Bundestages Friedenstraße 3a, 97318 Kitzingen Wertungswidersprüche – oder widersprüchliche Wertungen? In der Debatte über die Einführung der Präimplantationsdiagnostik auf der Grundlage einer Richtlinie der Bundesärztekammer taucht, um die Zulässig- keit der PID zu begründen, immer wieder die Argumentationslinie auf, es gebe einen Wertungswiderspruch zwischen § 218 StGB neuer Fassung und einem Verbot der PID. Es könne nicht sein, dass dem Embryo in vitro eine höhere Schutzwürdigkeit zuerkannt wird als dem Embryo in vivo, dessen Abtreibung nach § 218 a StGB straffrei möglich sein kann. Demgegenüber betont Hepp zu Recht, dass auf der Grundlage der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Tötung eines Embryos in vivo rechtswidrig ist; insoweit besteht in der Tat kein Wertungswiderspruch. Hepp versucht dann aber dennoch einen Wertungswiderspruch unter Berufung auf die klinische Wirklichkeit, die Möglichkeit einer „Schwangerschaft auf Probe“ unter § 218 StGB und einen auf den Zeitpunkt der PID antizipierten Schwangerschaftskonflikt zu konstruieren. Dagegen ist Folgendes einzuwenden: Auf der Suche nach einem möglichen Wertungswiderspruch kommt es entscheidend darauf an, die richtigen Bezugspunkte zu wählen. Nicht die Nichtdurchführung der PID „zwingt“ später zu einem Schwangerschaftsabbruch, sondern die Durchführung der In-vitro-Fertilisation.Wenn die Rede von einem antizipierten Schwangerschaftsabbruch sein soll, muss konsequent antizipiert werden, das heißt nicht nur bis zur Möglichkeit der PID, sondern bis zum Segen der IVF. Die entscheidende Frage lautet dann, ob im Zeitpunkt der Durchführung der IVF entweder eine Situation vorliegt, die bereits zu diesem Zeitpunkt einen Schwangerschaftsabbruch rechtfertigen würde, oder ob bereits zum Zeitpunkt der IVF feststeht, dass später ein Schwangerschaftsabbruch gerechtfertigt sein wird. Im ersten Fall ist die Durchführung der IVF nicht nachvollziehbar. Im zweiten Fall ist wesentlich, dass die medizinische Indikation des § 218 a Abs. 2 StGB ausschließlich auf die Gesundheit der Frau und nicht auf das Kind abstellt. Zum Wegfall der früheren embryopathischen Indikation formuliert Eser in Schönke/Schröder, Kommentar zum StGB,25.Auflage:„Obgleich es schon bei der bisher (das heißt nach § 18 StGB a. F.) eingeräumten Zulassung eines Schwangerschaftsabbruchs im Falle einer genetischen und pränatalen Schädigung des Kindes nicht um die Verhinde- rung erbkranken Nachwuchses als solches ging, sondern letztentscheidend damit allein der Schwangeren die befürchtete psychische Belastung erspart werden sollte, war damit die Gefahr nicht auszuschließen, dass dadurch langfristig das Tor zur platten Eugenik geöffnet werden könnte.“ . . . „Deshalb ist vor jedem Automatismus zwischen Befund und Schwangerschaftsabbruch zu warnen.“ Was bedeutet das für einen „antizipierten Schwangerschaftskonflikt“ im Zeitpunkt der IVF? Dass eine physische Gesundheitsgefahr für die Frau, die eine Abtreibung nach § 218 a Abs. 2 StGB rechtfertigt, aufgrund einer durch die PID festzustellenden Behinderung des Kindes droht, ist unwahrscheinlich. Soweit bereits im Zeitpunkt der Durchführung einer IVF bei der Gesamtwürdigung der Umstände soziale Aspekte eine Abtreibung rechtfertigen würden, wäre die Durchführung der IVF nicht nachvollziehbar. Bleiben psychische Gesundheitsgefahren für die Frau.Muss in einem solchen Fall die IVF durchgeführt werden? Wenn bei einem Paar mit hohem Risiko für eine schwerwiegende Behinderung des Nachwuchses (nur dann soll nach dem Richtlinienentwurf eine PID zugelassen werden) diese Behinderung eine solche seelische Gefahr für die Mutter bedeuten würde, dass dies eine Abtreibung rechtfertigte, stellt sich die Frage,ob in dieser Situation die IVF gerechtfertigt ist. Werden hier nicht mit dem Segen einer neuen Technik Mutter und Kind in einen Schwangerschaftsabbruch getrieben? Diese Fragen werden umso drängender, wenn man bedenkt, dass der PID ausschließlich eine rationale Entscheidung zu ihrer Durchführung vorangeht, was im Fall der natürlichen Fortpflanzung mit derselben Ausschließlichkeit nicht als Regelfall unterstellt werden kann.Wenn üblicherweise pränatale Diagnostik und PID verglichen werden, sei hier die Frage gestellt, weshalb die IVF eine Konfliktsituation überhaupt aufbauen muss, nur weil sie sich nach einer PID möglicherweise „einfacher“ lösen lässt als nach einer PND. Unter Berufung auf die in der klinischen Wirklichkeit bestehende Möglichkeit einer „Schwangerschaft auf Probe“ in Verbindung mit der PND konstruiert Hepp dann doch einen angeblichen Wer- 43 D O K U M E N T A T I O N tungswiderspruch zwischen § 218 StGB und einer Nichtzulassung der PID. Dem ist entgegenzuhalten, dass aus der Möglichkeit des kalten Missbrauchs einer Regelung, die einen existenziellen Konflikt lösen soll, nicht der Schluss zulässig ist auf die Ausweitung der vom Gesetz notgedrungen zugelassenen Konfliktlösung auf Fälle des gezielten Missbrauchs. Keine Gleichheit im Unrecht! Dem noch vorgängig ist die Frage, wie sich die so genannte „Schwangerschaft auf Probe“ und eine zu prognostizierende psychische Belastung der Frau vereinbaren lassen. Auch bei einer „Schwangerschaft auf Probe“ kann die Frau nicht sicher sein, dass eine Abtreibung zulässig sein wird. Wenn sie trotzdem eine Entscheidung für eine „Schwangerschaft auf Probe“ trifft, schreitet sie in berechnender Absicht in eine Konfliktlage, die ihr das Gesetz ausnahmsweise abnehmen will. Entweder ist der Konflikt dann ernst, dann ist die rationale Entscheidung für eine „Schwangerschaft auf Probe“ weder nachvollziehbar noch sanktionierbar. Oder das mit dem Konflikt war doch nicht so ernst gemeint. Dann scheidet eine Berufung auf § 218 a Abs. 2 StGB aus. In jedem Fall lassen sich kühles Kalkül und existenzieller Konflikt nicht vereinbaren. Man könne „mit Hilfe der PND die Geburt eines gesunden Kindes gleichsam erzwingen“, formuliert Hepp. Das mag schon sein, dass man das kann. Zu dieser Haltung passt aber nicht, dass sich Hepp direkt im nächsten Satz auf einen „Konflikt auf dem Boden der Autonomie der Mutter und der ihr durch ein krankes Kind nicht zumutbar erscheinenden Belastung für die Phase nach der Geburt“ beruft. Muss die IVF zugelassen werden, um die Geburt eines gesunden Kindes gleichsam zu erzwingen? Diese Argumente zeigen, dass jedenfalls ein „Dammbruch“, ausgehend von § 218 StGB, zur Zulässigkeit der PID nicht zwingend ist. Bei genauer Betrachtung, insbesondere der Tatsache, dass § 218 a StGB nur auf die Gesundheit der Mutter schaut und dass Bezugspunkt für eine Antizipation des Konflikts nicht die PID, sondern die IVF ist, wird deutlich, dass § 218 StGB als Argument für die Zulässigkeit der PID nicht taugt. Die Berufung auf Missbrauchsmöglichkeiten in 44 der klinischen Wirklichkeit führt andererseits zur Frage, ob es letztlich gar nicht um die Auflösung von Wertungswidersprüchen geht, sondern darum, den Damm etwas zu lockern. Die medizinische Machbarkeit ist dafür kein Grund. Regierungsrat Steffen Walter Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg Königstraße 46, 70173 Stuttgart Menschenzucht Ich möchte einen Gesichtspunkt in die Diskussion einbringen, der bisher keine Beachtung fand und wohl auch wissentlich verschwiegen wurde. Im Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik (PGD) steht im Vordergrund die Situation von kinderlosen Paaren, bei deren Kindern ein genetisches Risiko besteht. In diesen Fällen kann nach einer Invitro-Fertilisation zu einem sehr frühen Zeitpunkt eine genetische Überprüfung des Embryos erfolgen und gegebenenfalls das krankhafte Produkt vernichtet oder auch manipuliert werden. De facto reicht die Problematik weit über diese eng umgrenzte Situation hinaus, und durch keine noch so strenge Regelung wird sich die PGD auf Dauer auf diesen Bereich beschränken lassen. Die Präimplantationsdiagnostik kann nur durchgeführt werden, wenn ein Embryo nach der Befruchtung in vitro zur Verfügung steht. Diese Situation wurde erstmals mit der Technik der In-vitroFertilisation (IVF) möglich. Bei diesem Verfahren erfolgt allerdings die Befruchtung der Eizelle durch eins von der Vielzahl der vorhandenen Spermien, der natürlichen Situation entsprechend unbeeinflusst. Anders ist dies bei der Technik der intracytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI), die nahezu zwingend eine PGD erfordert, eine artifizielle Befruchtung. Bei ICSI wird ein Spermium selektiert und gezielt manuell gesteuert in eine Eizelle gebracht und damit der Befruchtungsprozess in Gang gesetzt. Es sei darauf hingewiesen, dass die beiden Techniken PGD und ICSI fast zeitgleich entwickelt wurden. Die primäre Indikation für ICSI ist die männlich bedingte Sterilität, das heißt in den Fällen, wo defekte, pathologische oder unreife Spermien vorliegen, die von sich aus nicht die Fähigkeit haben zu befruchten. Selbst bei einer Azoospermie kann mit aus Hodenbiopsien gewonnenen Spermien durch intracytoplasmatische Injektion eine Befruchtung erzwungen werden. Bei dieser Ausgangssituation ist mit einer gesteigerten Zahl von genetischen Störungen zu rechnen; nicht nur genetisch bedingte Sterilität wird weitergegeben. Welchen Einfluss die mechanische Irritation bei der Manipulation hat, ist letztlich nicht geklärt. Defekte und Fehlentwicklungen beim Embryo sollen dann mit der PGD erfasst und eliminiert werden. ICSI wird zwar von den Kassen nicht bezahlt, aber dennoch in ständig steigendem Umfang durchgeführt. Diese Praxis zeigt, welchen Einfluss gesetzgeberische Maßnahmen auf die Anwendung von neuen Techniken haben, obwohl eine Entscheidung des Bundesausschusses Ärzte und Krankenkassen, ICSI nicht als Kassenleistung anzuerkennen, vorliegt. Daher ist es fraglich, ob entsprechende Regelungen für PGD überhaupt greifen werden. Für die Entscheidung pro oder kontra PGD wesentlich erscheint mir die Einsicht, dass ICSI plus PGD Menschenzucht ist, der Beginn einer genetischen Selektion beim Menschen. Selektiert wird gezielt ein Spermium zur Befruchtung, und nach der Befruchtung kann der Embryo in Abhängigkeit von der genetischen Diagnose selektiert werden. Beide Techniken sind Eugenik: ICSI im negativen Sinn, da spontan nicht zur Befruchtung taugliche Spermien zur Fertilisation manipuliert werden und als Folge davon mit einem Weiterreichen von Fehlinformationen an die Kinder gerechnet werden muss. PGD im „positiven“ Sinn, da hier ein Aussortieren nach der Fertilisation in vitro erfolgt. Dem Verbot einer PGD, wie von Montgomery gefordert, muss ein Verbot von ICSI vorausgehen. Der Beitrag von Montgomery ist klar und eindeutig, der von Hepp wortreich und unverbindlich. Noch so ausgeklügelte Regularien werden nicht verhindern, dass die PGD aus vielfältigen Gründen bei in vitro gezeugten Embryonen erfolgen wird. Ich hoffe, dass sich noch viele einsichtige und verantwortungsbewusste Mediziner zum eindeutigen Nein bekennen. D O K U M E N T A T I O N Die breite „öffentliche Meinung“ ist sicherlich überfordert. Das zeigt die unreflektierte, breite Zustimmung zu ICSI, offensichtlich ist es schwer, den qualitativen Unterschied zwischen der natürlichen Befruchtung und der künstlichen zu verstehen. ICSI und PGD sind die Techniken für eine Eugenik. „Gegen das, was der Fortschritt der Fortpflanzungstechnik, der zwangsläufig auch ein Fortschritt an Eugenik ist, an moralisch Zweifelhaftem noch zu bieten hat, wird die Atombombe ein sittliches Kinderspiel gewesen sein.“ (C. Koch, Ende der Natürlichkeit. Eine Streitschrift zu Biotechnik und Bio-Moral, Hanser 1994) Prof. Dr. Gerhard Bettendorf ehem. Direktor der Abteilung für klinische und experimentelle Endokrinologie und des Reproduktionszentrums der Universität Hamburg Friedrich-Kirsten-Straße 19, 22391 Hamburg Kinderlosigkeit: Zumutbares Schicksal Es ist wohltuend, in einer ärztlich-anthropologischen Grundsatzdiskussion, die im Kontext der Präimplantationsdiagnostik (PID) entbrannt ist, aus dem Mund wenigstens eines Kammerpräsidenten kompetente und insofern auch mutige Worte zu hören,die einen eigenen Standpunkt klar formulieren, der nicht unbedingt Zeitströmungen hörig ist. Dafür möchte ich dem Hanseaten Montgomery danken und Respekt zollen, dass er aus einem tiefen ärztlichen Verantwortungsbewusstsein heraus unpolemisch, aber unmissverständlich zur aktuellen Situation der PID-Diskussion eine prospektive Sichtweise entwickelt, die würdig neben einer solchen von Aldous Huxley steht. Gestatten Sie mir aber noch eine persönliche Ergänzung. Wie Herr Hepp im gleichen Heft schreibt, hat die PID zur Aufklärung des genetischen Status des Embryos eine In-vitro-Fertilisation zur Voraussetzung. Hier an der ursächlichen Wurzel dieser ganzen Problematik möchte ich ansetzen. Ich stelle die Frage, ob in einer Welt, die bevölkerungspolitisch überquillt, überhaupt eine IVF sozialethisch zu rechtfertigen ist. Hinzu kommt, dass unsere Solidargemeinschaft im medizinischen Bereich heute bereits überfordert ist, sogar wenn es um existenziell bedrohliche Situationen geht. Im Kontext dazu möchte ich nur auf die im gleichen Heft erschienene Arbeit „Radioonkologie, Strahlenbiologie und medizinische Physik“ Bezug nehmen, wonach es „wegen des hohen finanziellen Aufwandes . . . Protonen für den klinischen Einsatz . . .“ in Deutschland erst seit 1998 möglich war, eine Therapieeinheit zu errichten. Hier stellt sich mir als langjährigem Frauenarzt trotzdem die Frage, ob ein Kinderwunsch – bei Würdigung aller Fakten – Priorität haben muss beispielsweise vor der Therapie besonderer maligner Tumoren? Kinderwunsch, so edel er sein mag, ist keine Existenzfrage. Verzicht auf ein Kind – ob primär oder bei Verdacht auf genetisches Risiko – ist ein zumutbares Schicksal, zumindest rechtfertigt es nicht die finanzielle Belastung der Solidargemeinschaft. Der Kinderlosigkeit lässt sich überdies durch die Möglichkeit der Adoption eines der vielen armen Kinder auf unserer schönen neuen Welt begegnen. Dies könnte mit echter Liebe zum Kind erreicht werden, allerdings nicht durch narzisstische Liebe zu sich selbst oder Forschernarzissmus, alles möglich zu machen, koste es, was es wolle. Dr. med. Günter Link Auf der Halde 13, 87439 Kempten Die PGD kommt Sehr geehrter Herr Kollege Montgomery, Sie (und alle anderen) können dieses Thema wenden und drehen, wie Sie wollen. Die PGD kommt so bestimmt wie der nächste Winter, letzten Endes routinemäßig ohne besondere Indikation. – Nein, ich bin kein Prophet. Dr. med. Josef Sliva 73117 Wangen Nachdenken über Limitierung der künstlichen Befruchtung Den Ausführungen von Dr. Montgomery ist im Hinblick auf die Präimplantationsdiagnostik absolut zuzustimmen. Zu fragen wäre nur, ob es tatsächlich ungewollt ist, dass der genetischen Selektion die Tür geöffnet wird, wenn die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe schon die Forcierung der Pränataldiagnostik für notwendig hält, weil immer weniger Kinder geboren werden. Der wenige Nachwuchs in Deutschland soll dann im Sinne des „Designer Child’s“ wenigstens gesund sein. Prof. Hepp widerspricht sich in seinem Beitrag zur PGD leider selbst. Wenn das menschliche Leben – nach einhelliger naturwissenschaftlicher Meinung – mit der Konjugation der haploiden Chromosomensätze beginnt, dann ist die Präimplantationsdiagnostik eine sehr frühe Form der Pränataldiagnostik und hat nichts mit der Implantation und dem Beginn der Schwangerschaft zu tun. Pränataldiagnostik ist eine Untersuchung des Menschen vor seiner Geburt. Ist dies der subtile Versuch, doch eine Abstufung des Lebensrechtes zu erreichen? Es ist zudem erstaunlich, dass in der Debatte um die PGD die Befruchtungskontrolle kaum erwähnt wird. Vor der Präimplantationsdiagnostik steht bereits die Untersuchung der befruchteten Eizelle auf ihre Vorkerne. Bereits ein Abweichen von den „normalen“ zwei Vorkernen führt zur Vernichtung der Zygoten, obwohl man weiß, dass sich mindestens 14 Prozent dieser Embryonen normal entwickeln können. Die Selektion, die Vorsicht vor dem nicht ganz Normalen und die Unterscheidung zwischen lebenswert und lebensunwert beginnt damit schon vor der genetischen Untersuchung. Leider blieb bisher auch zu wenig beachtet, dass amerikanische Fortpflanzungsmediziner die anschließende Pränataldiagnostik zur Sicherung des Ergebnisses der PGD besonders empfehlen. Die Meldung über 50 000 vernichtete Embryonen in England – ebenfalls in Heft 18/2000 – müsste jede weitere Diskussion über die Präimplantationsdiagnostik im Keim ersticken und – wie von Dr. Montgomery gefordert – zu einem absoluten Verbot führen. Notwendig ist zusätzlich ein intensives Nachdenken über eine gesetzliche Einschränkung der Pränataldiagnostik und Limitierung der künstlichen Befruchtung . . . Dr. med. Claudia Kaminski Ottmarsgässchen 8, 86152 Augsburg 45 D O K U M E N T A T I O N Ethisch nicht vertretbar Herrn Dr. Montgomery ist sehr zu danken für sein klares Plädoyer, die Präimplatationsdiagnostik zu verbieten. Dabei bildet weniger die Diagnostik an sich das Problem; vielmehr sind es die Konsequenzen, die sich aus dieser Diagnostik ableiten. Solange therapeutische Möglichkeiten fehlen und solange lediglich die Tötung des ungeborenen Menschen die Folge ist, lässt sich die Präimplantationsdiagnosik ethisch nicht vertreten. Natürlich ist es Aufgabe eines jeden Arztes, Krankheit zu verhindern. Doch auch hier sind seinem Handeln ethische Grenzen gesetzt. Es ist keine Prophylaxe, eine Erkrankte/einen Erkrankten frühzeitig zu identifizieren und dann zu töten. Dr. Rupert Pullen Anemonenweg 1, 42553 Velbert Alternativen In den Diskussionsbeiträgen zur Präimplantationsdiagnostik kann man leider nicht durchweg erkennen, dass im Mittelpunkt aller Überlegungen ein Ehepaar mit Kinderwunsch steht, das ein hohes genetisches Risiko trägt und damit rechnen muss, dass eine oder eine weitere Fehlgeburt,Totgeburt oder Geburt eines schwer geschädigten oder bald sterbenden Kindes zu befürchten ist. Wir Ärzte werden zum genetischen Risiko beziehungsweise Wiederholungsrisiko gefragt, nennen die Gefahr und sind dem ärztlichen Ethos verpflichtet vorzubeugen und zu heilen. Die Präimplantationsdiagnostik bietet die Möglichkeit der Verminderung des Risikos, dass schwer defektive Nachkommen entstehen, bevor der Embryo in den Mutterleib transferiert wird, bevor die Nidation als Bindung von Embryo und Mutter erfolgt und bevor Organsysteme entstehen, die das Menschenkind erst einmal lebensfähig werden lassen. Und schließlich wird ein Schwangerschaftsabbruch bis zur zwölften SSW (oder gar noch später?) vermieden. Der BÄK-Richtlinienentwurf gibt eine simple Empfehlung, wie die ethischen Konflikte der PID vermeidbar sind: „indem betroffene Paare bewusst auf Kinder 46 verzichten oder sich zu einer Adoption entschließen“. Der Ethos vom Verzicht entspricht der Schicksalsergebenheit gegenüber einer höheren Gewalt. Ärztlicher Ethos erlaubt uns nicht, apathischnihilistisch Krankheiten, Leiden und Schäden als Schicksal hinzunehmen, solange Hoffnung auf Vermeidung und Heilung besteht. Der BÄK-Richtlinienentwurf nennt leider nicht die schlechten Chancen für eine Adoption. In Deutschland warten sechs bis acht Ehepaare auf ein adoptierbares Kind, die meisten warten frustriert jahrelang, bis sie schließlich für die Adoption zu alt geworden sind. Der BÄK-Richtlinienentwurf nennt leider auch nicht eine seit über 30 Jahren in Deutschland sehr erfolgreich praktizierte Heilbehandlung, die dem Rat suchenden Ehepaar unbedingt genannt werden sollte, die donogene (gespendete, d. Red.) Insemination und donogene IVF aus genetischer Indikation. Sie ist weder ethisch noch rechtlich unzulässig. Seit Jahren existieren Richtlinien zur Spenderauswahl und zur Verfahrensweise. Das Ehepaar muss selbst zwischen Adoption, donogener Befruchtung und Verzicht entscheiden. Prof. Dr. E. Günther Max-Steenbeck-Straße 46, 07745 Jena Anspruchsdenken verschließen Mit der In-vitro-Fertilisation hat man die Basis ärztlichen Handelns verlassen. Mit ESchG und Richtlinien zur PID versucht man jetzt Dämme aufzurichten, die wahrscheinlich nicht lange, auf keinen Fall ewig halten werden. Offen wird in einzelnen Diskussionsbeiträgen bereits von eugenischen Zielsetzungen gesprochen. Zuerst wollte man nur den Kinderwunsch von Paaren erfüllen, jetzt wird bereits von amerikanischen Gerichten ein Recht des Kindes auf körperliche und geistige Gesundheit festgelegt, demnächst wird ein behindertes Kind seine Eltern auf Schadensersatz verklagen können. Und niemand kann sich damit entschuldigen, das habe er nicht gewollt. Erst 1968 wurde von der Bundesregierung das 1933 erlassene „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ endgültig für unwirksam erklärt, vorher war es nur dispensiert. Die Idee der Eugenik geht auf Sir Francis Galton zurück, welcher forderte, eine verantwortungsvolle Menschheit müsse ihre „Zuchtwahl“ selbst in die Hand nehmen, um die Bevölkerung vor einem vermeintlichen biologischen Niedergang zu bewahren. Und 1930 rief der Generalsekretär der American Eugenics Society aus: „In Zukunft wird der Mensch auf das 20. Jahrhundert zurückblicken und es das eugenische Jahrhundert nennen. Eugenik fegt wie eine große Religion über die Welt.“ Der Medizin wuchs die Rolle des Vollstreckers des sozial Wünschenswerten und scheinbar wissenschaftlich Erforderlichen zu. Wie es geendet hat, wissen wir. Was vergessen wurde, ist die Resonanz, welche diese Ideen seinerzeit hatten. Selbst die späteren Friedensnobelpreisträger Aiva und Gunnar Myrdal forderten ein schonungsloses Sterilisationsprogramm, und der amerikanische Physik-Nobelpreisträger W. Shockley wollte alle Menschen mit niedrigem IQ sterilisiert wissen. Zwangssterilisationen so genannter Erbkranker fanden bis in die jüngste Zeit in europäischen Ländern statt. Und jetzt leben diese Ideen in neuem Gewand wieder auf. Statt der Zuchtwahl geht es jetzt um die Evolution, „es sei an der Zeit, dass der Mensch seine Evolution selbst in die Hand nehme“, so Nobelpreisträger James Watson auf einem Symposion der Universität von Kalifornien in Los Angeles 1998. Vordergründig wird die Notwendigkeit einer Keimbahntherapie mit dem bisherigen Misserfolg der somatischen Gentherapie begründet.James Watson stritt mögliche Erfolge der somatischen Therapieform rundweg ab, darauf könne man warten, „bis die Sonne erlischt“. Gerade die Möglichkeit des Verwerfens von misslungenen Keimen im Blastozystenstadium wurde von allen anwesenden Wissenschaftern (Molekularbiologen, Evolutionsbiologen, Ethikern) als der große Vorteil gegenüber der unsicheren somatischen Gentherapie ohne Widerspruch begrüßt. Keimbahntherapie sei schließlich nur eine Erweiterung der somatischen Gentherapie, gab der Molekularbiologe John Campbell zu verstehen. Sie verurteilten einhellig alle Versuche von gesetzlichen Regle- D O K U M E N T A T I O N mentierungen von Keimbahneingriffen. Gewisse Bedenken scheinen aber doch zu bestehen, denn es wurde postuliert, dass keinesfalls genetische Veränderungen zwangsläufig von Generation zu Generation weitergegeben werden dürften, was durch den Einbau von Steuerungsmechanismen verhindert werden soll (eine Zusammenfassung ist im Internet unter http://www.ess.ucla.edu:80/huge/ report.html zugänglich). Die evolutionsbiologische Notwendigkeit genetischer Defekte sollte bei der Diskussion genetischer Manipulationen nicht außer Acht gelassen werden. Unser Überleben beruht auf einem ständigen genetischen Lotteriespiel. Das hohe Maß genetischer Variabilität gehört zur Grundbedingung allen Lebens. Einen genetisch definierten Idealtyp gibt es nicht. Als Preis dafür haben wir die Anzahl mehr oder weniger genetischer Varianten zu zahlen. Aus zwingenden evolutionsbiologischen Gründen kann kein Mensch, kein Lebewesen, genetisch völlig unbeschädigt und gesund sein. Und deshalb ist es angemessen, selbst den Zustand gewöhnlicher Gesundheit nicht als naturgegebene Norm anzusehen oder gar als Menschenrecht einzufordern. Die Medizin sollte sich jedem ihr angetragenen Anspruchsdenken verschließen, umso konsequenter, wenn dadurch ethische Konflikte vorprogrammiert sind. Bei Sterilität oder genetisch schwer belasteten Paaren, wie im Fall der Ethikkommission der Med. Univ. Lübeck, sollte man von einer Schwangerschaft abraten. Die Ethik darf sich nicht dem so genannten Fortschritt anpassen, „die Seele ist um sehr vieles älter als der menschliche Geist“ (K. Lorenz). Literatur beim Verfasser Dr. med. Rolf Klimm Bach 2, 83093 Bad Endorf Verunglimpfung deutscher Ethikkommissionen Grundlegend falsch, schon im Titel und dann noch mehrfach im Text, ist die angeblich von der modernen Medizin gelehrte Gleichsetzung von „menschlich sein“ mit „Mensch sein“. Spermien, Ei- zellen und Embryonen des Menschen sind zwar menschlich, aber sie sind noch kein halber oder ganzer Mensch. Diese frühesten Entwicklungsformen menschlichen Lebens haben weder die laut Bibel (Buch Genesis) notwendige Form noch den göttlichen Odem. Wenn die katholische Amtskirche durch ihr Verbieten von Kondom und Pille (und jetzt Präimplantationsdiagnostik) diese Frühestformen schützen möchte, so können (und werden) den Kirchenoberen hierbei selbst von ihren eigenen Gläubigen nur noch wenige folgen. Auch Embryonen sind mit Sicherheit in den ersten zwei Wochen keine Kinder oder Menschen, weil ein Mensch nicht zu zwei Menschen, der Embryo in diesem Zeitraum aber noch zu eineiigen Zwillingen werden kann – er ist also noch nicht einmal ein In-dividu-um, ein Unteilbares. Zudem ist das typische Schicksal von Embryonen, wie auch von Keimzellen, der frühe Tod: mindestens zwei Drittel sterben vor der Monatsblutung und gehen in der Regel mit der Regel unbemerkt ab. In unserer Zeit der höchstentwickelten medizinischen Fürsorge für Frühgeborene den Vorwurf der „dumpfen Mentalität . . . für das . . . nicht behinderte und kräftige Leben“ aufzustellen, zeugt von Unkenntnis oder Missachtung. Wird für behinderte Kinder und Erwachsene heute nicht getan, was früher schlicht unmöglich war? Wie hoch war denn in der Zeit vor der heutigen Medizin die Kindersterblichkeit, als die Menschen mit Gebeten und Gottes Hilfe auskommen mussten? Da Kardinal Meisner die Kollaboration deutscher Ärzte mit dem Nazi-Regime anspricht, so darf daran erinnert werden, dass der Vatikan als erster Staat jene Machtergreifung mit dem Konkordat völkerrechtlich anerkannte und dieser Vertrag immer noch gültig ist . . . Bemerkenswert auch, dass ein Kardinal zweimal im Namen der Christen redet, obwohl er wissen müsste, dass die meisten christlichen Religionen die extreme Position der katholischen Amtskirche auf dem Gebiet der Fortpflanzung keineswegs zu teilen vermögen . . . Kultur des Lebens Positiv und beachtenswert ist die Entschiedenheit, mit der Joachim Kardinal Meisner, Erzbischof von Köln, seine Stimme für den Schutz allen menschlichen Lebens erhebt. Ich freue mich, dass er sich für Klarheit in der Debatte um die Präimplantationsdiagnostik auf diese Weise engagiert. Gerade eine „Schärfung des Problembewusstseins“ ist bei dieser Diskussion angesagt. Die Debatte für und wider die Präimplantationsdiagnostik sollte dabei auf den freiheitlichen Grundsätzen dieses Rechtsstaates beruhen. Vor allem die deutsche Staatsidee, die sich in Artikel eins des Grundgesetzes niederschlägt, stellt einen hohen moralischen Anspruch, der verantwortungsbewusstes Handeln voraussetzt. Daher geht es in erster Linie nicht um „Einzelfallentscheidungen“, sondern vielmehr um den grundsätzlichen Primat des Schutzes allen menschlichen Lebens. Ich bin sicher, dass es nicht nur mir, als hoffentlich angehender Medizinstudentin, sondern vielen ein Anliegen ist, jene ethisch-moralischen und naturrechtlichen Werte in dieser Gesellschaft ohne Abstriche aufrechtzuerhalten. Leben ist zu bejahen. Daraus erwächst das Gebot, die Schwachen und Hilflosen in ihrer Ganzheit zu akzeptieren und zu fördern. Die Geste seitens der Bundesärztekammer, zu einem offenen und sachlichen, gleichwohl kritischen Dialog mit der Öffentlichkeit beizutragen, zeigt, dass sogar bei der Forderung nach einem sehr restriktiven Einsatz der Präimplantationsdiagnostik nicht über die Köpfe hinweg entschieden werden darf und ein Entgegenkommen ihrerseits möglich ist. Alice Kang Rheinstraße 39, 53179 Bonn Dr. Manfred Schleyer Diplom-Biologe, Institutstraße 22, 81241 München-Pasing 47 D O K U M E N T A T I O N Heft 47, 24. November 2000 Präimplantationsdiagnostik Ethisches Dilemma der Fortpflanzungsmedizin Ärzte, Politiker, Juristen und Theologen diskutierten bei einer öffentlichen Anhörung der Enquete-Kommission des Bundestages „Recht und Ethik der modernen Medizin“ über Chancen und Risiken der PGD. E ine schottische Familie mit fünf Kindern verlor durch einen Unfall die einzige Tochter. Sie möchte jetzt mithilfe von Präimplantationsdiagnostik (preimplantation genetic diagnosis = PGD) garantiert wieder ein Mädchen bekommen. Diesen „Fall“ der zurzeit in Großbritannien diskutiert wurde, trug der Vorsitzende des Marburger Bundes und Präsident der Ärztekammer Hamburg, Dr. med. Frank Ulrich Montgomery, in Berlin vor. „Direkter Weg zum qualitätsgesicherten Kind“ Auch wenn in Deutschland die Präimplantationsdiagnostik nicht zur Geschlechtswahl genutzt werden soll, so hält Montgomery die PGD dennoch für den „direkten Weg zum qualitätsgesicherten Kind“. Bei einer öffentlichen Anhörung der Enquete-Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“ drückte er die Befürchtung aus, dass die PGD nicht auf die Paare begrenzt werden könne, die erbgebundene Krankheitsgeschichten vorwiesen. „Über kurz oder lang werden bei allen In-vitro-Fertilisations-Maßnahmen PGDs nötig sein“, so Montgomery. Die Entschlüsselung des menschlichen Genoms stehe kurz vor ihrer Vollendung. Damit aber liege eine mindestens abstrakte Genkarte vor, in der Aberrationen, Variationen und Strickmusteranomalien des Menschen beschrieben sind. „Jeder von uns ist Träger solcher Anomalien – auch der Gesundeste.“ Der Grundgedanke der genetischen Selektion, der dem ganzen Verfahren in- 48 newohne, werde zu einer natürlichen „Ausmerzung aller Anomalien“ führen. Prof. Dr. med. Klaus Diedrich, Medizinische Universität zu Lübeck, hält diese Befürchtungen für unbegründet. So sei ein Screening auf mehrere monogenetische Veränderungen allein aufgrund des normalen Hintergrundrisikos in der Bevölkerung wenig sinnvoll.Die weltweiten Zahlen demonstrierten außerdem eindrucksvoll, dass die PGD immer noch eine in der Anwendung sehr begrenzte Technik sei. Um einem Missbrauch vorzubeugen, habe die Bundesärztekammer (BÄK) im März einen Diskussionsentwurf zur PGD (Deutsches Ärzteblatt, Heft 9/2000) vorgelegt, in dem ein Diagnosenkatalog eindeutig abgelehnt und in klarer Weise die Diagnostik vorgegeben werde. Durch eine Beibehaltung des Verbots der PGD würden möglicherweise deutsche Paare zu kommerziell orientierten Einrichtungen im Ausland getrieben, auf deren ethische und medizinische Standards man keinerlei Einfluss habe, befürchtet Priv.-Doz. Dr. med. Wolfram Henn, Homburg/Saar. Doch ist es eigentlich gerechtfertigt, einem Embryo, bei dem Behinderungen festgestellt wurden, das Lebensrecht zu verwehren? Nein – ist die deutliche Antwort von Karl Finke, Behindertenbeauftragter des Landes Niedersachsen. Er betrachtet es „mit Sorge und Kritik, dass Behinderung zunehmend als ein mit modernen medizintechnologischen Methoden aus der Welt zu schaffendes Übel angesehen wird. Menschen mit Behinderungen erlebten dies schon heute als eine mangelnde Akzeptanz gegenüber denjenigen, die dem gesellschaftlichen Leitbild von Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Fitness nicht entsprechen.“ Führende Fortpflanzungsmediziner und Biologen, wie kürzlich der Nobelpreisträger James Watson, sprächen bereits von einem Recht auf ein nichtbehindertes Kind, so Finke. Ein Recht, das sich zu einer Pflicht zur eugenischen Selektion verkehren könne. Die PGD intensiviere die schon in der pränatalen Diagnostik angelegte Tendenz zur eugenisch motivierten Auslese behinderten Lebens und öffne gleichzeitig die Tür zur positiven Eugenik. Studien zeigten zum Beispiel, dass in mehr als 90 Prozent der Fälle, in denen einer Frau im Rahmen von pränataler Diagnostik mitgeteilt wird, sie erwarte ein Kind mit Down-Syndrom, eine Abtreibung vorgenommen werde. Doch diese Schwangerschaftsabbrüche, die bei festgestellter Behinderung nach pränataler Diagnostik aufgrund der medizinischen Indikation bis zum Ende der Schwangerschaft möglich sind, könnten gerade durch PGD verhindert werden, erläuterte Prof. Dr. jur. Joachim Renzikowski, Universität Halle-Wittenberg. Ein später Abbruch einer „Schwangerschaft auf Probe“ sei nichts anderes als eine künstliche Frühgeburt und mit erheblichen Belastungen für die Mutter und die Leibesfrucht verbunden, so der Jurist. Eindeutige gesetzliche Regelung gefordert Dr. Hildburg Wegener, Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik, wies allerdings darauf hin, dass die Methode der PGD ebenso fehleranfällig wie aufwendig sei. Deshalb werde der schwangeren Frau im Richtlinienentwurf der BÄK zur Absicherung des Ergebnisses eine Fruchtwasseruntersuchung empfohlen. Ein Schwangerschaftsabbruch müsse also eventuell trotz Präimplantationsdiagnostik vorgenommen werden. Wegener vertritt außerdem die Auffassung, dass die Inanspruchnahme einer Präimplantationsdiagnostik und ein Schwangerschaftsabbruch nach pränataler Diagnostik gar nicht miteinander verglichen werden dürften: „Bei einem Schwangerschaftsabbruch reagieren die Beteiligten auf eine schicksalhaft vorgegebene Situation. Bei der PGD liegt keine Schwanger- D O K U M E N T A T I O N Baby genetisch ausgewählt In Frankreich ist zum ersten Mal ein genetisch ausgewähltes Kind zur Welt gekommen. Das Baby wurde im Béclère-Krankenhaus im südlich von Paris gelegenen Departement Hautsde-Seine geboren. Damit wurde in Frankreich erstmals die Präimplantationsdiagnostik angewandt. Das Kind ist nicht von der unheilbaren Krankheit betroffen, die einer der Elternteile in sich trägt und möglicherweise afp übertragen hätte. schaft vor. Die Beteiligten reagieren auf eine Situation, die sie selbst im Wissen um die sich daraus ergebenden Entscheidungen erst herbeigeführt haben.“ Auch von Juristen wird diese Einschätzung geteilt. „Die Situation des (ungewollt) gezeugten Embryos in vivo ist mit der Situation eines (bewusst und gewollt) erzeugten Embryos in vitro in keiner Weise vergleichbar“, sagte Dr. iur. Elke H. Mildenberger, Universität Münster. Deshalb sei es konsequent, wenn das Embryonenschutzgesetz (ESchG) eine künstlich befruchtete Eizelle bereits vom Zeitpunkt der Kernverschmelzung an schütze, im Paragraphen 218 dagegen dem Interesse einer ungewollt schwangeren Frau Vorrang eingeräumt und nidationsverhütende Maßnahmen nicht bestraft würden. Ihrer Ansicht nach ist die PGD mit dem Embryonenschutzgesetz nicht vereinbar. Prof. Dr. med. Karl Friedrich Sewing, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der BÄK, teilt diese Auffassung nicht. Dennoch plädierte er für eine eindeutige gesetzliche Regelung, um „bestehende Wertungswidersprüche aufzuheben oder diese gar nicht aufkommen zu lassen. Die gesetzlichen Regelungen sollten sich aber auch im Blick auf das europäische Ausland ausrichten mit dem Ziel, ethische Schieflagen zu vermeiden, etwa in dem Sinne, dass es nicht unbedingt ethischen Normen folgt, wenn wir im eigenen Land Entwicklungen unterbinden, die im Ausland gewonnenen Ergebnisse jedoch im eigenen Land nutzen wollen.“ Sobald die gesetzlichen Rahmenbedingungen klar seien, werde zu prüfen sein, ob und gegebenenfalls in welcher Weise berufsrechtliche Regeln zu erarbeiten oder zu modifizieren seien. Sewing betonte, dass an der prinzipiellen Schutzwürdigkeit des Embryos festgehalten werden müsse. Es sei allerdings nicht auszuschließen, dass in Einzelfällen eine Güterabwägung getroffen werden müsse. Dagegen vertritt Finke die Auffassung, dass der dem Grundgesetz zugrunde liegende Menschenwürdegedanke davon ausgehe, dass ein Embryo vom Moment seines Entstehens an schützenswert sei. Der niedersächsische Behindertenbeauftragte wies darauf hin, dass ein abgestufter Schutzstatus des Embryos je nach Entwicklungsstadium im Gegensatz zu anderen Staaten in der Bundesrepublik nicht vorgesehen sei. Das deutsche Rechtssystem schütze den Embryo als solchen, betonte auch der Theologe Prof. Dr. Dietmar Mieth,Tübingen. Der Präsident der Bundesärztekammer, Prof. Dr. med. Jörg-Dietrich Hoppe, begrüßte die „ergebnisoffene“ Diskussion bei der Anhörung. „Das ethi- sche Dilemma, Paaren mit hohen genetischen Risikofaktoren neue Perspektiven öffnen zu können, damit zugleich aber ethische Tabus zu berühren, erfordert eine gesamtgesellschaftliche Wertediskussion auf breiter Grundlage“, so Hoppe. Er räumte ein, dass ein Patentrezept für diese Fragen nicht in Sicht sei. Schließlich dürfe man nicht ignorieren, dass die betroffenen Paare in der Regel weder bewusst auf Kinder verzichten noch sich zu einer Adoption entschließen, sondern die PGD in anderen Staaten in Anspruch nehmen. Wenn die PGD in Deutschland zugelassen werden sollte, dann nur, so der Diskussionsentwurf der BÄK, wenn Rechtssicherheit und ein hohes Schutzniveau über strenge und restriktiv zu fassende Zulassungskriterien erreicht werden können. Über die rein medizinischen Aspekte dieses Verfahrens hinaus sei es unverzichtbar, dass der Bundesgesetzgeber die im Zivil- und Strafrecht notwendigen Regelungen vornehme, forderte der Gisela Klinkhammer BÄK-Präsident. Heft 48, 1. Dezember 2000 Präimplantationsdiagnostik Unterschiedliche Schutzwürdigkeit Auf Wertungswidersprüche weist der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer hin. U nzulässig ist die Präimplantationsdiagnostik (preimplantation genetic diagnosis = PGD) in Portugal, Österreich und der Schweiz. In den meisten europäischen Ländern ist sie entweder gesetzlich erlaubt, oder entsprechende Gesetzesvorhaben sind in Vorbereitung. In Deutschland ist es umstritten, ob die PGD mit dem Embryonenschutzgesetz vereinbar ist. In einem Fortpflanzungsmedizingesetz, das demnächst möglicherweise das Embryonenschutzgesetz ablösen wird, soll nach Vorstellung von Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer die Präimplantationsdiagnostik verboten werden. Nach Ansicht von Prof. Dr. med. KarlFriedrich Sewing, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer, verstößt die PGD nicht gegen das bestehende Embryonenschutzgesetz. Er kritisierte Bestrebungen, die Präimplantationsdiagnostik explizit zu verbieten, obwohl ein eventueller „PGD-Tourismus“ kein Argument dafür sei, diese Methode zu gestatten. Er hält es jedoch generell für ethisch fragwürdig, Wissen, das im Ausland entwickelt wurde, anschließend in Deutschland zu nutzen. Zwar müsse gerade in Deutschland in Fragen des Lebensschutzes ein hoher 49 D O K U M E N T A T I O N Heft 51–52, 25. Dezember 2000 Standard gelten, betonte Dr. med. Christiane Woopen, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats, anlässlich der Medica in Düsseldorf vor Journalisten. Einen Wertungswiderspruch sieht sie jedoch in der unterschiedlichen Schutzwürdigkeit des Embryos in vitro und in vivo. „Ein Gesetzgeber, der nidationsverhütende Maßnahmen nicht verbietet, der Schwangerschaftabbrüche nach Pränataldiagnostik nicht verbietet, der die Schwangerschaftsvermeidung durch die ,Pille danach‘ nicht der Beratungsregelung zum Schutz des ungeborenen Lebens unterwirft, kann die Präimplantationsdiagnostik nicht mit der Begründung verbieten, es gehe um den Schutz des Embryos.“ Den Hinweis darauf, dass bei bestehender Schwangerschaft in vivo der Embryo unter dem realen Schutz der Frau stehe, hält Woopen für realitätsfern. So begännen 53,6 Prozent der Frauen mit einem bekannten hohen Risiko für eine schwere genetisch bedingte Krankheit oder Behinderung des Kindes eine Schwangerschaft nur im Hinblick auf eine Pränataldiagnostik mit möglicherweise folgendem Schwangerschaftsabbruch. Auch wenn man so genannte Schwangerschaftsabbrüche auf Probe als problematisch erachte, müsse man im Rahmen rechtlicher Regelungsmöglichkeiten das geringere Übel nicht verbieten, fordert die Medizinethikerin. Gesellschaftlicher Diskurs Auch Sewing ist dieser Auffassung. Wenn der Embryo einen uneingeschränkten Schutz besäße, so sei dieser auch uneingeschränkt bis zur Geburt zu beanspruchen. Mit der Begründung einer symbiotischen Situation in vivo werde dieser Schutz im Sinne einer Güterabwägung beim straffreien Schwangerschaftsabbruch allerdings eingeschränkt. Sewing und Woopen begrüßten den gesellschaftlichen Diskurs. „Auf breiter Ebene sollte deutlich werden, dass es nicht nur um Detailfragen der Fortpflanzungsmedizin geht. Vielmehr geht es um Prinzipien übersteigende grundsätzliche Fragen über unsere Haltungen zu menschlichem Leben in all seiner Vielfalt und seinen Entwicklungsstufen“, sagte Woopen. Gisela Klinkhammer 50 Präimplantationsdiagnostik Zunehmendes Lebensrecht Genetische Untersuchungen am Embryo in vitro im medizinischen und juristischen Kontext* Rudolf Neidert V or dem Hintergrund biomedizinischer Umbrüche – die „Entschlüsselung“ des menschlichen Genoms und die Stammzellgewinnung durch Klonen von Embryonen – spielt sich in der deutschen Fachöffentlichkeit eine kontroverse Diskussion um die Präimplantationsdiagnostik (preimplantation genetic diagnosis = PGD) ab; zum ersten Mal wurde sie durch den „Lübecker Fall“ im Jahr 1995 in die Öffentlichkeit gebracht. Angestoßen hat die aktuelle medizinisch-ethisch-juristische Debatte die Bundesärztekammer (BÄK) im Februar dieses Jahres mit ihrem Diskussionsentwurf einer PGDMusterrichtlinie (1). Verstärkt wurde dieser Diskurs durch ein dreitägiges fortpflanzungsmedizinisches Symposium des Bundesministeriums für Gesundheit Ende Mai in Berlin (2). Auch die Enquete-Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“ des Deutschen Bundestages hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Die intensive Kontroverse, die sich vor allem im Deutschen Ärzteblatt zwischen März und Juli niedergeschlagen hat, zeigt leider noch das Trennende stärker als das Verbindende; dasselbe gilt für die Vorträge und Diskussionen auf dem Symposium. Dabei gehen die Fronten quer durch die „Lager“ der Theologen, Ethiker, Ärzte und Juristen (3). Der vorliegende Aufsatz möchte deshalb die Diskussion – im Zusammenhang werdenden Lebens in vitro und in vivo – durch einen empirischen Zugang zu der Problematik voranbringen, und zwar auf zweifache Weise: indem er zunächst die medizinischen Gegebenheiten der embryonal-fetalen Entwicklung des Ungeborenen, zum * Zum Diskussionsentwurf einer Muster-Richtlinie der Bundesärztekammer in Heft 9/2000 und den dazu erschienenen Beiträgen in den Heften 9, 10, 14, 16–18, 22 und 28–29 anderen die wichtigsten juristischen, vor allem gesetzlichen Gegebenheiten herausarbeitet. Im Zentrum seiner Betrachtungen steht dabei das nicht nur nach dem Grundgesetz oberste Rechtsgut: menschliches Leben – das Leben des geborenen und das erst „werdende Leben“ des ungeborenen Menschen. Medizinische Gegebenheiten Das genetische Diagnostikverfahren der PGD (4) umfasst drei Abschnitte: Erzeugung von bis zu drei Embryonen mit herkömmlicher In-vitro-Fertilisation (IVF), und zwar meist durch Mikroinjektion (ICSI); die genetische Untersuchung von je einer oder zwei aspirierten Embryonalzellen (nach dem Stadium der Totipotenz); schließlich der Transfer der nicht geschädigten oder – und darin liegt der ethische Angelpunkt – das Absterbenlassen der geschädigten Embryonen. Insgesamt ein aufwendiges und die Frau belastendes Verfahren – was erklärt, dass die Fallzahlen weltweit auch zehn Jahre nach den ersten Verfahren in engen Grenzen geblieben sind. Das Gesamtverfahren der PGD spielt sich meist in den ersten drei Tagen nach Beginn der „künstlichen“ Befruchtung ab, nachdem die Embryonen das Acht- bis 14-Zell-Stadium erreicht haben. Die embryonalen Entwicklungen sind keine plötzlichen Schritte, sondern Prozesse: so ist schon die Konzeption eine „Befruchtungskaskade“ mit 14 Schrittfolgen, und die Expression der Gene des neuen Individuums zeigt sich erst im Acht-Zell-Stadium. Setzt man den Beginn embryonalen und menschlichen Lebens bei der Befruchtung an und definiert man ihn zugleich genetisch – Vereinigung zweier haploider Chromosomensätze zu einem di- D O K U M E N T A T I O N ploiden Genom –, muss man die „Unschärfe“ dieses circa drei Tage währenden Vorgangs konstatieren. Vorab ein kurzer Blick auf den „Beginn vor dem Beginn“ embryonalen Lebens! Auch die Gameten von Frau und Mann, Ei- beziehungsweise Samenzelle, „leben“, aber noch nicht im konstitutiven Sinn eines Individuums; dies tun sie erst nach der Kernverschmelzung zum Embryo. Von dem Heranwachsen des Ungeborenen kann hier nur weniges angedeutet werden: Im Übrigen verweise ich auf die Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirates der BÄK über „Pränatale und perinatale Schmerzempfindung“ (5). Unbewusste Schmerzempfindung mit Reaktionen des Ungeborenen beginnt bereits in der frühen Fetalzeit – noch in den ersten zwölf Wochen – und nimmt kontinuierlich zu. Ab der 22. Woche post conceptionem (p. c.) ist ein bewusstes Schmerzerlebnis des Fetus zunehmend wahrscheinlich. Insgesamt wird die pränatale Schmerzempfindung als „werdende Funktion“ beschrieben – also auch hier keine festen Einschnitte. Ungefähr zur selben Zeit – ab der 20. bis 22. Woche p. c. – hat der Fetus die so genannte extrauterine Lebensfähigkeit erreicht, kann dann also nach einem Schwangerschaftsabbruch überleben. Auf diese schockierenden „Spätabbrüche“ hat die Bundesärztekammer mit der „Erklärung zum Schwangerschaftsabbruch nach Pränataldiagnostik“ und mit der gemeinsamen Empfehlung der einschlägigen Fachgesellschaften zur „Frühgeburt an der Grenze der Lebensfähigkeit“ von 1998 reagiert (6). Die Erklärung der BÄK empfiehlt dem Arzt, die extrauterine Lebensfähigkeit in der Regel als zeitliche Begrenzung für einen Abbruch anzusehen, weil sich zu diesem Zeitpunkt „der Schutzanspruch des ungeborenen Kindes aus ärztlicher Sicht nicht von demjenigen des geborenen unterscheidet“. Die Empfehlung stellt den Grundsatz auf, lebenserhaltende Maßnahmen seien zu ergreifen, wenn für das Kind auch nur eine kleine Chance zum Leben bestehe. Das Ausmaß, in dem embryonal-fetales Leben „geopfert“ wird, zeigt sich in folgenden Zahlen (7): 1999 (mindestens) 130 471 legale Abbrüche, davon 97,2 Prozent nach der Beratungsregelung – also ohne Indikation – in den er- sten zwölf Wochen p. c. (§ 218 a Abs. StGB). Auf die medizinische Indikation (§ 218 a Abs. 2) entfielen 3 661 Abbrüche (= 2,8 Prozent), teils vor, teils nach der 13. Woche (von Woche 13 bis 22 noch 1,4 Prozent; ab Woche 23 – der Zeit der „Spätabbrüche“ – 0,1 Prozent, absolut „nur“ 164 Fälle). Die amtliche Statistik schweigt zu den Abbrüchen aufgrund pränataldiagnostischer Befunde. Für 1994 werden mehr als 800 solcher Abbrüche aufgrund fetaler Pathologien oder auffälliger genetischer Befunde angegeben (8) – die meisten wohl ab der 13. Woche. Rechtliche Gegebenheiten Während naturwissenschaftliche Fakten als solche keine moralischen Grenzen aufzeigen, sind gesetzliche Gegebenheiten Normsetzungen – zwar keine ethischen, aber rechtliche. Dabei zählt nicht nur ein Steinchen des Rechts, sondern letztlich das ganze Mosaik eines Rechtsgebietes: bei der PGD nicht nur ein Paragraph des Embryonenschutzgesetzes (ESchG) oder dieses ganze Gesetz, sondern die Gesamtheit der menschliches Leben regelnden Normen. Das ESchG ist ein sehr abstraktes Strafgesetz, selbst für Juristen schwer auszulegen (9). Unbestritten strafbar ist es, für die genetische Diagnostik eine noch totipotente, das heißt zur Entwicklung des ganzen Individuums fähige Zelle zu verwenden, da das Gesetz diese einem Embryo gleichstellt (10). Für das rechtliche Hauptproblem – das „Verwerfen“ eines genetisch geschädigten Embryos – gilt Folgendes: Nach § 2 Abs. 1 macht sich strafbar, wer einen extrakorporal erzeugten Embryo „zu einem nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck . . . verwendet“. Ein Verwenden durch Unterlassen – das Absterbenlassen eines geschädigten Embryos durch Nichtübertragen – ist jedoch nicht tatbestandsmäßig; § 2 Abs. 1 trifft schon deshalb nicht zu. Außerdem fehlt es an dem „Zweck“, das heißt an der Absicht des Täters, die mehr ist als Vorsatz: es müsste ihm gerade darauf ankommen, den Embryo nicht zu erhalten; tatsächlich ist ihm dies jedoch höchst unerwünscht. Man wird dem Paar, das eine PGD vornehmen lässt, nur gerecht, wenn man seinen – meist sehnlichsten – Kinderwunsch moralisch ernst nimmt, auch sein Bemühen, diesem Kind eine absehbare schwerste Krankheit zu ersparen. Es kommt auf den Gesamtvorgang „IVF mit PGD“ an, nicht auf unselbstständige Teilakte. Den „Täter“ Arzt würde man sonst, obwohl er aus ärztlichem Ethos der Krankheitsverhütung Patienten hilft und Mitverantwortung für künftiges Leben übernimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bedrohen. „Die Aufgabe des Strafrechts beschränkt sich auch sonst darauf, das ethische Minimum festzulegen . . .“ (11). Das ESchG gilt nur für die wenigsten Embryonen, die in vitro gezeugten – und für diese nur von der Befruchtung bis zur Nidation. In derselben Entwicklungsphase genießen die natürlich gezeugten Embryonen keinerlei Lebensschutz, weshalb nidationshemmende Mittel straflos vertrieben und angewendet werden dürfen. Unter dem Gesichtspunkt des „Lebensschutzes von Anbeginn“ eine widersprüchliche Rechtslage! (12) Mit dem Abschluss der Einnistung des Embryos in der Gebärmutter (§ 218 a Abs. 1 StGB) beginnt das Recht des Schwangerschaftsabbruchs. In den ersten zwölf Wochen p. c. gilt die so genannte Beratungsregelung (§ 218 a Abs. 1) – praktisch eine „Fristenregelung mit Beratungspflicht“ (13); der abbrechende Arzt handelt ohne Indikation, auf Wunsch der Frau. Hinter deren Selbstbestimmungsrecht lässt das Gesetz das Lebensrecht des Ungeborenen zurücktreten, wenn auch unter dem Verdikt der Rechtswidrigkeit. Fast alle anderen legalen Abbrüche fallen unter die medizinische Indikation (§ 218 a Abs. 2), die den Abbruch für „nicht rechtswidrig“ erklärt. Auch der Lebensschutz des Ungeborenen durch die medizinische Indikation ist gering, lässt der Tatbestand des § 218 a Abs. 2 doch außer der Gefahr für das Leben der Schwangeren auch eine solche für deren körperlichen oder seelischen Gesundheitszustand genügen – das Leben des bereits herangewachsenen Kindes gilt dem Gesetz somit weniger als die Gesundheit der Frau! Diese Rechtslage erstreckt sich sogar über den Zeitpunkt der extraute- 51 D O K U M E N T A T I O N rinen Lebensfähigkeit des Nasciturus hinaus bis – theoretisch – zur Geburt. Dann, mit dem Ende der für das Ungeborene so lebensgefährlichen Zeit der Schwangerschaft, macht die Rechtsordnung gleichsam einen Sprung: „Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit Vollendung der Geburt“ (§ 1 BGB); und zugleich gewährt das StGB dem nunmehr geborenen Menschen mit seinen Tötungsparagraphen 211 und 212 vollen Lebensschutz. Ansätze einer vermittelnden Lösung Sowohl die medizinischen als auch die rechtlichen Gegebenheiten lassen – trotz gravierender Inkonsequenzen der Gesetzeslage – in etwa eine gemeinsame Linie erkennen, an der eine an der Empirie orientierte und von ihr legitimierte Lösung der PGD-Frage ansetzen kann. Die Embryonal- und Fetalentwicklung zeigt sich als „stufenloses Kontinuum“ (14); signifikante Entwicklungsschritte kann nur die ethische Bewertung des empirischen Substrats festmachen. Hervorzuheben ist die bewusste Schmerzempfindung; es ist ja gerade dieser erste Ausdruck einer leib-seelischen Einheit, woran ethischrechtlich eine erhöhte Schutzbedürftigkeit von Embryo und Fetus anzuknüpfen haben. Schließlich sind es die potenzielle Lebensfähigkeit außerhalb des mütterlichen Körpers und als Abschluss dieser Entwicklung die Geburt. Über den Beginn embryonalen Lebens sollte Konsens herrschen: die Entstehung eines genetisch neuen Individuums mit Verschmelzung von Ei- und Samenzelle – zwar erst potenzielles Leben als Mensch, aber kontinuierlich wachsendes Leben, bis dieses sich vollem menschlichen Leben vor der Geburt angenähert und mit dieser vollendet hat (15). Die vergleichbare Linie des geltenden Rechtes verläuft ebenfalls im Sinne wachsenden Schutzes, allerdings in groben Stufen: widersprüchlich in der ersten Stufe von der Befruchtung bis zur Einnistung: verfassungsrechtlich volles menschliches Leben, einfachgesetzlich nur im „Ausnahmefall“ (in vitro) ge- 52 schützt. Als zweite, große Stufe folgt dann die frühe Schwangerschaftszeit von der Nidation bis zur zwölften Woche: mit dem fragilen Schutz des Embryos durch das Beratungskonzept des Bundesverfassungsgerichts. Ab der 13. Woche p. c. (dritte Stufe) schränkt das Gesetz die Abbruchmöglichkeit auf die ungleich strengere medizinische Indikation ein. Mag sich übrigens das Verfassungsgerichtsurteil von 1993 im Sinne von Menschenwürde und Lebensschutz noch so kategorisch lesen – letztlich rechtfertigt es die Beratungslösung – eine „Quasi-Freigabe“ embryonalen Lebens. Dahinter verbirgt sich, dass das Gericht ungeborenes Leben mitnichten als absolutes Rechtsgut (wie die Menschenwürde) begreift, das keiner Güterabwägung fähig wäre; vielmehr lässt es in der Zwölf-Wochen-Frist dessen fast völlige Verdrängung durch das Entscheidungrecht der Frau zu, setzt bezeichnenderweise aber für die Zeit danach durch die medizinische Indikation höhere Anforderungen an eine Abwägung zulasten des Nasciturus. Kurzum: Gesetz und Rechtsprechung anerkennen tatsächlich, wenn auch zum Teil uneingestanden, die Notwendigkeit eines höheren Rechtsschutzes bei höherem Alter des Ungeborenen (16). In den konkreten Vorschriften, die für ungeborenes Leben gelten, drückt sich der ethische und rechtliche Status aus, der im geltenden Recht dem Embryo beziehungsweise Fetus zugebilligt wird. Wo dieses gesetzliche Recht Widersprüche in sich oder zum Verfassungsrecht aufweist, ist durch Auslegung, erforderlichenfalls durch Gesetzesänderung, Widerspruchsfreiheit herzustellen: orientiert am Prinzip der Einheit unserer Rechtsordnung. In der Phase zwischen Zeugung und Einnistung lässt sich die Diskrepanz zwischen dem Schutz des natürlich und des „künstlich“ gezeugten Embryos nur zum Teil durch dessen in vitro höhere Verletzlichkeit erklären – rechtfertigen lässt sie sich nicht, geht es doch hier wie dort um dasselbe embryonale Leben. Der verbleibende Widerspruch zeigt nur allzu deutlich die im rechtlichen Kontext schwer zu integrierende Schutzhöhe künstlich gezeugten Lebens bis zur Nidation. Gemessen an dem hehren verfassungsgerichtlichen Prinzip einer Gleichwertigkeit ungeborenen und geborenen Lebens (17), klafft allerdings die Schere zwischen dem Lebensschutzpostulat und dem – trotz Schutzkonzept – schwachen Schutz durch die Beratungsregelung (ab der Nidation) empfindlich auseinander. Immerhin soll der Abbruch in dieser Zeit von der Rechtsordnung missbilligt sein und lediglich straflos bleiben – anders als der vom Gesetz für „nicht rechtswidrig“ erklärte Abbruch aus medizinischer Indikation, die nach den ersten zwölf Wochen praktisch allein zum Tragen kommt. Mit der extrauterinen Lebensfähigkeit des Nasciturus ist dann der „Durchbruch“ in der Entwicklung ungeborenen Lebens erreicht, dem höchste Rechtserheblichkeit zukommt. Eine Erstreckung der Indikation des § 218 a Abs. 2 – eigentlich einer medizinisch-sozialen – auf diese Endphase des Ungeborenen als eines selbstständig Lebensfähigen verträgt sich schlechterdings nicht mit dem hier vertretenen und empirisch belegten, auf ein volles Menschsein hin wachsenden Leben des Embryos und Fetus. In dieser „vierten Stufe“ müsste deshalb dem Lebensrecht des Ungeborenen vergleichbares Gewicht wie der Rechtsposition der Schwangeren beigemessen werden – zu realisieren nur durch eine Einschränkung des § 218 a Abs. 2 (18). Ohne einen „zeitlichen Sicherheitsabstand“ zwischen der medizinischen Indikation, die eine Tötung des Ungeborenen rechtfertigt, und dem Tötungsverbot des Strafgesetzbuchs ab der Geburt würde die innere Akzeptanz eben dieses Verbotes unterhöhlt. Zusammengefasst bedeutet der skizzierte Lösungsansatz Folgendes: grundsätzliches Lebensrecht des Embryos ab der Befruchtung mit Rücksicht auf seine Möglichkeit, Mensch zu werden (Potenzialität), jedoch zwischen Zeugung und Geburt ein entwicklungsbedingtes Heranwachsen aus rudimentären Anfängen bis zum sich auf die Geburt hin vollendenden Rechtsstatus – ein zwischen den Extrempositionen vermittelndes Konzept. Selbstverantwortung und -entscheidung der Frau verdienen umso mehr Berücksichtigung, je früher der Embryo in seiner D O K U M E N T A T I O N Entwicklung steht; umgekehrt fordert das Lebensrecht des heranwachsenden Fetus umso größere Achtung, je mehr sich dieser dem geborenen Menschen annähert. Dies hat gegenläufige Konsequenzen: für die Schlussphase der Schwangerschaft eine grundsätzliche Unzulässigkeit der Spätabtreibung lebensfähiger Kinder, für den ersten Abschnitt die Möglichkeit einer Güterabwägung auch zulasten des eben erst gezeugten embryonalen Lebens. In den ersten Tagen spielt sich ja die PGD ab; doch welches Gewicht soll das keimende Lebensrecht der winzigen Morula in der Petrischale besitzen? Ein einfacher Umkehrschluss von dem zweiten, unter der Beratungslösung stehenden Abschnitt – Alleinentscheidung der Frau erst recht hier! – wäre voreilig. Gewiss überzeugt die gegen die PGD vorgetragene These von der Unvergleichbarkeit der Situationen in vitro und in vivo (19) im Wesentlichen nicht: denn hier wie dort sieht sich die Frau mit dem Dilemma konfrontiert, ein schwerstgeschädigtes Kind austragen zu sollen – bei einer PGD würde dieser Konflikt nur „antizipiert“, aber gleichwohl real erlebt. Zudem wäre es ein rechtlicher Widerspruch, denselben geschädigten Embryo in vitro nicht absterben, in vivo dagegen durchaus abtreiben lassen zu dürfen – ein zu Recht häufig vorgebrachtes Argument. Allerdings ist in der Petrischale das „künstlich gezeugte“ Leben tatsächlich wesentlich gefährdeter, da seine Abtötung ohne ärztlichen Eingriff im Körper der Mutter möglich ist. Deshalb sollte eine rechtliche Regelung dieser Diagnostik von einer engen genetischen Indikation ausgehen, die in einem formellen Verfahren – nach Billigung durch eine Ethikkommission – festzustellen wäre. Dies hat der Wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer mit seinem restriktiven und verantwortungsvollen Diskussionsentwurf vorgeschlagen. Die an einer PGD Beteiligten würden dann rechtmäßig handeln. Eine vom Vorstand der Bundesärztekammer – nach Ablauf der Diskussionsphase – verabschiedete MusterRichtlinie müsste von der jeweiligen Ärztekammer umgesetzt werden; da nach hier begründeter Auffassung die PGD nicht strafbar ist, wäre dies auch ohne weiteres möglich. Allerdings sollte dieses Verfahren von erheblicher Grundrechtsrelevanz durch den Gesetzgeber über eine gesetzliche Klarstellung, wenn auch in engen Grenzen, ausdrücklich erlaubt werden. Anmerkungen Mein Dank für Hinweise auf Literatur bzw. zum Manuskript dieses Aufsatzes gilt den Professoren K. Bayertz (Ethik), H. M. Beier, K. Diedrich und W. Holzgreve (Medizin) sowie F. Hufen und H.-L. Schreiber (Recht). 1. DÄBl v. 3. 3. 2000, S. A-525 ff. Die verantwortliche Arbeitsgruppe der BÄK stand unter der Federführung von H. Hepp. Der „Lübecker Fall“ (von K. Diedrich und E. Schwinger wegen Mukoviszidose-Belastung des Paares beantragte PGD) fand durch die dortige EthikKommission 1996 ein zwiespältiges Votum (ethisch ja, nach ESchG nein). 2. Zwei Tagungsbände „Fortpflanzungsmedizin in Deutschland“ dürften Anfang 2001 bei Nomos, Baden-Baden, erscheinen (Wiss. Red. D. Arndt, Berlin, und G. Obe, Essen). Kritik an dem Symposium übt H. M. Beier in: Reproduktionsmedizin 2000/16, S. 332 ff. 3. Die folgenden Kurzbelege sind exemplarisch und notwendigerweise subjektiv: Für die Theologen Rendtorff eher pro und Mieth eher kontra (R. auf dem Symposium, M. in: Ethik Med, Bd. 11, Suppl. 1); für die Ethiker Bayertz pro, Graumann kontra (beide auf dem Symposium); für die Naturwissenschaftler Ludwig/Diedrich pro, Kollek kontra (L./D. in: Gynäkologie 4/98, S. 353 ff., K.: Präimplantationsdiagnostik, Tüb. u. Basel, 2000); für die Juristen Schreiber pro, Laufs kontra (Schr. in: DÄBl v. 28. 4. 2000, S. A-1135 ff., Laufs im Symposium und in: Ethik Med 1999/11, S. 55 ff.). 4. Zum Verfahren ausführlich R. Kollek (Fußnote 3, S. 27 ff.), M. Ludwig/B. Schöpper/K. Diedrich in: Reproduktionsmedizin 1999/15, S. 65 ff., und H. M. Beier: Assistierte Reproduktion, München 1997 („Befruchtungskaskade“, S. 10 f.).– Ende 1999 gab es insgesamt nur 424 nach PGD geborene Kinder aufgrund von 499 Schwangerschaften bei 1 317 Patientinnen (Mitteilung Prof. Diedrich). 5. DÄBl v . 21. 11. 1991, S. A-4157 ff. 6. DÄBl v. 20. 11. 1998, S. A-3013 ff. Die Arbeitsgruppe des Wiss. Beirates der BÄK stand wie diejenige zur PGD unter der Federführung von H. Hepp. Gemäß Empfehlung in: Frauenarzt 12/1998, S. 1803 ff. (unter Mitwirkung u. a. von H. Hepp und W. Holzgreve). 7. Statistisches Bundesamt, Gesundheitswesen, Fachserie 12, Reihe 3 1999 (zur Methodik – Untererfassung – dort 2.3); die Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft ist p. c. berechnet (2.4.). 8. M. Ludwig/K. Diedrich in: Ethik Med 1999/11, Suppl. 1, S. 38 ff. (39): 838 Fälle für 1994. 9. Bei den Juristen gegen Strafbarkeit H.-L. Schreiber (Mitglied der BÄK-AG) in: DÄBl v. 28. 4. 2000, S. A1135 f., Ch. Rittner in: DÄBl v. 28. 4. 2000, S. A-1130 f., R. Ratzel in: DÄBl v. 28. 4. 2000, S.A-1125 f., S. Schneider in: MedR 2000/8, S. 360 ff., B. Tag in: Kämmerer/ Speck, Geschlecht und Moral, Heidelberg 1999, S. 87 ff., R. Neidert in: MedR 1998/8, S. 347 ff., Bericht der Bioethik-Kommission Rheinland-Pfalz v. 20. 6. 1999, Teil II Vorbem. und Thesen II. 8 ff., im Ergebnis auch M. Frommel (Symposium); für Strafbarkeit A. Laufs in: Ethik Med 1999/11, S. 55 ff., R. Beckmann in: DÄBl v. 17. 7. 2000, S. A-1959 ff., U. Riedel in: DÄBl v. 10. 3. 2000, S. A-586 f., R. Röger in: Schriftnr. der Juristenv. Lebensrecht e.V., Nr. 17 (2000), S. 55 ff. – Bei den juristischen Laien gegen Strafbarkeit insb. H. Hepp (im Anschluss u. a. an Schreiber) in: DÄBl v. 5. 5. 2000, S. C-930 ff.; für Strafbarkeit R. Kollek (Fußnote 3), Kap. 6 (jedoch zum Teil ohne zureichende juristische Interpretation). 10. § 8 Abs. 1 ESchG. – Ende der Totipotenz nach dem 8Zell-Stadium (H. M. Beier in: Reproduktionsmedizin 1998/14, S. 41 ff. und 2000/16, S. 332 ff.). Im Ausland punktiert man schon vor dem 8-Zell-Stadium; allerdings ist die Diagnostik auch noch danach möglich. 11. H.-L.Günther im Komm. Zum ESchG von Keller/Günther/Kaiser 1992, Rz. 34 zu § 2. 12. So – über den Gegenstand der Entscheidung (§ 218) hinaus – das Bundesverfassungsgericht am 28. 5. 1993 (Bd. 88, S. 203 ff., 251 f.) und u. a. A. Laufs (Fußnote 3). 13. H. Tröndle, Komm. zum StGB, Rz 14 b vor § 218. Mit seinem Beratungskonzept verfolgt das BVerfG immerhin das Ziel, dem Lebensschutz des Ungeborenen in der Frühphase der Schwangerschaft durch austragungsorientierte Beratung statt durch Strafdrohung zu dienen (Fußnote 12, S. 264 ff.). 14. Stellungnahme des Wiss. Beirates der BÄK (Fußnote 5), Ziffer 2. 15. So ausdrücklich auch der Ethiker K. Bayertz (Symposium, Fußnote 3), der eine „gradualistische Auffassung“ vertritt: wachsender, graduell abgestufter Status zwischen Befruchtung und Geburt. Dass auf der leiblich-seelischen Grundlage von Personalität der Gradualismus auch von einem Moraltheologen vertreten werden kann, zeigt das Beispiel von B. Irrgang, dargestellt von P. Fonk: Schwangerschaft auf Probe? . . . in: Ethica 7 (1999), S. 29 ff. und 143 ff. (161 f.). 16. Ansatzweise E. G. Mahrenholz und B. Sommer in ihrer abweichenden Meinung zu BVerfGE 88, S. 203 ff. (342). Auch das eigentliche Urteil anerkennt, dass das Lebensrecht nicht absolut gilt (S. 253 f.); sogar in das „Recht auf Leben“ des (geborenen) Menschen darf aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden (Art. 2 Abs. 2 GG). Der in der ethischen Diskussion oft unkritische Umgang mit der (absoluten) „Würde des Menschen“ (Art. 1 Abs. 1 GG) verdiente eine gesonderte verfassungsrechtliche Widerlegung. 17. BVerfGE 39 (S. 1 ff., 37 f.) und E 88 (S. 203 ff., 251 f.) sowie H. Tröndle (Fußnote 13), Rz. 19 vor § 218, mit weiteren Nachweisen. 18. Eine Änderung fordert auch A. Laufs (Symposium, Fußnote 3). Mögliche Ansatzpunkte einer Änderung: Befristung der medizinischen Indikation, übergesetzlicher Notstand. E. G. Mahrenholz und B. Sommer (Fußnote 16, S. 345) weisen auf das niederländische StGB hin (Abbruch nur bis zur 24. Woche). 19. Insbesondere R. Kollek (Symposium der Ärztekammer Berlin am 11. 4. 2000, auch Publikation Fußnote 3, S. 210 f.). Überzeugend gegen diese These Chr. Woopen, Zeitschr. für med. Ethik 1999, S. 233 ff. (mit einem Überblick über die Vertreter der Nichtvergleichbarkeits-These). Dieselbe Autorin erörtert Argumente zur ethischen Bewertung der PGD und deren Folgen in: Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik, Bd. 5, 2000, S. 117 ff. (auch zu Kriterien für ein abgestuftes Schutzkonzept, S. 119). ❚ Zitierweise dieses Beitrags: Dt Ärztebl 2000; 97: A 3483–3486 [Heft 51–52] Anschrift des Verfassers: Ministerialrat a. D. Dr. jur. Rudolf Neidert Herrengarten 15 53343 Wachtberg 53 D O K U M E N T A T I O N Heft 14, 6. April 2001 DISKUSSION zu dem Beitrag Zunehmendes Lebensrecht von Ministerialrat a. D. Dr. jur. Rudolf Neidert Lebensrecht-Kompromiss birgt viele Risiken „Zunehmendes Lebensrecht“ – diese Begriffsprägung setzt den Gedanken vom „werdenden“ beziehungsweise „wachsenden Leben des Embryos und Fetus“ voraus „auf ein volles Menschenleben hin“. Nicht notwendigerweise logisch, das ganze Gedankengebäude jedoch erhellend, wird „die Entstehung eines genetisch neuen Individuums mit Verschmelzung von Ei- und Samenzelle“ mit dem Terminus „potenzielles Leben als Mensch“ in Verbindung gebracht. Dieser nun ist nichts anderes als interessenorientierte und somit gewollte Irreführung: Es entsteht nach Verschmelzung von Ei und Samenzelle kein potenzielles, sondern einsehr reales Leben, ein sehr potentes dazu, dessen ungeheure Entwicklungsmöglichkeiten und rasantes Entwicklungstempo, dessen Verletzlichkeit aber auch dem Betrachter nahe legen, dass gerade in den frühesten Entwicklungsphasen dieses Menschen eine besondere Schutzbedürftigkeit bestehen könnte. Denn fest steht: So eindeutig wie es kein potenzielles und kein werdendes Leben gibt, so eindeutig ist das durch die Verschmelzung der Keimzellen Entstandene eben Leben und von Anfang an Mensch, ja ein einmaliges und unverwechselbares Individuum. Wie trivial, ethisch-rechtlich eine erhöhte Schutzbedürftigkeit an einer Schmerzempfindung, an einer potenziellen Lebensfähigkeit außerhalb des mütterlichen Körpers oder an der Geburt festmachen zu wollen: Schmerzen können provoziert, aber auch genommen werden; der Zeitpunkt der Überlebensfähigkeit außerhalb des Mutterleibes verschiebt sich pro Dekade, ja bald von Jahr zu Jahr, weiter vor zu immer früheren Schwangerschaftsstadien; und nicht erst das Dilemma der Spätabtreibungen hat aufgezeigt, wie 54 wahrhaft abwegig es ist, das Recht, ein Menschenleben beenden zu dürfen, auf die Tatsache der noch nicht erfolgten Geburt zu beziehen, wohingegen Frühgeborene gleicher Behinderung oder Erkrankung volles Lebensrecht zugeschrieben wird und voller Schutzanspruch. Wie gern gehen an diesem Punkt die Gedanken auf die schiefe Bahn. Was heißt denn auch schon lebensfähig? Wie lebensfähig ist denn ein Neugeborenes, gar ein behindertes Neugeborenes? Doch nur in dem Maße, wie sich Mutter und Vater und gegebenenfalls Ärzte und Schwestern ihm zuwenden beziehungsweise eine Pflegefamilie, eine bestellte Person, eine gesellschaftliche Einrichtung, im weitesten Sinn: die Solidargemeinschaft. Wie aber ist es um die Solidargemeinschaft mit Behinderten und Kranken in einer Gesellschaft bestellt, die Spätabtreibungen rechtlich verankern ließ? Hat uns Peter Singers Gedankengut nicht bereits soweit infiziert, dass die Bereitschaft wächst, das Lebensrecht Neugeborener mit Behinderung zur Disposition zu stellen? Mag der Wunsch nach einer vermittelnden Lösung auch noch so verständlich sein, ein Kompromiss in Sachen Lebensrecht birgt viele Risiken, wie auch aus der Formulierung eines zunehmenden Lebensrechtes ersichtlich wird. Es bedarf nur des Perspektivwechsels vom späten zum früheren Lebensstadium hin, und es wird ein abnehmendes Lebensrecht daraus. Gibt es dann vielleicht auch ein maximales Lebensrecht, etwa zum Zeitpunkt der vollen Handlungs- und Leistungsfähigkeit, der vollen Gesundheit und des vollen Wohlbefindens (entsprechend dem „vollen Menschsein“?), dem mit Rückgang dieser Fähigkeiten und Eigenschaften Abnahme verordnet wird? Die angeblich von Gesetz und Rechtsprechung anerkannte „Notwendigkeit“ eines altersbezogenen abgestuften Rechtsschutzes der Ungeborenen ist auch nur politisch verordnet. Dr. med. Gerhard Haasis Max-Reger-Straße 40 28209 Bremen Unklare Begriffe, zweifelhafte Schlüsse In allem, was Rudolf Neidert über Feten schreibt, gebe ich ihm gern Recht. Bei seinen Thesen über Zygoten und Embryo- nen jedoch sehe ich zwei Schwierigkeiten. Erstens können auch nach mehr als einer Woche noch (ohne dass es dazu eines menschlichen Eingriffs bedürfte) aus einem Embryo eineiige Zwillinge entstehen. Zumindest so lange haben wir es mit einem „Dividuum“ zu tun. Was den Zeitraum nach den ersten beiden Wochen post conceptionem (p. c.) betrifft, so bin ich mir nicht sicher, ob es einen Begriff von Individualität gibt, der sich auf etwas ohne Zentralnervensystem (ZNS) und ohne persönliche Geschichte anwenden lässt. Zweitens ist der Ausdruck „unbewusste Schmerzempfindung“ recht dunkel. „Es tut weh, aber ich merke davon nichts“ ist eine widersprüchliche Auskunft. Der Hinweis auf „Reaktionen des Ungeborenen“ trägt nicht zur Aufklärung bei. Es gibt keinen Schmerz ohne Bewusstsein (von Schmerz), und es gibt kein Bewusstsein ohne ein ZNS oder ein ZNS-Äquivalent. Und Letzteres fehlt im frühen Embryonalstadium nachweislich. Solange die Begriffe, die wir benutzen, unklar bleiben, sind die Schlüsse, die wir aus ihnen ziehen, zweifelhaft. Andreas Scholtz M. A. Bredowstraße 18 10551 Berlin Klärung vor Vermittlung Die Idee des zunehmenden Lebensschutzes ist zumindest genauso plausibel wie absurd. Das Paradox wird durch unterschiedliche Perspektiven ausgelöst: zwar mag die intrauterine Entwicklung eine Tendenz der Zunahme nahe legen, andererseits geschieht jene in einer so engen zeitlichen Abfolge, dass jegliche Abstufungen genauso unzulässig sein dürften. Die eine Sichtweise mag eine Unterscheidung bei einem Abstand von wenigen Wochen, ja Tagen sogar für zulässig erklären, die andere lässt fragen, was dieser Abstand an der Balance zwischen dem Lebensrecht des Kindes und der Selbstverantwortung („Lebensinteressen“) der Mutter ändern kann. Meine Kritik ist nicht, dass der Autor nur die eine Perspektive dargestellt hatte. Dass diese jedoch zur „vermittelnden Lösung“ erklärt wurde, empfinde ich intellektuell als befremdend. Methodologisch ist zu fragen, ob hier der Vermittlungsversuch überhaupt begründet sei und nicht eher vor der D O K U M E N T A T I O N Klärung der Frage der eventuellen PGD der gesetzliche Lebensschutz revidiert werden müsste.Wenn in Berlin jede dritte Schwangerschaft abgebrochen wird, dann ist ernsthaft zu fragen, ob das Beratungskonzept seine Aufgabe erfüllt. Sonst setzen wir das gleiche Modell fort: hoher Anspruch in der Theorie und eine verheerende Praxis. Also Klärung vor Vermittlung! Dr. med. Rafael Mikolajczyk Friedrichrodaer Straße 121 12249 Berlin Kaum absehbare Auswirkungen Rudolf Neidert will mit seinem Beitrag die Diskussion um die Präimplantationsdiagnostik „durch einen empirischen Zugang“ voranbringen. Als Lösungsansatz propagiert er einen „Gleichklang“ zwischen dem kontinuierlichen Heranwachsen des ungeborenen Kindes und dessen rechtlichem Schutz. Am Anfang der vorgeburtlichen Entwicklung soll das Lebensrecht des Embryos in weitem Umfang zur Disposition stehen. In späteren Stadien verdiene der Embryo umso größere Achtung, „je mehr sich dieser dem geborenen Menschen annähert“. Dieser Ansatz wirkt auf den ersten Blick in sich stimmig. Tatsächlich gibt es für diesen „Gleichklang“ biologischer Wachstumsprozesse mit rechtlichen Schutzbestimmungen weder einen rational nachvollziehbaren Grund, noch wird dieses Prinzip von seinen Verfechtern selbst ernst genommen. Der Mensch macht während seines Lebens eine ausgeprägte Entwicklung durch. Er wird bekanntlich nicht vom Klapperstorch gebracht, fällt also nicht „fertig“ vom Himmel. Er entsteht, wie alle Lebewesen, aus kleinsten Anfängen heraus, entwickelt sich allmählich und kontinuierlich zu einer – individuell sehr unterschiedlichen – „ausgewachsenen“ Form, altert, verliert wieder an Leistungsfähigkeit und stirbt schließlich. Es ist keineswegs einleuchtend, irgendeiner Phase dieses Lebens allein aufgrund der biologischen Entwicklungsstufe größeren rechtlichen Schutz angedeihen zu lassen als einer anderen. Bei der Suche nach einer angemessenen rechtlichen Bewertung der vorgeburtlichen Entwicklung des Menschen lautet die Grundfrage: Geht es um den Schutzanspruch des menschlichen Lebewesens als solches oder um die Wertschätzung bestimmter Bewusstseinszustände und Fähigkeiten? Schmerzempfinden findet sich auch bei den Tieren. Soll also der empfindungslose Embryo rechtlich weniger Schutz genießen als ein ausgewachsener Hund, ein Schwein oder ein Huhn – wie der australische Bioethiker Peter Singer meint? In vielen Leistungsbereichen haben Haustiere einen weiten Vorsprung vor ungeborenen – aber auch neugeborenen – Kindern. Soll es wirklich darauf ankommen? Dann müsste Kleinkindern noch bis zum Alter von ein bis zwei Jahren das Lebensrecht abgesprochen werden. Unsere Rechtsordnung basiert auf der Unantastbarkeit der Menschenwürde. Sie ist das Fundament der Verfassung. Die Würde des Menschen kann aber nicht mit dem Körperwachstum, der physischen oder der intellektuellen Leistungsfähigkeit anwachsen und gegebenenfalls auch wieder abnehmen. Würde und (Nutz-)Wert unterscheiden sich prinzipiell. Deshalb kann aus einzelnen biologischen Entwicklungen auf dem Weg zum „fertigen“ Menschen (wann ist der Mensch „fertig“?) ein unterschiedlicher Grundstatus nicht abgeleitet werden. Gerade das Recht auf Leben, die Voraussetzung und Basis aller anderen Grundrechte, kann von der „Nützlichkeit“ oder Leistungsfähigkeit des einzelnen Menschen nicht abhängen. Neidert nimmt das von ihm postulierte Prinzip „wachsendes Leben gleich wachsender Schutz“ selbst nicht wirklich ernst, weil er es auf den Zeitraum vor der Geburt beschränkt. Die „Logik des Wachsens“ überschreitet diese Grenze. Die Geburt ist sicher ein wichtiger Einschnitt im Leben des Menschen, seine biologische Entwicklung bleibt an diesem Punkt aber keineswegs stehen. Die Leistungsfähigkeit des Neugeborenen befindet sich fast auf dem Nullpunkt. Der Säugling ist von der Hilfe und Zuwendung anderer völlig abhängig. Sowohl körperlich als auch geistig ist er noch meilenweit vom Entwicklungsstand eines Erwachsenen entfernt. Warum sollte dann das Recht auf Leben nicht auch nachgeburtlich noch „wachsen“ oder in Alter und Krankheit sowie im Falle einer Behinderung „abnehmen“? Wer hier nicht konsequent seinen Begründungsansatz für das Lebensrecht durchhält, setzt sich dem Verdacht aus, nur ein bestimmtes Ergebnis erzielen zu wollen. Die von Neidert angeführten Stufen der menschlichen Entwicklung (Schmerzempfinden, extrauterine Lebensfähigkeit), die er für rechtlich relevant hält, sind auch für sich genommen nicht geeignet, eine Abstufung des Lebensrechts zu rechtfertigen. Ansatz- und begründungslos bezeichnet Neidert die „bewusste Schmerzempfindung“ als „ersten Ausdruck einer leibseelischen Einheit“. Die Seele hat er in der Schilderung der „medizinischen Gegebenheiten“ nicht erwähnt. Ich bezweifle, dass die Seele Gegenstand der medizinischen Wissenschaft ist oder mit den naturwissenschaftlichen Methoden der Medizin beschrieben oder erfasst werden kann. Wenn Neidert aber von der Existenz einer Seele ausgeht, warum sollte dann die Schmerzempfindung das erste Erkennungszeichen dieser Seele sein? Die Seele als geistiges Sein- und Wirkprinzip (oder wie man sie auch immer definieren mag) könnte bereits lange vor dem Beginn der Schmerzempfindlichkeit vorhanden sein, zum Beispiel in dem zehn- oder zwölfzelligen Frühembryo, den Neidert im Rahmen der PGD zu opfern bereit ist.Wäre es nicht nahe liegend anzunehmen, dass der Embryo von Anfang an beseelt ist, da er die Fähigkeit zu bewusster Schmerzempfindung hervorbringt? Die von Neidert behauptete „Relevanz“ der Schmerzempfindlichkeit für die Frage der rechtlichen Schutzwürdigkeit entbehrt einer sachlichen Begründung. Eine solche wird auch nicht zu finden sein. Schließlich führt eine beeinträchtigte oder aufgehobene Schmerzempfindlichkeit bei geborenen Menschen auch nicht zu einer Minderung des Rechts auf Leben. Den „Durchbruch“ in der Entwicklung ungeborenen Lebens sieht Neidert erst mit der extrauterinen Lebensfähigkeit erreicht. Ihr spricht er „höchste Rechtserheblichkeit“ zu. Die Fähigkeit, außerhalb des Mutterleibes überleben zu können, ist aber ebenfalls ungeeignet, die Schutzwürdigkeit ungeborener Kinder zu beeinflussen. Je nach der individuellen Konstitution des ungeborenen Kindes kann diese Überlebensfähigkeit schon nach dem fünften Schwangerschaftsmonat gegeben sein. Der Zeitpunkt lässt sich aber nicht abstrakt für alle Fälle einheitlich bestimmen. Die extrauterine Lebensfähigkeit ist aber kein Wesensmerkmal des Embryos, sondern hängt von den medizinischen Kenntnissen des behandelnden Arztes und der technischen Aus- 55 D O K U M E N T A T I O N stattung der Klinik ab. Ein Kind, das auf der neonatologischen Abteilung eines deutschen Krankenhauses im sechsten Schwangerschaftsmonat „überlebensfähig“ ist, wird im gleichen Entwicklungsstadium in einem Land der „Dritten Welt“ nicht überleben, weil die notwendigen Geräte und Medikamente fehlen. Das Kind ist aber unabhängig vom Ort der Geburt dasselbe. Während noch vor dreißig bis vierzig Jahren viele Kinder im siebten Schwangerschaftsmonat als Frühgeborene nicht überlebensfähig waren, wären sie es heute ohne weiteres. Das kann aber nicht bedeuten, dass heute Kinder während der Entwicklung im Mutterleib „schneller“ zu schutzwürdigen Menschen werden als in den 60erJahren. Der Zeitpunkt der extrakorporalen Überlebensfähigkeit sagt etwas über das ärztliche Können und den Stand der medizinischen Technik, aber nichts über die „Menschqualität“ oder die rechtliche Schutzwürdigkeit eines Lebewesens aus. Das Kriterium der Lebensfähigkeit wäre im Übrigen ein Argument für den stärkeren strafrechtlichen Schutz künstlich erzeugter Embryonen durch das Embryonenschutzgesetz, den Neidert als problematisch ansieht. Im Rahmen der In-vitroFertilisation werden schließlich menschliche Embryonen einige Tage außerhalb des Mutterleibes am Leben erhalten. Sie müssten somit nach dem Kriterium der „extrauterinen Lebensfähigkeit“ in diesem frühen Entwicklungsstadium besonderen rechtlichen Schutz genießen. Nach dem Transfer des Embryos in die Gebärmutter müsste der Schutzstatus wieder abnehmen, um gegen Ende der Schwangerschaft erneut anzusteigen – ein zwar tatsächlich aus Rechtsvorschriften ableitbares Auf und Ab des Lebensschutzes, das allerdings rationaler Logik entbehrt. Die Abhängigkeit von günstigen Umgebungsbedingungen für das Weiterleben ändert an der Qualität des Subjekts nichts und kann daher auch kein Kriterium für den rechtlichen Schutzanspruch sein. Unterschiedliche Schutzbestimmungen sind daher – wenn überhaupt – nur mit anderen Argumenten zu begründen. Fragwürdig ist auch der „empirische Zugang“ Neiderts zu den Rechtsfragen. Die unterschiedlichen Rechtsfolgen in einzelnen gesetzlichen Regelungen müssen keineswegs Ausdruck eines unterschiedlichen Grundrechtsstatus hinsichtlich diverser vorgeburtlicher Entwicklungsstadien des 56 Menschen sein. Vor allem lässt sich aus widersprüchlichen Regelungen im einfachen Recht kein Schluss auf die grundrechtliche Schutzwürdigkeit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) ziehen. Neidert erkennt selbst an, dass dort, wo Widersprüche zu anderen Gesetzen oder zum Verfassungsrecht bestehen, „erforderlichenfalls durch Gesetzesänderung“ Widerspruchsfreiheit herzustellen sei. In welche Richtung die Gesetzesänderungen gehen müssten, kann sich nicht aus dem einfachen Recht, sondern nur aus einer Orientierung am Verfassungsrecht ergeben. Ein abgestuftes Lebensrecht lässt sich aus der Verfassung nicht begründen. Das Bundesverfassungsgericht hat vielmehr entschieden, dass „die von Anfang an im menschlichen Sein angelegten potenziellen Fähigkeiten genügen, um die Menschenwürde zu begründen“. „Liegt die Würde des Menschseins auch für das ungeborene Leben im Dasein um seiner selbst willen, verbieten sich jegliche Differenzierungen der Schutzverpflichtung mit Blick auf Alter und Entwicklungsstand dieses Lebens.“ Der menschliche Embryo hat daher auch im Frühstadium seiner Entwicklung vor der Nidation Anteil am Schutz der Menschenwürde und des Rechts auf Leben und darf im Rahmen der PGD nicht zur Disposition gestellt werden. Neidert gibt letztlich nur vor, eine „vermittelnde Lösung“ anzubieten. Der von ihm favorisierte gradualistische Ansatz endet schlicht in einer Befürwortung der PGD. Dies stellt keine „mittlere“ Position dar – auch nicht, wenn die PGD nur unter einschränkenden Bedingungen zugelassen werden soll. Zwischen Leben und Tod gibt es keine Mitte. Diejenigen Embryonen, die im Rahmen der PGD „aussortiert“ werden, bleiben nicht in einem Zwischenstadium hängen, sondern sterben ab. Das ist dem Verfahren immanent und wird von allen Beteiligten von vornherein einkalkuliert. Wenn – wie Neidert es vorschlägt – „Selbstverantwortung und -entscheidung der Frau“ umso mehr Berücksichtigung verdienen, „je früher der Embryo in seiner Entwicklung steht“, dann sind nennenswerte Restriktionen im Umgang mit Embryonen überhaupt nicht begründbar. Dann müssen sie nicht nur für das vermeintliche „Recht auf ein gesundes Kind“, sondern auch für andere, sicherlich „hochwertige“ Interessen in Forschung und Therapie geopfert werden. Die Entscheidung über die Zulassung der Präimplantationsdiagnostik ist daher ei- ne Grundsatzentscheidung mit kaum absehbaren Auswirkungen für den weiteren Umgang mit dem menschlichen Leben. Literatur beim Verfasser Rainer Beckmann Richter am Amtsgericht, Mitglied der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Recht und Ethik der modernen Medizin“ Friedenstraße 3 a, 97318 Kitzingen Schlusswort Vier Leserzuschriften, eine eher pro, die anderen kontra; drei echte Leserbriefe, ein Gegen-Aufsatz von über fünf Spalten – was lässt sich darauf „kurz“ antworten? Nun denn: Ich gäbe eine vermittelnde Lösung nur vor (Mikolajczyk, Beckmann). Gewiss vermittle ich nicht zwischen Ja und Nein zur PID, wohl aber zwischen den Extremen „volles Lebensrecht ab Zeugung“ und „erst ab Geburt“. – Dass Haasis nicht einmal Potenzialität gelten lassen will, entzieht seiner eigenen Position „Leben von Anbeginn“ den Boden; PID-Gegner stützen sich sonst gerade darauf. – Die „Logik des Wachsens“ überschreite die Grenze der Geburt (Beckmann). Ich begründe das gewachsene Schutzbedürfnis des Fetus mit Schmerzempfindung und Lebensfähigkeit (etwa 20 Wochen vor der Geburt!) und fordere ein strengeres Abtreibungsrecht zugunsten reifer Feten. – „Unbewusste Schmerzempfindung“ (dies zu Scholtz) ist ein sinnvoller Begriff, den der in Fußnote 14 zitierte Wissenschaftliche Beirat der BÄK verwendet. Letztlich geht es mir um Konsequenz und Ehrlichkeit angesichts unseres (auch vom BVerfG gebilligten) Abtreibungsrechts. „Menschenwürde“ wird zur Phrase, wenn man sie für Embryonen in vitro fordert, aber in vivo über 130 000 Abbrüche im Jahr zulässt. Da wünschte ich mir mehr Einsatz für Leben und Würde lebensfähiger Feten und gegen die Barbarei der Spätabtreibungen – auch dies ist meine Konsequenz zunehmenden Lebensrechts! Dr. jur. Rudolf Neidert Herrengarten 15 53343 Wachtberg D O K U M E N T A T I O N Heft 51–52, 25. Dezember 2000 Präimplantationsdiagnostik Mirjam Zimmermann Ruben Zimmermann Gibt es das Recht auf ein gesundes Kind? Eine ethische Anfrage zum „Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik“ der Bundesärztekammer D ie Bundesärztekammer (BÄK) hat in ihrem „Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik“ (Deutsches Ärzteblatt 9/2000) die fächerübergreifende Tragweite der Präimplantationsdiagnostik (preimplantation genetic diagnosis = PGD) benannt und zu einer gesamtgesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema aufgerufen. Zentral ist dabei folgende Frage: Welche ethische Bedeutung hat der Wunsch der betroffenen Eltern nach einem (gesunden) Kind? Die prinzipielle Schutzbedürftigkeit des ungeborenen Lebens wird im Vorwort zum Diskussionsentwurf hervorgehoben. Wenn aus diesem Grundsatz zugleich die zerstörende „Untersuchung von Embryonen im Stadium zellulärer Totipotenz“ und „fremdnützige Verwendung von Embryonen“ verworfen werden, kann man folgern, dass die Verfasser auf die Nennung eines zeitlichen Beginns dieser Schutzbedürftigkeit des ungeborenen Lebens verzichten. Keine subjektive Notlage Der Embryo ist von Beginn, das heißt ab dem Zeitpunkt der Fertilisation, schutzbedürftig im Sinne von Grundgesetz Art. 2 Abs. 2: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“ Hier folgt der Wissenschaftliche Beirat der BÄK der geltenden Gesetzeslage, wie sie etwa im Embryonenschutzgesetz (EschG) § 8 Abs. 1 oder im Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 28. Mai 1993 zum Schwangerschaftsabbruch festgeschrieben wurde. Die Verwerfung eines Embryos in vitro, an dem ein genetischer Defekt diagno- stiziert wurde, muss demnach als rechtswidrige Tötung eines menschlichen Lebens betrachtet werden. Allerdings besteht zum Beispiel nach Meinung der juristischen Vertreter der Bioethik-Kommission Rheinland-Pfalz in ihrem Bericht zur PGD „das Recht auf Leben nach Artikel 2 Abs. 2 GG nicht uneingeschränkt, sondern unterliegt gesetzlichen Schranken. Es muss gegen andere, verfassungsrechtlich garantierte Rechte, wie das Persönlichkeitsrecht, die Gesundheit der Mutter und das Elternrecht abgewogen werden“ (Bericht 1999, These II 4). Die entscheidende Frage in der Einschätzung der PGD lautet deshalb: Kann es Gründe geben, die das prinzipielle Lebensrecht des Embryos so relativieren, dass im Falle eines NichtTransfers – das entspräche dem Sterbenlassen des Embryos im Sinne einer passiven Tötung – von der Strafverfolgung abgesehen werden kann? Kann also analog zur gängigen Rechtspraxis beim Schwangerschaftsabbruch nach Pränataldiagnostik die Verwerfung eines erkrankten Embryos in vitro nach Präimplantationsdiagnostik als „rechtswidrig, aber straffrei“ eingestuft werden? Bei der Tötung ungeborenen menschlichen Lebens in vivo – das heißt der Abtreibung – sieht der Gesetzgeber lediglich wegen einer subjektiven Notlage der Mutter nach Pflichtberatung von einer Strafe ab. Im Blick auf den Embryo in vitro besteht diese subjektive Notlage zunächst nicht, weil er sich in der Hand Dritter (Biologe/Arzt) befindet. Es wäre also zu fragen, ob bei schwerer genetischer Belastung der Eltern der bei einer Schwangerschaft die Straffreiheit be- gründende Konflikt als Rechtfertigung für eine PGD antizipierbar ist. Die BÄK bejaht dies, wenn es in der Richtlinie heißt: „Ausschlaggebend ist, dass diese Erkrankung zu einer schwerwiegenden gesundheitlichen Beeinträchtigung der künftigen Schwangeren beziehungsweise der Mutter führen könnte.“ (Abs. 2: Indikationsgrundlage) Dabei wird allerdings außer Acht gelassen, dass im Fall des Schwangerschaftsabbruchs nach Pränataldiagnostik eine Schwangerschaft bereits besteht und ein schon existierendes erkranktes Kind den genannten Konflikt für die Mutter auslöst. Ärztlicher Rat und ärztliches Handeln reagieren hierbei auf eine schon bestehende Krankheitssituation. Anders im Fall der PGD: Hier wird der mögliche schwere Konflikt erst durch ärztliches Tun herbeigeführt, denn durch die assistierte Reproduktion entsteht mit „hohem Risiko“, wie der Richtlinienentwurf vorschreibt, ein Kind, durch dessen Schädigung eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Mutter zu befürchten ist. Ist es mit dem Ethos ärztlichen Handelns vereinbar, eine solche Konfliktsituation absichtlich herbeizuführen? Rechtfertigt es die Notlage der zukünftigen Mutter, eine Situation künstlich herbeizuführen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die Tötung eines menschlichen Embryos zur Folge hat? „Lebensinteressen“ In der ethisch-rechtlichen Bewertung ist jedoch nicht die Gesundheit der Mutter angesichts eines erkrankten Kindes mit dem Lebensrecht des Em- 57 D O K U M E N T A T I O N bryos aufzurechnen (wie beim Schwangerschaftsabbruch), sondern die Frage heißt, wie Prof. Dr. med. Hermann Hepp als Vorsitzender des BÄKArbeitskreises erläutert, „ob mit Rücksicht auf die gesundheitlichen und/ oder sozialen Lebensinteressen der Mutter die Schutzbedürftigkeit (des kranken Embryos in vitro) einer positiven Güterabwägung unterworfen werden darf und daraus ein abgestufter Rechtsschutz resultiert.“ (Hepp 2000, 218). Wenn man also die Rechte der Mutter geltend machen will, dann geht es um „Lebensinteressen“, sei es die Angst, „an der Furcht vor einem genetisch bedingt schwerstkranken Kind gesundheitlich zu zerbrechen“ (Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie, Vorwort), sei es um die Hoffnung auf ein gesundes Kind. In jedem Fall wird die schwere Konfliktsituation gegenwärtig nur antizipiert. Die entscheidende Frage lautet also, ob und in welchem Maß die Wünsche und Interessen der Mutter, die sich auf einen zukünftigen Sachverhalt beziehen, ethische Bedeutung erlangen können. Die Ethik-Kommission des Landes Rheinland-Pfalz versichert, dass der Wunsch eines Paares mit hohen genetischen Risikofaktoren „ein eigenes gesundes Kind zu erhalten, (. . .) sittliche Qualität“ hat (These III 2 a). Doch wie hoch ist diese „sittliche Qualität“? Darf sich der „Kinderwunsch“ ausdrücklich auf „Wunschkinder“, nämlich gesunde eigene Kinder beschränken? Wenn sich der Wunsch allgemein auf Kinder beziehen würde, wäre entweder durch Verzicht auf biologische Elternschaft (Adoption, Besamung) oder durch Inkaufnahme eines behinderten Kindes die PGD überflüssig. Der Wunsch der Eltern bezieht sich folglich auf eigene gesunde Kinder, sofern man „gesund“ im Sinne der Abwesenheit der zu befürchtenden genetischen Schädigung definiert. Hedonismus-Prinzip In rechtlicher Hinsicht etwa nach Art. 6 Abs. 2 GG sind zwar „Pflege und Erziehung der Kinder (. . .) das natürliche Recht der Eltern“, allerdings wird da- 58 bei die Existenz der Kinder selbstverständlich vorausgesetzt. Können Eltern hingegen auch Rechte auf die Existenz gesunder Kinder geltend machen, oder kann man diesem Wunsch zumindest hohe sittliche Qualität bescheinigen? Wer dazu beiträgt, das Leid einer betroffenen Familie (durch Vermeidung einer Schwangerschaft auf Probe oder durch Nicht-Transfer eines kranken Kindes) zu verringern beziehungsweise das Glück der Eltern durch ein gesundes Kind zu vermehren, ist dem so genannten Hedonismus-Prinzip verpflichtet: Nach dieser Maxime ist es ethisch geboten, Leid zu verringern und Glück zu vergrößern. „Der klassische Utilitarist betrachtet eine Handlung als richtig, wenn sie ebenso viel oder mehr Zuwachs an Glück für alle Betroffenen produziert als jede andere Handlung, und als falsch, wenn sie das nicht tut“ (Singer 1994, 17). Präferenz-Utilitarismus Da sich die ethische Bewertung allerdings zunächst nicht auf eine schon existierende Handlung bezieht, sondern auf einen Wunsch beziehungsweise ein bestimmtes Interesse der Eltern, handelt es sich bei dieser Argumentation um eine Spielart des klassischen Utilitarismus, dem „Präferenz-Utilitarismus“, wie er beispielsweise von Richard Marvin Hare (Oxford) vertreten wurde. Nach dieser Variante werden nicht die Handlungen, sondern die Präferenzen, das heißt die Interessen und Wünsche, der betroffenen Personen gegeneinander abgewogen. Eine Handlung wird nach dem Grad der Übereinstimmung ihrer zu erwartenden Folgen mit den Wünschen der betroffenen Personen bewertet. In dieser Weise kann dem „Interesse (der Mutter), kein missgebildetes Kind zu haben, das die normale Entwicklung der übrigen Familie verhindern oder stark beeinträchtigen kann“ (Hare 1992, 376), hohe sittliche Qualität zugesprochen werden. Das Hedonismus-Prinzip wird gerade von Vertretern des Präferenz-Utilitarismus mit der Perspektive der „Totalansicht“ (total view) verknüpft: Den moralischen Wert einer Handlung kann an nur aus der Gesamtsumme des Glücks aller Betroffenen eruieren. Nach Hare und Singer spielt es keine Rolle, ob die Gesamtsumme des Glücks durch die Lustvermehrung existierender Wesen oder durch die Vermehrung lustfähiger Wesen angestrebt wird (Singer 1994, 139). Wenn es ethisch gerechtfertigt scheint, mit dem Ziel der Leidverringerung gesunde Embryonen zu produzieren, kranke aber zu verwerfen, dann findet exakt die Argumentation des Präferenz-Utilitarismus mit Hedonismus-Prinzip und Totalansicht Anwendung. Denn, so Singer, „für den Präferenz-Utilitarismus ist das dem getöteten Wesen zugefügte Unrecht nur ein zu beachtender Faktor, und die Präferenz des Opfers könnte manchmal durch die Präferenzen von anderen aufgewogen werden“ (Singer 1994, 130). Wenn man die bei Präimplantationsdiagnostik gestellte Problematik als „Interessenkonflikt“ definiert, bei dem „Lebensinteressen“ der Mutter und Lebensinteresse des Embryos abgewogen werden müssen, dann unterstreicht das die Beobachtung, dass die Argumentation des Präferenz-Utilitarismus bemüht wird. Peter Singer und Richard Marvin Hare befürworten aber nicht nur die selektive Chance des Schwangerschaftsabbruchs, sie sind auch der Auffassung, dass die Eliminierung von leidenden Menschen auch nach der Geburt, zum Beispiel bei behinderten Säuglingen, möglich sein sollte. „Säuglinge zu töten kann nicht gleichgesetzt werden mit dem Töten normaler menschlicher Wesen oder anderer selbstbewusster Wesen. (. . .) Das Leben eines Neugeborenen hat für dieses weniger Wert als das Leben eines Schweins, eines Hundes oder eines Schimpansen für das nichtmenschliche Tier“ (Singer 1994, 233.219). Ethische Dammbrüche Die Ethik Singers beruht auf Voraussetzungen (wie Speziezismuskritik, reduktionistisches Menschenbild, vgl. dazu Zimmermann 1996 und 1997), die von den Verfassern des Diskussionsent- D O K U M E N T A T I O N wurfs nicht geteilt werden. Dennoch sollte es zu denken geben, dass sich die durch die Argumentation begründete abgestufte Schutzwürdigkeit des Embryos in vitro problemlos auf andere Bereiche menschlichen Lebens übertragen lässt. In dem Maß, wie man dem Hedonismus-Prinzip Raum gewährt, wird man sich bei konsistenter Argumentation kaum gegen ethische Dammbrüche in anderen Bereichen wehren können. Die Argumentation in der medizinischen Praxis läuft auf einer anderen Ebene: Die Verfechter der PGD wollen mit hohem Ethos Menschen helfen, und zwar Menschen, die „an der Furcht vor einem genetisch bedingt schwerstkranken Kind gesundheitlich zu zerbrechen drohen“ (Bundesärztekammer, Vorwort zum Richtlinienentwurf). Wenn die Hilfe für die betroffenen Menschen jedoch darin besteht, ihnen zu einem „gesunden“ eigenen Kind zu verhelfen, dient die Erzeugung (und Verwerfung) der Embryonen letztlich fremden Zwecken. Immanuel Kant wollte dieser Verzweckung des menschlichen Lebens einen Riegel vorschieben. Eine Formulierung seines so genannten kategorischen Imperativs in der „Grundlegung der Metaphysik der Sitten“ lautet: „Handle so, dass du die Menschheit in deiner Person als in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, und niemals bloß als Mittel gebrauchst“ (Kant 1991, 79). Der Mensch, und das gilt auch für das Kind und den Embryo in jedem Entwicklungsstadium, „existiert als Zweck an sich selbst“. Ein Embryo kann deshalb nicht zum Mittel der Furchtbekämpfung seiner Eltern angesichts ihres Wunsches auf ein gesundes eigenes Kind eingesetzt werden. „Praktische Ethik“ Fazit: Weder die klinische Notwendigkeit noch der Hinweis auf die Praxis in Nachbarländern können als ethisches Argument hinreichen (Hepp 2000, 1221). Ebenso wenig kann der Wunsch der Eltern nach einem gesunden Kind eine ethische Validität beanspruchen, die das Lebensrecht anderen menschlichen Lebens außer Kraft setzen könnte. Wenn man anerkennt, dass die Schutzwürdigkeit des menschlichen Embryos vom Zeitpunkt der Fertilisation an besteht, dann könnte das Lebensrecht des Embryos nur dann einer positiven Güterabwägung mit den Interessen der Mutter unterworfen werden, wenn der spätere, die Straffreiheit bei Schwangerschaftsabbruch begründende Konflikt im Analogieschluss bereits bei der PGD antizipiert wird. Eine ethische Argumentation, die dies bejaht, stützt sich auf utilitaristische Maximen wie Interessenabwägung, Hedonismus-Prinzip und Totalansicht unter Einbeziehung noch nicht existierender Wesen. Wem diese „praktische Ethik“ angemessen erscheint, der findet darin einen moralischen Rückhalt zur Begründung der Präimplantationsdiagnostik. Wer jedoch gegenüber dieser Moralphilosophie mit ihren bekannten Konsequenzen (vgl. Peter Singers Euthanasie-Thesen) skeptisch bleibt, sollte die ethische Argumentation in der Begründung der PGD noch einmal überdenken. Literatur 1. Hare RM: Das missgebildete Kind. Moralische Dilemmata für Ärzte und Eltern. In: Leist A (Hg.): Um Leben und Tod. Moralische Probleme bei Abtreibung, künstlicher Befruchtung, Euthanasie und Selbstmord, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 3. Aufl. 1992; 374–383 (zuerst: The Abnormal Child: Moral Dilemmas of Doctors and Parents, Dokumentation in Medical Ethics 3, 1974). 2. Hepp H: Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie der Bundesärztekammer: Präimplantationsdiagnostik – medizinische, ethische und rechtliche Aspekte, Dt Ärztebl 2000; 97: A-1213–1221 [Heft 18]. 3. Höffe O: Einführung in die utilitaristische Ethik, Tübingen, ²1992. 4. Kant I: Grundlegung der Metaphysik der Sitten (1785), Stuttgart, 1991. 5. Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz (Hg.): Präimplantationsdiagnostik. Thesen zu den medizinischen, rechtlichen und ethischen Problemstellungen. Bericht der Bioethik-Kommission des Landes Rheinland-Pfalz vom 20. Juni 1999, Alzey, 1999. 6. Singer P: Praktische Ethik. Neuausgabe, Stuttgart: Reclam, 1994 (orig. Cambridge 1993). 7. Zimmermann M, Zimmermann R: Präferenz-Utilitarismus. Zur Neuausgabe der „Praktischen Ethik“ von Peter Singer, Zeitschrift für Evangelische Ethik 40 (1996), 295–307. 8. Zimmermann M: Geburtshilfe als Sterbehilfe? Zur Behandlungsentscheidung bei schwerstgeschädigten Neugeborenen und Frühgeborenen, Frankfurt a. M. u. a., 1997. 9. Zimmermann M, Zimmermann R: Präimplantationsdiagnostik: Chance oder Irrweg?, Zeitschrift für Evangelische Ethik 45 (2001), 47–57. ❚ Zitierweise dieses Beitrags: Dt Ärztebl 2000; 97: A 3487–3489 [Heft 51–52] Anschrift der Verfasser: Dr. theol. Mirjam Zimmermann Dr. theol. Ruben Zimmermann Nadlerstraße 17 69226 Nußloch E-Mail: [email protected] Heft 8, 23. Februar 2001 Medizinische Ethik Zu dem Beitrag „Gibt es das Recht auf ein gesundes Kind?“ von Dr. theol. Mirjam Zimmermann und Dr. theol. Ruben Zimmermann in Heft 51–52/2000: Nichts für Nichtmediziner! Bei diesem Thema ist eine sachliche Diskussion geboten. Leider vermitteln die Autoren dieses Artikels durch ihre Ausdrucksweise, dass es ihnen weniger auf eine solide Bewertung der Präim- plantationsdiagnostik (PGD) – eventuell unter Einbeziehung der Erfahrungen anderer Länder – als auf eine polemische Debatte ankommt. Bereits die Überschrift „Recht auf das gesunde Kind?“ ist einer ernsthaften Debatte in einer medizinischen Zeitschrift unangemessen. Auch die Autoren wissen natürlich, dass es bei der PGD nicht um „Gesundheit“ des Kindes schlechthin geht, sondern nur um die Vermeidung von bestimmten Krankheiten, die wir heute erkennen können (deren Liste mit der Zeit sicherlich zunehmend länger werden wird). Auch geht es nicht um „kranke“ Embryonen, sondern um solche mit früh erkennbaren genetischen Schäden. Polemisch ist auch die Behauptung, mit der Erlaubnis der PGD würde einer weitergehenden Eugenik Tür und Tor geöffnet. Jede medizinisch-technische Entwicklung hat ihre Missbrauchsmöglichkeiten. Gab es nicht auch ernsthafte Menschen, die vor den Gefahren der Narkose gewarnt haben? 59 D O K U M E N T A T I O N Die Ansicht, die PGD missachte ethische Normen unserer Gesellschaft, missachtet gröblich die Einzelschicksale betroffener Eltern und Kinder. Wer kann sich das Recht nehmen, sich über die Sorgen der Betroffenen hinwegzusetzen. Ich denke, dass in unserer Gesellschaft das Wohl des Einzelnen das höchste Gut ist. Oder wollen wir tatsächlich wieder eine Unterordnung des Individualwohls unter den gesellschaftlichen Nutzen? Das hat, gleich unter welchem Vorzeichen, das freiheitliche Denken noch nie gefördert. Beispielhaft zeigt dieser Artikel das Dilemma der Ethik der Naturwissenschaften auf: sie kann nicht selbst Neues erschaffen, sondern kann nur wissenschaftliche Ergebnisse anderer Wissenschaften bewerten. Die Basis der Bewertung bleibt oft unklar, so auch in diesem Artikel.Wie ein Journalist sucht der Ethiker Beispiele aus der Literatur, die seinen Standpunkt untermauern, ohne ein Für und Wider umfassend zu berücksichtigen. Dazu gehören auch abschreckende Beispiele von Autoren, die über das jeweilige Ziel hinaus gedacht haben, wie der in diesem Artikel zitierte Autor Singer. Ich plädiere dafür, Fragen der medizinischen Ethik nicht in die Hände von Nichtmedizinern zu legen. Diejenigen, die eine Entwicklung vorantreiben, sind verantwortlich für deren Richtung, denn nur sie kennen die Möglichkeiten, die in dieser Entwicklung stecken. Diese Wissenschaftler müssen sich über die ethischen Auswirkungen ihrer Technik Gedanken machen. Die Delegation an Ethiker gleich welcher Herkunft, die sich mühsam mit der Anwendung solcher Techniken vertraut machen müssen, bedeutet fast immer einen Schritt zurück. Es bedeutet auch, wichtige Aspekte der Wissenschaft aus der Hand zu geben. Prof. Dr. med. W. Krause, Klinik für Andrologie und Venerologie, Universitäts-Hautklinik, Deutschhausstraße 9, 35037 Marburg Menschenwürde nicht tangiert Ich empfehle den Autoren, die Frage einmal umgestellt zu diskutieren: Gibt es das Recht des Kindes auf Gesund- 60 heit? Ich denke, die Theologen werden mit ihrem insinuiertem „HedonismusPrinzip“ Schwierigkeiten bekommen. In der Tat: Die Deutschen holen in der Gen-Technik auf. Das ist erfreulich und auch notwendig, denn Engländer und Franzosen sind schon weiter. Wir haben die reelle Chance, die Vererbung furchtbarer Krankheiten und Missbildungen zu vermeiden. Wenn das gelänge, welch ein Segen und welch ein Triumph für die biomedizinische Forschung! Die Einsprüche und Bedenken der Moralisten aller Konfessionen können den wissenschaftlichen Fortschritt allenfalls verzögern, aber ihn nicht aufhalten. Der ethische Diskurs ist ein Faktum, er mag die Forschung begleiten, aber er soll sie nicht behindern. Die Menschenwürde, von der stets die Rede ist, wird durch die Implantationstechnik nicht tangiert, wenngleich die Wertvorstellungen von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent unterschiedlich bleiben werden. Der Gesetzgeber ist nun aufgefordert, eindeutige und verbindliche Regeln zu treffen. Im Gesetz soll sich die vertretbare (nicht die wahre oder falsche) Bioethik wiederfinden. Schiller im Wallenstein: „Das ganz Gemeine ist’s, das ewig Gestrige, was immer war und immer wiederkehrt, und morgen gilt, weil’s heute hat gegolten . . . “ Dr. Alfons Werner Reuke, Sommerhalde 42, 71672 Marbach am Neckar Eugenische Selektion? Als Eltern von drei Kindern, darunter eines mit Down-Syndrom, sehen wir mit zunehmender Sorge die Entwicklung auf dem Gebiet der Pränataldiagnostik. Unter der Ehrfurcht gebietenden Maske der „Medizinischen Indikation“ kommt die altbekannte Fratze der eugenischen Selektion zum Vorschein. Es ist erschreckend, wie gelassen und routiniert Spätabtreibungen von Feten mit Trisomie 21 abgewickelt und inzwischen kaum noch hinterfragt werden. Leider ist es so, dass Frauen oftmals zu einer Amniozentese gedrängt werden (mit allen fatalen Konsequenzen), Frauen, die einem solchen Eingriff anfangs vielleicht unentschlossen oder gar ablehnend gegenüberstanden („Ich empfehle Ihnen eine Fruchtwasseruntersuchung.“). Es wird der Anschein erweckt, die Amniozentese sei Bestandteil einer modernen Schwangerschaftsvorsorge (für Frauen ab 35). Etwas mehr Sorgsamkeit seitens der „beratenden“ Ärzte wäre hier angebracht. Diese sind mangels eigener Anschauung und Reflexion vielfach nicht in der Lage, die liebenswerte Individualität eines Kindes mit Down-Syndrom zu würdigen. Die Entscheidung zur Spätabtreibung demonstriert scheinbar Selbstbestimmung, verheißt Befreiung und Ungebundenheit, entlässt die Betroffenen aber häufig in schwere Krisen, die, auch wenn man sie aus eigener Kraft überwunden, pharmakologisch gemeistert oder psychotherapeutisch ausbehandelt glaubt, doch Narben im Gemüt hinterlassen. Unser Erleben in der Familie und die Erfahrung vieler Eltern zeigen ganz klar, dass es durchaus Sinn macht und tiefe Freude bereitet, teilnehmend die Entwicklung eines Down-Kindes zu begleiten, unterstützt durch vielfältige und hervorragende Fördermöglichkeiten. Das Down-Syndrom lässt sich eben nicht auf die Auflistung typischer Stigmata reduzieren . . . Kein unbedeutender Lichtblick in einer Welt, die in vielen Bereichen als kalt, abweisend und hart empfunden wird. Es mag schon sein, dass ein Mensch mit Down-Syndrom außerstande ist, die Anforderungen unserer Leistungsgesellschaft zu erfüllen. Kann dies aber seine vorgeburtliche Tötung in irgendeiner Weise rechtfertigen? Dres. med. Isabel und Christoph Starz, ValentinBecker-Straße 2, 97769 Bad Brückenau D O K U M E N T A T I O N Heft 1–2, 8. Januar 2001 Medizinische Ethik Weiterhin Diskussionsbedarf Die deutschen Ärzte sind sich weitgehend einig. Die Gesetze sollten nicht alles erlauben, was medizinisch möglich ist. D ie Niederländer legalisieren die aktive Sterbehilfe, in Großbritannien ist soeben das therapeutische Klonen genehmigt worden, in zahlreichen europäischen Staaten ist die Präimplantationsdiagnostik erlaubt. In Deutschland sind sich Ärzte und Politiker weitgehend einig: Es soll nicht alles erlaubt werden, was möglich ist. So will zum Beispiel Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer die Präimplantationsdiagnostik (preimplantation genetic diagnosis = PGD) unmissverständlich in einem neuen Fortpflanzungsmedizingesetz verbieten. Dies soll das bisher geltende Embryonenschutzgesetz ablösen. In Gang gesetzt wurde die Diskussion über diese Methode der vorgeburtlichen Diagnostik durch einen von der Bundesärztekammer vorgelegten, von deren Wissenschaftlichem Beirat ausgearbeiteten „Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik“. Nach dem Entwurf kann eine streng auf den Einzelfall bezogene Indikationsstellung zur PGD infrage kommen. Das Spektrum möglicher Indikationen ist äußerst eng gefasst und bezieht sich ausschließlich auf Paare, bei deren Nachkommen nachgewiesenermaßen ein hohes Risiko für eine schwerwiegende, genetisch bedingte Erkrankung besteht. Das Bundesgesundheitsministerium lehnt eine Präimplantationsdiagnostik dagegen unter anderem deswegen ab, weil die Gefahr bestehe, dass in der Gesellschaft eine Erwartungshaltung für gesunde Kinder entstehen könnte und es Eltern schwer gemacht werde, sich für ein behindertes Kind zu entscheiden. Auch in der Bundesärztekammer (BÄK) sei die Meinungsbildung über die Präimplantationsdiagnostik keineswegs abgeschlossen, betont deren Prä- sident, Prof. Dr. med. Jörg-Dietrich Hoppe. Vielmehr habe die BÄK die Diskussion angeregt, um zu entscheiden, ob und inwieweit die PGD in Deutschland Anwendung finden soll. Ein Argument, das für die Anwendung der PGD angeführt wird, ist, dass sie Spätabtreibungen verhindern könnte. Bei festgestellter Behinderung nach pränataler Diagnostik sind derzeit aufgrund der medizinischen Indikation Abtreibungen bis zum Ende der Schwangerschaft möglich. Dazu erklärte Andrea Fischer, dass es zwischen den beteiligten Ministerien und dem Bundestag Arbeitsgruppen gebe, die sich mit dieser Problematik beschäftigten. „Dort wird darüber nachgedacht, dass Spätabtreibungen nur in bestimmten Zentren gemacht werden sollen, mit entsprechender vorheriger Beratung. Dies soll Spätabtreibungen sehr stark einschränken.“ Auch zum therapeutischen Klonen, das durch das Embryonenschutzgesetz (ESchG) verboten ist, fordert Hoppe eine gesellschaftliche Diskussion. Eine Lockerung des ESchG hält er für den falschen Weg. Es müsste vielmehr geklärt werden, ob nicht auch mit körpereigenen erwachsenen Stammzellen neue Therapien für bisher unheilbare Krankheiten entwickelt werden könnten. Nach Hoppes Überzeugung wird das Klonen von Embryonen erhebliche Auswirkungen auf „unser Verständnis von Menschenwürde und schützenswertem Leben“ haben. Ministerin Fischer teilt diese Auffassung: „Wenn wir die Forschung an embryonalen Stammzellen erlauben, würde dies den Einstieg in die Produktion überzähliger Embryonen bedeuten. Das ist zurzeit aber nicht erlaubt, und ich meine auch nicht, dass wir diesen Weg gehen sollten.“ Sie räumt aber ebenso wie die CDU-Parteivorsitzende Angela Merkel ein, dass es eine Grauzone im ESchG gibt: Im Ausland gewonnene embryonale Stammzellen können nach Deutschland importiert werden. „Trotzdem kann sich ein Land dafür entscheiden, dass es an dieser Erforschung nicht an vorderster Stelle teilnimmt, die Ergebnisse später jedoch nutzt“, sagte Merkel. In den Niederlanden hat Ende November 2000 das Parlament ein Gesetz beschlossen, wonach aktive Sterbehilfe unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt sein soll.Auch in Deutschland gibt es, so Hoppe, eine Bewegung, die auf die Abschaffung des § 216 des Strafgesetzbuches hinarbeitet, in dem die Tötung auf Verlangen unter Strafe gestellt ist. Bundesjustizministerin Herta DäublerGmelin sprach sich strikt gegen solche Bestrebungen aus. Die BÄK hatte aktiver Euthanasie in ihren Grundsätzen zur ärztlichen Sterbebegleitung ebenfalls eine deutliche Absage erteilt. Ärzte sollten Leben erhalten und nicht Gisela Klinkhammer töten. Heft 3, 19. Januar 2001 Embryonenschutz Englische Verführung Das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat neuerdings einen gewissen Ruf, gegenüber dem Fortschritt in der Biotechnologie besonders aufgeschlossen zu sein und die tradierte Ethik, angesichts allerlei hoch gespannter Hoffnungen, infrage zu stellen. Die Lehre vom Segen der reinen Marktwirtschaft schwappt so vom Wirtschaftsund Finanzteil ins Kulturelle. Ganz in diesem Sinne erschien dort am 29. Dezember letzten Jahres ein Artikel „gegen eine Ethik mit Scheuklappen“, in dem Karl-Friedrich Sewing die Entscheidung des britischen Unterhauses zum so genannten therapeutischen Klonen verständnisvoll würdigte und Kritiker aus Deutschland als „verbale Schnellfeuergewehre“ abtat. Lediglich 61 D O K U M E N T A T I O N Bundeskanzler Schröder bekam ein Lob wegen seiner „Ansätze einer differenzierten Betrachtungsweise“. Sewing spricht sich für Forschung an embryonalen Stammzellen aus, „überzählige“ Embryonen, die bei der künstlichen Befruchtung anfielen, sollten eingesetzt werden dürfen. Die traditionellen Verfahren hätten wohl ausgedient, der Aufbruch zu neuen Ufern sei gerechtfertigt, begründet Sewing. Wenn im Ausland mit embryonalen Stammzellen geforscht werde, dürfe sich die deutsche medizinische Wissenschaft nicht verweigern. Sewing firmiert in der Frankfurter Allgemeinen als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer, nicht als Privatmann. Dem würde man selbstverständlich die Freiheit zubilligen, seine Meinung in dieser Weise zu artikulieren und gegen (angebliche) ethische Scheuklappen aufzufahren. Für den Vorsitzenden einer offiziellen Einrichtung der Ärzteschaft gelten andere Spielregeln. Sewing vertritt Auffassungen, die vielleicht von interessierten Forschern geteilt werden, nicht aber von der verfassten Ärzteschaft. Er segelt somit unter falscher Flagge. Er segelt freilich im Strom des Zeitgeistes, gehört er doch zu jenen, die angestrengt danach suchen, Forschung an Embryonen, die bisher nicht erlaubt und ärztlich umstritten ist, zu rechtfertigen. Lockt Sewing mit dem noch relativ schlichten Hinweis auf das Ausland, dann der neue Kulturstaatsminister in des Bundeskanzlers Kabinett mit philosophischen Versuchungen, was nahe liegt, ist doch Julian Nida-Rümelin Professor für Bioethik: Für ihn (so sein Artikel im Berliner Tagesspiegel vom 3. Januar) ist das ausschlaggebende Kriterium die Menschenwürde. So weit, so gut. Doch dann kommt’s. Die rhetorische Frage, ob das Klonen eines Embryos die Menschenwürde beschädige, beantwortet er: „Die Antwort ist für mich: zweifellos nein.“ Denn, so Nida-Rümelins Rechtfertigung: „Die Achtung der Menschenwürde ist dort angebracht, wo die Voraussetzungen erfüllt sind, dass ein menschliches Wesen entwürdigt werde, ihm seine Selbstachtung genommen werden kann. Daher lässt sich das Kriterium 62 der Menschenwürde nicht auf Embryonen ausweiten. Die Selbstachtung eines Embryonen lässt sich nicht beschädigen.“ Das ist die anspruchsvolle Ver- brämung des Bioethikers Nida-Rümelin von Sewings schlichtem Utilitarismus. Die Schlittenfahrt hat begonNorbert Jachertz nen. Heft 7, 16. Februar 2001 Embryonenschutz Zu dem Kommentar „Englische Verführung“ von Norbert Jachertz in Heft 3/2001: Journalistische Schlittenfahrt Im Deutschen Ärzteblatt hat dessen Chefredakteur Norbert Jachertz meinen Aufsatz „Warum nicht Embryonen? Gegen eine Ethik mit Scheuklappen“ in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 29. Dezember 2000 „kommentiert“. Die Äußerungen von Jachertz (inhaltlich hat er sich mit dem Aufsatz überhaupt nicht auseinander gesetzt) zeigen, dass es in ihm Gott sei Dank wenigstens einen Menschen in Deutschland gibt, der auf die schwierigen Fragen der modernen Medizin eine Antwort weiß. Er wird auch sicherlich Gleichgesonnene finden, die ihm die Richtigkeit seiner Denke bestätigen. Im Namen der von ihm gleichermaßen wie ich gescholtenen interessierten Forscher (Diese haben der Ärzteschaft seit Jahrhunderten durch ihre Arbeit ermöglicht, ihre Patienten auf hohem wissenschaftlichem und technischem Niveau erfolgreich zu behandeln.) entschuldige ich mich dafür, dass sie anders denken als Jachertz. Ob Jachertz wohl weiß, dass nicht gerade die dümmsten Ärzte, Naturwissenschaftler, Juristen, Theologen und Philosophen zurzeit in den verschiedensten Gremien (Wissenschaftlicher Beirat der Bundesärztekammer, Deutsche Forschungsgemeinschaft, European Science Foundation) um einen sachgerechten und ethisch und rechtlich vertretbaren Umgang mit den modernen medizinischen Problemen ringen? Bei solchen Äußerungen des Chefredakteurs des Deutschen Ärzteblattes darf sich niemand wundern, wenn die Diskussion um die brennenden Themen der modernen Medizin auf hohem sachkundigem und ethischem Niveau (wenn man von den Äußerungen von Nida-Rümelin einmal absieht, mit dem Jachertz mich gerne gedanklich zu identifizieren versucht) nicht im Deutschen Ärzteblatt, sondern (auch von Ärzten) in den großen Tages- und Wochenzeitungen geführt wird. Eine journalistische Schlittenfahrt nach Jachertzschem Strickmuster schadet der deutschen Ärzteschaft, nicht aber demjenigen, den er im Fadenkreuz seines „Kommentars“ hat. Prof. Dr. med. Karl-Friedrich Sewing, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer, Herbert-Lewin-Straße 1, 50931 Köln Wer ist die deutsche Ärzteschaft? Herr Jachertz greift den Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer, Prof. Dr. Sewing, wegen seines Aufsatzes in der FAZ massiv an, indem er die Behauptung aufstellt – als Chefredakteur des Deutschen Ärzteblattes als solcher gekennzeichnet –, dass Sewings Auffassungen zwar „von interessierten Forschern“, aber nicht von der „verfassten Ärzteschaft“ geteilt würden. Wer ist das? Die gesamte deutsche Ärzteschaft? Der Deutsche Ärztetag? Der Präsident/Vizepräsident der Bundesärztekammer? Wann hat eine Abstimmung über das therapeutische Klonen stattgefunden? Das müsste mir entgangen sein! Es ehrt die Herren Prof. Hoppe und Dr. Montgomery, wenn sie für die Beibehaltung des deutschen Embryonenschutzgesetzes plädieren, das therapeutisches Klonen verbietet. Dennoch handelt es sich dabei nur um ihre persönliche Meinung. Auch dem Chefredakteur des Mitteilungsblattes aller deutschen Ärztinnen und Ärzte steht eine solche apodiktische Feststellung nicht zu. Sie hat eine herabsetzende Tendenz, die gerade bei einem so sensiblen Thema Herrn Jachertz nicht gut zu Gesicht steht. Warum nicht den ethischen Diskurs im Deutschen Ärzteblatt eröffnen, wie zur PID geschehen? Warum nicht ein Leserforum, wo jeder zu Wort kommt? Es sind im Übrigen D O K U M E N T A T I O N längst nicht nur „interessierte (etwa profitorientierte?) Forscher“, die sich mutig dafür aussprechen, dass Deutschland nicht bei dem Anspruch verharrt, eine Insel höchster ethischer Maßstäbe in Europa bleiben zu wollen und dabei die Entwicklung eines der aussichtsreichsten therapeutischen Ansätze dieses Jahrtausends zu verpassen. Prof. Dr. med. Ch. Rittner, Institut für Rechtsmedizin, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Am Pulverturm 3, 55131 Mainz Heft 10, 9. März 2001 Unter falscher Flagge? Mit scharfen Worten kritisiert Jachertz die in der FAZ getätigte Meinungsäußerung zur Stammzellenforschung von Sewing, dem Chef des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer. Er habe nicht „die Meinung der verfassten Ärzteschaft“ wiedergegeben und „segele unter falscher Flagge“. Ziel der Forschung mit (pluri-, nicht toti-potenten!) humanen Stammzellen ist die Entwicklung von Therapien für bisher nicht behandelbare Krankheiten. Dies ist wohl zunächst ein akzeptables, ja respektables Ansinnen eines Arztes. Dasselbe gilt für Konzepte des therapeutischen Klonens, mit dessen Hilfe klinisch dringend benötigtes Gewebe, keine Embryonen hergestellt werden sollen. Ebenfalls eine Absicht, die ein Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates der verfassten deutschen Ärzteschaft wohl (auch öffentlich) äußern darf, vielleicht sogar muss (?). Gegen diese (zukünftigen) Heilmethoden, deren Erforschung unter Verwendung embryonaler Stammzellen in den USA, in England und Frankreich auch mittels therapeutischen Klonens mittlerweile politisch akzeptiert sind, steht das deutsche Embryonenschutzgesetz. Dieses spricht jeder befruchteten humanen Eizelle, gleich welchen Stadiums und wo immer sich diese befindet, den vollen Umfang der Menschenwürde zu. Gleichzeitig verschreibt und implantiert die „verfasste deutsche Ärzteschaft“ Millionen von Frauen Spiralen zur Kontrazeption, die nichts anderes tun, als solche „Embryonen“ unter dem Schutz der gesellschaftlichen Akzeptanz zu töten. Gleichzeitig vollzieht die „verfasste deutsche Ärzteschaft“ unter dem Schutz des Gesetzgebers jährlich über 200 000 Abtreibungen an Embryonen in weitaus fortgeschritteneren Entwicklungsstadien. Wer segelt hier unter falscher Flagge? Der Diskurs macht doch unmissverständlich deutlich, dass die Definition der „Würde des Embryos“ dringend neu bedacht werden will. Eine abstufende Einschätzung des „moral status of the embryo“, wie von der Europäischen Kommission definiert, stellt wohl die einzig intelligente und praktikable Lösung dar. Ein Umdenken in diese Richtung scheint dringend geboten und folgt nicht der „englischen Verführung“, sondern dem Stand der medizinischen Wissenschaft. Auf der Insel wurde seit langem und sehr sorgfältig diskutiert, ob auf diese Weise (hoffentlich) verfügbare Behandlungsverfahren für englische Patienten in Großbritannien entwickelt werden sollen oder ob man sie importiert beziehungsweise Kranke im Ausland behandeln lässt. Prof. Dr. med. Axel Haverich, Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie, MHH, Carl-Neuberg-Straße 1, 30625 Hannover Anmerkung (zugleich zu den Briefen von Sewing und Rittner in Heft 7): Mein Kommentar „Englische Verführung“ kritisierte, dass Sewing als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer Auffassungen vertrat, die der Beschlusslage der verfassten Ärzteschaft nicht entsprechen. Als Vorsitzender eines offiziellen Gremiums der Bundesärztekammer hätte sich Sewing an die Beschlusslage halten oder deutlich machen müssen, dass er sich als Privatmann äußerte. Die verfasste Ärzteschaft ist ein eingeführter Begriff. Gemeint ist in diesem Fall die in Ärztekammern und in der Arbeitsgemeinschaft der Ärztekammern, nämlich der Bundesärztekammer, organisierte Ärzteschaft; sie hat im Deutschen Ärztetag, der Hauptversammlung der Bundesärztekammer, eine aus demokratischen Wahlen hervorgegangene oberste Repräsentanz. Der Deutsche Ärztetag hat sich bisher gegen therapeutisches Klonen und Embryonenforschung ausgesprochen. Norbert Jachertz Heft 4, 26. Januar 2001 Bioethik CDU lotet noch Grenzen aus Mahnende Stimmen bei einem Kongress in Berlin A ngela Merkel hat eine breite öffentliche Debatte über die ethische Verantwortung der Wissenschaft und die Grenzen der Gentechnik gefordert. Die CDU-Vorsitzende äußerte sich beim Bioethik-Kongress ihrer Partei im Dezember in Berlin. Er stand unter dem Motto: „Auch in Zukunft menschenwür- dig leben – Ethik und Gentechnologie im 21. Jahrhundert“. Merkel zeigte sich sowohl gegenüber der Präimplantationsdiagnostik wie gegenüber Gentests skeptisch. Im Fall derartiger Tests müsse der Gesetzgeber verhindern, dass Arbeitgeber und Versicherer Zugang zu Daten von Kunden oder ihren Mitarbeitern erhielten. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU, Jürgen Rüttgers, bezeichnete es als skandalös, dass derzeit wieder offen gegen die Geburt behinderter Kinder votiert werde. Grundüberzeugungen von der Würde des Menschen und seiner unbedingten Schutzwürdigkeit dürften nicht zugunsten „postmoderner Beliebigkeit“ Rie aufgegeben werden. 63 D O K U M E N T A T I O N Heft 4, 26. Januar 2001 Meinungsaustausch mit dem Bundeskanzler Kurskorrekturen bei den Budgets im Gespräch Ein Treffen zwischen Gerhard Schröder, Jörg-Dietrich Hoppe und Manfred Richter-Reichhelm war seit längerem eingeplant, der Wechsel im Bundesgesundheitsministerium angeblich nicht. Nun wird mit Ulla Schmidt um die Umsetzung ärztlicher Forderungen gerungen. F reundlich, inhaltsreich, unvoreingenommen – so beschrieben Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe und Dr. Manfred Richter-Reichhelm übereinstimmend die Atmosphäre beim Meinungsaustausch mit dem Bundeskanzler am 18. Januar. Gerhard Schröder hatte den Präsidenten der Bundesärztekammer (BÄK) und den Ersten Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) schon vor einigen Wochen eingeladen. Nun nahmen auch die neue Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt teil sowie die Parlamentarische Staatssekretärin im BMG, Gudrun SchaichWalch, und der Beauftragte für die Belange der Behinderten, Karl-Hermann Haack, alle SPD. Dennoch: „Eine angenehme Atmosphäre reicht nicht. Es müssen Ergebnisse her“, sagte Richter-Reichhelm gegenüber dem Deutschen Ärzteblatt. Das habe man auch deutlich gemacht. Der Kanzler wisse, dass die Ärzteschaft die Konfrontation nicht suche, aber zu Aktionen bereit sei. Hoppe ist der Auffassung, dass ein wichtiger Antrieb für Gespräche wie das gerade geführte der Wunsch Schröders sei, durch die Lösung der gröbsten Probleme die Gesundheitspolitik aus Wahlkämpfen herauszuhalten. Für handfeste Ergebnisse reicht ein einstündiges Gespräch nicht aus, ebenso wenig eine Kanzlerzusage. Um die Probleme zu beseitigen, die die Ärzteschaft belasten, sind Mehrheiten in den Parlamenten von Bund und Ländern erforderlich. Einige Themen wurden jedoch am 18. Januar zumindest problematisiert und mögliche Alternativen besprochen. 64 So soll geprüft werden, ob die Honorar- und Arzneimittelbudgets durch andere sinnvolle Alternativen ersetzt werden. Richter-Reichhelm sagte, man habe budgetablösende individuelle Richtgrößen für die Arzneimittelversorgung in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) als Ziel genannt. Was die Honorarbudgets anbelangt, so wurde im Kern über Regelleistungsvolumina gesprochen. Noch für diese Woche sind dazu weitere Gespräche zwischen Vertretern der Ärzteschaft und dem BMG angesetzt. Schröder hat zugesagt, sich dafür einzusetzen, dass noch in dieser Legislaturperiode das Wohnortprinzip eingeführt wird. Damit wäre die Zahlung der ärztlichen Vergütung nach dem Kassensitz abgeschafft. Erörtert wurde weiterhin, welche Konsequenzen sich für die Ärzte aus dem Krankenkassenwechsel von immer mehr Versicherten und aus Steuerungsinstrumenten wie dem Risikostrukturausgleich ergeben. Ebenso war die besondere Situation von Ärztinnen und Ärzten in den fünf neuen Bundesländern Thema. Breiten Raum nahm nach den Worten Hoppes das Gespräch über medizinethische Fragen ein. Schröder ließ in der offiziellen Erklärung des Bundeskanzleramtes unter anderem verbreiten, man stimme mit der Ärzteschaft überein, dass nur die ethisch vertretbaren Potenziale der Gentechnik für die Behandlung von Krankheiten genutzt werden sollen. Politische Beobachter glauben dennoch, dass Schröder und Schmidt auf diesem Feld gewisse Lockerungen anstreben (siehe auch „Seite eins“ in diesem Heft). Dem Präsidenten der Bundesärztekammer zufolge hat Schröder erklärt, er wolle in Sachen Embryonenforschung keine Regelung wie in Großbritannien. Gesetzesinitiativen, die die derzeitige Rechtslage verändern, sind wohl nicht geplant, damit auch keine Verschärfungen. Schröder will sich jedoch offenbar mittelfristig die Option offen halten, Forschung an embryonalen Stammzellen in einem gewissen Rahmen zu erlauben, ebenso den eng begrenzten Einsatz der Präimplantationsdiagnostik. Diese Möglichkeit favorisiert der Wissenschaftliche Beirat der BÄK; eine Beschlussfassung des Verbandes der Bundesärztekammer steht bisher aus. Im Gespräch ist derzeit im Übrigen ein neuer Ethikrat, der direkt beim Kanzler angesiedelt würde. Bei diesen und anderen Fragen wird in Zukunft neben Schmidt und SchaichWalch der zweite Staatssekretär Dr. Klaus Theo Schröder ein Wort mitzureden haben (dazu auch „Seite eins“). Richter-Reichhelm, zugleich KVVorsitzender in Berlin, kennt ihn als ruhigen, sachlichen Gesprächspartner. Auch zu Gudrun Schaich-Walch habe man einen guten Draht. „Sie ist seit langem in diesem Themenfeld sachkundig“, bekräftigt Hoppe. Er sieht eine Chance darin, dass das Bundesgesundheitsministerium nun in der Hand des großen Koalitionspartners ist. Ulla Schmidt auf Schröders Linie Einfach wird es aber auch in Zukunft nicht. Denn innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion sind die Meinungen, welche gesundheitspolitischen Reformen D O K U M E N T A T I O N die richtigen sind, geteilt. Schröder steht für einen eher wirtschaftsfreundlichen, „modernen“ Kurs; er wird sich kaum eine Ministerin ausgesucht haben, die eine völlig andere Linie vertritt. SchaichWalchs Position ist schwer zu bestimmen. Sie hat sich in letzter Zeit zum Beispiel für eine Überprüfung des Leistungskatalogs der GKV ausgesprochen wie auch für Alternativen zur jetzigen Budgetpolitik. Ihr jüngster Vorschlag zielte darauf ab, den Ärzten mehr Zeit einzuräumen, ein überzogenes Arzneimittel-Jahresbudget auszugleichen. Vieles traf in ihrer Fraktion keinesfalls auf Zustimmung. Dort stehen Klaus Kirschner, der Vorsitzende des Bewertungsausschusses für Gesundheit, und Regina Schmidt-Zabel, die neue gesundheitspolitische Sprecherin, eher für eine traditionelle Haltung. Und was ist von Ulla Schmidt zu erwarten? Da sie keine gesundheitspolitische Erfahrung besitzt, weiß man über ihre Absichten noch nicht viel. Schröder hat jedoch im Gespräch mit Hoppe und RichterReichhelm bekräftigt, dass in der nächsten Legislaturperiode eine Reform der GKV nach dem Muster der Rentenversicherung ansteht. Für diese Thematik wäre die neue Ministerin, die als ausgewiesene Rentenexpertin gilt, dann gut Sabine Rieser gerüstet. Heft 4, 26. Januar 2001 Gentechnik Der Zweck heiligt die Mittel Das Ziel, Gewebe aus embryonalen Stammzellen zu züchten und Therapien zu entwickeln, lässt ethische Bedenken in den Hintergrund treten. D ie Karten in der Gesundheitspolitik werden neu gemischt. Das betrifft auch die Gentechnik. Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Gudrun Schaich-Walch (SPD), kündigte bereits an, dass es keine übereilten gesetzlichen Neuregelungen geben werde, damit wohl auch kein neues Fortpflanzungsmedizingesetz in dieser Legislaturperiode. Bisher hatte Ex-Gesundheitsministerin Andrea Fischer als „Bremse“ in Sachen Gentechnik gegolten. Ihr Eckpunktepapier sah vor, Präimplantationsdiagnostik und das Klonen von menschlichen Embryonen zu verbieten. Wenn es nun bei dem aus dem Jahr 1990 stammenden Embryonenschutzgesetz bleibt, wird auch der Import und damit die Forschung an embryonalen Stammzellen in Deutschland erlaubt bleiben. Diskussion im EU-Parlament „Das erste geklonte Baby wird früher zur Welt kommen, als dem ersten Parkinson-Patienten durch embryonale Stammzellen wirksam geholfen wird“, meint Dr. med. Peter Liese (CDU), Mitglied des Europäischen Parlaments, angesichts dieser Entwicklung. „Wir müssen die Chancen der Gentechnik nutzen, aber die Menschenwürde muss das oberste Prinzip sein.“ Am 16. Januar hat im Europäischen Parlament der Ausschuss „Humangenetik und die anderen neuen Technologien in der modernen Medizin“ seine Arbeit aufgenommen. 36 Mitglieder aus allen politischen Fraktionen werden sich ein Jahr lang mit den Möglichkeiten und Gefahren der DNA-Analyse, der Präimplantationsdiagnostik sowie mit den Fragen des Klonens von menschlichen Embryonen und der Patentierung von biotechnologischen Erfindungen beschäftigen. Das Europäische Parlament lehnt das Klonen von Menschen grundsätzlich ab. Liese befürchtet dennoch bald einen Dammbruch in Europa. Der Grund: Die britische Regierung will das Herstellen von menschlichen Embryonen durch die gleiche Methode erlauben, die zum geklonten Schaf Dolly führte. Am 20. Dezember 2000 hat sie dafür die Unterstützung des Unterhauses (jedoch nicht des Oberhauses) bekommen. Die Methode sei notwendig, um Patienten mit Erkrankungen wie Parkinson oder Diabetes zu helfen, argumentieren die Befürworter des therapeutischen Klonens. Indes hofft Liese auf den entschiede- nen Widerstand von Staats- und Regierungschefs gegen die britische Initiative. Geklontes Baby ist nicht weit Wenn einmal das Ziel, dem Menschen zu helfen, über den ethischen Bedenken stünde, sei das Klonen nicht mehr aufzuhalten, meinen Kritiker. Ein Beispiel dafür ist Baby Adam in den USA.Adam wurde durch Präimplantationsdiagnostik und In-vitro-Fertilisation so selektiert, dass er seiner an Leukämie erkrankten Schwester als Zellspender dienen konnte. Für die Hoffnung auf Hilfe dürfe nicht der Embryonenschutz geopfert werden: „Es ist viel einfacher, geklonte menschliche Embryonen in den Uterus einzupflanzen, als aus menschlichen embryonalen Stammzellen wirksame Therapien zu entwickeln“, gibt Liese zu bedenken. Trotzdem gebe es Alternativen. Für aussichtsreich hält Liese die Forschung an adulten Stammzellen. Diese könnten beispielsweise aus der Nabelschnur gewonnen werden, wogegen sonst der Embryo zerstört würde. Große deutsche Pharma-Unternehmen investieren bereits in die adulte StammDr. med. Eva A. Richter zellforschung. 65 D O K U M E N T A T I O N Heft 4, 26. Januar 2001 Z unächst sah es so aus, als bahne sich in der Regierungskoalition bei der Einstellung zu medizinethischen Fragen ein Kurswechsel an. Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte Ende letzten Jahres vor „ideologischen Scheuklappen“ bei Fragen der Gentechnik gewarnt. Julian Nida-Rümelin hatte noch vor seinem Amtsantritt als neuer Kulturstaatsminister Embryonen eine Menschenwürde abgesprochen. Die neue Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Gudrun Schaich-Walch (SPD), grenzte sich von der Linie der bisherigen Gesundheitsministerin Andrea Fischer ab. Schaich-Walch hält es nämlich nicht für erforderlich, noch in dieser Legislaturperiode ein Fortpflanzungsmedizingesetz zu verabschieden. Darin wollte Fischer die Präimplantationsdia- Medizinethik Irritationen gnostik unmissverständlich verbieten. Das therapeutische Klonen ist zwar nicht erlaubt, eine Lücke im Gesetz ermöglicht jedoch das Forschen mit embryonalen Stammzellen aus dem Ausland. Die Äußerungen der Politiker stießen allerdings sogar in den eigenen Reihen auf Protest. So bezeichnete der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Wilhelm Schmidt, die Ankündigungen Schaich-Walchs als „verfrüht“. Auch die Bündnisgrünen sind irritiert: Darüber müsse in der Koalition zunächst geredet werden, teilten sie mit. Der Präsident der Bundesärztekammer, Prof. Dr. med. Jörg-Dietrich Hoppe, registrierte, dass der Bundeskanzler die wirtschaftlichen und therapeutischen Aspekte offensichtlich gegenüber dem Lebensschutz stärker gewichte als Andrea Fischer. Möglicherweise überrascht von diesen Reaktionen, bekräftigte Schröder inzwischen, dass „Deutschland auf die Forschung mit adulten Stammzellen setzt“. Bundesjustizministerin Herta DäublerGmelin (SPD) betonte ebenfalls, dass es keinen Kurswechsel geben werde. Sie warnte davor, dass Gentests bei Embryonen zu einer „Selektion von Menschen“ führen könnten. Es bleibt allerdings zu bezweifeln, ob die Bundesregierung nicht letztlich doch die Gentechnik vorwiegend unter ökonomischen GesichtspunkGisela Klinkhammer ten bewerten wird. Heft 7, 16. Februar 2001 O bwohl eine Novellierung des Embryonenschutzgesetzes vorerst in die Ferne gerückt ist, bleibt die Fortpflanzungsmedizin ein brisantes Thema. Besonderer Streitpunkt: die Präimplantationsdiagnostik (PID). Das Positionspapier von Ex-Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer, das unter anderem das Verbot der PID vorgesehen hatte, ist inzwischen in einer Schublade des BMG verschwunden. Konkrete Vorstellungen, in welchen Punkten das Embryonenschutzgesetz geändert werden sollte, liegen jedoch auch von anderen Seiten vor. Bei einer Podiumsdiskussion der Berliner Wissenschaftlichen Gesellschaft, der Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie und der KaiserinFriedrich-Stiftung tauschten sich Ende Januar in Berlin Ärzte, Ethiker, Naturwissenschaftler, Juristen und Politiker über aktuelle Entwicklungen und Kontroversen innerhalb der Fortpflanzungsmedizin aus. Prof. Dr. med. Heribert Kentenich, Chefarzt der Frauenklinik der DRK-Kliniken Westend, Berlin, stellte sein Konzept zur Änderung des Embryonenschutzgesetzes vor, das großen Zuspruch fand. Kentenich plädierte für eine „limitierte, jedoch positive Regelung der PID in Deutschland“. Die Information und Beratung der Paare müsse verbes- 66 Fortpflanzungsmedizin Die Gewichteverschieben sich Ob die Präimplantationsdiagnostik in Deutschland zugelassen werden soll, ist weiterhin umstritten. Die Zahl der Befürworter nimmt jedoch zu. sert werden, um es ihnen zu ermöglichen, sowohl den Weg der PID als auch den „normalen“ Weg zu einer Schwangerschaft zu gehen, sagte der Gynäkologe. Im Fortpflanzungsmedizingesetz müsse es hierfür eine klare gesetzliche Regelung geben. Die Grenzen, die das Embryonenschutzgesetz derzeit setzt, hält Kentenich für „unzeitgemäß und an die Konfliktsituation nicht konkret genug adaptiert“. Die spezifische Geschichte Deutschlands dürfe nicht dazu führen, dass die Reproduktionsmedizin generell in Deutschland einer sehr restriktiven Regelung unterworfen werde. Paare würden im Zweifelsfalle die PID im Ausland vornehmen lassen oder eine „Schwangerschaft auf Probe“ eingehen. „Die PID kann nicht unabhängig von der Pränataldiagnostik diskutiert werden“, betonte der Präsident der Bun- desärztekammer (BÄK), Prof. Dr. med. Jörg-Dietrich Hoppe. Die momentane „Unlogik im Schutz des Lebens“ hätte er auch beim Kanzlergespräch Anfang Januar dargestellt und auf den dringenden Regelungsbedarf hingewiesen. Die Meinung innerhalb der BÄK zur PID sei heterogen, aber würde prinzipiell dem im Frühjahr 2000 vorgelegten Diskussionsentwurf entsprechen, so Hoppe. „Vor dem Hintergrund der „Schwangerschaft auf Probe“ müsste die PID erlaubt sein“, meinte Dr. med. Christiane Woopen, Institut für Geschichte und Ethik in der Medizin der Universität Köln, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der BÄK. In dessen Arbeitsgruppe „Präimplantationsdiagnostik“ sei über mögliche Änderungen des Entwurfs gesprochen worden, berichtete sie. So müsse der Screeningeffekt bei der PID noch deutlicher ausgeschlossen D O K U M E N T A T I O N Heft 8, 23. Februar 2001 und die psychosoziale Beratung verstärkt werden. Dass der Forderung nach einer humangenetischen Beratung vor einer PID im Diskussionsentwurf der BÄK nicht genügend Rechnung getragen werde, monierte Prof. Dr. rer. nat. Karl Sperling, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik. Im Übrigen vertrete seine Fachgesellschaft die Ansicht, dass die PID grundsätzlich allen Frauen zur Verfügung stehen sollte, die ein erhöhtes genetisches Risiko für eine schwerwiegende kindliche Erkrankung tragen. Die PID sei eine Möglichkeit der vorgeburtlichen Diagnostik, die Schwangerschaftsabbrüche und die damit verbundene Belastung der Betroffenen vermeiden könne. „Eine PID darf jedoch nur unter Einhaltung strikter Richtlinien erfolgen“, betonte Sperling. Prof. Dr. jur. Friedhelm Hufen, Lehrstuhl für öffentliches Recht der Universität Mainz, plädierte nicht nur für die Zulassung der PID. Er ging sogar noch weiter: „Da die Pränataldiagnostik zur Nachgefragt DÄ: Die Bundesregierung will eine Überarbeitung des Embryonenschutzgesetzes vorerst auf Eis legen. Halten Sie eine Novellierung zurzeit für nötig? Ulrike Flach: Das wäre nur die zweitbeste Lösung. Besser wäre ein neues Fortpflanzungsmedizingesetz, das diesen Bereich umfassend regelt. Die Forschung und die medizinischen Anwendungsmöglichkeiten rasen voran, das Recht humpelt hinterher. Eine Verschiebungsstrategie ist grundfalsch. Die FDP meint, dass wir noch in dieser Legislaturperiode entweder ein Fortpflanzungsmedizingesetz oder eine Novellierung des Embryonenschutzgesetzes brauchen. DÄ: In welchen Punkten würden Sie das Embryonenschutzgesetz ändern? Ulrike Flach: Wir wollen eine offene, fraktionsübergreifende Diskussion zur Schaffung von rechtlichen Rahmenbedingungen für die Präimplantationsdiagnostik (PID). Dieses Verfahren ist ja nach Meinung Verfügung steht, ist ein absolutes Verbot der PID unangemessen.“ Aus verfassungsrechtlicher Sicht bedürfe nicht die Zulassung, sondern das Verbot der PID einer Rechtfertigung. Auch andere Änderungen des Embryonenschutzgesetzes, für die sich Kentenich in der Berliner Veranstaltung einsetzte, wären nach Ansicht Hufens verfassungsrechtlich in vollem Umfang möglich. Kentenich forderte unter anderem die Zulassung der Eizellspende. Es sei ein „Skandal“, dass die Eizellgewinnung in Deutschland schwieriger sei als die Samenzellgewinnung und sich ein Arzt potenziell strafbar mache, wenn er die Adresse eines Behandlungszentrums im Ausland weitergebe. Für die Samenzellspende forderte Kentenich klare gesetzliche Regelungen. Ferner sprach er sich dafür aus, die Forschung an Embryonen und ihre Selektion unter strengen Limits zu erlauben. Gegner der PID waren bei der Podiumsdiskussion in Berlin nicht anweDr. med. Eva A. Richter send. anerkannter Rechtsexperten prinzipiell im Embryonenschutzgesetz schon vorgesehen. Die PID könnte bei Invitro-Fertilisation generell anwendbar sein, müsste aber in der Entscheidungsgewalt der Eltern bleiben. Gleichzeitig müssten natürlich Missbrauchschranken eingebaut werden. Die PID muss auf die Verhinderung genetischer Erkrankungen dort beschränkt werden, wo die Eltern das Risiko sehen und begründen können. DÄ: Gibt es für Sie Tabus? Ulrike Flach: Natürlich! Tabu ist beispielsweise die Züchtung von Menschen. Tabu sind auch alle Manipulationen, die darauf zielen, Kinder nach Wunsch mit blauen oder grünen Augen, blonden oder schwarzen Haaren zu schaffen. Außerdem müssen wir uns immer fragen: Rechtfertigt das Ziel den Eingriff? Die Erfüllung des Kinderwunsches für Eltern mit hohen genetischen Risiken rechtfertigt ihn, nicht aber die Züchtung von Zwitterwesen aus Mensch und Tier. Wir werden aber noch oft vor einem Abwägungskonflikt stehen. DÄ: Unter welchen Bedingungen würden Sie die PID erlauben? Ulrike Flach: Die Bundesärztekammer hat einen Entwurf vorgelegt, den ich als Grundlage für geeignet halte. Darin sind klare Zulassungsbedingungen und berufsrechtliche Voraussetzungen enthalten. DÄ: Ist die PID nicht der erste Schritt zum „Designer-Baby“? Ulrike Flach: PID ist eine Methode für einen sehr eingeschränkten Kreis von Eltern. Wenn keine medizinischen Gründe vorliegen, sondern einfach das „Wunschkind“ geschaffen werden soll, würde ich keine Zustimmung zur Anwendung geben. Freilich: Die technischen Möglichkeiten für das „Designer-Baby“ gibt es. Die Gesellschaft muss sich darüber einigen, welche Werteorientierung gelten soll. PID ist ja nur ein Werkzeug; es kommt darauf an, zu welchem Zweck es verwendet wird. Die Fragen stellte Dr. med. Eva A. Richter Medizinische Ethik Auf Schlingerkurs Wohin die Bundesregierung bei der Gentechnik steuert, bleibt unklar. E in möglicher Kurswechsel der Bundesregierung in der Gentechnik zeichnet sich bereits seit längerem ab. In einer Antwort auf eine kleine Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die letzte Woche vorgelegt wurde, bezieht die Regierung Stellung unter anderem zu den Themen Fortpflanzungsmedizingesetz und geplante Einrichtung eines nationalen Ethikrates. Klare Aussagen lässt die Koalition jedoch vermissen. Die damalige Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer wollte noch in dieser Legislaturperiode ein Fortpflanzungsmedizingesetz verabschieden, in dem unter anderem die Präimplantationsdiagnostik eindeutig verboten werden sollte. Um möglichst schnell zu klaren Positionen zu kommen, hatte das Bundesgesundheitsministerium im letzten Jahr ein hochkarätiges Symposium veranstaltet. Doch Fischers Bestrebungen finden zurzeit offenbar keine Fortsetzung. Ausweichend fällt jedenfalls die Stellungnahme zu einem künftigen Fortpflanzungsmedizingesetz aus. Die Bundesregierung: Auf dem Symposium sei der „derzeitige Meinungsstand der medizinischen Wissenschaft und Praxis, der Forschung, Ethik, Rechtswissenschaft und Sozialwissenschaft von den unterschiedlichen Standpunkten aus dargestellt und kontrovers diskutiert“ worden. Vor der Entscheidung über gesetzliche Regelungen sollte nach Auffassung der Bundesregierung die Debatte im Bundestag intensiv fortgesetzt werden. Und bei dem von Andrea Fischer vorgelegten Eckpunktepapier, in dem sie ihre Vorstellungen dargelegt hatte, habe es sich nicht „um ein innerhalb der Bundesregierung abgestimmtes Konzept für ein mögliches Fortpflanzungsmedizingesetz gehandelt, sondern um ein Positionspapier, das die 67 D O K U M E N T A T I O N Meinung der damaligen Bundesministerin für Gesundheit wiedergab“. Andrea Fischers strikte Auffassung werde jetzt nicht mehr geteilt, sagte der Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), Prof. Dr. med. Jörg-Dietrich Hoppe, der Katholischen NachrichtenAgentur. Hoppe glaubt indessen nicht an einen generellen Kurswechsel der Bundesregierung in der Biomedizin. So haben sich beispielsweise Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin und Bundesforschungsministerin Edelgard Bulmahn deutlich gegen das Klonen von Embryonen zu Forschungszwecken ausgesprochen. Bundeskanzler Gerhard Schröder und Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt seien jedoch möglicherweise bereit, die Präimplantationsdiagnostik in sehr eng gefassten Grenzen zu gestatten, so der BÄK-Präsident. Ob bereits wenige Tage alten Embryonen eine Menschenwürde zugesprochen werden kann, lässt die Bundesregierung ebenfalls offen. Sie distanziert sich jedenfalls nicht ausdrücklich von Äußerungen des Kulturstaatsministers Julian NidaRümelin (SPD), der die Auffassung vertritt, dass sich „das Kriterium Menschenwürde nicht auf Embryonen ausweiten“ lässt. „Ethische Argumente sind keine rechtlichen Argumente“, heißt es dazu in der Stellungnahme der Bundesregierung. In der internationalen Philosophie würden Begriffe wie zum Beispiel der der Menschenwürde gelegentlich anders verwendet als im verbindlichen deutschen Verfassungsrecht. Die Bundesregierung sehe sich in ihrem Handeln auch künftig verfassungsrechtlich verpflichtet, die Würde des Menschen, wie sie in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ihren Ausdruck gefunden hat, zu achten und zu schützen. Auch zur Zulässigkeit von Gentests und ihrer Verwertung wurde die Bundesregierung befragt. Sie sieht „für die Verwertung von aus genetischen Tests gewonnenen Erkenntnissen beim Zugang zu Sozialversicherungen keinen Raum“. Die Bundesregierung bewertet es positiv, dass „in der privaten Kranken-, Unfall- und Lebensversicherung Gentests gegenwärtig nicht als Voraussetzung für den Abschluss von Versicherungsverträgen verlangt werden“. Darauf hätte sich die deutsche Versicherungswirtschaft verständigt. 68 Diese Äußerung stieß auf Kritik bei den Bundestagsabgeordneten Hubert Hüppe und Annette Widmann-Mauz (beide CDU). Sie erklären, dass die Bundesregierung offenbar ungerührt scheine von den Sorgen der Bürger, die mit Recht eine verlässlichere Grundlage erwarteten als Absprachen unter Wirtschaftsunternehmen. Nicht nur bei Oppositionspolitikern, sondern auch in den eigenen Reihen stieß die Ankündigung Schröders, einen nationalen Ethikrat einzurichten, auf Kritik. Dieser solle, so die Bundesregierung, „die verschiedenen gesellschaftlichen Positio- nen widerspiegeln“. Während Ulla Schmidt die Einrichtung eines Ethikrates begrüßt, hält Monika Knoche (Bündnis 90/Die Grünen) ihn nicht für erforderlich. Ethikräte hätten keine Definitionshoheit darüber, was das ethisch Verantwortbare sei. Außerdem gebe es bereits einen bei dem Bundesgesundheitministerium zugeordneten Ethikbeirat sowie die vom Bundestag eingesetzte Enquete-Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“. Doch offensichtlich, so Hüppe und Widmann-Mauz, „passt deren Arbeit Gisela Klinkhammer Schröder nicht“. Heft 10, 9. März 2001 Biomedizin Kein „Hirtenwort“, sondern Diskussionsanstoß Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hat ein Thesenpapier zur Bioethik vorgelegt. D as Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) will die Überarbeitung des Embryonenschutzgesetzes oder die Erarbeitung eines neuen Fortpflanzungsmedizingesetzes begleiten – und zwar ohne ideologische Scheuklappen. Dabei hält die katholische Laienorganisation prinzipiell an ihren Positionen fest, wünscht sich jedoch eine breite gesellschaftliche Debatte. Unter dem hohen Tempo des biomedizinischen Erkenntnisgewinns sowie dem Druck auf die Politiker, die strengen deutschen Standards im Embryonenschutz zu „nivellieren“, gerate der ethische Diskurs zunehmend in die Defensive, warnt das ZdK. „Nicht nur die Kritiker, sondern auch die Befürworter des biomedizinischen Fortschritts müssen die Gründe für ihr Handeln offen legen“, heißt es im Thesenpapier „Der biomedizinische Fortschritt als Herausforderung für das christliche Menschenbild“, das das ZdK am 1. März in Berlin vorstellte. Darin werden die katholischen Orientierungen benannt und begründet (www.zdk.de). Die neun „Orientierungen im Zeitalter der Biomedizin“ des ZdK: G Die Würde des Menschen ist unantastbar; vom Moment der Zeugung bis zum Tod. G Das menschliche Leben ist der Verfügbarkeit des Menschen entzogen; niemand darf darüber urteilen, wer lebenswert oder lebensunwert ist. G Das menschliche Leben ist unteilbar; vorgeburtliche Phase und der erste Lebensabschnitt unterscheiden sich nur graduell. G Der Mensch ist mehr als die Summe seiner Gene und Neuronen. G Der christliche Glaube stellt Menschen mit Behinderungen, Krankheiten und Benachteiligungen in den Mittelpunkt; Gendiagnostik darf nur nach Einwilligung erfolgen. G Der Mensch bedarf der Erlösung; nahezu religiöse Verheißungen der Medizin und der Technik sind realitätsferne Illusionen. G Biomedizinische Fortschritte müssen dem Wohl der Patienten dienen. G Jeder Mensch ist für sein Handeln verantwortlich; Forscher, Anwender und Nutzer müssen sich ein eigenes Urteil bilden. G Der Staat ist auf die Menschenwürde verpflichtet; sie darf nicht der Forschungsfreiheit und Marktinteressen geopfert werden. D O K U M E N T A T I O N Das ZdK wolle nicht belehren, sondern einen Denk- und Diskussionsanstoß zum „Jahr der Lebenswissenschaften“ 2001 liefern, betonte Dr. Thomas Sternberg, Sprecher des kulturpolitischen Arbeitskreises des ZdK. Dass es den Katholiken mit der Diskussion Ernst ist, zeigte die öffentliche Vorstellung des Thesenpapiers. Diese war nicht als Frontal-, sondern als Diskussionsveranstaltung konzipiert, zu der Politiker verschiedener Fraktionen, Befürworter, aber auch Gegner der katholischen Position eingeladen waren. Von ihnen mussten die Verfasser des Papiers einige Kritik einstecken. Bereits die mit der Biomedizin verbundenen Visionen seien zu negativ dargestellt, befand Dr. Martin Hrabe de Angelis, München, einer der vier Koordinatoren des deutschen Human-Genom-Projektes. Die Chancen, die die Gentechnik den Menschen bietet, dürften nicht verschwiegen werden. Die katholische Laienorganisation benennt die „Reproduktionsvision“ (Garantie für die genetische Gesundheit der Neugeborenen), die „Steuerungsvision“ (frühzeitiges Erkennen von Krankheiten) und die „Heilungsvision“. Gleichzeitig warnte sie davor, dass hinter diesen Visionen häufig ökonomische Interessen stehen könnten. Ferner bestehe die Gefahr, dass sich unter dem Deckmantel der Gesundheit andere Gesichtspunkte einschleichen, wie eine „effizientere Ressourcenverwertung“ oder der Wunsch nach „Verbesserung der Evolution“. Dass die Heilung von Menschen die biomedizinische Forschung rechtfertigt, erschien auch der anwesenden ehemaligen Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer (Grüne) zu „trivial“: „Heilung ist kein Wert, der anderes irrelevant werden lässt“, sagte die Verfechterin eines restriktiven Embryonenschutzes. Leiden in Kauf zu nehmen, hält Angelis dagegen für problematisch: „Wenn es die Möglichkeit gibt zu heilen, müssen wir dies tun.“ Er warnte davor, dass jetzt das „ethische Ross zu hoch gesattelt wird“. Wo die Menschenwürde beginnt, die es zu schützen gelte, blieb schließlich offen. Die Katholiken gehen davon aus, dass das menschliche Leben „im biologischen Sinn“ und damit die Menschenwürde mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle beginnt. Jede Grenzziehung sei will- kürlich. Fischer sieht dies ähnlich; man dürfe jedoch keine Norm daraus ableiten; graduelle Abstufungen seien möglich. So ist es straffrei, die Nidation des Embryos in den Uterus während der ersten 14 Tage zu verhindern. Der Berliner Philosoph Prof. Dr. Volker Gerhardt, Vorsitzender der Bioethik-Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft, plädierte dafür, die Grenze für das „Menschsein“ bei der Geburt zu ziehen. Die vorgeburtliche Zeit dürfe jedoch nicht ignoriert werden, schränkte er ein. Für zweckmäßig hält er graduelle Schutzbestimmungen. Diese sähe das Embryonenschutzgesetz bereits vor, betonte Wolf-Michael Catenhusen (SPD), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesforschungsministerium. Zur Position der SPD äußerte er sich nicht. Man dürfe jedoch nicht jede Art von Forschung an Embryonen erlauben. Um einen gesamtgesellschaftlichen Konsens zu finden, könne man allerdings nicht auf Fundamentalisten Dr. med. Eva A. Richter eingehen. Heft 11, 16. März 2001 Bischofskonferenz Warnung vor Missbrauch der Gentechnik Die katholischen Bischöfe lehnen Präimplantationsdiagnostik und therapeutisches Klonen ab. D er Mensch: sein eigener Schöpfer?“ ist der Titel einer Schrift, die von der Deutschen Bischofskonferenz letzte Woche in Augsburg vorgestellt wurde. Die Antwort lautet erwartungsgemäß „nein“, und dies wird auch gleich zu Beginn des Papiers begründet: „Menschliches Leben ist heilig und steht weder an seinem Anfang noch an seinem Ende zur Disposition. Das Leben ist der Verfügbarkeit des Menschen entzogen; da alle Menschen unter Gottes Schutz stehen, darf sich keiner am Leben des anderen vergreifen.“ Heft 9, 2. März 2001 Ärztinnenbund Dammbruch befürchtet Ärztinnen sprechen sich gegen Präimplantationsdiagnostik aus. D er Deutsche Ärztinnenbund lehnt die Präimplantationsdiagnostik (PID) ab. Dabei beruft er sich auf eine Stellungnahme seines Ausschusses für Ethikfragen. Darin heißt es, dass man mit Einführung der Methode befürchten müsse, dass ihre Anwendung auch auf weniger schwerwiegende Krankheiten und andere genetische Merkmale ausgeweitet werde. Das Hauptargument der Befürworter der PID sei, dass dadurch ein Schwangerschaftsabbruch und das damit verbundene Trauma für die Mutter vermieden werden könne. Die Mutter müsse jedoch bis zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Ergebnisse der pränatalen Diagnostik damit rechnen, dass das ungeborene Kind eine erkennbar schwere Erkrankung aufweise. Daher könne es auch nach PID zu einem Abbruch kommen. Die Stellungnahme kann abgerufen werden unter: www.aerztinnenbund.de 69 D O K U M E N T A T I O N Heft 11, 16. März 2001 Folgerichtig wird von den Bischöfen die Präimplantationsdiagnostik als „Tötung menschlichen Lebens“ kategorisch abgelehnt. Sie sei ein „eindeutiges Instrument zur Selektion“, da genetisch belastete Embryonen aussortiert und vernichtet würden. Sie müsse daher in Deutschland auch weiterhin verboten bleiben, fordert die Bischofskonferenz. Beim therapeutischen Klonen werde menschliches Leben, das immer zugleich personales und von Gott bejahtes Leben ist, zum Ersatzteillager degradiert.Auch medizinischer Nutzen könne kein Verfahren mit menschlichen Embryonen rechtfertigen, das die unantastbare Würde dieses Lebens infrage stelle. Das reproduktive Klonen wird ebenfalls abgelehnt, unter anderem weil der Embryo instrumentalisiert würde. Die Gentherapie wird allerdings nicht grundsätzlich von den Bischöfen verurteilt. Schon jetzt würden in Deutschland Gentests für mehr als hundert Krankheiten angeboten. Mit ihrer Hilfe könne man nicht nur bestehende Krankheiten feststellen, sondern auch Veranlagungen für Krankheiten, die sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erst in Zukunft auswirken würden. Das Recht auf Nichtwissen gehöre allerdings zu den verfassungsmäßig verbrieften Persönlichkeitsrechten. Prädiktive Gentests dürfen nach Auffassung der Bischöfe weder von Arbeitgebern noch von Versicherungen verlangt, angenommen oder verwertet werden. Bei der pränatalen Diagnostik heben die Bischöfe die Möglichkeit einer vorzeitigen Therapie hervor.Es könne jedoch nicht gebilligt werden, einen Embryo abzutreiben, bei dem eine Krankheit oder Behinderung festgestellt wurde. Gegen die Keimbahntherapie sprechen nach Ansicht der Bischöfe vor allem drei Argumente: die noch unausgereifte Methode; die für die Entwicklung notwendige verbrauchende Embryonenforschung und die Gefahr des Missbrauchs zur Menschenzüchtung. Die Bischofskonferenz fordert den Bundestag auf, den Missbrauch der Gentechnik durch Gesetze zu verhindern. Unterstützung für ihr Anliegen erhielten sie unter anderem vom Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Präses Manfred Kock. „In diesen Fragen passt kein Blatt Papier zwischen Gisela Klinkhammer uns“, sagte er. 70 Fortschritt der Biomedizin Die Politik steht vor der Quadratur des Kreises Unser Verhältnis zu Zeugung, Geburt und Tod hat sich radikal verändert. In dem Buch „Politik des Lebens – Politik des Sterbens“ beschreibt Andreas Kuhlmann diese Umwälzungen und macht Vorschläge für Reaktionen der Politik. Das Deutsche Ärzteblatt veröffentlicht einen auszugsweisen Vorabdruck. D urch den Fortschritt der Biomedizin können Krankheitsverläufe besser begriffen und beeinflusst, im günstigen Fall abgewehrt und Leiden kuriert werden. Dieser Fortschritt rüttelt aber zugleich an den Grundfesten des menschlichen Selbstverständnisses: Das Verhältnis zur eigenen Physis, zu Zeugung, Geburt und Tod, zu versehrter Existenz muss neu bestimmt werden. Mit der Erkenntnis wächst nicht nur der Aktionsradius, sondern auch die Definitionsmacht des Menschen in Bezug auf seine eigene Natur. Je mehr er nämlich über die physischen Gesetzmäßigkeiten seines Daseins erfährt, desto größer wird zugleich sein Handlungsspielraum: Mehr und mehr als Naturwesen beschrieben und begriffen, wird der Mensch zum Subjekt wie zum Objekt gezielter Manipulation – zum Artefakt. Hinsichtlich Zeugung und Elternschaft ist gut zwanzig Jahre nach der ersten erfolgreichen Laborbefruchtung buchstäblich nichts mehr so, wie es einmal war. Embryonen können zu einem bestimmten Datum produziert und der Frau implantiert werden, sie können aber auch eingefroren und zu einem späteren Zeitpunkt übertragen werden – selbst dann, wenn die Ei- und Samenspender inzwischen tot sind. Schließlich wird der Embryo zum Gegenstand der Merkmalsselektion und -planung. Pränatale Diagnostik und Präimplantationsdiagnostik erlauben es schon heute, die Geburt von Kindern mit bestimmten schweren Erkrankungen zu verhindern. In dem Maße, in dem das menschliche Genom entschlüsselt und die Funktionsweise der einzelnen Gene offenbar wird, nimmt auch die Möglichkeit zu, Veranlagungen zu diagnostizieren und eine entsprechende Auswahl zu treffen. Die Optimierung des Nachwuchses durch Genmanipulation ist als ein Zukunftsszenario, das von manchen Fachleuten nach Kräften ausgemalt wird, in der Öffentlichkeit schon sehr präsent. Lassen sich unter dem Einfluss der Fortpflanzungsmedizin mehrere frühe Lebensstadien unterscheiden, über deren Eigenschaften und Status zu befinden ist, so führt die Intensivmedizin dazu, dass sich auch am Ende des Lebens menschliche Existenz vervielfältigt und ausdifferenziert. Die meisten entwickelten Gesellschaften sehen es inzwischen als legitim an, den Menschen Organe zu entnehmen, wenn das Gehirn nicht mehr arbeitet, der Kreislauf aber durch Apparate aufrechterhalten werden kann. Vor der Organentnahme müssen die Ärzte sich vergewissern, dass es sich bei dem Patienten tatsächlich um einen Hirntoten handelt. Das verlangt ihnen wie dem Pflegepersonal ein zutiefst paradoxes Verhalten ab: Weil und obwohl der Patient noch lebendig aussieht – er atmet, ist durchblutet, zeigt bestimmte Reflexe –, muss ihm mitgespielt werden, als handle es sich um eine Leiche. Damit man sicher sein kann, dass der Hirnstamm nicht mehr funktioniert, wird der Körper auf dem Operationstisch in einer Weise malträtiert, die man einem Lebenden nur zumuten würde, wenn das irgendeinen therapeutischen Nutzen für diesen selbst verspräche. Durch apparative Tests, vor al- D O K U M E N T A T I O N lem aber durch Drücken, Stechen, Kneifen, durch Einspülen von Eiswasser in die Gehörgänge oder Reizung des Atemzentrums mit Kohlendioxyd soll bestätigt werden, dass der Körper nicht mehr in signifikanter Weise reagiert. Fällt der Test positiv aus, erklärt man den Patienten für hirntot und gibt ihn zur Explantation frei. Für die Organentnahme wird der Körper in vielen Fällen vom Brust- bis zum Schambein aufgeschnitten wie ein Kadaver, den man nach Belieben ausweiden kann. Auf diese Prozedur reagiert der „tote“ Leib aber durch Ansteigen des Blutdrucks, Hautrötung, Schwitzen und Muskelkontraktionen. Dagegen werden Betäubungsmittel und muskelentspannende Pharmaka verabreicht, die die Restaktivität des Körpers unterdrücken. Da aber garantiert sein muss, dass die Organe frisch bleiben, wird andererseits der Kreislauf medikamentös unterstützt, damit der Körper weiterhin seinen Dienst tun kann. Hirntoddiagnostik und Organexplantation schaffen also eine Sphäre zwischen Leben und Tod: Die Akteure müssen von dem, was sie sehen, abstrahieren und sich sagen, dass der Patient nichts mehr empfindet. Bevor sie explantieren können, müssen sie sich und anderen dies bestätigen, indem sie die Leiblichkeit desselben Patienten vehement stimulieren, anstatt ihm, der doch „tot“ ist, seine Ruhe zu lassen. Entfesselte Dynamik einer anonymen Technologie Die bereits existierenden, zu erwartenden oder auch nur mutmaßlichen Neuerungen der Biomedizin drohen das menschliche Selbstverständnis und die menschlichen Lebensweisen radikal zu verändern. Das meiste, was offiziell als „Politik“ gilt, erscheint dagegen relativ bedeutungslos. Medizintechnologische Innovationen werden fast immer weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit in den wissenschaftlichen Labors entwickelt. Wenn sie dann plötzlich zum Gegenstand einer hektischen und geradezu wuchernden Erörterung werden, geraten die Dispute über Präferenzen und Befürchtungen häufig eher diffus. Die moderne Medizin erscheint in den Augen ihrer Kritiker als „Biomacht“, die die Patienten erbarmungslos der eigenen Funktionslogik unterwirft. Diese werde durch unterschiedlichste Faktoren bestimmt: den Zwang zur optimalen Anpassung der Menschen an soziale Erfordernisse, die entfesselte Dynamik einer anonymen Technologie sowie die Profit- und Profilierungsinteressen von Wissenschaftlern, Ärzten und des medizinisch-industriellen Komplexes. Das alles forciere den „Fortschritt“ und degradiere den Einzelnen zum bloßen Opfer, dessen Wünsche und Bedürfnisse keinerlei Berücksichtigung mehr finden würden. Dieses gerade in Deutschland so verbreitete, mit herrschaftskritischem Furor und mit allen Mitteln politischer Rhetorik beschworene Szenario einer menschenfeindlichen Medizin sieht sich notorisch mit dem Einwand konfrontiert, dass viele therapeutische Neuerungen sehr wohl für sich in Anspruch nehmen können, den Interessen und Hoffnungen ganz bestimmter Patienten zu dienen. Der Verweis, dass Institutionen und Technologien die Autonomie und das Wohlergehen von Individuen bedrohen, ignoriert häufig mit frappierender Hartnäckigkeit, welche Bedeutung dem Heilungs- oder Präventionswunsch konkreter Personen für die Legitimierung selbst riskanter oder ethisch fragwürdiger wissenschaftlicher und therapeutischer Bemühungen zukommt. In säkularisierten Gesellschaften gilt die Gesundheit des Einzelnen als weithin anerkannter und hoch veranschlagter Wert. Einwände, die den medizinischen Fortschritt infrage stellen, sind dagegen meistens machtlos. Gemeinwesen, die sich verfassungsgemäß als Sozialstaaten verstehen, ist ja das ganz elementare, gerade auch physische Wohlergehen ihrer Bürger glücklicherweise nicht gleichgültig. In solch einem sozialen Rahmen muss das Heilsversprechen der Medizin auf fruchtbaren Boden fallen. Gewiss, die frohe Botschaft der Fortschrittslobbyisten wird häufig geradezu militant verbreitet. Was sich an ernstlichen Warnungen selbst dem nur vagen Versprechen auf therapeutische Errungenschaften in den Weg stellt, wird förmlich niedergewalzt mit dem forschen Verweis, dass Recht hat, wer heilt oder das Heilen – eventuell – befördert. Die berechtigte Kritik an einem solchen Fortschrittsfuror sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, in welchem Maße dieser mit der Akzeptanz der – meist schweigenden – Mehrheit rechnen kann. Hinter der Vorstellung, Wunschkinder „fabrizieren“, Fortpflanzung „managen“ und auch das Sterben souverän „beherrschen“ zu können, verbergen sich Extremvisionen persönlicher Autonomie. Daraus werden Forderungen abgeleitet, die sich mitunter nicht nur als ethisch fragwürdig, sondern schlicht als unrealistisch erweisen. Als wäre die Verfügungsmacht, die der biomedizinische Komplex bereitstellt, nicht schon eindrucksvoll genug, wird in verzerrender Weise die Kontrollierbarkeit kreatürlicher Prozesse angepriesen – und unterschlagen, dass spontane, nicht voraussehbare und deshalb nicht kalkulierbare physische und psychische Ereignisse sich zweifellos auch weiterhin geltend machen. Man mag das bedauern oder erleichtert konstatieren – es zu ignorieren kann jedoch zur Folge haben, dass das proklamierte Prinzip der Selbstbestimmung krass verletzt und den Einzelnen Gewalt angetan wird. Man darf sich nichts vormachen: Darüber, ob eine therapeutische Maßnahme der Selbstbestimmung des Einzelnen förderlich ist oder nicht, lässt sich selten Einigkeit erzielen. Kontrovers sind Möglichkeiten der Biomedizin häufig vor allem deshalb, weil die Meinungen auseinander gehen, was unter Autonomie überhaupt zu verstehen ist. Was heißt es, selbstbestimmt zu leben, und was heißt es, selbstbestimmt zu sterben? Die Antworten stehen sich allerdings nicht in abstrakter, säuberlich ausbuchstabierter Form gegenüber. Umstritten sind zumeist Situationsdeutungen: Beim Disput darüber, welche neuen diagnostischen, prognostischen und therapeutischen Verfahren zulässig und erwünscht sind, versuchen die Kontrahenten jene Chancen und Risiken möglichst anschaulich zu vergegenwärtigen, die für die Patienten mit dem Einsatz solcher Verfahren einhergehen. Der Humangenetiker, der die Präimplantati- 71 D O K U M E N T A T I O N onsdiagnostik anpreist, erzählt von Paaren, die schon ein Kind oder gar zwei Kinder mit Mukoviszidose haben, diese auch mit aller Liebe und Fürsorge großziehen, sich nun aber sehnlichst noch ein gesundes Kind wünschen – nicht zuletzt deshalb, weil Menschen mit Mukoviszidose nur über eine eingeschränkte Lebenserwartung verfügen. Diese Eltern nun, so lautet der Bericht, haben schon zwei Kinder im fünften Schwangerschaftsmonat abtreiben lassen, weil sich nach pränataler Diagnose herausstellte, dass sie wieder krank sein würden. Um ihnen eine abermalige Frustration nach begonnener Schwangerschaft zu ersparen, soll den Eltern nun die nach Auffassung der Beteiligten weniger belastende Labordiagnostik von Embryonen angeboten werden. Kritikern dieses avancierten Selektionsverfahrens fällt es erstaunlich leicht, solche konkreten Wünsche auszublenden. Für sie ist die Frau vor allem das Opfer manipulativer Strategien: Schon das bloße Angebot, diagnostizieren zu lassen, setze die Frauen nur schwer erträglichen Entscheidungszwängen aus; die Durchführung der Tests und die Mitteilung abstrakter Risikozahlen verunsichere sie darüber hinaus massiv. Und bei „positivem“ Befund bleibe ihnen in Wirklichkeit gar keine Wahl: Der Druck von Ärzten und Juristen und der Einfluss eines behindertenfeindlichen sozialen Umfelds führten dazu, dass sie das aller Voraussicht nach geschädigte Kind – ganz gleich, was sie selbst sich wünschen – nicht zur Welt bringen. Noch kontroverser wird die Meinungsbildung, wenn moralische Normen ins Spiel kommen, die mit dem Autonomieprinzip konkurrieren. Um zu demonstrieren, dass ein medizinisches Verfahren die Grundfesten der menschlichen Zivilisation bedroht, setzt man Werte immer wieder wie Trumpfkarten ein. Ob Achtung der Menschenwürde, unbedingter Lebensschutz, Recht auf „natürliche“ Abstammung oder Schutz intakter Familienstrukturen – all das wird beschworen, als verstünde es sich von selbst, dass zum Beispiel Praktiken der „therapeutischen“ Selektion, der Genveränderung oder der Organtransplantation mit diesen Prinzipien unvereinbar seien. Doch solche magischen 72 Bannsprüche, die alle Erklärungen überflüssig zu machen scheinen, verlieren in der öffentlichen Debatte oft allzu schnell ihre Eindeutigkeit:Was die Achtung der Menschenwürde eigentlich konkret gebietet und ob es wirklich ausnahmslos oberstes Gebot sein kann, menschliches Leben um jeden Preis zu erhalten, erweist sich dann als unklar und fragwürdig. Wenn es um revolutionäre Neuerungen geht, ist die Reaktion meist noch relativ einhellig. Auf die Geburt des ersten „Retortenbabys“ im Jahre 1978 reagierte ein großer Teil der Bevölkerung mit Abscheu oder Befremden. Dass hier die „Würde“, genauer die physische und psychische Integrität, der Frau bedroht sei und dass außerdem frühe Stadien menschlichen Lebens in unzulässiger Weise instrumentalisiert werden könnten, schien intuitiv einzuleuchten. Je mehr jedoch die Erfolgsmeldungen überwogen, desto schwieriger wurde es, an der ursprünglichen kategorischen Ablehnung festzuhalten. Was sollte eigentlich so verdammenswert daran sein, wenn infertile Paare mit Kinderwunsch medizinische Hilfe bei der Zeugung in Anspruch nahmen? Was sprach umgekehrt dafür, die „natürliche“ Fortpflanzung für sakrosankt zu erklären? Ohnehin wurde mit der fortschreitenden Etablierung der Laborbefruchtung, die man bei Sterilität mittlerweile als Routineverfahren einsetzte, immer undeutlicher, was „unnatürlich“ in diesem Zusammenhang eigentlich zu bedeuten hatte. Politik, die biomedizinische Innovationen zu regulieren sucht, muss mit umstrittenen Situationsdeutungen wie mit konkurrierenden moralischen Prinzipien umgehen. Entziehen kann sie sich dieser Aufgabe nicht. Denn dass reguliert werden muss, erkennen auch die Verfechter der neuen Verfahren an. Sie möchten selbst genau wissen, was zulässig ist und was nicht: Dürfen bei der künstlichen Fertilisation Gameten genutzt werden, die nicht einem der beiden Partner entstammen, und ist die Herkunft dieser Keimzellen zu dokumentieren und bei Verlangen später dem Kind mitzuteilen? Was darf oder muss mit Embryonen geschehen, die bei der Laborbefruchtung „übrig bleiben“? Wie muss der Arzt bei Risi- koschwangerschaften aufklären, um sich vor Regressansprüchen nach der Geburt eines behinderten Kindes zu schützen? Wie lässt sich der Hirntod mit hundertprozentiger Sicherheit feststellen, und wie muss diese Diagnose belegt werden? Unter welchen Voraussetzungen darf explantiert werden, und an wen können die Organe weitergegeben werden? Die einzelnen Praktiken enthalten eine kaum überschaubare Fülle von Aspekten, die rechtlich definiert werden müssen, will man nicht der Willkür Tür und Tor öffnen. Bei jeder Gesetzgebung stellt sich dann aber zugleich die Grundsatzfrage, ob das neue Verfahren mit „der Moral“ der Gesellschaft im Einklang steht. Das zu entscheiden, überfordert staatliche Instanzen in aller Regel. Zumeist werden sie ohnehin erst dann mit dieser Frage konfrontiert, wenn durch die Entwicklung und Einführung einer Diagnostik oder Therapie die Weichen bereits gestellt sind. Die Entwicklung, die schon voll im Gange ist, kann dann nur nachträglich „abgesegnet“ und in einem begrenzten Maß kanalisiert, kaum aber noch grundsätzlich umgelenkt oder aufgehalten werden. Für eine qualifizierte Prognose der mittel- und langfristigen Konsequenzen der Innovationen – die auch bei den Fachleuten selbst umstritten sind – fehlt den Politikern meist die nötige Sachkenntnis. Zudem fließen in die Entscheidung über die Zulässigkeit biomedizinischer Verfahren so vielfältige und tief verwurzelte Werthaltungen ein, dass es unter den Vorzeichen des weltanschaulichen Pluralismus höchst schwierig ist, zu konsensfähigen Beschlüssen zu gelangen. Stellungnahmen, die aus der Sicht einer der Parteien besonders überzeugend und nahe liegend erscheinen, stoßen oft allgemein auf wenig Akzeptanz. Das heißt: Je zwingender ein Urteil für die Verfechter oder Kritiker einer Option ausfällt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es mit allgemeiner Zustimmung rechnen kann. Die Wertmaßstäbe und Tatsachenbehauptungen, die in diese Urteile einfließen, sind nämlich derart spezifisch, dass sie in einer wertpluralen Gesellschaft immer nur von einzelnen Fraktionen des Gemeinwesens akzeptiert werden. Man D O K U M E N T A T I O N kann sagen: Je partikularer eine Überzeugung, desto schwieriger ist es für ihre Anhänger hinzunehmen, dass sie den Lauf der Dinge nicht entscheidend beeinflussen können. Die Frage nach dem angemessenen Umgang mit Zeugung, Geburt, Krankheit, Sterben und Tod provoziert quasireligiöse Vorstellungen von Gut und Böse, die sich nicht einfach wegrationalisieren und in die private Sphäre der Bürger abdrängen lassen. Das liberale Credo, dass politische Entscheidungen wertneutral ausfallen müssen, wird damit auf eine harte Probe gestellt.Permissive Regelungen, das heißt Gesetze, die möglichst wenig verbieten, sind zwar den liberalen Grundwerten westlicher Gesellschaften insofern eher angemessen, als sie den Bürgern weitgehend die Wahl lassen, ob sie von gewissen Möglichkeiten Gebrauch machen wollen oder nicht. Doch unparteiisch sind solche Regelungen deshalb keineswegs. Denn auch sie basieren auf ganz bestimmten Wertüberzeugungen: Dass Ärzte mit gespendeten Keimzellen im Labor ein Kind zeugen und diese vielleicht sogar nach besonderen medizinischen Standards auswählen oder dass ein ganzes Geschwader von Chirurgen an einen „hirntoten“ Patienten mit einem Wunschzettel herantritt, ihn aufschneidet und ihm Zellmaterial und Organe entnimmt – all das kann nur dann zulässig erscheinen, wenn man menschliches Leben in einer ganz bestimmten Weise definiert und damit das totale Verfügen über frühe und späte Lebensstadien als moralisch akzeptabel deklariert. Wunsch, Menschen zu heilen, entfaltet ungeheure Kräfte Die Politik steht deshalb vor einem Dilemma, und was ihr abverlangt wird, mutet nicht selten an wie die Quadratur des Kreises: Sie ist gut beraten, möglichst wenig restriktiv zu verfahren, um nicht die Wahlfreiheit der Bürger zu verletzen. Zugleich aber darf sie nicht den Verdacht aufkommen lassen, dass sie mit solcher Liberalität einzelne Weltanschauungen privilegiert oder den Wünschen einzelner Interessengruppen – den Forschern, der Wirtschaft, den Patienten – nachgibt. Entscheidungsträger müssen den häufig be- rechtigten oder doch gut nachvollziehbaren Vorbehalten gegenüber dem radikalen Wandel im Umgang mit Leben und Sterben Gehör schenken, ohne ihnen doch in der Weise nachgeben zu können, dass sie ganze therapeutische Entwicklungsstränge durch staatliche Order einfach kappen. Es ist deshalb schwer vorstellbar, dass das extrem restriktive deutsche Embryonenschutzgesetz Bestand haben wird. Das Verbot der Embryonenforschung beschränkt nicht nur den Verhaltensspielraum von Wissenschaftlern, sondern es erstickt auch eine Fülle medizinisch-therapeutischer Möglichkeiten. Mit dem Selbstverständnis liberaler Gesellschaften, sich und ihren Bürgern ein breites Spektrum von Entwicklungswegen offen zu halten, ist dies solange unvereinbar, wie hiermit nicht eindeutig die elementaren Interessen konkreter Personen verletzt werden. Dass aber frühe menschliche Embryonen in gleicher Weise unbedingten Schutz ihrer Integrität verdienen wie voll entwickelte Personen, wird wohl kaum eine Mehrheit der Bevölkerung bejahen. Erweist sich das Embryonenschutzgesetz als zu restriktiv, so muss das deutsche Transplantations medizingesetz gerade aus liberaler Sicht als zu permissiv gelten. Dem Postulat, dass die persönlichen Wertentscheidungen jedes Einzelnen zu respektieren sind, hätte man Rechnung tragen können, ohne damit der Organspende und Organtransplantation ein Ende zu bereiten. Weil es eben nach wie vor strittig ist, ob „hirntote“ Personen „richtig“ tot sind oder nicht, kann nur jeder selbst entscheiden, ob ihm seine Organe in diesem Zustand, in den er womöglich einmal gerät, entnommen werden dürfen. Hier handelt es sich um eine solch gravierende Entscheidung, dass sie nicht – wie nach deutschem Recht erlaubt – an Angehörige delegiert werden darf, die hiermit im Augenblick des Abschiednehmens vom todkranken Patienten häufig auch psychisch völlig überfordert sind. Das Argument, dass mit einer „engen“ Regelung das ohnehin unzureichende „Organaufkommen“ abermals stark zurückgehen würde, zeigt die ungeheure Versuchung, der man nicht erliegen darf: dass nämlich im Namen des zu erzielenden therapeutischen Nutzens die Persönlichkeitssphäre des Einzelnen verletzt wird. Die Medizinverbrechen des zurückliegenden Jahrhunderts können uns – anders, als häufig behauptet wird – nicht darüber belehren, welche neuen medizinischen Verfahren verwerflich und welche wünschenswert sind. Die Geschichte zeigt jedoch, was für eine ungeheuer expansive und destruktive Kraft der – echte oder vorgebliche – Wunsch entfalten kann, Menschen zu heilen. Dieser Dynamik fallen dann allzu schnell jene zum Opfer, die als unheilbar gelten. Man sollte sich hieran erinnern, damit der „therapeutische Imperativ“ nicht als ein „kategorischer Imperativ“ missverstanden wird und inhumanen Interventionen Tür und Tor öffnet. ) Heft 13, 30. März 2001 PID „Glasklare Regelung“ BÄK-Präsident fordert Rechtssicherheit. P rof. Dr. med. Jörg-Dietrich Hoppe, Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), fordert eine „glasklare gesetzliche Regelung zur PID“. Wenn die Präimplantationsdiagnostik (PID) in Deutschland zugelassen werden sollte, dann nur, wie es der Diskussionsentwurf der BÄK vom Februar 2000 vorsehe, wenn Rechtssicherheit und ein hohes Schutzniveau über strenge und restriktiv zu fassende Zulassungskriterien erreicht werden könnten. Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin wies in einem Schreiben an einen Gynäkologen auf die Strafbarkeit von „PID-Tourismus“ hin: Ein Arzt, der eine Frau zur PID an den ausländischen Kollegen vermittele oder die Patientin im Rahmen der hormonellen Stimulation betreue, unterstütze eine strafbare Handlung. Er könne sich als Gehilfe strafbar machen. Das gelte auch, wenn die PID in dem Land, in dem sie vorgenommen werde, nicht strafbar sei. 73 D O K U M E N T A T I O N Heft 12, 23. März 2001 Präimplantationsdiagnostik Ganz am Anfang Das Bundesgesundheitsministerium möchte vor einer gesetzlichen Regelung die Frage der Präimplantationsdiagnostik auf breiter Basis diskutieren. E ine Entscheidung, ob die Präimplantationsdiagnostik (PID) in Deutschland zugelassen werden soll, wird in nächster Zeit nicht fallen. Dies verdeutlichte die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium (BMG), Gudrun Schaich-Walch (SPD), bei der Diskussionsveranstaltung „Berliner Dialog Biomedizin“ der Friedrich-EbertStiftung am 13. März. „Wir stehen ganz am Anfang der Diskussion und müssen keine Eile haben“, sagte sie. „Im wissenschaftlichen Bereich werden wir nichts verpassen.“ Dass die neue Führung des Bundesgesundheitsministeriums das Positionspapier des ursprünglichen Ministeriums unter Andrea Fischer nicht als Diskussionsgrundlage verwende, läge nicht an einer großzügigeren Haltung gegenüber biomedizinischen Fragen. Man wolle allerdings in der Debatte nicht vorgeben, dass die PID verboten werden solle. Auch wenn Zeitpunkt und Ergebnis offen sind – äußern wird sich der Gesetzgeber zur PID gewiss. Um eine Entscheidung zu fällen, sei rechtliche Klarheit erforderlich, so Schaich-Walch. Zurzeit ist das Gegenteil der Fall: Die Rechtsauffassungen, ob das Embryonenschutzgesetz die PID zulässt oder verbietet, gehen auseinander. Das BMG will daher ein Gesetz erarbeiten, das einen Konsens im Bundestag und in der Bevölkerung findet. Die Frage der Zulässigkeit der PID soll klar geregelt und nicht nur Auslegungssache sein. Eine Regelung durch die Richtlinien der Bundesärztekammer und das Berufsrecht lehnt Schaich-Walch ab. Auch der Präsident der Bundesärztekammer, Prof. Dr. med. Jörg-Dietrich Hoppe, plädiert für eine gesetzliche Klarstellung. Die Verantwortung dürfe 74 nicht allein auf die Ärzte übertragen werden. „Wenn der Gesetzgeber die PID will, brauchen wir zunächst Rechtsklarheit; danach sind wir gern bereit, eine berufsrechtliche Regelung zu finden“, betonte er in Berlin. Erst eine gesetzliche, dann eine berufsrechtliche Regelung Für eine solche Reihenfolge sprach sich während der Podiumsdiskussion auch Dr. Carola Reimann (SPD), Biotechnologin und Mitglied der Enquete-Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“, aus. Die Kommission hätte zwar am Vortag mehrheitlich die PID als unvereinbar mit dem Embryonenschutzgesetz beurteilt; bei diesem Thema seien jedoch keine Mehrheiten, sondern ein Konsens erforderlich. Dazu müsse die Schutzwürdigkeit der Embryonen diskutiert werden. Die Kern- Einmal Gott spielen Reproduktives Klonen ist für Experten „reine Scharlatanerie“. Nicht die therapeutischen Möglichkeiten, sondern die Idee, den Menschen zu optimieren, stünde anscheinend bislang im Mittelpunkt der Bemühungen um das Klonen, warnte der Kulturstaatsminister Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin bei den „Berliner Wissenschaftsgesprächen“, die am 12. März von der Berliner Zeitung und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) veranstaltet wurden. Das therapeutische Klonen könne den Einstieg in das Projekt des „optimierten Menschen“ bedeuten. Solange diese Gefahr bestehe, wende auch er sich gegen diese Bemühungen. Sobald das Risiko aber ausgeschlossen sei, habe er keine grundsätzlichen Einwände gegen das therapeutische Klonen. Zugleich räumte der Minister auf der Veranstaltung ein, sich möglicherweise im Januar missverständlich ausgedrückt zu haben. Damals hatte er im „Tagesspiegel“ frage laute: Ist ein Embryo in vitro schutzwürdiger als in vivo? Die Spirale als legale Verhütungsmethode, die die Nidation des Embryos in vivo verhindert, und die Möglichkeit der straffreien Abtreibung nach § 218 StGB würden von den Frauen nicht leichtfertig angewandt. Schon dass die In-vitro-Fertilisation mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden sei, würde die Anwendung der PID nach Ansicht Reimanns begrenzen. Voraussetzung sei allerdings, die PID auf bestimmte Erkrankungen einzuengen und eine ausführliche psychosoziale Beratung anzubieten. Eine „Schwangerschaft auf Probe“ durch die Möglichkeiten der Pränataldiagnostik bezeichnete Reimann als „frauenverachtend“. Sowohl die PID als auch die Pränataldiagnostik hält Dr. med. Alfred Sonnenfeld, Theologe und Medizinethiker der Charité Berlin, für unvertretbar. Man müsse sich der Herausforderung stellen, den Embryo schon als vollständigen Menschen zu sehen. Auch Hoppe stellte klar, dass es sich in jedem Fall um menschliches Leben handele und die PID eine Selektionsmethode sei. Eine unterschiedliche Schutzwürdigkeit der Embryonen in vivo und in vitro sieht er jedoch nicht. Ferner scheint es ihm nicht sinnvoll zu sein, Grenzen der PID anhand einer Diagnosenliste zu ziehen. Zweckmäßiger sei eine individuelle ärztliche Beratung. Dr. med. Eva A. Richter Embryonen im frühen Stadium die Menschenwürde abgesprochen. Menschenwürde sei jedoch nicht mit Schutzwürdigkeit gleichzusetzen, betonte der Philosoph jetzt in Berlin. Die Schutzwürdigkeit des Embryos bestünde von Anbeginn an und nähme im Reifungsprozess graduell zu. Das Vorhaben der italienischen Forschergruppe um Severino Antinori, einen Menschen zu klonen, bezeichnete Prof. Dr. Ernst-Ludwig Winnacker, Präsident der DFG, als „reine Scharlatanerie“. Das Klonen eines vollständigen Organismus sei inakzeptabel. Bereits der Weg dahin sei unvertretbar, weil Tierversuche gezeigt hätten, dass viele Embryonen sterben und Jungtiere missgebildet oder lebensunfähig zur Welt kämen. Auch der Benefit des therapeutischen Klonens läge noch in weiter Ferne. Eine Alternative sieht der DFG-Präsident hingegen in der Forschung an adulten Stammzellen. Eine Änderung des deutschen Embryonenschutzgesetzes, in dem das therapeutische Klonen verboten wird, lehnt Winnacker ab. Deutschland dürfe sich allerdings innerhalb der internationalen Wissenschaft ER nicht isolieren. D O K U M E N T A T I O N Heft 14, 6. April 2001 Streit um die Embryonen Was tun, wenn man sich nicht einigen kann? Nach den Äußerungen des Präsidenten der Bundesärztekammer in der Frankfurter Allgemeinen stellt sich die Frage: Welche Rolle kommt der Ärzteschaft zu? Urban Wiesing D em Leser „anspruchsvoller“ Zeitungen wird seit einigen Monaten ein erbitterter Kampf aufgefallen sein. Gestritten wird um neuere Technologien wie die Präimplantationsdiagnostik oder die Forschung an embryonalen Stammzellen, vor allem aber um die grundlegende Frage, welcher Schutz dem ungeborenen menschlichen Leben zukommen soll. Anlässe zu dieser Debatte gab es mehrere: Die Bundesärztekammer hatte einen Entwurf einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik (PID) vorgestellt, in der sie diese innerhalb strenger Grenzen befürwortet. Ein Mitglied der Bundesregierung, Staatsminister Julian Nida-Rümelin, hatte sich gegen die gleiche Zuschreibung der Menschenwürde an menschliche Embryonen in den ersten 14 Tagen vor der Implantation ausgesprochen. Seither wechseln sich wöchentlich, zuweilen täglich die Stellungnahmen für und gegen den Lebensschutz von Embryonen ab. Die Argumente sind seit langem bekannt Die Standpunkte und die angeführten Argumente zum Lebensrecht des ungeborenen menschlichen Lebens sind nicht neu, sondern seit langem bekannt. Alles, was in den letzten Monaten für und wider den Lebensschutz von Embryonen zu lesen war, lässt sich schon seit geraumer Zeit in der einschlägigen moralphilosophischen Literatur finden. Neu ist allenfalls die Aufgeregtheit angesichts der Tatsache, dass ein Mitglied der Bundesregierung den Lebensschutz von Embryonen relativiert hat. Dabei hat Nida-Rümelin nur das öffentlich gesagt, was in der Moralphilosophie – der Staatsminister ist hier ausgewiesener Experte – zu den ausführlich diskutierten Positionen gehört. Man wird sich nicht einigen können Bei der Debatte war eines schon vorab klar: Man wird sich am Ende nicht einigen können. Man hätte gleich eingangs vor der Illusion warnen sollen, es ließe sich zum moralischen Status des ungeborenen menschlichen Lebens ein Konsens finden. Die Positionen zwischen den Befürwortern eines uneingeschränkten Schutzes der Embryonen ab Verschmelzung von Samen- und Eizelle und den Befürwortern eines abgestuften, wachsenden Schutzes der Embryonen liegen so weit auseinander, dass sie nicht zu vermitteln sind. Selbst ein Rückgriff auf das Grundgesetz und die darin verankerte Menschenwürde kann die Kontroverse nicht entschärfen. Zwar schützt das Grundgesetz nach Ansicht der meisten Rechtsgelehrten menschliches Leben ab der Verschmelzung von Samenund Eizelle, doch auch hier erhebt sich Widerspruch. Für Norbert Hoerster lässt die Verfassung keine eindeutigen Rückschlüsse zu, und für Reinhard Merkel ist das Embryonenschutzgesetz gar verfassungswidrig. Es bestätigt sich, was im Grunde seit langem bekannt ist: Man wird sich nicht einig, und daran dürfte sich auch in Zukunft nichts ändern. Für mehrere Positionen zum Schutz des un- geborenen Lebens lassen sich plausible Argumente anführen.Wenn es eines Beweises bedurft hätte, dass wir uns in einer wertepluralen Gesellschaft befinden, hier ist er. Was folgt aus dieser ernüchternden Diagnose? Die Debatte um den moralischen Status des ungeborenen menschlichen Lebens führt uns mit Deutlichkeit vor Augen, dass in dieser Frage eine politische Entscheidung gefällt werden muss, da kein moralischer Konsens erwartet werden darf. Der Staat in Form seiner demokratisch legitimierten Institutionen muss sich Fragen jenseits der verschiedenen Überzeugungen stellen. Erstens: Auf welchen Prämissen basieren die jeweiligen Positionen zum Lebensschutz des ungeborenen Lebens, und inwieweit sind diese Vorannahmen – zum Beispiel religiöser Art – für alle verbindlich? Zweitens: Nicht die Frage, welche Vorgehensweise ist moralisch die einzig richtige, stellt sich, sondern: Welche Handlungen soll der Staat erlauben? Im Grunde hat sich der Gesetzgeber so bereits beim § 218 verhalten. Dieses Gesetz ist einzig ein politischer Kompromiss, der dem moralischen Dissens in unserer Gesellschaft nicht beikommen konnte. Auch die Konsequenzen aus der notorischen Uneinigkeit beim Embryonenschutz sind lange bekannt. Schon vor über zehn Jahren beendete Anton Leist seine Untersuchung zum moralischen Status des ungeborenen Lebens mit der Feststellung, dass sie in die Frage der Toleranz münden würde. Was soll erlaubt werden, ohne die Zumutbarkeit der Vertreter anderer Ansichten zu überfordern? Wenn gute Argumente für einen gestuften Lebensschutz von Embryonen angeführt werden können und die Gegenargumente zumeist auf bedingt verallgemeinerungsfähigen Vorannahmen beruhen, dann sollte man den Schutz der Embryonen in der frühesten Phase zumindest gegen andere hochrangige Güter zur Abwägung stellen. Dass diese Überlegungen nicht ganz folgewidrig sind, sei mit Verweis auf die Realität untermauert: Die Tötung von Embryonen geschieht beispielsweise durch die Spirale millionenfach, ohne dass sie sonderlich kontrovers wäre. Entweder die Spirale müsste verboten werden, oder die Überlegungen der 75 D O K U M E N T A T I O N Bundesärztekammer zur PID sind nicht ganz abwegig. Zudem schließen liberale rechtliche Regelungen nicht aus, dass für zahlreiche Bürger aufgrund von moralischen, hoch respektablen Überzeugungen eine PID oder ein Schwangerschaftsabbruch nicht infrage kommen. In die Diskussion haben sich Ärzte und Vertreter der verfassten Ärzteschaft eingeschaltet – mit deutlicher Resonanz. Insbesondere ein Artikel des Präsidenten der Bundesärztekammer, Jörg-Dietrich Hoppe, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat zahlreiche Reaktionen provoziert. Nicht zuletzt von ihm selbst, wurde doch sein Artikel ohne Rücksprache gekürzt, entstellend überschrieben und redaktionell vernichtend kommentiert: Seine Ausführungen seien „in weiten Teilen ein Dokument der Hilflosigkeit“. Das bitterböse Urteil des redaktionellen Kommentars richtete sich unter anderem gegen Hoppes Äußerung, die aufgeworfenen Fragen könnten nur von der „Gesamtgesellschaft“ beantwortet werden. Dem hielt wenig später Stephan Sahm entgegen, es zähle „zu den vornehmsten ärztlichen Pflichten [. . .], zu den ethischen Herausforderungen medizinischer Praxis einen Standpunkt zu finden“ . Unweigerlich drängt sich die Frage auf, welche Rolle der Ärzteschaft bei der Auseinandersetzung zukommt. Zweierlei sollte man sich vergegenwärtigen. Erstens: Wen betreffen die Entscheidungen? Und zweitens: Gibt es eine Gruppe, die über einen privilegierten Zugang zu einer besseren und in höherem Maße verbindlichen Moral verfügt? Die erste Frage lässt sich leicht beantworten: Die Auswirkungen neuer Technologien in der Medizin betreffen alle potenziellen Kranken, also im Prinzip alle Bürger. Die Frage, wie eine Gesellschaft mit dem ungeborenen menschlichen Leben umgehen soll, betrifft gleichermaßen alle Bürger. Hier steht kein professionsinternes, sondern ein „gesamtgesellschaftliches“ Problem zur Debatte. Bei der Frage nach einem privilegierten Zugang zu einer Moral wird man auf Grundannahmen unseres Gemeinwesens verweisen müssen. Zu diesen gehört, dass ein jeder Bürger in Sachen 76 Moral zunächst einmal selbst Experte ist. Als sittliche Subjekte sind wir in hohem Maße auf uns selbst verwiesen, und darin sind sich alle Bürger gleich. Es ist mit dem Selbstverständnis einer demokratischen und offenen Gesellschaft daher kaum zu vereinbaren, dass einer Berufsgruppe exklusive moralische Fähigkeiten zugestanden werden, und Gleiches gilt für exklusive moralische Befugnisse. Wer es anders sieht, müsste es begründen – und das dürfte kaum gelingen. Kurzum: Die Frage, wie eine Gesellschaft mit dem ungeborenen Leben umgehen soll, lässt sich nicht von einer Profession lösen. Erstens geht sie alle an, und zweitens verfügt ein Berufsstand über keinerlei besondere Fähigkeiten und Befugnisse in moralischen Fragen. Die Ärzteschaft – Spiegel einer wertepluralen Gesellschaft Demokratische Gesellschaften halten die Zuständigkeit von Professionen gezielt begrenzt: Für die moralischen Probleme in ihrem Arbeitsbereich und vor allem für die Grundhaltungen des ärztlichen Ethos wird der Profession zwar ein Formulierungsrecht, beim ärztlichen Ethos gar ein Vorschlagsrecht eingeräumt. Die Berufsordnung – in Selbstverwaltung erstellt – muss jedoch stets von einem Minister gezeichnet werden. Anderes wäre in einem demokratischen Rechtsstaat auch schwerlich zu vertreten. Ärzte können die moralischen Normen ihres Handelns formulieren, argumentativ untermauern und für sie werben. Ihre Gültigkeit festlegen können sie als Profession jedoch nicht. Zuständig sind die demokratisch legitimierten Institutionen der Gesellschaft. Dieser Aufteilung von Zuständigkeit wird stets der hohe Sachverstand der Professionen entgegengehalten. Nur sie verfügten über die Kenntnisse, die angemessene und sachgerechte Urteile erlauben. Und in der Tat ist der öffentliche Diskurs vom Sachverstand der Experten abhängig – allerdings nur in technischen Fragen. Nichts anderes ist mit dem Selbstverständnis einer Demokratie zu vereinbaren, als dass die Diskussion um die Medizin im öffentlichen Raum stattfindet, dass die Vertreter der Standesorganisationen ein Diskussi- onspartner unter vielen sind, dass von ihnen zwar technischer Sachverstand verlangt werden kann, ihnen aber kein privilegierter Zugang auf eine überlegene oder bindende Moral zusteht. Ein Vergleich drängt sich auf: Man stelle sich das Befremden vor, wenn die militärische Führung der Bundeswehr feststellen würde, es gehöre zu den vornehmsten Pflichten des Militärs, in Sachen Kriegsführung einen Standpunkt zu finden und entsprechend zu entscheiden. Wenn demokratische Gesellschaften beständig darauf beharren, dass Soldaten „Bürger in Uniform“ sind und ihnen keinerlei Sonderstellung zukommt, dann ist doch nicht einzusehen, was so schlecht dran ist, wenn sich die Ärzte als „Bürger im weißen Kittel“ verstehen. Insofern war es nur zu angemessen, wenn die Bundesärztekammer zunächst einen Entwurf zur Präimplantationsdiagnostik zur Diskussion gestellt hat. Den Kritikern dieser Vorgehensweise sei gesagt, dass alles andere ungleich mehr Proteste hervorgerufen hätte. Jörg-Dietrich Hoppe hat nicht nur die „Gesamtgesellschaft“ als Forum des Diskurses angeführt, sondern realistischerweise hinzugefügt, dass es um ethische Grundfragen gehe, „über die gesamtgesellschaftlich keine Einigkeit erzielt werden kann“. Ist es vor diesem Hintergrund nicht völlig abwegig, von den Ärzten zu verlangen – wie im redaktionellen Kommentar der Frankfurter Allgemeinen –, was der Gesellschaft nicht mehr gelingt? Die Ärzteschaft spiegelt auch nur die Gesellschaft wider, und es wäre ganz illusorisch anzunehmen, dass sich alle Ärzte in der Frage des Schwangerschaftsabbruchs oder der PID einig wären. (Noch nicht einmal innerhalb der Vorstandes der Bundesärztekammer, wie der Kommentar von Frank Ulrich Montgomery, gleichfalls in der Frankfurter Allgemeinen, verdeutlicht!) Die Ärzteschaft einer wertepluralen Gesellschaft ist keine vollständig homogene Gruppe, bei der es zu schwierigen und komplexen Themen nur eine Meinung gibt. Dem Präsidenten der Bundesärztekammer wurde überdies der Verweis auf eine Äußerung von Hermann-Josef Hepp vorgeworfen, in dieser Situation könne es „ein schuldfreies Arztsein“ nicht mehr geben. Man mag über den D O K U M E N T A T I O N Heft 14, 6. April 2001 Begriff „schuldfrei“ streiten, vermutlich wäre „konfliktfrei“ treffender. Gleichwohl, in der Sache steht jedoch völlig außer Zweifel, dass die Herausforderungen der modernen Medizin – auch die PID – eben nicht einfach zu lösen sind, sondern die Unsicherheit, die Abwägung und der Kompromiss zur Regelung dieser Verfahren gehören. Viele Aspekte sind zu berücksichtigen, und bei einer Entscheidung müssen bestimmte Aspekte zurücktreten – so oder so mit Folgen für die Beteiligten. Zu loben ist, wer sich dazu bekennt, und nicht, wer das verleugnet. Hilflosigkeit oder Eingeständnis der Schwierigkeiten? Wenn der redaktionelle Kommentar der Frankfurter Allgemeinen die Ausführungen Hoppes als „hilflos“ bezeichnet, so mag man dem in gewissem Maße zustimmen. Aber eignet sich diese Eigenschaft eines Diskussionsbeitrags als Vorwurf? Wer ist denn in dieser Situation nicht hilflos? Die, die vorgeben, es nicht zu sein, berufen sich zumeist auf Prämissen, die schwerlich zu verallgemeinern sind, oder sie scheuen die Komplexität der Sachverhalte. Sie erklären ihren eigenen Standpunkt zum Maßstab für alle anderen und glauben, die Tiefe ihrer persönlichen Überzeugtheit gebiete zwangsläufige Allgemeinverbindlichkeit. Sie können sich beispielsweise auf religiöse Überzeugung zurückziehen, aber in einem Rechtsstaat mit Religionsfreiheit sind damit die Schwierigkeiten einer allgemeinen Regelung nicht behoben. Ein Eingeständnis der Schwierigkeiten, will man in einer wertepluralen Gesellschaft hochkomplizierte Methoden der Medizin regeln, ist kein Ausdruck der Hilflosigkeit, sondern ein Ausdruck der Redlichkeit und ein erster Schritt. ❚ Zitierweise dieses Beitrags: Dt Ärztebl 2001; 98: A 896–898 [Heft 14] Literatur beim Verfasser Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. med. Dr. phil. Urban Wiesing Lehrstuhl für Ethik in der Medizin Universität Tübingen Keplerstraße 15 72074 Tübingen Embryonenforschung in Europa Gesundheit ist nicht das höchste Gut Die unterschiedlichen Auffassungen von Menschenwürde haben ihre Ursache in verschiedenen geistigen Traditionen. Ulrich Eibach D er Begriff Menschenwürde spielt in vielen Verfassungen von Staaten und internationalen Übereinkommen eine zentrale Rolle. Es gibt jedoch selbst in Europa recht unterschiedliche Auffassungen über das, was unter diesem „Prädikat“ zu verstehen ist. Im angelsächsischen Bereich bezeichnet man „frühe Embryonen“ als „Präimplantationsprodukte“ und Leben, das endgültig ohne Bewusstsein ist, als „human vegetable“. Man unterscheidet also zwischen biologisch menschlichem und personalem Leben. Entsprechend bleibt in dem Übereinkommen des Europarats die Frage nach dem Beginn und dem Ende des Lebens offen, wohingegen die deutsche Gesetzgebung das Ende des personalen Lebens im Transplantationsgesetz mit dem Hirntod und seinen Beginn im Embryonenschutzgesetz mit der Bildung der Zygote gegeben sieht. Frühen Embryonen kann danach eine Teilhabe an der Menschenwürde nicht abgesprochen werden. Diese unterschiedlichen Auffassungen haben ihren Grund in verschiedenen geistigen Traditionen. Religiös-transzendentes Verständnis Die nach dem Grundgesetz unantastbare Würde des Menschen (Art. 1) konkretisiert sich nach Art. 2 im Recht auf Freiheit, Leben und körperliche Unversehrtheit, unabhängig vom Grad der Behinderung (Art. 3 Abs. 3.). Dieses Verständnis von Menschenwürde ist maßgeblich geprägt durch die jüdisch-christliche Vorstellung von der „Gottebenbildlichkeit“ des Menschen. Sie gründet in der beson- deren Beziehung Gottes zum Geschöpf Mensch. Der Mensch konstituiert sich weder in seinem Leben noch in seiner Würde selbst. Er „verdankt“ sein Leben, sein Personsein und seine Würde anderen, letztlich nicht den Eltern, sondern Gott. Demnach sind Personsein und Menschenwürde keine empirischen Qualitäten, sondern „transzendente“ Größen, die – von Gott her – dem ganzen Leben vom Beginn bis zum Tod zugesprochen sind. Kein menschliches Leben muss erst selbst den Erweis erbringen, dass es der Prädikate Person und Menschenwürde würdig ist. Deshalb muss ihm die Menschenwürde auch nicht erst von Menschen zuerkannt werden, vielmehr ist sie von allen Menschen zugleich mit dem Gegebensein von Leben anzuerkennen, unabhängig vom Grad seiner seelisch-geistigen Fähigkeiten. In dieser Begründung der Menschenwürde in „Transzendenz“, in Gott, ist der Grund zu suchen, dass alles Leben einer totalen ge- und verbrauchenden Verfügung von Menschen entzogen sein soll. Menschenwürde ist demnach keine empirische Größe, die im Mikroskop oder sonst wie sinnlich fassbar wäre.Fragt man nach dem „anatomischen Substrat“, dem die Menschenwürde nach dieser Sicht zukommt, so ist es die ganze Leiblichkeit, der Lebensträger (= Organismus). Wann organismisches Leben beginnt,kann nur auf der Grundlage der Erkenntnisse der Biologie ermittelt werden. Für die biologische Definition von individuellem Leben bei höheren Lebewesen mit geschlechtlicher Fortpflanzung sind folgende Kriterien entscheidend: (1) Es muss eine genetische Individualität vorliegen. Dieses Kriterium ist mit der 77 D O K U M E N T A T I O N Bildung der Zygote erfüllt. (2) Es muss ein zu einer Ganzheit integriertes, also organismisches Lebensgeschehen feststellbar sein, das in Interaktion mit seiner Umwelt (beispielsweise Eileiter, Gebärmutter) zu einer eigenständigen Lebensdynamik fähig ist (unter anderem Stoffwechsel,Wachstum). Es wird oft behauptet, frühe Embryonen erfüllten dieses Kriterium nicht, sie seien ein bloßer „Zellhaufen“.Aber die „Totipotenz“ der Zellen im frühesten Embryonalstadium widerspricht nicht der Erkenntnis,dass es sich von der Bildung der Zygote an um eine sich selbst organisierende und differenzierende funktionelle „Ganzheit“ handelt. Dass nur aus einem Teil dieser Zellen der Embryo, aus anderen der Trophoblast entsteht, widerspricht dem auch nicht, weil dieses Differenzierungsgeschehen nicht determiniert ist, man also nicht vorwegsagen kann, welche der totipotenten Zellen zu was werden. Schutzrechte des Embryos Wird die Menschenwürde dem ganzen Lebensträger zugesprochen, so können frühen Embryonen zumindest nicht die Teilhabe an der Menschenwürde und Schutzrechte ganz abgesprochen werden. Das grundlegende Recht ist dabei das Recht auf Leben. Es ist umstritten, inwieweit dieses christlich geprägte Verständnis von Menschenwürde ohne die religiösen Voraussetzungen zu begründen ist. Jedoch ist auch in der deutsches Rechtsverständnis maßgeblich prägenden Philosophie Immanuel Kants festgehalten, dass das Prädikat Person dem Menschen als „Natur- und Gattungswesen“ zuzuordnen ist. Zwar ist Kants Verständnis von Menschenwürde stark an der Freiheit orientiert, doch ist diese nach ihm ein Postulat der praktischen Vernunft, also eine „transzendente“ und keine empirische Größe. Eine grundsätzlich abweichende Sicht wird dann vertreten, wenn Personsein und Menschenwürde als empirisch feststellbare seelisch geistige Qualitäten des Lebens (zum Beispiel Selbstbewusstsein, bewusste Interessen) verstanden werden, wie es in der angelsächsischen positivistisch-empiristischen Philosophie der Fall ist, die die internationale Diskussion über Bioethik 78 prägt. Fragt man nach dem anatomischen Substrat, dem diese empirischen Qualitäten zuzuordnen sind, so ist es nicht mehr der ganze Lebensträger, sondern es sind nur bestimmte Bereiche des Großhirns. Dies besagt einerseits, dass dem Leben frühestens ab dem Zeitpunkt eine Teilhabe an der Menschenwürde zugesprochen werden kann, ab dem die entsprechenden Strukturen des Gehirns ausgebildet sind, und andererseits, dass deren Fehlen beziehungsweise Verlust infolge Krankheit gleichzusetzen ist mit dem Fehlen beziehungsweise Verlust des Personseins, das damit nur biologisch-menschliches Leben ist. Der Gedanke einer unverlierbaren und unverrechenbaren Menschenwürde allen menschlichen Lebens ist diesem Denkansatz fremd. Die Teilhabe an der Menschenwürde wird je nach Entwicklungsgrad des Lebens abgestuft gedacht. Da nicht mehr das Leben in sich, sondern nur die seelisch- geistigen Qualitäten zu schützen sind, kann Leben, sofern es noch nicht zum Besitz dieser Qualitäten herangereift ist (Embryonen, Feten) oder sie nie besessen (behindert Geborene) oder sie durch Krankheit verloren hat, gegen andere Güter und Interessen verrechnet werden. Mit abnehmender „Wertigkeit“ ist das Leben immer weniger zu schützen, darf es zunehmend als Mittel zum Zweck (zum Beispiel therapeutischer oder auch rein wissenschaftlicher Art) ge- und verbraucht werden. Nur auf der Basis eines empiristischen Menschenbilds kann man von frühen Embryonen als einem „Zellhaufen“ reden, da an ihm in der Tat im Mikroskop keine empirische Menschenwürde zu beobachten ist. Der Streit um die Forschung an Embryonen in Europa ist nicht zu verstehen ohne die aufgezeigten unterschiedlichen geistigen Traditionen. Es geht demnach um grundsätzliche Fragen des Menschenbilds und der Interpretation des Grundgesetzes. Entscheidungen, die für den Bereich der „fremdnützigen“ Forschung mit Embryonen gefällt werden, haben eine weit über diesen Fachbereich hinausgehende Bedeutung. Begründet man sie mit dem empiristischen Menschenbild, so werden damit zugleich negative Lebenswerturteile über menschliches Leben gerechtfertigt, und „minderwertiges“, angeblich bloß biologisch menschliches Leben wird in einer Güterabwägung verrechenbar gegen Interessen anderer. Dieses Vorgehen wird sich nicht auf früheste Stadien des Lebens begrenzen lassen, es wird – wenn die zu seiner Rechtfertigung angeführten therapeutischen und sonstigen Interessen stark genug sind – auch fortgeschrittene Lebensstadien, selbst geborenes Leben umfassen. Eine mit derartigen Argumenten gerechtfertigte therapeutische Forschung kann zur Aushöhlung des für den Schutz des Lebens fundamentalen Verständnisses von Menschenwürde führen. Es könnte sich erneut bewahrheiten, was der bedeutende Arzt Viktor von Weizsäcker anlässlich der „Nürnberger Ärzteprozesse“ schrieb, dass ein „transzendenzloses“, rein empirisches Verständnis des Menschenlebens zwangsläufig zur Vorstellung vom „lebensunwerten“ Leben führt und dass der ungeheure Kampf für die Gesundheit einerseits und der experimentelle und vernichtende Umgang mit „unheilbarem“ Leben andererseits nur die zwei Seiten ein und derselben Medaille seien, der Glorifizierung von Gesundheit und diesseitigem Leben.Wo der wissenschaftliche und therapeutische Fortschritt die vor allem für den Schutz der schwächsten Glieder der Gesellschaft grundlegenden Rechte,wie das angedeutete Verständnis von Menschenwürde, infrage stellt, muss die Gesellschaft bereit sein, auf mögliche therapeutische Fortschritte zu verzichten, und dies auch durch rechtliche Verbote einfordern. Die Gesundheit ist nicht das höchste und erst recht nicht das einzige zu schützende Gut. ❚ Zitierweise dieses Beitrags: Dt Ärztebl 2001; 98: A 899–900 [Heft 14] Literatur 1. Bayertz K: (Ed.) (1996) Sanctity of Life and Human Dignity, (Kluwer) Dordrecht (NL). 2. Eibach U: (2000) Menschenwürde an den Grenzen des Lebens, (Neukirchener Verlagshaus) NeukirchenVluyn. 3. Rager G (Hrsg.) (1998): Beginn, Personalität und Würde des Menschen, (Alber) Freiburg, 2. Aufl. Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. theol. Ulrich Eibach Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Bonn und Pfarrer an den Universitätskliniken Bonn Sigmund-Freud-Straße 25, Haus 30, 53105 Bonn E-Mail: [email protected] D O K U M E N T A T I O N Heft 27, 6. Juli 2001 DISKUSSION zu dem Beitrag Embryonenforschung in Europa Gesundheit ist nicht das höchste Gut von Prof. Dr. theol. Ulrich Eibach in Heft 14/2001 Keine stichhaltigen Argumente Der Verfasser argumentiert gegen die Embryonenforschung nach bewährtem Muster. Er begründet die Menschenwürde mit der Gottebenbildlichkeit des Menschen und behauptet, dass ohne religiöse Voraussetzungen das christlich geprägte Verständnis dieser Menschenwürde schwierig zu begründen sei, um dann nahezu übergangslos die „empiristische“ Position zu kritisieren, die nicht mehr den ganzen Menschen zum Subjekt der ethischen Betrachtung mache, sondern nur noch Teile des Großhirns. Ohne weiteres sieht er in dieser philosophischen Position einen schlüpfrigen Abhang, der über die Diskussion des „minderwertigen“ zum „lebensunwürdigen“ Leben führe. Leider enthält der ganze Artikel kaum einen Gedanken, den man als stichhaltiges Argument bezeichnen könnte. Denn wenn man das Verbot, frühe Embryonen zu „verbrauchen“, mit der Notwendigkeit der Befolgung eines göttlichen Willens begründet, so sind an diese Regelung mehrere Voraussetzungen geknüpft: Es müsste zum Beispiel ein Gott existieren, wovon viele Menschen nicht überzeugt sind, und dieser Gott müsste die Tötung von Embryonen verboten haben. Dass darüber hinaus noch zu fragen wäre, inwiefern wir Menschen diese Gebote zu befolgen hätten, soll hier nicht weiter diskutiert werden. Aber selbst wenn diese Voraussetzungen erfüllt wären, müsste noch die Frage beantwortet werden, wieso dieser göttliche Wille für Embryonen gültig wäre, nicht aber zum Beispiel für passive Sterbehilfe, Notwehr, Tötungen im Verteidigungskrieg oder sogar die Todesstrafe, die von der katholischen Kirche bekanntlich gebilligt wird. Darüber hinaus ist bei konsequenter Befolgung des Menschenwürdeprinzips, wie es Eibach vertritt, völlig unklar, wieso nicht massivster Widerstand gegen millionenfache Tötungen von unschuldigen Embryonen im frühen Stadium (durch Gebrauch von Intrauterinpessaren) vonseiten der offiziellen Kirchenvertreter erfolgt. Immerhin handelt es sich bei der Nichtbeachtung des Tötungsverbotes der Bibel um eine Todsünde, die nach zumindest katholischer Lehre den ewigen Tod in der Hölle bedeutet, wenn „sie nicht durch Reue und göttliche Vergebung wieder gutgemacht wird“ (Katechismus der katholischen Kirche 1993, 1860). Bei konsequenter Sichtweise wäre dann sogar der Einsatz des verstorbenen Apostelnachfolgers Dyba, der außer verbaler Kritik an der Abtreibung noch die Kirchenglocken zu unpassenden Zeiten betätigte, als zu gemäßigt zu qualifizieren. Hier bleibt also für Professor Dr. theol. U. Eibach noch einiges zu tun. Die von ihm konstruierte Verbindung „empiristische Philosophie“ und „lebensunwertes Leben“ dagegen bedarf eigentlich kaum eines Kommentars. Wer keine besseren Argumente hat, greift zum nächst verfügbaren: dem Dammbruchargument. Es ist deshalb bei Menschen, die gewohnt sind, wenig Zeit mit Nachdenken zu verbringen, so erfolgreich, weil es prinzipiell unwiderlegbar ist : Es ist nämlich keine ethische Entscheidung vorstellbar, die nicht zumindest theoretisch den Gefahren des Dammbruchs ausgesetzt wäre. Dr. med. Martin Klein, Hermann Hesse Weg 2, 97276 Margetshöchheim Zustimmung Ich kann den Ausführungen von Herrn Eibach nur vollstens zustimmen. Das starke Forschungsinteresse und das methodisch Interessante und Machbare dürfen unsere Gesellschaft nicht dazu verleiten, in ihren ethischen Grundsätzen unscharf zu werden. Je laxer wir mit der Definition des Lebens umgehen, desto stärker machen wir uns selbst zum „Schöpfer“ von Leben und Tod. Dies wäre ein fataler Irrtum. Auch kann es uns zum Bumerang im Alter werden, wenn uns das Recht auf Leben einmal verneint wird, zum Beispiel weil unsere „seelischgeistigen“ Qualitäten nachlassen. Dr. med. Mathias Brinschwitz, Georg-Voigt-Straße 21, 35039 Marburg Widersprüche Ohne die grundsätzlichen Feststellungen Eibachs zur Unantastbarkeit der Menschenwürde infrage stellen zu wollen, sehe ich doch in zwei Punkten seiner Ausführungen Widersprüche: Eibach äußert, Voraussetzung für „individuelles Leben“ sei, dass „ein zu einer Ganzheit integriertes, also organismisches Lebensgeschehen feststellbar sein (muss), das in Interaktion mit seiner Umwelt (beispielsweise Eileiter, Gebärmutter) zu einer eigenständigen Lebensdynamik fähig ist (Stoffwechsel, Wachstum)“. Nun liegt es aber auf der Hand, dass das nach der Befruchtung entstehende Zellkonglomerat ohne Nidation nicht lebensfähig ist. Wird die Nidation durch natürliche oder künstliche Umstände verhindert, geht der Zellverband zugrunde. Eibach wendet sich gegen den Standpunkt der Abhängigkeit einer Teilhabe an der Menschenwürde von der Entwicklung bestimmter Bereiche des Großhirns. Es besteht aber spätestens seit der Verabschiedung des Transplantationsgesetzes vom 5. November 1997 ein allgemeiner Konsens, dass mit dem Hirntod der Individualtod des Menschen eingetreten ist und danach Teile des menschlichen Organismus für medizinische Zwecke verwendet werden dürfen. Wenn man also der Linie Eibachs konsequent folgen wollte, verstieße sowohl der Gebrauch der Spirale zur Empfängnisverhütung als auch die Organentnahme zu Transplantationszwecken beim hirntoten Organismus gegen die Menschenwürde. Meines Erachtens muss ein ethisches Prinzip unabhängig von seinen Wurzeln in sich schlüssig sein, um den Anspruch 79 D O K U M E N T A T I O N allgemeiner Verbindlichkeit erheben und als Vorgabe für den Gesetzgeber dienen zu können. Prof. Dr. med. habil. H. W. Opderbecke, Kesslerplatz 10, 90489 Nürnberg Präventivmedizinische Aufgabe In seinem Beitrag fordert Eibach, dass Gesundheit beziehungsweise ihre Wiederherstellung nicht durch Verletzung der Menschenwürde erkauft werden dürfe. Damit wird auf ein immer auffälliger werdendes Grundproblem in der Medizin hingewiesen, dass nämlich Gesundheit und Menschenwürde, anstatt sich zu ergänzen, in ein gegensätzliches, beinahe sich ausschließendes Verhältnis zueinander geraten könnten. Während die medizinischen, die Menschenwürde verletzenden Übergriffe im Nationalsozialismus sowohl ethisch als auch rechtlich klar bewertet werden konnten, ist die Frage nach der Verletzung der Menschenwürde heute offensichtlich nicht eindeutig zu beantworten, wenn es um das Forschen an Embryonen, aber auch um menschliches Klonen oder um Babys nach Maß usw. geht. Ein solches Auseinanderdriften von Gesundheit und Menschenwürde bedeutet aber, die Gesellschaft einer Zerreißprobe auszusetzen. Abgesehen von dem verfassungsrechtlichen Gebot zur Menschenwürde (Art. 1. Abs. 1 des Grundgesetzes) wäre die Gesundheit nur noch ein zweifelhaftes Gut, wenn sie zu dem Verständnis von Menschenwürde in einem Widerspruch stünde. Der Medizin sollte es vielmehr darum gehen, die gemeinsame Schnittfläche von Gesundheit und Menschenwürde zu fassen und diese für das medizinische Handeln und Forschen zu erschließen. Die wirklich strittige Frage ist aber, wie Eibach hervorhebt, welche Auffassung von Menschenwürde denn nun bei den anstehenden Entscheidungen in der medizinischen Forschung und Therapie gelten soll: die religiös-transzendentale oder die positivistisch-empirische. Es mag aus medizinisch-naturwissenschaftlicher Sicht schwer fallen, anstelle von empirisch begründbaren theologische Argumente zu übernehmen. Nach Spaemann ist es aber die re- 80 ligiös-metaphysische Dimension der Würde, die dem menschlichen Leben die herausgehobene Wertigkeit verleiht. „Es ist ein auch heute noch nicht ganz ausgestorbener Irrtum, man könne die religiöse Betrachtung der Wirklichkeit fallenlassen, ohne dass einem etliches andere mit abhanden kommt, auf das man weniger leicht verzichten möchte“, schreibt er in seinem „Über den Begriff der Menschenwürde“ betitelten Aufsatz (Spaemann, 1987). Ganz unabhängig von den ethischphilosophischen oder theologischen Aussagen zur Frage, ob Embryonen Menschenwürde zusteht, müssen auf jeden Fall die hier relevanten medizinischepidemiologischen Zusammenhänge, wenn es doch um Gesundheit geht, beachtet werden. Wie zahlreiche sozialmedizinisch-epidemiologische Untersuchungen ausweisen, steht das Schutzziel Gesundheit mit anderen Wertebereichen in einem engen Bedeutungsund Funktionszusammenhang. Natürlich sind es Menschenwürde – im Gegensatz zum Menschenhass –, aber auch Selbstwertgefühl, Bedeutsamkeit und Sinnhaftigkeit, die soziale und biologische Lebenszusammenhänge durchdringen und Gesundheit des einzelnen und der Allgemeinheit fördern (Antonovsky, 1997). Diese Qualitäten, nur weil sie naturwissenschaftlich unzugänglich sind oder weil auch Gelehrte über ihre Bedeutung streiten mögen, nun dem Menschen dort vorzuenthalten oder auszureden, wo er sie nicht gerade expressis verbis beansprucht und erkämpft, führt vor allem zur Schwächung gesundheitsfördernder Systemzusammenhänge. Durch Zuweisung von Menschenwürde und von Achtung vor Mensch und Natur (dazu zählen Embryonen) ist uns – Art.1. Abs.1 GG außer Acht lassend – eine Möglichkeit und Chance gegeben, eine bestimmte soziale Wirklichkeit zu erzeugen und dadurch Wohlbefinden und gesundheitsfördernde Lebensbedingungen zu schaffen. Diese Möglichkeit zu nutzen, ist eine präventivmedizinische Aufgabe, sie ungenutzt zu lassen, bedeutet ein Weniger an Gesundheit. Literatur beim Verfasser Prof. Dr. med. Hartmut Dunkelberg, Abteilung Allgemeine Hygiene und Umweltmedizin der Universität Göttingen, Windausweg 2, 37073 Göttingen PID „Ein Verfahren zur Selektion“ Bei der Präimplantationsdiagnostik (PID) handelt es sich nach Auffassung der Organisation „Ärzte für das Leben“ (ÄfdL) ausschließlich um ein Selektionsverfahren. Die Organisation lehnt deshalb in einer Stellungnahme den „Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik“ des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer ab. Sie befürchtet, dass durch die Einführung der PID gesellschaftliche Vorurteile gegen Behinderte verstärkt werden und dass sich die Tendenz verhärtet, „im behinderten Mitmenschen allein den ,Belastungsfaktor‘ zu sehen, statt ihn als prinzipiell Gleichberechtigten zu achten“. Die Äfdl befürchtet, dass das Lebensrecht behinderter Menschen infrage gestellt werden könnte. Die Verfahren der Invitro-Fertilisation seien deshalb auf Fälle der Sterilitätsbehandlung zu beschränken. Ein ursprünglich ärztliches Behandlungsverfahren dürfe nicht zu Selektionszwecken missbraucht und zu eugenischen Handlungsspielräumen erweitert werden. Wenn erblich schwer belastete Paare einen dringenden Kinderwunsch äußerten, empfiehlt die Organisation die Adoption als eine humane Alternative. Ein Recht auf ein gesundes Kind gibt es nach Auffassung der Ärzte für das Leben nicht. Jeder ungeborene und geborene Mensch habe ein persönliches Recht auf Leben. Zwar fordere auch der Diskussionsentwurf strenge Bestimmungen, doch diese könnten schnell überholt werden, befürchten die Ärzte für das Leben. Sie lehnen auch die verbrauchende Embryonenforschung ab. Die Verfahren der künstlichen Befruchtung müssten vor einer solchen Möglichkeit rechtlich über das Embryonenschutzgesetz abgesichert bleiben. Die ÄfdL fordert, den Gesetzestext so zu formulieren, dass Missdeutungen nicht mehr möglich sind. Der gesamte Text der Stellungnahme kann abgerufen werden unter www. Kli aerzte-fuer-das-leben.de D O K U M E N T A T I O N Heft 15, 13. April 2001 N ach der Äußerung der EnqueteKommission des Deutschen Bundestags scheint festzustehen, dass ohne eine Gesetzesänderung Präimplantationsdiagnostik (PID) in Deutschland nicht möglich sein wird. Damit ist der Weg frei für eine tief greifende Debatte, die Zeit der Taktiererei ist vorbei. In der nun anstehenden Debatte werden auch die Motive der Akteure von Interesse sein. Gerade bei Menschen, die in ethischen Debatten eher unerfahren sind – was niemandem vorzuwerfen ist –, bestimmen oftmals das Ziel, der Wunsch, das Wollen auch die Argumente. Doch ethische Grundprinzipien bestimmen das Gewicht der Argumente, nicht umgekehrt. In der Diskussion mit Gesundheitspolitikerinnen – vor allem der SPD – ist mir ein Argument immer wieder vorgehalten worden, mit dem man sich intensiv auseinander setzen muss: PID sei eine Form des Selbstbestimmungsrechts der Frau. („Mein Bauch gehört mir.“) Hinter der PID-Debatte stehe die Fortsetzung des Befreiungskampfes der Frau in unserer Gesellschaft. Verkürzt gesagt, Politikerinnen, die noch geprägt sind von der Abtreibungsdebatte der 70er- und 80er-Jahre, vermuten einen Rückschritt hinter die Positionen, die sie mühsam erkämpft haben. Wieder einmal sehen wir, wie viele Zusammenhänge es zwischen der §-218-Debatte und der PID gibt. Aus der Sicht der reinen Ethik war und ist der § 218 ein Sündenfall. Und doch: Mit diesem Bruch müssen wir alle leben, denn die Neuregelung des § 218 hat zugleich Millionen Frauen aus Abhängigkeit, Zweifel und Not befreit. Das muss gesellschaftlich anerkannt und akzeptiert werden. Bei der PID hingegen geht es nicht um Millionen Frauen, sondern höchstens um 50 bis 100 Paare. Ihnen soll auch nicht das Recht auf Schwangerschaftsabbruch genommen werden – alle Methoden der pränatalen Diagnostik und die daraus abzuleitenden Indikationen zum straffreien Schwangerschaftsabbruch stehen ihnen nach wie vor offen. Und schließlich, Regine Kollek; die Hamburger Medizinethikerin wird nicht müde, darauf hinzuweisen, dass gerade die Anwendung der PID Frauen noch mehr belasten kann als der Verzicht. Schließlich muss eine IVF mit all ihren PID Motivsuche technischen und hormonellen Manipulationen, ihren Imponderabilien und Risiken an Frauen vorgenommen werden, die in der Lage sind, ihre Kinder auf normalem Wege zu konzipieren. Insofern hat also der Verzicht auf PID nichts mit einer Einschränkung der Rechte von Frauen zu tun, schon gar nichts mit einem Zurückdrehen der aus dem § 218 abgeleiteten Frauenrechte. Unser Bundeskanzler, Gerhard Schröder, hat sich nun auch in letzter Zeit intensiv um das Thema gekümmert. Was treibt ihn auf dieses ethisch schwierige Feld? Hier gibt es nur Vermutungen, die sich aus seinen sonstigen Aktivitäten ableiten lassen. Schröder ist ein Politiker, der immer dann aktiv wird, wenn > große Populationen betroffen sind, > das Thema weite Bevölkerungsbereiche anspricht, > wissenschaftliche Möglichkeiten und Freiheitsräume eingeschränkt werden oder > wirtschaftliche Interessen tangiert sind. Nimmt man die Ankündigungen ernst, dass die PID auf wenige schwerwiegende Indikationen beschränkt bleiben soll, dann werden weder große Populationen betroffen sein, noch wird die PID, ausgeführt an 50 bis 100 Paaren jährlich, ein wirtschaftlich nennenswertes Feld werden. Diese Argumente scheiden also aus. Auch ist die Bevölkerung, das belegen alle Umfragen, mehrheitlich gegen alle Manipulationen am Embryo, auch gegen PID. Durch die Erklärung zur „Chefsache“ ist hier also auch kein „politischer Blumentopf“ zu gewinnen. Wissenschaftlich ist die PID ein seit rund zwanzig Jahren bekanntes Verfahren. In der Biologie, an Tieren schon viel verwendet, selbst am Menschen (im Ausland) längst erprobt. Wissenschaftlich also auch nichts Neues! Bleibt die Frage nach übergeordneten wirtschaftlichen Motiven. Wir wissen, dass der Kanzler auch eine intensive De- batte um die Verwendung von embryonalen Stammzellen und „therapeutisches Klonen“ angestoßen hat. Der Kanzler selber scheint diesen Methoden offener gegenüberzustehen als weite Teile der Bevölkerung. Er hat großes Interesse an biotechnologischen Verfahren und will diese befördern. Ihn treiben dabei vorrangig wirtschaftspolitische Motive. Er ist sich der Tatsache bewusst, dass die Verwendung embryonaler Stammzellen heute noch vom Embryonenschutzgesetz verboten ist. Für eine Änderung dieser Bestimmung bestehen zurzeit weder Mehrheiten im Parlament noch in der Bevölkerung. Würde man aber die PID – am unauffälligsten, und deshalb von politischen Befürwortern der PID am liebsten gesehen, durch untergesetzliche Regelung über eine Richtlinie der Bundesärztekammer – zulassen, würde ein offener logischer Bruch entstehen, dass Embryonenmanipulationen und Verbrauch von Embryonen zum Nutzen einzelner Paare zwar zulässig, Forschung zur Heilung ganzer Volkskrankheiten (so zumindest die euphorischen Heilsversprechungen mancher Wissenschaftler) aber verboten bliebe. In die Debatte um die ethischen Probleme an Anfang und Ende des Lebens wäre eine weitere Irrationalität eingeführt, die uns weg von der reinen Ethik hin zu einer pragmatischen Moral führt. Im Klartext: Ich befürchte, dass das Engagement des Kanzlers vor allem ein dialektischer Trick ist, da ihm längst bewusst geworden ist, dass mit der Zulassung der PID auch die Vorbehalte gegen embryonale Stammzellforschung und therapeutisches Klonen fallen werden. Damit aber wäre die Tür geöffnet für ein wissenschaftliches und wirtschaftliches „Eldorado“ – dann gäbe es kein Halten mehr. Dr. med. Frank Ulrich Montgomery Der Verfasser ist Präsident der Ärztekammer Hamburg und 1. Vorsitzender des Marburger Bundes. 81 D O K U M E N T A T I O N Heft 20, 18. Mai 2001 Präimplantationsdiagnostik „Eine SiegerBesiegten-Stimmung darf nicht aufkommen“ Interview mit Professor Dr. med. Jörg-Dietrich Hoppe, dem Präsidenten der Bundesärztekammer und des Deutschen Ärztetages, über PID, PND, Embryonenschutz und die Haltung der Ärzteschaft DÄ: Seit knapp eineinhalb Jahren läuft der von der Ärzteschaft angestoßene gesellschaftliche Diskurs über die Präimplantationsdiagnostik, ausgehend von dem Diskussionsentwurf einer Richtlinie des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer. Hat die öffentliche Diskussion Sie beziehungsweise die Bundesärztekammer in der Entscheidungsfindung vorangebracht? Hoppe: Wir haben diesen Diskurs ja nicht primär angestoßen, sondern vielmehr eine mehr im Verborgenen stattfindende Diskussion öffentlich gemacht. Damals, nach dem Regierungswechsel, hatte die neue Bundesregierung gesagt, sie wolle das Thema gesetzlich regeln. Und wir wollten, dass niemand sagen kann, er habe nicht gewusst, um was es geht, wenn die Entscheidungen des Gesetzgebers gefällt werden. Dieses Ziel haben wir erreicht. Die Probleme um die Präimplantationsdiagnostik, aber auch die weitergehenden Komplexe wie Stammzellzüchtung, Embryonenforschung, Embryonenverbrauch sind in der Öffentlichkeit mittlerweile sehr bekannt. DÄ: Wie aber steht es um den Entscheidungsprozess innerhalb der Ärzteschaft? Hoppe: Auch bei uns selbst ist die Diskussion weitergegangen. Wir sind uns aber klar darüber, dass man über etliche Konfliktfelder nicht nach Mehrheitsbildung innerhalb der Ärzteschaft abstimmen kann. Wir können Rat erteilen, können die Alternativen benennen, die sich ergeben, und können so die Gesellschaft vorbereiten, um eine Mehrheitsbildung im politischen Raum zu beschleunigen oder überhaupt erst möglich zu machen. DÄ: Haben diese langen Diskussionen und das Abwarten nicht dazu geführt, dass das Thema PID schon fast verlassen worden ist und inzwischen über die von Ihnen erwähnten weitergehenden Möglichkeiten laut nachgedacht wird, siehe die jüngste Stellungnahme der DFG zugunsten der embryonalen Stammzellforschung? Hoppe: Die Stammzellforschung ist nicht neu und auch nicht mehr aufzuhalten. Es handelt sich um eine weltweit stattfindende Entwicklung, die man dadurch, dass Deutschland sich aus dieser Diskussion heraushalten würde, nicht verhindert. In Hinblick auf die Zielsetzung der Forschung mit embryonalen Stammzellen sehe ich auch keinen direkten Zusammenhang mit der PID. Eine gemeinsame Zielsetzung erkenne ich vielmehr bei Präimplantationsdiagnostik, Pränataldiagnostik und Reproduktionsmedizin. Eine losgelöste Diskussion um Präimplantationsdiagnostik mit der Zielrichtung, allein diese zu verbieten, die PND aber nicht, halte ich für einen logischen Bruch. Bei uns geht es auch um die Frage, ob Präimplantationsdiagnostik denjenigen Paaren angeboten werden soll, die sonst eine „Schwangerschaft auf Probe“ eingehen würden. DÄ: Meine Frage zielte in eine andere Richtung. Um sie zu präzisieren: Ist PID nur ein Einfallstor für weitergehende Forschung, die zurzeit noch verboten ist? Hoppe: Nein. Ich denke, dass die PID auch bei denjenigen, die sie entwickelt haben und die sie heute in anderen Ländern anwenden, nur darauf zielt, den Paaren, die eine Erblast mit sich tragen, zu einem gesunden Kind zu verhelfen. Wenn man diese Diagnostik nicht zulässt, bedeutet das, dass man diese Paare implizit PID = Präimplantationsdiagnostik PND = Pränataldiagnostik IVF = In-vitro-Fertilisation DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft Frau Däubler-Gmelin = Bundesjustizministerin Frau Fischer = frühere Bundesgesundheitsministerin auf Pränataldiagnostik im Sinne der Schwangerschaft auf Probe verweist. Darin sehe ich das Problem. Wenn man diesen Zusammenhang verneint und sagt, mit PID solle der Weg zur Stammzellforschung und weiteren genetischen Forschung geebnet werden, und gäbe es dafür Beweise, dann würde ich sagen: Nehmen wir in Gottes Namen die Pränataldiagnostik mit Spätabtreibung in Kauf und lassen PID nicht zu. Aber ich sehe den Zusammenhang so nicht. DÄ: Sind Sie demnach guter Hoffnung, dass man die PID mit ganz engen Indikationen und unter strengen Kriterien einführen kann, ohne dass das zu Weiterungen führt? Hoppe: Ja, da bin ich sicher – wenn man PID unter Kontrolle hält. Eine solche Kontrolle muss gewährleistet sein, andernfalls sehe ich die Gefahr des Missbrauchs bis hin zur Menschenzüchtung. DÄ: PID enthält als Grundgedanken die Auswahl nach lebenswertem und lebensunwertem Leben. Dieser Grundgedanke könnte, wenn er bei der PID gesellschaftlich akzeptiert wird, auch auf andere Lebenserscheinungen übertragen werden. Oder ist es ein purer Zufall, dass parallel mit der PID-Diskussion auch eine Diskussion über die Beendigung des Lebens im Alter geführt wird, nicht nur in Holland, sondern auch bei uns? Hoppe: Die Euthanasiediskussion ist wesentlich älter als die Diskussion über PID. Sie läuft mit wechselnden Höhen und Tiefen schon seit Mitte der 70er-Jahre. Im Moment erleben wir ein besonderes Interesse vor allem infolge der Diskussion in Holland. Zweifelhafte Umfragen heizen die Stimmung zusätzlich an. Doch wenn die deutschen Bürgerinnen und Bürger konkret gefragt würden und genau wüssten, was hier gemeint ist, dann würde in Deutschland mit Sicherheit Euthanasie in dieser Form, wie sie in Holland geübt wird, also Einschläferung von Menschen, von denen man meint, dass sie kein lebenswertes Leben mehr führen, abgelehnt werden. Ich glaube, die Diskussionen um PID und Sterbehilfe werden eben doch unabhängig voneinander geführt. Die PID sehe ich genauso wie die PND primär nicht als selektive Methode, sondern als eine Methode, erbbelasteten Eltern zu einem gesunden Kind zu verhelfen. Man kann das ablehnen und empfehlen, Paare, die eine schwere erbliche Belastung mit sich tragen, sollten auf Kinder verzichten. Mir wäre am liebsten, wenn das so wäre. Aber diese Auffassung ist längst nicht mehr gesellschaftsfähig, seit die IVF zugelassen ist und Pränataldiagnostik durchgeführt wird mit dem Ziel, intrauterin eine Erbschädigung bei Kindern festzustellen und 83 D O K U M E N T A T I O N diese Kinder dann abzutreiben. Nachdem dazu offensichtlich ein gesellschaftlicher Konsens besteht, ist PID nur eine Alternative zur PND. Diese ganze Diskussion wäre im Übrigen überflüssig, wenn wir in unserer Gesellschaft Behinderung ohne Wenn und Aber akzeptieren würden. Damit hätten wir eine ganz andere Bewusstseinslage, dann müssten aber sowohl PID als auch PND mit dieser Zielsetzung in Deutschland verboten werden. DÄ: Wenn man aus ethischen Erwägungen PND ablehnt, müsste man konsequenterweise auch gegen PID sein? Hoppe: Ja, und umgekehrt. DÄ: Sie verweisen immer wieder auf diesen Zusammenhang von PND und PID und argumentieren: Wenn wir PND zulassen, dann müssen wir auch PID zulassen. Ist das nicht eine selbst gebaute Falle? Denn niemand wird PND verbieten, nachdem sie einmal eingeführt ist; konsequenterweise müsste dann auch, wenn man Ihrer Logik folgt, PID zugelassen werden. Hoppe: Ich sehe das nicht als Falle, ich sehe das als eine logische Konsequenz. Wenn man allein PID verbietet, hat man nicht die Welt in Ordnung gebracht. Ich will nicht alleine PID nicht, ich will auch PND nicht. Denn wenn man nur PID nicht will, dann verstärkt man PND, denn PND ist dann die Methode der Wahl, oder PID-Auslandstourismus wäre dann die Alternative. Und das kann doch nicht richtig sein. DÄ: Müssten Sie dann nicht sowohl gegen PID als auch gegen PND zu Felde ziehen? Hoppe: Das tue ich ja. Ich verweise bei allen Gelegenheiten auf den direkten Zusammenhang zur PID und PND. Das darf man nicht getrennt voneinander betrachten. DÄ: Rübergekommen ist: PND und PID sind eng verwandt, und wenn wir PND haben, müssen wir PID zulassen. Deshalb die Bemerkung von der selbst gebauten Falle. Hoppe: Nein, ich argumentiere so, weil ich nicht nur PND, sondern den ganzen Paragraphen 218 neu diskutieren will. Ich halte auch die Argumentation von Frau Däubler-Gmelin für völlig richtig, die sagt, wir kommen gar nicht umhin, in diesem Zusammenhang den 218 erneut zu diskutieren. Frau Fischer wollte das ja nicht. Frau Fischer wollte ich dazu bringen, PND neu zu überdenken, denn man kann nicht schlüssig der Öffentlichkeit klar machen, dass man gegen PID ist, und PND unberührt lassen. Wenn man es nicht mehr schafft, PND zurückzudrängen, wird sich auch PID etablieren. Das würde ich sehr schweren Herzens ertragen wie damals, als PND zugelassen wur- 84 de und wie die Entwicklung des 218 überhaupt. Wer allerdings dagegen sagt: Wir verbieten PID, und dann ist unser Gewissen entlastet, macht es sich zu einfach. Und dieser Switch, PID sei nur das Einfallstor für Stammzellforschung, ist künstlich, ein Stimmungsargument, aber für mich nicht überzeugend. DÄ: Aber es passt ins Bild, in dem PID nur ein Teil ist; dazu gehört auch verbrauchende Embryonenforschung. Die DFG hat diese gerade befürwortet. Wenn sich die Politik dem anschließt, dann muss es zu einer Änderung des Embryonenschutzgesetzes kommen.Wenn das geändert wird, dann ist vieles frei. Hoppe: Auch für PID müsste das Embryonenschutzgesetz geändert werden. DÄ: Der Auffassung war der Wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer aber nicht. Hoppe: Ja, damals. Ich bin seit geraumer Zeit der Meinung, dass man das Embryonenschutzgesetz auf jeden Fall ändern müsste, wenn PID zugelassen werden soll, weil damit rechtliche Klarheit geschaffen wird. DÄ: Nehmen wir einmal an, das Embryonenschutzgesetz würde geändert, vielleicht im Sinne von PID, vielleicht aber auch zugunsten verbrauchender Embryonenforschung. Glauben Sie, dass es dann zu einer Stellungnahme der Ärzteschaft kommen wird, oder bleibt die Ärzteschaft dabei, wie Sie eben sagten, Alternativen und deren Folgen aufzuzeigen und die Diskussion zu moderieren? Hoppe: Ich glaube, dass wir als Ärzte immer wieder klarstellen müssen, dass es nicht so sein darf, dass Menschen selbst im frühesten Stadium ihrer Entwicklung, also von der Verschmelzung der Gameten an, für andere Menschen verfügbar gemacht werden dürfen. Es darf nie sein, dass Menschen für den Heilungsprozess anderer ausgenutzt werden. Deswegen müssen wir die Forschung mit adulten Stammzellen fördern oder die ja auch in der Diskussion befindliche Variante einer Umlenkung der Entwicklung des noch nicht befruchteten und noch nicht verschmolzenen Eies in Richtung der Produktion von Stammzellen. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, es sei möglich, im Vorkernstadium, ohne Erzeugung eines Embryos im Sinne unserer Definition, bereits Stammzellen zu produzieren, die funktionstüchtig sind. Das wäre dann keine verbrauchende Embryonenforschung. Wenn die Technik gelingen sollte, bliebe zwar unser Verständnis vom menschlichen Leben unverändert, wie wir das bei adulten Stammzellen erreichen wollen, nämlich ohne die Produktion von menschlichem Leben verursacht zu haben, das nur als Organbank dient. DÄ: Demnach wäre es vorschnell, wenn der Gesetzgeber durch Änderung des Embryonenschutzgesetzes die Gewinnung von embryonalen Stammzellen fördern würde. Er würde dann solche alternativen Forschungen behindern, indem er jetzt den einfacheren Weg eröffnet. Hoppe: Man sollte alles unternehmen, um die beiden alternativen Wege zu fördern und alles andere gesetzgeberisch erst einmal nicht zuzulassen, damit man den Druck nicht herausnimmt, in die beiden anderen Richtungen weiterzukommen. DÄ: Zwei eher praktische Fragen: Was wird aus dem Richtlinienentwurf des Wissenschaftlichen Beirates, kommt er als Richtlinie, oder bleibt er als Diskussionsentwurf liegen? Hoppe: Wenn die PID zugelassen wird, also das Embryonenschutzgesetz so geändert wird, dass diese Methode erlaubt wird, dann sind wir bereit, bei der späteren Operationalisierung eine entsprechend adaptierte Richtlinie auszuarbeiten, ähnlich wie bei der Pränataldiagnostik. Wenn PID in Deutschland eindeutig verboten bleibt, dann wird der Entwurf als Diskussionsgrundlage zurückgezogen, das Thema hat sich damit erübrigt. DÄ: Beim kommenden Deutschen Ärztetag werden die Themen PID und Embryonenforschung sicher zur Sprache kommen. Nehmen wir an, der Ärztetag wollte dazu Beschlüsse fassen. Sollte er oder sollte er es bleiben lassen? Hoppe: Ich glaube, wir müssen auf dem Ärztetag erst einmal die Zusammenhänge klarstellen und dort, wo sich aus ärztlicher Sicht eine klare Meinung und auch eine klare Hilfe für die Entscheidungsfindung in der Öffentlichkeit formulieren lässt, sollte der Ärztetag sich äußern. Eine Abstimmung über ethische Themen auf dem Ärztetag, und das werden die Delegierten-Kolleginnen und -Kollegen auf dem Ärztetag sicher selbst wissen, darf niemals dazu führen, dass es eine Sieger-Besiegten-Stimmung gibt. DÄ: Eine abschließende Frage: In Schröders Nationalem Ethikrat ist die Ärzteschaft als gesellschaftliche Gruppe nicht vertreten. Stört Sie das? Hoppe: Nein, das stört mich nicht. Ich sehe den Ethikrat auch nicht so sehr als aus gesellschaftlichen Gruppen zusammengesetzt, sondern mehr aus Professionen, und die Ärzteschaft ist insofern auch fachkundig vertreten. Wenn die Ärzteschaft dort quasi als Körperschaft vertreten wäre, wären derjenige oder diejenige, die dort tätig sein würden, ja an Gremienentscheidungen gebunden und damit in einer Konfliktsituation, die man dem oder der Betreffenden nicht wünDÄ-Fragen: Norbert Jachertz schen kann. D O K U M E N T A T I O N Heft 21, 25. Mai 2001 Gestaffeltes Schutzkonzept D ie Präimplantationsdiagnostik (PID) zählt zu den umstrittensten Bereichen der modernen Gentechnologie. Welche Vorgaben für die normative Einhegung der PID möglich oder sogar geboten sind, beantwortet sich vor allem nach den Bestimmungen des Verfassungsrechts.Als kollidierende Rechte stehen sich Berechtigungen der Eltern einerseits und des in vitro erzeugten Embryos andererseits gegenüber. Mitunter zeichnet sich die aktuelle Debatte durch erstaunliche Argumentationskünste der Protagonisten beziehungsweise durch den Rückgriff auf recht abwegige verfassungsrechtliche Konstruktionen aus. So gewährt zwar das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG und Art. 1 Abs. 1 GG – ebenso wie der Schutz der Ehe nach Art. 6 Abs. 1 GG – den Eltern das Recht, über die eigene Fortpflanzung zu bestimmen. Diese Berechtigung erfasst aber lediglich die Entscheidung über das „Ob“ der Fortpflanzung. Ein vermeintliches Recht der Eltern, nur gesunde Kinder zu haben, wird hingegen nicht begründet. Ebenso wenig räumt das allgemeine Persönlichkeitsrecht den Eltern einen Anspruch auf Kenntnis der genetischen Information des Embryos ein. Da der Embryo ein eigenständiges Rechtssubjekt darstellt, endet hier das elterliche Selbstbestimmungsrecht. Einschlägig sind lediglich die fundamentalen Verbürgungen der Menschenwürde sowie des Rechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit. So berührt ein Verbot der PID das der Mutter über Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG gewährleistete Recht auf körperliche Unversehrtheit, wenn die Frau nach der Implantation aufgrund der in Ermangelung einer Präimplantationsdiagnostik nicht vorab diagnostizierten Behinderung des Kindes physische oder, aufgrund des Wissens um die Behinderung, psychische Nachteile erleidet. Umgekehrt führt die gesetzliche Gestattung der PID zu einer Aktivierung staatlicher Schutzpflichten. Eine Schutzpflicht kommt dem Staat nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts insbesondere beim Schutz des ungeborenen Lebens vor den Eingriffen Dritter zu. Ebenso gilt es, die Würde des Embryos zu schützen, wobei aber kein lückenloser, sondern lediglich ein effektiver Schutz erforderlich ist. Eine gesetzliche Regelung der PID muss die genannten Rechtsgüter zu einem gerechten Ausgleich bringen. Welchen Mindestanforderungen ein solcher Ausgleich grundsätzlich zu genügen hat, wurde vom Bundesverfassungsgericht vor allem im Hinblick auf die Abtreibungsproblematik ausführlich dargelegt. Diese flexible Konzeption muss zur Vermeidung anderenfalls drohender Verwerfungen in der Systematik des verfassungsrechtlichen Lebensschutzes analog auf den Bereich der PID übertragen werden. Eine gesetzliche Regelung hat sich an den folgenden Eckpunkten zu orientieren: Die Selektion eines Embryos aufgrund PID ist infolge der staatlichen Schutzpflicht gesetzlich zu verbieten. Die ebenfalls zu berücksichtigende Grundrechtsposition der Frau führt dazu, dass es in Ausnahmesituationen zulässig ist, Ausnahmetatbestände von einem solchen grundsätzlichen Verbot vorzusehen. Ein solcher Fall besteht jedenfalls dann, wenn eine ernste Gefahr für das Leben der Frau oder das Risiko einer schwerwiegenden Beeinträchtigung ihrer Gesundheit zu befürchten ist. Gleiches gilt für den Fall einer drohenden besonders schwerwiegenden Behinderung des Kindes. Nur ein derartiges gestaffeltes Schutzkonzept vermag die erforderliche Abwägung der betroffenen Rechtspositionen zu geDr. jur. Tade M. Spranger währleisten. Heft 22, 1. Juni 2001 104. Deutscher Ärztetag Gespanntes Abwarten D ie CDU steckt in dem gleichen Dilemma wie alle großen Organisationen, die ein weites Meinungsspektrum in sich vereinen und sich nunmehr zu Gendiagnostik und Embryonenforschung äußern müssen. Da gibt es einerseits die Befürworter einer liberalen Handhabung, die unser Land nicht vom tatsächlichen oder vermeintlichen Fortschritt abkoppeln wollen, und da gibt es andererseits jene, die auf tradierten Grundwerten bestehen und befürchten, mit Präimplantationsdiagnostik werde der Weg zur Menschenselektion beschritten und mit Embryonenforschung werde bewusst die Tötung von Menschenleben in Kauf genommen. Die CDU-Spitze, die am 28. Mai stundenlang beraten hat, hat schließlich den bewährten taktischen (Aus-) Weg eingeschlagen: Man bekräftigt das Bekenntnis zu den Grundwerten, man erklärt das Leben von Anfang an für schutzwürdig, man lehnt ganz eindeutig ab, was alle ablehnen, nämlich Klonen und Embryonenforschung aus schnöder Gewinnsucht, und hält sich bei den wirklich umstrittenen Fragen die Türen offen. PID lehnt die CDU „nicht grundsätzlich“ ab, wohl aber deren eugenische Ausnutzung. Sie weiß indes nicht so recht, wie das zu bewerkstelligen ist, und spricht sich für eine weitere offene Diskussion aus. Sie wartet zunächst mal ab. Das Verhalten der CDU gleicht auffallend dem der Ärzteschaft. Auch die steckt nämlich in jenem Dilemma, auch sie muss gegensätzliche Meinungen miteinander vereinbar machen – doch die Kundigen ahnen, dass das letztlich nicht geht. Am Ende könnten mit verschämter Freude jene stehen, denen der „Durchbruch“ gelungen ist, und auf der anderen Seite jene mit tapferer Miene, die „alles versucht“ haben. Bis auf weiteres setzt die Ärzteschaft auf gesellschaftliche Diskussion und wartet gleichfalls ab. Sie lehnt, abzulesen an Beschlussfassungen des jüngsten Deutschen Ärztetages, Embryonenforschung, wie sie jüngst die Deutsche Forschungsgemeinschaft befürwortet hat, 85 D O K U M E N T A T I O N Heft 22, 1. Juni 2001 ab. Allerdings – den Beschluss gilt es aufmerksam zu lesen: Die Ablehnung gilt „derzeit“. Die Haltung zur PID ist weiterhin offen. Auch hier empfiehlt sich, genau hinzusehen:Anträge, die auf eine eindeutige Absage an PID zielten, wurden vom Deutschen Ärztetag mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Am Ende des auch vom Ärztetag gewünschten „gesellschaftlichen“ Klärungsprozesses dürfte die „gesellschaftliche“ Entscheidung stehen, und die Ärzteschaft wäre der eigenen Entscheidung enthoben. Sie hat freilich zuvor die nötigen Informationen bereitgestellt, die Alternativen aufgezeigt, wie es der Präsident der Bundesärztekammer, Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe, in einem Interview, das in Heft 20 erschienen ist, formuliert hat. Alsdann würde die Ärzteschaft, so Hoppe, falls der Gesetzgeber den Embryonenschutz abschwächen sollte, nötigenfalls Richtlinien für die innerärztlich sachgemäße Durchführung beschließen. Bis dahin wird es noch eine Weile dauern, der gesellschaftliche Diskurs dauert an. Wem nützt die ablaufende Zeit? Vordergründig beiden Richtungen. Die Gesellschaft ist in den letzten Monaten tatsächlich, auch im Sinne derer, die zur Vorsicht raten, problembewusst geworden. Das ist gut so. Jeder soll wissen, dass Grundfragen des Lebens zur Diskussion stehen. Die ablaufende Zeit nützt nicht zuletzt aber auch den Befürwortern der liberalen Handhabung. Sie führen derzeit immer neue medizinische und naturwissenschaftliche Bataillone und philosophische und juristische Hilfstruppen ins Feld. Bis zur Entscheidung des Gesetzgebers – der wird um eine solche nicht herumkommen – herrscht gespanntes Norbert Jachertz Abwarten. 86 Gesundheits- und Sozialpolitik Freiheit und Verantwortung in der modernen Medizin Auszug aus der Rede zur Eröffnung des 104. Deutschen Ärztetages: Die Aussagen zur ärztlichen Ethik Jörg-Dietrich Hoppe Freiheit und Verantwortung in der modernen Medizin – das heißt für uns vor allen Dingen Freiheit in Verantwortung. Diese ethische Selbstverpflichtung eben ist der entscheidende Unterschied zur Beliebigkeit. Bei keinem anderen Thema offenbart sich diese Differenz so gravierend wie bei der Diskussion um die Sterbehilfe. Die Entscheidung des niederländischen Parlaments, das Tötungsverbot in bestimmten Fällen aufzuheben und ärztlich gestützte Euthanasie zuzulassen, rührt an den Grundfesten einer humanen Gesellschaft. Es ist zu befürchten, dass nunmehr auch in anderen europäischen Ländern diejenigen Auftrieb bekommen werden, die einer Legalisierung der Euthanasie das Wort reden. Für uns aber ist eine gezielte Lebensverkürzung durch Maßnahmen, die den Tod herbeiführen oder das Sterben beschleunigen sollen, nach wie vor mit den Prinzipien des Arztberufes unvereinbar. Das hat auch der Weltärztebund wiederholt festgestellt, zuletzt am vergangenen 5. Mai mit nur einer Gegenstimme, und die kam aus den Niederlanden. Denn ethische Werte sind keine Modeerscheinungen der Postmoderne, ethische Werte sind Prinzipien des Humanismus, ihrem Wesen nach unverbrüchlich, vielleicht sogar naturgegeben. Wie schnell allerdings solche Werte durch Ignoranz, Ideologie oder schlicht durch eine Gebrauchsethik ersetzt werden können, zeigt schon ein kurzer Blick zurück in die Vergangenheit. Das Euthanasie-Programm der Nazis, die Vernichtung so genannten lebensunwerten Lebens, nahm seinen Anfang in der Diskreditierung des Verbots aktiver Sterbehilfe. Erst als Tötung auf Verlangen gesellschaftlich akzeptiert erschien und das unbedingte Lebensrecht des Menschen an sich schon nichts mehr galt, begannen die Nazis mit der Massentötung behinderter Menschen. Der Bevölkerung wurde dann eingeredet, man täte den „armseligen Kreaturen“ – wie es damals hieß – nur einen Gefallen und gewähre ihnen deshalb den „Gnadentod“. Ohne die Gleichgültigkeit beziehungsweise schweigende Zustimmung in der Bevölkerung hätten diese Mordtaten an psychisch Kranken, geistig und körperlich Behinderten so nicht geschehen können. Warum dieser kleine Exkurs in unsere Geschichte? Ich glaube, dass ethische Werte verteidigt werden müssen, wenn sie bewahrt werden sollen, dass man für die Werte des Humanismus kämpfen muss und dass Ignoranz und Gleichgültigkeit gegenüber den Schwächeren der Anfang vom Ende sind. Auch dürfen wir uns nicht gefälligen Argumentationen des Zeitgeistes hingeben und uns allzu sehr von Meinungsumfragen beeindrucken lassen. Zumal wenn sie lapidar formuliert sind wie etwa „Sollte die aktive Sterbehilfe erlaubt werden?“. Wer denkt da nicht sofort an das Selbstbestimmungsrecht des mündigen Menschen? Wie aber würde wohl das Ergebnis einer solchen Umfrage aussehen, wenn die Frage lautete: „Sollte ihr Arzt Patienten im finalen Stadium töten dürfen?“ Wir müssen uns mit aller Macht dagegen wenden, dass ein gesellschaftliches Klima entsteht, das Sterbehilfe zum Mittel der Wahl bei schwerstkranken und lebensmüden Menschen erklärt. Schon eine Relativierung würde unweigerlich auf eine schiefe Ebene führen. Denn dadurch würde auch der Druck auf diejenigen Patienten, welche sich den Tod nicht wünschen, sondern bis zum letzten Atemzug zu hoffen wagen, unerträglich steigen. Jan Roß hat Recht, wenn er sagt: „Wer meint, dass getötet werden darf, wer getötet werden will, wird leicht zu dem Schluss kommen, dass nur der nicht getötet werden darf, der nicht getötet werden will.“ Zitatende Es ist deshalb nicht nur Verpflichtung der Ärzte, sondern aller Menschen in diesem Land, die Unverfügbarkeit menschlichen Lebens anzuerkennen und zu bewahren. Deshalb plädieren wir mit Nachdruck für einen Ausbau der Hospize und der palliativmedizinischen Versorgung und wenden uns mit aller Macht gegen jeden Versuch, Ärzte zu staatlich legitimierten Euthanatikern zu machen! N Wie am Ende des menschlichen Lebens, so müssen wir uns auch an dessen Beginn immer wieder dar- D O K U M E N T A T I O N auf besinnen, was originäre Aufgabe des Arztes ist. Darüber haben wir gerade bei der Präimplantationsdiagnostik in der Ärzteschaft eine intensive Diskussion geführt. Und ich bin dem Chefredakteur des Deutschen Ärzteblattes, Herrn Jachertz, außerordentlich dankbar, dass er in einer umfangreichen Dokumentation die verschiedenen Meinungsbeiträge für uns zusammengefasst hat. Unser grundlegendes Problem in der Bewertung neuester Medizintechniken liegt in ihrem offensichtlichen Wertewiderspruch. Einerseits versprechen sie bisher unheilbare Krankheiten zu heilen oder zu verhindern,zum anderen aber drohen wir in die Selektion oder Verwertung menschlichen Lebens zu geraten. Auch der Gesetzgeber kann längst nicht mehr Schritt halten mit medizinischem Fortschritt. So regelt das Embryonenschutzgesetz von 1990 zwar den Umgang mit befruchteten Eizellen und Embryonen bis zur Nidation. Inwieweit aber die Präimplantationsdiagnostik – oder auch PID – mit diesem Gesetz vereinbar ist, ist nach wie vor umstritten. Mit dem „Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik“ vom Februar vergangenen Jahres, in dem die Zulassungskriterien äußerst restriktiv gefasst sind, haben wir den öffentlichen Diskurs zu diesem Thema gefordert, ja regelrecht provoziert. Wir wollten Problembewusstsein schärfen, und es sollte niemand mehr sagen können, er habe nicht gewusst, um was es geht. Dafür sind wir auch gescholten worden. Aber es bleibt dabei, was auch Bundespräsident Johannes Rau in seiner jüngsten, bemerkenswerten Berliner Rede angemerkt hat: „Nachdenken kann man nur, wenn zwischen Entdeckung und Anwendung Zeit bleibt, wenn wir die möglichen Folgen bedenken können, bevor sie eingetreten sind.“ Zitatende Ich darf noch einmal daran erinnern: Durch die rasante Entwicklung im Bereich der Fortpflanzungsmedizin ist es in den vergangenen Jahren möglich geworden, einen Embryo außerhalb des Mutterleibes zu erzeugen und bereits in den ersten Tagen nach der Befruchtung auf bestimmte genetische Belastungen oder Chromosomenstörungen zu untersuchen. Nach einer solchen Präimplantationsdiagnostik kann entschieden werden, ob eine Einnistung erfolgen oder ob der Embryo dem Absterben anheim gegeben werden soll. PID ermöglicht es erblich schwer belasteten Paaren mit Kinderwunsch, auf eine so genannte „Schwangerschaft auf Probe“, also auf Postnidationsdiagnostik beziehungsweise Pränataldiagnostik mit der möglichen Konsequenz eines Schwangerschaftsabbruchs, zu verzichten. In elf Ländern der Europäischen Union ist die PID erlaubt, in drei Ländern ausdrücklich verboten, in Deutschland bisher umstritten – und das zu Recht. Denn allein schon aufgrund von Gesetzgebung und Rechtsprechung ist der Mensch bei uns in seiner Entwicklung vom befruchteten Ei bis zum Greis unterschiedlich geschützt: 1. Der Keim, also das in Teilung befindliche befruchtete Ei im Reagenzglas, ist de jure und zugleich de facto geschützt. 2. Der Embryo im Mutterleib ist zwar de jure geschützt, de facto aber nicht: a) vor der Nidation durch die Spirale oder die Pille danach als Mittel der Einnistungsverhütung – das heißt ohne konkrete Konfliktsituation Frau/Kind b) nach der Nidation wegen der Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs wegen eines Konfliktes Frau/Kind bis zur 12. Schwangerschaftswoche c) während der gesamten Schwangerschaftsdauer bei so genannter medizinischer Indikation (nach Pränataldiagnostik) bis zum Geburtsbeginn 3. Sonderfall: Ein Kind, das den Schwangerschaftsabbruch überlebt hat, ist de jure und de facto geschützt – trotz des Konfliktes Frau/Kind. Schlussfolgerung: Eine völlig inkonsistente Rechtslage, die auch der Verfassung nicht entsprechen kann. Eine unerträgliche Situation für unsere Gynäkologen und Perinatalärzte! Darüber hinaus sind weitere wichtige Fragen ungeklärt: > Wie lässt sich gewährleisten, dass der Embryo nur auf die genetischen Belastungen oder Chromosomenstörungen der Eltern untersucht wird? > Ist es sicher auszuschließen, dass die Entnahme einer Zelle zur Diagnostik wirklich keine Schädigung des „Rest“-Embryos zur Folge hat? > Darf ein künstlich gezeugter Embryo im Reagenzglas nicht untersucht werden, während ein Embryo im Mutterleib jederzeit untersucht werden darf? > Und schließlich: Lässt sich die Möglichkeit eines Spätschwangerschaftsabbruchs nach Pränataldiagnostik mit einem Verbot der PID widerspruchsfrei vereinbaren? Wie wird denn schon jetzt im Rahmen einer IvFBehandlung mit Embryonen verfahren, die als schadhaft gelten oder infiziert sind? Man lässt sie sterben. Ich persönlich sehe die Präimplantationsdiagnostik von ihrer Intention her genauso wie die Pränataldiagnostik primär nicht als selektive Methode, sondern als eine Möglichkeit, erbbelasteten Eltern zu einem gesunden Kind zu verhelfen. Man kann das ablehnen und Paaren mit einer schweren erblichen Belastung empfehlen, auf Kinder zu verzichten. Das wäre uneingeschränkt auch meine Präferenz. Und ich stimme dem Bundespräsidenten uneingeschränkt zu in seiner Feststellung: „Wenn es die Möglichkeit gibt, Kinder künstlich zu erzeugen oder die genetischen Anlagen eines Embryos zu testen – entsteht dann nicht leicht eine Haltung, dass jede und jeder, der eigene Kinder bekommen will, auch das Recht dazu habe – und zwar sogar ein Recht auf gesunde Kinder? Wo bisher unerfüllbare Wünsche erfüllbar werden oder erfüllbar erscheinen, da entsteht daraus schnell ein Anschein von Recht. Wir wissen aber doch, dass es ein solches Recht nicht gibt.“ Zitatende Aber, meine Damen und Herren, ist diese Auffassung noch mehrheitsfähig, seit die In-vitro-Fertilisation zugelassen ist und Pränataldiagnostik durchgeführt wird mit dem Ziel, intrauterin mögliche Erbschädigungen bei Kindern festzustellen und diese Kinder dann abzutreiben? Deshalb sage ich: Durch ein Verbot der Präimplantationsdiagnostik allein ist die Welt nicht in Ordnung zu bringen. Die Problematik ist komplexer und sollte nicht simplifiziert diskutiert werden. Ich mahne aber zugleich, dass wir dann die PID unter strikter Kontrolle halten müssen, damit nicht Antworten gesucht werden auf Fragen, die wir nicht stellen wollen. Dann nämlich wäre PID tatsächlich der erste Schritt in Richtung Selektion. Bedingt durch die derzeit ungeklärte Rechtslage in Deutschland, sehen sich Ärzte häufig dazu gedrängt, Rat suchende Paare mit erblichen Belastungen in einer Konfliktsituation auf eine Behandlung im Ausland hinzuweisen und sich dadurch möglicherweise strafbar zu machen. Dies ist für die Ärzteschaft eine untragbare Situation. Deshalb appellieren wir dringend an den Gesetzgeber, eine Klärung der Rechtslage herbeizuführen und für den Fall einer Zulassung der PID weitere Kriterien einer restriktiven Handhabung mitzugestalten. Diese ganze Diskussion wäre im Übrigen überflüssig, wenn wir in unserer Gesellschaft Behinderte ohne Wenn und Aber akzeptieren würden. Umso wichtiger ist es, dass wir Ärzte immer wieder klarstellen, dass Menschen selbst im frühesten Stadium ihrer Entwicklung, also von der Verschmelzung der Gameten an, nicht für andere Menschen verfügbar gemacht werden dürfen. Es darf niemals so sein, dass Menschen für den Heilungsprozess anderer ausgenutzt werden. Verbrauchende Embryonenforschung lehnen wir deshalb strikt ab. Eine ethisch vertretbare Alternative ist die Forschung mit adulten Stammzellen oder Stammzellen aus Nabelschnurblut.Diese müssen wir fördern,so wie es auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft in ihrer vorletzten Stellungnahme noch empfohlen hat. ) 87 D O K U M E N T A T I O N Heft 22, 1. Juni 2001 TOP I: Ethik Die Unverfügbarkeit menschlichen Lebens Die Delegierten des Ärztetages legten sich (vorerst) fest: nein zur embryonalen Stammzellforschung, nein zur aktiven Euthanasie. Bei der Präimplantationsdiagnostik konnten sie sich auf keine eindeutige Position einigen. Der Gesetzgeber soll zunächst die Rechtslage klären. D ie Würde des Menschen ist unantastbar. Das wird wohl von niemandem bestritten. Doch ab wann besitzt ein Embryo eine menschliche Würde? Darf an menschlichen Embryonen geforscht werden, oder dürfen gar embryonale Stammzellen zu Forschungszwecken hergestellt werden? Nein – ist die Antwort des 104. Deutschen Ärztetages. Er erteilt der Herstellung, dem Import und der Verwendung von embryonalen Stammzellen eine klare Absage. Einschränkend wurde allerdings das Wort „derzeit“ eingefügt. Der Ärztetag wandte sich damit gegen die Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), die den Import embryonaler Stammzellen und langfristig auch deren Gewinnung in Deutschland zulassen will (dazu DÄ, Heft 19/2001). Dieser Vorstoß der DFG ziele auf eine Änderung des Embryonenschutzgesetzes ab, um die Forschung mit embryonalen Stammzellen auch in Deutschland zu ermöglichen. Der Ärztetag stimmt in dieser Frage mit Bundespräsident Johannes Rau überein, der sich in seiner Berliner Rede „Wird alles gut? – Für einen Fortschritt nach menschlichem Maß“ am 18. Mai ebenfalls für eine Beibehaltung des Embryonenschutzgesetzes ausgesprochen hatte: „Auch hochrangige Ziele wissenschaftlicher Forschung dürfen nicht darüber bestimmen, ab wann menschliches Leben geschützt werden soll.“ Um die vielen noch offenen Fragen der zellulären Entwicklungsbiologie zu klären, seien weitere intensive Forschungsanstrengungen notwendig, heißt es in dem Beschluss. „Die Wissen- 88 schaftler müssen die Öffentlichkeit sachlich und fundiert über die Grundlagen der Forschung mit embryonalen und adulten Stammzellen informieren“, forderte der Ärztetag. Auch die Quellen für menschliche Stammzellen müsse man genau benennen (überzählige Embryonen, fetales Gewebe, adulte Stammzellen). Dabei dürften sich Ärzte und Patienten keine übertriebenen Hoffnungen auf eine baldige therapeutische Anwendung dieser Techniken machen. Die Öffentlichkeit müsse „ergebnisoffen“ in den Dialog über die ethischen und rechtlichen Probleme eingebunden werden, um Möglichkeiten, aber auch Grenzen der Forschung mit embryonalen Stammzellen zu erkennen. Der Präsident der Bundesärztekammer, Prof. Dr. med. Jörg-Dietrich Hoppe, sagte, er erwarte, dass der Beschluss eine politische Entscheidung zur embryonalen Stammzellforschung zumindest hinauszögere. Eine ethisch vertretbare Alternative sei die Forschung mit adulten Stammzellen oder Stammzellen aus Nabelschnurblut. Diese müsse gefördert werden, so wie es die Deutsche Forschungsgemeinschaft in ihrer vorletzten Stellungnahme noch empfohlen habe. Der Beschluss des Ärztetages wurde mehrheitlich gefasst. Zum Thema Embryonenforschung gab es zuvor jedoch erheblichen Diskussionsbedarf. Eine ganze Reihe von Delegierten wollte einer Empfehlung des Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer, Prof. Dr. med. KarlFriedrich Sewing, folgen, der dafür plädierte, zunächst das Votum des Beirates, der sich in einem eigenen Ausschuss mit dem Problem beschäftige, abzuwarten. Zahlreiche Delegierte betonten dagegen, dass man die Debatte nur befördern könne, wenn man sich daran beteilige, statt abzuwarten. Die Delegierten fordern rechtliche Klarheit Schwieriger als bei der embryonalen Stammzellforschung fiel dem Ärztetag eine Einschätzung der Präimplantationsdiagnostik (PID). Auf eine klare Pro- oder Kontraposition wollte sich die Mehrheit der Delegierten nicht festlegen. Ein Grund dafür ist die bisher noch ungeklärte Rechtslage. Die Delegierten des Ärztetages appellierten deshalb an den Gesetzgeber, rechtliche Klarheit über die Zulässigkeit der PID herzustellen. Es müsse geklärt werden, inwieweit genetische Untersuchungen von Embryonen vor einer möglichen Übertragung in die Gebärmutter mit der geltenden Rechtslage zu vereinbaren seien. Ärzte sähen sich häufig dazu gedrängt, Rat suchende Paare in einer Konfliktsituation auf eine Behandlung im Ausland hinzuweisen und sich dadurch möglicherweise strafbar zu machen. „Dies ist für die Ärzteschaft eine untragbare Situation“, heißt es in dem Beschluss. Für den Fall einer Zulassung müsse der Gesetzgeber weitere Kriterien für eine maximale Eingrenzbarkeit dieser Methode mitgestalten. Außerdem sollten zahlreiche noch offene Fragen geklärt werden, zum Beispiel wie es zu gewährleisten sei, dass der Embryo nur auf die genetischen Belastungen oder Chromosomenstörungen der Eltern untersucht wird und ob sich die Möglichkeit eines Spätschwangerschaftsabbruchs nach Pränataldiagnostik mit einem Verbot der PID widerspruchsfrei vereinbaren lässt. Ein Antrag von Prof. Dr. med. Winfried Kahlke, Ärztekammer Hamburg, sprach sich dafür aus, „PID nicht in die medizinische Praxis aufzunehmen und das Embryonenschutzgesetz in seiner gegenwärtigen Fassung zu belassen“. Nach Auffassung Kahlkes bedeutet die Etablierung dieser Methode, dass die Entscheidung, welche Kinder ausgetra- D O K U M E N T A T I O N gen werden sollen, bereits vor der Schwangerschaft getroffen werde, um die Geburt von kranken und behinderten Kindern zu verhindern. Damit stelle PID den Einzug einer genetischen Selektion in die medizinische Praxis dar. Das Argument, dass ein möglicher Schwangerschaftsabbruch durch die Vorauswahl des zu implantierenden Embryos vermieden werden könnte, hält Kahlke nicht für überzeugend. Der Schwangerschaftsabbruch erfolge, um eine als unerträglich beziehungsweise als unzumutbar empfundene Belastung der Schwangeren abzuwehren, die anders nicht abzuwenden sei. Das Verwerfen eines ungewollten Embryos im Rahmen der PID beabsichtige, den Anspruch auf ein bestimmtes Kind zu erfüllen: „Eine Notlage, die durch kein anderes Mittel abzuwenden wäre, liegt hier nicht vor.“ Kahlke wies auch auf die Gefühlslage der Betroffenen hin. Die in der Selbsthilfevereinigung Mukoviszidose vertretenen Eltern und Patienten hätten schwere Bedenken gegen eine Zulassung der Präimplantationsdiagnostik. Dass Behinderte dieser Methode äußerst kritisch gegenüberstehen, ist nachvollziehbar. Eine Äußerung von Dr. med. Norbert Metke, Landesärztekammer Baden-Württemberg, dürfte sie in ihrer Sorge bestärken. Metke bezeichnete die PID als „Pflicht der Ärzte“. Ärztliches Handeln sei immer ein Eingriff in die Natur. „Wenn wir künstliches Leben schaffen, haben wir auch die Pflicht, gesundes Leben zu schaffen.“ Metke, der als Orthopäde selbst behinderte Kinder behandelt, ging sogar noch weiter und sagte: „Ich sehe keinen Eigenwert in behindertem Leben.“ Die Bemerkung löste Pfiffe und Buh-Rufe aus. Wenig später nahm Metke den „schlimmen Satz“ zwar wieder zurück, sagte aber, dass er im Leid von Behinderten nichts Positives erkennen könne. Mehrere Delegierte kritisierten Metke scharf. So meinte Dr. med. Helmut Peters, Landesärztekammer Rheinland-Pfalz, dass Kinder mit Trisomie 21 häufig zufriedener als „ambitionierte Wissenschaftler“ seien. Peters zitierte unter großem Beifall Erich Kästners Gedicht „Der synthetische Mensch“. Den darin beschriebenen Katalog- Menschen, „mit Bärten oder mit Busen, mit allen Zubehörteilen, je nach Geschlecht“, wollten die Delegierten offenbar nicht. „Behindertes Leben hat denselben Eigenwert wie das von jedem Delegierten hier im Raum“, sagte Rudolf Henke, Vorstandsmitglied der Bundesärztekammer. Bundespräsident Johannes Rau hatte in seiner Berliner Rede die PID als eine Praxis bezeichnet, „die das Tor weit öffnet für biologische Selektion, für eine Zeugung auf Probe“. Ein Recht auf gesunde Kinder gebe es nicht. Noch so verständliche Wünsche und Sehnsüchte seien keine Rechte. Diese Auffassung wurde auch von Delegierten des Ärztetages geteilt, unter anderem von Dr. med. Astrid Bühren, Vorstandsmitglied der Bundesärztekammer. In einem von ihr eingebrachten Antrag fragte sie, ob es gerechtfertigt sei, dass eine grundsätzlich fertile Frau als Patientin dem In-vitro-Fertilisationsprogramm mit seinen potenziellen medizinischen Risiken zugeführt werde. Bühren forderte eine „Abwägung, ob es gerechtfertigt ist, einem grundsätzlich fertilen Paar, das Kinder in intimer Zweisamkeit ohne technische Eingriffe und Laboratmosphäre zeugen könnte, die invasive Eizellentnahme, die masturbatorische Samenzellspende, eine reduzierte Konzeptionschance, das Risiko emotionaler Krisensituationen und psychosomatische Auswirkungen mit Einfluss auf die Paarbeziehung anzuraten“. Dr. med. Frank Ulrich Montgomery, Vorstandsmitglied der Bundesärztekammer, sagte ebenfalls, dass die Präimplantationsdiagnostik keine „schöne, saubere Methode“ sei. Es gab jedoch auch Befürworter der Zulassung dieser Methode; Bührens Antrag wurde ebenso wie der von Kahlke abgelehnt. Wenn jährlich mehr als 200 000 Embryonen weggeworfen würden, warum solle man dann nicht an ihnen forschen, fragte Dr. med. Ulrich Lang, Landesärztekammer Hessen. Wiederholt wurde eingewendet, dass PID im Ausland erlaubt sei und dass diese Möglichkeit von Paaren dann auch genützt würde. Hoppe äußerte Verständnis für die Befürchtungen der Gegner der Präimplantationsdiagnostik. Er erläuterte aber auch, warum seiner Auffassung nach die Welt durch ein Verbot der PID nicht in Ordnung zu bringen sei (dazu auch das Interview mit Hoppe in DÄ, Heft 20/2001). Er betrachte die Präimplantationsdiagnostik und die Pränataldiagnostik nicht primär als selektive Methode, sondern als eine Möglichkeit, erbbelasteten Eltern zu einem gesunden Kind zu verhelfen. „Man kann das ablehnen, und Paaren mit einer schweren erblichen Belastung empfehlen, auf Kinder zu verzichten. Das wäre uneingeschränkt auch meine Präferenz.“ Es sei jedoch fraglich, ob eine solche Auffassung noch mehrheitsfähig sei, seit die Invitro-Fertilisation zugelassen sei und Pränataldiagnostik vorgenommen werde, mit dem Ziel, intrauterin mögliche Erbschädigungen bei Kindern festzustellen und diese Kinder dann abzutreiben. Wenn PID zugelassen würde, dürfte sie allerdings nur mit Restriktionen erlaubt werden, „damit nicht Antworten gesucht werden auf Fragen, die wir nicht stellen wollen. Dann nämlich wäre PID der erste Schritt in Richtung Selektion.“ Bei der Einstellung zur aktiven Euthanasie waren sich die Delegierten einig. Die niederländische Regelung wird von ihnen einmütig abgelehnt. „Aktive Sterbehilfe ist das vorsätzliche Töten von Menschen. Das steht in krassem Widerspruch zum ärztlichem Auftrag, das Leben zu schützen. Der ärztliche Beruf würde so ein anderer, der Arzt würde zum Vollstrecker werden“, heißt es in einem Beschluss. Jeder Patient müsse sich zu jeder Zeit sicher sein, dass Ärzte konsequent für das Leben eintreten und weder aus wirtschaftlichen noch aus politischen Gründen das Leben zur Disposition stellen. Diese Sicherheit könne nur dann garantiert werden, wenn Ärzte das Töten von Patienten kategorisch ablehnen. Es gebe schon Wissenschaftler, die von „Sterbekosten“ sprechen, wenn sie die Behandlung und Hilfe in der Zeit vor dem Tod meinen. „Wenn Schwerstkranke schnell und kostengünstig sterben wollen, kommt eine makabre Kostenlogik in Gang“, warnt der Ärztetag. Inhalt des ärztlichen Auftrages sei, Leiden zu lindern und Angst zu nehmen, um damit ein würdevolles Lebens- 89 D O K U M E N T A T I O N ende zu ermöglichen. Als Alternative zur aktiven Sterbehilfe müssten daher die Voraussetzungen für eine weitere Verbreitung und Anwendung der Palliativmedizin verbessert werden. Die Ärztetagsdelegierten betonten, dass das Sterben Teil des Lebens sei und auch die letzte Phase des Lebens menschenwürdig gelebt werden könne. Deshalb müssten die für Krankenhauspla- nung zuständigen Länder bei der Kapazitätenermittlung für die stationäre Versorgung die Notwendigkeit palliativmedizinischer Maßnahmen einbeziehen. Über die Verbesserung der palliativmedizinischen Versorgung im Krankenhaus hinaus sei auch die weitere Förderung und finanzielle Sicherstellung ambulanter und stationärer Hospizarbeit erforderlich. Gisela Klinkhammer Heft 22, 1. Juni 2001 Entschließungen zum Tagesordnungspunkt I Gesundheits-, Sozialund ärztliche Berufspolitik Konflikte bei ärztlichen Entscheidungen – am Beispiel der Präimplantationsdiagnostik Durch die rasante Entwicklung im Bereich der Fortpflanzungsmedizin in den vergangenen Jahren ist es möglich geworden, einen Embryo außerhalb des Mutterleibs zu zeugen und bereits in den ersten Tagen nach der Befruchtung auf bestimmte genetische Belastungen oder Chromosomenstörungen zu untersuchen. Das Ergebnis dieser Präimplantationsdiagnostik (PID) ermöglicht den Eltern die Entscheidung, ob der Embryo implantiert werden soll. Das Embryonenschutzgesetz (ESchG) von 1990 regelt den Umgang mit Gameten, befruchteten Eizellen und Embryonen im Zeitraum bis zur Einnistung des Embryos in den Uterus. Vom Beginn des menschlichen Lebens an soll der Lebensschutz gewährleistet werden. Als Beginn wird nach § 8 Abs. 1 ESchG der Abschluss der Befruchtung der Eizelle, d. h. also die Kernverschmelzung in der befruchteten Eizelle mit der Entstehung eines neuen, individuellen Genoms angesehen. Juristisch ungeklärt ist bisher, inwieweit die PID mit dem Embryonenschutzgesetz vereinbar ist. 1. Mit der Veröffentlichung des „Diskussionsentwurfs zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik“ im Februar 2000 hat die Ärzteschaft die öffentliche Diskussion angestoßen und das Problembewusstsein geschärft. Die Ärzteschaft hat keine Entscheidung getroffen, sondern für den Fall einer Zulassung die engstmögliche Zulässigkeit der ärztlichen Durchführung für PID beschrieben und einen möglichen Verfahrensweg aufgezeigt. 2. Es ist Aufgabe der Ärzteschaft, in dem gesellschaftlichen Diskurs auf ethische Probleme 90 hinzuweisen, vor denen Ärzte mit ihren Patientinnen und Patienten stehen: Die in der Reproduktionsmedizin tätigen Ärzte stehen in der Situation, einerseits mit PID in Verbindung mit einer IvF über Methoden zu verfügen, die Paaren mit monogenetischen Erkrankungen zu einem nicht betroffenen Kind verhelfen könnten, andererseits mit der gesellschaftlich anerkannten Anwendung von Pränataler Diagnostik (PND) der Frau eine „Schwangerschaft auf Probe“ und gegebenenfalls eine Abtreibung, den Verzicht auf Kinder, eine heterologe Befruchtung mit Spendersamen oder eine Adoption zuzumuten. In diesem Zusammenhang ist es unerlässlich, die offenen Fragen zu klären: > Wie wird im Rahmen einer IvF-Behandlung mit Embryonen verfahren, die sichtlich erkennbare Zellveränderungen haben? > Wie lässt sich gewährleisten, dass der Embryo nur auf die genetischen Belastungen oder Chromosomenstörungen der Eltern untersucht wird? > Ist auszuschließen, dass die Entnahme einer Zelle zur Diagnostik keine Schädigung des „Rest“Embryos zur Folge hat? > Darf ein künstlich gezeugter Embryo im Reagenzglas nicht untersucht werden, während ein Embryo ím Mutterleib jederzeit untersucht werden darf? > Lässt sich die Möglichkeit eines Spätschwangerschaftsabbruchs nach Pränataldiagnostik mit einem Verbot der PID widerspruchsfrei vereinbaren? 3. Die Ärzteschaft appelliert dringend an den Gesetzgeber, eine Klärung der Rechtslage herbeizuführen und für den Fall einer Zulassung der PID weitere Kriterien für eine maximale Eingrenzbarkeit mitzugestalten. Im europäischen Ausland ist die Diskussion um PID bereits Anfang der 90er-Jahre geführt worden mit dem Ergebnis, dass die PID in vielen Ländern „in Ausnahmefällen und mit strengen Indikationen“ zugelassen wurde. Mittlerweile sind weltweit 500 Kinder nach PID geboren. Um eine Ausweitung der Anwendung zu verhindern, wäre beispielsweise eine Beschränkung auf wenige Kompetenzzentren denkbar. Bedingt durch die derzeit ungeklärte Rechtslage in Deutschland, sehen sich Ärzte häufig dazu gedrängt, Rat suchende Paare in dieser Konfliktsituation auf eine Behandlung im Ausland hinzuweisen und sich dadurch möglicherweise strafbar zu machen. Dies ist für die Ärzteschaft eine untragbare Situation. 4. Die Frage der Zulässigkeit der PID bedarf einer gesamtgesellschaftlichen Auseinandersetzung. Dabei bilden die normativen Maßstäbe der Verfassung den Rahmen des ethischen Diskurses. Hierzu gehören die Würde des Menschen, die Wahrung grundlegender Ansprüche und Rechte, aber auch die Widerspruchsfreiheit der Normen und die Verhältnismäßigkeit. Mehrheitsentscheidungen im Vorstand der Bundesärztekammer oder auf dem Deutschen Ärztetag sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht zielführend, zumal ethische Konflikte nicht durch Abstimmung gelöst werden können. 5. Der Gesetzgeber allein ist legitimiert, darüber zu entscheiden, welche rechtlichen Grundlagen den Umgang mit diesen Konflikten bestimmen sollen. ) Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen Die Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zur Forschung mit menschlichen Stammzellen vom Mai 2001 zielen auf eine Änderung des § 1 Embryonenschutzgesetz (EschG), um eine Herstellung und Verwendung humaner embryonaler Stammzellen auch in Deutschland zu ermöglichen. Der Deutsche Ärztetag stellt fest, dass derzeit einer solchen Forderung einer Öffnung des ESchG nicht gefolgt werden kann. Die Öffentlichkeit muss ergebnisoffen in den Dialog über die mit der Forschung an humanen embryonalen Stammzellen verbundenen ethischen und rechtlichen Probleme eingebunden werden, um Möglichkeiten, aber auch Grenzen der Forschung mit menschlichen embryonalen Stammzellen zu erkennen. Auch der Import embryonaler Stammzellen ist ethisch nicht akzeptabel. Der Deutsche Ärztetag stellt fest, dass die Forschung an embryonalen sowie an gewebespezifischen (adulten) Stammzellen in den letzten Jahren D O K U M E N T A T I O N zu Fortschritten sowohl im Bereich der naturwissenschaftlichen als auch der medizinischen Erkenntnis geführt hat. Um die vielen offenen Fragen der zellulären Entwicklungsbiologie zu klären, sind aus wissenschaftlicher Sicht weitere intensive Forschungsanstrengungen notwendig. In diesem Zusammenhang sind die Wissenschaftler aufgefordert, die Öffentlichkeit sachlich und fundiert über die Grundlagen der Forschung mit embryonalen und adulten Stammzellen und eine mögliche Ausweitung auf humane embryonale Stammzellen zu informieren und die verschiedenen Quellen für menschliche Stammzellen (überzählige Embryonen, fetales Gewebe, adulte Stammzellen) zu benennen. Der Deutsche Ärztetag fordert die Wissenschaftler auf, bei der Darstellung der zu erwartenden Forschungsergebnisse größtmögliche Sachlichkeit zu üben, da die Möglichkeiten einer Realisierung von therapeutischen Anwendungen wahrscheinlich noch in weiter Zukunft liegen. Patienten als auch Ärzten darf keine übertriebene Hoffnung auf eine baldige Anwendung gemacht werden. Auch der Gesetzgeber wird seine zu treffende Entscheidung, ob eine Forschung mit menschlichen embryonalen Stammzellen in Deutschland erlaubt werden soll, erst nach intensiver Beratung fällen. Insbesondere sollte der Enquete-Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“ sowie dem Nationalen Ethikrat die Möglichkeit gegeben werden, die Gesellschaft und die politischen Entscheidungsträger über die ethischen Fragen zu beraten, um eine sachgerechte Urteilsbildung vorzubereiten. ) Heft 30, 27. Juli 2001 DISKUSSION zu unserer Berichterstattung vom 104. Deutschen Ärztetag in Heft 22/2001 Auf die Gefahr hinweisen Die offiziellen Organe der Ärzteschaft tragen leider nur wenig dazu bei, das im Moment in der Gesellschaft brodelnde Bemühen zu unterstützen, angesichts zukunftsweisender Entscheidungsnotwendigkeiten zwischen einem ökono- mischen Diskurs und einem Diskurs einer Ethik des Heilens zu differenzieren. Ich möchte dies an einem Beispiel illustrieren: Aufgabe der Ärzteschaft wäre es, auf die Gefahr hinzuweisen, die in den Vorstellungen steckt, mit der über die PID als Möglichkeit zur Vermeidung „erbkranken Nachwuchses“ diskutiert wird. Eine PID ist nur dann möglich, wenn eine IVF geplant ist. Sich genetisch belastet fühlende Paare müssten auf die noch normalen Fortpflanzungsrituale mit allen deren Freuden und inspirierenden Risiken verzichten, wenn sie eine PID durchführen lassen wollten. Ist diese Entfremdung im Denken erst einmal etabliert, entsteht – wie man es von der PND weiß – eine Nachfrage, die das Angebot rechtfertigt. Die Nachfrage fragt jedoch nicht mehr nach Ethik, sondern nur noch nach dem Preis. Dies dient zwar der Belegung gynäkologischer Abteilungen, lässt aber den Arzt in seiner individuellen Gewissensentscheidung verworren allein. Dr. med. Gudrun Wollmann, Am Mühlrain 24 e, 69151 Neckargemünd In „Fliegermanier“ fordern Liebe Vertretung unserer Interessen, schöne Papiere haben Sie da wieder aufgesetzt. Politisch korrekt formuliert, viele Forderungen, kein Druck. Gleichzeitig stehen die von Ihnen Vertretenen im niedergelassenen Bereich vor Pfennigsbetrags-Bezahlungen. Im stationären Bereich wird bei bekannten unmöglichen Arbeitsbedingungen sanft über neue Urteile zur Arbeitszeit diskutiert. In der Summe klingt durch: Wo zu wenig Geld ist, können wir nicht zu vehement fordern. Brav sind wir, die die Leistungen der Patientenversorgung erbringen.Verkaufen wir den Patienten doch lieber, jeder für sich, ein paar gewisse Extras oder betrügen bei der Abrechnung, weil es anders nicht geht. Wir haben in den letzten zehn Jahren auf Gehaltserhöhung verzichtet, in Kliniken mehr Stunden gearbeitet, um auch der Dokumentation gerecht zu werden. Aber an gemeinsamer Stärke haben wir nicht gearbeitet. Wo Krankenkassen hintenrum nicht erstattungsfähige Leistungen an Patienten bezahlen, um sie als Kunden zu halten, wa- chen wir immer noch nicht auf. Geld genug ist da, ob von den Kassen oder den Patienten. Wir müssen es nur in Fliegermanier einfordern. Wo das dann herkommt, sollen Kassen und Politiker bestimmen, die haben den Patienten ja auch lange genug beigebracht – wählt uns, dann gibt es fast alles. Dr. med. U. Siepmann-Winkler, Nerotal 59, 65193 Wiesbaden Die Zeit, grundlegend Neues zu formulieren, verrinnt Der Deutsche Ärztetag stützt das bestehende System und will es, wie Politik, Krankenkassen, Ärztekammern und KVen auch, durch ständige Reformen und noch mehr Bürokratie retten, obwohl der endgültige Zusammenbruch angesichts der ständigen Zunahme chronisch kranker und immer älterer Patienten, in Verbindung mit dem rasanten Fortschritt, absehbar ist. Daher störte mich das Fehlen von Nachdenklichkeit über ganz neue Wege oder Visionen. Angesichts der berufspolitisch, leider immer noch, weitgehend passiven Ärzteschaft, der es anscheinend gefällt, Spielball von Politik und Kassen zu sein, kein Wunder. Sollte das Gesundheitswesen nicht endlich an unsere sonstige gesellschaftliche Wirklichkeit angepasst werden, hin zu mehr Eigenverantwortung, zu Effizienz durch Wettbewerb und Marktwirtschaft? Die Patienten sind längst nicht mehr der Mittelpunkt. Es fehlt dringend am „case management“. Das heutige System ruft zu viel Unzufriedenheit hervor, daher der Zulauf zu alternativer Medizin. Fazit: Während ärztliche Gremien fröhlich über Reformen, neue Bürokratisierung, DRGs oder PID debattieren, verrinnt die Zeit, grundlegend Neues zu formulieren. Dr. med. Udo Saueressig, Gründelsweg 7, 69436 Schönbrunn PID ist medizinisch sinnvoll Die Präimplantationsdiagnostik (PID) ist medizinisch sinnvoll. Dass die Delegierten des Deutschen Ärztetages sich einer klaren Stellungnahme zu diesem Thema mit dem Verweis auf die „unge- 91 D O K U M E N T A T I O N klärte Rechtslage“ enthielten, ist beschämend. Es geht hierbei nicht um die „Rechtslage“, sondern um die Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass die PID, trotz medizinischer Rechtfertigung, das ethische Fundament unserer Menschlichkeit durch die Teilung in „lebenswert“ und „lebensunwert“ infrage stellt. Dieses Paradoxon kann nur durch die gleichzeitige radikale Bejahung eines jeden menschlichen Lebens und Unterstützung kranker und behinderter Menschen gelöst werden – nur auf diesem gesellschaftlichen Fundament ist eine PID paradoxerweise ethisch vertretbar. Dr. med. Hans Jörgen Grabe, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Rostocker Chaussee 70, 18437 Stralsund Wohltuende Offenheit Wohltuend, mit welcher Offenheit gerade auf diesem Ärztetag brisante Themen wie etwa die Ethik-Diskussion angegangen wurden, ebenso auch die ausgewogene Zivilcourage des Präsidenten Hoppe, mit seiner nicht nur medizinischen, sondern ärztlichen Einstellung etwa zur PID. Aber merkwürdig fand ich doch, dass offensichtlich nicht bewusst – oder schamvoll nicht angesprochen – wird, dass das Thema PID unbeschadet der ethisch nicht vertretbaren Akzeptanz auch unter ökonomischen und damit gesundheitspolitischem Aspekt gesehen werden muss. Droht hier nicht auch ein Eigentor der Ärzteschaft, wenn Forderungen aus der gynäkologischen und biomedizinischen Ecke in den gesetzlichen Leistungskatalog aufgenommen werden sollen, der mit den vorhandenen Finanzmitteln schon jetzt nicht mehr ausreichend bedient werden kann. Zu Recht besteht der Anspruch auf leistungsgerechte Honorierung der Ärzteschaft – im Hintergrund ein Jammern der Gynäkologen über das Budgetkorsett –, und dann soll sich der Luxus geleistet werden, die finanzträchtige PID einzuführen mit der inhumanen Konsequenz, genetisch minderwertigen Nachwuchs zu verhindern. Ist ärztlich statt Wunscherfüllung nicht ein Behandlungsauftrag bei unerfülltem Kinderwunsch mittels Psychotherapie gegeben, womit die Menschenwürde für die Frau und den Embryo gewahrt bleiben und unser abendländisches Welt- 92 und Menschenbild nicht infrage gestellt wird. Denn das Embryonalstadium ist kein „Niemandsland der Menschwerdung“! Erschütternd, wenn Mediziner vor dem Gremium eines Ärztetages wagen, zu äußern, sie würden im behinderten Leben keinen Eigenwert sehen. Das hat nichts mehr mit demokratischer Redefreiheit zu tun und disqualifiziert darüber hinaus einen Mandatsträger. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es in der PID- und Stammzellenauseinandersetzung weniger um Menschlichkeit im ethischen Sinne als um Ideologie – Forschernarzissmus, Materialismus? – geht. Herrn Montgomerys Befürchtungen, über die Stammzellforschung die Hintertüre zur PID öffnen zu können, bewölken bedrohlich den politischen Himmel. Darum mein besonderer Dank allen Kolleginnen und Kollegen, die – wie unser Bundespräsident – für unser humanitär geprägtes Arzttum eintreten, nicht zuletzt an dieser Stelle aber auch dem Chefredakteur, Norbert Jachertz, der nicht nur im DÄ ausreichend Raum zur Diskussion zu diesem schicksalsträchtigen Thema gibt, sondern darüber hinaus ehrlich seine eigene Sichtweise (Heft 3/2001) einbringt, was ihn nur ehren kann, auch wenn es leider Kollegen gibt, die ihm in dieser Position das Recht dazu absprechen wollen. Dr. med. Günter Link, Auf der Halde 13, 87439 Kempten Zum Beitrag „Die Unverfügbarkeit menschlichen Lebens“ von Gisela Klinkhammer und der dort zitierten Äußerung von Dr. med. Norbert Metke (Landesärztekammer Baden-Württemberg): „Ich sehe keinen Eigenwert in behindertem Leben.“: Empörend Als Hebamme und ganz besonders als Mutter von drei Kindern – wovon das jüngste chronisch krank und deshalb schwerbehindert ist – möchte ich Ihnen gegenüber meine Empörung äußern. Mein 14-jähriger Sohn erfährt nach und nach alle Stadien einer fortschreitenden Behinderung und benötigt mittlerweile eine kontinuierliche Schmerztherapie. Er ist trotzdem ausgesprochen lebensfroh, sehr sozial und findet immer wieder neue Lebensinhalte. Ich habe ihn einmal ganz direkt gefragt, ob er froh ist, geboren worden und am Leben zu sein. Er antwortete sofort: „Natürlich!“ – und – etwas vorwurfsvoll (?): „Was denkst du denn?“ Haben Sie das Recht, anderen Menschen ihr Lebensrecht abzusprechen? Haben Sie das Recht zu bestimmen, wie viel und welches „Leid“ lebenswert ist und welches nicht? In meinen Augen sind Menschen wie Sie behindert – in ihrer Sichtweise und Toleranz anderen gegenüber und in ihrem Größenwahn, „lebenswert“ beurteilen zu können. Haben Sie als Arzt wirklich schon einmal ein persönliches Gespräch mit Ihren behinderten Patienten geführt? Das habe ich nämlich bei vielen Ärzten in Bezug auf meinen Sohn vermisst. Er wurde untersucht, geröntgt, operiert und medikamentös behandelt, aber kaum ein Arzt fragte ihn: „Wie geht es dir mit deinem Leben?“ Gudrun Grabe-Rump, Pilzweg 4, 51069 Köln Zum Beitrag: „Beim Geld wird’s ernst“ von Norbert Jachertz: Stimmgewichtung ändern Es ist schade, dass über die noch zu führende Satzungsänderungsdiskussion so oberflächlich berichtet wurde. Denn demokratisches Denken und Handeln lebt nun einmal vor allem von und mit Entscheidungen von Mehrheiten. Dieses hohe demokratische Prinzip wird nach jetziger Regelung im Hinblick auf die deutsche Ärzteschaft im Vorstand der BÄK nicht verwirklicht. Denn ohne eine Stimmgewichtung im Vorstand der Bundesärztekammer können sich Entscheidungen ergeben, dass mit einer Mehrheit von neun Präsidenten der Landesärztekammern gerade einmal 25 Prozent der deutschen Ärzte vertreten werden (Quelle: Finanzbericht 99/00). Dies bedeutet im Extremfall, dass lediglich 13 Prozent der Gesamtärzteschaft hinter einem Mehrheitsbeschluss des Vorstandes der BÄK stehen müssen. Da der Deutsche Ärztetag nur einmal im Jahr tagen kann, werden sinnvollerweise im Laufe des Jahres viele wichtige Fragen, teilweise sogar Schlüsselfragen der Berufspolitik, im Vorstand beantwortet. Dazu ist es notwendig, dass der Vorstand der BÄK glaubhaft darstellen kann, dass hinter seiner Mehrheit auch die Mehrheit der deutschen Ärzteschaft D O K U M E N T A T I O N Heft 24, 15. Juni 2001 versammelt ist. Nur so kann er kraftvoll und effizient auch wichtige Fragen beantworten, und gesellschafts- und berufspolitische Meinungen folgerichtig nach außen vertreten. Natürlich sind in diesem Zusammenhang auch Vorstandsentscheidungen mit erheblicher Tragweite zu finanziellen Fragestellungen von Wichtigkeit. Hierzu stellt der Berichterstatter fest: „Über die Finanzgebaren wird seit Jahren argwöhnisch gewacht.“ Ich denke, die damit befassten Delegierten und Mitglieder des Finanzausschusses nehmen lediglich ihre Aufgabe sehr ernst, die sich aus der Treuhänderschaft über die Beiträge der Pflichtmitglieder ergibt. Sorgfältiges Überwachen der jährlichen Steigerungsrate im Haushalt, Überprüfen der eingegangenen Verpflichtungen auf ihre Notwendigkeit im Interesse der Ärzteschaft und genaue Kontrolle von Verträgen zur Sicherung von investierten Millionenbeträgen sollten absolute Selbstverständlichkeit sein. Dass hier bayerische Bedenken öfter in der Vergangenheit nicht ausreichend ernst genommen wurden, sei nur am Rande erwähnt. Fazit: Grundsätzlich sei festgestellt, dass Inhalte einer Satzung weiterzuentwickeln und anzupassen sind, wenn man sich auch zukünftig an einer sinnvollen Satzung orientieren will. Als Beispiel für notwendige Anpassungen mögen aus dem Bereich der Finanzen der § 9 Abs. 7 Satz 3 gesehen werden. Mehrheitsvoten des BÄK-Vorstandes müssen weiterhin in der Öffentlichkeit als hoch respektierte Meinungsäußerungen der deutschen Ärzteschaft zu werten sein. Dies ist ohne Stimmgewichtung nicht möglich. Insbesondere auch bei Entscheidungen mit großen finanziellen Folgelasten ist die Stimme des Präsidenten einer Ärztekammer, der 60 000 Ärzte vertritt, anders zu sehen als die eines Präsidenten, der knapp 4 000 Ärzte vertritt. In einem Satz allerdings kann von unserer Seite dem Berichterstatter, Herrn Jachertz, voll zugestimmt werden: „Gleichwohl ist nicht auszuschließen, dass Bayern das Thema erneut aufs Tapet bringt.“ Dr. med. Joachim Calles, Bayerischer Delegierter und Mitglied der Finanzkommission der Bundesärztekammer, Mozartstraße 29, 96332 Pressig-Rothenkirchen Gentechnikdebatte im Bundestag Wo ist die Grenze? Politiker aller Fraktionen sprachen im Deutschen Bundestag über den Wert und die Würde vorgeburtlichen Lebens. E s sei vielleicht eine der wichtigsten Debatten gewesen, die je im Deutschen Bundestag geführt wurden, sagte Hubert Hüppe (CDU). Und dabei ging es nicht um konkrete Gesetzesvorhaben. Aber es ging um den Wert und die Würde des (vorgeburtlichen) Lebens. Abgeordnete aller Bundestagsfraktionen legten am 31. Mai – ausgehend von der Präimplantationsdiagnostik (PID) und der embryonalen Stammzellforschung – ihr jeweils persönliches Menschenbild und ihre Wertehaltung dar. Um Politik ging es dabei eher sekundär. Am Ende des Meinungsbildungsprozesses steht möglicherweise eine Novellierung des Embryonenschutzgesetzes. Dies ist allerdings in dieser Legislaturperiode eher unwahrscheinlich. Die Vorsitzende der Enquete-Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“, Margot von Renesse (SPD), setzte gleich zu Anfang Akzente. Sie warnte davor, das „Gewissen zu vergewaltigen“. Die „Guten“ dürften nicht von den „Bösen“ getrennt werden. Der Begriff der Menschenwürde lasse sich nicht benutzen wie eine binomische Formel in der Mathematik. Menschenwürde sei nicht ein Gerinnungsprodukt von Ideologie, und sie eigne sich schon gar nicht als Knüppel, mit dem man auf den Kopf eines anderen einschlage. Renesse forderte dazu auf, erst nach einer breiten Diskussion in Fragen, die das Menschenbild betreffen, zu Entscheidungen zu kommen. Nahezu alle Redner schlossen sich dieser Forderung an. Die Diskussion wurde sachlich und nachdenklich geführt, es gab einige bemerkenswerte Wortbeiträge. Dabei wurde deutlich, dass die Fronten quer durch alle Parteien verlaufen. Die Regierung wollte jedoch Einigkeit demonstrieren. Das dürfte der Grund dafür sein, dass die mit dem Themenkomplex befassten Ministerinnen in der Debatte schwiegen.Weder Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt und Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn, eher Befürworterinnen einer Gentechnik-Öffnung, äußerten sich, noch Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin, die der Präimplantationsdiagnostik und Embryonenforschung kritisch gegenübersteht. Lediglich Bundeskanzler Gerhard Schröder ergriff das Wort, und zwar in seiner Funktion als Abgeordneter. Er plädierte für eine „Ethik des Heilens und des Helfens“, die ebenso Respekt wie die „Achtung der Schöpfung“ verdiene. „Ich sehe nicht, dass sich beides gleichzeitig ausschließt“, sagte der Abgeordnete Schröder. Er sprach sich für eine „begrenzte Forschung“ an überzähligen befruchteten Eizellen aus, die bei der In-vitro-Fertilisation in Deutschland anfallen. Auch die Präimplantationsdiagnostik befürwortet er. Unter Anspielung auf die kritische Rede von Bundespräsident Johannes Rau am 18. Mai in Berlin fragte er: „Ist der Rubikon wirklich überschritten, wenn ein Verfahren, das im Mutterleib angewendet werden darf, auf Embryonen, die durch künstliche Befruchtung entstanden sind, übertragen werden soll?“ Die PID sei ein „rein diagnostisches und kein therapeutisches Verfahren“. Nach seiner Ansicht sei die Methode „in genau den Grenzen“ zu verantworten, wie die medizinische Indikation beim Schwangerschaftsabbruch zugelassen sei. Ohne sie direkt anzusprechen, wandte sich Schröder gegen die Justizministerin, die die Anwendung der neuen Verfahren als grundgesetzwidrig bezeichnet hatte. „Ich stimme Herrn Schmidt-Jortzig ausdrücklich zu, wenn er darauf hinweist, dass der Rückgriff auf das Verfassungsgericht zurzeit wenig hilft“, sagte Schröder. 93 D O K U M E N T A T I O N Ganz anderer Auffassung war der SPD-Abgeordnete Wolfgang Wodarg, der seine Haltung anschaulich erläuterte. Wodarg, selbst Arzt, berichtete über ein Gespräch unter Kollegen. Ein Bonner Gynäkologe hatte einer Mutter freigestellt, ihr Kind mit Lippenkiefergaumenspalte abzutreiben. „Er hat gesagt, das Kind wäre der Mutter nicht zuzumuten gewesen, sie hätte das nicht ausgehalten.“ Neben ihm habe einer der besten deutschen Pädiater gesessen, dem man angesehen habe, dass er als Kind an einer solchen Lippenkiefergaumenspalte operiert worden war. „Da wurde für mich sehr deutlich, in welchem Maße dieses Thema auch mit Menschenwürde zu tun hat.“ Ein entschiedener Gegner der PID ist auch Hüppe, der stellvertretende Vorsitzende der Enquete-Kommission. Zur Unterstützung seiner Argumentation führte er eine Erhebung an, wonach bei Paaren, die PID in Anspruch nahmen, trotz teilweise mehrfacher Versuche nur jede siebte Frau ein Kind ausgetragen habe. „Das ist ein Menschenverbrauch, den ich nicht akzeptieren kann.“ Auch das Argument, dass Präimplantationsdiagnostik Abtreibungen vermeide, sei falsch: „Die Statistik belegt, dass vier Prozent der Föten nach Pränataldiagnostik abgetrieben und fünf Prozent durch so genannte Mehrlingsreduktionen getötet wurden. Wer diesen Menschenverbrauch leugnet, der macht sich nicht nur am menschlichen Leben schuldig, sondern auch an den Eltern, die den Versprechungen der PID-Befürworter glauben.“ Diese Auffassung findet in der Union Befürworter, aber keineswegs ungeteilte Zustimmung. So lehnte die CDUParteivorsitzende Angela Merkel ein „radikales Nein“ zur PID ab. Es falle ihr in bestimmten Fällen schwer, Eltern, die bereits ein behindertes Kind haben, dieses Verfahren zu verwehren. Merkel wies jedoch darauf hin, dass es weder das Recht auf ein gesundes Kind noch auf ein Kind überhaupt gebe. Es gebe lediglich die Hoffnung auf ein gesundes Kind. Die CDU-Vorsitzende forderte ein Moratorium: Solange es keine politische Entscheidung gebe, müsse PID und Embryonenforschung verboten 94 bleiben. Auch ein Import von pluripotenten Stammzellen sei mit dem Geist des Embryonenschutzgesetzes nicht vereinbar. Merkel kündigte inzwischen an, die Union wolle dazu einen Gesetzentwurf einbringen. Auslöser ist der Vorstoß des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Wolfgang Clement (SPD). Clement befürwortet den Import embryonaler Stammzellen aus Haifa und hat Fördergelder des Landes Nordrhein-Westfalen zugesichert (dazu das Interview mit dem Bonner Forscher Oliver Brüstle in diesem Heft). Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Friedrich Merz, ging deutlich auf Distanz zu seiner Parteivorsitzenden. Merz warnte davor, den Zeitpunkt der Menschwerdung nach hinten zu verschieben. Damit sei dann nicht nur am Beginn, sondern auch am Ende des menschlichen Lebens der absolute Schutz des Grundgesetzes relativiert. Er befürchtet, dass mit der Einführung von PID der Selektion „Tür und Tor geöffnet“ werde. „Im Reagenzglas werden genauso wie die schweren genetischen Defekte auch positive genetische Dispositionen feststellbar sein. Wo ist die Grenze? Wer trifft die Entscheidung?“ fragte Merz. Der CDUFraktionsvorsitzende wandte sich wie die meisten Redner seiner Partei gegen die Stammzellforschung mit Embryonen. Aber auch in dieser Frage geht ein Riss durch die Union. So verbindet Peter Hintze mit der embryonalen Stammzellforschung die „Hoffnung, schwere Krankheiten heilen zu können“. Die Grünen äußerten sich vorwiegend ablehnend gegenüber Embryonenforschung und PID. Die frühere Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer befürchtet, „dass sich bei der Präimplantationsdiagnostik eine Begrenzung nicht einhalten lässt, dass die Nachfrage nach diesem Verfahren steigen wird, sodass es immer selbstverständlicher sein wird, von künftigen Eltern zu verlangen, dass sie kein krankes Kind bekommen oder dass sie sich vielleicht sogar, wenn sie es doch wollen, dafür rechtfertigen.“ Der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Rezzo Schlauch, betonte jedoch, dass seine Partei die Hoffnung der Kranken und die Sorgen der Eltern ernst nehme. „Wir wollen Gentechnik deswegen dort zulassen, wo sie den Menschen tatsächlich hilft und sie nicht gefährdet.“ Auch die PDS ist bei der Beurteilung der Gentechnik gespalten. Darauf wies der Fraktionsvorsitzende der PDS, Roland Claus, hin. Tradierte Wertvorstellungen reichten für diese Debatte jedenfalls nicht aus. Die PDS-Abgeordnete Angela Marquardt warnte vor „einer Entwicklung, die letztlich dazu führt, dass der Mensch nicht mehr die Gesellschaft verbessert und lebenswerter macht, sondern dass sich die Menschen an bestehende Umstände anzupassen haben“. Keine alleinige Verantwortung der Ärzte Eindeutig legte sich nur die FDP fest. Sie sprach sich geschlossen für die neuen Möglichkeiten der Gentechnik aus. Der frühere Justizminister Edzard Schmidt-Jortzig sagte zwar, dass die Menschenwürde gegen nichts abwägbar sei, der Schutz des Menschenlebens lasse aber sehr wohl Einschränkungen zugunsten anderer Rechtsgüter zu. FDP-Fraktionschef Wolfgang Gerhardt warb für eine Zulassung der Präimplantationsdiagnostik in engen Grenzen. Es müsse moralisch und ethisch ausgelotet werden, ob menschliches Leid durch die Möglichkeiten der Gentechnik beseitigt werden könnte. Klare Entscheidungen forderte der Präsident der Bundesärztekammer, Jörg-Dietrich Hoppe, anlässlich der Debatte: „Wir brauchen widerspruchsfreie rechtliche Regelungen, die von der Gesellschaft akzeptiert und durch unsere ethischen Werte begründet werden. Deshalb kommt für die Ärzteschaft auch bei der Präimplantationsdiagnostik keine Regelung infrage, die den Ärzten die alleinige Verantwortung zuschiebt und ihr Handeln als rechtswidrig Gisela Klinkhammer erscheinen lässt.“ D O K U M E N T A T I O N Heft 24, 15. Juni 2001 Embryonale Stammzellforschung Die Mechanismen entschlüsseln und auf adulte Zellen anwenden Interview mit dem Bonner Neuropathologen Prof. Dr. med. Oliver Brüstle Herr Brüstle, weshalb drängen Sie derzeit so darauf, dass wissenschaftspolitische Entscheidungen in Richtung embryonaler Stammzellforschung getroffen werden? Brüstle: Seit eineinhalb Jahren wird bereits intensiv über dieses Thema diskutiert. Inzwischen arbeiten international zahlreiche Teams an der Umsetzung der Stammzell-Technologie, aus embryonalen Stammzellen des Menschen Spenderzellen für die Transplantationsmedizin herzustellen. Wir haben in der Vergangenheit Erfolge im Bereich des Nervensystems am Tiermodell erzielen können. Jetzt sind wir stark daran interessiert, diese Befunde auf menschliche Zellen umzusetzen.Wenn die Diskussion weiterhin hinausgezögert wird, sehe ich die Gefahr, dass wir uns langfristig abkoppeln. DÄ: Sie waren gemeinsam mit dem NRW-Ministerpräsidenten Wolfgang Clement in einem Labor in Haifa, Israel. Warum ist dieses für Sie so interessant? Brüstle: In Haifa ist eine der Gruppen, der es gelungen ist, humane embryonale Stammzellen herzustellen. Und wir sind im Moment auf der Suche nach Partnern, mit denen sich unsere Vorstellungen verwirklichen lassen. DÄ: Sie haben derzeit einen Partner in den USA.Wollen Sie den auswechseln? Brüstle: Wir halten weiterhin Kontakt zu dem Campus an der Universität Madison,Wisconsin. In Israel handelt es sich lediglich um Sondierungsgespräche. Wir sind daran interessiert, einen Partner zu finden, mit dem sich eine langfristige, faire Partnerschaft verwirklichen lässt, ohne in eine zu starke Abhängigkeit zu geraten. Hier bieten sich in Israel möglicherweise andere Perspektiven als in den USA. DÄ: Wo liegt der Unterschied? Brüstle: Der Austausch von Zellen ist an strenge Auflagen gebunden. Quasi al- DÄ: le Ergebnisse, die mit diesen Zellen erzielt werden, fallen an den Partner in den USA. Auch das Forschungsprojekt selbst, das man bearbeiten will, muss von dem Partner genehmigt werden. Diese ausgeprägte Abhängigkeit spielt die eine Rolle, zudem sind aber die Zelllinien in Haifa sehr erfolgversprechend – sofern man das nach dem ersten Besuch beurteilen kann. Es geht aber um mehr als um einen Austausch von Zelllinien. Es ist ein sehr intensiver personeller Austausch mit Israel möglich. Auch dazu wurden bereits erste Gespräche geführt. Momentan sind jedoch noch keinerlei Vereinbarungen getroffen worden. Keinesfalls sollen aber Dinge durchgeführt werden, die den rechtlichen Rahmen in Deutschland umgehen würden. Es geht nicht um die Herstellung neuer ES-Zelllinien, es geht nicht um Embryonenforschung, sondern um die Nutzung pluripotenter Zelllinien. DÄ: Welche Projekte planen Sie mit Haifa? Brüstle: In der Vergangenheit ist es uns gelungen, Spenderzellen für das Nervensystem aus embryonalen Stammzellen der Maus herzustellen und am Tiermodell einzusetzen. Dort wollen wir anknüpfen und prüfen, ob es möglich ist, aus humanen embryonalen Stammzellen in gleicher Weise Vorläuferzellen des Nervensystems in der Zellkultur herzustellen. Im nächsten Schritt müssten diese Zellen am Tiermodell erprobt werden. Erst dann kann abgewogen werden, inwieweit diese Technik verbreitert werden soll, und ob diese Zellen für zukünftige Behandlungsstrategien infrage kommen. DÄ: Wie lange wird das dauern? Brüstle: Insgesamt rechne ich mit mindestens fünf bis zehn Jahren, bis überhaupt abgeschätzt werden kann, in welcher Art und Weise und in welchem Umfang embryonale Stammzellen klinisch relevant sind. Das schließt auch den Vergleich mit adulten Stammzellen ein. Dann erst würden klinische Studien folgen. DÄ: Über die klinische Relevanz der Stammzellforschung wird viel spekuliert. Wo liegen die realen Chancen? Brüstle: Die große Perspektive ist, Spenderzellen für Zellersatz – nicht für Organersatz – in nahezu unbegrenzter Menge herzustellen. Es bietet sich die Möglichkeit, eines der Kernprobleme der Transplantationsmedizin langfristig zu lösen, nämlich den Mangel an Spendergewebe. Die zweite Perspektive ist, Probleme der Abstoßungsreaktion zu umgehen, indem Zellen mit identischer Erbinformation hergestellt werden. Dies ist im Bereich der adulten Stammzellen durch Gewinnung der Zellen direkt vom Patienten, im Bereich der embryonalen Stammzellen durch Kernreprogrammierungsstrategien möglich. DÄ: Kernreprogrammierung – wäre das nicht therapeutisches Klonen? Brüstle: Es läuft im weitesten Sinne darauf hinaus. Doch ich glaube nicht, dass dieses Konzept jemals therapeutisch eingesetzt wird. Und zwar aus zwei Gründen: Erstens wären Eizellspenden in großer Zahl nötig, zweitens würden auf diese Weise Blastozysten erzeugt, also Embryonen. Beides ist aus ethischer Sicht hochproblematisch und sollte nach meiner Ansicht nicht durchgeführt werden. Auch eine naturwissenschaftliche Argumentation spricht dagegen: Bis heute sind die Prozesse der Kernreprogrammierung völlig unverstanden. Fehlentwicklungen können nicht ausgeschlossen werden. Zellen, die auf diese Weise hergestellt werden, bergen unter Umständen Schäden, die wir im Zellkulturstadium gar nicht erkennen können. 95 D O K U M E N T A T I O N DÄ: Sollte man auf dem Gebiet der Kernreprogrammierung forschen? Brüstle: Meine Vorstellung geht dahin, die unbekannten Mechanismen durch Kernreprogrammierungs-Studien an tierischen Zellen zu entschlüsseln, um sie dann langfristig auf adulte humane Zellen anzuwenden. Es besteht die Idee, adulte Zellen direkt in ein pluripotentes Stadium umzuprogrammieren, das dem einer embryonalen Stammzelle entspricht. Die Erzeugung der Blastozyste würde so umgangen. Wir hätten dann eine Fusion von adulter und embryonaler Stammzelltechnologie, die es uns erlauben würde, die Vorteile pluripotenter Stammzellen zu nutzen und gleichzeitig die ethisch kritischen Bereiche zu umgehen. DÄ: Reichen für die Kernreprogrammierungs-Studien Zellen tierischen Ursprungs aus? Brüstle: Zunächst schon. Es wäre aus meiner Sicht unverantwortlich, Untersuchungen auf humane Zellen auszuweiten, bevor nicht alles erdenklich Mögliche am Tierexperiment gemacht worden ist. Natürlich müssen die Ergebnisse schließlich am Menschen validiert werden. Beim therapeutischen Klonen besteht allerdings die Hoffnung, dass dies ohne Erzeugung von Embryonen möglich sein wird. DÄ: In den USA haben Sie eine Methode entwickelt, mit der man durch Zellkultur aus embryonalen Stammzellen Nervenzellen herstellen kann. Wie funktioniert diese? Brüstle: Embryonale Stammzellen können prinzipiell in alle Gewebetypen ausreifen. Das Schüsselproblem ist, diese Entwicklung in die gewünschte Richtung zu steuern und die Zellpopulation so aufzureinigen, dass keine unreifen embryonalen Zellen mehr vorhanden sind. Denn diese könnten nach der Transplantation Teratome erzeugen. DÄ: Wie steuern Sie die Ausreifung? Brüstle: Die Zellen werden zunächst unter der Anwesenheit von Wachstumsfaktoren auf embryonalen Fibroblasten beliebig vermehrt. Dann werden die Zellen zu Embryoidkörperchen zusammengelagert. Dies sind Zellaggregate, in denen spontan die Ausreifung in verschiedene Gewebetypen stattfindet. Nach einigen Tagen werden die Embryoidkörperchen in Zellkulturlösun- 96 gen überführt, die so zusammengesetzt sind, dass bevorzugt Zellen des Nervensystems überleben. Diese werden dann durch Wachstumsfaktoren gezielt vermehrt. DÄ: Werden Zellen, die nicht gewünscht sind, während des Verfahrens vernichtet? Brüstle: Um zur Zelltyp-Spezifizierung zu kommen, gibt es zwei Strategien: Zum einen werden Faktoren eingebracht, die eine bestimmte Zellpopulation bevorzugen und andere während des Kulturverfahrens ausmerzen. Bei der anderen Strategie werden Marker in embryonale Stammzellen eingefügt, die nur von bestimmten Zelltypen exprimiert werden, beispielsweise ein Antibiotikaresistenz-Gen oder ein grün fluoreszierendes Protein, das ausschließlich in den entstandenen Nervenzellen exprimiert wird. Durch Gabe eines Antibiotikums oder durch ein Sortierverfahren ist es möglich, diese Zelltypen anzureichern. DÄ: Wäre nach der Transplantation dieser gewonnenen Zellen nicht auch noch eine Eigendifferenzierung oder gar eine Tumorbildung denkbar? Brüstle: Dies ist ein ernst zu nehmendes Problem. Deshalb müssen vor einer klinischen Anwendung Langzeituntersuchungen stehen, die gewährleisten, dass diese Zellen über Jahre hinweg stabil in ihrem Zelltyp verankert bleiben. Eine Tumorbildung ist bei den von uns hergestellten hochaufgereinigten Gliazellen im Tierversuch bisher in keinem Fall vorgekommen. DÄ: In Großbritannien ist man bereits in die klinische Anwendung gegangen und hat Parkinson-Patienten fetale dopaminproduzierende Zellen transplantiert, von denen sich dann wohl auch einige zu Knochen- und Knorpelzellen entwickelt haben . . . Brüstle: Das sind Experimente, die nicht sauber durchgeführt wurden. Dabei handelt es sich um einen Ansatz, der nicht auf Stammzellen aufbaut, sondern auf der Isolation von Zellen aus dem fetalen Nervensystem. Wird das Verfahren – die Entnahme von Zellen aus der Hirnregion, aus der sich später die dopaminergen Neurone entwickeln – nicht sachgemäß durchgeführt, besteht die Gefahr, dass andere Gewebeteile mit transplantiert werden und sich spä- ter entwickeln. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die embryonale Stammzelltechnik. Dort müssen wiederum die undifferenzierten Zellen aussortiert werden, da diese nach Transplantation in alle möglichen Zellen ausreifen könnten. DÄ: Wie hoch ist die Gefahr der Abstoßung nach der Transplantation? Brüstle: Die Abstoßung ist ein Kernproblem der Transplantationsmedizin überhaupt. Um sie zu verhindern, wäre es bei den embryonalen Stammzellen denkbar, Banden von Zellen aufzubauen, in denen verschiedene Gewebetypen vorhanden sind, und dann für den jeweiligen Patienten einen gematchten Donor zu finden. Weiterhin ist es möglich, die Oberflächenstruktur dieser Zellen genetisch so zu verändern, dass Abstoßungsreaktionen zumindest gehemmt werden. Es ist über die Kernreprogrammierung langfristig möglich, pluripotente Zellen mit dem Erbgut desselben Patienten herzustellen. DÄ: Das wäre auch mit adulten Stammzellen möglich. Warum forscht man dann nicht zunächst an diesen? Brüstle: In der momentanen Diskussion werden die adulten Stammzellen oft als den embryonalen Stammzellen ebenbürtig dargestellt. Aus naturwissenschaftlicher Sicht kann man in meinen Augen jedoch nicht auf die Forschung an embryonalen Stammzellen verzichten. Diese haben wichtige Vorteile: eine uneingeschränkte Vermehrbarkeit über lange Zeiträume und die Möglichkeit der gezielten Ausreifung in der Zellkultur. DÄ: Doch neuen Publikationen zufolge sollen auch adulte Stammzellen in andere Gewebe einwandern und dort nicht nur Ursprungsgewebe bilden können . . . Brüstle: Es ist aber noch nicht möglich, diesen Transdifferenzierungsprozess gezielt in der Zellkultur zu steuern. Es gibt wohl einzelne Fälle, bei denen aus adulten Stammzellen verwandte Gewebszellen gezüchtet wurden. Es scheinen jedoch gravierende Unterschiede zu den embryonalen Stammzellen zu bestehen, da es sich bei diesen um eine Programmierung von einer unreifen in eine reife Zelle handelt. Bei den adulten Stammzellen handelt es sich um eine Umprogrammierung von einer spezifischen Zelle in eine andere gewe- D O K U M E N T A T I O N bespezifische Zelle. Diesen Prozess kann man heute noch nicht gezielt in einer Zellkultur ablaufen lassen.Auch die Vermehrbarkeit ist eingeschränkt. Seit vielen Jahren wird bereits versucht, Knochenmarks-Stammzellen außerhalb des Körpers zu vermehren. Die Erfolge sind jedoch sehr ernüchternd. Diese Kernprobleme müssen gelöst werden, bevor die adulten Stammzellen Äquvalenz erreichen können. DÄ: Mit den embryonalen Stammzellen taucht aber die ethische Problematik auf.Verletzt man in Ihren Augen ethische Normen mit der embryonalen Stammzellforschung? Brüstle: Mit der Gewinnung dieser Zellen ist sicher eine ethische Problematik verbunden. Darüber denken wir sehr ernsthaft nach. Einerseits ist auch bei bereits existierenden Zelllinien letztlich ein Embryo verbraucht worden. Auf der anderen Seite steht die ärztliche Verpflichtung, nach neuen Behandlungsstrategien zu suchen. Im Nervensystem ist die Situation besonders prekär, da dort so gut wie keine Regeneration stattfindet. DÄ: Könnte man dann nicht alles und jedes mit der ärztlichen Behandlungspflicht und dem Wunsch zu Heilen begründen, auch therapeutisches Klonen oder Keimbahninterventionen? Brüstle: Da müssen ganz klare Grenzen gezogen werden. Für mich wäre ein Einsatz nur unter klar definierten Bedingungen zu akzeptieren. DÄ: Welche wären das? Brüstle: Weder für Forschungs- noch für therapeutische Zwecke dürfen Embryonen gezielt hergestellt werden. Eingriffe in die Keimbahn und reproduktives Klonen müssen verboten bleiben. Auf der anderen Seite halte ich es durchaus für erwägenswert, so genannte überzählige Embryonen, für die keinerlei andere Verwendung vorgesehen ist, mit Zustimmung der Eltern in begrenzter Zahl und unter strenger Kontrolle für die Gewinnung von Zelllinien einzusetzen. Dabei handelt es sich nicht um eine verbrauchende Embryonenforschung im großen Maßstab.Wenige Zelllinien würden genügen, um alle Zentren in Europa mit Zellen auszustatten. DÄ: Der Import von pluripotenten Zellen nach Deutschland würde also genügen? Brüstle: Im ersten Schritt ist der Import die einzige Lösung, die überhaupt praktikabel ist, auch aufgrund der rechtlichen Situation. Zunächst geht es darum, die prinzipielle Übertragbarkeit der Befunde von Mauszellen auf menschliche Zellen zu überprüfen. Dafür kann man auf bestehende Zelllinien zurückgreifen. Wenn sich zeigt, dass diese Zellen halten, was die Mauszellen versprechen, kann darüber nachgedacht werden, ob es in begrenzter Zahl, unter strengen Auflagen und nur an ausgewählten Zentren möglich sein soll, solche Zelllinien auch in Deutschland herzustellen. Es scheint mir – wenn wir uns für die Technologie entscheiden – zudem wenig konsequent, jetzt kritische Bereiche ins Ausland zu verlagern oder sie gar moralisch zu verurteilen, um dann in fünf bis zehn Jahren den Nutzen zu reimportieren. Wenn wir uns gegen die Forschung an embryonalen Stammzellen entscheiden, sollte das auch konsequent sein. Auch die DFG spricht sich in ihrer Stellungnahme dafür aus, eine begrenzte Herstellung eigener Zellinien zu überdenken, wenn der Import nicht ausreiche. DÄ: In Deutschland gibt es nach dem Embryonenschutzgesetz keine oder nur ganz wenige überzählige Embryonen. Könnten diese überhaupt ausreichen? Brüstle: Nach den Ergebnissen in Haifa zu urteilen, könnte eine geringe Zahl von Embryonen genügen, um dauerhaft vermehrungsfähige Zelllinien zu erzeugen.Allerdings hat meine Arbeitsgruppe keinen Anteil bei der Herstellung von embryonalen Stammzellen, sondern wir arbeiten ausschließlich mit bereits existierenden Zelllinien. DÄ: Würde mit der Herstellung von Stammzellen in Deutschland der „Embryonenindustrie“ das Tor geöffnet? Brüstle: Gerade dies muss verhindert werden. Wenn wir den Bereich für eine therapeutische Nutzung öffnen, halte ich es für unabdingbar, dass die Grenzen klar gezogen werden. Es dürfte nur auf Embryonen zurückgegriffen werden, die aus anderen Gründen überzählig sind. DÄ: Glauben Sie , dass die DFG am 4. Juli Ihr Projekt und damit den Import der embryonalen Stammzellen billigt? Brüstle: Ja, ich bin optimistisch. Meine Befürchtung aber ist, dass das Projekt zwar nicht abgelehnt wird, aber sich ein erneuter zeitlicher Aufschub anbahnt. Der Antrag liegt jetzt bereits elf Monate bei der DFG. Die Entwicklung auf diesem Gebiet schreitet aber so rasant voran, dass es jetzt schon fraglich ist, ob wir überhaupt den Vorsprung, den wir auf tierexperimentellem Niveau hatten, noch halten können. Wenn wir die Diskussion weiter hinziehen, wird sie sich selbst totlaufen. Dann haben die Dinge, die wir machen wollten, andere Instituten im Ausland durchgeführt. DÄ: Würden Sie bei einem „Nein“ der DFG auf Ihre Forschung verzichten? Brüstle: Wenn es tatsächlich die demokratische Entscheidung gäbe, dass wir in Deutschland diese Technologie nicht wollen, dann muss sich der einzelne Wissenschaftler dieser Entscheidung auch anschließen. Aus persönlichen Gründen ins Ausland zu gehen, ist jedem selbst überlassen. Ich bin da im Moment noch unentschieden. DÄ-Fragen: Dr. med. Eva A. Richter, Norbert Jachertz Heft 25, 22. Juni 2001 Bioethik-Diskussion Gespaltene Fraktionen Bei keiner anderen Frage gehen die Ansichten innerhalb der Parteien so auseinander wie bei der Bioethik. Präimplantationsdiagnostik (PID) ja oder nein? Embryonale Stammzellforschung? Besonders die beiden Volksparteien SPD und CDU/CSU können sich auf keinen gemeinsamen Nenner einigen. Diametral unterschiedliche Positionen gibt es in der SPD-Fraktion. Für Bundeskanzler Gerhard Schröder verwirklicht sich die Würde des Menschen in erster Linie im Zugang zur Erwerbsarbeit, wie er als Antwort auf die Berliner Rede von Bundespräsident Johannes Rau (auch SPD) sagte. Dieser hatte 97 D O K U M E N T A T I O N am 18. Mai betont, dass Tabelle es „Dinge gibt, die wir Was soll man in der Biomedizin zulassen? um keines tatsächlichen – Antworten der Parteien (Stand 6. Juni 2001) oder vermeintlichen PID Embryonale Vorteiles willen tun dürStammzellforschung fen“. Sowohl PID als SPD unentschlossen, unentschlossen, auch Embryonenforkonträre Ansichten konträre Ansichten schung lehnt Rau ab. CDU/CSU CDU: unentschlossen CDU: nein Auch für JustizministeCSU: nein CSU: nein rin Herta DäublerGmelin (SPD) ist beiFDP ja ja des nicht mit der VerfasB90/Die Grünen nein nein sung vereinbar. Anders PDS unentschlossen, unentschlossen, verhalten sich die beieher nein eher nein den SPD-Ministerinnen Ulla Schmidt (Bundesgesundheitsministerin) und Edelgard CSU-Fraktion ebenfalls keinen innerBulmahn (Bundesforschungsministerin). parteilichen Konsens. Einig waren sich Sie wollen die PID in engen Grenzen er- die Abgeordneten lediglich, dass sie die lauben und halten die embryonale verbrauchende Embryonenforschung Stammzellforschung für diskutabel. Un- nicht zulassen wollen. Die CSU lehnt terstützt werden sie von der Vorsitzen- zudem die PID ab. Darauf kann (und den der Enquete-Kommission des Deut- will) sich die CDU aber nicht festlegen. schen Bundestages „Recht und Ethik der Im Vorfeld der Sitzung des CDUmodernen Medizin“, Margot von Renes- Bundesvorstandes, die gleichfalls am se. Sie meint, es liege in der Natur der 28. Mai stattfand, hatte der stellvertreWissenschaft, auch Tabus zu brechen. tende Parteivorsitzende der CDU, JürEine ausführliche bioethische Dis- gen Rüttgers, den Entwurf eines kussion am 28. Mai brachte der CDU/ Grundsatzpapiers vorgelegt, in dem er ´ C ´ die PID als „Diagnosemöglichkeit“ bezeichnete. Die Parteivorsitzende Angela Merkel schloss sich dieser Meinung an. Auch sie neige dazu, die PID unter bestimmten Restriktionen zuzulassen. Dies stieß auf innerparteiliche Kritik, so dass schließlich Rüttgers PID-Passagen im Positionspapier geändert wurden. Kein Ja, kein Nein, die Haltung der CDU bleibt offen. „Wir wollen die Diskussion weiter führen“, erklärte Merkel. Bereits vor Wochen hat sich die FDP mit ihrem Positionspapier eindeutig für PID und embryonale Stammzellforschung ausgesprochen. Sie betont die medizinischen und wirtschaftlichen Chancen der Biomedizin. Mitte Mai hat sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf eine gemeinsame Position verständigt. In ihrem Eckpunktepapier zur Gentechnikpolitik lehnt sie PID und Embryonenforschung ab und fordert zudem eine Präzisierung des Embryonenschutzgesetzes, um den Umgang mit „überzähligen“ Embryonen zu regeln. Noch nicht positioniert hat sich die PDS, doch sie scheint in dieser Frage die Ansicht der CSU und der Grünen zu Dr. med. Eva A. Richter teilen. Heft 25, 22. Juni 2001 Stammzellen Was Forscher wollen, was sie dürfen Die Biomedizin weckt die Hoffnung auf neue Therapieformen. Vor allem aber löst sie ethisch begründete Vorbehalte aus. R einhard Merkel ließ es wie Zauberei aussehen: Entnähme man einem frühen menschlichen Embryo eine totipotente Zelle mit einer Pipette, so erklärte der Hamburger Rechtsphilosoph, und setze sie anschließend wieder an ihren Platz zurück, dann unterscheide sich dieser Zustand in nichts von der Ausgangssituation. Nach dem Gesetz habe man aber das Vergehen einer „missbräuchlichen Verwendung eines menschlichen Embryonen“ begangen. Auch sei der Straftatbestand des „Klonens“ er- 98 füllt. Und durch die Rückführung der Zelle habe man von zwei Embryonen einen spurlos verschwinden lassen. Mit der Absurdität dieses Exempels brachte Merkel seine Kritik am Embryonenschutzgesetz (ESchG) zum Ausdruck. Blastomerenzelle = Embryo „Stammzellen und therapeutisches Klonen – Biomedizin ohne Grenzen?“ hieß die Tagung in Düsseldorf, mit der das Wissenschaftszentrum NordrheinWestfalen eine aktuelle gesellschaftliche Diskussion aufgriff. Die Tübinger Bioethikerin Eve-Marie Engels, Mitglied im Nationalen Ethikrat, und der Rechtswissenschaftler Rüdiger Wolfrum, Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), stellten in ihren Beiträgen juristische und ethische Probleme der Embryonenforschung heraus. Engels erläuterte, jede menschliche totipotente Zelle trage die Anlage, zu einem vollständigen Menschen heranzureifen, sei also bereits ein Embryo. Dies treffe auch für eine Blastomerenzelle zu. Aus dem Keimling entnommen, könne sie unter geeigneten Bedingungen zu einem menschlichen Individuum heranwachsen. Totipotente menschliche Zellen dürfen in Deutschland kraft des ESchG ausschließlich zu ihrem eigenen Nutzen, etwa in der In-vitro-Fertilisation (IVF), verwendet werden. Die Entnahme von pluripotenten Stammzellen aus dem weiteren Ent- D O K U M E N T A T I O N wicklungsstadium der Blastozyste sei ebenso untersagt wie eine Embryonenherstellung zu diesem Zweck, sagte Engels. Zwar habe eine pluripotente Zelle den Status eingebüßt, ein vollständiger Embryo zu sein, ihre Gewinnung, so Engels weiter, sei jedoch nicht ohne Zerstörung oder Schädigung des Embryos möglich. Ebenfalls verboten sei die Benutzung bereits existierender, so genannter überzähliger Embryonen aus der IVF zur Entnahme von Stammzellen. Der Import von im Ausland hergestellten, pluripotenten embryonalen Stammzellen (ES-Zellen) sei ethisch bedenklich, jedoch gesetzgeberisch nicht verboten. Nun würden Entwicklungen in der Biomedizin, etwa das therapeutische Klonen, die Frage aufwerfen, ob das ESchG geändert werden solle. Wolfrum erklärte, er halte eine Änderung des Gesetzes vorerst nicht für erforderlich. Die DFG lehne therapeutisches ebenso wie reproduktives Klonen nach wie vor ab. Vorrangig solle weiterhin die ethisch unbedenklichere Forschung an adulten Stammzellen (AS-Zellen) gefördert werden. Falls sich die Notwendigkeit einer Forschung an ES-Zellen bestätigen sollte und die bisherigen Möglichkeiten dafür nicht ausreichen, schlage die DFG eine „zeitlich befristete“ Lockerung des ESchG vor. In der Frage des Lebensschutzes des Embryos sieht Wolfrum eine Ähnlichkeit zur Abtreibungsfrage, auch wenn bei der Stammzellforschung dem Lebensrecht des Embryos kein direktes, den vitalen mütterlichen Bedürfnissen gleichwertiges Äquivalent entgegengestellt werden könne. „Der Preis einer eingeschränkten Eröffnung dieser Forschung unter wissenschaftlicher und ethischer Kontrolle kann gemessen an dem Schutz, den der Embryo im deutschen Recht de facto genießt, gering gehalten werden“, heißt es in seinem Thesenpapier. In der Diskussion wurde eingewendet, dass auch eine geringfügige Einschränkung des Lebensschutzes zwangsläufig seine Vernichtung zur Folge habe. Merkel ging so weit, „ein echtes subjektives Grundrecht des Embryos auf Lebens- und Würdeschutz“ generell in Abrede zu stellen. Visionen Einen ähnlichen Standpunkt vertrat der britische Genomforscher Austin Smith. Nach seiner Ansicht ist der Fetus bis zur Geburt noch kein Mensch, sondern lediglich als „Teil des menschlichen Lebenszyklus“ zu betrachten. Der Embryo müsse jedoch allein schon wegen seines gewaltigen Potenzials besonders geachtet und geschätzt werden.ES-Zellen,möglicherweise der „biomedizinische Rohstoff des 21. Jahrhunderts“, seien aus der inneren Zellmasse von Blastozysten leicht zu gewinnen. ES-Zellen seien fähig, sich in identische Zellen zu teilen und schier grenzenlos zu vermehren. Zugleich zeigten sie eine ausgeprägte Plastizität. Smith hofft, aus ihnen transplantierbare Ersatzgewebe zu züchten. Nach Stimulation mit Wachstumsfaktoren könnten sie in den Händen von Transplantationsmedizinern zu ausgezeichneten Werkzeugen werden. Bei zahlreichen bislang unheilbaren Krankheiten wie Herzinfarkt, Parkinsonismus, multipler Sklerose, Typ-1Diabetes oder Mukoviszidose seien künftig neue, sehr effektive Behandlungsmöglichkeiten denkbar. Schon bald könnten ES-Zellen in der pharmazeutischen Forschung eingesetzt werden. Smith führte aus, dass adulte Stammzellen sich weniger gut zur Weiterentwicklung der Gentherapie eigneten. Unter In-vitro-Bedingungen seien sie nicht so problemlos zu vermehren wie ES-Zellen. Ob die angestrebten Differenzierungsprozesse bei ES-Zellen tatsächlich gut steuerbar und eine etwaige Onkogenität beherrschbar seien, müsse vordringlich erforscht werden. Restriktionen auf nationaler Ebene dürften die internationale Zusammenarbeit nicht behindern, so Smith. Auftragsforschung Der Bonner Neuropathologe Oliver Brüstle kritisierte die bisherigen Forschungsbedingungen in Deutschland. In einem früheren Projekt hatte Brüstle tierische ES-Zellen zu Vorläuferzellen gezüchtet und in die Gehirne von Mäusen mit einer Markscheidenerkrankung transplantiert. Dort war der Zellersatz zu Myelin-bildenden Stützzellen ge- reift. Um weitere Forschungen auch mit menschlichen ES-Zellen durchzuführen, sei er aufgrund der Gesetzeslage in Deutschland jedoch auf Importe aus dem Ausland angewiesen, sagte Brüstle. Zelllinien, aber auch Verfahren und selbst die Forschungsergebnisse, müssten dem ausländischen Partner zurückgegeben werden. „Krass gesagt, das ist Auftragsforschung für das Ausland“, beschrieb er die Situation. Auch um nicht in den Ruf einer – so Brüstle – „Doppelmoral“ zu geraten, möchte er die rechtlichen Grundlagen für die Stammzellforschung in Deutschland neu geregelt wissen. Brüstle stellte dar, warum sich ESZellen für die Forschung besser eigneten als AS-Zellen. Einzelne Gene könnten aus dem Kernmaterial gezielt eliminiert und ein Zellersatz zu Transplantationszwecken einfacher hergestellt werden. AS-Zellen seien wenig proliferativ, ihre Anreicherung in der Zellkultur bislang selten gelungen und die gezielte Umzüchtung (Transdifferenzierung) noch wenig überzeugend. Als ein wichtiger Vorteil der AS-Zellen müsse jedoch deren immunologische Kompatibilität gesehen werden, da ihr Spender zugleich Empfänger sei. Ebenso dürfe nicht verkannt werden, dass die Forschung mit ES-Zellen gewisse Risiken berge. Diese beträfen ihre Zelltyp-Spezifizierung und den Reinheitsgrad der verwendeten Kulturen, was vielleicht zu Teratomen (Missbildungen) führen könnte. Einen Konflikt zwischen den Forschungen an ES-Zellen und AS-Zellen gibt es nach Brüstles Einschätzung nicht. Die meisten Stammzellforscher seien an beiden Richtungen interessiert, um sie miteinander zu vergleichen. Gewarnt werden müsse allerdings vor allzu optimistischen Erwartungen. Vor dem Einsatz beim Menschen seien viele abgestufte Vorversuche notwendig, und früheste Therapieerfolge erst in fünf bis zehn Jahren zu erwarten. Auswirkungen auf die Gesellschaft Ein entschiedenes Plädoyer für eine Beschränkung der Forschung auf ASZellen unternahm der amerikanische 99 D O K U M E N T A T I O N Heft 28–29, 16. Juli 2001 Wissenschaftsautor Jeremy Rifkin. Er wies auf Entwicklungen hin, zu denen die neuen Biowissenschaften in den angelsächsischen Ländern bereits geführt hätten. Dort seien Patente nicht nur auf Laborverfahren und Gensequenzen, sondern auch auf Stammzelllinien und Hybridlebewesen vergeben worden. Viele Biotechnologieunternehmen versuchten, sich mit den Entwicklungen in der Biomedizin „eine goldene Nase“ zu verdienen. Diese kommerziellen Interessen würden im Ringen um eine ethische und rechtliche Basis für die Embryonenforschung leider allzu oft übersehen. Rifkin behauptete, die Gesellschaft setze sich ohne Not der Gefahr einer neuen, kommerziell orientierten Form der Eugenik aus. Viele Gefahren („slippery slopes“) drohten allein schon durch die immanente Dynamik der biomedizinischen Technologie. Jeder Schritt fordere und rechtfertige den nächsten. Aber diese Entwicklungen seien später nicht mehr rückgängig zu machen. Zu wenig beachtet werde weiterhin, dass der Verlust genetisch bedingter rezessiver Eigenschaften sich in der Evolution des Menschen nachteilig auswirken könnte. Noch schwerer wiege, dass der Versuch einer Perfektionierung des Menschen durch Genmanipulation und Klonierung unweigerlich zu einem Verlust an Empathie, zu Geringerschätzung von Abweichung und Behinderung führe. Nach Rifkins Worten würden gesellschaftliche Auseinandersetzungen heute weniger durch Positionen wie „rechts“ oder „links“ als durch den Widerspruch zwischen „utilitaristischen und intrinsischen“ Werten geprägt. Solange es für die Biowissenschaftler aussichtsreiche und ethisch unbedenklichere Alternativen wie die Forschung an ASZellen gebe, sei nicht einzusehen, Embryonen als Rohstofflieferanten für zukünftige Therapieformen zu instrumentalisieren. Ärzte seien gut beraten, sich auf den hippokratischen Eid mit seinem „primum nihil nocere“ (vor allem nicht schaden) zurück zu besinnen. Dr. med. Peter Bartmann 100 Embryonale Stammzellen Entscheidung über Import vertagt SPD und Grüne haben im Bundestag die Forderung der Union nach einem Moratorium zur Einfuhr von Stammzellen zurückgewiesen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft verhält sich bisher abwartend. B undeskanzler Gerhard Schröder befürwortet die Forschung an embryonalen Stammzellen. Einen Import lehnt er allerdings ab. Er ist sich wohl bewusst, dass eine offene Auseinandersetzung dem Image der Koalition großen Schaden zufügen würde. Deshalb sprach sich die SPD gemeinsam mit den Grünen für einen Kompromiss aus: Zunächst wurde ein Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion abgelehnt. Darin heißt es: „Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, bis zu einer endgültigen Entscheidung des Deutschen Bundestages sicherzustellen, dass kein Import von embryonalen Stammzellen nach Deutschland stattfindet, deren Gewinnung die Tötung von Embryonen voraussetzt. Der Deutsche Bundestag appelliert an die Wissenschaftler in der Bundesrepublik Deutschland, bis zu einer entsprechenden Entscheidung des Deutschen Bundestages vom Import von und der Forschung an embryonalen Stammzellen abzusehen.“ Dagegen stimmte das Parlament mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen für einen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen und SPD, wonach sich der Bundestag voraussichtlich im Herbst mit der Frage der Forschung an importierten embryonalen Stammzellen unter Berücksichtigung von Stellungnahmen der Enquete-Kommission des Bundestages „Recht und Ethik der modernen Medizin“, des Nationalen Ethikrats und der Deutschen Forschungsgemeinschaft befassen soll. Auch in diesem Antrag wird an alle Forscher appelliert, der Entscheidung nicht durch Schaffung von vollendeten Tatsachen vorzugreifen. Sprecher der Koalitionsfraktionen wiesen darauf hin, dass die Forscher nicht zu einem Moratorium gezwungen werden könnten. Ein Importverbot sei außerdem nur bei einer entsprechenden Änderung des Embryonenschutzgesetzes (ESchG) möglich. SPD und Grüne hatten sich jedoch darauf verständigt, das ESchG in dieser Legislaturperiode nicht mehr zu novellieren. Ein „Moratorium in recht abgeschwächter Form“, so die stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Maria Böhmer, stellt allerdings auch der Antrag der Regierungskoalition dar. Doch auch in ihrer Fraktion gibt es keine Einigkeit. Während Böhmer forderte, die Forschung an adulten Stammzellen stärker zu fördern und eine verbrauchende Embryonenforschung abzulehnen, wollte der frühere Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer (CSU) eine Forschung an Stammzellen aus überzähligen Embryonen nicht ausschließen. Die SPD-Abgeordnete und Vorsitzende der Enquete-Kommission, Margot von Renesse, wies auf Versäumnisse des Parlaments hin, das die „derzeitige Hängepartie mit verschuldet“ und das Embryonenschutzgesetz nicht fortgeschrieben habe. Sie frage sich, „ob wir als Gesetzgeber nicht einiges verschlafen haben“. Die FDP sprach sich in einem eigenen Antrag für den Import von embryonalen Stammzellen aus. „Der Import embryonaler Stammzellen ist zum Zweck der Forschung zulässig, denn er ist laut Embryonenschutzgesetz nicht verboten“, sagte die FDP-Abgeordnete Ulrike Flach. Ein Importstopp sei aus forschungspolitischer Sicht nicht vertretbar: „Wer heute ein Moratorium verab- D O K U M E N T A T I O N schiedet, lähmt einen ganzen Forschungszweig“, so Flach. Der Antrag der FDP wurde allerdings mit den Stimmen aller anderen Fraktionen abgelehnt. Auch der Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), Prof. Dr. med. Jörg-Dietrich Hoppe, appellierte anlässlich der Bundestagsdebatte an die Wissenschaftler, ihren vorläufigen Verzicht auf die Forschung an embryonalen Stammzellen öffentlich zu erklären. „Die Zentren, die bereits solche Stammzellen importiert haben, sollten sich freiwillig einem Moratorium unterwerfen, bis der Bundestag eine eindeutige Entscheidung getroffen hat,“ forderte Hoppe. In einem Interview mit der Rheinischen Post verwies Hoppe darauf, dass er den Import embryonaler Stammzellen unter den jetzigen Umständen nicht für vertretbar hält. Ergebnisse von Forschungen an der Universität Essen könnten außerdem zu ganz neuen Überlegungen führen. Der Entwicklungsbiologe Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Hans-Werner Denker hält nämlich die Annahme, dass sich aus embryonalen Stammzellen keine Embryonen entwickeln können, für nicht ausreichend belegt. Dazu Hoppe: „Wenn Denker Recht hat, handelte es sich bei diesen Zellen um totipotente, also um Embryonen. Sie dürften natürlich für Forschung oder Experimente nicht zur Verfügung stehen. Wir gehen davon aus, dass Stammzellen nur noch pluripotent sind.“ Um die vielen Fragen der zellulären Entwicklungsbiologie zu klären, seien weitere intensive Forschungsanstrengungen notwendig. Die DFG wartet ab Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat ihre Entscheidung, ob die Forschung an humanen embryonalen Stammzellen gefördert werden soll, nochmals vertagt. Eigentlich stand die Behandlung des vor etwa einem Jahr gestellten Antrags der beiden Bonner Neuropathologen Priv.-Doz. Dr. med. Oliver Brüstle und Prof. Dr. med. Otmar Wiestler auf der Tagesordnung des DFG-Hauptausschusses am 3. Juli. Auf Vorschlag des Präsidiums wurde die Debatte darüber aber abgesetzt. Über die Vergabe von Fördermitteln für die hu- mane embryonale Stammzellforschung soll nun bei der Sitzung am 7. Dezember entschieden werden – „spätestens“. Damit wird die DFG der Bitte des Nationalen Ethikrates gerecht, Zeit für die eigene Diskussion zu gewinnen. Sie wolle die von ihr gewünschte und selbst angestoßene Diskussion nicht durch eine konkrete Förderentscheidung beeinflussen, heißt es in der Stellungnahme. Lieber wolle man im Dezember auf der Basis der dann geltenden Rechtslage ein Votum abgeben. Prof. Dr. ErnstLudwig Winnacker, Präsident der DFG, will abwarten. „Eile ist auch jetzt nicht geboten“, betonte er in Berlin. Ein Aufschub des Votums brächte keinen wesentlichen Schaden für die deutsche Wissenschaft. Der Nationale Ethikrat will sich in seiner nächsten Sitzung am 27. September mit dem Thema befassen. Dies gab der Vorsitzende, Dr. Spiros Simitis, am 9. Juli in Berlin bekannt. Der Rat wolle aber im Herbst keinem Entscheidungsgremium die Kompetenz abnehmen, sondern nur Argumente aufbereiten und der Regierung und dem Deutschen Bundestag zur Verfügung stellen, betonte Simitis. Die Forscher hingegen drängen. Die Entwicklung auf dem Gebiet der embryonalen Stammzellforschung schreite so schnell voran, dass man leicht den Anschluss verpassen könnte, warnte Brüstle (DÄ, Heft 24/2001). Einen Aufschub der DFG-Entscheidung hatte er bereits vor einem Monat befürchtet. Er betonte jedoch, dass er an einer offenen Diskussion und an einer transparenten Forschung interessiert sei. Deshalb habe er vor Beginn weiterer Forschungsaktivitäten einen Antrag bei der DFG gestellt. Bisher hat Brüstle nur an embryonalen Stammzellen der Maus geforscht. „Es war gut, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft nicht vorzeitig Fakten geschaffen und den Förderantrag von Professor Brüstle zur Forschung an importierten Stammzellen bis zum Jahresende zurückgestellt hat“, lobte am 4. Juli Bundeskanzler Gerhard Schröder bei der DFG-Jahresversammlung 2001 in Berlin. „Gerade in dieser Frage, die wie kaum eine andere das Selbstverständnis der Menschen berührt,brauchen wir eine offene und gewissenhafte Debatte sowie mehr Information und Aufklärung.“ Deshalb habe er auch den Nationalen Ethikrat berufen. Allerdings solle dieser nicht stellvertretend für Politik und Gesellschaft abschließend und verbindlich entscheiden, die Diskussion könne auch nach seinem Votum kontrovers weitergeführt werden. Schröder bekräftigte, dass die Qualität der Forschung ganz wesentlich für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes sei. Ethische Fragen dürften nicht nach wirtschaftlichem Nutzen entschieden werden. Doch es sei klar, dass neue wissenschaftliche Erkenntnisse es erforderlich machen könnten, weltanschauliche Grundsätze neu zu bewerten. Das Embryonenschutzgesetz will Schröder derzeit jedoch nicht ändern. „Auf seiner Basis ist der Import embryonaler Stammzellen erlaubt“, erklärte er. „Das schafft hinreichende Sicherheit für unsere Forscher.“ Embryonale Stammzellen bereits importiert Was nicht verboten ist, ist erlaubt – diesen Grundsatz nutzen einige Wissenschaftler. Sie haben humane embryonale Stammzellen bereits nach Deutschland importieren lassen, ohne dies bei der DFG zu beantragen oder gar von ihr genehmigen zu lassen. Dies wurde wenige Tage vor der geplanten Entscheidung bekannt. So bestätigten die Universitätskliniken in Lübeck, München und Köln, dass sie embryonale Stammzellen bei der Firma WiCell, USA, bestellt und von ihr erhalten haben. Die Wissenschaftler versicherten aber gleichzeitig, vor einer politischen Regelung in Deutschland nicht an diesen Zellen zu forschen. Auch die Kieler Universität plante, in den nächsten Wochen embryonale Stammzellen von der australischen Firmas ES Cell International zu importieren. Außer den genannten Universitäten ist derzeit nicht bekannt, dass andere Einrichtungen in Deutschland bereits embryonale Stammzelllinien erworben haben. Denkbar wäre dies jedoch. Weitere Import-Anträge lägen der DFG jedoch nicht vor, bestätigte Winnacker. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass es jedermann frei gestellt sei, embryonale Stammzellen zu importieren, 101 D O K U M E N T A T I O N da es sich dabei nicht um Embryonen handele. Das Embryonenschutzgesetz würde in diesem Fall nicht greifen; die Forscher müssten demzufolge nicht einmal eine Gesetzeslücke nutzen. Für die Kontrolle des Import von embryonalen Stammzellen fühlt er sich nicht verantwortlich: „Wir sind keine Forschungspolizei.“ Der DFG-Präsident schlug deshalb vor, die Arbeit an embryonalen Stammzellen von einer unabhängigen Kommission überwachen zu lassen, ähnlich der Zentralen Kommission für biologische Sicherheit. Diese solle die Rahmenbedingungen für den Import und die Arbeit an den Zellen festlegen und von einem Genehmigungsverfahren abhängig machen. Die DFG kümmere sich um die Anträge und die Einhaltung von wissenschaftlichen, ethischen und rechtlichen Grundlagen dieser Anträge. „Als Verteiler staatlicher Mittel zielt unser Einsatz darauf ab, die Stammzellforschung nicht in den privaten Sektor abzudrängen, sondern in der gebotenen Transparenz stattfinden zu lassen“, betonte der DFG-Präsident. Gisela Klinkhammer/Dr. med. Eva A. Richter Heft 33, 17. August 2001 Embryonenschutz Keine Entscheidung ohne qualifizierte Beratung Bei Schwangerschaftskonflikten nach pränataler Diagnostik und auch im Falle der Zulassung von Präimplantationsdiagnostik sind eine angemessene Aufklärung sowie eine Pflichtberatung erforderlich. D ie Eigenverantwortung von Patientinnen und Patienten ist in der Medizinethik ein maßgebendes Leitbild geworden. Voraussetzung dafür sind Aufklärung und Beratung, die in der Reproduktions- und Pränatalmedizin unter dem Aspekt des Embryonenschutzes einen besonders hohen Stellenwert besitzen. So wird in der gegenwärtig geführten Diskussion über eine Zulassung der Präimplantationsdiagnostik (PID) in Deutschland immer wieder auf das Erfordernis einer Pflichtberatung verwiesen. Die Auseinandersetzung mit deren Inhalt droht dabei aber ebenso zu kurz zu kommen wie der Blick auf Defizite in vergleichbaren Konfliktsituationen. Hohe Anforderungen an die Qualität der Aufklärung Eine angemessene Aufklärung ist notwendige Voraussetzung der rechtlich wirksamen Einwilligung von Patienten 102 in eine diagnostische oder therapeutische ärztliche Intervention. Die Anforderungen an die Qualität der Aufklärung sind umso höher, – je folgenschwerer die Intervention sein kann (im Sinne von Risiken sowie psychischen Belastungen für die Patientin oder den Patienten selbst, aber auch für vorgeburtliches menschliches Leben), – je größer der Entscheidungsspielraum ist (aufgrund der Möglichkeit, medizinisch, aber auch ethisch gleichrangige oder zumindest erwägenswerte alternative Optionen in Anspruch zu nehmen), und – je komplexer und ferner vom jeweiligen intuitiven Vorverständnis der Ablauf und die möglichen Folgen der Intervention sind. Diesen Kriterien gemäß sind die Anforderungen an die Beratung in der Reproduktions- und Pränatalmedizin besonders hoch. Deshalb muss ärztliche Beratung in ihrem Umfang, im Spektrum der vermittelten Inhalte und in der Qualifikation der Berater höchsten Maßstäben genügen. Sie bedarf spezifischer berufsrechtlicher Verankerung und einer entsprechend qualifizierenden Unterweisung. Ziel dieser Regelungen und ihrer praktischen Umsetzung muss es sein, bei den Ratsuchenden einen als Grundlage autonomer Entscheidungen hinreichenden Kenntnisstand über die medizinischen Fakten, die möglichen sozialen Folgen sowie über die ethischen und rechtlichen Probleme zu vermitteln. Von zentraler Bedeutung ist dafür die Verpflichtung sowohl der auf diesem Gebiet tätigen medizinischen Einrichtungen, geeignete Beratungsangebote sicherzustellen, als auch der Ratsuchenden, diese Angebote tatsächlich wahrzunehmen. Eine solche Pflichtberatung ist so auszugestalten, dass sie die Entscheidungsfreiheit der Frau und der Familie nicht einschränkt. Daher ist eine möglichst umfassende und zugleich ergebnisoffene Beratung erforderlich. Bei reproduktionsmedizinischen Fragen kommt einer solchen Beratung besonderes Gewicht zu, weil Entscheidungen für oder gegen diese Verfahren stets Dritte mitbetreffen, nämlich das ungeborene Leben und Angehörige. Diagnostik im reproduktionsmedizinischen Kontext geht über die übliche medizinische Diagnostik hinaus. Das bedeutet, dass nicht nur vor einer Diagnostik individuell beraten werden muss, sondern dass auch die Ergebnisse der Der Beitrag wurde von der Arbeitsgruppe „Reproduktionsmedizin und Embryonenschutz“ der Akademie für Ethik in der Medizin verfasst: Dr. theol. Markus Babo, M.A., Katholisches Pfarramt Gommiswald/Schweiz; Ass. jur. Urs Peter Böcher, Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht, Universität Mainz; Priv.-Doz. Dr. med. Wolfram Henn, Institut für Humangenetik, Universität des Saarlandes; Prof. Dr. phil. Dipl.-Biol. Uwe Körner, Universitätsklinikum Charité, Humboldt-Universität zu Berlin; Prof. Dr. theol. Hartmut Kreß, Abt. Sozialethik, Evang.-Theol. Fakultät, Universität Bonn; Prof. Dr. sc. agr. Hans-Wilhelm Michelmann, Frauenklinik, Universität Göttingen; Dr. med. M.A. phil. Fuat S. Oduncu, Medizinische Klinik, Klinikum der Universität München – Innenstadt, Dr. phil. Alfred Simon, Akademie für Ethik in der Medizin e.V.; Prof. Dr. jur. Christiane Wendehorst, Abt. für Arzt- und Arzneimittelrecht, Juristisches Seminar, Universität Göttingen; Dipl.Biol. Christa Wewetzer, Zentrum für Gesundheitsethik, Evangelische Akademie Loccum D O K U M E N T A T I O N Diagnostik anschließend in interpretierenden Beratungsgesprächen erörtert werden müssen [1]. Derzeit ist noch nicht entschieden, ob in Deutschland die PID zugelassen wird. 1. Für den Fall einer Zulassung nennt der Diskussionsentwurf der Bundesärztekammer (BÄK) [2] Mindeststandards für die Beratung im Zusammenhang mit der PID, die keinesfalls unterschritten werden dürfen. Gefordert ist in diesem Diskussionspapier die Beteiligung von Humangenetikern und Gynäkologen am Beratungsprozess. Darüber hinaus muss auch psychosoziale und ethische Beratungskompetenz eingebracht werden. Zur Forderung des Entwurfs, in der Beratung als zur PID alternative Handlungsoptionen zum Beispiel „Adoption oder Verzicht auf eigene Kinder“ und „im Falle einer Schwangerschaft die Möglichkeit zur pränatalen Diagnostik“ darzustellen, müssen als weitere Alternativen ergänzt werden: „Realisierung des Kinderwunsches im Bewusstsein des individuellen Risikos von Kindern des Paares für die in Rede stehende Krankheit“ sowie „Möglichkeit der heterologen Fertilisation (Insemination beziehungsweise – falls künftig zugelassen – Eizellspende)“. Zudem müssen ethische, psychosoziale und rechtliche Aspekte der PID und der verfügbaren Alternativen thematisiert werden. Zu den ethischen Aspekten gehört der Sachverhalt, dass durch die Präimplantationsdiagnostik der embryonale Lebensschutz relativiert wird. Schutz von vorgeburtlichem Leben Die grundsätzlich zu fordernde Trias Beratung – Diagnostik – Beratung kann im biologisch vorgegebenen engen zeitlichen Rahmen einer PID an praktische Grenzen stoßen. Umso umfassender müssen in der Beratung vor der PID die aus der künstlichen Befruchtung und der Diagnostik resultierenden Handlungsoptionen erörtert werden. 2. Für den Fall, dass die PID in Deutschland nicht zugelassen wird, muss die Tatsache berücksichtigt werden, dass für an Präimplantationsdiagnostik interessierte Paare Angebote im Ausland verfügbar sein werden. Da- bei ist zu befürchten, dass an PID anbietenden, zum Teil privatwirtschaftlichen Einrichtungen im Ausland die als erforderlich anzusehende Beratungsqualität nicht immer gewährleistet sein wird. Insbesondere ethische Probleme und alternative Handlungsoptionen zur PID werden oft nicht aufgezeigt. Deshalb muss auch für diesen Fall qualifizierten Beratungseinrichtungen die Möglichkeit eingeräumt werden, Paare mit dem Wunsch nach PID zu betreuen und ergebnisoffen zu beraten. Das setzt voraus, dass auch bei einem Verbot von PID Ärzte, die über PID im Ausland informieren und die Paare beraten, nicht von Strafe bedroht sein dürfen. Umgekehrt darf sich ein Arzt aber auch nicht dadurch strafbar oder haftbar machen, dass er dies unterlässt. Im Zuge der Reform des § 218 StGB ist die embryopathische Indikation für den Schwangerschaftsabbruch abgeschafft worden. Die früher von der embryopathischen Indikation umfassten Problemstellungen sind seither faktisch in die medizinische Indikation aufgenommen worden. Dadurch sind für den Fall der pränatalen Diagnose einer Schädigung des ungeborenen Kindes keine spezifischen Beratungsverfahren gesetzlich vorgeschrieben. Die bestehenden Richtlinien zur pränatalen Diagnostik [3] sind offensichtlich nicht ausreichend, da in der Praxis nur wenige Schwangere nach pathologischem Befund einer Pränataldiagnostik genetisch beraten werden. Weil von den Befürwortern der PID die Pflichtberatung als eine Voraussetzung für deren Zulassung angesehen wird, würde sich ohne eine gleichartige Beratung nach Pränataldiagnostik ein Wertungswiderspruch ergeben. Es wäre nicht nachvollziehbar, warum die Beratung als Instrument auch des Schutzes ungeborenen Lebens im Rahmen einer vorhandenen Schwangerschaft einen niedrigeren Stellenwert haben sollte als präkonzeptionell. Zumal die Pränataldiagnostik, die zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt als die PID stattfindet, Feten betrifft, welche mit Blick auf Gehirnbildung und Schmerzempfindung bereits weit entwickelt sind. Das moralische Anliegen des Schutzes von individuellem vorgeburtlichem Leben ist bei der Pränataldiagnostik insofern noch deutlicher als bei der PID berührt.Auch gegenüber der in § 218 a Abs. 1 StGB festgelegten „Fristenregelung mit Beratungspflicht“ ist das Fehlen einer korrespondierenden Pflichtberatung in einem Schwangerschaftskonflikt bei pränatal diagnostizierter zu erwartender Behinderung des ungeborenen Kindes als eine ethisch inakzeptable Benachteiligung behinderten Lebens anzusehen. Weiterhin zeigen sich im Zusammenhang mit pränatalen Screeningtests, wie dem „Triple-Screening“, empfindliche Defizite in der Schwangerenberatung. Diese Tests zielen auf eine Risikoerkennung für genetisch bedingte Schädigungen des ungeborenen Kindes, speziell Chromosomenanomalien. Da sie bei bestimmter Risikoanzeige eine invasive Pränataldiagnostik mit der Option des Schwangerschaftsabbruchs nach sich ziehen, stehen sie beim Beratungsbedarf nicht der allgemeinen Schwangerschaftsüberwachung, sondern der genetischen Pränataldiagnostik nahe. Folglich sind für diese Screeningtests analoge Aufklärungsstandards unabdingbar wie für die Pränataldiagnostik selbst. Insbesondere ist erforderlich, dass – entgegen verbreiteter Praxis – jede Schwangere vor einem Screeningtest wie vor einer Pränataldiagnostik spezifisch über dessen medizinische und ethische Implikationen aufgeklärt werden muss und ihre Einwilligung schriftlich erklärt. In der politischen Realität ist auf allen Seiten große Zurückhaltung zu verspüren, den mühsam erarbeiteten Konsens zum § 218 StGB durch erneute Reformbemühungen aufs Spiel zu setzen. Dennoch machen die bestehenden Defizite in der Beratung im Zusammenhang mit der Pränataldiagnostik und deren Inkonsistenz mit Prinzipien des Embryonenschutzes eine Diskussion notwendig, wie auch hier eine für Ärzte und Schwangere verpflichtende Beratung angemessener Qualität sichergestellt werden kann. Beratung in zugelassenen Einrichtungen Eine Möglichkeit, dies ohne die keinesfalls anzustrebende Wiedereinführung einer embryopathischen Indikation zum Schwangerschaftsabbruch zu errei- 103 D O K U M E N T A T I O N Heft 33, 17. August 2001 chen, wäre eine bescheinigungspflichtige problembezogene Schwangerenkonfliktberatung auch vor Schwangerschaftsabbrüchen aus medizinischer Indikation. Ohne eine solche Beratung sollte der Schwangerschaftsabbruch nur dann nicht rechtswidrig sein, wenn mit dem Aufschub durch die Beratung eine vitale Bedrohung für die Schwangere verbunden wäre. Die Pflichtberatung zu medizinischen Schwangerschaftskonflikten sollte hierfür zugelassenen Einrichtungen vorbehalten bleiben, die angemessene Kompetenzen auf medizinischem, aber auch psychosozialem und ethischem Gebiet vorweisen können. Literatur 1. Kommission für Öffentlichkeitsarbeit und ethische Fragen der Gesellschaft für Humangenetik e.V. (1996): Positionspapier. Med. Genetik 8: 125–131. 2. Bundesärztekammer: Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik. Dt Ärztebl 2000; 97: A 525–528 [Heft 9]. 3. Bundesärztekammer: Richtlinien zur pränatalen Diagnostik von Krankheiten und Krankheitsdispositionen. Dt Ärztebl 1998; 95: A 3236–3242 [Heft 50]. Anschrift für die Verfasser: Priv.-Doz. Dr. med. Wolfram Henn Institut für Humangenetik, Universitätskliniken Bau 68, 66421 Homburg/Saar E-Mail: [email protected] Stammzellforschung „Ethik des Heilens“ G eorge W. Bush hat es sich nicht leicht gemacht mit seiner Einstellung zu menschlichen Embryonen. In einer Fernseherklärung schilderte er letzte Woche ausführlich seinen Meinungsbildungsprozess. „Ist ein Embryo im frühen Stadium bereits menschliches Leben?“, fragte sich der amerikanische Präsident. Nach vielen Gesprächen mit Naturwissenschaftlern, Ärzten und Theologen kam er zu der Ansicht: „Jeder Embryo ist einzigartig wie eine Schneeflocke und besitzt das einzigartige genetische Potenzial zu einem individuellen menschlichen Wesen.“ Auch auf die Frage, ob man Embryonen nicht für „höhere Zwecke“ benutzen dürfe, wenn sie doch in jedem Fall zerstört würden, habe er verschiedene Antworten erhalten. Bush verweist auf die moralischen Gefahren bei der Forschung an embryonalen Stammzellen. In diesem Zusammenhang sprach er sich entschieden gegen das Klonen von Menschen aus. Ohne moralisches Dilemma könne nur an Plazentazellen und an adulten Stammzellen geforscht werden, was deshalb auch mit Bundesmitteln unterstützt werden soll. Wegen seiner zahlreichen Bedenken spricht sich Bush gegen eine Forschungsförderung mit gezüchteten Linien aus. Die Forschung an Experimenten mit bestehenden Linien embryonaler Stammzellen soll dagegen gefördert werden, „da die Entscheidung über Leben und Tod hier bereits vollzogen ist“. Nach Auskunft führender Wissenschaftler böten diese 60 Linien sehr gute Aussichten auf einen Durchbruch im Bereich der Entwicklung neuer Heilverfahren. Wie Bundeskanzler Gerhard Schröder ist er also Verfechter einer „Ethik des Helfens und Heilens.“ Gemessen am Beschluss des diesjährigen Ärztetages in Ludwigshafen hätte Bushs (fauler) Kompromiss keinen Bestand. Dort hatten die Delegierten der Herstellung, dem Import und der Verwendung embryonaler Stammzellen (derzeit) eine eindeutige Absage Gisela Klinkhammer erteilt. Heft 37, 14. September 2001 Humanismusstreit Vom Überschreiten des Rubikon In der derzeitigen Debatte über medizinethische Fragen wird nicht nur über das Pro und Kontra von Präimplantationsdiagnostik und embryonaler Stammzellforschung, sondern auch über den Wert und die Würde menschlichen Lebens diskutiert. V or etwa einem Jahr ging Prof. Dr. phil. Dr. h. c. mult. Wolfgang Frühwald mit einem jungen amerikanischen Juristen durch Berlin. Dieser habe ihm einen Kummer anvertraut, über den er offenkundig schon länger nachgedacht hatte. Er komme nicht über den Gedanken hinweg, sagte er, dass seine Generation die letzte sein werde, die auf natürlichem Weg gezeugt worden war. Über diese Episode berichtet Frühwald, Präsident der Alexander von 104 Humboldt-Stiftung und früherer Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), in der jüngsten Ausgabe von „Wirtschaft & Wissenschaft“, der Zeitschrift des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft. Er selbst hielt die Angst des jungen Mannes zunächst für „ein Produkt ausgedehnter ScienceFiction-Lektüre“. Inzwischen scheint sie ihm jedoch alles andere als abwegig. In mehreren Beiträgen äußerte er seine Befürchtungen, die offenbar von einer Ansprache des Präsidenten der MaxPlanck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Prof. Dr. rer. nat. Hubert Markl, ausgelöst worden waren. Markl hatte sich bei der Hauptversammlung seiner Gesellschaft am 22. Juni gegen den Bundespräsidenten und die Auffassungen der beiden großen christlichen Kirchen gewandt und dezidiert deren Weltanschauung widersprochen. Johannes Rau hatte sich in seiner Berliner Rede am 18. Mai für eine Beibehaltung D O K U M E N T A T I O N des Embryonenschutzgesetzes ausgesprochen. „Auch hochrangige Ziele wissenschaftlicher Forschung dürfen nicht darüber bestimmen, ab wann menschliches Leben geschützt werden soll“, sagte Rau. Für Markl dagegen ist eine „befruchtete Eizelle noch lange kein Mensch, jedenfalls nicht als eine naturwissenschaftlich begründete Tatsache; allenfalls dann, wenn wir dem Begriff ,Mensch‘ – und zwar durchaus willkürlich – eine ganz andere Bedeutung zuweisen“. Jeder lebende Mensch gehöre zwar biologisch zur Art Homo sapiens. „Aber Menschlichkeit, Menschenwürde, ja recht eigentlich Menschsein ist mehr als dies Faktum, es ist eine kulturell-sozial begründete Attribution, die sich in der Begriffsbegründung zwar sehr wohl biologischer Fakten bedienen kann, ja muss, die sich aber in ihnen nicht erschöpft.“ Zwar müsse der „Umgang mit Menschenembryonen anderen Normen unterworfen werden als der mit Mäuseembryonen“, doch der „Akt der Zuschreibung des vollgültigen Menschseins wird durchaus verschieden begründet“. Das sei auch der deutschen Rechtsprechung und Lebenspraxis alles andere als fremd, sonst wäre nach Auffassung Markls die weitgehende rechtsfriedliche Regelung von Abtreibungen und die allgemein akzeptierte Verwendung von einnistungshemmenden Mitteln zur Geburtenkontrolle gar nicht möglich. Der Beschluss des britischen Gesetzgebers, Forschung an und mit menschlichen Embryonen und mit Zellkulturen aus solchen Embryonen bis hin zum therapeutischen Klonen in den ersten beiden Lebenswochen unter sorgfältig zu begründenden und kontrollierten Bedingungen freizugeben, bedeutet für Markl keine Verabschiedung Großbritanniens aus der abendländischen Wertegemeinschaft. Dass „willkürliche Entscheidungen – wie jene der Dreimonatsgrenze in der Abtreibung – unvermeidlich sind, sollte bei genauerem Überlegen gerade als Ausdruck menschlicher Gewissensfreiheit und moralischer Verantwortlichkeit gesehen werden“. In diesem Zusammenhang bekennt sich Markl zur „Freiheit eines Nichtchristenmenschen“. Wenn es um bioethische Entscheidungen gehe, die vor allem Beginn und Ende des Lebens beträfen, müsse der Gewissens- und Handlungsfreiheit des einzelnen Menschen in einer freien Gesellschaft ein hoher Rang eingeräumt werden. „Damit ist nicht nur die Freiheit von Eltern, insbesondere von Müttern gemeint, sich, wenn Präimplantations- oder Pränataldiagnostik schwere Entwicklungsstörungen einer Leibesfrucht erwarten lässt, nach ärztlicher Beratung für oder gegen deren Austragen zu entscheiden.“ Markl fühlt sich von „sozialethischen Argumenten“ der Art geschreckt, es könnte die Stimmung in der Bevölkerung für oder gegen Behinderte beeinflussen, wenn es Müttern frei überlassen werde, solche schweren Entscheidungen zu treffen. Dabei werde nämlich verkannt, dass die meisten Behinderungen nicht angeboren seien. Selbst von den angeborenen Fällen könnten auch künftig viele keineswegs viel früher erkannt werden. „An Behinderten wird es der Gesellschaft also bestimmt nicht mangeln.“ Am Ende des Lebens treffe er ebenfalls seine Entscheidung als „freier selbst entscheidungsberechtigter Staatsbürger“. Ausdrücklich begrüßt Markl deshalb die niederländische Euthanasiegesetzgebung. Das holländische Parlament habe „den hohen Wert der Freiheit des Menschen, über sich selbst zu entscheiden, trotz aller Anfeindungen, mutig anerkannt“. Innere Zerreißprobe Der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft stimmte auch den Empfehlungen der DFG zur Forschung an embryonalen Stammzellen vom 3. Mai „aus voller Überzeugung zu“. In Anspielung auf die Rede Raus, der vor einem Überschreiten des Rubikon gewarnt hatte, sagte Markl: „Der Rubikon ist kein Fluss, jenseits dessen das Böse lauert; denn das Böse ist, wenn schon, dann längst immer mitten in uns. Der Rubikon ist vielmehr ein Fluss, dem der Mensch ständig selber ein neues Flussbett bahnen muss, weil er das Vertraute vom Unentschlossenen trennt, und den wir deshalb nur wohlbedacht und mit Verantwortung für unser Handeln überschreiten sollten.“ Frühwald fühlte sich durch die Ausführungen Markls zu einer Erwiderung herausgefordert. Nach seiner Auffas- sung, die er in einem Interview mit der Zeitschrift „Forschung & Lehre“ darlegte, geht es bei der Diskussion über die Forschung an embryonalen Stammzellen „schon längst um viel mehr“. Es gehe nämlich um die Auseinandersetzung zwischen einem „christlichen, zumindest kantianischen Menschenbild auf der einen Seite und einem szientistischen, sozialdarwinistischen Menschenbild auf der anderen Seite“. Der ausgebrochene „Kulturkampf“ (oder „Humanismusstreit“, wie die Auseinandersetzung inzwischen bezeichnet wird) werde so rasch nicht enden. Frühwald schlägt sich in diesem Streit unmissverständlich auf die Seite des „keineswegs forschungsfeindlichen Bundespräsidenten“. Dabei betont er, dass er die DFG mit ihrer Entscheidung nicht kritisiert, weil die Forschungsgemeinschaft vor einer inneren Zerreißprobe stehe. In Ländern, in denen zum Beispiel der Embryo in den ersten 14 Tagen seiner Entwicklung keine menschliche Würde zugesprochen bekäme, sei auch „nicht die pure Barbarei ausgebrochen“. Im Unterschied zum therapeutischen Nihilismus des 19. Jahrhunderts, in dem das Experiment um des Experimentes willen gepflegt wurde, sei heute die medizinische Grundlagenforschung, auch und gerade im Bereich der Stammzellenforschung, auf therapeutische Ziele ausgerichtet. Allerdings sei die experimentelle Wissenschaft heute dabei, durch jeweils neu geschaffene Fakten die Grenzen immer weiter in ihrem Sinne hinauszuschieben und damit den Verdacht zu erwecken, die Forschungsfreiheit als einen absoluten Wert auch der Menschenwürde überzuordnen. Wiederholt werde als Argument für die Forschung an embryonalen Stammzellen die Internationalität der Forschung ins Feld geführt. Doch dies ist nach Auffassung Frühwalds ein ausschließlich wirtschaftliches Argument: „Es geht um den Vorsprung im Wettbewerb, um Verwertungsinteressen.“ Doch bei Fragen um Menschenwürde und Lebensdefinitionen könnten wirtschaftliche Interessen nicht die primär bestimmenden Interessen sein. Die Behauptung, weil die Gesellschaft die In-vitro-Fertilisation billige und damit „überzählige“ Embryonen 105 D O K U M E N T A T I O N Heft 39, 28. September 2001 in Kauf nehme, dürfe jetzt auch an ihnen geforscht werden, bezeichnet Frühwald als „baren Utilitarismus“. An ihnen zu forschen bedeute, sie zu einem ihnen fremden Zweck zu instrumentalisieren. Das aber sei ein Verstoß gegen die menschliche Würde. Dr. theol. Wolfgang Huber, evangelischer Bischof von Berlin-Brandenburg und Mitglied des Nationalen Ethikrats, teilt die Befürchtungen Frühwalds. „Wir stehen unausweichlich vor der Frage, an welchen Grundsätzen wir uns orientieren wollen“, schrieb er Anfang August in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Seine Auffassung dazu ist: „Der Grundsatz der unantastbaren Menschenwürde verpflichtet dazu, menschliches Leben insgesamt nicht zu instrumentalisieren; den Menschen auch in den frühesten Entwicklungsstufen des vorgeburtlichen Lebens niemals nur als Mittel zu fremden Zwecken einzusetzen.“ Der Hinweis darauf, dass ein Embryo im Mutterleib vor der Nidation relativ schutzlos sei, sei keine Rechtfertigung dafür, dass der Forscher mit dem Embryo in der Petrischale machen dürfe, was ihm gefällt. Der Präimplantationsdiagnostik könne aus ethischen Gründen nicht zugestimmt werden, „weil sie gegen die Tendenz zu einer aktiven Vorselektion menschlichen Lebens nicht abzugrenzen ist“. Im Gegensatz zu Markl ist Huber der Ansicht, dass durch dieses Verfahren behindertem Leben nur ein geminderter Lebensschutz zuerkannt werde. In der Frage der Forschung mit embryonalen Stammzellen bezieht der Theologe ebenfalls eine eindeutige Position: „Es kann nicht nur um eine Abwägung der Menschenwürde gegen andere Güter gehen.“ Wer heute der embryonalen Stammzellforschung zustimme, werde sich morgen dem therapeutischen Klonen nicht verweigern können. Und wer therapeutisches Klonen betreibe, habe den Weg zum reproduktiven Klonen bereits beschritten. Denen, die einen nächsten Schritt befürchten, werde beruhigend gesagt, einen solchen Schritt habe niemand im Sinn. „Wird auch nicht im Nachhinein gesagt werden, ,leider‘ habe man zu einem früheren Zeitpunkt den ,Rubikon‘ überschritten, nun sei kein Halten mehr?“ Gisela Klinkhammer fragt Huber. 106 Embryonale Stammzellforschung Unterschiedliche Wertvorstellungen Mit der internationalen Regelung der Forschung an embryonalen Stammzellen beschäftigte sich unter anderem ein Symposium in Hannover. M öglichkeiten und Grenzen der Stammzellforschung – das war das Thema eines Hearings, das von der Stiftung Niedersachsen in Zusammenarbeit mit dem niedersächsischen Landtag am 31. August und 1. September veranstaltet wurde. Auf die Grenzen verwiesen und ethische Bedenken vorgebracht wurden vor allem bei der embryonalen Stammzellforschung. Zahlreiche Experten stellten aber dennoch deren Möglichkeiten heraus. Für unverzichtbar hält sie auch Privatdozent Dr. med. Oliver Brüstle (dazu DÄ, Heft 24/2001). „Die Forschung an adulten wie auch an embryonalen Stammzellen ergänzt sich, es sind Felder, die sich befruchten und die zu Synergien führen“, so Brüstle. Brüstle und sein Institutsleiter Prof. Dr. med. Otmar Wiestler hatten bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) einen Projektantrag gestellt, um an embryonalen Stammzellen forschen zu können, die sie aus dem Ausland importieren wollen. Die DFG hat ihre Entscheidung vorerst vertagt. Nach dem deutschen Embryonenschutzgesetz ist die Herstellung von Linien aus embryonalen Stammzellen verboten. Der Import ist jedoch wegen einer Gesetzeslücke erlaubt. Doch ob wirklich an importierten Zellen geforscht werden soll, ist umstritten. Auf europäischer Ebene gibt es in dieser Frage „unterschiedliche Wertvorstellungen“, sagte Dr. Octavi Quintana Trias vom spanischen Gesundheitsministerium. Die Menschenrechtskonvention zu Biomedizin des Europarates verbiete die Erzeugung menschlicher Embryonen zu Forschungszwecken. In der Konvention werde je- doch nicht bestimmt, was ein Embryo sei, schränkte Prof. Dr. jur. Jochen Taupitz, Mannheim, ein. Die Grundrechtscharta der Europäischen Union verbiete lediglich das reproduktive, nicht jedoch das therapeutische Klonen. Und eine EU-Richtlinie, die therapeutisches und reproduktives Klonen verbietet, gebe es bisher nicht, so Quintana Trias. Wenn ein Land restriktiver sei als andere, forderte er in Anspielung auf die Regelung in Deutschland, solle die Europäische Union nicht dem Standard dieses restriktiven Landes folgen. Die Herstellung von Embryonen zu Forschungszwecken lehnt er allerdings ab. „Für Embryonenforschung sollte man nur Embryonen nehmen, die sowieso zerstört werden.“ In Europa gibt es nach seinen Angaben 250 000 bis 300 000 so genannte überzählige Embryonen. In Spanien gebe es etwa 37 000 „überzählige“ Embryonen, von denen rund 4 000 für Stammzelllinien verwendungsfähig seien. Bisher verfolgt Spanien ebenso wie Österreich ein Schutzkonzept, „dessen einschränkende Bestimmungen lediglich auf Befruchtungsverfahren ausgerichtet sind, sodass das darin enthaltene Klonierungsverbot den Zellkerntransfer von der Technik her nicht erfasst“, erläuterte Taupitz. In einigen Ländern umfasse das Klonierungsverbot von vornherein nur die Schaffung eines „vollständigen Menschen“. Das sei beispielsweise in Israel der Fall, wo erst die Geburt des Menschen als der entscheidende Einschnitt im Hinblick auf den vollen Menschenwürdeschutz angesehen werde. In Australien, Dänemark, Großbritannien, Finnland und Schweden sei eine fremdnützige Forschung D O K U M E N T A T I O N Heft 40, 5. Oktober 2001 von Embryonen auf die ersten 14 Tage der Entwicklung beschränkt. Andere Länder, wie Norwegen, Frankreich und die Schweiz, folgten dem deutschen Konzept, das die Erzeugung eines Embryos vom Beginn der Entwicklung an verbiete. Während beispielsweise in Frankreich „liberalisierende Gesetzentwürfe auf dem Tisch liegen“, würden zum Beispiel in Kanada, Italien und in den USA Verschärfungen angestrebt. Der US-amerikanische Präsident George W. Bush hatte sich am 9. August dafür ausgesprochen, Forschung an vorhandenen Stammzelllinien mit Bundesmitteln zu unterstützen. Die Schaffung neuer Zelllinien oder gar das Klonen sollte jedoch nicht öffentlich gefördert werden. Diese Entscheidung wurde von Prof. Dr. Erich H. Loewy, University of California, Davis, scharf kritisiert: „Die Bushsche Lösung ist gar keine Lösung. Sie treibt die Forschung in die Arme der Industrie.“ Und eine Kommerzialisierung von Stammzellen sei zutiefst unethisch. Grundsätzlich sprach sich Loewy für eine „evolutionäre Entwicklungsethik“ aus und befürwortete die Forschung an embryonalen menschlichen Stammzellen. Seiner Ansicht nach haben sie keine volle Schutzwürdigkeit: „Am Leben zu sein, bedeutet etwas anderes, als Leben Gisela Klinkhammer zu haben.“ Deutsche Bischofskonferenz Kein „Zellhaufen“ D ie Attentate von New York und Washington haben wohl nur kurzfristig das Thema Medizinethik in den Hintergrund treten lassen“, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Karl Lehmann, zu Beginn der diesjährigen Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda. Es werde nicht mehr lange dauern, bis Nachrichten über neue Experimente eintreffen würden. Die Bischofskonferenz hielt es deshalb für erforderlich, sich intensiv mit den Themen Stammzellforschung, Beginn des menschlichen Lebens und Schutzwürdigkeit von Embryonen zu beschäftigen. Doch ist ihre Meinung überhaupt gefragt? Viel entscheidender scheint da beispielsweise die Empfehlung des Nationalen Ethikrats, der sich zurzeit damit beschäftigt, ob embryonale Stammzelllinien importiert werden und an ihnen geforscht werden darf. Doch das Gremium, bei dem Repräsentanten der katholischen Kirche mit Wissenschaftlern, die einem Embryo in frühem Stadium keine volle Schutzwürdigkeit zubilligen, an einem Tisch sitzen, kann sich nicht einigen und stellte zunächst lediglich fest: „Es gibt mehrere Meinungen zu diesem Thema.“ Dass es auch keine spezielle katholische Meinung gibt, räumte Kardinal Lehmann ein. Dennoch können und wollen die Bischöfe richtungweisend sein. „Die Kirche sieht sich als Anwältin des Lebens und als Anwältin des Menschen. Wir haben in dieser öffentlichen Diskussion nur die ,Macht‘ unserer guten Argumente“, sagte der Vorsitzende der Bischofskonferenz. Und so heißt es in einem „orientierenden Text“ der katholischen Bischöfe: Embryologische Forschungen über die Vereinigung von Ei- und Samenzellen stützen die These, dass der Embryo kein „Zellhaufen“, sondern von Anfang an Mensch ist und sich als solcher entwickelt. Versuche, eine abgestufte Schutzwürdigkeit zu begründen, seien ebenso zurückzuweisen wie Vorschläge, das Lebensrecht erst mit der Geburt beginnen zu lassen. Eine Außenseitermeinung ist diese Auffassung sicher nicht. Schließlich deckt sie sich auch mit dem (bisher noch) geltenden EmbryonenschutzgeGisela Klinkhammer setz. Heft 41, 12. Oktober 2001 Reproduktionsmedizin Fachgesellschaften für klare Regelungen Involvierte Ärzte fordern unter anderem die Zulassung der Präimplantationsdiagnostik, die Lockerung der restriktiven Embryokultur und die Schaffung einer zentralen Registrierungs- und Beratungsstelle für die assistierte Reproduktion. F ür eine neue, umfassende rechtliche Regelung der Fortpflanzungsmedizin haben sich in Bonn Vertreter verschiedener involvierter Fachgesellschaften ausgesprochen. Das erforderliche Fortpflanzungsmedizingesetz sollte eine Liberalisierung in maßvollen Grenzen erlauben und speziell auch die weiten Bereiche regeln, in denen das Embryonenschutzgesetz Rechtsunsicherheit bie- tet, heißt es in einem Positionspapier, das von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologische Endokrinologie, der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, der Deutschen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin und dem Bundesverband Reproduktionsmedizinischer Zentren erarbeitet wurde. Ein zentraler Punkt hierbei sei die Präimplantationsdiagnostik, die nicht explizit verboten, aber auch nicht zulässig sei. Prof. Ricardo Felberbaum (Lübeck) und Dr. Michael Thaele (Saarbrücken) verdeutlichten das Dilemma von Ärzten und betroffenen Patienten: Wenn nach humangenetischer Beratung klar ist, dass ein hohes Risiko für ein Kind mit schweren, nicht therapierbaren Erbkrankheiten besteht, kann das Paar entweder das Risiko einer 107 D O K U M E N T A T I O N Schwangerschaft eingehen und im Zweifelsfall nach der Pränataldiagnostik eine Interruptio vornehmen lassen – oder ins Ausland reisen zur assistierten Fortpflanzung und nur gesunde Embryonen transferieren lassen. Eindeutigen Regelungsbedarf sehen die Fortpflanzungsmediziner darüber hinaus bei der – für Ärzte und Patienten – rechtlich nicht ausreichend geklärten heterologen Insemination. Hier müssten unbedingt die Spender zentral registriert werden, um „Vielfachspender“ auszuschließen. Darüber hinaus sind nach Auffassung der Experten auch eindeutige rechtliche Bestimmungen für die Tiefkühllagerung von Ovar- und Hodengewebe notwendig – ein Vorgehen, das zunehmend von jungen Krebspatientinnen und -patienten nachgefragt wird, die sich einer Therapie mit möglicherweise irreversibler Schädigung der Gonaden unterziehen müssen. Ein wesentliches Anliegen der unterzeichnenden Fachgesellschaften ist darüber hinaus die Schaffung einer zentralen, interdisziplinär besetzten Stelle zur Registrierung, Beratung und Prüfung aller Zentren, die Maßnahmen der assistierten Reproduktion vornehmen. Zentrale Stelle als Bundesamt Wie Prof. Franz Geisthövel (Freiburg) betonte, könnte diese zentrale Stelle als Bundesamt eingerichtet werden oder bei der Bundesärztekammer oder einer anderen unabhängigen Institution angesiedelt sein. Es sollte sich um eine unabhängige Einrichtung nach dem Vorbild der Human Fertilization and Embryology Authority in England handeln, die durch Transparenz auch die Vertrauensbildung in der Gesellschaft stärkt. Unter der Leitung eines Nicht(Fortpflanzungs-)Mediziners, so die Vorstellungen, könnten Anfragen oder Klagen von Patienten beantwortet, aber auch neue wissenschaftliche Konzepte beurteilt und Studien initiiert werden. Darüber hinaus müsste die Institution Kontrollen der Zentren – und auch Sanktionen – veranlassen können. Aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht notwendig ist nach Ansicht der Experten eine Lockerung der restriktiven Maßgaben zur Embryokultur: Im Aus- 108 land können Reproduktionsmediziner deutlich höhere Erfolge bei IVF und ICSI erzielen, weil sie mehr Embryonen heranwachsen lassen bis zum Blastozystenstadium (Tag fünf) und aus dem „Pool“ nur die zwei für den aktuell anstehenden Transfer verwenden, die aus morphologischen Kriterien das höchste Implantationspotenzial besitzen. Die Schwangerschaftsraten sind bei diesem Vorgehen etwa doppelt so hoch wie hierzulande. Bei der längeren Kultivierung tritt allerdings eine natürliche Auslese auf: Nur etwa die Hälfte der Embryonen entwickelt sich aufgrund von Chromosomenanomalien oder anderer Defekte bis zum erwünschten Stadium. Da hierzulande nur drei Embryonen heranwachsen dürfen, sind den Reproduktionsmedizinern „die Hände gebunden“ – es bliebe oft nichts zum Auswählen übrig. Wenn diese „Dreier-Regel“ abgeschafft wird, müsste gleichzeitig die Möglichkeit eingeräumt werden, auch Embryonen für einen späteren Transfer tiefzufrieren, erläuterte Prof. Wolfgang Würfel (München). Werden diese dann nicht benötigt, sollte das Paar sie als Alternative zur Vernichtung bei einem ernst genommenen Embryonenschutz dann auch zur Adoption freigeben können. Auch in diesem Punkt besteht heute Rechtsunsicherheit, da das ESchG zwar die Eizellspende verbietet – was in der heutigen Situation neu zu überdenken sei –, nicht jedoch die Embryonenspende. Eindeutig traten die Reproduktionsmediziner Befürchtungen entgegen, wonach sich in den Tiefkühltruhen schon heute über 5 000 Embryonen befinden sollen. Felberbaum nannte Daten aus den IVF-Zentren: Von 1988 bis 2000 sind 406 Embryonen von 170 Paaren tiefgefroren worden, wobei inzwischen mehr als drei Viertel der Paare (141) bereits 335 Embryonen wieder transferiert wurden. Auf Eis liegen demnach derzeit 71 Embryonen von 29 Paaren. Bisher können Embryonen nur in Ausnahmefällen eingefroren werden – etwa wegen einer Erkrankung oder eines Unfalls der Frau zum Zeitpunkt des geplanten Dr. Renate Leinmüller Transfers. Heft 43, 26. Oktober 2001 Präimplantationsdiagnostik Anfang ohne Ende Ob sich die PID auf einige Indikationen begrenzen lässt, bleibt umstritten. D ass sich die Präimplantationsdiagnostik (PID) nicht auf wenige Paare beschränken lässt, befürchten PID-Gegner. Dass diesen Paaren endlich die Möglichkeit gegeben werden müsse, ein gesundes Kind zu bekommen, meinen hingegen die Befürworter. Die Debatte um die PID erhält neue Aktualität, denn die FDP-Fraktion stellte dieser Tage einen Gesetzentwurf zur Regelung der Präimplantationsdiagnostik vor. Darin fordert sie, das Embryonenschutzgesetz zu ändern und die PID „nach eingehender Beratung und positivem Votum einer Ethikkommission“ zu gestatten – wenn die Eltern eine Veranlagung für eine schwerwiegende Erbkrankheit in sich tragen. Doch in diesem Punkt sehen die PIDGegner die größten Probleme. „Die PID wird sich nicht begrenzen lassen. Das war auch bei der Pränataldiagnostik bereits nicht möglich“, betonte Marion Brüssel, Landesvorsitzende des Berliner Hebammenverbandes, bei der Anhörung des Bundestagsausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend am 17. Oktober in Berlin, die parallel zur Vorstellung des FDP-Gesetzentwurfs stattfand.Sachverständige – hauptsächlich Frauen – diskutierten dabei „Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik“ weniger aus ethischer oder medizinischer, sondern aus frauenspezifischer Sicht. Es sei nicht möglich, einem Paar die PID zu gestatten und einem anderen zu D O K U M E N T A T I O N Heft 47, 23. November 2001 verweigern, betonte Dr. med. Astrid Bühren, Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes. Letztlich werde jede Form von „Belastung“ für die Familie als ausreichender Grund für die PID akzeptiert werden müssen. „Indikationslisten werden bald erweitert und dann ganz abgeschafft werden. Die PID wird zu einem weit verbreiteten Phänomen werden, das sich auf die gesamte Gesellschaft auswirkt“, befürchtet Bühren. „Ihre Anwendung wird zu einer Pflicht der Betroffenen gegenüber der Allgemeinheit werden.“ Frauen wollen Sicherheit Dr. med. Barbara Dennis vom Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft e.V. beobachtet als Gynäkologin einen „Perfektionsanspruch“ bei den Schwangeren. Sie würden lieber mehr Untersuchungen als weniger in Anspruch nehmen. Der eigenen Wahrnehmung der Schwangerschaft würden sie dabei fast nicht mehr trauen, berichtete sie. Diese sei verstärkt durch die Angst vor einem behinderten Kind geprägt, bekräftigte auch Claudia Heinkel vom Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche. „Frauen erleben den Einsatz der Technik zwar ambivalent, aber erst nach mehreren Untersuchungen mit normalem Befund können sie die Schwangerschaft ruhig fortsetzen.“ Für sie steht fest: „Gibt es erst die PID, wird sie auch angewendet.“ Ein Verbot hält die FDP-Fraktion für verfassungsrechtlich bedenklich. Es stehe im Widerspruch zum Recht der Frau, die Schwangerschaft nach Pränataldiagnostik und bei Vorliegen einer medizinischen Indikation abzubrechen. Um eine rechtliche Grundlage für die betroffenen Paare und Ärzte zu schaffen, müsse das Embryonenschutzgesetz geändert werden, fordern die Liberalen. Bisher ist umstritten, ob dieses die PID zulässt. Ihr Papier schickte die FDP an Bundestagsabgeordnete anderer Fraktionen, die als Befürworter der PID bekannt sind. Bald will sie einen fraktionsübergreifenden Gesetzentwurf in den BundesER tag einbringen. Stammzellen-Import Signal auf Stopp E ine so deutliche Entscheidung war nicht zu erwarten gewesen. 17 der 24 anwesenden Mitglieder der EnqueteKommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“ des Deutschen Bundestages sprachen sich gegen einen Import von menschlichen embryonalen Stammzellen zu Forschungszwecken aus. Auf ein Mehrheits- und Minderheitsvotum verzichtete die Kommission. Da es sich um eine Gewissensfrage handele, wolle sie den Bundestagsabgeordneten nicht raten, wie sie sich bei der wegen Terminschwierigkeiten auf Januar verschobenen Debatte entscheiden sollen, sagte die Vorsitzende der Kommission, Margot von Renesse (SPD). Ein Stopp-Signal ist der abwägende Bericht der Enquete-Kommission jedoch allemal. Die 17 Import-Gegner meinen, dass der Bundestag und die Bundesregierung alle Möglichkeiten ausschöpfen sollten, um die Einfuhr von embryonalen Stammzell-Linien zu verhindern. Lediglich sieben Kommissionsmitglieder bezweifeln, dass ein vollständiges Import-Verbot verfassungs- und europarechtlich begründet werden kann. Sie plädieren dafür, den Import unter engen Voraussetzungen, beispielsweise unter Kontrolle einer staatlichen Behörde, zu tolerieren. Einig ist sich die Kommission, dass das derzeitige Embryonenschutzgesetz beibehalten werden muss. Ihre Entscheidung wollen einige Mitglieder der Enquete-Kommission auch als Aufforderung an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) verstanden wissen, den Abstimmungstermin über den Antrag von Prof. Dr. med. Oliver Brüstle nochmals zu verschieben und die Debatte des Bundestages abzuwarten. Noch stehe der 7. Dezember als Termin, an dem sich der DFGHauptausschuss entscheiden wolle, erklärte eine Sprecherin der DFG. Eine nochmalige Verschiebung sei zwar denkbar, aber ungewiss. Definitiv noch Ende November will der vom Bundeskanzler eingesetzte Nationale Ethikrat seine Entscheidung vorlegen. Dessen Mitglieder gelten mehrheitlich als Befürworter des StammzellImports. Doch auch der Rat will die Entscheidung der Enquete-Kommission Dr. med. Eva A. Richter berücksichtigen. Heft 48, 30. November 2001 Stammzellen-Import Druck von allen Seiten Die Deutsche Forschungsgemeinschaft wird ihre Entscheidung vermutlich nochmals vertagen. Doch die Forscher drängen. R eine Verzögerungstaktik“ nennt Prof. Dr. med. Oliver Brüstle das nochmalige Verschieben der Entscheidungen über den Import von embryonalen Stammzellen. Mit seiner Einschätzung mag der Bonner Neuropathologe und Stammzellforscher Recht behalten. Denn trotz aller ethisch-moralischen Einwände scheint die (gesellschaftlich gebilligte) Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen in Deutschland nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Brüstle ist optimistisch und dennoch frustriert. Bereits vor eineinhalb Jahren hatte er bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) beantragt, menschliche embryonale Stammzellen zu importieren. „Während unsere Diskussion über den Import festzufahren scheint, wird im Ausland emsig an embryonalen Stammzellen geforscht“, kritisierte er 109 D O K U M E N T A T I O N bei einer Diskussionsveranstaltung der Berliner Medizinischen Gesellschaft am 21. November. In den USA sei inzwischen eine internationale StammzellBank eingerichtet worden, die den Austausch der Zelllinien koordiniere. Auch die Europäische Union stelle mittlerweile Fördergelder zur Verfügung. Brüstle drängt auf die Entscheidung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Er müsse endlich wissen, woran er wäre. Auf Bitte der Politik hatte die DFG diese bereits zweimal verschoben, zuletzt auf den 7. Dezember. Jetzt ist ein weiterer Aufschub im Gespräch, nämlich auf die nächste Sitzung des Hauptausschusses am 31. Januar. Ein Brief des DFG-Präsidenten Prof. Dr. Ernst-Ludwig Winnacker ging in diesen Tagen an die Mitglieder des Hauptausschusses, in dem er empfiehlt, einer nochmaligen Vertagung zuzustimmen. Doch so lange will Brüstle nicht mehr warten. „Meiner Meinung nach muss die DFG noch in diesem Jahr klar Stellung beziehen“, sagte Brüstle gegenüber der Frankfurter Rundschau. „Das könnte so aussehen, dass sie meinem Antrag zustimmt, aber das Anlaufen der Forschungsförderung verschiebt bis nach der Bundestagsdebatte.“ Eine Alternative wäre die Stammzellforschung im privaten Sektor, deutet Brüstle an. Dies führe jedoch zu weniger Kontrolle und Transparenz. Dass das tatsächlich so ist, zeigt das jüngste Beispiel aus den USA: Ein amerikanisches Biotechnik-Unternehmen hat jetzt erstmals menschliche Embryonen geklont. Präsident George W. Bush hatte im Sommer zwar die Forschung an existierenden Zelllinien befürwortet, sich aber gegen das Klonen ausgesprochen. Eine entsprechende Gesetzesvorlage wird derzeit vom US-Senat erarbeitet. Die DFG und ihr Präsident stehen unter Druck – und das gleich von mehreren Seiten. Die Forschungsgemeinschaft werde vorgeführt, die wissenschaftliche Selbstverwaltung geschwächt, meinen Brüstle und weitere Forscher. Andererseits kann Winnacker schwerlich die Bitte von Bundestagspräsident Wolfgang Thierse sowie mehreren Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die Entscheidung zu vertagen, ignorieren. „Wir haben den Schwarzen Peter zugeschoben bekommen“, sagte er der Wochenzeitung „Die Zeit“. Der Politik 110 stellt Winnacker ein Ultimatum. Die DFG benötige eine feste Zusage, dass sich der Bundestag tatsächlich während der Sitzungswoche Ende Januar entscheide, betonte der DFG-Präsident. „Wenn sich anbahnt, dass keine Debatte stattfindet, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das für uns ein ganz klares Signal, zu handeln.“ Winnacker lässt keinen Zweifel, wie die DFG-Entscheidung ausfallen wird: „Der Import ist rechtlich nicht verboten.“ Rückendeckung erhält die DFG von Bundesforschungsministerin Edelgard Bulmahn. Sie will den Import embryonaler Stammzellen unter strengen Auflagen erlauben. So sollen nur Zelllinien aus „überzähligen“ Embryonen verwendet werden, deren Herkunft eindeutig belegbar ist und deren Spender ihr Einverständnis gegeben haben. Die DFG hat sich bereits im Mai für die Forschung an embryonalen Stammzellen ausgesprochen. Sie befürwortet grundsätzlich sowohl den Import als auch – wenn es nötig sein sollte – die Herstellung von embryonalen Stammzelllinien. Vorerst wolle man sich auf die Forschung an importierten Zellen beschränken, erklärt sie. Doch die zweite Option könnte in naher Zukunft zur Debatte stehen. Untersuchungen haben nämlich inzwischen ergeben, dass von den weltweit 72 verfügbaren Zelllinien nur 20 den Kriterien an eine pluripotente Stammzelllinie genügen. Zudem ist nicht zu erwarten, dass die Forscher langfristig wissenschaftlich und kommerziell von anderen Staaten abhängig sein wollen. Auch das Votum des Nationalen Ethikrates steht noch aus. Er wollte sich ursprünglich am 21. November äußern. Doch die Meinungen der 25 Mitglieder zu dieser Frage seien konträr, sagte eine Sprecherin. Die Entscheidung sei deshalb auf den 29. November vertagt worden. Vermutlich wird der Rat mehrheitlich für den Import von menschlichen embryonalen Stammzellen votieren. Insider gehen sogar von einer Zweidrittelmehrheit innerhalb des von Bundeskanzler Gerhard Schröder eingesetzten Gremiums aus. Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages hatte sich mehrheitlich gegen den Stammzellen-Import ausgesprochen. Dr. med. Eva A. Richter Heft 49, 7. Dezember 2001 Stammzellforschung Perfektes Timing W enn der Deutsche Bundestag am 30. Januar des nächsten Jahres darüber entscheidet, ob der Import embryonaler Stammzellen verboten oder zugelassen sein soll, dann werden ihm die diversen Expertenaussagen kaum aus der Verlegenheit helfen. Er, der Gesetzgeber, ist am Zuge. Der Nationale Ethikrat hat sich für einen Import ausgesprochen, die Enquete-Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“ des Bundestages hat zwei Modelle gegeneinander gestellt. Modell A läuft auf ein Verbot des Imports hinaus, Modell B auf eine Tolerierung. Der Nationale Ethikrat, jenes von Bundeskanzler Schröder eingerichtete Gremium, hatte mit knapper Mehrheit am 29. November den Import befürwortet, unter allerlei Auflagen und mit einer Befristung bis Ende 2003. Das öffentliche Echo war widersprüchlich, widersprüchlich auch quer durch die Parteien. Der Präsident der Bundesärztekammer sprach sich dafür aus, zunächst andere Forschungsrichtungen einzuschlagen und nur, wenn diese zu keinen befriedigenden Ergebnissen führten, die Forschung an importierten embryonalen Stammzellen in Erwägung zu ziehen. Wenige Tage bevor der Nationale Ethikrat sein Votum abgab, am 23. November, hatte die Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer gleichfalls votiert. Sie kam ebenfalls zu der Empfehlung, den Import unter Kautelen zuzulassen (Wortlaut in diesem Heft). Man darf davon ausgehen, dass die Stellungnahme der Zentralen Ethikkommission Schröders Ethikrat inhaltlich vorlag und die angestrebte Rolle spielte. Die Kommission hatte zuletzt mit Hochdruck an ihrer Stellung- D O K U M E N T A T I O N nahme gearbeitet und das perfekte Timing schließlich erreicht. Die Zentrale Ethikkommission ist angesiedelt bei der Bundesärztekammer, in ihrer Arbeit jedoch von dieser unabhängig. Ihre Stellungnahme kann nicht als Bundesärztekammervotum zugunsten des Embryonenimports gewertet werden; sie steht auch nicht im Einklang mit der Meinungsbildung des Deutschen Ärztetages. In der Gedankenführung stimmen die Empfehlungen des Nationalen Ethikrates und der Zentralen Kommission auffallend überein. Sie gleichen auch der Stellungnahme der Deutschen Forschungsgemeinschaft vom 3. Mai dieses Jahres. Das mag Wissenschaftler-Konsens sein, dürfte aber auch an personellen Querverbindungen zwischen den drei Institutionen liegen. Bevor der Bundestag entscheidet, sollte er sich damit beschäftigen, wie die Voten zustande kamen. Er sollte auch prüfen, aus welchen Quellen die derzeit gängigen Aussagen zur Rechtslage stammen, die da die Meinung wiedergeben, ein Verbot des Imports sei verfassungswidrig und der Import mit dem Embryo- nenschutzgesetz durchaus vereinbar. Wenn die Bundestagsabgeordneten demnächst entscheiden, dann muss ihnen ganz klar sein, dass sie bei einer Entscheidung zugunsten des Importes eine Tür öffnen, die nicht mehr zu schließen sein wird. Zunächst wird es nur um den Import existierender Stammzelllinien gehen. Zurzeit geht die veröffentlichte Meinung noch dahin, die bereits vorhandenen Zelllinien reichten für die Forschung aus. Es gibt freilich Hinweise, dass Zahl und Qualität der Stammzellen bei anziehender Forschung nicht ausreichen werden. Also wird man, wenn das Tor geöffnet ist, auch hier weitersehen, indem neue Linien eröffnet werden – und weshalb dann nicht in Deutschland? Zurzeit sprechen sich alle Voten dezidiert für die Gewinnung embryonaler Stammzellen aus so genannten übrig gebliebenen Embryonen aus. Aber lässt sich nicht die Zahl der „übrig gebliebenen“ mit einem gewissen Belieben variieren, und wo liegt dann die Grenze zur direkten Gewinnung von Embryonen zu Forschungszwecken? Die vorliegenden Stellungnahmen weisen dies ener- gisch zurück. Würde sich eine solch ablehnende Haltung auf Dauer und bei anhaltendem Druck aus der Wissenschaft wirklich halten lassen? Die Argumentationslinie ist schon vorgezeichnet: Wenn an Embryonen geforscht werden darf, weshalb dann nicht generell? Die offene Frage bleibt, ob das, was wissenschaftlich möglich ist und anderenorts erlaubt ist, hierzulande auf die Dauer verhindert werden kann. Globalisierung beherrscht die Wissenschaft, die Globalisierung der Ethik folgt ihr auf dem Fuße.Wer sich dem weltweiten Druck widersetzt, braucht starke Nerven und feste Überzeugungen. Haben wir die? Gerade dieser Tage hat der höchst angesehene US-amerikanische Philosoph Richard Rorty seine Wunschvorstellung in einem Interview (mit dem „Tagesspiegel“) offenbart: „Persönlich wünsche ich mir, dass man dekretiert, dass das menschliche Leben beginnt, wenn ein Embryo drei Monate alt ist. Bis dahin könnten Ärzte experimentieren.“ Pragmatiker Rorty wurde am 2. Dezember in Berlin der nach dem Mystiker benannte Meister-Eckhart-Preis Norbert Jachertz verliehen. Heft 49, 7. Dezember 2001 Stammzellforschung (I) Abschied von der Menschenwürde? Der Grundkonsens der liberalen Gesellschaft ist durch die Forschung an embryonalen Stammzellen gefährdet. Santiago Ewig D ie geplante Forschung an humanen embryonalen Stammzellen stellt einen fundamentalen Bruch mit den bisher geltenden Wertvorstellungen dar. Die Konsequenzen sind erheblich. Der Abschied vom Begriff der Menschenwürde als Ausdruck der Selbstzwecklichkeit des Menschen bedeutet, dass die Menschenwürde in den Grenzbereichen des Lebens entsprechend den Interessen anderer zur Disposition steht. Im Kern bedeutet er die Aufgabe der liberalen Idee der Aufklärung, die in der Achtung und Bewahrung der Selbstzwecklichkeit des Menschen die Grundlage der Frei- heit zur Selbstbestimmung und zum moralischen Handeln sieht. Konzepte des „abgestuften Lebensschutzes“ Kaum ein Befürworter der Forschung an humanen embryonalen Stammzellen wird dieser Bewertung zustimmen. Wie argumentieren sie also, und was liegt ihren Argumentationsmustern zugrunde? Das soll beispielhaft an der Argumentation von Wiestler und Brüstle aufgezeigt werden (1, 2). Am Ausgangspunkt steht die Forschungsperspektive des Zellersatzes durch Stammzellen. Embryonale Stammzellen weisen durch ihre Pluripotenz und nahezu unbegrenzte Vermehrbarkeit entscheidende Vorteile gegenüber adulten Stammzellen auf. Daher erscheint die Forschung an humanen embryonalen Stammzellen zumindest aktuell unverzichtbar. Wiestler und Brüstle neigen Konzepten des „abgestuften Lebensschutzes“ zu, die dem Embryo zwar Würde und Schutzwürdigkeit einräumen, jedoch die Zubilligung der uneingeschränkten Menschenwürde von be- 111 D O K U M E N T A T I O N stimmten Entwicklungsschritten abhängig machen. Die Tötung von Embryonen kann somit in einer Güterabwägung gerechtfertigt werden, wenn diese vor Ablauf einer bestimmten Entwicklung und aufgrund hochrangiger Forschungsziele geschieht. Als hochrangiges Forschungsziel wird nicht weniger als die Aussicht auf Heilung ausgegeben. Das Aufkommen einer „Ethik des Heilens“ drückt das Bestreben aus, den Imperativ der Heilungspflicht angesichts einer gegebenen Heilungsperspektive als handlungsleitend zu rechtfertigen. Wiestler und Brüstle führen eine Reihe von Begrenzungen ins Feld, die diese Güterabwägung gegen die Gefahren der unbegrenzten Embryonenforschung und ihrer Kommerzialisierung absichern sollen. Zu diesen gehören die Beschränkung auf den Import bereits existierender Zelllinien, die aus dem Tode geweihten, „überzähligen“ Embryonen gewonnen wurden; die klare Definition des Forschungsziels und die Komplementarität der Forschung an embryonalen und adulten Stammzellen, die nach einer Zwischenphase sogar die Aufhebung der Notwendigkeit der Forschung an embryonalen Stammzellen in Aussicht stellt. Begrenzung soll auch durch strenge wissenschaftliche Begutachtung, bioethische Begleitung und öffentliche Transparenz sichergestellt werden. In ihrer Sicht stellt auch auf politischer Ebene die staatliche Anerkennung der Forschung an humanen embryonalen Stammzellen eine Begrenzung dar, weil nur auf diese Weise eine Kommerzialisierung durch private Unternehmen verhindert werden könne. Schließlich betonen Wiestler und Brüstle, dass sie Tabus berücksichtigen: das Verbot der Embryonenherstellung zu Forschungszwecken, Eingriffe in die Keimbahn und das reproduktive Klonen. Die ethische Argumentation von Wiestler und Brüstle ist jedoch nicht handlungsanleitend, sondern sekundär legitimatorischer Natur. Die Heilungsperspektive, die für die Güterabwägung ausschlaggebend ist, erscheint nicht allgemein anerkennungsfähig begründbar. Zum heutigen Zeitpunkt ist sie Utopie. Die von Wiestler und Brüstle vorgestellten Remyelinisierungsexperimente an Ratten mit der Pelizaeus-Merzbacherschen Erkran- 112 kung reichen über ihre immanente Evidenz kaum hinaus. Die Begrenzungen der Forschung an humanen embryonalen Stammzellen verlaufen exakt am Rande dessen, was den beiden Forschern aktuell an Forschung notwendig erscheint. Die Perspektive ist ganz auf die eigenen Projekte beschränkt. Die Grenze, bis zu der Embryonen verbraucht werden dürfen, bleibt ohne eigene Begründung. Der Stammzellimport deckt den nötigen Bedarf; daher braucht aktuell mehr nicht gefordert zu werden. Doch die Begrenzungen stellen keine ethisch verbindlichen Grenzen, sondern letztlich unverbindliche Absichtserklärungen zweier Forscher dar. Im Detail bleiben diese Begrenzungen nicht einmal innerhalb der eigenen Forschergruppe konsistent. Während Wiestler eine Herstellung eigener embryonaler Stammzellreihen nicht beabsichtigt, hält Brüstle diese in Zukunft für unabweisbar. Auch hinsichtlich der Herstellung von Embryonen zu Forschungszwecken bleiben Unklarheiten. Brüstle schließt eine solche kategorisch aus. In seiner Haltung dem therapeutischen Klonen gegenüber bleibt er jedoch eigentümlich vage. In letzter Instanz muss und wird er sie befürworten:Wie anders sollte die Kernreprogrammierung entschlüsselt werden? Über künftige Entwicklungen, die sowohl in der Konsequenz des eigenen Handelns als auch in der biotechnologischen Forschungslogik liegen, wird nicht reflektiert. Die Implikationen des eigenen Handelns für das Wertbewusstsein und die Wertgeltung werden ignoriert. In einer solchen weiten Perspektive verlieren Begrenzungsargumente ihr Gewicht. Es wird vielmehr deutlich, dass Begrenzungen je nach Entwicklung der Forschungsimperative nahezu beliebig erweitert werden können. Ist die Forschung an embryonalen Stammzellen angelaufen, können gegen eine verbrauchende Embryonenforschung in großem Ausmaß systematisch-ethische Argumente nicht mehr plausibel gemacht werden. Eine verbrauchende Embryonenforschung in großem Umfang stellt dann keinen „Missbrauch“ dar, sondern eine logische Konsequenz. Diese Begründungsmuster wiederholen sich bei der Präimplantationsdiagnostik (PID). In dieser sekundär legitimatorischen Ar- gumentationsweise kommt ein weit verbreiteter unaufgeklärter Szientismus zum Ausdruck, der aus sich heraus keine Kriterien für einen „Fortschritt nach menschlichem Maß“ (3) hervorbringen kann, weil er den „Fortschritt“ an immanente Forschungsperspektiven beziehungsweise -interessen der Wissenschaft oder der Forscher bindet. Jede Bioethik ist in dieser Perspektive eine Vermittlungsinstanz, die nachträglich die Gründe dafür liefern muss, warum Wertvorstellungen an den Fortschritt der Wissenschaft angepasst werden müssen. Auch die Politik entscheidet dann nicht autonom,sondern kanalisiert lediglich die Folgen der Entwicklung der Wissenschaft in eine strukturell akzeptable Form. In der Diskussion um die Forschung an humanen embryonalen Stammzellen geht es nicht allein um diese selbst, sondern um die Auseinandersetzung mit einem Szientismus und Bioutopismus, der nicht neu ist, sondern sich jetzt lediglich im Zuge der bevorstehenden Entgrenzungen der Verfügungsmacht durch die neuen Biotechnologien in modernem Gewande zeigt. Eine Kritik dieser Positionen, gar eine politisch wirksame Mobilisierung gegen diese, muss die verschiedenen Dimensionen erkennen, die durch die neuen Biotechnologien berührt werden und die daher in diese Kritik Eingang finden müssen. Heilung bleibt ein bedingtes Ziel Die neuen Biotechnologien umfassen: Die Neubesinnung auf den Begriff der Menschenwürde: Konstitutiv für den Begriff der Menschenwürde ist, dass diese nicht von Menschen nach bestimmten Kriterien anderen Menschen verliehen wird, sondern unabhängig aller Kriterien für alle gilt, die der Gattung Mensch angehören.Nur indem die Menschenwürde der Verfügbarkeit durch andere Menschen entzogen wird, gilt sie uneingeschränkt. Das bedeutet, dass kein Zweck die Menschenwürde zugunsten anderer Werte relativieren kann. Die Bewertung des moralischen Status des Embryos: Ethische Urteile sind stets gemischte Urteile. Sie beruhen auf der ethischen Grundeinstellung, die einen Sachverhalt zu beurteilen hat. Das D O K U M E N T A T I O N Urteil über den moralischen Status des Embryos muss somit dem plausibelsten biologischen Sachverhalt über den Beginn des Lebens angepasst werden. Hier gilt: „Menschliches Leben, dem Würde und Schutzwürdigkeit zusteht, ist dann gegeben, wenn eine menschliche Zelle mit ihrem individuellen Chromosomensatz das Potenzial einer kontinuierlichen Entwicklung in sich vereint.“ (4). Entscheidend ist, dass durch die Verschmelzung von menschlicher Ei- und Samenzelle eine neue genetische Identität entstanden ist, die die Zugehörigkeit dieses Lebens zur menschlichen Gattung festlegt. Somit kommt auch dem Embryo in vollem Umfang Menschenwürde zu. Jede andere Position bedeutet im Kern eine Zerstörung des Begriffs der Menschenwürde (5, 6). Die Reflexion auf Forschungsziele der medizinischen Wissenschaft: Soll der Szientismus überwunden werden, muss über die Inhalte des Fortschritts reflektiert werden. Folgende Grundthese könnte eine Ausgangsbasis sein: Ziel der medizinischen Wissenschaft ist nicht die Abschaffung des Todes, sondern die Auslöschung der Schrecken, die mit der menschlichen Endlichkeit gegeben sein können. Heilung bleibt somit ein bedingtes Ziel. Heilung muss vielmehr mit Palliation zusammen realisiert werden, und zwar aus zwei Gründen: Heilung führt nicht zu weniger Krankheit, sondern verschiebt diese in höhere Altersstufen. Die einseitige Betonung der Heilung führt zwangsläufig zu aggressiven Konsequenzen für diejenigen, die nicht geheilt werden können. Hier eröffnen sich die bedrückenden Perspektiven der Eugenik und des Sozialdarwinismus, die man nur ermessen kann, wenn man sie nicht simplizistisch mit dem Nationalsozialismus gleichsetzt und durch seine Überhöhung zum absolut Bösen für erledigt hält. Es gibt keine ärztliche Pflicht zur Heilung um jeden Preis, wohl aber zum Beistand in jeder Situation. Die Bedeutung der Menschenwürde für den Grundkonsens der liberalen Gesellschaft: Der Grundkonsens der liberalen Gesellschaft ist auf der Geltung der Menschenwürde gegründet. Er ist nicht positiv bestimmt, sondern dient vielmehr als Platzhalter für seine möglichen positiven Begründungen. Gerade in dieser negativen Bestimmung der Unverfügbar- keit verleiht er einer liberalen pluralistischen Gesellschaft ihre Fundamente. Das bedeutet nicht, dass die religiösen und philosophischen Begründungen dieser Menschenwürde deshalb irrelevant sind. Ganz im Gegenteil wächst dieser von ihren Begründungen die eigentliche Lebenskraft zu. Dies trifft sicher in besonderem Ausmaß für den christlichen Glauben an die Gottebenbildlichkeit des Menschen sowie Kreuz und Auferstehung zu. Einstieg in die verbrauchende Embryonenforschung Wenn die Menschenwürde aber nun teilbar wird, verliert sie ihre einigende Kraft. Der Ausschluss bestimmter Personen aufgrund bestimmter Kriterien führt zu einer Spaltung der Gesellschaft in diejenigen, die diese Kriterien erfüllen, und die anderen, die dies nicht können. Es kommt darauf an zu erkennen, dass der Grundkonsens der liberalen Gesellschaft durch die Forschung an humanen embryonalen Stammzellen – wie auch durch das therapeutische Klonen und die PID – gefährdet ist. Aktuell zeichnet sich im ethischen Konflikt um die Forschung an humanen embryonalen Stammzellen die Tendenz ab, diesen durch Begrenzungen des Verbrauchs an Embryonen zu neutralisieren. In den USA entschied Präsident Bush, die staatliche Förderung der Forschung an humanen embryonalen Stammzellen auf bestimmte,schon vorhandene Stammzelllinien zu beschränken. In Deutschland hat sich der Nationale Ethikrat mehrheitlich hin zu einer Empfehlung zum Import vorhandener humaner embryonaler Stammzelllinien orientiert. Die Argumentation geht in beiden Fällen dahin,dass es ethisch schwer zu vertreten wäre, dieses einmal schon vorhandene Forschungspotenzial zu verwerfen. Dabei ist nicht selten die Neigung unverkennbar, den Zusammenhang von humaner embryonaler Stammzellforschung und Embryonenverbrauch zu verschleiern. Die Befürworter dieser Lösung erhoffen sich, den Konflikt zwischen den Anliegen der „Lebensschützer“ einerseits und der Zeitnot der Forschung andererseits im Sinne eines pragmatischen Moratoriums zu entschärfen: Forschung ja, aber nur an vorhandenen Stammzelllinien. Diese Argumentation ist nur noch politisch bestimmt. Sie zeigt, wie sehr die angebliche Naturwüchsigkeit des biotechnologischen Fortschritts durch politische Entscheidungen gefördert wird.Aus ethischer Sicht muss jedoch darauf bestanden werden, dass die Forschung an importierten humanen embryonalen Stammzellen eine Teilhabe an der Verantwortung für die Tötung der entsprechenden Embryonen zwingend beinhaltet. Diskussion an der Bonner Universität Nicht nur auf bundespolitischer Ebene ist die embryonale Stammzellforschung umstritten. Die Absicht des Bonner Neuropathologen, Prof. Dr. med. Oliver Brüste, an importierten embryonalen Stammzelllinien zu arbeiten, stößt auch an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn auf Kritik. Zur Gewinnung derartiger Stammzellen sei eine Vernichtung menschlicher Embryonen notwendig, die durch künstliche Befruchtung erzeugt und dann nicht mehr in die Gebärmutter der Frau übertragen worden seien, heißt es in einer von mehr als 20 Fakultätsmitgliedern unterzeichneten Stellungnahme (abrufbar unter www.aerzteblatt.de). Damit würden diese zu einem Zweck missbraucht, der ihrer ursprünglichen Bestimmung, zur Geburt eines Kindes zu verhelfen, eindeutig widerspreche: „Die Forschung mit embryonalen Stammzellen, die aus dem Ausland importiert wurden, schließt eine ethische und – sinngemäß – auch eine rechtliche Billigung dieses verbrauchenden Umgangs mit Embryonen ein“. In der von Priv.-Doz. Dr. med. Santiago Ewig, Priv.-Doz. Dr. med. Axel Glasmacher und Prof. Dr. theol. Ulrich Eibach verfassten Stellungnahme wird dies als mit der Menschenwürde unvereinbar angesehen. „Das sich aus der Würde des Menschen ergebende Recht auf Leben darf auch zu ,hochrangigen‘ therapeutischen Zwecken für andere nicht infrage gestellt werden.“ Andere Bonner Wissenschaftler unterstützen das Vorhaben von Brüstle. Der zeigt sich optimistisch, die „Forschung allerspätestens zu Beginn des neuen Jahres auch in Deutschland aufnehmen zu können“. Zuvor müsse neben der lokalen Ethikkommission der Universität Bonn die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) die einzelnen Projektschritte begutachten und genehmigen. Zusätzlich werde der Bonner Leiter des Instituts für Wissenschaft und Ethik, Prof. Dr. phil. Ludger Honnefelder, die Forschungen begleiten. Brüstle forderte die DFG auf, noch in diesem Jahr klar zum Import menschlicher Stammzellen Stellung zu beziehen. Dazu regte er einen Zweistufenplan an (DÄ, Heft 48/2001). Kli 113 D O K U M E N T A T I O N Die sich abzeichnenden Entscheidungen in Deutschland bedeuten den Einstieg in die verbrauchende Embryonenforschung einschließlich des therapeutischen Klonens. Der geistige Widerstand gegen die Forschung an humanen embryonalen Stammzellen entspringt nicht einer „fundamentalistischen“, gar ausschließlich konfessionell begründeten Gegenposition. Vielmehr sind die Gegner dieser Forschung Verteidiger der Menschenwürde, die die Grundlage des liberalen Rechtsstaats bildet. Möglicherweise ist der Einstieg in die verbrau- chende Embryonenforschung auch in Deutschland nicht mehr abzuwenden. Entgegen den Suggestionen ihrer Protagonisten handelt es sich dabei jedoch nicht um einen naturwüchsigen und unabänderlichen „Fortschritt“, sondern um reversible politische Entscheidungen, auch wenn im Falle des Embryonenverbrauchs die Opfer nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Auch nach der Empfehlung des Nationalen Ethikrats und der noch offenen Entscheidung der Politik: Der politische Konflikt um die Menschenwürde hat erst begon- nen. Er muss in der Substanz eine Auseinandersetzung über die Grundlagen unseres Gemeinwesens und um die Inhalte und Ziele des „Fortschritts“ sein. ❚ Zitierweise dieses Beitrags: Dt Ärztebl 2001; 98: A 3268–3270 [Heft 49] Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf das Literaturverzeichnis, das über den Sonderdruck beim Verfasser und über das Internet (www.aerzteblatt.de) erhältlich ist. Anschrift des Verfassers: Priv.-Doz. Dr. med. Santiago Ewig Oberarzt der Medizinischen Universitäts-Poliklinik der Universität Bonn Wilhelmstraße 35, 53111 Bonn Heft 49, 7. Dezember 2001 Dokumentation Stellungnahme der Zentralen Ethikkommission zur Stammzellforschung D ie Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer hat die Aufgabe, Stellungnahmen zu ethischen Fragen abzugeben, die durch den Fortschritt und die technologische Entwicklung in der Medizin und ihren Grenzgebieten aufgeworfen werden und die eine argumentative Antwort erfordern. Die Kommission hat als unabhängiges Gremium 1995 ihre Arbeit aufgenommen und ist multidisziplinär zusammengesetzt. Sie besteht aus 16 Mitgliedern; neben 5 Ärzten der verschiedenen Fachdisziplinen gehören ihr Naturwissenschaftler, Juristen, Philosophen, Theologen und Soziologen an. Embryonenforschung und Stammzellforschung werden zurzeit öffentlich und wissenschaftlich kontrovers diskutiert. Die Zentrale Ethikkommission sieht es als ihre Aufgabe an, zu den damit verbundenen Fragen Stellung zu nehmen, und legt nachfolgend in Thesenform die Ergebnisse ihrer Beratungen vor. Hinsichtlich der Begründung verweist sie auf eine ausführliche Stellungnahme, die in Kürze vorgelegt werden wird. Hier wird sich die Zentrale Ethikkommission auch zur Frage des somatischen Zellkerntransfers (so genanntes therapeutisches Klonen) differenziert äußern. 1. Die Forschung an Stammzellen steht ungeachtet viel versprechender Ergebnisse in weiten Bereichen noch am Anfang.Viele wichtige Fragen zur Biologie und zum Potenzial embryonaler, fetaler und adulter Stammzellen sowie der Stammzellen aus Nabelschnurblut sind bisher nicht beantwortet. Dies betrifft insbesondere auch eine Abschätzung der klinischen Möglichkeiten, die durch den Einsatz der verschiedenen Stammzelltypen verwirklicht werden könnten. 2. Die Zentrale Ethikkommission weist darauf hin, dass die entsprechende Forschung bisher weithin reine Grundlagenforschung darstellt. Die bisherige Charakterisierung von Stammzellen reicht für den klinischen Einsatz noch keineswegs aus. Auch wenn überraschende Durchbrüche niemals auszuschließen sind, warnt die Zentrale Ethikkommission 114 eindringlich vor übertriebenen und voreiligen Heilungsversprechen beziehungsweise -erwartungen. Lediglich die Forschung mit speziellen hämatopoetischen Stammzellen hat bisher zu einer klinischen Anwendung in der Onkologie geführt. 3. Die Zentrale Ethikkommission verweist auf die gesellschaftliche Bedeutung der Grundlagenforschung und der patientenbezogenen Forschung.Aus gutem Grund ist die Wissenschaftsfreiheit von der Verfassung individuell und institutionell garantiert. 4. Die Zentrale Ethikkommission verweist darauf, dass das Bemühen um Fortschritte bei der Heilung und Linderung von Krankheiten auch im Hinblick auf zukünftige Generationen ein hohes ethisches und soziales Gut darstellt. Auch aus verfassungsrechtlicher Sicht besteht eine entsprechende Schutzpflicht des Staates für Leben und Gesundheit der Patienten. 5. Die Zentrale Ethikkommission verweist darauf, dass die Rechtsordnung auch dem ungeborenen menschlichen Leben in seinen frühesten Formen Schutz der Menschenwürde und des Lebens zuspricht. Daraus resultiert aber offenbar keine absolute, jedweder Abwägung entzogene Schutzpflicht. Dies zeigt die Güter- und Interessenabwägung beim Schwangerschaftsabbruch und beim Gebrauch von Nidationshemmern.1 6. Die Zentrale Ethikkommission ist sich bewusst, dass die Gewinnung und Nutzung von humanen embryonalen Stammzellen gravierendere ethische Probleme aufwerfen als die der adulten und fetalen Stammzellen sowie der Stammzellen aus Nabelschnurblut. 7. Ethische Güterabwägungen zwischen hochrangigen Schutzinteressen sind in der medizinischen Forschung und Praxis oft unausweichlich. Die Zentrale Ethikkommission bejaht einstimmig auch im Hinblick auf die Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen die prinzipielle Zulässigkeit einer Güterabwägung aus ethischer Sicht. Im Blick auf Art und Umfang der Güterabwägung und ihrer Konsequenzen gehen die Auffassungen in der Zentralen Ethikkommission allerdings auseinander. 8. Aufgrund der vorstehenden Darlegungen und unter Abwägung auch entgegenstehender Argumente ist die Zentrale Ethikkommission mehrheitlich (bei 1 Gegenstimme) der Ansicht, dass mensch- liche Embryonen, die für Zwecke der assistierten Reproduktion erzeugt wurden, aber nicht implantiert werden können, für Forschungszwecke verwendet werden dürfen, die nicht vergleichbar auf andere Weise (zum Beispiel durch Forschung an adulten Stammzellen oder an tierischen Zellen) erreicht werden können. Öffentlich und privat finanzierte Forschungsvorhaben mit humanen embryonalen Stammzellen sollten hinsichtlich ihrer Zulässigkeit von einer unabhängigen, interdisziplinär zusammengesetzten Kommission beurteilt werden. 9. Die Zentrale Ethikkommission spricht sich unter den vorstehend genannten Voraussetzungen mehrheitlich (bei 4 Gegenstimmen) dafür aus, den Import von pluripotenten embryonalen Stammzellen nicht zu behindern.2 10. Die Zentrale Ethikkommission ist einstimmig der Ansicht, dass die gezielte Herstellung von Embryonen zu Forschungszwecken auf dem Weg der Befruchtung ethisch nicht vertretbar ist. 11. Die Zentrale Ethikkommission ist einstimmig der Ansicht, dass das reproduktive Klonen von Menschen, gleichgültig auf welchem Weg es erfolgt, nicht vertretbar ist. 12. Die Zentrale Ethikkommission empfiehlt einstimmig eine intensive begleitende Forschung der ethischen, rechtlichen und sozialen Implikationen der Stammzellforschung. Köln, 23. November 2001 1 Aus moraltheologischer Sicht ist diese Regelung allerdings zu hinterfragen. 2 Anmerkung Prof. Doerfler/Prof. Helmchen: Wir haben gegen die Zulassung des Imports embryonaler Stammzellen bei gleichzeitig durch das Embryonenschutzgesetz bestehendem Verbot der Gewinnung dieser Zellen in Deutschland gestimmt. Es wäre für uns mehr als fragwürdig und völlig inakzeptabel, wenn man die in der Bundesrepublik von manchen gesellschaftlichen Gruppen aus ethischen Gründen abgelehnte Gewinnung embryonaler Stammzellen Wissenschaftlern in anderen Ländern überließe, sich die Vorteile der Forschungsergebnisse, die mit diesen Zellen vielleicht einmal gewonnen werden können, in Deutschland dann aber nutzbar machte. Diese Mentalität des unverbindlichen „SOWOHL ALS AUCH“ ist unrealistisch und würde von unseren Kollegen in anderen Ländern mit Misstrauen betrachtet: Some Germans want to have their cake and eat it too. Die „Zentrale Ethikkommission“ ist zwar bei der Bundesärztekammer (BÄK) eingerichtet, in ihrer Arbeit aber von der BÄK unabhängig. Die hier dokumentierte Stellungnahme gibt somit nicht die BÄK-Auffassung wieder; deren Vorstand DÄ hat sich noch keine Meinung gebildet. D O K U M E N T A T I O N Heft 49, 7. Dezember 2001 Stammzellforschung (II) Hartmut Kreß Menschenrecht auf Gesundheit Die Verwendung verwaister Embryonen ist ethisch denkbar. D ie Debatte um die Forschung an embryonalen Stammzellen ist durch die Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) vom 3. Mai in Bewegung geraten. Die DFG votierte für eine stärkere Beteiligung an der Forschung mit Stammzelllinien von Embryonen, die bei künstlicher Befruchtung übrig geblieben sind. Demgegenüber hat zum Beispiel die Bundesjustizministerin „absolute Grenzen“ gefordert. Der diesjährige (104.) Deutsche Ärztetag hielt diese Forschung „derzeit“ nicht für ratsam. Es steht außer Frage: Der Umgang mit Embryonen und die Beurteilung des moralischen Status von Embryonen berühren das Menschenbild und das Verständnis von Menschenwürde zutiefst. Deshalb hat es seinen guten Sinn, dass heutzutage zum Embryonenschutz auf einer Basis reflektiert wird, die kulturgeschichtlich gesehen äußerst restriktiv ist. Erst seit der Aufklärungsepoche, vor allem seit dem Preußischen Allgemeinen Landrecht von 1794, setzte sich die strikte Auffassung durch, das ungeborene Kind schon von vornherein, von der Zeugung an, im vollen Sinn als schutzwürdigen Menschen zu erachten. Die katholische Kirche hat sich sogar erst 1869 endgültig von ihrer alten Lehre getrennt, das vorgeburtliche Leben werde erst am 80. oder 90. Tag nach der Empfängnis zu einem Menschen im eigentlichen Sinn. Diese Lehre gründete auf der Idee einer stufenweisen Beseelung, die Aristoteles oder Thomas von Aquin entwickelt hatten. Das volle Menschsein des Fetus resultiere aus der Einstiftung einer Geistseele, die, nach zwei Vorstufen der Beseelung, schließlich mehrere Wochen nach der Empfängnis stattfinde. Deshalb war für das mittelalterliche Kirchenrecht eine frühe Abtreibung der Leibesfrucht, vor der Einstiftung der Geistseele, viel we- niger problematisch als eine spätere Abtreibung. Kein „absoluter“ Lebensschutz Letztlich verhalfen dann die moderne, naturwissenschaftlich fundierte Biologie und Embryologie der restriktiven Sicht zum Durchbruch, dass der Embryo von vornherein ein eigenständiger schutzwürdiger Mensch ist. Biologisch betrachtet entwickelt sich der Embryo aus seiner genetischen Anlage heraus kontinuierlich zu einer vollständigen Person. Normativ-ethisch ausgedrückt: Er besitzt von Anfang an eine so genannte starke, nämlich eine aktive, in ihm selbst als Subjekt verankerte Potenzialität zum Personsein. Ethisch und menschenrechtlich gilt, dass die Menschenwürde jedem menschlichen Individuum gleicherweise und voraussetzungslos zukommt. Deshalb sind auch dem Embryo bereits in seinen frühesten Lebensstadien Schutzwürdigkeit und Lebensrecht zuzusprechen. Inzwischen mehren sich jedoch Stimmen, die einen gradualisierten Embryonenschutz vertreten. Ihnen zufolge nimmt die Schutzwürdigkeit des Embryos mit steigendem Reifegrad beziehungsweise mit fortschreitender Individualentwicklung zu. Solche Überlegungen wirken fast wie eine Aktualisierung der alten philosophisch-theologischen Idee der stufenweisen Beseelung des Fetus. Ihnen ist entgegenzuhalten, dass ethischer Begriffsbildung zufolge „Würde“ oder „Schutzwürdigkeit“ einer Abstufung, Steigerung oder Quantifizierung grundsätzlich entzogen sind. Schon deswegen kann ein Gradualitätskonzept nicht überzeugen. Umgekehrt lässt sich aber auch nicht der Gedanke aufrechterhalten, der Embryonenschutz gelte in „absoluter“ Form. Einen absoluten Standpunkt zu vertreten, bedeutet, von konkreten Umständen, Situationen und Handlungskonstellationen ganz abzusehen. Aus einem solchen Rigorismus heraus hat der Vatikan, der nunmehr die Geistbeseelung des Embryos sofort bei der Empfängnis lehrt, jetzt den Rückzug der deutschen katholischen Kirche aus der gesetzlichen Schwangerschaftskonfliktberatung durchgesetzt. Die Deutsche Bischofskonferenz hat im März die Präimplantationsdiagnostik kategorisch abgelehnt. Das Postulat „absoluter Grenzen“ oder eines „absoluten“ Embryonenschutzes ist aber, ganz abgesehen von Evidenz- und Akzeptanzproblemen in einer pluralen Gesellschaft, auch ethiktheoretisch nicht plausibel. In begründeten Fällen hat die Ethik Ausnahmen vom Lebensschutz stets zugestehen müssen. Klassische Beispiele sind die Notwehr, die Nothilfe oder der Verteidigungskrieg. Eine Relativierung von Lebensschutz und Lebenserhaltung liegt auch bei der passiven Sterbehilfe vor. Dort ist die Einsicht leitend, dass unerträglich gewordenes Leiden ein Ende haben darf und ein Sterben in Würde möglich sein sollte. Der Lebensschutz wird ferner relativiert, wenn in Konfliktfällen der Schwangerschaftsabbruch toleriert wird oder wenn das Embryonenschutzgesetz darauf verzichtet, überzählige beziehungsweise verwaiste Embryonen am Leben zu erhalten (etwa durch Zulassung pränataler Adoption). So unterschiedlich diese Beispiele sind, belegen sie doch, dass in besonders begründeten Fällen sogar das menschliche Leben selbst in eine Abwägung gestellt werden darf. Die Würde des Menschseins und das Prinzip, dass der Lebensschutz fundamental ist und im Zweifel stets vorrangig Geltung besitzt, werden dadurch nicht beeinträchtigt. Den Lebensschutz jedoch „absolut“ setzen zu wollen lässt sich 115 D O K U M E N T A T I O N angesichts konkreter Konflikt- und Entscheidungssituationen nicht durchhalten. Besondere Abwägungsaspekte für frühe embryonale Stadien Für die frühen embryonalen Stadien, um die es bei der Stammzellforschung geht, hat die Ethik noch besondere Abwägungsaspekte zu beachten. So ist zu fragen, ob – angesichts der fließenden Übergänge zwischen Toti- und Pluripotenz und der Reprogrammierbarkeit spezialisierter Zellen – die Totipotenz noch ein plausibles, handhabbares Abgrenzungskriterium bildet. Zudem ist der Embryo nach der Nidation noch viel deutlicher als vorher ein sich selbst entwickelndes Individuum. Indem sich seine Körperachse ausbildet, nimmt er als Individuum „Gestalt“ an; Zwillingsbildung ist nicht mehr möglich. Insofern stellt sich die Frage, ob ganz frühe Embryonalstadien vor der Nidation exakt genauso wie der Embryo nach der Nidation geschützt werden müssen. Für diese frühembryonale Phase sollte zwar keine nach unten hin „abgestufte“ Schutzwürdigkeit behauptet werden. Aber es lässt sich eine etwas größere Ausnahmemöglichkeit vom grundsätzlich geltenden Lebensschutz und Lebenserhalt vertreten. Deshalb werden für die Stammzellforschung die Verwendung verwaister, ohnehin dem Tod ausgelieferter Embryonen und theoretisch sogar übergangsweise eine Reprogrammierung von Zellkernen, bei der ein Abbruch der Entwicklung nach wenigen Tagen erfolgt, ethisch denkbar. Dass darauf bezogene Abwägungen legitim sind, begründet sich aus den herausgeho- 116 benen Zielen der Stammzellforschung, nämlich der Therapie von Krankheiten, bei denen konventionelle Behandlungsmethoden an Grenzen stoßen. In bestimmten Fällen scheint der alleinige Rückgriff auf adulte Stammzellen heutigem Ermessen zufolge unzureichend zu bleiben. Das Votum, das die DFG zugunsten der Forschung an embryonalen Stammzellen abgab, legte vor allem auf die Forschungsfreiheit Wert. Diese bildet in der Tat einen Kern neuzeitlicher Verfassungsprinzipien und ist auch in der EUGrundrechtscharta tragend. Für die Abwägung, die die Forschung an embryonalen Stammzellen betrifft, dürfte letztlich jedoch dem Menschenrecht auf Gesundheit eine noch höhere Aussagekraft zukommen. Denn der Embryonenschutz einerseits und die Gesundheitsförderung andererseits stehen als vitale, das Leben betreffende Güter in innerem Bezug zueinander. Das Menschenrecht auf Gesundheit, nämlich das Recht des Einzelnen auf „das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit“, haben Internationale Konventionen kodifiziert (Internationaler Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966 oder die UN-Kinderrechtskonvention von 1989). Die EU-Grundrechtscharta fordert ein „hohes Gesundheitsschutzniveau“ für die „Durchführung aller Politiken und Maßnahmen“. Das Recht auf Gesundheit zählt zu jenen Menschenrechten, die staatlicherseits nach Maßgabe der jeweiligen technischen, ökonomischen und sozialkulturellen Bedingungen zu fördern sind. Auch auf der Basis einer Ethik der Zukunftsverantwortung, mithin im Blick auf schwere Krankheitsbilder künftig lebender Patienten, ist das Menschenrecht auf Gesundheit bedeutsam. Normierende Kriterien und permanente Überprüfung Es ist argumentativ unvertraut und neuartig, den Schutz von Embryonen, also ein Schutzrecht einerseits, und das Recht auf Gesundheit als menschenrechtlichen Anspruch andererseits in einen Ausgleich zu bringen. Voraussetzung für eine – therapeutischen Zielen dienende – embryonale Stammzellforschung müssten normierende Kriterien, permanente Überprüfung und die Möglichkeit der Korrektur einmal betretener Forschungspfade sein. Die Gefahr, dass durch diese Forschung die Ethik des Embryonenschutzes oder gar die kulturelle Geltung der Menschenwürde generell ausgehöhlt würde, könnte so abgewehrt werden. ❚ Zitierweise dieses Beitrags: Dt Ärztebl 2001; 98: A 3272–3274 [Heft 49] Literatur 1. Demel S:Abtreibung zwischen Straffreiheit und Exkommunikation. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer, 1995. 2. Knoepffler N: Menschliche Embryonen und medizinethische Konfliktfälle. In: Knoepffler N, Haniel A (Hrsg.): Menschenwürde und medizinethische Konfliktfälle. Stuttgart, Leipzig: Hirzel, 2000; 55–66. 3. Kreß H: Menschenwürde vor der Geburt. Grundsatzfragen und gegenwärtige Entscheidungsprobleme (Präimplantationsdiagnostik; Nutzung von Stammzellen). In: Kreß H/Kaatsch H-J (Hrsg.): Menschenwürde, Medizin und Bioethik. Münster: LIT, 2000; 11–37. 4. Kreß H: Präimplantationsdiagnostik, der Status von Embryonen und embryonale Stammzellen. In: Zeitschrift für Evangelische Ethik 2001; 46: 230–235. Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. theol. Hartmut Kreß Universität Bonn, Evangelisch-Theologische Fakultät Abteilung Sozialethik Am Hof 1, 53113 Bonn E-Mail: [email protected] D O K U M E N T A T I O N Heft 1–2, 7. Januar 2002 Forschung und Ethik Die Weichen sind gestellt Embryonale Stammzellforschung und PID sind umstrittene Themen, für die in diesem Jahr Entscheidungen anstehen. N och im Januar wird die Entscheidung in einer in Deutschland seit Monaten heftig umstrittenen Frage erwartet: Embryonale Stammzellforschung – ja oder nein? Eine Antwort darauf soll der Deutsche Bundestag nach einer erneuten Debatte am 30. Januar geben. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) will am 31. Januar über die öffentliche Förderung des Projekts von Prof. Dr. med. Oliver Brüstle, der embryonale Stammzelllinien importieren will, entscheiden. Die Entscheidung ist bereits mehrfach verschoben worden, zuletzt am 7. Dezember 2001, um dem Bundestag nochmals Gelegenheit zur Diskussion zu geben. Die Enquete-Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“, die sich im November mehrheitlich gegen die Forschung an embryonalen Stammzellen und gegen den Import von Zelllinien wandte, macht es den Abgeordneten nicht leicht. Da es sich um eine Gewissensfrage handele, gab sie keine Empfehlung für die Abstimmung. Eine Minderheit plädierte dafür, den Import unter strengen Voraussetzungen zu tolerieren. Dies ist auch die Ansicht der knappen Mehrheit des Nationalen Ethikrats. Das von Bundeskanzler Gerhard Schröder im Frühjahr 2001 eingesetzte Gremium befürwortete am 29. November den Import von embryonalen Stammzellen unter strengen Auflagen und mit einer Befristung auf drei Jahre. Bundesforschungsministerin Edelgard Bulmahn will die Forschung an „überzähligen“ Embryonen ebenso erlauben wie die Zentrale Ethikkommission, die zwar bei der Bundesärztekammer (BÄK) angesiedelt, jedoch von ihr unabhängig ist. Der Präsident der BÄK, Prof. Dr. med. Jörg-Dietrich Hoppe, mahnt indes zur Besonnenheit. Man solle zunächst die Möglichkeiten der Forschung an adulten Stammzellen ausschöpfen, fordert er. Ablehnend steht Bundesjustizministerin Däubler-Gmelin der Forschung an embryonalen Stammzellen gegenüber. Sie ist der Ansicht, dass Embryonen als frühe Formen des menschlichen Lebens nicht „vernutzt“ werden dürften. Forschungsfreiheit gehöre zwar zu den Grundrechten, sagte sie Ende Dezember in Berlin, doch Anwendungsforschung am Menschen sei selbstverständlich nicht frei. „Egal, wie das Votum des Bundestages am 30. Januar ausfällt“, sagte Däubler-Gmelin, an den DFG-Präsidenten Prof. Dr. Ernst-Ludwig Winnacker gewandt, „erwarte ich, dass dies auf die DFG-Entscheidung Einfluss hat!“ Deren Meinung steht jedoch bereits seit Mai vergangenen Jahres grundsätzlich fest: Man könne in Deutschland nicht auf die Forschung an embryonalen Stammzellen verzichten. Auch die Max-Planck-Gesellschaft sieht das so. Die Präimplantationsdiagnostik (PID) ist längst kein Tabuthema mehr. Die Zahl ihrer Befürworter jedenfalls scheint zuzunehmen. Zurzeit ist diese Methode vorgeburtlicher Diagnostik nach dem Embryonenschutzgesetz verboten. Aber auch das ist umstritten. Der Wissenschaftliche Beirat der BÄK, der mit seinem „Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik“ (DÄ, Heft 9/2000) die Debatte über diese Methode ausgelöst hatte, hält die PID für mit dem Embryonenschutzgesetz vereinbar. In einer jetzt vorgelegten „Ergänzenden Stellungnahme“ hält er nach Überprüfung der Einwände an seiner Position fest, „wonach die PID im Einzelfall bei Verdacht auf die Entstehung einer schwerwiegenden genetischen Erkrankung in engen Grenzen und Einhaltung strikter Verfahrensregeln aus medizinischen, ethischen und rechtlichen Gesichtspunkten vertretbar ist“. Der Wissenschaftliche Beirat drängt allerdings auf eine Klärung der Zulässigkeit der PID durch den Gesetzgeber. Die Bundesärztekammer hat dieser Stellungnahme noch nicht zugestimmt, deren Vorstand will sich am 17. Januar eine Meinung dazu bilden. Die Mehrheit der Delegierten des 104. Deutschen Ärztetages in Ludwigshafen hatte ebenfalls an den Gesetzgeber appelliert, rechtliche Klarheit über die Zulässigkeit der PID herzustellen. Für den Fall einer Zulassung müsse der Gesetzgeber weitere Kriterien für eine maximale Eingrenzbarkeit dieser Methode mitgestalten, heißt es in einem Beschluss. Auch in der Politik besteht keine Einigkeit in der Frage, ob die PID zugelassen werden sollte. Nur die Freien Demokraten haben sich festgelegt: Sie sprechen sich eindeutig für die PID aus und haben einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt, der in erster Lesung am 14. Dezember im Bundestag beraten wurde. Dieser Entwurf stieß auf scharfe Kritik bei zahlreichen Abgeordneten unterschiedlicher Fraktionen. „Die Zulassung der PID kann stigmatisierende und diskriminierende Tendenzen in der Gesellschaft gegenüber Menschen mit Behinderungen und chronisch Kranken verstärken“, sagte die Behindertenbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion, Helga Kühn-Mengel. Für Maria Böhmer (CDU/CSU) bedeutet PID,„dass menschliches Leben selektiert und getötet wird“. Dr. med. Eva A. Richter/Gisela Klinkhammer 117 D O K U M E N T A T I O N Heft 1–2, 7. Januar 2002 Stammzellen „Rohstoff“ für die regenerative Medizin Stammzellen gelten als Hoffnungsträger in der regenerativen Medizin. Doch sowohl embryonale als auch adulte Stammzellen weisen Vor- und Nachteile auf. D ie Stammzellforschung weckt derzeit Hoffnung auf eine nahezu unbegrenzte Anwendung von Stammzellen in der regenerativen Medizin. Ergebnisse aus Tierversuchen mit embryonalen und adulten Stammzellen lassen vermuten, dass in einer nicht allzu fernen Zukunft für die Transplantation geeignete Spenderzellen in Zellkulturverfahren hergestellt werden können. Einen starken Aufschwung nahm die Stammzellforschung Ende 1998, als Wissenschaftler Verfahren zur Kultur humaner Stammzellen aus in vitro befruchteten menschlichen Embryonen entwickelten. Die Arbeitsgruppe um James Thomson, University of Wisconsin, Madison (USA), isolierte aus einem sieben Tage alten Embryo Stammzellen und gewann daraus mehrere Zelllinien. Diese Methode eröffnete völlig neue Perspektiven für Gewebezucht und Organersatz. Das Wissenschaftsmagazin „Science“ deklarierte 1999 zum Jahr der Stammzellforschung („Breakthrough 1999“). Ethische und rechtliche Fragen Embryonale Stammzellen scheinen grundsätzlich zur Züchtung von Gewebe oder Organen geeignet zu sein. Es ist durchaus denkbar, dass künftig fehlerhafte Organfunktionen durch Transplantation von gezüchteten Stammzellen behoben und somit einige erbliche und erworbene Erkrankungen geheilt werden können. Allerdings wirft die Gewinnung von Stammzellen aus „geopferten“ Embryonen viele ethische, moralische und rechtliche Fragen auf. Dies ist bei adulten Stammzellen weniger der Fall. Die aus dem erwachse- 118 Die Entwicklungspotenziale der embryonalen Stammzellen (ES-Zellen, EG-Zellen) und der adulten Stammzellen unterscheiden sich deutlich. Generell nimmt das entwicklungsbiologische Potenzial mit dem ontogenetischen Alter ab. Die ES-Zellen und EG-Zellen eignen sich deshalb wahrscheinlich besonders für Zellersatzstrategien bei Geweben, die sich nur sehr eingeschränkt regenerieren (speziell für das Nervensystem). So konnten aus ESZellen der Maus abgeleitete Zellen in einem Rattenmodell bei einer Myelinmangel-Krankheit den Myelinmangel wieder aufheben. Da die multiple Sklerose ebenfalls eine MyelinmangelKrankheit ist, sind analoge Therapieansätze vorstellbar. Aus ES-Zellen der Maus können auch Nervenzelltypen hergestellt werden, die bei Morbus Parkinson defekt sind. Vorstellbar ist ferner die Transplantation von ESZellen abgeleiteten Herzmuskelzellen zur Behandlung von Herzinsuffizienz und Herzinfarkt. Ein ebenso viel versprechender Weg ist die In-vitro-Differenzierung insulinbildender Zellen zur Behandlung des Diabetes mellitus. nen Organismus gewonnenen Stammzellen scheinen ebenfalls ein annähernd unbegrenztes Differenzierungspotenzial zu besitzen. Im Labor lassen sich aus ihnen unter speziellen Bedingungen Muskel-, Knorpel-, Leber- oder Nervenzellen züchten. Bisher war ihre Umwandlungsfähigkeit oder Plastizität unbekannt. Sie könnte aber genutzt werden, um spezifische Zellen oder Gewebsverbände für die Transplantation herzustellen. Stammzellen können auf verschiedenen Wegen gewonnen werden: Adulte Stammzellen lassen sich aus fetalen Geweben, Nabelschnurblut oder aus Grafik Geweben eines Erwachsenen (zum Beispiel aus dem Knochenmark) isolieren. Embryonale Stammzellen (ES) werden aus bis zu sieben Tagen alten Embryonen gewonnen. Mehrere Arbeitsgruppen haben inzwischen Zelllinien etabliert, wobei jede eine fast unerschöpfliche Quelle für For- Korrelation zwischen Selbsterneuerungspotenzial und ontogenetischem Alter bei einem und demselben Phänotyp von Blutschungs- und Behand- stammzellen. Das Potenzial ist am höchsten bei Zellen aus fetaler lungszwecke darstellen Leber, gefolgt von denen aus Nagelschnurblut, und am niedrigkönnte. Auch aus den sten aus erwachsenem Knochenmark. Quelle: Anthony D. Ho et al. Urkeimzellen während der fetalen Entwicklung können „emIn jüngster Zeit hat sich herausgebryonale germ“-(EG-) Zellen abgelei- stellt, dass adulte Stammzellen nicht tet werden. Menschliche EG-Zellen nur Zellen des entsprechenden Organs besitzen ähnliche Potenziale wie ES- hervorbringen können, sondern auch Zellen. Ob die aus menschlichen EG- Zellen anderer Gewebe oder Organe. Zellen abgeleiteten Spenderzellen nach Aus dem Knochenmark wurden zum Transplantation zur Geweberegenera- Beispiel nicht nur neue Blutzellen abtion eingesetzt werden können, ist zur- geleitet, sondern auch Zellen verschiezeit offen. dener Körpergewebe, wie Knochen, D O K U M E N T A T I O N Knorpel, Sehnen, Muskeln, Leber. Sogar Nervenzellen bildeten sich. Neurale Stammzellen, isoliert aus einer erwachsenen Maus, können nach Implantation in frühe Embryonalstadien einer Empfängermaus in zahlreichen Geweben und Organen identifiziert werden. Ein breites Differenzierungsspektrum ließ sich auch für Stammzellen aus dem Skelettmuskel nachweisen. Eine Transplantation von Knochenmarkzellen behob bei Mäusen einen ansonsten wahrscheinlich tödlich verlaufenden Leberschaden. Im April 2001 hat eine amerikanische Arbeitsgruppe über die Regeneration von Cardiomyozyten nach Herzinfarkt berichtet. Sie umspritzte das infarzierte Gebiet mit Blutstammzellen aus einem Spendertier. Bei Mäuseherzen mit künstlich erzeugtem Infarkt erreichte eine weitere Arbeitsgruppe durch Transplantation von Blutstammzellen eine Gefäßneubildung und Regeneration der Cardiomyozyten. Auch autologe Blutstammzellen werden zur Gefäßneubildung nach einer induzierten Ischämie des Skelettmuskels verwendet. Allerdings gelangen den Forschern die meisten Versuche bisher nur im Tiermodell. Klinische Relevanz fraglich Im Gegensatz zu den adulten Stammzellen sind die embryonalen Stammzellen aus Zelllinien eine fast unerschöpfliche Quelle. Die Konzentration pluripotenter Stammzellen im erwachsenen Organismus ist dagegen gering. Aber nur diese reifen in Gewebe mit sehr niedrigen Teilungsraten, wie Neuronen, Cardiomyozyten oder Inselzellen, aus. Bei den Tiermodellen wurden Transplantate aus angereicherten Zellen eines Spendertiers verwendet. Das Tier musste geopfert werden. Ob adulte Stammzellen klinische Relevanz erreichen, ist daher fragwürdig. Die Verwendung von embryonalen Stammzellen birgt jedoch ethische Probleme und auch einige Gefahren. Im Tierversuch induzierte die Transplantation von unreifen embryonalen Zellen Teratome oder Teratokarzinome. Der Einsatz spezieller Kulturbedingungen kann diese Gefahr allerdings zumindest im Tierversuch beseitigen. Eine Trans- plantation von aus ES-Zellen abgeleiteten Spenderzellen führt in einem erwachsenen Organismus möglicherweise zu Abstoßungsreaktionen. Daher müssen die ES-Zellen zuerst auf einen geordneten Differenzierungsweg gelenkt werden (Priming). Ob sich aus menschlichen ES-Zellen Spenderzellen gewinnen lassen, wird derzeit intensiv untersucht. Nur durch Forschungsarbeiten an menschlichen ES-Zellen lassen sich solche Informationen ableiten. Nabelschnurblut, das in der Regel nach der Geburt entsorgt wird, enthält eine begrenzte Anzahl von Blutstammzellen und pluripotenten Stammzellen. Durch Transplantation dieser Zellen lässt sich ein intaktes Blut- und Immunsystem wiederherstellen. Nabelschnurblut enthält jedoch keine ausreichende Zahl von Stammzellen, um auch größere Kinder und Erwachsene zu behandeln. Deshalb versuchen Wissenschaftler seit Jahren, unter kontrollierten Bedingungen Stammzellen zu kultivieren und zu vermehren. Die pluripotenten Stammzellen brauchen aber offensichtlich spezielle Kulturbedingungen. Bisher ist ihre Vermehrung aus Knochenmark des Erwachsenen oder aus Nabelschnurblut noch nicht überzeugend gelungen. Alternative: fetale Stammzellen Durch In-vitro-Manipulationen können aus dem „Rohstoff“ Stammzelle vermutlich eines Tages Knorpel-, Leber- oder Nervenzellen gezüchtet werden. Diese könnten sich zur Transplantation bei Patienten mit Gelenkserkrankungen, Leberversagen, Alzheimer-Demenz, Morbus Parkinson, Schlaganfall oder Querschnittslähmungen eignen. Wegen ihrer enormen Selbsterneuerungsfähigkeit und des entwicklungsbiologischen Potenzials können embryonale Stammzellen wahrscheinlich für Zellersatzstrategien bei Geweben eingesetzt werden, die nur ein sehr eingeschränktes Regenerationsvermögen aufweisen. Adulte Stammzellen können auch neue Differenzierungswege „erlernen“, sind jedoch schwer im Organismus zu finden. Hinzu kommt, dass die Selbsterneuerungsfähigkeit solcher Stammzellen relativ gering ist. Es ist daher fragwürdig, ob diese theoretisch interessante Alternative für den klinischen Einsatz bedeutsam sein wird. Beim derzeitigen Stand ist es daher besser, sich alle Wege offen zu halten, anstatt sich auf eine feste Strategie der Stammzellforschung zu beschränken. Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. med. Anthony D. Ho Universität Heidelberg Medizinische Klinik und Poliklinik V Hospitalstraße 3, 69115 Heidelberg Fetale Gewebe kommen prinzipiell auch als Quelle pluripotenter Stammzellen infrage. Fetale Knochenmarks- und Leberzellen besitzen ein relativ hohes Proliferations- und Selbsterneuerungspotenzial. Ob das Plastizitätspotenzial mit den Selbsterneuerungs- und Proliferationspotenzialen korreliert, wird intensiv untersucht. Eventuell stellen diese Stammzellen eine Alternative für die regenerative Medizin dar (Grafik). Die fetalen Stammzellen können jedoch nur während eines sehr engen Entwicklungsfensters aus abortiertem Gewebe von Feten gewonnen werden. Da in der Regel nur aus medizinischen Gründen ein Abort eingeleitet wird, wahrscheinlich aufgrund einer Fehlbildung oder einer Embryopathie, ist solches Material möglicherweise mit zellulären Schäden assoziiert und nur bedingt für die Gewinnung therapeutisch einsetzbarer Spenderzellen geeignet. 119 D O K U M E N T A T I O N Heft 3, 18. Januar 2002 Stammzellforschung Erfolg versprechende Therapieansätze Die Entscheidung zur Stammzellforschung steht bevor. In der gesellschaftlichen Diskussion ist derzeit die Forschung an adulten Stammzellen in den Hintergrund getreten, obwohl auch diese ein erhebliches Therapiepotenzial besitzen. E mbryonale Stammzellen sind gerade schwer in Mode“, sagte der Vorsitzende des Nationalen Ethikrates, Prof. Dr. jur. Spiros Simitis, Anfang Januar in einem Interview mit dem „Spiegel“. Forschung dürfe sich jedoch nicht nach irgendwelchen Modetrends richten. Auch ökonomische Faktoren dürften bei der Entscheidung keine Rolle spielen. „Wenn die Länder und der Bund massiv in die Forschung mit adulten Stammzellen investierten, würden wir andere Ergebnisse haben“, erklärte der Jurist. Das Dilemma der deutschen Stammzelldebatte sei es, dass sie zu einem Zeitpunkt begonnen habe, an dem die Vorentscheidungen bereits weitgehend getroffen waren, meint Simitis.Alternative Wege seien jetzt nur noch schwer zu beschreiten. Riss durch alle Parteien Tatsächlich dreht sich die politische Diskussion nahezu ausschließlich um die Forschung an embryonalen Stammzellen (ES-Zellen) und kaum um die an adulten Stammzellen (AS-Zellen). In einem fraktionsübergreifenden Gruppenantrag fordern die Gegner der Forschung an ESZellen aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen, PDS und CSU die Bundesregierung nochmals auf, den Import von menschlichen Stammzelllinien zu verhindern. Zudem liegt ein Antrag von Importgegnern in der CDU vor. Als Antwort auf diese Anträge haben dagegen Befürworter des Stammzelllinien-Imports, darunter Margot von Renesse (SPD), Vorsitzende der Enquete-Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“, ebenfalls eine 120 Initiative verfasst. Darin plädieren sie für den Import, aber unter noch strengeren Vorschriften, als sie vom Nationalen Ethikrat empfohlen werden. Der Ethikrat befürwortet einen Import von ES-Zelllinien nur, wenn die verwendeten Embryonen unabhängig von Forschungsvorhaben durch künstliche Befruchtung erzeugt wurden und nicht mehr transferiert werden. Das Paar, aus dessen Keimzellen der Embryo erzeugt wurde, muss zustimmen. Die Forschungsvorhaben müssen eine medizinische Perspektive haben und interdisziplinär begutachtet werden. Die knappe Mehrheit des Rates hatte am 29. November 2001 für den Import unter diesen Auflagen und mit einer Befristung auf drei Jahre plädiert. Kurz vor Weihnachten hat der Rat seine schriftliche Stellungnahme zum Import menschlicher ESZellen vorgelegt. Darin erläutert er seine Argumente sowohl für als auch gegen die Gewinnung von ES-Zellen. Ein großer Teil des Memorandums beschäftigt sich mit den Argumenten für oder gegen deren Import. Dabei gelangt der Nationale Ethikrat zu vier möglichen Schlussfolgerungen. Option A hält den Import und die Gewinnung von embryonalen Stammzellen aus überzähligen Embryonen für zulässig (auch im Inland). Nach Option B dürfen die ES-Zellen zwar importiert, jedoch nicht erzeugt werden. 15 Mitglieder sprachen sich für diese Option aus, darunter neun Mitglieder, die zugleich Option A befürworteten. Option C wendet sich vorläufig gegen den Import. Bis 2004 sollen noch offene Fragen geklärt werden, insbesondere soll die Forschung an adulten Stammzellen gezielt gefördert werden. Option D lehnt den Import grundsätzlich als ethisch unzulässig ab. Die Gewinnung von embryonalen Stammzellen wird als Tötung menschlichen Lebens angesehen. Zehn Mitglieder sprachen sich für das Moratorium aus (Option C), darunter vier Mitglieder, die gleichzeitig für Option D stimmten. Einig ist sich der Ethikrat darin, dass die Forschung an embryonalen Stammzellen Fragen der Menschenwürde, des Lebensschutzes und der Wissenschaftsfreiheit aufwirft, die es gegeneinander abzuwägen gilt. Der Suche nach neuen Therapiemöglichkeiten misst er ein hohes Gewicht bei. Umstritten bleibt jedoch, welche Wege der Forschung mit humanen Stammzellen notwendig und ethisch vertretbar sind. Bundesjustizministerin Prof. Dr. jur. Herta Däubler-Gmelin sähe es gern, wenn stärker auf adulte Stammzellen gesetzt würde. Dies sagte sie im Dezember bei einer Podiumsdiskussion der Wochenzeitung „Die Zeit“ in Berlin. Der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), Prof. Dr. rer. nat. Ernst-Ludwig Winnacker, und Prof. Dr. med. Otmar D.Wiestler, Direktor des Institutes für Neuropathologie der Universität Bonn, verteidigten die Forschung an ES-Zellen. Diese würden viele Vorteile gegenüber den adulten Stammzellen bieten, beispielsweise die nahezu unbegrenzte Vermehrbarkeit. „Man darf die Zweige der Stammzellforschung nicht gegeneinander in die Waagschale legen“, betonte Wiestler. Der Verzicht auf ESZellen sei kurzsichtig, die Forschung an adulten Stammzellen allein führe nicht zum Ziel. Winnacker berief sich auf die Forschungsfreiheit: „Jetzt hat man schon ein schlechtes Gewissen, wenn man nur darüber redet.“ Grundlegende Forschungserfolge habe es immer nur in Grenzbereichen gegeben. Die Justizministerin konterte: Forschungsfreiheit gehöre zwar zu den Grundrechten, Anwendungsforschung am Menschen sei jedoch nicht frei. „Egal, wie die Bundestags-Entscheidung ausfällt, sie wird großen Einfluss auf die DFG haben“, betonte Däubler-Gmelin. Den möglichen Einsatz adulter neuronaler Stammzellen als Zellersatz untersucht unter anderem der Neurobiologe Dr. rer. nat. Ludwig Aigner in einem Forscherteam* der Universität Regensburg. Er berichtete darüber bei ei- D O K U M E N T A T I O N nem Symposium der Berliner Medizinischen Gesellschaft Ende November in Berlin. Seine Arbeitsgruppe versucht, ausgehend von Resektaten aus der Epilepsiechirurgie, adulte neuronale Stammzellen zu kultivieren, zu differenzieren und in den Organismus zu retransplantieren. Dazu sollen zunächst geeignete Zellkulturmethoden zur Vermehrung und Reifung der adulten Stammzellen entwickelt werden. Der Forschungsansatz beruht auf der Erkenntnis, dass Stammzellen nicht nur während der embryonalen und fetalen Entwicklung, sondern auch im adulten Gehirn existieren und sich zu neuen Nervenzellen entwickeln können (Neurogenese). Bis vor wenigen Jahren glaubte man noch, dass sich die Gehirnzellen nach der Geburt nur noch reduzieren, nicht aber regenerieren und vermehren können. Inzwischen ist jedoch die Neurogenese im adulten Gehirn nachgewiesen, vor allem im Bulbus olfactorius, im Gyrus dentatus des Hippocampus und im Neocortex. * Dr. rer. nat. Hans-Georg Kuhn, Dr. med. Norbert Weidner und Dr. med. Jürgen Winkler Auf dem Gebiet der adulten Stammzellforschung beschäftigen sich Ärzte und Wissenschaftler mit zwei grundsätzlichen Bereichen: der Stimulation der adulten Neurogenese in vivo und der Regulation in vitro. Die „In-vivoStammzellforscher“ versuchen, die Neurogenese durch Wachstumsfaktoren, Unterdrückung von Apoptose-Signalen und äußere Reize „vor Ort“ zu stimulieren und auf diese Weise Reparaturvorgänge zu induzieren und Zellverluste direkt im Gehirn zu kompensieren (DÄ, Heft 33/2001). „In-vitro-Stammzellforscher“ wie Aigner nutzen ebenfalls die Multipotenz der adulten neuronalen Stammzellen. Sie entnehmen diese jedoch und versuchen, deren Proliferation und Differenzierung durch Medienzusätze zu beeinflussen. Aigners Vision ist es, körpereigene Zellen zu vermehren und in vitro zu neuen Nerven- beziehungsweise Gliazellen (Astrozyten sowie Oligodendrozyten) reifen zu lassen und diese dem Spender autolog zu transplantieren. Somit würde die Gefahr der Transplantatabstoßung gebannt, die bei der Trans- Nachgefragt DÄ: Herr Aigner, wird die Transplantation von adulten neuralen Stammzellen die Therapie der Zukunft bei neurologischen Erkrankungen sein? Aigner: Neurale Stammzellen des adulten Nervensystems werden sicherlich nicht das Allheilmittel sämtlicher neurologischer Erkrankungen sein. Ihr Einsatz wird sich primär auf neurodegenerative Erkrankungen, wie den Morbus Parkinson oder entzündliche Erkrankungen, wie die multiple Sklerose, beschränken. Die derzeitigen Therapien versuchen lediglich den Zellverlust zu vermindern oder den Verlust von Neurotransmitterstoffen zu kompensieren. Stammzelltherapien hingegen zielen auf einen zellulären Ersatz ab. te Stammzellforschung profitiert auf jeden Fall von den Kenntnissen, die an embryonalen Zellen gewonnen worden sind, da die Regulationsmechanismen, die die Proliferation und Differenzierung kontrollieren, vergleichbar sind. DÄ: Welches sind die größten Hindernisse bis zum klinischen Einsatz von adulten Stammzellen? Aigner: Derzeit ist der EinDr. rer. nat. Ludwig Aigner, satz primär durch die noch unzureichenden ZellkulturbedinNachwuchsgruppenleiter der Universität Regens- gungen limitiert. Im Gegensatz burg, VW-Stiftung Foto: privat zu ES-Zellen vermehren sich adulte Stammzellen nur unDÄ: Die adulten neuronalen Stammzellen biegenügend. Wir müssen noch Wege finden, die Zellten einige Vorteile: Sie sind ohne ethische Bedenken proliferation zu steigern, um aus einer möglichst verfügbar und werden nach autologer Transplantakleinen Biopsie in relativ kurzer Zeit möglichst vietion nicht vom Organismus abgestoßen. Ist es da le neurale Stammzellen zu züchten. überhaupt nötig, menschliche embryonale Stammzellen zur Züchtung von Zellersatz einzusetzen? DÄ: In welchem Zeitraum könnten die TheraAigner: Bei dem derzeitigen Wissensstand solpiestrategien umgesetzt werden? len und müssen beide Zelltypen gleichwertig und inAigner: Mit einer auf adulte neurale Stammtensiv zunächst im Tierexperiment auf ihr therapeuzellen basierenden Zellersatztherapie kann sichertisches Potenzial und auf ihr Risiko getestet werden. lich nicht in den nächsten fünf Jahren gerechnet Erst dann kann einer Zellpopulation der Vorzug für werden. Ein Zeitraum von zehn Jahren ist eher readie klinische Anwendung gegeben werden. Die adullistisch. plantation von embryonalen Stammzellen besteht. Neurale Stammzellen lassen sich bereits aus verschiedenen Gehirnregionen von Nagern und Menschen isolieren. „Durch geeignete Wachstumsfaktoren, wie den epidermalen Wachstumsfaktor (EGF) und den basischen Fibroblasten-Wachstumsfaktor (FGF-2) können die Zellen in Neurosphären (dreidimensionale Zellaggregate von neuralen Vorläuferzellen) angereichert und vermehrt werden“, erklärt Aigner. Nach klonaler Expansion der Zellen entzog der Neurobiologe den Neurosphären die Wachstumsfaktoren und gab andere Signalmoleküle hinzu (Retinolsäure sowie neurotrophe Faktoren). Daraufhin beobachtete er die Reifung der Stammzellen zu Nervenoder Gliazellen. Besonders erfolgversprechend sei der Einsatz der autologen Transplantation bei der Therapie des Morbus Parkinson, da dieser durch einen räumlich und funktionell relativ eng umschriebenen Nervenzellverlust charakterisiert ist. Bei Morbus Alzheimer hingegen sei eher eine endogene Stimulation der neuralen Stammzellen aussichtsreich. Bei Traumata, wie der Querschnittslähmung, ist ebenfalls die Transplantation von neuralen Stammzellen erfolgversprechend. Die dadurch ersetzten Gliazellen könnten ein neues Gerüst zur Wiedereinsprossung unterbrochener Nervenbahnen bilden. „Bei der Transplantation gehen wir davon aus, dass die In-vivo-Umgebung des Transplantats zusätzlich einen determinierenden Einfluss auf die Differenzierung ausübt“, erläuterte Aigner. Seinem Kollegen Weidner gelang es bereits, aus dem erwachsenen ZNS gewonnene neurale Stammzellen in verletztes Rückenmark zu transplantieren, die sich in Gliazellen umwandelten. Am 30. Januar werden die Abgeordneten des Deutschen Bundestages abschließend und allein nach ihrem Gewissen über die Zukunft der Stammzellforschung in Deutschland diskutieren. Die Abstimmung gehört damit zu den wenigen, bei denen es keinen Fraktionszwang gibt. Einen Tag später will die DFG entscheiden, ob der Import von embryonalen Stammzelllinien aus dem Ausland mit öffentlichen Geldern gefördert werden soll. Dr. med. Eva A. Richter 121 D O K U M E N T A T I O N Heft 4, 25. Januar 2002 Stammzellforschung Durch- oder Dammbruch N ächste Woche, am 30. Januar, will der Deutsche Bundestag darüber entscheiden, ob embryonale Stammzellen nach Deutschland importiert werden dürfen. Er will damit eine Frage klären, die das deutsche Embryonenschutzgesetz offen gelassen hat – ob bewusst oder unbewusst, darüber streiten die Gelehrten. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft steht bereits am Drücker, um grünes Licht für Forschungen an embryonalen Stammzellen zu geben. Im Vorfeld der Bundestagsentscheidung hat es gegensätzliche gutachterliche Stellungnahmen gegeben. Die Enquete-Kommission des Bundestages plädierte für ein Verbot des Imports, ließ aber vorsorglich Alternativen erkennen. Der Nationale Ethikrat des Bundeskanzlers sprach sich für den Import aus, und die Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekam- mer kam fast zeitgleich zum gleichen Ergebnis. Eine Äußerung der Bundesärztekammer selbst steht aus, wenn man von einer zurückhaltenden Entschließung des Deutschen Ärztetages aus dem vergangenen Jahr einmal absieht. Der Vorstand der Bundesärztekammer hatte sich noch am 17. Januar von Wissenschaftlern über den Stand der Erkenntnisse informieren lassen, eine eigene Entscheidung jedoch hintangestellt. In den Bundestagsfraktionen und innerhalb der Bundesregierung sind die Auffassungen nach wie vor geteilt. Es bleibt also spannend, mit welcher Mehrheit der Bundestag abstimmen wird. Die Hoffnung der Befürworter der embryonalen Stammzellforschung geht dahin, dass die Abgeordneten durch die langwierige öffentliche Diskussion weich gekocht sind, wenn sie nicht ohnehin der Freiheit der Forschung, dem Wissenschaftsstandort Deutschland und den Hoffnungen auf Heilung den Vorzug vor ethischen Überzeugungen geben. Eine positive Entscheidung des Bundestages würde von den einschlägigen Forschern gewiss als Durchbruch gewertet. Die Gegner befürchten eher einen Dammbruch. Ob Durchbruch oder Dammbruch, eine Zustimmung des Bundestages zum Import embryonaler Stammzellen wäre nur ein erster Schritt. Denn es würde nicht beim Import bleiben, sondern in der Logik der Entscheidung läge es, embryonale Stammzellen auch in Deutschland zu erzeugen und schließlich, Forschung siegt, auch weitergehende Forschungen, so sie nur mit genügenden Heilsversprechungen verbunden sind, in die Wege zu leiten. Wenn der Bundestag das nicht will, dann müsste er ein klares Wort sprechen und sich auf die Linie des Embryonenschutzgesetzes begeNorbert Jachertz ben. Heft 4, 25. Januar 2002 Embryonenforschung und PID „Ethik des Heilens“ versus „Ethik der Menschenwürde“ Eine kritische Betrachtung jenseits von Pro und Kontra Heinz Schott N ur wenige haben in ihrem Beruf unmittelbar mit menschlichen Embryonen zu tun. Ontogenetisch gesehen bedeuten diese jedoch für alle gleichsam den dunklen Urgrund der individuellen Existenz, das „absolut Unbewusste“, wie der romantische Geburtshelfer, Naturforscher und Maler Carl Gustav Carus (1789 bis 1869) formulierte (2). Wir alle sind in unserem Leben selbst einmal Embryonen gewesen. Insofern handelt die Thematik auch von uns selbst – und nicht nur von Zygoten, Zellhaufen, Blastozyten. 122 Die experimentelle Forschung in der naturwissenschaftlich-biologischen Medizin folgt einer logischen Strategie. Im ersten Schritt werden bestimmte diagnostische oder therapeutische Methoden durch Tierversuche (Tiermodell) etabliert. Im zweiten Schritt folgt die Übertragung tierexperimentell gewonnener Fähigkeiten und Erkenntnisse auf den Menschen.Einem solchen Humanexperiment können im gesetzlich vorgegebenen Rahmen gesunde Versuchspersonen oder Kranke (Heilversuch) unterzogen werden. Bei positiven Forschungsergebnis- sen ist dann die klinisch-praktische Medizin um eine neue Methode oder ein neues Heilmittel bereichert,die in einem dritten Schritt in die klinische Praxis eingeführt werden. Die Bonner Neurowissenschaftler Otmar Wiestler und Oliver Brüstle wollten gerade den üblichen konsequenten Schritt vom Tier- zum Humanexperiment machen: nämlich von der nachweisbaren Rekonstruktion defekter Rattenhirne mit Stammzellen aus Mäuseembryonen zur eventuellen möglichen Rekonstruktion defekter menschlicher Ge- D O K U M E N T A T I O N hirne mit Stammzellen aus menschlichen Embryonen. Was für die Forscher einen wissenschaftlich innovativen und therapeutisch viel versprechenden Schritt bedeutet, wird jedoch in der breiten Öffentlichkeit von vielen als Skandal empfunden, was zu schwerem Geschütz in den Feuilletons, heftigen Debatten in den Medien, programmatischen Manifesten und Reden und vor allem zu einer Hochkonjunktur der professionellen Bioethik geführt hat. Diese hat sich zu einer Art „bioethics industry“ entwickelt. Nicht nur staatliche Großforschungsprojekte, sondern gerade auch die Privatunternehmen planen inzwischen von vornherein einen prozentualen Anteil der Investitionen für eine „begleitende“ Ethik ein. So ist der renommierte Moraltheologe Ronald M. Green Leiter der Ethikkommission der US-amerikanischen Firma Advanced Cell Technology (ACT), die durch ihre jüngste Klonierung eines menschlichen Embryos weltweit Aufsehen erregt hat. Green vertritt eine liberale Eugenik: „Was wollen die Leute mit ihrem privaten Geld machen? Das soll ihnen überlassen bleiben.“ Die Mitglieder seien, wie er sagt, von der Firma ACT unabhängig und arbeiteten quasi „ehrenamtlich“. Jedes Mitglied des Ethikrates habe aber von vornherein gewusst, was die Firma vorgehabt habe, nämlich das therapeutische Klonen. Insofern sei es um eine ethische „Begleitung“ gegangen: „Ich habe niemanden in den Beirat berufen, der die Nutzung von Embryonen oder die gesamte Forschungsrichtung grundsätzlich ablehnt. Das würde keinen Sinn machen.“(8) Patt-Situation Die menschlichen Embryonen sind nicht nur wegen der Stammzellforschung in den Mittelpunkt der gegenwärtigen Kontroverse gerückt, sondern auch wegen der Präimplantationsdiagnostik (PID). In beiden Fällen geht es letztlich um die Frage, ob menschliche Embryonen unter bestimmten Voraussetzungen getötet werden dürfen: Im ersteren Fall werden zur Gewinnung von Stammzellen Embryonen „verbraucht“, im letzteren Fall defiziente Embryonen nach genetischer Testung „verworfen“. Die Debatte hat inzwischen eine typi- sche Pro-und-Kontra-Struktur angenommen. > Pro-Argumentation: Die Befürworter sagen, es gehe bei der Forschung mit menschlichen embryonalen Stammzellen um hochrangige Ziele.Wer diese Forschung unterbinden wolle, mache sich schuldig. Er verhindere ungeahnte Chancen des medizinischen Fortschrittes und verstoße gegen den „therapeutischen Imperativ“ beziehungsweise die „Ethik des Heilens“ (3). So haben für den Rechtsphilosophen Reinhard Merkel die mit der Embryonenforschung „verfolgten Ziele der Hilfe für schwerkranke Menschen . . . ein so erhebliches Gewicht, dass sie die Verweigerung der Solidarität gegenüber frühesten Embryonen . . . rechtfertigen können“ (13). Demgegenüber tritt der Vorwurf, die Freiheit der Wissenschaft werde durch generelle Restriktionen der verbrauchenden Embryonenforschung verletzt, zunehmend in den Hintergrund. > Kontra-Argumentation: Die Gegner der Forschung an menschlichen Embryonen stützen sich auf eine „Ethik der Menschenwürde“: Wer menschliche Embryonen – direkt oder indirekt – tötet, verstoße gegen die Menschenwürde, die dem menschlichen Embryo mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle zukomme. Dies bedeute einen Dammbruch, das Überschreiten des Rubikon. Der Begriff „Menschenwürde“ wird von drei dogmatischen Säulen gestützt: der Gottebenbildlichkeit im Sinne der Bibel (Gen. 1, 27), Kants Rede vom PersonSein des Menschen als „Zweck an sich selbst“ (12) sowie dem einleitenden Satz des Grundgesetzes („Die Würde des Menschen ist unantastbar.“). „Ethik des Heilens“ versus „Ethik der Menschwürde“: Im Schachspiel nennt man eine solche Situation „Patt“. Zug um Zug wird das Ja der einen Seite durch das Nein der anderen gekontert, annulliert und vice versa. Angst und Schuld: die Macht von Metaphern Woher kommt die starke Emotionalität in dieser Kontroverse? Achten wir hier zunächst auf ihre Metaphorik. Die Gegner der verbrauchenden Embryonenforschung und der PID orientieren sich an der zentralen Metapher des Dammbruchs. Diese setzt Assoziationen zum Terminus „Tabubruch“ frei und impliziert das Schreckensbild einer Überschwemmung mit der Gefahr des Ertrinkens. Ähnliches meint auch die Rede vom Überschreiten des Rubikon, der schiefen Ebene (slippery slope), einer „Bahn ohne Halt“ (Johannes Rau). Dementsprechend prognostiziert der Bonner Zellbiologe Volker Herzog eine „Kaskade zur Klonierung des Menschen“: von der Freigabe vorhandener menschlicher embryonaler StammzellLinien, über die Verwendung überschüssiger Embryonen, Schaffung von Embryonen zu Forschungszwecken bis hin zum therapeutischen und schließlich reproduktiven Klonen (10). Die Vorstellung eines unaufhaltsamen Eroberungszugs (Stichwort: Rubikon) oder die eines automatischen Abrutschens in finstere Abgründe (Stichwort: schiefe Ebene) erzeugen Angst: Angst vor einer entfesselten Menschenzüchtung mit dem Verlust traditioneller Ideale unseres kulturellen Selbstverständnisses, die im Begriff der Menschenwürde verankert sind. Abgesehen davon, dass wohl auch manch ein Befürworter der verbrauchenden Embryonenforschung beziehungsweise der PID insgeheim Angst oder Unbehagen angesichts der neuen Zugriffsmöglichkeiten verspüren dürfte, kommt in der „Ethik des Heilens“ noch eine andere Angst zum Vorschein: nämlich schwer kranke Menschen ohne mögliche Hilfe ihrem Schicksal zu überlassen, „erbarmungslos“ oder „unbarmherzig“ an ihrer Not vorbeizugehen. Die Schuld des Menschen an seiner Krankheit, die Krankheit als Folge der Sünde ist auch in unserer gegenwärtigen Medizin ein wirksamer, verborgener Topos, denken wir nur an alltägliche Bemerkungen über die krank machenden Folgen des übermäßigen Fettverzehrs oder des Zigarettenrauchens. Doch nirgends war und ist die Schuldfrage so brisant wie bei der Eugenik. Dies lässt sich historisch an der Propagierung der Zwangssterilisation illustrieren: Das Missachten der erbbiologischen Naturgesetze, etwa durch die Weitergabe krankhafter Erbanlagen an die Nachkommen, wurde in NS-Propagandafilmen vor Millionenpublikum wortwört- 123 D O K U M E N T A T I O N lich als Schuld der Eltern, als Sünde wider die Natur gebrandmarkt. Dies lässt sich aber auch aktuell belegen: In Frankreich haben Gerichte entschieden, dass Kinder mit pränatal absehbaren (mehr oder weniger schweren) Behinderungen ein Recht auf Nichtexistenz haben, ihr Geborenwerden also unter Umständen schuldhaft (durch fehlerhafte Pränataldiagnostik) zustande kommt. Es gibt auch Metaphern der Angst, die den politökonomischen Bereich betreffen: etwa die Metapher vom Verpassen des Zuges, vom Zuspätkommen, von der Vertreibung von Wissenschaftlern und Forschungskapital ins Ausland. Hier meldet sich die Angst zu Wort, im neoliberalen Überlebenskampf zu kurz zu kommen und der Konkurrenz zu unterliegen, vom Ausland abhängig zu werden, den Standort Deutschland zu ruinieren et cetera. Im Schatten von Darwinismus und Biologismus Nach dem Philosophen Robert Spaemann setzt der Gedanke des Menschenrechts voraus, „dass jeder Mensch als geborenes Mitglied der Menschheit kraft eigenen Rechts den anderen gegenübertritt, und dies wiederum bedeutet, dass die biologische Zugehörigkeit zur Spezies homo sapiens allein es sein darf, die jene Minimalwürde begründet, welche wir Menschenwürde nennen“ (16). Die „Instruktion“ des Vatikans „Donum Vitae“ von 1987 formulierte unmissverständlich: „Die in vitro erzeugten menschlichen Embryonen sind als menschliche Geschöpfe und rechtsfähige Wesen zu betrachten: Ihre Würde und ihr Recht auf Leben sind vom ersten Augenblick des Lebens an zu achten.“ (4) Die „Ethik des Heilens“, auf die sich die biomedizinische Forschung beruft, relativiert diesen Status menschlicher Embryonen. Sie versucht,Vorstufen zur Menschwerdung zu definieren, etwa einen „Prä-Embryo“ (17), dem noch keine unantastbare Menschenwürde zuzubilligen sei – zum Beispiel solange noch keine Einnistung erfolgt oder solange noch die Zwillingsbildung möglich sei. Wolfgang Frühwald, Präsident der Alexander von Humboldt-Stiftung, hat 124 angesichts der gegensätzlichen Standpunkte einen „Kulturkampf“ – „christlich, zumindest kantianisches Menschenbild“ einerseits versus „szientistisch-sozialdarwinistisches Menschenbild“ anderseits – diagnostiziert (6, 7). Ohne Zweifel begegnen wir heute – im Verbund mit dem wirtschaftlichen Neoliberalismus – einem wieder belebten (sozial)darwinistischen Denken, das angesichts gentechnologischer Möglichkeiten die evolutionäre Leiter vom Affen zum Menschen nach oben für ausziehbar hält. Die Vision von der gentechnologischen Verbesserung des Menschen (enhancement) spukt in vielen Köpfen. So erklärte der Nobelpreisträger James D. Watson, „dass menschliches und anderes Leben nicht von Gott geschaffen wurde, sondern durch einen evolutionären Prozess entsteht, den Darwinschen Prinzipien der natürlichen Auslese folgt“ (18). Atmen wir heute wirklich noch oder wieder den Geist des darwinistischen Zeitalters (der ja seinerzeit unter anderem auch Nationalismus und Imperialismus beflügelte)? Natur und Geist: der vergessene Kontext Im gesamten Diskurs über den Status menschlicher Embryonen fehlt eine Auseinandersetzung mit dem Begriff der Natur und dem des Geistes. So vermisse ich als Medizinhistoriker vor allem die klassischen Fragen der Naturphilosophie – beispielsweise: Was bedeutet irdisches Leben im Kosmos? Wie verhalten sich organische und anorganische Natur zueinander? Wie ist das Verhältnis von Mensch und Welt (Mikrokosmos und Makrokosmos) beschaffen? Wie begegnen sich tierische und geistige Natur im Menschen? Ist schon der Begriff der Natur für die Biomedizin ein blinder Fleck, so gilt dies umso mehr für den Begriff des Geistes. Der Bonner Philosoph Wolfram Hogrebe hat dies polemisch auf die Formel gebracht: „Im Stile einer Renaissance des 19. Jahrhunderts propagiert man heute, nur um dem Geist ausweichen zu können, Life Sciences, Lebenswissenschaften. Sie sollen die Geisteswissenschaften unnötig machen. . . . Was braucht man Geist, wenn man die Gene hat, mit de- nen Geld zu machen ist? . . .Wenn wir jemanden fragen: ‚Wer bist du?‘, dann fragen wir nicht nach seinen Genen, sondern nach seiner geschichtlichen Identität, über die er zugleich immer auch hinaus ist.“ (11) Der Begriff des Geistes ist für den Diskurs der Biomedizin offensichtlich bedeutungslos. Die Leitbegriffe der Ethikdebatte, wie Menschenwürde, Lebensrecht, Heilen, Güterabwägung et cetera, können keine konstruktive gesellschaftskritische Kraft entfalten, da weder die historischen Quellen noch der globale Kontext ins Auge gefasst werden. Ein Kant-Zitat zur Würde der Person und der Verweis auf Artikel 1 des Grundgesetzes oder die Rede vom „therapeutischen Imperativ“ und dem „Kinderwunsch“ als Postulat der Autonomie bedeuten noch keine kritische Analyse unserer geistigen Situation, unseres Aufenthaltsortes in der Natur- und Menschheitsgeschichte. Erst wenn wir uns mit diesem Kontext der modernen Biomedizin auseinander setzen, können wir in historischer Perspektive durch „Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten“ (Freud) eine Gemeinschaft verändernde Orientierung für die Zukunft gewinnen. Können, dürfen wir uns schon jene Freiheit herausnehmen, welche die liberale Eugenik gegenwärtig bereits einfordert? Oder müsste sie nicht erst durch disziplinierte Bildungsarbeit an uns selbst errungen werden? Sexualität – Eros – Liebe 1978 wurde das erste Kind nach In-vitroFertilisation in England geboren. Vor dem „Retortenbaby“ Louise Brown wurden alle Babys der Welt durch Invivo-Fertilisation gezeugt. Diese Zeugung geschieht bekanntlich im Spannungsfeld von Sexualität und Liebe – und in schlimmen Fällen im Spannungsfeld von Sexualität und Gewalt. Embryonen werden heute – unabhängig von ihrer ethisch-rechtlichen Bewertung – als isolierte biologische Monaden dargestellt und imaginiert, abgelöst von ihren organischen Ursprungsorten im Körper der Frau und des Mannes, abgelöst vom Zeugungsakt, der sich in einen Herstellungsakt verwandelt hat. Solche biotechnischen Eingriffe würden die „intuitive Unterscheidung zwischen Gewachse- D O K U M E N T A T I O N nem und Gemachtem“ verwirren, beklagte kürzlich Jürgen Habermas (9). Die Begriffe Sexualität, Eros, Liebe haben im bioethischen Diskurs keine nennenswerte Bedeutung, sieht man einmal von der Position der katholischen Kirche ab, welche – gemäß der Enzyklika „Humanae vitae“ von Paul VI. – die „biologische Integrität des Geschlechtsaktes“, gewissermaßen also die „Würde des Sex“ (4), verteidigt. Dafür stoßen wir auf den Begriff des Kinderwunsches, der die Prozeduren der Reproduktionsmedizin unter dem Vorzeichen der Autonomie der Patienten beziehungsweise Klienten legitimiert. Doch inwiefern ist Sterilität überhaupt als Krankheit zu definieren? Und inwiefern ist der Kinderwunsch und seine reproduktionsmedizinische Realisierung tatsächlich als Rechtsanspruch „autonomer“ Personen auf ihre gesundheitliche Integrität zu begreifen? Der Traum vom Menschenmachen Wahrscheinlich ist in unserer angeblich säkularen, pluralen, liberalen Gesellschaft der Druck, Kinder zu bekommen, keineswegs geringer als etwa in traditionellen Kulturen oder Entwicklungsländern mit Großfamilien beziehungsweise unkontrolliertem Kinderreichtum. Dieser Druck tritt bei uns im Gegensatz zu früheren Zeiten und anderen Kulturkreisen nur zeitverschoben auf: Relativ junge Frauen sollen bis zum Erreichen einer bestimmten Stufe ihrer Berufsund Lebenskarriere keine Kinder bekommen, dann aber umso gesicherter. Der Druck, zunächst keine Kinder zu bekommen, verkehrt sich in den Druck, um jeden Preis noch Kinder zu bekommen. Was bedeutet da eigentlich der Kinderwunsch als Rechtsanspruch auf reproduktionsmedizinische Behandlung? Hybris bezeichnete ursprünglich den Hochmut, die Selbstüberhebung des Menschen gegenüber den Göttern und ist im Diskurs der „life sciences“ durchaus virulent. So meinte James D. Watson: In der Vergangenheit „konnten nur die Götter die Zukunft vorhersagen und unserem künftigen Schicksal eine gute oder schlechte Wendung geben. Heute liegt dies zum Teil in unseren ei- genen Händen.“ (17) Namhafte Fachleute wie Peter Propping (15) oder die Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard (14) sind gegenüber solchen Allmachtsfantasien skeptisch und mahnen zur Bescheidenheit. Doch die Hoffnung, einen Quantensprung der wissenschaftlichen Medizin vollziehen zu können, ist wohl für alle Beteiligten ein starkes Motiv. Ein kurzer Einblick in Kultur- und Wissenschaftsgeschichte zeigt, dass es offenbar einem uralten Menschheitstraum entspricht, die Rolle des Schöpfergottes zu übernehmen und selbst einen Menschen zu schaffen. In Mythen, Sagen und in der Literatur begegnen uns Golems, Homunculi und Roboter, von der jüdischen Kabbala bis hin zu romantischen Schauerromanen. Merkwürdigerweise liegt auf den überlieferten Visionen, künstlich einen Menschen zu schaffen, kein Segen. Zumeist werden nämlich durch gotteslästerliche, teuflische Akte Zerrbilder des Menschen geschaffen, die angst- und ekelerregend sind und der Menschheit sehr gefährlich werden können, wie zum Beispiel Mary Shellys Frankenstein-Roman zeigt. Verena Wetzstein, die diesen mythischen Stoffen des Menschenmachens nachgegangen ist, kommt zum Schluss: „Diese zumindest im Unterbewusstsein der Öffentlichkeit noch präsenten Mythen sind in der heutigen öffentlichen Diskussion über Stammzellenforschung mitzubedenken, will man die Hitze der Debatte verstehen. . . . Die Klonierung von Menschen erscheint als die Verwirklichung des Homunculus. Wer sollte da nicht an die zügellosen Geschöpfe und die Bestrafung des blasphemischen Schöpfertums denken, die uns Mythen und Sagen jahrtausendelang erzählt haben?“ (19) Freiheit eines „Nichtchristenmenschen“ (Markl) gleichermaßen gilt? Zumindest eine Hybris besteht darin, die Geschichte der Menschheit mit ihren Mythen und Sagen, die Geschichte der Wissenschaft mit ihren Aufbrüchen und Irrwegen, die Geschichte der eigenen Person mit ihren Träumen und Intuitionen zu ignorieren, das heißt, ihnen keine wissenschaftliche Bedeutung für das eigene WissenschaftTreiben zuzubilligen. Diese Hybris besteht aus einer historischen Selbstvergessenheit: nämlich der Idealisierung des Selbst-machen-Könnens, der Vorstellung einer eigenen Verfügungsgewalt über die Zukunft, gepaart mit der Abwehr des Gedankens einer unaufhebbaren Nicht-Autonomie des Menschen, seiner Abhängigkeit, Hilflosigkeit und Verletzbarkeit auf dieser selbst wiederum vergänglichen Erde, nur einer von „unendlich vielen Erden“, wie Giordano Bruno vor mehr als 400 Jahren spekulierte (1). Was jenseits von Pro und Kontra, jenseits von Kant- und Darwin-Zitaten, jenseits von tagespolitischen Aufgeregtheiten von allen gefordert wird, ist das Infragestellen von gewohnten Gewissheiten, das Heraushören leiser Zwischentöne aus dem menschheitsgeschichtlichen und transkulturellen „Hintergrundrauschen“, die kritische und vor allem wissenschaftskritische Auseinandersetzung mit den vorherrschenden Menschenund Weltbildern. Vor Hybris schützt nur kritische Selbstreflexion, die – salopp gesprochen – „Dekonstruktion“ und Demut zusammenbringt. Stark gekürzte und überarbeitete Fassung eines Vortrags zum Schwerpunkt „Bioethik“ beim Dies Academicus des Studium Universale der Universität Bonn am 5. Dezember 2001 ❚ Zitierweise dieses Beitrags: Dtsch Arztebl 2002; 99: A 172–175 [Heft 4] Hybris versus Selbstreflexion In unserem Selbstverständnis gehen wir davon aus, in einer so genannten säkularen und pluralistischen Gesellschaft zu leben, die zu religiöser Neutralität und den universalen Menschenrechten verpflichtet ist. Inwiefern kann man dann überhaupt noch im herkömmlichen Sinn von Hybris sprechen, wenn die Vorstellung von Gott oder den Göttern unverbindliche Privatmeinung ist, wenn die Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf das Literaturverzeichnis, das über den Sonderdruck beim Verfasser und über das Internet (www.aerzteblatt.de) erhältlich ist. Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. med. Dr. phil. Heinz Schott Medizinhistorisches Institut der Universität Bonn Sigmund-Freud-Straße 25 53105 Bonn 125 D O K U M E N T A T I O N Heft 5, 1. Februar 2002 Stammzellforschung Das Argument des Sokrates oder: Die Frage nach dem therapeutischen Gebrauch menschlicher embryonaler Stammzellen D as Denken des modernen Menschen ist geprägt von den Abläufen der Technik. In der Rationalität der Technik ist das Verhältnis von Mittel und Ziel für alle klar. Gut ist ein technisches Mittel, wenn es effizient ist. Gut ist eine Druckmaschine, wenn sie schnell und kostengünstig Papier bedruckt, und besser ist ihr Nachfolgemodell, wenn es diese Effizienz zu erhöhen vermag. Kein technisches Mittel hat einen Wert in sich, sondern es definiert sich allein über seine funktionale Brauchbarkeit. Die Allgegenwart technischer und wirtschaftlicher Rationalität der Gegenwart stellt eine Herausforderung für das philosophische Nachdenken über menschliches Handeln dar, das Ethik genannt wird. Auch menschliches Handeln kennt Ziele ebenso wie Mittel zum Ziel. Die Frage drängt sich auf: Ist es nicht auch in der Ethik so, dass mit der Festlegung eines Zieles die Auswahl der Mittel nur noch eine Frage der Zweckmäßigkeit darstellt? Wenn ein Ziel gut ist – kann es dann überhaupt noch ein anderes Kriterium für das Gutsein der Mittel geben als die Effizienz? Das umfassende Gut-Sein Um die Bedeutung der Thematik zu begreifen, empfiehlt es sich, einen Blick auf den berühmtesten Justizmord der Geschichte zu werfen, der im Jahr 399 v. Chr. stattfand. Sein prominentes Opfer: der griechische Philosoph Sokrates. Der tragische Urteilsspruch gegen ihn beruhte auf vielerlei Gründen, zu denen das allgemeine Klima weltanschaulicher Unsicherheit und eine gewisse Unbeholfenheit der attischen Gesetze gehörten. Orientierungslos war Athen nach der Niederlage im Peloponnesischen Krieg vor * Dr. med. Dr. theol. Alfred Sonnenfeld ist Lehrbeauftragter für Bioethik und Mitglied der Ethikkommission an der Charité, Humboldt-Universität, zu Berlin. 126 Alfred Sonnenfeld* Mittel zu solchem Zweck rechtfertigen soll. Man würde heute sagen: Kriton arallem dadurch geworden, dass seine öf- gumentiert „teleologisch“ oder „verantfentliche Moral zu einer gesellschaftli- wortungsethisch“. Auf einen anderen chen Konvention degeneriert war. Einen Standpunkt stellt sich Sokrates. Für ihn sichtbaren Beleg dafür bot die überragen- zählt nur die Frage, ob die Handlung de Stelle der Sophisten, die Rhetorik und selbst, die zur Debatte steht, also die Manipulation an die Stelle objektiver Flucht, als solche gerecht ist. Für ihn gilt Wahrheit gesetzt hatten. Durch sein kom- das unumstößliche Axiom: Man darf auf promissloses,ja herausforderndes Verhal- keine Weise Unrecht tun. Kein übergeten gegen deren These von der bloßen ordneter guter Zweck kann zur LegitiKonventionalität der Moral galt Sokrates mation eines Verhaltens dienen, das in als unerhörter Provokateur. Sokrates sich betrachtet schlecht und ungerecht wagte es, die scheinbar gesellschaftlich ist. Denn, so gibt der Philosoph seinem allgemein akzeptierte und gut legitimier- Freund Kriton zu bedenken: „Man soll te Polis-Sittlichkeit der Athener freimütig nicht einfach dem Leben den größten im Namen allgemeingültiger Wahrheiten Wert beimessen, sondern dem Rechtund Werte infrage zu stellen. Dies brachte Leben“1. Darum entscheidet sich Sokrates dafür, den Gesetihm den Tod ein. zen nicht zu entflieFrüh hat man erKein übergeordneter hen und lieber den kannt, dass der Tod des guter Zweck kann zu erleiden, als Sokrates mehr ist als zur Legitimation eines Tod ein Unrecht zu tun. einer der vielen bedauVerhaltens dienen, Sokrates ist zutiefst erlichen Justizirrtümer das in sich betrachtet davon überzeugt, dass der Geschichte. Er ist ein bis heute gültiges schlecht und ungerecht ist. es in einer Entscheidungssituation für den Paradigma für eine Grundentscheidung in der Beurteilung Handelnden allemal besser ist, „Unrecht sittlichen Handelns.Platon hat dies in sei- zu leiden, als Unrecht zu tun“. Nicht ein nem Dialog „Kriton“ zum Ausdruck zu Pragmatismus, der alles in Kauf nimmt, bringen versucht. Dieser Dialog zwi- um seine Ziele und Interessen durchzuschen dem gleichnamigen Freund des So- setzen, ist das höchste Gut für den Menkrates und dem Meister spielt in dessen schen, sondern das umfassendere GutGefängniszelle, morgens vor Sonnenauf- Sein der Seele. Die moralische Integrität gang, zwei Tage vor der Hinrichtung. Im einer menschlichen Handlung wird also letzten möglichen Augenblick sucht Kri- durch das Erleiden eines Unrechts nicht ton seinen Freund auf, um ihn zur Flucht beeinträchtigt, wohl aber durch jedes ins Ausland zu überreden; alles Notwen- Unrechttun – auch wenn es scheinbar nur dige dafür hat er schon in die Wege gelei- den Bereich der Mittel betrifft. Das Unrechttun ist nicht nur deshalb schlecht, tet. Doch Sokrates lehnt ab. In den unterschiedlichen Argumenta- wenn der Handelnde sich dadurch an eitionen des Kriton und des Sokrates an- ner anderen Person vergeht, sondern es gesichts des Problems „Fliehen oder ist abzulehnen, weil der Handelnde sich bleiben?“ begegnen uns zwei grundsätz- selbst, sofern er ein zur Sittlichkeit beliche, konträre Sichtweisen für die Beur- fähigtes Wesen ist, damit schädigt. Diese teilung menschlichen Verhaltens. Kriton Sittlichkeit orientiert sich an Handlungsargumentiert ganz vom übergeordneten (guten) Zweck her, der die Flucht als 1 Platon, Kriton, 47 d–48 b (Stuttgart 1998), S. 46. D O K U M E N T A T I O N normen, die absolut und allgemein gelten, ohne dass übergeordnete Zwecke diese Geltung relativieren könnten. Darum gibt es konkrete Handlungsforderungen und -verbote, die sich jeglicher Abwägung entziehen. Solche Verbotsnormen zeigen Grenzen menschlichen Handelns an, die nicht überschritten werden dürfen. Ebenfalls wie für Sokrates sind für Aristoteles2 absolute Handlungsverbote menschliche Handlungen, die immer gelten. Weil sie objektiv schlecht sind, das heißt: sie sind unter allen Umständen sittlich verdorben, deshalb sollen sie immer und für jeden Fall unterlassen werden. Das gilt auch dann, wenn solche Handlungen durch hinzukommende, gut gemeinte Absichten beeinflusst werden. Die moralische Identität der absoluten Handlungsverbote kann durch keine dazukommende Absicht oder Folgenabschätzung neu beschrieben oder neu definiert werden. Sie bleibt resistent gegenüber allen hinzukommenden, gut gemeinten Überlegungen. Tugend der Gerechtigkeit Absolute Handlungsverbote beziehen sich auf bestimmte Handlungsweisen, die einen konkreten ethischen Kontext ausdrücken, die, wenn sie dennoch begangen werden, einen schweren Verstoß gegen eine oder mehrere Tugenden implizieren3. Ein absolutes Handlungsverbot wählen bedeutet, sich gegen eine bestimmte Tugend zu entscheiden. So wird etwa durch die gezielte Tötung eines Embryos zu Forschungszwecken die Tugend der Gerechtigkeit empfindlich getroffen. Mit der Entfernung der inneren Zellmasse des Embryos im Blastozystenstadium wählt der Arzt den Tod eines Menschen. Dieser Handlungsvollzug fällt immer unter die Intention des Tötens und prägt den Willen des Arztes. Er ist in sich betrachtet ein Akt der Unge2 Aristoteles, Nikomachische Ethik, II, 61107 a 9–18. M: Die Perspektiven der Moral. Philosophische Grundlagen der Tugendethik (Berlin 2001), S. 303–321. 4 Vgl.: Sonnenfeld A: Selbstverwirklichung oder Selbstvernichtung. Gewissen und ethisches Handeln im ärztlichen Beruf, in: Dtsch Arztebl, 1990; 87: A 1507–1515 [Heft 19]. 5 Vgl.: Röm, 3,8, in abgewandelter Form: „Man darf nie etwas Schlechtes tun, um ein Gut zu erwirken.“ 3 Vgl.: Rhonheimer rechtigkeit, weil er die Entscheidung für den Tod eines unschuldigen Menschen impliziert. Die Tugend der Gerechtigkeit bedeutet ja vor allem, dass ich den anderen als mir Ebenbürtigen anerkenne. Die goldene Regel aber verbietet mir, dass ich dem Nächsten seine Existenz aberkenne: „Was du nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinem anderen zu.“ Dieses Lebensrecht jeder Person ist die Grenze aller Güterabwägungen. Die Folgen einer solchen Handlung führen an erster Stelle zu einer Verformung im Willen des Handelnden selbst. Sollte sich diese Handlung wiederholen, bliebe eine dauernde Verformung des Gewissens nicht aus4. Um diese Gefahr zu vermeiden, sollte eine bioethische Debatte stattfinden, die nicht fragt, wie sich die Menschen faktisch verhalten, sondern wie sie sich verhalten sollen. Medizinische Ethik zielt nicht darauf ab, ob eine Handlungsweise für richtig gehalten wird, sondern ob sie richtig ist, das heißt also, ob sie tatsächlich der menschlichen Würde dient. Das Argument des Sokrates bleibt aktuell. In der bioethischen Debatte geht es im Wesentlichen um dasselbe Problem wie damals: Es geht um die Frage nach der Absolutheit und Allgemeingültigkeit von Handlungsnormen angesichts von übergeordneten Zielsetzungen, die diese Normen scheinbar relativieren. Und ganz konkret geht es um die Frage, ob der Grundsatz, „dass man niemals die Tötung eines Unschuldigen als Mittel zu einem anderen Zweck anstreben oder wählen darf“5, zu diesen unantastbaren ethischen Grundsätzen zählt. Das Ziel medizinischer Ethik zu formulieren scheint einfach zu sein: Es handelt sich, so lautet ein überzeugender Vorschlag, um eine „Ethik des Heilens“. Die Formel klingt überzeugend. Niemand wird bezweifeln, dass etwa im Blick auf einen Parkinson-Kranken die Heilung genau dieses Leidens für den Arzt eine ethisch gute Tat ist. Nun aber muss auch über die konkrete Umsetzung des ethischen Leitsatzes nachgedacht werden. Damit steht man vor dem entscheidenden Schritt in der aktuellen Stammzelldiskussion. Beim Umgang mit Embryonen hat man es mit einer Handlung zu tun, die in sich selbst beurteilt werden muss, weil sie ein Objekt betrifft, das stets in sich, in sei- nem Eigenwert, und niemals bloß als Mittel fremder Zwecke zu betrachten ist. Denn mit der Vereinigung der beiden Vorkerne von Ei- und Samenzelle ist die genetische Identität des neu entstandenen menschlichen Lebens fixiert. Damit ist seine Zugehörigkeit zur menschlichen Spezies festgelegt. Seine Sonderstellung liegt im einzigartigen Chromosomensatz begründet, der das inhärierende Potenzial einer kontinuierlichen Entwicklung in sich vereint. Somit kommt dem Embryo in vollem Umfang Menschenwürde zu. Jede andere Position würde eine Instrumentalisierung der Menschenwürde bedeuten. Die Würde des Menschen Erst in der ganzheitlichen, Ziel und Mittel in ihrem untrennbaren Zusammenhang berücksichtigenden Betrachtung wird medizinische Ethik ihrem Anspruch gerecht, „Ethik des Heilens“ zu sein. Denn auch der Heilungswille darf den Arzt nicht dazu veranlassen, die ethische Betrachtung einer Handlung am Maßstab einer aspekthaften, am Paradigma der Technik ausgerichteten Zweckrationalität vorzunehmen. In der Technik kann das Mittel zur reinen Funktion erklärt werden, ohne dass man den Gesamtprozess falsch einschätzt. Menschliches Handeln dagegen ist nur dann gut, wenn das gute Ziel auch durch solche Mittel verwirklicht wird, die in sich der Würde des Menschen, den man behandelt, nicht widersprechen. Behandelt wird aber nicht nur der Patient, sondern auch der ungeborene Mensch, dessen Körpermaterial man benutzen will. Therapeutisches Handeln ist wie jedes Handeln nur dann „gut“ im umfassenden Sinne, wenn darin der Mensch in jedem Stadium seiner Existenz davor geschützt wird, zum bloßen Mittel erklärt und damit als Person negiert zu werden. Nur wenn der Arzt in diesem größeren Sinne „gut“ handeln will, tut er etwas, das ihn selbst erfüllen kann. ❚ Zitierweise dieses Beitrags: Dtsch Arztebl 2002; 99: A 271–272 [Heft 5]. Anschrift des Verfassers: Dr. med. Dr. theol. Alfred Sonnenfeld Universitätsklinikum Charité Ethik-Kommission des Virchow-Klinikums. Lehrgebäude Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin 127 D O K U M E N T A T I O N Heft 6, 8. Februar 2002 Stammzellenimport Unter Auflagen zugelassen Nach dem Beschluss des Bundestages dürfen bestehende embryonale Stammzelllinien importiert, jedoch keine weiteren Embryonen zu Forschungszwecken getötet werden. D er Bundestag hat entschieden: Der Import bereits existierender embryonaler Stammzelllinien nach Deutschland wird unter Auflagen erlaubt, die Tötung weiterer Embryonen soll jedoch durch eine Stichtagsregelung verhindert werden. Gegen 18.30 Uhr am 30. Januar verkündete Bundestagsvizepräsident Dr. h.c. Rudolf Seiters das Ergebnis. 340 von 618 Abgeordneten hatten sich nach einer viereinhalbstündigen Debatte in einem zweiten Wahlgang für den fraktionsübergreifenden Kompromissantrag von Dr. Maria Böhmer (CDU), Margot von Renesse (SPD) und Andrea Fischer (Bündnis 90/Die Grünen) entschieden. „Der gewundene Weg führt nicht selten zum Ausweg“, hatte Renesse zuvor in der sehr sachlich geführten Debatte gesagt. Ein Ausweg aus dieser schwierigen Gewissensfrage war der „Nein-aberAntrag“ wohl für alle diejenigen, die sich nicht zwischen den Werten Lebensschutz und Forschungsfreiheit entscheiden mochten. Seine Argumentation setzt auf Konsens, weniger auf Klarheit. So bekräftigt er einerseits die Zielsetzung des Embryonenschutzgesetzes: „Embryonen dürfen nur zum Zweck der Fortpflanzung erzeugt werden. Eine Tötung von Embryonen zu Forschungszwecken muss verboten bleiben.“ Andererseits ist eine Zeile später zu lesen, dass menschliche embryonale Stammzellen keine Embryonen seien, weil sie sich nicht zu einem vollständigen menschlichen Organismus entwickeln könnten. „Ein unmittelbarer Grundrechtsschutz kann für sie nicht in Anspruch genommen werden“, heißt es in dem Antrag. Dieser sei kein Kompromiss, sondern das Ergebnis einer Verständigung zwischen Befürwortern und Gegnern der Forschung an embryonalen Stammzellen, erklärte 128 Renesse den Abgeordneten, die an diesem Tag ohne Fraktionszwang entscheiden konnten. Für den Mittelweg warb neben Dr. Angela Merkel (CDU) auch Bundeskanzler Gerhard Schröder. Damit werde weder eine neue Rechtslage geschaffen, noch gehe Deutschland einen Sonderweg, sagte Schröder, der ausdrücklich nicht als Kanzler, sondern als SPDAbgeordneter sprach. Bei der Debatte ergriff kein Minister das Wort; weder Forschungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD), die seit Monaten für eine Liberalisierung der Forschung plädiert, noch Justizministerin Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin, die aus verfassungsrechtlicher Sicht die Forschung an embryonalen Stammzellen ablehnt. Die anderen beiden Anträge hatten sich für eine eindeutige Ja- beziehungsweise Nein-Regelung ausgesprochen. Beide klaren Positionen erhielten jedoch keine absolute Mehrheit. Der Antrag der Importgegner, den Dr.Wolfgang Wodarg (SPD), Dr. Hermann Kues (CDU) und Monika Knoche (Bündnis 90/Die Grünen) gestellt hatten, erhielt im ersten Abstimmungsgang 262 Stimmen, im zweiten 265. Er sprach sich sowohl gegen eine Tötung von Embryonen zu Forschungszwecken aus als auch gegen einen Import von Zelllinien. „Wenn wir die Tötung von Embryonen im Ausland billigen, wird sie auch später im Inland gebilligt“, argumentierte Kues. Klar sei schon jetzt, dass die Forscher mehr als nur den Import wollten. Auch Knoche forderte die Abgeordneten auf, sich „ehrlich zwischen Ja oder Nein zu entscheiden“. Mit der Erlaubnis des Imports würde erstmals eine Statusdefinition des Embryos vorgenommen. Für den Antrag der Befürworter der embryonalen Stammzellforschung, den hauptsächlich die FDP unter Ulrike Flach sowie Peter Hintze (CDU) und Dr. Wolfgang Schäuble (CDU) stellten, stimmten im ersten Wahlgang 106 Abgeordnete. Sie schlossen sich im zweiten Abstimmungsgang dem Kompromissantrag an. Auch Flach hatte zuvor für eine eindeutige Entscheidung geworben; der Kompromissantrag mogele sich um diese herum. Ihr Antrag plädierte sowohl für den Import als auch für die Änderung des Embryonenschutzgesetzes und die Herstellung von embryonalen Stammzelllinien in Deutschland – falls dies erforderlich sei. Darauf müssen die Forscher in Deutschland nun verzichten. Dennoch begrüßte die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) den Beschluss des Bundestages als „erkennbares Abwägen zwischen den Belangen der Forschungsfreiheit und den ethischen Bedenken“. Der DFG-Hauptausschuss genehmigte am 31. Januar den Antrag des Bonner Neurowissenschaftlers Prof. Dr. med. Oliver Brüstle. Er will humane embryonale Stammzelllinien aus Israel nach Deutschland importieren. Die DFGFördermittel in Höhe von 102 000 A erhält er für sein Projekt jedoch erst, wenn das erforderliche Gesetz zur Regelung des Imports in Kraft ist und die darin genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Brüstle sagte in Bonn, er hoffe, noch vor der Sommerpause mit den Arbeiten beginnen zu können. Dem Bundesforschungsministerium zufolge wird bereits mit Hochdruck an dem Gesetzentwurf gearbeitet. Er soll in der zweiten Februarhälfte in das Parlament eingebracht und bis Juni verabschiedet werden.Das neue Gesetz soll die Bedingungen für einen Import regeln. So soll eine von einer Ethikkommission beratene Kontrollbehörde geschaffen werden, die wahrscheinlich im Bereich des Bundesgesundheitsministeriums angesiedelt sein wird. Sie soll alle Kriterien überwachen und sicherstellen, dass die Embryonen nicht zu Forschungszwecken erzeugt wurden, die Eltern zugestimmt, jedoch keine finanzielle Entlohnung erhalten haben. Der vom Parlament angenommene Antrag sieht ferner vor, dass nach einem bestimmten Datum hergestellte Stammzelllinien nicht nach Deutschland importiert werden dürfen. Dabei wird der 30. Januar 2002 als der späteste Termin genannt. Die Antragstel- D O K U M E N T A T I O N Nachgefragt DÄ: Der Deutsche Bundestag hat entschieden, den Import von bestehenden humanen embryonalen Stammzelllinien zu erlauben, die Herstellung neuer Zelllinien in Deutschland jedoch zu verhindern. Sind Sie mit diesem Kompromiss zufrieden? Winnacker: Wir können mit diesem Kompromiss leben und gehen davon aus, dass unter den weltweit existierenden 72 Stammzelllinien hinreichend viele sind, die sich als für die Forschung geeignet erweisen. Ein Problem auf längere Sicht könnte allerdings die Frage der Kosten für die einzelnen Linien werden. DÄ: Halten Sie die Herstellung von neuen humanen embryonalen Stammzelllinien für erforderlich, um eine erfolgreiche Forschung auf diesem Gebiet zu gewährleisten? Winnacker: Der Deutsche Bundestag hat entschieden, dass Stammzellenimport nur von bereits existierenden Stammzelllinien möglich sein soll – daran werden wir uns halten. DÄ: Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass es der Stammzellforscherin Catherine Verfaillie gelungen ist, adulte multipotente Stamm- Prof. Dr. Ernst-Ludwig Winnacker, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft Foto: dpa zellen beim Menschen zu gewinnen, die ähnliche Eigenschaften wie embryonale Stammzellen besitzen. Wäre eine ethisch unbedenkliche Forschung an diesen Zellen nicht die bessere? Winnacker: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat in den letzten Jahren insgesamt 43 Millionen Euro in die Förderung der adulten Stammzellforschung investiert. Selbstverständlich geben wir dieser Forschung den Vorrang – daraus haben wir nie ein Hehl gemacht. Schon in unserer Stellungnahme vom Mai 2001 haben wir ausgeführt, dass wir davon ausgehen, dass nur für eine gewisse Zeit vergleichende Forschung mit em- bryonalen Stammzelllinien erforderlich ist, um dann längerfristig auf den Königsweg der adulten Stammzellen zu setzen. DÄ: Bis zum Mai vergangenen Jahres hatten Sie ausschließlich für eine Forschung an adulten Stammzellen plädiert. Wie kam es zu Ihrer Meinungsänderung? Winnacker: Es war kein plötzlicher Meinungsumschwung, auch wenn es vielleicht so gewirkt hat. Vielmehr hat sich die Wissenschaft auf diesem Gebiet so rasant fortentwickelt, dass wir dies nicht mehr übersehen konnten und auch nicht mehr verantworten konnten, deutsche Wissenschaftler von der Teilnahme an diesem Förderungszweig auszuschließen. DÄ: Haben Sie die Diskussion um die Stammzellforschung in den letzten Monaten als fair gegenüber der Forschung empfunden? Winnacker: Die Diskussion war hart und zielte manchmal auch unter die Gürtellinie – insgesamt aber bin ich froh um diese bundesweite Debatte, da sie dazu beigetragen hat, die Positionen zu klären und letztlich auch zu dem Ergebnis vom 30. Januar geführt hat. ler wollen dadurch verhindern, dass zum Zwecke des Imports weitere Embryonen getötet werden. Doch um diese Stichtagsregelung gibt es bereits Streit. Die Forschungsbefürworter in der FDP und der Union fordern inzwischen, den Termin nach hinten zu verschieben. Fischer und Böhmer schlagen stattdessen den 9. August 2001 vor. Dieser Stichtag gilt in den USA. Einen Tag vor der Entscheidung hatte Fischer auf dem Kongress der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Berlin erklärt, dass der von ihr unterstützte Kompromissantrag nicht zur Ausweitung der Forschung an embryonalen Stammzelllinien führe. Deren Verwendung sei eng begrenzt. „Wir werden das Fenster nur einen Spalt öffnen, um es danach wieder zu schließen“,bekräftigte die Grünen-Politikerin. Enttäuscht haben die Kirchen auf den Bundestagsbeschluss reagiert. „Durch diese Entscheidung sind Lebensrecht und uneingeschränkter Lebensschutz des Menschen vom Zeitpunkt der Befruchtung an nicht mehr gewährleistet“, kritisierten die Spitzen der katholischen und evangelischen Kirche in einer gemeinsamen Erklärung. Bereits im Vorfeld hatten die Bischofskonferenz und die EKD Forschungsmethoden, die eine „Vernichtung embryonaler Menschen“ beinhalten, als inakzeptabel bezeichnet. Sie plädieren für eine Forschung an adulten Dr. med. Eva A. Richter Stammzellen. Heft 5, 1. Februar 2002 Präimplantationsdiagnostik „Verfassungsrechtlich unzulässig“ Experten und Mitglieder der Bundestagsausschüsse diskutieren kontrovers. M it einem klaren Nein beantwortete jetzt ein prominenter Verfassungsrechtler die umstrittene Frage, ob die Präimplantationsdiagnostik (PID) zugelassen werden sollte. Prof. Dr. Ernst Benda, Präsident des Bundesverfassungsgerichts von 1971 bis 1983 und ehemaliger CDU-Innenminister (1968 bis 1969), hält die PID aus verfassungsrechtlicher Sicht für unzulässig. Sie bedeute, dass nach einer Invitro-Fertilisation alle Embryonen, die Anlass zu Bedenken geben, im Wege einer negativen Auswahl verworfen und vernichtet würden, erklärte er bei der Anhörung des Rechts- und Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages zum Gesetzentwurf der FDPFraktion am 23. Januar in Berlin. Dieser sieht vor, die PID rechtlich abzusichern, wenn sich Paare aufgrund der Veranlagung zu einer schwerwiegenden Erbkrankheit nach gründlicher Beratung durch ihren Arzt und einem positiven Votum einer Ethikkommission zu einem solchen Schritt entscheiden. Der Präsident der Bundesärztekammer, Prof. Dr. med. Jörg-Dietrich Hoppe, hält den FDP-Antrag und die Zulassung der PID ebenfalls für ethisch und rechtlich bedenklich.Diese Meinung habe sich 129 D O K U M E N T A T I O N mehrheitlich auch bei den Abgeordneten und Sachverständigen abgezeichnet, sagte er im Anschluss an die Anhörung. „Es müsste einen erheblichen Gesinnungswandel geben, wenn das Embryonenschutzgesetz geändert und die PID zugelassen werden sollten.“ Der Status des Embryos und seine Schutzwürdigkeit müssten jedoch noch grundlegend und präzise geklärt werden. Für Benda liegt die rechtliche Situation auf der Hand: „Die Frage, von welchem Zeitpunkt an menschliches Leben unter dem Schutz der Menschenwürde steht, ist verfassungsrechtlich dahin zu beantworten, dass dies vom Zeitpunkt der Befruchtung – in vivo oder in vitro – der Fall ist“, sagte er. Nach der Entscheidung des Ersten Senats von 1975 komme jedem menschlichen Leben Menschenwürde zu. Dabei sei es unwesentlich, ob sich der Träger dieser bewusst sei (BVerfGE 39, 1). „Abstufungen der Menschenwürde gibt es nicht“, erklärte Benda. „Die PID verbietet sich daher.“ Dieser Ansicht ist auch Prof. Dr. Wolfram Höfling, Staatsrechtler an der Universität Köln. Ein explizites Verbot der PID könnte verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden, meinte er; eine Klarstellung durch den Gesetzgeber müsste aber dennoch erfolgen. Als Argumente gegen die PID führte er das Embryonenschutzgesetz an. Darin werde nach § 2 Abs.1 bestraft, wer einen extrakorporal erzeugten Embryo zu einem nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck verwendet. Als Embryo gelte nach §8 Abs.12 auch jede einem Embryo entnommene totipotente Zelle. „Untersucht man die Stellungnahmen der Vertreter, die die PID und die Verwerfung eines geschädigten Embryos für strafbar halten, fragt man vergeblich nach einer haltbaren juristischen Begründung“, meint hingegen Prof. Dr. Monika Frommel, Direktorin des Instituts für Sanktionsrecht und Kriminologie der Universität Kiel. „De lege lata ist die PID unter engen Voraussetzungen in Deutschland erlaubt.“ Als Rechtfertigungsgründe nennt Frommel die spezielle medizinische Situation sowie einen allgemeinen Notstand. Dieser könne entstehen, da eine risikoreiche Implantation die körperliche und seelische Gesundheit der Patientin schädige. Der Arzt dürfe deshalb nach § 34 StGB eine Gü- Heft 7, 15. Februar 2002 Deutsche (Gesundheits-)Politik terabwägung treffen und die Gesundheit der Frau als das höhere Rechtsgut zulasten des Embryonenschutzes retten. Für ethisch vertretbar hält Dr. Viktoria Stein-Hobohm vom Justizministerium Rheinland-Pfalz die PID, wenn diese auf Hochrisikopaare begrenzt wird. Zu diesem Ergebnis kommt auch der Wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer. Er appelliert deshalb an den Gesetzgeber, die Rechtslage zu klären. „Sollte die PID erlaubt werden, ist die Indikation in jedem Einzelfall zu prüfen“, ergänzte Hoppe. Eine Festlegung auf bestimmte Diagnosen verbiete sich, um eine regelhafte Anwendung der PID in solchen Fällen zu vermeiden. Es soll lediglich der Zustand einer Erkrankung beschrieben werden. Gegen die Auflistung der Erkrankungen mit einer „Generalklausel“ wendet sich Benda. Dies widerspräche der vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Wesentlichkeitstheorie. Danach müssen wesentliche Entscheidungen vom Gesetzgeber selbst getroffen werden und dürfen nicht an andere Entscheidungsgegner (an die Eltern, den Arzt und die Ethikkommission) delegiert werden. Dr. med. Eva A. Richter Ein klares Jein E ine Sternstunde des deutschen Parlamentarismus sei die Debatte um die Embryonenforschung im Bundestag gewesen – so das Urteil zahlloser Kommentatoren. Ohne Polemik und Fraktionszwang, sachlich und ernst seien die Abgeordneten ihrem Auftrag nachgekommen. Eines wird dabei übersehen: Wieder hat die Politik nicht den Mut aufgebracht, zu einer klaren Entscheidung zu kommen, wieder einmal hat sie ein entschiedenes „Jein“ zustande gebracht. Die Meinungsverschiedenheiten über den genauen Wortlaut des nun fälligen Gesetzes zeigen einmal mehr, dass Politik hierzulande nicht mehr die Kunst des Machbaren bedeutet, sondern vielmehr die Kunst, jedes größere Problem ungelöst vor sich herzuschieben. Die Nicht-Entscheidung des Bundestages zur Embryonenforschung ist 130 nur ein Beispiel für die lähmende Unentschlossenheit der Politik. Wohin man blickt in der Gesundheitspolitik – überall herrscht Stillstand. Wem kann man noch plausibel vermitteln, dass es über eine schier endlose Zeit hinweg nicht möglich ist, die Medizinerausbildung zu reformieren? Wer – außer einer Hand voll Experten – ist noch in der Lage, innerhalb eines Krankenversicherungssystems, das dringend reformbedürftig ist, aber seit Jahrzehnten Opfer einer detailversessenen Regelungswut ist, den Überblick zu bewahren? Wie immer man zur Rezertifizierung der ärztlichen Approbation stehen mag – fast unerträglich ist die Vorstellung, dass dieses Thema in den nächsten zehn Jahren landauf, landab in diversen Ländergremien behandelt wird, ohne dass eine klare Entscheidung fällt. Das föderale System, für dessen Etablierung es einmal gute Gründe gab, dient inzwischen dazu, jeden Reformansatz, der den Abstimmungsprozess auf Bundesebene überstanden hat, aus politischem Kalkül oder Koalitionsräson zunichte zu machen. (Gesundheits-)Politiker müssen entscheiden, und sie müssen die Verantwortung dafür übernehmen. Politik kann nicht heißen, es jedem recht machen zu wollen und jedem größeren Problem elegant aus dem Weg zu gehen. Aber noch herrscht die Devise „im Großen kleckern, im Kleinen klotzen“ vor. Und so freuen wir uns auf die Gesetzesinitiative der Bundesregierung, mit der Jugendlichen unter 16 Jahren mithilfe einer Chipkarte die Benutzung von Zigarettenautomaten verwehrt werden soll. In welcher Welt leben die Thomas Gerst Politiker? D O K U M E N T A T I O N Heft 7, 15. Feburar 2002 Embryonenforschung Machtproben Forscher rütteln am Kompromiss des Bundestages. Die Meinungsbildung in der Ärzteschaft ist offen; zwischen Bundesärztekammer und deren Wissenschaftlichem Beirat bahnt sich eine Machtprobe an. K aum hatte der Bundestag am 30. Januar über den Import embryonaler Stammzellen abgestimmt, setzten auch schon Überlegungen ein, wie der gefundene Kompromiss zugunsten der Forschung ausgeweitet werden könnte. Angelpunkt ist die Stichtagsregelung. Der Bundestag hatte beschlossen, embryonale Stammzellen nicht zu importieren, abgesehen von Stammzelllinien, die zu einem Stichtag bereits existierten. Unter den Abgeordneten kursierte die Überlegung, als Stichtag den 30. Januar, zu nehmen, andere plädierten für den 7. August 2001, einen in den USA angesetzten Stichtag. Im August vergangenen Jahres sollen 72 Stammzelllinien existiert haben. Deren Zahl hat sich inzwischen wohl erhöht. Die deutschen Forscher, die den Embryonenimport befördern wollen, plädieren für einen weit hinaus geschobenen Stichtag. Man sucht nach möglichst „frischem Material“. Ein früher Stichtag schränkt zudem die Menge des Angebots ein. Der Import nach Deutschland könnte somit teuer werden. Dabei geht es nicht allein um Geld. Die Anbieter von Zelllinien könnten von deutschen Forschern auch verlangen, am Forschungsdesign und an den Ergebnissen beteiligt zu werden. Solche Befürchtungen standen schon im Raum, als Professor Dr. Oliver Brüstle sich nach Israel orientierte, nachdem er zuvor Kontakte in die USA gepflegt hatte. Solche Argumente werden bei der Formulierung des Gesetzentwurfes und bei den Beratungen in den Bundestagsausschüssen ihre Rolle spielen. Der Gesetzentwurf wird im Bundesforschungsministerium erarbeitet. Im Bundestag wird der Forschungsausschuss federführend sein. Beide gelten als Befür- worter „liberaler“ Lösungen. Eine Machtprobe zwischen jenen, die Embryonenimport strikt begrenzen wollen und jenen, die den Forschern entgegenkommen wollen, ist zu erwarten. Eine Machtprobe im Kleinen bahnt sich unterdessen innerhalb der Ärzteschaft an. Die Bundesärztekammer hat sich in Sachen Embryonenforschung noch nicht definitiv entschieden. Es gibt allerdings einen Beschluss des 104. Deutschen Ärztetages aus 2001, der den Import embryonaler Stammzellen als ethisch nicht akzeptabel kennzeichnet und der die Wissenschaft dazu auffordert, mit Versprechungen zurückhaltend zu sein. Der Vorstand der Bundesärztekammer wollte, so der letzte Stand der Überlegungen, die Abstimmung im Bundestag abwarten. Das Thema dürfte den kommenden Ärztetag, Ende Mai diesen Jahres, erneut beschäftigen. Im Vorfeld der Bundestagsentscheidung hatte der Präsident der Bundesärztekammer, Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe, in einem Pressegespräch Position gegen verbrauchende Embryonenforschung bezogen und vor Heilsversprechungen gewarnt. Gegen Hoppe machte der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer, Prof. Dr. Karl-Friedrich Sewing, Front. In einem (inzwischen auch öffentlich verbreiteten) Brief an Hoppe bekundete Sewing, er fühle sich verpflichtet, sich „schützend vor die zahlreichen Ärzte zu stellen, die als Wissenschaftler in Kliniken und Forschungslaboratorien mit Erfolg für die praktizierenden Ärzte die Instrumentarien erarbeiten, mit denen diese ihre Patienten zunehmend erfolgreicher behandeln können.“ Sewing verlangte von Hoppe zu verdeutlichen, dass seine, Hoppes, Verlautbarungen, „nicht die einhellige Meinung der Ärzteschaft darstellen und nicht dem Rat der dafür zuständigen Gremien entspringen“. Sewing ließ zudem auf eigene Faust (zusammen mit der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer) eine Presseerklärung ab, in der er namens des Wissenschaftlichen Beirats die Bundestagsentscheidung als richtig, ethisch ausgewogen und mutig bezeichnete. Es gibt freilich bisher keine förmliche Beschlussfassung des Wissenschaftlichen Beirats, auf die sich Sewing berufen könnte, geschweige denn eine Vorlage des Beirats an den Vorstand der Bundesärztekammer. Der aber wäre das zuständige Gremium, um die Auffassung der Ärzteschaft zu vertreten. Die Bundesärztekammer wird nach dem Eindruck von Beobachtern klarstellen müssen, inwieweit sie selbst die Positionen der Ärzteschaft zu embryonaler Stammzellforschung darlegt oder ob sie bereit ist, ihrem Beratungsgremium, dem Wissenschaftlichen Beirat, das Feld zu überlassen. Die Klärung erscheint umso vordringlicher, als die nächste Machtprobe sich bereits abzeichnet: Noch in diesem Monat will der Bundestag das heiße Thema Präimplantationsdiagnostik angehen. Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer hat sich auch dazu bereits Norbert Jachertz positioniert. 131 D O K U M E N T A T I O N Heft 9, 1. März 2002 Symposium in der Kaiserin-Friedrich-Stiftung Solidarität mit den „fortpflanzungswilligen Schichten“ Reproduktionsmediziner fordern die Zulassung der Präimplantationsdiagnostik. D esinteresse an der menschlichen Fortpflanzung warf Prof. Dr. med. Jürgen Hammerstein, Geschäftsführer der Kaiserin-Friedrich-Stiftung, Berlin, am 23. Februar der Politik vor: „In Deutschland herrscht eine fortpflanzungsbehindernde Gesetzgebung“, sagte der ehemalige Reproduktionsmediziner des Klinikums Steglitz der Freien Universität Berlin, zum Abschluss des 26. Symposiums für Juristen und Ärzte, das die Kaiserin-Friedrich-Stiftung in diesem Jahr zum Thema Reproduktionsmedizin organisierte. Die Befürworter „liberaler“ Lösungen waren dabei weitgehend unter sich. Hammerstein erklärte, die Solidarität der Entscheidungsträger mit den fortpflanzungswilligen Schichten des Volkes drohe verloren zu gehen. Das Grundgesetz zum Schutz von Ehe und Familie würde zunehmend ausgehöhlt. Der Gynäkologe verwies auf liberalere Gesetze zur Reproduktionsmedizin in anderen europäischen Ländern. So sei in Großbritannien, Schweden, Dänemark, den Niederlanden, Finnland, Belgien, Frankreich, Spanien, Italien und Griechenland die Präimplantationsdiagnostik (PID) erlaubt und werde dort erfolgreich praktiziert. Von einem Dammbruch könne in diesen christlichen Ländern nicht die Rede sein, betonte Prof. Dr. med. Hermann Hepp, Direktor der Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Klinikums Großhadern, München. Hepp ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer und war dort federführend mit der Erstellung des Diskussionsentwurfs zur PID befasst. Dieser befürwortet die PID in Grenzen (DÄ, Heft 9/2000). 132 Als zulässig erklärt die PID auch der Artikel 18 der Bioethikkonvention des Europarates vom April 1997, die aber zugleich restriktivere, nationale Regelungen befürwortet. Das deutsche Embryonenschutzgesetz, das seit dem 1. Januar 1991 in Kraft ist, steht der PID nach Ansicht der meisten Experten entgegen. Danach dürfen Embryonen nur zum Zwecke der Fortpflanzung erzeugt werden.Alle Embryonen (zwei bis drei) müssen der künftigen Mutter eingepflanzt werden. Eine Auswahl ist nur im Vorkernstadium gestattet. Erfolgsraten optimieren „Durch diese restriktiven Regelungen sind die Schwangerschaftsraten für kinderlose Paare nach In-vitro-Fertilisation (IVF) deutlich eingeschränkt“, bedauert Prof. Dr. med. Hans Van der Ven, Direktor der Abteilung für Gynäkologie, Endokrinologie und Reproduktionsmedizin am Universitätsklinikum Bonn. Diese lägen derzeit in Deutschland je nach Alter der Frau zwischen 15 und 25 Prozent. Dies sei zwar beachtlich, verglichen mit der natürlichen Befruchtung, bei der die Erfolgsrate auch nur etwa 28 Prozent betrage; die Baby-take-home-Raten nach IVF im Ausland würden jedoch bei etwa 50 Prozent liegen. Grund dafür sei die Möglichkeit, ein oder zwei Embryonen mit optimalen Eigenschaften auszuwählen. Ein weiterer Vorteil sei dabei die Reduktion der Mehrlingsschwangerschaften nach IVF. „Untersuchungen haben gezeigt, dass die PID zu einer zweifachen Implantationsrate und zu einer 2,5fachen Abnahme von Spontanaborten führt“, bekräf- tigte Prof. Dr. med. Gerhard Wolff, Direktor des Instituts für Humangenetik und Anthropologie der Universität Freiburg. Das Einpflanzen von Embryonen mit Chromosomenstörungen, die die Hauptursache für Fehlgeburten darstellen, könne deutlich minimiert werden, wenn die Embryonen vorher untersucht und gegebenenfalls verworfen werden. Angesichts der Gesetzeslage in Deutschland gelte es, die technischen Möglichkeiten im Vorkernstadium zu optimieren, meint Van der Ven. Dies wäre durch eine verbesserte Beurteilung der Vorkerne, den optimalen Zeitpunkt des Embryonentransfers sowie die Polkörperbiopsie möglich. Prof. Dr. med. Heribert Kentenich, Chefarzt der Gynäkologischen Abteilung der DRK-Frauenklinik Westend, Berlin, geht weiter: Er forderte auf dem Symposion eine Änderung des Embryonenschutzgesetzes, das die eingeschränkte Selektion von Embryonen und den Blastozystentransfer erlauben sollte. Die PID müsse gestattet werden, da die betroffenen Frauen ansonsten zu einer Schwangerschaft auf Probe gezwungen wären oder vom Arzt ins Ausland geschickt werden müssten. Ferner plädiert Kentenich dafür, die heterologe Insemination, die Eizellspende, die Behandlung lesbischer Paare und die Forschung an Embryonen zu gestatten. Eine internationale Regelung sei dringend erforderlich, meint Prof. Dr. jur. Eberhard Eichenhofer. „Nationale Zwischenschritte sind zwar unvermeidbar“, sagte der Inhaber des Lehrstuhls Sozialrecht und Bürgerliches Recht der Universität Jena, „aber liberalere Regelungen haben gegenüber konservativen den Vorrang.“ Die Gründe für den „deutschen Sonderweg“ sieht er in den Erfahrungen aus der Zeit des Nationalsozialismus. Doch: „Wir können einen rechtlichen Sonderweg nur einfordern, wenn wir die Güterabwägung mit anderen Argumenten treffen als die übrigen europäischen Länder – aber dies tun wir nicht“, sagte der Jurist. Es sei an der Zeit, von der „German disease“ Abschied zu nehmen und sich in den europäischen Kontext einzuordnen. Dies sei jedoch mit dem ärztlichen Berufsrecht kaum zu vereinbaren, argumentiert Prof. Dr. jur. Dr. h.c.Adolf Laufs vom Institut für Deutsches, Europäisches D O K U M E N T A T I O N Heft 12, 22. März 2002 und Internationales Medizinrecht, Gesundheitsrecht und Bioethik der Universitäten Heidelberg und Mannheim – er war der einzige Jurist, der einen kritischen Vortrag zum Thema PID hielt. Der Arzt müsse ungeborenes Leben erhalten; der Heilauftrag sei bei der PID zweifelhaft, sagte Laufs. Ihre Zulassung und die Änderung des Embryonenschutzgesetzes stehe zudem dem Verfassungsrecht entgegen.Völlig anderer Ansicht ist sein Mannheimer Kollege Prof. Dr. iur. Jochen Taupitz, Mitglied im Nationalen Ethikrat und in der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer. Für ihn ist der erste Artikel des Grundgesetzes („Die Menschenwürde ist unantastbar“) kein „Totschlagargument“. Die Menschenwürde sei nicht statisch konzipiert; Änderungen könnten sich ergeben. Zudem habe das Verfassungsrecht dem Embryo niemals Grundrechte zugesprochen, sondern nur den Schutz durch die Gesellschaft. Dieser käme jedoch auch dem menschlichen Leichnam, der Natur und den Tieren zu. Auch Margot von Renesse,Vorsitzende der Enquete-Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“ des Bundestages, hält einen liberaleren Umgang mit dem Artikel 1 des Grundgesetzes für angemessen. Sie sieht die Diskussion um die PID als eine Suche nach der Grenze des Strafrechts an.Menschen in Notsituationen müssten unter Umständen straffrei bleiben können – ähnlich wie bei der Abtreibungsregelung. Behandlungschancen und die Erweiterung des Wissens sollten nicht beschränkt werden. Dass die Beschränkungen innerhalb der Reproduktionsmedizin die menschliche Fortpflanzung stark beeinträchtigen, bezweifelt Prof. Dr. habil. Elmar Brähler von der Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik der Universität Leipzig. „Nach empirischen Untersuchungen sind zwar 30 Prozent aller Frauen zeitweilig ungewollt kinderlos, von einer dauerhaft ungewollten Kinderlosigkeit sind jedoch lediglich ein bis drei Prozent aller Frauen betroffen.“ Die Ergebnisse seiner Repräsentativerhebung von 1999 zeigen auch, dass die Hälfte aller Schwangerschaften ungeplant zustande kommen. Brählers Fazit: „Man sollte an spontaner Zeugung festhalten, da sonst die Geburtenzahl noch weiter zurückgeht.“ Dr. med. Eva A. Richter Stammzellgesetz Tauziehen um Definitionen Der Entwurf des Stammzellgesetzes weicht vom Beschluss des Deutschen Bundestages vom 30. Januar ab – zugunsten der Forschung. Er wird jetzt überarbeitet. D er Entwurf zum geplanten Stammzellgesetz hält nicht, was der Beschluss des Deutschen Bundestages vom 30. Januar versprach: „Keine verbrauchende Embryonenforschung“. Einige Regelungen im jetzigen Entwurf, den 115 Abgeordnete von SPD, CDU/CSU und Bündnis 90/Die Grünen erstellten, weichen die Auflagen wieder auf, die das Parlament an einen Import von humanen menschlichen Stammzelllinien knüpfte. Bei der mehr als sechsstündigen Anhörung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung im Bundestag am 11. März wies vor allem die Enquetekommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“ wiederholt auf die eigentliche Intention des Gesetzes hin – nämlich die Forschung an embryonalen Stammzelllinien sowie deren Import nur in Ausnahmefällen zuzulassen. An dem Gesetzentwurf kritisierten die Sachverständigen hauptsächlich, dass nunmehr embryonale Stammzellen statt embryonaler Stammzelllinien eingeführt werden sollen. Ferner bemängelten sie, dass nicht die Eltern der Stammzellgewinnung zustimmen müssen, sondern lediglich „nach dem Recht des Herkunftslandes dazu berechtigte natürliche Personen“.Auch dass sich die neu zu schaffende zentrale Ethikkommission der Zulassungsbehörde vorrangig aus Naturwissenschaftlern zusammensetzen soll, lehnen die Sachverständigen ab. Damit treten Probleme zutage, die mit der Gratwanderung des Bundestages, der sich weder für ein klares Ja noch für ein klares Nein entscheiden konnte, schon programmiert waren. Der Gesetzestext soll nun bis zum 26.April überarbeitet werden. Die zweite und dritte Lesung im Bundestag ist für den 26. April vorgesehen. Tatsächlich kommt der Formulierung des Stammzellgesetzes große Bedeutung zu. Erst mit ihm werden die Weichen gestellt, wie die Forschung an embryonalen Stammzellen in Deutschland gehandhabt werden soll. Federführend für die Erarbeitung des Stammzellgesetzes ist das Forschungsministerium. Von ihm werden der Gesundheits-, der Rechts- und der Familienausschuss sowie die Enquetekommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“ zur Beratung herangezogen. „Der Import humaner embryonaler Stammzellen wird auf bestehende Stammzelllinien, die zu einem bestimmten Stichtag etabliert wurden, beschränkt“, heißt es in dem von den Bundestagsabgeordneten beschlossenen Antrag. Jetzt ist jedoch nur noch von Stammzellen die Rede. Die Begriffe „Stammzelllinien“ und „Stammzellen“ würden in der amerikanischen Literatur synonym gebraucht, verteidigte Prof.Dr.Bärbel Friedrich,Institut für Biologie der Humboldt-Universität Berlin und Präsidiumsmitglied der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die jetzige Formulierung. Prof. Dr. Peter Gruss, MaxPlanck-Institut für Biophysikalische Chemie, Göttingen, und designierter Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, gab zu bedenken, dass die Mehrzahl der in den USA registrierten Stammzelllinien uncharaktisiert sei und damit der biologischen Definition von „Linien“ nicht entspreche. Die Formulierung „Stammzellen“ müsse unbedingt ins Gesetz, wolle man die Forschung nicht behindern. Gegner der Forschung an menschlichen Embryonen sehen hinter der geänderten Formulierung jedoch die Gefahr der Ausweitung und des Missbrauchs. Das „Herstellungsdatum“ sei nicht mehr nachweisbar, wenn Stammzellen importiert werden könnten, aus denen erst später Stammzelllinien gezüchtet 133 D O K U M E N T A T I O N würden, befürchtet Dr. Ingrid Schneider, Institut für Politikwissenschaft der Universität Hamburg. Zudem sollte nach ihrer Ansicht im Gesetz verankert werden, dass nur kryokonservierte Embryonen zur Herstellung von Stammzelllinien verwendet werden dürfen. Ansonsten sei nicht gewährleistet, dass diese tatsächlich „überzählig“ seien. Ein Streitpunkt war bei der Anhörung erneut die Stichtagsregelung – obwohl sich die Abgeordneten bereits Ende Februar auf den 1. Januar 2002 als Stichtag geeinigt hatten. Damit waren sie der Vorgabe des Bundestagsbeschlusses nachgekommen, nur den Import von Stammzelllinien zu erlauben, die vor einem bestimmten Stichtag hergestellt wurden. Die Forschungspolitiker um Peter Hintze, Katharina Reiche (beide CDU) und Ulrike Flach (FDP) fordern jedoch eine liberalere Genehmigungspraxis und einen flexiblen Stichtag. Dabei soll jeweils zwischen dem Antrag der Forscher auf Import und der Herstellung der Stammzellen ein bestimmter Zeitpunkt liegen, beispielsweise sechs Monate, wie Flach meint. Behielte man die vorgesehene Stichtagsregelung bei, wür- de dies bedeuten, dass sich die Forscher auf wenige Stammzelllinien beschränken müssten. Die Naturwissenschaftler unterstützen diesen Vorschlag. Für die Grundlagenforschung reichten die Stammzelllinien, die den deutschen Forschern durch die bisherige Stichtagsregelung zur Verfügung stünden, zwar aus, die Entwicklung von Therapien wäre jedoch nicht möglich, erklärte Friedrich. Als Gründe führte die Biologin einerseits die geringe Anzahl der Stammzelllinien an, andererseits aber deren Kontaminierung mit tierischen Zellen und Viren. In der Tat basieren die meisten der etwa 80 weltweit existierenden und in den USA registrierten Stammzelllinien auf Mausnährzellen und können „verseucht“ und somit für die Anwendung am Menschen ungeeignet sein. Prof. Dr. Dr. h. c. Rüdiger Wolfrum, Max-Planck-Institut für ausländisches Recht und Völkerrecht, Heidelberg, hat rechtliche Bedenken bezüglich der Stichtagsregelung. Der § 5 des neuen Stammzellgesetzes spreche nicht nur von Grundlagenforschung,sondern nenne als Ziel auch die Entwicklung diagnostischer, präventiver und therapeutischer Verfahren zur Anwendung beim Menschen. Dies müsse bei der Stichtagsregelung bedacht werden, wenn das Gesetz Heft 16, 19. April 2002 Kirchen Feilschen um den Stichtag einige Jahre gültig sein solle. Ein weiteres Problem sei die rechtliche Verfügbarkeit der Stammzelllinien. Denn auf die amerikanischen Zelllinien sind meist Patente angemeldet. Jede Forschung bedarf der Genehmigung der Verwertungsfirmen. Die Firma Gerold besitze sogar die Lizenz auf die Herstellung der Stammzelllinien, argumentiert Schneider. „Alle Forscher müssen somit dieses Patent beachten. Nicht der Stichtag schreibt das Monopol der Stammzellanbieter vor, sondern das internationale Patentrecht.“ Die Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche sind enttäuscht über die Ausgestaltung des Gesetzes. Besonders beklagen sie die „ungleichmäßige“ Zusammensetzung der zentralen Ethikkommission der Zulassungsbehörde, die die Erfüllung der Auflagen überprüfen und entscheiden soll, ob die Forschungsprojekte ethisch vertretbar sind. Die Kommission soll sich aus fünf Naturwissenschaftlern und Medizinern, aber nur aus vier Ethikern und Theologen zusammensetzen. Juristen warnten vor zu einschneidenden Regelungen im Gesetz. Es laufe dadurch Gefahr, verfassungswidrig zu sein. Die Hürden, die es setze, müssten bewältigbar bleiben. Die „Haltbarkeitsdauer“ des Gesetzes ist ihrer Meinung nach sowieso bereits Dr. med. Eva A. Richter eng begrenzt. Absage an PID D ie Vertreter der beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland sind sich einig: In einer Stellungnahme anlässlich der „Woche für das Leben“ betonen Präses Manfred Kock und Kardinal Karl Lehmann, dass für die Kirchen „die Erkenntnis maßgeblich ist, dass menschliches Leben mit der Befruchtung von Ei- und Samenzelle beginnt. Der Mensch entwickelt sich von diesem Zeitpunkt an nicht mehr zum Menschen, sondern als Mensch.“ Folglich lehnen sie auch die „Vernutzung menschlicher Embryonen, wie sie bei der embryonalen Stammzellforschung geschieht, aus christlicher Sicht entschieden ab, selbst wenn sie zugunsten der Heilung anderer Menschen angestrebt wird.“ Denn die Gewinnung 134 menschlicher embryonaler Stammzellen ist, wie die Kirchen betonen, nur durch die Vernichtung von Embryonen möglich. Die Präimplantationsdiagnostik (PID) stößt ebenfalls auf scharfe Kritik. Im Gegensatz zur Pränataldiagnostik diene die Präimplantationsdiagnostik keinerlei therapeutischen Zwecken, sondern sei allein auf die Selektion von menschlichem Leben ausgerichtet. Einen Anspruch auf ein Kind, gar auf ein gesundes Kind, gebe es nicht. Die Kirchen wollen es jedoch nicht bei dieser Stellungnahme belassen, sie wollen auch auf die Politik einwirken. Sie bedauern den Beschluss des Bundestages zum Import embryonaler Stammzelllinien und hoffen, dass die strikte Begrenzung des Imports embryonaler Stamm- zellen im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens nicht aufgeweicht werde. Der Beschluss des Bundestages müsse so umgesetzt werden, „dass das grundsätzliche Nein zum Import und der Koppelung der ausnahmsweisen Zulassung an enge Voraussetzungen auch deutlich wird“, so Kock. In Bezug auf die PID begrüßen die Kirchen das „Votum der Enquete-Kommission und hoffen, dass der Bundestag diesem Votum folgen wird“. Ob die Kirchen tatsächlich Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen werden, bleibt abzuwarten. Die ökumenische „Woche für das Leben“, auf der sie gemeinsam ihre Standpunkte vertreten, ist jedenfalls ein Beitrag zur Debatte über medizinethische Themen, der nicht überGisela Klinkhammer hört werden sollte. D O K U M E N T A T I O N Heft 17, 26. April 2002 Stammzellgesetz Klarheit oder Kompromiss D em Stammzellgesetz, das den Import menschlicher embryonaler Stammzellen nach Deutschland regeln soll, scheint das Schicksal so mancher Kompromisse zu drohen. Es wird von mehreren Seiten gleichzeitig angegriffen und könnte bei der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs an diesem Freitag im Bundestag zerrissen werden. Die Vorsitzende des Forschungsausschusses, Ulrike Flach (FDP), will die Stichtagsregelung aufweichen und für jedes Forschungsprojekt einen eigenen Stichtag durchsetzen. Die Grünen-Abgeordnete Monika Knoche will sich dagegen gemeinsam mit Wolfgang Wodarg (SPD) und Hubert Hüppe (CDU) für ein eindeutiges Importverbot einsetzen. Damit wäre die Ausgangssituation der Bun- destagsdebatte zum Stammzellimport vom 30. Januar wieder hergestellt: „Ja“ kontra „Nein“ kontra „Konsens“. Bei den mitberatenden Ausschüssen bestehen bis jetzt große Differenzen über die Ausgestaltung des Gesetzes.Während der federführende Bundestagsausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung einem geänderten Entwurf des Stammzellgesetzes mit großer Mehrheit zustimmte, lehnte der Rechtsausschuss diesen grundsätzlich ab. Sachverständige hatten bei einer Anhörung im März (DÄ, Heft 22/2002) bereits den Gesetzentwurf von Dr. Maria Böhmer (CDU), Wolf-Michael Catenhusen (SPD) und Andrea Fischer (Bündnis 90/Die Grünen) kritisiert. Diese versuchen jetzt wieder einen Spagat und haben den Entwurf geändert. Danach sollen Stammzellen statt Stammzelllinien importiert werden. Der Begriff wird allerdings konkretisiert. Als Stichtag für die Erzeugung der Stammzellen soll weiterhin der 1. Januar 2002 gelten. Die Gewinnung soll sich nach den Rechtsvorschriften des Herkunftslandes richten, aber auch den Grundsätzen der deutschen Rechtsordnung folgen. Die Abstimmung im Bundestag wird vermutlich namentlich und ohne Fraktionszwang erfolgen (über den aktuellen Stand informiert der tägliche Nachrichtendienst des DÄ im Internet unter www.aerzteblatt.de).Vielleicht setzt man ja diesmal auf Klarheit statt auf einen verwaschenen Konsens. Dr. med. Eva A. Richter Heft 18, 3. Mai 2002 Entscheidung zum Stammzellgesetz Die Tür steht einen Spalt offen Die Mehrheit des Bundestages plädierte dafür, den Import von menschlichen embryonalen Stammzellen unter Auflagen zu erlauben. S elig sind die, die Frieden stiften“, zitierte Margot von Renesse aus der Bergpredigt und meinte damit diejenigen, die zwei Stunden später nochmals für den Kompromiss zum Import von menschlichen embryonalen Stammzellen stimmen würden. Dies taten am Abend des 25. April zwei Drittel der 563 anwesenden Bundestagsabgeordneten. Sie verabschiedeten in zweiter und dritter Lesung den Gesetzentwurf von Dr. Maria Böhmer (CDU), Wolf-Michael Catenhusen (SPD), Andrea Fischer (Bündnis 90/Die Grünen) und Margot von Renesse (SPD), der den Beschluss des Bundestages vom 30. Januar in geltendes Recht umsetzen soll. Erlaubt ist nun der Import von embryonalen Stammzellen, die vor dem 1. Januar 2002 im Ausland hergestellt wurden, sofern das Gesetz im Mai (wie allgemein erwartet wird) den Bundesrat passiert. Die Diskussion in der vergangenen Woche war die etwas kleinere Neuauflage der Bundestagsdebatte vom 30. Januar. Allein ihrem Gewissen verpflichtet, stimmten die Abgeordneten wieder namentlich und ohne Fraktionszwang über drei Varianten ab: über ein „Nein“ oder ein „Ja“ zur Stammzellforschung sowie über die Kompromisslösung. Für diese plädierten 360 Abgeordnete; für das „Nein“ 190. Der forschungsfreundliche Antrag der FDP, in dem Ulrike Flach einen flexiblen Stichtag forderte, fiel bereits vorher ohne namentliche Abstimmung durch. Die Neuauflage der Debatte zeigt, dass der im Januar erzielte Kompromiss nur eine Notlösung war. Ein Konsens, der offensichtlich vie- len Bauchschmerzen bereitete. Der Gesetzentwurf konnte keine Brücken zwischen Importgegnern und Befürwortern bauen. Im Gegenteil: Er verschärfte die Situation. „Ein bioethischer Eiertanz – der Bundestag wird hinters Licht geführt“, kritisierte Wolfgang Wodarg (SPD) den Entwurf. Dieser hielte nicht, was der Beschluss vom Januar versprochen hätte, nämlich lediglich eine Genehmigung des Importes von Stammzellen aus etablierten embryonalen Stammzelllinien. „Stattdessen erlaubt das Gesetz den Import von kultivierten und kryokonservierten Stammzellen, die dann in Deutschland vermehrt werden können“, sagte Wodarg. Der SPD-Abgeordnete plädierte deshalb dafür, nur den Import von Stammzellen aus etablierten Zellli- 135 D O K U M E N T A T I O N Das Gesetz im Überblick Das vom Bundestag verabschiedete Stammzellgesetz verbietet grundsätzlich die Gewinnung von menschlichen embryonalen Stammzellen (ESZ) in Deutschland. Ein Import der Zellen und die Forschung daran ist nur unter folgenden Bedingungen erlaubt: > Es dürfen nur ESZ eingeführt werden, die am 1. Januar 2002 bereits vorhanden waren und die in Übereinstimmung mit der Rechtslage im Herkunftsland gewonnen wurden. > Es müssen hochrangige Forschungsziele verfolgt werden, die mit anderen Zellen nicht zu erreichen sind. > Die ESZ müssen aus „überzähligen Embryonen“ stammen, die definitiv nicht mehr zur Erzeugung einer Schwangerschaft verwendet werden. > Den Spendern darf kein Entgelt gezahlt werden. > Jeder Import und jede Verwendung von ESZ bedarf der Genehmigung der zuständigen Behörde (Robert Koch-Institut oder Paul-Ehrlich-Institut). > Eine zentrale Ethikkommission, der neun Sachverständige aus Biologie, Medizin, Ethik und Theologie angehören, muss die Projekte begutachten. > Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnisoder Geldstrafen geahndet. > Anstiftung oder Beihilfe zu einer nach deutschem Recht strafbaren Verwendung von ESZ im Ausland werden gleichfalls bestraft. nien zu gestatten, die „stabilisiert, vermehrbar und hinreichend charakterisiert sind“. Sein Antrag wurde abgelehnt. „Die ethische Wanderdüne hat sich bereits in Bewegung gesetzt“, kommentierte Hubert Hüppe (CDU). Gemeinsam mit Monika Knoche (Bündnis 90/Die Grünen) forderten Hüppe und Wodarg ein generelles Importverbot. Dagegen sprächen keinerlei rechtliche Gründe, verteidigten sie ihren Antrag. „Der Mittelweg ist kein Ausweg“, sagte Knoche. Nicht grundsätzliche philosophische und ethische Argumentationen seien jetzt wichtig, sondern der harte Gesetzestext. „Darin darf keine Doppelmoral stecken.“ Das für den Gesetzentwurf verantwortliche Quartett Böhmer, Fischer, Catenhusen und von Renesse verteidigte diesen. „Für die deutsche Forschung hat kein Embryo das Leben zu lassen.Wir haben den Auftrag des Parlaments loyal erfüllt“, sagte die Juristin Margot von Renesse. Bereits bei einer Anhörung des federführenden Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung im Bundestag am 11. März war Kritik am 136 Entwurf laut geworden. Bemängelt hatten Sachverständige, dass lediglich „nach dem Recht des Herkunftslandes dazu berechtigte natürliche Personen“ der Stammzellgewinnung zustimmen müssen; sich die zentrale Ethikkommission hauptsächlich aus Naturwissenschaftlern zusammensetzen soll und deutsche Forscher im Ausland straffrei mit jenen menschlichen embryonalen Stammzellen forschen können, die nicht nach deutschen Bedingungen gewonnen wurden. „Darauf haben wir reagiert“, sagte von Renesse. Der Zustimmungspassus wurde gestrichen. Für die Gewinnung von Stammzellen dürfen jetzt nur Embryonen verwendet worden sein, die zum Zwecke einer Schwangerschaft extrakorporal erzeugt, aber endgültig nicht mehr dafür verwendet werden. Gendefekte dürfen nicht festgestellt worden sein. Der Begriff „embryonale Stammzelle“ wird zudem genau definiert. Einen Tag vor der abschließenden Beratung legten Böhmer, Fischer und von Renesse einen weiteren Änderungsantrag vor (Catenhusen klinkte sich aus). Dieser beharrt auf den Vorschriften des Strafgesetzbuches. Das Parlament nahm den Antrag an. Damit bleibt ein deutscher Forscher strafbar, wenn er im Ausland Forscher anstiftet oder Beihilfe leistet, embryonale Stammzellen zu gewinnen oder in anderer Weise zu verwenden, als es das deutsche Gesetz vorschreibt. Besonders schwer tat sich nach eigenen Angaben Andrea Fischer mit der Arbeit am Gesetzentwurf. „Ich habe mich immer wieder gefragt, ob ich meine eigene Position verrate“, sagte sie. „Denn bei Leben und Tod kann es keinen Kompromiss geben. Unser Entwurf ist jedoch keiner.“ Das Embryonenschutzgesetz werde auf Dauer festgeschrieben. „Wir beziehen uns nur auf die unabänderliche Vergangenheit.“ Diese Ausnahme müsse man machen, um sich den Widersprüchen zu stellen, erklärte Fischer. Viele Menschen würden große Hoffnung in die Stammzellforschung setzen. „Die Forschung hat uns Brücken gebaut, wir sollten das jetzt auch tun.“ Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hatte die Bundestagsdebatte im Januar abgewartet, bevor sie ihrerseits entschied, Forschungsprojekte an menschlichen embryonalen Stammzellen zu fördern. Der DFG-Präsident, Prof. Dr. med. Ernst-Ludwig Winnacker, zeigte sich jetzt erleichtert über die Verabschiedung des Stammzellgesetzes. Zufrieden ist er mit dem Stichtag allerdings nicht. „Wir können mit dieser Regelung leben“, äußerte sich Winnacker vorsichtig. Kritik übte er an der ins Gesetz aufgenommenen Strafbewehrung. Diese müsse überdacht werden, falls deutsche Wissenschaftler im internationalen Kontext handlungsunfähig würden. „Kleinstes Übel“ oder „Besser den Spatz in der Hand“ – die Beweggründe der Abgeordneten, die für den Gesetzentwurf stimmten, waren unterschiedlich. Wie lange das verabschiedete Stammzellgesetz Bestand haben wird, ist fraglich. „Ich sehe das gelassen“, sagt Ulrike Flach (FDP), die mit ihrem Antrag auf einen flexiblen Stichtag scheiterte. „Wenn sich Forschungserfolge zeigen, wird das Gesetz sowieso geänDr. med. Eva A. Richter dert.“ DÄ: Beiträge zu Embryonenforschung Seit der Veröffentlichung des „Diskussionsentwurfs zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik“ (DÄ, Heft 17/2000) läuft der Diskurs nicht nur über die Präimplantationsdiagnostik (PID), sondern auch über Embryonenforschung. Das Deutsche Ärzteblatt hat sich intensiv an dieser Diskussion beteiligt und die unterschiedlichsten Stimmen zu Wort kommen lassen. Eine Zusammenstellung der Beiträge kann über das Internet unter www.aerzteblatt.de abgerufen werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass sich die veröffentlichten Beiträge keineswegs in jedem Fall mit der Meinung der Redaktion decken. Die Diskussion wird fortgeführt. DÄ Ergänzende Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer zum Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik Die Bundesärztekammer hat im März 2000 der Öffentlichkeit einen Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik (PID1) vorgestellt. Dieser Entwurf ist kontrovers diskutiert worden. Der Wissenschaftliche Beirat2 hat anhand der Einwendungen den Entwurf überprüft. Er hält an seiner Position fest, wonach die PID im Einzelfall bei Verdacht auf die Entstehung einer schwer wiegenden genetischen Erkrankung in engen Grenzen und unter Einhaltung strikter Verfahrensregeln aus medizinischen, ethischen und rechtlichen Gesichtspunkten vertretbar ist. Die kontroverse öffentliche Diskussion hat gezeigt, dass eine rechtliche Klärung der Zulässigkeit der PID durch den Gesetzgeber notwendig ist. Eine Richtlinie der Bundesärztekammer reicht deshalb nicht aus, weil in der Diskussion unterschiedliche Positionen zu grundrechtlichen Fragestellungen und zur Frage, ob die PID nach dem geltenden Embryonenschutzgesetz (ESchG) zulässig ist, hervorgetreten sind. Embryonenschutzgesetz (ESchG) Nach unserer Interpretation des ESchG ist die PID nicht verboten. Es ist die Ansicht vertreten worden, die PID verstoße gegen § 1 Abs. 1 Nr. 2 ESchG. Bei der PID werde eine Eizelle zu einem anderen Zweck befruchtet, als die Schwangerschaft bei der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt. Die Befruchtung erfolge nicht, um direkt eine Schwangerschaft zu veranlassen, sondern um eine Selektionsmöglichkeit zu eröffnen, den Embryo zu prüfen und erst danach zu entscheiden, ob eine Schwangerschaft herbeigeführt werden solle. Zweifelsfrei ist das Ziel der extrakorporalen Befruchtung die Herbeiführung einer Schwangerschaft. Das kann, wenn eine PID vorgesehen ist, nicht deshalb verneint werden, weil ein Teilakt (der Transfer) noch von weiteren Voraussetzungen, nämlich der Zustimmung der Frau zum Transfer nach genetischem Test, abhängig gemacht wird. Die Zielsetzung wird auch dann nicht unwirksam, wenn der Erfolg noch unsicher und von Zwischenbedingungen 1 2 Auf Grund der weiten Verbreitung der Abkürzung PID innerhalb der in Deutschland geführten Diskussion wird sie der international gebräuchlichen Abkürzung PGD ("Preimplantation Genetic Diagnosis" (=PGD) in dieser Stellungnahme vorgezogen. Diese Ergänzende Stellungnahme hat der Wissenschaftliche Beirat am 15.12.2001 beschlossen. 2 abhängig ist. Eine andere Auslegung des Gesetzestextes wäre verfassungsrechtlich verbotene Analogie (Art. 103 II GG). Die PID stellt auch keinen Verstoß gegen § 2 EschG dar, der verbietet, einen extrakorporal erzeugten Embryo zu einem nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck zu verwenden. Der auf Grund eines genetischen Tests nicht transferierte Embryo wird nicht fremdnützig "verwendet". Die Unterlassung der Weiterkultivierung mit der Folge des Absterbens stellt keine fremdnützige Verwendung dar, da durch die Unterlassung der Weiterkultivierung eine Verwendung gerade nicht erfolgt. Verfassungsrecht Die PID verstößt auch nicht gegen verfassungsrechtliche Grundsätze, insbesondere verletzt sie nicht die Menschenwürde (Art. 1 GG) und das Recht auf Leben (Art. 2 II GG). Neues, individuelles menschliches Leben beginnt mit der chromosomalen Vereinigung der Zellkerne von Ei- und Samenzelle und ist verfassungsrechtlich prinzipiell geschützt. Mit der extrakorporalen Befruchtung in Verbindung mit PID in dem im Diskussionsentwurf vorgesehenen Umfang ist keine Verletzung der Menschenwürde des Embryo verbunden. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts läge sie vor, wenn ein Mensch zum bloßen Objekt herabgewürdigt, verächtlich gemacht und willkürlich behandelt wird. Dies trifft bei der PID mit der Möglichkeit der Unterlassung des Transfers bei einer Feststellung schwerer genetischer Schäden nicht zu. Denn extrakorporale Befruchtung und PID erfolgen nur mit dem Ziel, eine Schwangerschaft herbeizuführen und eine schwerwiegende genetische Erkrankung auszuschließen. Die Einschränkung des Rechts auf Leben kann durch Gesetz entsprechend der Rechtfertigung eines Schwangerschaftsabbruchs erlaubt sein. Zwar liegt zum Zeitpunkt der PID ein Konflikt zwischen dem Lebensrecht des Embryos und einer gesundheitlichen Gefährdung der Frau wie beim Schwangerschaftsabbruch noch nicht unmittelbar vor, da sich der Embryo noch in vitro befindet. Die Konfliktsituation ist aber vergleichbar, sie wird jedoch – da absehbar - bei der PID antizipiert: Das Lebensrecht des Embryos steht im Konflikt mit der befürchteten gesundheitlichen Gefährdung der Frau. Gegen die PID wird angeführt, dass es ein verfassungsrechtlich begründbares Recht auf ein gesundes Kind nicht gebe. Dem ist zuzustimmen. Bei der eng begrenzten Anwendung der PID geht es allerdings nicht um die Erfüllung positiver Rechtsansprüche, sondern um die Möglichkeit zur Abwehr grundrechtsrelevanter 3 Gesundheitsrisiken der Frau unter der Annahme verfassungsrechtlich garantierter Fortpflanzungsfreiheit. Indikationen Der Diskussionsentwurf der Bundesärztekammer sieht eine enge, sehr begrenzte Indikationenlösung für die PID vor. Sie soll nur zulässig sein bei solchen Paaren, bei denen ein hohes Risiko für eine schwerwiegende genetisch bedingte Erkrankung der Nachkommen besteht. Nur eine solche, auf den antizipierten Konflikt zwischen Frau und Embryo abstellende Lösung ist verfassungsrechtlich unbedenklich. Damit wird zum einen eine befürchtete beliebige Selektion nach jeweils erwünschten Eigenschaften und eine allgemeine eugenisch orientierte Nachwuchsplanung ausgeschlossen. Außerdem wird eine Ausweitung der PID als allgemeines Screeningverfahren in der Fortpflanzungsmedizin damit verhindert. Das gilt auch für den Einsatz der PID etwa zur Steigerung der Erfolgsrate extrakorporaler Befruchtungsmaßnahmen. Einer Ausweitung der PID auf nicht sterile Paare ohne hohes Risiko einer schweren genetischen Erkrankung steht im Übrigen schon praktisch die physische und psychische Belastung durch die für die PID erforderlichen Verfahren der assistierten Reproduktion entgegen. Die Indikation für eine PID ist in jedem Einzelfall in Abwägung des Schutzes des ungeborenen Lebens gegenüber der Belastung der Frau unter Berücksichtigung des Schweregrades und der Therapiemöglichkeiten der zu erwartenden Erkrankung des Kindes zu prüfen. Eine Festlegung auf bestimmte Krankheiten verbietet sich schon, um eine regelhafte Anwendung der PID bei bestimmten Krankheitsrisiken auszuschließen. Es kann nur eine auf den jeweiligen Einzelfall bezogene Indikation geben. Überzählige Embryonen Gegen die PID wird vorgebracht, dass sie die Tür öffne für Forschung - insbesondere Stammzellforschung - an überzähligen Embryonen. Zur Verbesserung der Effizienz der PID werden in den meisten einschlägigen Zentren im Ausland mehr als drei Embryonen gleichzeitig untersucht. Dennoch hält der Diskussionsentwurf daran fest, dass entsprechend der geltenden Rechtslage (§ 1 Abs. 3 ESchG) nicht mehr als drei Embryonen pro Zyklus erzeugt werden dürfen, so dass nicht von vorneherein überzählige Embryonen entstehen. Außerdem sieht der Diskussionsentwurf vor (Abschnitt 4.3.), dass die mit der in Frage stehenden genetischen Veränderung nicht transferierten Embryonen weder kultiviert, kryokonserviert noch anderweitig verwendet werden dürfen. 4 Fazit Zulässigkeit und Indikationsgrundlage für die PID sollten gesetzlich festgelegt werden. Dabei sollte – wie im Diskussionsentwurf vorgeschlagen – an einer Beschränkung auf eine bekannte und schwerwiegende genetisch bedingte Erkrankung festgehalten werden. Das Verfahren für die Zulassung der PID sollte auf Grund gesetzlicher Ermächtigung berufsrechtlich geregelt werden. Mitglieder der Arbeitsgruppe Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. H. M. Beier, Direktor des Instituts für Anatomie und Reproduktionsbiologie der Medizinischen Fakultät der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen Prof. Dr. med. K. Diedrich, Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Medizinische Universität zu Lübeck Prof. Dr. med. W. Engel, Direktor des Instituts für Humangenetik der Universität Göttingen Prof. Dr. med. H. Hepp, Direktor der Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Klinikum Großhadern, München (federführend) Prof. Dr. theol. M. Honecker, Evangelisch-theologische Fakultät der Universität Bonn, Abteilung für Sozialethik Prof. Dr. med. E. Nieschlag, FRCP, Direktor des Instituts für Reproduktionsmedizin, Westfälische Wilhelms-Universität Münster Prof. Dr. jur. Dr. h. c. mult. H.-L. Schreiber, Direktor des Juristischen Seminars der Universität Göttingen Prof. Dr. med. K.-F. Sewing, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer (bis 07/2002), Hannover RA’in U. Wollersheim, Rechtsabteilung der Bundesärztekammer, Köln Dr. med. Chr. Woopen, Institut für Geschichte und Ethik der Medizin, Universität zu Köln, Institut für Wissenschaft und Ethik, Bonn Prof. Dr. med. H.-B. Wuermeling, em. Direktor des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Erlangen-Nürnberg (Ablehnung) Geschäftsführung Dezernat Wissenschaft und Forschung Bundesärztekammer Herbert-Lewin-Str. 1 50931 Köln