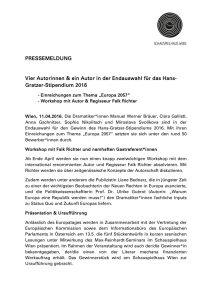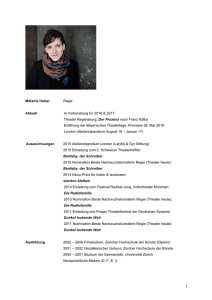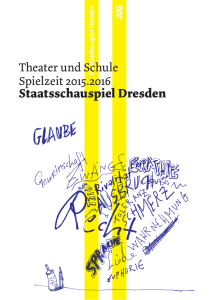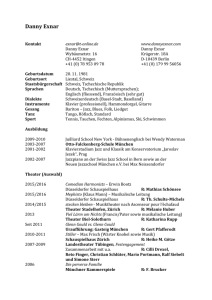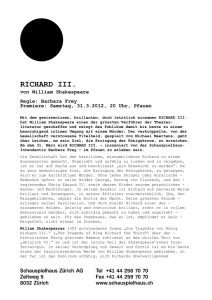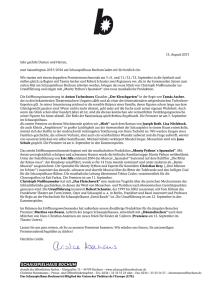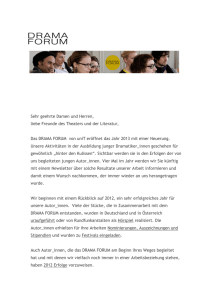Spielzeitheft 2014.2015
Werbung
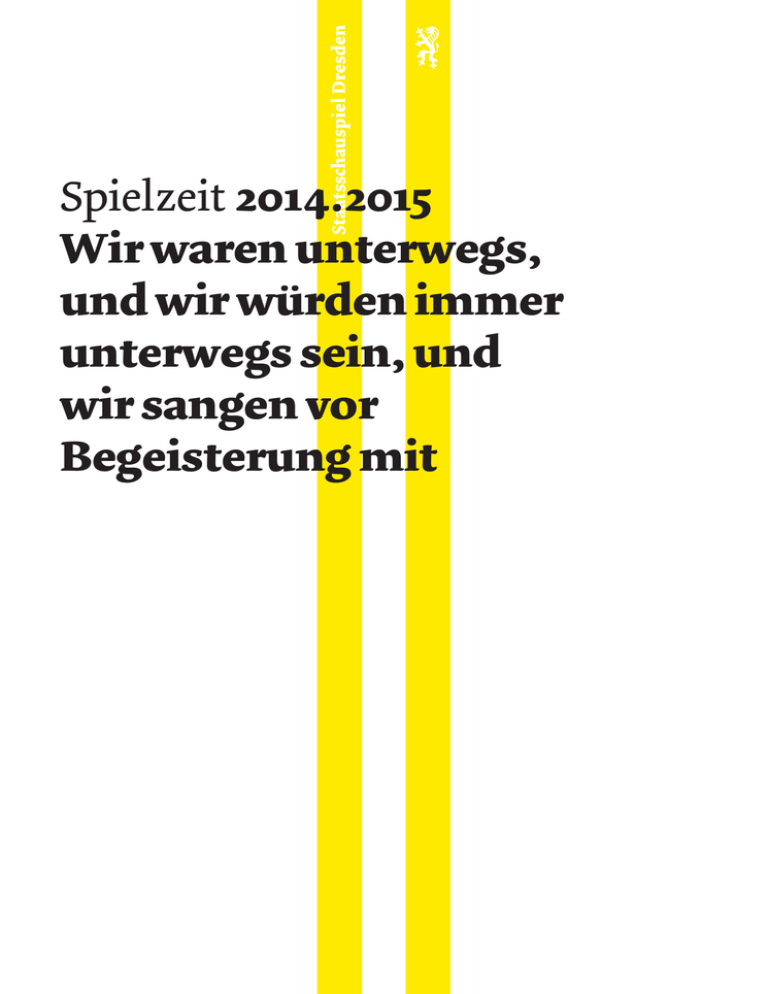
Spielzeit 2014. 2015 Wir waren unterwegs, und wir würden immer unterwegs sein, und wir sangen vor Begeisterung mit 100 Prozent Dresden Weiter im Spielplan: Die letzten Tage der Menschheit Weiter im Spielplan: Antigone Weiter im Spielplan: King Arthur 14.15 Wir danken den Förderern und Partnern der Spielzeit 2014/2015 für die Zusammenarbeit und für die freundliche Unterstützung unserer Produktionen und Projekte. Förderer und Projektpartner Medien- und Kooperationspartner deutsche städte medien Koproduzenten Rimini Apparat 10 Vorwort Liebes Publikum! In diesem Spielzeitheft sehen Sie 42 große Porträtfotos des Vielleicht kann das Theater heute am ehesten ein offener Schauspielensembles, der Schauspielerinnen und Schau- Ort sein, ein gesellschaftliches Labor, ein Projekt, an dem spieler, die den Spielplan tragen und die Ihnen vertraut viele teilhaben und das niemandem gehört. Vielleicht fehlt sind als diejenigen, die in den Inszenierungen von unserer uns allen ein wenig die Gelassenheit auszuhalten, nicht in und ihrer Welt erzählen. In den letzten Spielzeitheften wa- jedem Moment Bedeutung zu produzieren. ren sie in merkwürdige – oft selbstgewählte – inszenierte Zurück zum Moment neben dem Moment. Was haben die Situationen gestellt. Diesmal treten sie Ihnen fast privat Schauspielerinnen und Schauspieler im Augenblick des gegenüber. Dennoch: Etwas stimmt nicht. Wohin wendet Fotos gesehen? Ein überraschendes Bild, einen auf sie zusich der Blick, wie entsteht die innere und äußere Bewe- fliegenden Ball, einen unbekannten Film, einen merkwürgung? Normalerweise sucht der Fotograf (hier ist es der digen Menschen, der komische Dinge getan hat? Mal blitzt Theaterfotograf Matthias Horn, unser Auge auf das Thea- schelmisch oder konzentriert die Zunge des Porträtierten ter und seine Menschen) den „richtigen Moment“, den Mo- im Gesicht, mal wandert oder folgt der Blick, mal greift ment, in dem der Schauspieler, der porträtiert wird, ganz die Hand ins scheinbar Leere. Es sind Momente eines kurbei sich ist. Diesmal geht es um etwas anderes, um den Mo- zen Aus-sich-Heraustretens, eines Aufbruchs, ohne sich ment neben dem Moment, um ein Kurz-vorher oder ein selbst zu verlassen. Reaktion und Aktion sind ganz nah Kurz-hinterher. Um einen Moment der Ablenkung, des beieinander, das, was ich erfahre, und das, was ich daraus Vergessens und des Abschweifens, um eine andere Art von mache. Das könnte auch eine Art zu spielen sein, die sehr Konzentration, um eine winzige Differenz des Bewusst- schnell ist und modern und doch ganz aus der Ruhe und seins. Wovon handelt eigentlich Theater, und wie fixieren dem Zentrum kommt. Wir können von Schauspielern viel die Schauspieler ihre Figuren? Ist es die Suche nach dem lernen, denn sie haben gelernt, wach zu sein, gleichzeitig treffenden, sprechenden, zeichenhaften und bedeutenden auf sich achtzugeben, sich nicht zu verlieren und sich doch Moment? Oder ist es die kleine Abweichung, die Unschärfe, ganz einzulassen. die Irritation, die das Geheimnis ihrer Kunst ausmacht? Gerade jetzt scheint es manchmal notwendig, von diesen Anders als noch vor einigen Jahren, als die sozialen und kleinen, aber fundamentalen Momenten des Spielens und politischen Verhältnisse uns vielleicht noch gewisser und der Weltwahrnehmung zu reden, denn das Getöse in der selbstgewisser erschienen und das Theater sich heftig an Theater- und Medienlandschaft klingt im Augenblick wieder Definition von Welt beteiligte, kann heute unsere Qua- der einmal laut und schrill. lität gerade die Suchbewegung, das Umspielen des fikti- Mehrere der großen Bühnen im deutschsprachigen Raum – ven Zentrums sein. Dies wäre eine elegante Alternative vom Burgtheater über das Düsseldorfer Schauspielhaus bis zum krampfhaften Festhalten an einer trotzig behaupte- zur Semperoper – stehen derzeit unter finanziellen oder ten Bedeutung. personalpolitischen Aspekten im Spannungsfeld kritischer Es erscheint mir oft von unerträglicher Larmoyanz, wenn Aufmerksamkeit. Theater wird weniger als Kunstform und ehemalige Theaterkönige, krisenaffine Feuilletonisten und -produktion diskutiert denn als gelingender oder scheiternerregte Netzanonyme den Bedeutungsverlust des Theaters – der Betrieb. oder der Kunst überhaupt – beklagen. Je nach Himmels- Natürlich müssen die Betriebe funktionieren, natürlich richtung und Generation wird man von der 68er- oder der müssen sie transparent sein, und natürlich existiert – wie in 89er-Theaterwichtigkeitskeule erschlagen. Die Bedeutung fast jeder anderen gesellschaftlichen Institution – Reformvon Theater hat sich aber – historisch betrachtet – jeweils bedarf. Und ebenso natürlich bedarf es der gemeinsamen unterschiedlich definiert. Man kann das an vielen Beispie- Sorgfalt, Verantwortung und Intelligenz unserer Geselllen im Jubiläumsband zum einhundertjährigen Bestehen schaft, von Politik und Publikum, von Kunst und Kritik, an des Staatsschauspiels Dresden nachvollziehen. Entwürfen für eine Zukunft ihres Theaters zu arbeiten. Wie im Theater selbst sich die Kunst des Spielens und die Kunst des Zuschauens verbinden, wie in der Antike das Theater eine Sache der Polis war, so können auch heute die Probleme und die Lösungen nur gemeinsam beschrieben und gefunden werden. Wir versuchen, Ihnen für die Saison 2014/2015 einen Spielplan zu bieten, der unsere Schauspieler in vielen authentischen und berührenden, schrägen und rätselhaften Momenten zeigt. Momente, die treffen, und Momente, die umspielen. Spannende Theatermomente und versteckte Momente neben den Momenten. Nicht ganz ohne Risiko, aber eben auch nicht ganz ohne die Überzeugung, dass das Theater einer der schönsten Orte gemeinsamen Nachdenkens und Nachfühlens bleiben wird. Wir freuen uns auf Sie. Ihr Wilfried Schulz Intendant Staatsschauspiel Dresden 11 Eröffnungsfest Wir beginnen die neue Theatersaison mit einem großen Eröffnungsfest für die ganze Familie am 6. September! Mitglieder des Ensembles und Freunde des Hauses präsentieren vom Postplatz bis zur Probebühne unterm Dach ein abwechslungsreiches literarisches und musikalisches Programm. Um 15 Uhr geht’s für die Kleinen los: In der Kinderleseecke gibt es spannende Geschichten zu hören, die in sagenhafte Welten entführen. Und für die ganz Mutigen erzählt der Theatergeist tief unten in den Gewölben gruselige Gespenstergeschichten. Im Kinderschminksalon kann man sich in fiese Monster oder bezaubernde Prinzessinnen verwandeln. In den Foyers zeigen die Gewerke Tricks und Kniffe aus ihrem Arbeitsalltag und laden zum Ausprobieren ein. Bei der Theaterrallye, die in alle Winkel des Theaters führt, gibt es tolle Preise zu gewinnen und allerhand zu entdecken. Aufregende Spezialeffekte und technisches Know-how präsentiert die große moderierte Bühnentechnik-Show. Die Bürgerbühne und die Theaterpädagogik informieren über die Theaterclubs, Neuinszenierungen sowie über Angebote für Schüler und Lehrer und stellen in Miniperformances ihre künftigen Projekte vor. Darüber hinaus präsentieren die Schauspielerinnen und Schauspieler überall im Haus bis spät in die Nacht vielfältige literarische, musikalische und szenische Überraschungen. Die Studentinnen und Studenten des Schauspielstudios Dresden werden Ausschnitte aus ihrem Chansonprogramm zeigen. Für alle Fans der beliebten Reihe „Schund Royal – Bibliothek der billigen Gefühle“ gibt es eine Groschenromanlesung am Rande des guten Geschmacks. Auf den Spuren von Lessings „Miss Sara Sampson“ können Sie bei britischem High Tea und Songs von Noël Coward sentimentalen Gedichten lauschen. Oder Sie spüren in unserer „Sehnsuchtsbox Moskau“ den unendlichen russischen Weiten nach und lassen sich bei einem Wodka in die Geheimnisse der russischen Seele einweihen. Auf dem Postplatz können Sie sich den ganzen Tag von einem abwechslungsreichen Programm mit verschiedenen Livebands mitreißen lassen. Um 20 Uhr gibt es natürlich wieder die große Saisonvorschau auf der Schauspielhausbühne: Hier stellt das gesamte Ensemble in kurzen Szenen und moderierten Gesprächen mit Regisseuren, Autoren und weiteren Gästen die Inszenierungen der neuen Spielzeit vor. Und danach heißt es: Tanzen bis zum Morgengrauen auf der großen Bühne. Für das leibliche Wohl sorgt das Team des Theaterrestaurants william im ganzen Haus und draußen mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot für jeden Geschmack. Sie sind herzlich eingeladen. 12 Inhalt Die Spielzeit 2014/2015 Essays, Porträts, Interviews und Gedanken 14 p Die Saison in der Übersicht 44 p Huxleys Herzkatheter Heribert Prantl denkt über das Gesundheitssystem nach 46 p Drei Schwestern und ich Wladimir Kaminers russische Sehnsucht 51 p Zwillinge, die durch die Halle fliegen Susanne Lietzows Pläne mit dem „Gespenst von Canterville“ 52 p Protect me from what I want Armin Kerber porträtiert den Regisseur Linus Tunström 54 p Wer ist wer, wie ist und wie scheint man? Norbert Kentrup über eine Shakespeare’sche Verwechslungskomödie 60 p Verlacht vom Fiesko Simon Strauß lässt sich von Schiller verstören 61 p Der Geruch von Veroneser Salami Jochen Schmidt über seinen Lieblingskafka 62 p Bittere Systeme Andreas Kriegenburg begegnet Lorca 63 p Gezi – Tahrir – Majdan Justus H. Ulbricht über Revolution, Glück und Moral 64 p Der Untergang der Titanic Meike Schreiber erinnert an das Ende der Lehman Brothers 70 p Winnetou oder der Fremde in uns Arved Schultze über Wunsch- und Angstbilder von Fremdheit 72 p Wir glauben daran, dass Theater mit Bürgern eine neue Kunstform ist! Vier Bürgerbühnenleiter und ihre Konzepte 73 p Geistergespräche im Park Michael Hametner über Monika Marons jüngstes Buch 78 p Armes Herz! Dagrun Hintze sieht fern und liest Lessing 80 p Geschichtsarbeiter Tilmann Köhler über Thomas Freyer 81 p Welt der Pannen, Welt der Verantwortungslosigkeit Klaus Cäsar Zehrer schließt „Die Panne“ mit den Katastrophen unserer Tage kurz 84 p Wie ich die Photonenklarinette erfand Clemens Sienknecht hat ein „Superhirn“ 85 p Das schönste Mädchen von Gera Jan Gehler beantwortet Fragen zum Theater 86 p Schuld schreibt sich ein Sandra Strunz über „Alle meine Söhne“ 87 p Die Urszene Martin Heckmanns’ neues Stück Die Premieren im Schauspielhaus 20 p Schöne neue Welt nach dem Roman von Aldous Huxley 20 p Drei Schwestern von Anton Tschechow 21 p Das Gespenst von Canterville Kinder- und Familienstück nach Oscar Wilde 21 p Faust von Johann Wolfgang von Goethe 22 p Wie es euch gefällt Komödie von William Shakespeare 22 p Die Verschwörung des Fiesko zu Genua Ein Republikanisches Trauerspiel von Friedrich Schiller 23 p Amerika nach dem Roman von Franz Kafka 23 p Bernarda Albas Haus Tragödie von Federico García Lorca 24 p Dantons Tod von Georg Büchner 24 p Lehman Brothers. von Stefano Massini Die Premieren im Kleinen Haus 28 p Wir sind keine Barbaren! von Philipp Löhle 28 p Merlin oder Das wüste Land von Tankred Dorst 29 p Zwischenspiel nach dem Roman von Monika Maron 29 p Miss Sara Sampson Bürgerliches Trauerspiel von Gotthold Ephraim Lessing 30 p mein deutsches deutsches Land von Thomas Freyer 30 p Katzelmacher von Rainer Werner Fassbinder 31 p Die Panne Komödie von Friedrich Dürrenmatt 31 p Superhirn von Clemens Sienknecht 35 p Mischpoke Eine jüdische Chronik von 1945 bis heute 35 p Ein neuer Text Uraufführung in der Regie von Jan Gehler 36 p Soldaten Ein Dokumentartheater über Helden, Heimkehrer und die Zukunft des Krieges 36 p Alles im Fluss Ein Projekt über die Elbe und den Wandel der Zeit 37 p Alle meine Söhne von Arthur Miller 37 p Die Bergwanderung oder Sexualität heute von Martin Heckmanns Und außerdem ... 38 p Extras, Veranstaltungsreihen, Kooperationen und Gastronomie Das Dresdner Ensemble Die Schauspielerinnen und Schauspieler fotografiert von Matthias Horn 19 p Cathleen Baumann 17 p Sonja Beißwenger 48 p Thomas Braungardt 56 p Christian Clauß 49 p Thomas Eisen 40 p Rosa Enskat 41 p Christian Erdmann 34 p Christian Friedel 16 p Albrecht Goette 58 p Sascha Göpel 57 p Christine Hoppe 76 p Holger Hübner 92 p Ben Daniel Jöhnk 66 p Lars Jung 32 p André Kaczmarczyk 43 p Hannelore Koch 18 p Jonas Friedrich Leonhardi 75 p Matthias Luckey 25 p Philipp Lux 67 p Jan Maak 27 p Ahmad Mesgarha 33 p Anna-Katharina Muck 68 p Duran Özer 89 p Benjamin Pauquet 59 p Ina Piontek 69 p Karina Plachetka 50 p Tom Quaas 42 p Torsten Ranft 91 p Matthias Reichwald 88 p Nele Rosetz 26 p Lea Ruckpaul 77 p Yohanna Schwertfeger 90 p Antje Trautmann 74 p Ines Marie Westernströer Die Studentinnen und Studenten des ­Schauspielstudios Dresden 82 p Nina Gummich Pauline Kästner Tobias Krüger Kilian Land Lukas Mundas Justus Pfankuch Nadine Quittner Max Rothbart Alle Texte im Kapitel „Essays, Porträts, Interviews und Gedanken“ sind Originalbeiträge für dieses Magazin. Die Bürgerbühne 93 p Die Inszenierungen und Clubs s­owie die Angebote für Schüler und Lehrer Informationen 104 p Ensemble und Mitarbeiter 106 p Anrechte 111 p Ermäßigungen und Geschenke 112 p Saalplan und Preise 114 p Freunde und Förderer sowie Adressen 115 p Öffnungszeiten, Kartenkauf, Gastronomie, Behindertenservice, Impressum 13 Schauspielhaus Schöne neue Welt nach dem Roman von Aldous Huxley neu für die Bühne bearbeitet Regie: Roger Vontobel Uraufführung 12. 9. 2014 Drei Schwestern von Anton Tschechow Regie: Tilmann Köhler Premiere 4. 10. 2014 Das Gespenst von Canterville Kinder- und Familienstück nach Oscar Wilde Regie: Susanne Lietzow Premiere 31. 10. 2014 Faust Der Tragödie erster Teil von Johann W. von Goethe Regie: Linus Tunström Premiere 29. 11. 2014 Wie es euch gefällt Komödie von William Shakespeare Regie: Jan Gehler Premiere Januar 2015 Die Verschwörung des Fiesko zu Genua Ein Republikanisches Trauerspiel von Friedrich Schiller Regie: Jan Philipp Gloger Premiere Februar 2015 Kleines Haus Amerika nach dem Roman von Franz Kafka Regie: Wolfgang Engel Premiere März 2015 Wir sind keine Barbaren! von Philipp Löhle Regie: Barbara Bürk Premiere 14. 9. 2014 Kleines Haus 1 Bernarda Albas Haus Tragödie von Federico García Lorca Regie: Andreas Kriegenburg Premiere April 2015 Merlin oder Das wüste Land von Tankred Dorst Ein Weltentwurf mit Dresdner Jugendlichen Regie: Kristo Šagor Premiere 27. 9. 2014 Kleines Haus 2 Die Bürgerbühne Dantons Tod von Georg Büchner Regie: Friederike Heller Premiere Mai 2015 Lehman Brothers. Aufstieg und Fall einer Dynastie von Stefano Massini Regie: Stefan Bachmann Deutschsprachige Erstaufführung Mai 2015 In Kooperation mit dem Schauspiel Köln Zwischenspiel nach dem Roman von Monika Maron Regie: Malte Schiller Uraufführung 5. 10. 2014 Kleines Haus 3 Miss Sara Sampson Bürgerliches Trauerspiel von Gotthold Ephraim Lessing Regie: Sebastian Kreyer Premiere 1. 11. 2014 Kleines Haus 1 mein deutsches deutsches Land von Thomas Freyer Regie: Tilmann Köhler Uraufführung 27. 11. 2014 Kleines Haus 2 Weiterhin im Schauspielhaus: Antigone Tragödie von Sophokles Blütenträume von Lutz Hübner Dämonen nach dem Roman von Fjodor Dostojewskij Der geteilte Himmel nach der Erzählung von Christa Wolf Der Kaufmann von Venedig von William Shakespeare Der Meister und Margarita nach dem Roman von Michail Bulgakow Der Parasit oder Die Kunst sein Glück zu machen von Friedrich Schiller Der Selbstmörder Groteske von Nikolai Erdman Die Dreigroschenoper von Bertolt Brecht. Musik Kurt Weill Die Jüdin von Toledo Historisches Trauerspiel von Franz Grillparzer Die letzten Tage der Menschheit Tragödie von Karl Kraus Don Carlos von Friedrich Schiller Emilia Galotti Bürgerliches Trauerspiel von Gotthold Ephraim Lessing Geschichten aus dem Wiener Wald Volksstück von Ödön von Horváth Hamlet von William Shakespeare King Arthur Semiopera von John Dryden und Henry Purcell Klaus im Schrank oder Das verkehrte Weihnachtsfest Kinder- und Familienstück von Erich Kästner Was ihr wollt Komödie von Shakespeare Palais im Großen Garten: A Christmas Carol – Ein Weihnachtslied von Gerold Theobalt nach Charles Dickens Unterwegs: Ich will Zeugnis ablegen Aus den Tagebüchern Victor Klemperers 14 In Kooperation Katzelmacher von Rainer Werner Fassbinder Erzählt von jungen Dresdnerinnen und Dresdnern Regie: Robert Lehniger Premiere 12. 12. 2014 Kleines Haus 3 Die Bürgerbühne Die Panne Komödie von Friedrich Dürrenmatt Regie: Roger Vontobel Premiere Januar 2015 Kleines Haus 1 Superhirn oder Wie ich die Photonenklarinette erfand von Clemens Sienknecht Regie und Musik: Clemens Sienknecht Uraufführung Februar 2015 Kleines Haus 3 Mischpoke Eine jüdische Chronik von 1945 bis heute Regie: David Benjamin Brückel Uraufführung Februar 2015 Kleines Haus 3 Die Bürgerbühne Ein neuer Text Regie: Jan Gehler Uraufführung März 2015 Kleines Haus 2 Soldaten Ein Dokumentartheater über Helden, Heimkehrer und die Zukunft des Krieges Regie: Clemens Bechtel Uraufführung März 2015 Kleines Haus 3 Die Bürgerbühne In Kooperation mit dem Militärhistorischen Museum Dresden Alles im Fluss Ein Projekt über die Elbe und den Wandel der Zeit Regie: Uli Jäckle Uraufführung April 2015 Kleines Haus 3 Die Bürgerbühne Alle meine Söhne von Arthur Miller Regie: Sandra Strunz Premiere Mai 2015 Kleines Haus 1 Die Bergwanderung oder Sexualität heute von Martin Heckmanns Uraufführung Juni 2015 Kleines Haus 2 Situation Rooms von Rimini Protokoll März 2015 im MHM Dresden In Zusammenarbeit mit dem Militärhistorischen Museum Dresden Außerdem Theater zu Gast in Dresden Wir zeigen Inszenierungen renommierter Bühnen u. a. aus Berlin, Stuttgart und Hamburg Januar bis Juni 2015 Über die Zukunft des Theaters Eine vierteilige Veranstaltungsreihe des Staatsschauspiel Dresden mit dem Schauspiel Leipzig September bis Dezember 2014 In Kooperation mit der Sächsischen Akademie der Künste Eine Woche im Oktober 25 Jahre friedliche Revolution – Eine Themenwoche mit Theater, Diskussionen, Lesungen, Konzerten und Performances Oktober 2014 Weiterhin im Kleinen Haus: Aus dem Leben eines Taugenichts nach der Novelle von Joseph von Eichendorff Corpus Delicti von Juli Zeh Der abentheurliche ­Simplicissimus Teutsch nach H. J. C. Grimmelshausen Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui von Bertolt Brecht Der Diener zweier Herren von Carlo Goldoni Die Firma dankt von Lutz Hübner Ein Exempel Mutmaßungen über die ­sächsische Demokratie von Lutz Hübner Fabian. Die Geschichte eines Moralisten nach dem Roman von Erich Kästner Frau Müller muss weg Komödie von Lutz Hübner Nipple Jesus von Nick Hornby Schneckenmühle nach dem Roman von Jochen Schmidt Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des ­Christopher Boone von Simon Stephens nach dem Roman von Mark Haddon Träume werden Wirklichkeit! Ein Disneydrama von Christian Lollike Tschick nach dem Roman von Wolfgang Herrndorf Woyzeck nach Georg Büchner, von Tom Waits, Kathleen Brennan, Robert Wilson 20 000 Seiten von Lukas Bärfuss und die Inszenierungen der Bürgerbühne: Expedition Freischütz Ein Musiktheaterprojekt nach Carl Maria von Weber Ich armer Tor nach Goethes „Faust“ Irrfahrten des Odysseus nach Homer Ja, ich will! von Lissa Lehmenkühler Meine Akte und ich von Clemens Bechtel Weiße Flecken von Tobias Rausch 15 Albrecht Goette 16 Sonja Beißwenger 17 Jonas Friedrich Leonhardi 18 Cathleen Baumann 19 Die Premieren im Schauspielhaus Schöne neue Welt nach dem Roman von Aldous Huxley neu für die Bühne bearbeitet Uraufführung am 12. September 2014 im Schauspielhaus Regie: Roger Vontobel p Bühne: Claudia Rohner p Kostüm: Ellen Hofmann Drei Schwestern von Anton Tschechow Premiere am 4. Oktober 2014 im Schauspielhaus Regie: Tilmann Köhler p Bühne: Karoly Risz Aldous Huxleys „Brave new world“ gehört zu den einfluss- Mascha, Olga und Irina. Seit mehr als zehn Jahren leben die reichsten Texten des 20. Jahrhunderts. Die Geschichte ent- drei Schwestern in der kleinen Provinzstadt, deren einzige wirft eine Zukunftsvision der Welt im 26. Jahrhundert oder, Attraktion das ansässige Offizierskorps ist. Die jüngste, wie es im Text nach neuer Zeitrechnung heißt, „im Jahre Irina, leidet unter der Untätigkeit, zu der sie sich verdammt fühlt. Mascha ist verheiratet mit dem peniblen Kulygin. 632 nach Ford“. Huxley beschreibt eine Wohlstandsgesellschaft, die Krank- Und Olga ist Lehrerin. heit, Alter und Religion abgeschafft und Massenproduktion Aufgewachsen sind sie in Moskau, und Moskau ist ihre und -konsum in den Mittelpunkt allen Strebens gestellt Sehnsucht. Doch der Rückweg scheint verbaut. Ihr Bruder hat. Es ist eine Welt, in der Menschen nur noch künstlich Andrej hat das Erbe verjuxt, das für eine Rückkehr in die erzeugt werden, genormt, designt und an ihren zukünfti- Metropole notwendig wäre. Die Karriere, von der er träumgen Platz in der arbeitenden Gemeinschaft bereits von der te, hat sich zerschlagen, und seine Frau Natascha erweist sich als Provinzdrache, der einen zusätzlichen Schatten ersten Spaltung der Eizelle an angepasst. In dieser Welt, die totale Kontrolle und totale Einheitlich- über das Leben der drei Schwestern wirft. keit zur Maxime hat, erleben wir die Kämpfe dreier Außen- Zeit geht ins Land. Die Schwestern verlieben sich – keine seiter: John Savage, Bernard Marx und Helmholtz Watson. findet dabei ihr Glück. Sie reden von ihren Träumen, von Der erste ist einer der wenigen Wilden aus einem Indianer- Aufbruch und Sinn, doch sie treten auf der Stelle. Schließreservat, der zweite ein „Fabrikationsfehler“, der sich in der lich kommt es zur Katastrophe: Irinas Bräutigam wird am ihm zugedachten Kaste nicht wohlfühlt und sich – was eine Vorabend der Hochzeit bei einem Duell getötet. Das Militär Straftat ist – verliebt. Der dritte ist ein Mensch, der dem wird aus dem Städtchen abgezogen. Die drei Schwestern Rest der Genormten geistig so weit überlegen ist, dass er bleiben zurück. „Drei Schwestern“, 1901 in Moskau uraufgeführt, ist ein Stück, eine nicht staatskonforme Individualität ausbildet. Huxley entwirft eine Dystopie, die von unserer Realität das seine Figuren in den Mittelpunkt stellt, nicht einen nicht so weit entfernt ist, wie man es gerne hätte. Er wirft Handlungsbogen. Der Text ist eine große, wehmütige und Fragen auf, die uns heute bewegen – die Frage nach den komische Denkbewegung, ein sehnsüchtiges Kreisen um Grenzen der Demokratie, nach den Grenzen des Wachs- eine verlorene Mitte. tums, nach der Verantwortlichkeit der Wissenschaft für Der russisch-deutsche Schriftsteller Wladimir Kaminer hat sich Gedanken zur russischen Sehnsucht gemacht p Seite 46 Leben und Tod. Die Inszenierung ist eine neue Dramatisierung des Romans, für die sich der New Yorker „Aldous & Laura Huxley Literary Trust“ das Staatsschauspiel Dresden als Partner gewünscht hat. Einen Essay des Journalisten Heribert Prantl zu „Schöne neue Welt“ finden Sie auf p Seite 44 Roger Vontobel wurde 1977 in Zürich geboren, studierte Schauspiel in New York und Pasadena sowie Schauspielregie am Institut für Theater, Musiktheater und Film itmf in Hamburg. Nach Inszenierungen in Essen und München wurde Vontobel 2006 in der Kritikerumfrage der Fachzeitschrift „Theater heute“ zum Nachwuchsregisseur des Jahres gewählt. Er arbeitete in den letzten Jahren am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, an den Münchner Kammerspielen und am Schauspiel Bochum. Für seine Inszenierung von Schillers „Don Carlos“ am Staatsschauspiel Dresden wurde Vontobel in der Hauptkategorie „Beste Regie“ mit dem wichtigsten deutschen Theaterpreis „Der Faust“ ausgezeichnet. Außerdem wurde „Don Carlos“ zum Berliner Theatertreffen 2011, zu den Schillertagen in Mannheim und zu zahlreichen Gastspielen im In- und Ausland eingeladen. In Dresden inszenierte er auch Kleists „Der zerbrochne Krug“ und Shakespeares „Hamlet“. 20 Tilmann Köhler wurde 1979 in Weimar geboren und studierte Schau­spielregie an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. 2005 wurde er als Hausregisseur an das Deutsche Nationaltheater Weimar engagiert. Hier inszenierte er u. a. Goethes „Faust“, Shakespeares „Othello“ und Bruckners „Krankheit der Jugend“, das 2007 zum Berliner Theatertreffen eingeladen war. Weitere Inszenierungen entstanden am Maxim Gorki Theater Berlin, am Schauspiel Hannover und am Deutschen Theater Berlin. Seit 2009 ist Köhler Hausregisseur am Staatsschauspiel Dresden sowie Leiter des Schauspielstudios Dresden. Hier inszenierte er bisher u. a. Tschechows „Kirschgarten“, Brechts „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ (ausgezeichnet mit dem Kurt-Hübner-Preis für junge Regie 2009), Shakespeares „Der Kaufmann von Venedig“ und Christa Wolfs „Der geteilte Himmel“. In Frankfurt am Main inszenierte er 2013 mit Händels „Teseo“ seine erste Oper. In Dresden folgten die Semiopera „King Arthur“, die in Zusammenarbeit mit der Semperoper Dresden entstand, sowie Brechts „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“. Das Gespenst von Canterville Kinder- und Familienstück nach Oscar Wilde für alle ab 10 Jahren Premiere am 31. Oktober 2014 im Schauspielhaus Regie: Susanne Lietzow p Bühne: Aurel Lenfert p Kostüm: Marie Luise Lichtenthal Faust Der Tragödie erster Teil von Johann Wolfgang von Goethe Premiere am 29. November 2014 im Schauspielhaus Regie: Linus Tunström Sir Simon de Canterville ist Herr auf Canterville Chase, und zwar seit über 300 Jahren. So lange sucht er nämlich schon als Geist das altehrwürdige Schloss seiner Familie heim. Längst hat auch der letzte Nachfahre das Weite gesucht, terrorisiert von Simon, der, so munkeln die Hausangestellten, für den grausamen Mord an seiner Frau verflucht wurde. Simon selbst begreift sich als Künstler des Schreckens. Wenn er nicht gerade einen neuen Spuk ersinnt oder auf dem Tennisplatz mit seinen Knochen Kegel spielt, erinnert er sich mit Vorliebe an seine unvergesslichen Auftritte als „Roter Ruben“, „Erwürgtes Kind“ oder „Blutsauger vom Bexley-Moor“. Als eine amerikanische Diplomatenfamilie Schloss Canterville kauft und dort einzieht, nimmt Sir Simon die Verteidigung seines Erbes mit entsprechend selbstbewusster Gelassenheit auf. Doch Mr. Otis samt Frau und Kindern erweist sich als äußerst unschreckhaft, mehr noch, mit typisch amerikanischem Optimismus und einer Palette an fortschrittlichen Produkten rückt die Familie dem Geist zu Leibe. Ein Kampf von „Blut gegen Fleckenentferner“ und „Kettengerassel gegen Schmieröl“ beginnt. „Das Gespenst von Canterville“ erschien 1887 als erste Erzählung des irischen Schriftstellers Oscar Wilde in der Londoner Zeitschrift „The Court and Society Review“. Seitdem erfreut sich die Geschichte des Gespensts, das das Fürchten lernen muss und darüber glatt in eine Depression verfällt, nicht abreißen wollender Beliebtheit. Ein Klassiker der Gruselliteratur, versetzt mit satirischem Witz und einer Sprachgewandtheit, die den späteren Skandalautor und „Dandy aller Dandys“ Oscar Wilde erkennen lässt. Frühbuchertermine für „Das Gespenst von Canterville“ sowie Kästners „Klaus im Schrank“ finden Sie auf p Seite 51, wo die Regisseurin Susanne Lietzow außerdem erste Pläne zum diesjährigen Familienstück verrät. Ein Teufel namens Mephisto wettet mit dem Herrn um die Seele Heinrich Fausts. Faust – Jurist, Theologe, Mediziner, Philosoph – will sterben, doch Mephisto macht ihm ein Angebot: Er will ihm zeigen, was noch kein Mensch je gesehen hat. Nun wetten auch Faust und Mephisto: Sollte Mephisto Faust je dazu bringen, sich aufs Faulbett zu legen, selbstgefällig zu werden, zu genießen – dann will Faust dem Teufel im Jenseits seine Seele geben. „Werd’ ich zum Augenblicke sagen: / Verweile doch! du bist so schön! / Dann magst du mich in Fesseln schlagen, / Dann will ich gern zu Grunde gehn!“ Mephisto nimmt Faust mit auf eine Reise, die ihn von Auerbachs Keller in eine Hexenküche bringt, von der Begegnung mit Gretchen, einer jungen Frau, zur Walpurgisnacht. Während Gretchen wahnsinnig wird – nachdem ihre Mutter an einem Schlafmittel stirbt, das Faust Gretchen gegeben hat; nachdem Faust sie wieder verlassen hat; und nachdem sie ihrer beider Kind getötet hat – und doch vom Herrn gerettet, ist Fausts und Mephistos Reise noch nicht beendet – aber es endet „Der Tragödie Erster Teil“. Über dreißig Jahre hat Johann Wolfgang von Goethe an verschiedenen Fassungen des Faust-Stoffes gearbeitet, der auf alten Volkssagen beruht. Die Interpretationsgeschichte des Stückes – ob als Parabel auf den deutschen Geist, ob als philosophische Studie über das Subjekt, ob als Volkstheater – füllt Bibliotheken, und viele theatergeschichtlich bedeutende Inszenierungen sind mit Goethes „Faust“ gemacht worden – einem Stoff, der sich immer wieder anders entdecken lässt. Der Dramaturg Armin Kerber porträtiert den schwedischen Regisseur Linus Tunström p Seite 52 Susanne Lietzow wurde 1968 in Innsbruck geboren. Sie studierte Bildhauerei in New York und absolvierte anschließend eine Schauspielausbildung in Innsbruck. Es folgten Engagements am Theater Phönix in Linz und am Deutschen Nationaltheater Weimar, wo sie jeweils auch Regie führte, wie auch u. a. am Schauspielhaus Wien und am Schauspiel Hannover. Von 1997 bis 2000 war sie Gastdozentin für Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig. 2006 erhielt sie für „How much, Schatzi?“ nach H. C. Artmann zusammen mit dem Projekttheater Wien/Vorarlberg, dessen künstlerische Leitung sie seit 2005 innehat, den Nestroy-Preis für die beste Offproduktion. Am Staatsschauspiel Dresden inszenierte sie bereits Lutz Hübners „Die Firma dankt“, Johann Wolfgang von Goethes „Reineke Fuchs“, Gerhart Hauptmanns „Die Ratten“ und die Uraufführung von Erich Kästners „Klaus im Schrank“. Mit dem Schauspielstudio Dresden erarbeitete sie Juli Zehs Gesellschaftsdystopie „Corpus Delicti“. Linus Tunström, 1969 in Stockholm geboren, studierte an der Ecole internationale de Théâtre Jacques Lecoq in Paris. Regiearbeiten führten ihn an die wichtigsten Theater Skandinaviens, u. a. an das Nationaltheater in Stockholm, das Theater Göteborg, das Königliche Theater in Kopenhagen, das Stockholmer Cullberg-Ballett und die Oper in Malmö. 2007 inszenierte Linus Tunström mit Strindbergs „Ein Traumspiel“ am Theater Bern erstmals eine Arbeit im deutschsprachigen Raum. Bereits drei seiner Inszenierungen wurden zum schwedischen Theatertreffen eingeladen. Seit 2007 ist er Direktor des Stadttheaters Uppsala, das unter seiner Leitung 2009 mit dem schwedischen Theaterkritikerpreis als „Schwedens vielseitigste Bühne“ ausgezeichnet wurde. Zuletzt inszenierte er in Uppsala Tolstojs „Anna Karenina“, Ingmar Bergmans „Fanny und Alexander“ sowie Shakespeares „Hamlet“. 21 Wie es euch gefällt Komödie von William Shakespeare Premiere im Januar 2015 im Schauspielhaus Regie: Jan Gehler p Bühne: Sabrina Rox Die Verschwörung des Fiesko zu Genua Ein Republikanisches Trauerspiel von Friedrich Schiller Premiere im Februar 2015 im Schauspielhaus Regie: Jan Philipp Gloger In „Wie es euch gefällt“ flieht eine Gruppe politisch Verfolg- Es ist das Jahr 1547. Genua wird vom greisen Dogen Doria ter in den Wald von Arden: Herzog Senior wurde von sei- regiert, dessen Neffe und potenzieller Nachfolger tyranninem Bruder Friedrich entmachtet und lebt fortan unter siert die Stadt. Doch unter den Nobili regt sich Widerstand; freiem Himmel – mitsamt Edelleuten und Hofnarr. Macht- ein paar republikanische Verschwörer planen den Umsturz. kämpfe und Intrigen bei Hof treiben auch Seniors Tochter Über Fiesko allerdings sind sie sich im Unklaren. Ist er Rosalind und ihre beste Freundin Celia, pikanterweise noch ein Verbündeter oder ist er abgefallen? Fiesko spielt Friedrichs Tochter, in die Verbannung. Um Gefahren zu den Lebemann, verschleiert seine Absichten – mit gutem entgehen, verkleidet sich Rosalind als Mann und sucht so Grund, denn auch er steht auf der Todesliste des jungen nach ihrem Vater, dem rechtmäßigen Herrscher. Der junge Doria. Auf beiden Seiten werden Verbündete gesucht, SolEdelmann Orlando, um Erbe und Ausbildung betrogen, ist daten gesammelt, aber Fiesko zögert: Soll er sich wirklich ebenfalls auf der Flucht. als Anführer den Republikanern anschließen oder doch In der Wildnis werden zivilisatorische Standards zunehmend besser die Alleinherrschaft ergreifen? Als der Aufstand abgelegt – das gefällt jedem, oder? Orlando vergeht vor losbricht, ist das Geflecht der Intrigen so dicht, dass es Sehnsucht nach Rosalind und heftet heiße Liebesschwüre alle mitreißt. an die Bäume. In ihrer Verkleidung als Jüngling Ganymed „Fiesko“ ist das Drama eines Politikers, der über seinen avanciert Rosalind zum engen Vertrauten Orlandos und eigenen Ehrgeiz stolpert. Jung, beliebt, brillant und erfolgstellt damit seine Liebe auf eine harte Probe. Und nicht reich, kann er sich nicht entscheiden und unterwirft seine nur er lässt sich täuschen: Auch die Schäferin Phoebe hat politische Überzeugung seinem Machtwillen. „Die kalte, sich in Ganymed/Rosalind verliebt, was wiederum ihrem unfruchtbare Staatsaktion aus dem menschlichen Herzen Verehrer Silvius Folterqualen bereitet. Der Wald von Arden herauszuspinnen und eben dadurch an das menschliche ist nämlich keineswegs leer, sondern von Schäfern und Herz wieder anzuknüpfen – den Mann durch den staatsklugen Kopf zu verwickeln – und von der erfinderischen Ziegenhirten bevölkert. Die ausgelassene Gesellschaft verstrickt sich tief in ein Intrige Situationen für die Menschheit zu entlehnen – das aberwitziges Spiel von Illusion und Sehnsucht, von echter stand bei mir“, schreibt Schiller in der Vorrede zu seinem und vorgetäuschter Liebe. Die Realität des Hofes rückt in zweiten Stück, in dem er sich erstmals eines historischen weite Ferne. Spätestens als Usurpator Friedrich von einem Stoffs annimmt. „Fiesko“ wurde 1784 in Mannheim uraufEinsiedler zum Pazifismus bekehrt wird, ist klar: „Wie es geführt, allerdings mit geringem Erfolg, was Schiller auf euch gefällt“ – den Titel sollte man ernst nehmen, denn im das Publikum zurückführt: „Republikanische Freiheit ist hierzulande ein Schall ohne Bedeutung“, konstatiert er. Wald von Arden gilt nur dies Gesetz. Der Shakespeare-Experte Norbert Kentrup blickt hinter die Kulis- Das dürfte sich in den letzten 230 Jahren geändert haben. Unter Anleitung von Fiesko sucht der Journalist Simon Strauß sen des elisabethanischen Theaterklassikers p Seite 54 nach heißen und revolutionären Regungen p Seite 60 Jan Gehler wurde 1983 in Gera geboren und studierte Szenische Künste an der Universität Hildesheim. Von 2009 bis 2011 war er Regieassistent am Staatsschauspiel Dresden, wo er in der Spielzeit 2011/2012 die Uraufführung von Wolfgang Herrndorfs Roman „Tschick“ inszenierte, die 2012 zum Theaterfestival „Radikal jung“ nach München sowie zum Heidelberger Stückemarkt eingeladen wurde. Außerdem erhielt er für diese Arbeit eine Nominierung für den renommierten Theaterpreis „Der Faust“. Weitere Arbeiten führten ihn an das Volkstheater München, das Maxim Gorki Theater Berlin und das Theater Freiburg. Seit der Spielzeit 2013/2014 ist Jan Gehler Hausregisseur am Staatsschauspiel Dresden. Unter seiner Regie entstanden in Dresden außerdem Joseph von Eichendorffs „Aus dem Leben eines Taugenichts“, die deutsche Erstaufführung von Mark Haddons Roman „Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone“ sowie im Juni 2014 die Uraufführung von Lutz Hübners „Ein Exempel“. 22 Jan Philipp Gloger wurde 1981 in Hagen geboren. Er studierte Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen und Regie an der Zürcher Hochschule der Künste. Seit 2007 arbeitet er als freischaffender Regisseur u. a. am Theater Augsburg, am Deutschen Theater Berlin, am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und am Residenztheater München. Seine Inszenierungen waren beim Heidelberger Stückemarkt, bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen und bei den Mülheimer Theatertagen zu sehen. Für seine Inszenierung von Goethes „Clavigo“ erhielt er 2011 den Regiepreis der Bayerischen Theatertage. Mit Mozarts „Figaros Hochzeit“ inszenierte er 2010 am Theater Augsburg seine erste Oper. Es folgten 2012 „Der fliegende Holländer“ von Richard Wagner bei den Bayreuther Festspielen sowie Mozarts „Idomeneo“ an der Oper Frankfurt. Von 2011 bis 2014 war Jan Philipp Gloger leitender Regisseur am Staatstheater Mainz. An der Dresdner Semperoper inszenierte er im April 2014 Verdis „Simon Boccanegra“. Amerika nach dem Roman von Franz Kafka Premiere im März 2015 im Schauspielhaus Regie: Wolfgang Engel p Bühne: Olaf Altmann Bernarda Albas Haus Tragödie von Federico García Lorca Premiere im April 2015 im Schauspielhaus Regie und Bühne: Andreas Kriegenburg p Kostüm: Andrea Schaad „Als der sechzehnjährige Karl Roßmann, der von seinen „Bernarda Albas Haus“ ist eine „Tragödie von den Frauen armen Eltern nach Amerika geschickt worden war, weil ihn in den Dörfern Spaniens“, wie es im Untertitel heißt. Zuein Dienstmädchen verführt und ein Kind von ihm bekom- sammen mit „Yerma“ und „Bluthochzeit“ bildet das Stück men hatte, in dem schon langsam gewordenen Schiff in eine Trilogie, die sich mit dem Bild der spanischen Frau den Hafen von New York einfuhr, erblickt er die schon auseinandersetzt. Nach dem Tod ihres Mannes verordnet längst beobachtete Statue der Freiheitsgöttin wie in einem Bernarda Alba ihren fünf Töchtern, ihrer Mutter und den plötzlich stärker gewordenen Sonnenlicht“ – so beginnt Mägden ihres Hauses eine mehrjährige Trauer. Für ihre Franz Kafkas „Der Verschollene“, besser bekannt unter dem Kinder, zwischen zwanzig und vierzig Jahre alt, wird das Titel, den Max Brod seiner Edition des Romanfragments Haus zum Gefängnis. Lediglich die älteste, Angustias, darf aus Kafkas Nachlass gab: „Amerika“. noch mit ihrem Verlobten Pepe in Kontakt treten – durch Karl Roßmann „goes west“, und Karl Roßmann ist „on the ein vergittertes Fenster. Auch ein Ausbruchsversuch der road“. Aus diesen beiden Idealisierungen amerikanischer Tochter Adela scheitert. Lebensläufe strickt Kafka den Weg eines europäischen Emi- Nach außen wird versucht, die Fassade der heilen Familie granten im neuen gelobten Land Amerika. Karl Roßmann zu wahren – doch hinter den verschlossenen Türen wacht wird allerdings nicht „vom Tellerwäscher zum Millionär“, tyrannisch Bernarda Alba und verteidigt das Bollwerk ihres sondern vom Neffen seines reichen Onkels zum Liftboy, Rückzugs und ihrer Abkehr von der Welt zur Not auch mit dann zum „Mädchen für alles“ einer sich prostituierenden Waffengewalt. So wird sie zum Sinnbild der Erstarrung Sängerin, und schließlich wird er für „niedrige technische und der pervertierten Sitte. Arbeiten“ vom „Naturtheater von Oklahoma“ angeworben. Federico García Lorca, 1898 in Fuente Vaqueros geboren, Wie alle Romane Kafkas ist auch dieser Fragment geblie- blieb seiner andalusischen Heimat sein ganzes Werk hinben. Dieser lichteste seiner Romanversuche, der schon durch treu. Seine Texte, die von der Lyrik bis zum Drama mehrfach für die Bühne adaptiert worden ist und dessen reichen, nahmen immer wieder kritisch Bezug auf die Hauptfigur chaplineske Züge trägt, erzählt vom amerikani- Gegenwart und provozierten gesellschaftliche Fragestelschen Traum, von Freiheit, vom „pursuit of happiness“ – lungen. Sie machten den Dichter zu einem unbequemen, kritischen Geist, der bei Publikum und Leserschaft gleichin Negation. Der Schriftsteller Jochen Schmidt über Kafkas Romanfragment p wohl große Erfolge feierte. 1936, zum Beginn des Spanischen Bürgerkriegs, wurde Lorca von einer Milizgruppe Seite 61 Francos ermordet. Der Regisseur Andreas Kriegenburg beschreibt die lang anhaltende Faszination, die vom Kosmos Federico García Lorcas ausgeht p Seite 62 Wolfgang Engel wurde 1943 in Schwerin geboren. Von 1980 bis 1991 war er am Staatsschauspiel Dresden als Hausregisseur tätig, wo ihn seine Inszenierungen zu einem der prägendsten Regisseure der ddr machten. Ab 1983 reiste Engel zu Regiearbeiten u. a. auch an das Wiener Burgtheater, das Schauspielhaus Zürich, das Berliner Schillertheater und das Münchner Residenztheater. 1991 ging er nach Frankfurt am Main und wurde fester Regisseur am dortigen Schauspiel. Von 1995 bis 2008 war Wolfgang Engel Intendant des Schauspielhauses Leipzig. 2010 führte er am Staatsschauspiel Dresden Regie bei der viel beachteten Uraufführung von Uwe Tellkamps „Der Turm“. Es folgten Michail Bulgakows „Der Meister und Margarita“, Jewgeni Schwarz’ „Der Drache“ sowie Karl Kraus’ „Die letzten Tage der Menschheit“. 2011 erhielt Wolfgang Engel den Theaterpreis „Der Faust“ für sein Lebenswerk. Andreas Kriegenburg wurde 1963 in Magdeburg geboren und gehört zu den renommiertesten deutschen Regisseuren, neun seiner Inszenierungen wurden zum Berliner Theatertreffen eingeladen. 2008 wurde er für seine Uraufführung von Dea Lohers „Das letzte Feuer“ mit dem deutschen Theaterpreis „Der Faust“ ausgezeichnet. Für die Bühnenbilder zu seinen Inszenierungen von Kleists „Prinz Friedrich von Homburg“ und Dea Lohers „Diebe“ wurde er 2010 von der Fachzeitschrift „Theater heute“ zum Bühnenbildner des Jahres gekürt. Darüber hinaus ist Andreas Kriegenburg auch als Opernregisseur tätig, so führte er 2011 Regie bei Puccinis „Tosca“ an der Oper in Frankfurt am Main sowie 2012 bei Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“ an der Bayerischen Staatsoper. Am Staatsschauspiel entstanden unter seiner Regie Jean Paul Sartres „Die Fliegen“ sowie in der letzten Spielzeit Shakespeares „Was ihr wollt“. Im März 2014 inszenierte er an der Semperoper Dresden Mozarts „Così fan tutte“. 23 Dantons Tod von Georg Büchner Premiere im Mai 2015 im Schauspielhaus Regie: Friederike Heller p Bühne: Sabine Kohlstedt Lehman Brothers. Aufstieg und Fall einer Dynastie von Stefano Massini Deutschsprachige Erstaufführung im Mai 2015 im Schauspielhaus Regie: Stefan Bachmann p Bühne: Olaf Altmann In Kooperation mit dem Schauspiel Köln Die Revolution ist vorbei, aber warum steht die Guillotine Am 11. September 1844 kommt ein bayerischer Jude in nicht still? 1794, fünf Jahre nach dem Sturm auf die Bastille, Manhattan an. Es ist Heyum Lehmann, der mit Betreten hungert Frankreichs Volk. Laben soll es sich am Fleisch der der Neuen Welt ein anderer Mensch wird: Henry Lehman. Aristokraten und am Blut der Revolutionsgegner, zumin- Er will in Amerika sein Glück versuchen und eröffnet ein dest wenn es nach den Mitgliedern des Wohlfahrtsaus- Textilgeschäft in Montgomery/Alabama. Als seine beiden schusses geht, die jüngst die politische Macht eroberten. Brüder nachkommen, steht auf dem Ladenschild bald „Das Laster muss bestraft werden, die Tugend muss durch schon „Lehman Brothers“. Der Familienbetrieb wächst in den Schrecken herrschen“, lässt Maximilien de Robespierre schwindelerregendem Tempo: Aus dem Tuchladen wird verlauten, eine bessere Zukunft fest im Blick. Dabei hatte ein Finanzimperium. alles so schön angefangen! Freiheit, Gleichheit, Brüderlich- Schneller, größer, weiter …? 2008 brach die amerikanische keit – hehre Ideale, die die Freunde Danton und Desmoulins Bank Lehman Brothers zusammen und läutete den Kollaps einst im „Club des Cordeliers“ formuliert und gemeinsam des Finanzmarktes ein. Sie steht für das Platzen der Spekumit Robespierre und St. Just in der Nationalversammlung lationsblase, die Gier der Banker und den Beginn einer durchgesetzt hatten. Doch die andauernde Not des Volkes weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise. Der 39-jährige macht sie zu Feinden. Danton, selbst verantwortlich für Stefano Massini gilt als einer der prägenden zeitgenössidas tragische „Septembermassaker“, ist angewidert von schen Dramatiker Italiens. Seine Stücke werden internatiRobespierres Schreckensherrschaft, zweifelt jedoch an der onal gespielt und sind vielfach ausgezeichnet, u. a. 2005 Veränderbarkeit der Verhältnisse. Müde vom Terror, ge- mit dem Pier Vittorio Tondelli-Preis, der wichtigsten Ausnießt er, was ihm vom Leben noch bleibt: Frauen, Wein und zeichnung für italienische Dramatik, und 2013 mit dem Kartenspiel. Als Danton sich endlich aufrafft einzuschrei- italienischen Theaterpreis Premio Ubu, insbesondere für ten, hat Robespierre längst die Mittel an der Hand, den „Lehman Brothers.“. 2007 erschien „Donna non rieducabile“ einstigen Bruder im Geiste zu liquidieren. über Anna Politkovskaja. Das Stück war Vorlage für einen Georg Büchner ist 22 Jahre alt und selbst ein politisch erfolgreichen Kinofilm, der auf Festivals vorgestellt und Verfolgter, als er, gestützt auf historische Quellen, die letz- von rai ausgestrahlt wurde. Mit „Lehman Brothers.“ hat ten Tage Dantons dramatisiert. Die Revolutionäre, über die Massini eine Familiensaga verfasst, die in epischer Form der junge Dichter schreibt, sind kaum älter, als sie ihre und fast biblischer Sprache vom Aufstieg der drei Brüder Utopie einer gerechten Republik entwerfen. So ist „Dantons erzählt. Die Chronik führt durch mehr als 150 Jahre und Tod“ auch eine Reflexion über die Wünsche, die jede junge schildert, wie die Welt sich immer schneller dreht und Generation umtreibt: „selber machen zu dürfen“ und „die dabei immer kleiner wird. Und die Lehmans nutzen dabei Welt verändern zu wollen“. Sind Tod und Schrecken das, mit sicherem Instinkt die sich fast rituell wiederholenden was uns dann erwartet? Krisen, um immer weiter zu wachsen – bis zum eigenen Justus H. Ulbricht über Revolution, Glück und Moral p Seite 63 Zusammenbruch. „Lehman Brothers.“ ist die epische Autopsie der kapitalistischen Katastrophe, lehrreich und sinnlich zugleich. Die Finanzjournalistin Meike Schreiber über die letzten Tage einer Bank im September 2008 p Seite 64 Friederike Heller wurde 1974 in Westberlin geboren. Sie studierte an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg Schauspielregie bei Jürgen Flimm. Für ihre Inszenierung von Peter Handkes „Untertagblues“ am Wiener Burgtheater wurde sie 2005 von der Fachzeitschrift „Theater heute“ zur Nachwuchsregisseurin des Jahres ernannt. Weitere Inszenierungen führten sie an das Thalia Theater Hamburg, das Schauspiel Köln, das Schauspiel Stuttgart, das Münchner Residenztheater und die Schaubühne Berlin. Dort war sie von 2009 bis 2010 als Hausregisseurin und Dramaturgin engagiert. Am Staatsschauspiel Dresden entstanden unter ihrer Regie Goethes „Wilhelm Meisters Lehrjahre“, Peter Weiss’ „Marat/Sade“, Brechts „Die Dreigroschenoper“ sowie im Mai 2014 Dostojewskijs „Dämonen“. 24 Stefan Bachmann, geboren 1966 in Zürich, war nach seinem Studium der Germanistik in Zürich und Berlin 1992 Mitbegründer des Berliner Theaters Affekt. Ab 1993 inszenierte er u. a. am Schauspiel Bonn, an der Berliner Volksbühne, am Theater Neumarkt in Zürich und am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Von 1998 bis 2003 war er Schauspieldirektor am Theater Basel, welches 1999 von der Fachzeitschrift „Theater heute“ zum Theater des Jahres gewählt wurde. Anschließend arbeitete er wieder als freier Regisseur und inszenierte am Wiener Burgtheater, am Düsseldorfer Schauspielhaus, am Maxim Gorki Theater Berlin und am Thalia Theater Hamburg. Seine Inszenierungen waren mehrfach zum Berliner Theatertreffen eingeladen, zuletzt 2011 „Die Beteiligten“ von Kathrin Röggla. 2013 erhielt er den österreichischen Nestroy-Theaterpreis für Elfriede Jelineks „Winterreise“ am Burgtheater Wien. Seit der Spielzeit 2013/2014 ist Stefan Bachmann Intendant am Schauspiel Köln. Am Staatsschauspiel Dresden inszenierte er bereits Harry Mulischs „Das steinerne Brautbett“ und Schillers „Der Parasit“. Philipp Lux 25 Lea Ruckpaul 26 Ahmad Mesgarha 27 Die Premieren im Kleinen Haus Wir sind keine Barbaren! von Philipp Löhle Premiere am 14. September 2014 im Kleinen Haus 1 Regie: Barbara Bürk p Bühne: Anke Grot p Kostüm: Irène Favre de Lucascaz Merlin oder Das wüste Land von Tankred Dorst Ein Weltentwurf mit Dresdner Jugendlichen Premiere am 27. September 2014 im Kleinen Haus 2 Eine Produktion der Bürgerbühne Regie: Kristo Šagor p Bühne: Alexandre Corazzola p Kostüm: Justina Klimczyk Neben Barbara und Mario sind neue Mieter eingezogen. Linda und Paul werden bald zu gern gesehenen Nachbarn. Die Frauen reden über Yoga, und die Männer finden vor dem Flachbildschirm zusammen. Doch als eines Tages ein Fremder im Haus auftaucht, den Linda und Paul sofort abweisen, ist es vorbei mit dem freundschaftlichen Miteinander. Barbara nimmt den Mann kurz entschlossen bei sich auf. Es ist doch klar, dass er, der Klint oder Bobo heißt, ein Asylsuchender aus Afrika ist – oder war es nicht doch Asien? –, dass er auf jeden Fall Hilfe braucht, weil er in seiner Heimat Entsetzliches erlitten hat. Klints/Bobos wahre Identität wird ein Geheimnis bleiben, man wird sich bis zum Schluss nicht darüber einig, ob er schwarz ist, braun oder doch Mandelaugen hat. Der fremde Besucher wird zum Sinnbild für die Entrechteten und Beleidigten dieser Welt. Die Begegnung mit einem von ihnen löst bei den Wohlstandsbürgern Abwehr, Schuldgefühle oder erotische Sehnsüchte aus. In witzigen und schnellen Dialogen entlarvt das Stück die gesteigerte Hysterie im Angesicht des Unbekannten. Erstmals stellen wir in Dresden den Dramatiker Philipp Löhle vor. Seit er 2007 mit seinem Debüt „Genannt Gospodin“ auf sich aufmerksam gemacht hat, stehen seine Texte auf den Spielplänen vieler Häuser im deutschsprachigen Raum. Er wurde mehrfach ausgezeichnet, für den Mülheimer Dramatikerpreis nominiert und war Hausautor am Maxim Gorki Theater in Berlin, am Nationaltheater Mannheim und am Staatstheater Mainz. Arved Schultze denkt über den großen Fremden Winnetou und die Gefahr von Gleichheit nach p Seite 70 Tankred Dorsts „Merlin“ hat die epischen Dimensionen einer Kinotrilogie oder einer TV-Serie: überbordendes Dramenmaterial aus 97 Szenen. Das ist nur angemessen, denn Merlin erzählt vom Entstehen und Vergehen einer ganzen Welt. Einer Welt, in der sich christliche und keltische Sagen tief durchdringen, in der die Gegenwart durch ein fantastisches Mittelalter schimmert. Merlins Vater ist der Teufel. Er beauftragt seinen Sohn, die Menschen „zum Bösen zu befreien“. Doch Merlin verweigert seinem Erzeuger den Gehorsam und animiert stattdessen Artus zur Gründung der Tafelrunde. Als König sucht dieser die ritterlichen Tugenden mit der Idee der Demokratie zu verbinden. Angezogen vom Gral als höchstem Ziel, versuchen die Ritter, etwas Bleibendes zu schaffen. Doch sie scheitern an ihren Ambitionen, an den Frauen und an der nächsten Generation, die sich weigert, die Utopien ihrer Väter, deren Moral und Manieren zu übernehmen. So geht das Artusreich unter. Gemeinsam mit dem Regisseur Kristo Šagor untersuchen Dresdner Jugendliche die große Saga um König Artus sowie die Fragen nach dem Sein und dem Werden, die Tankred Dorst darin aufwirft. Welche Utopien übernehmen wir von unseren Eltern? Wie sieht eine ideale und gerechte Gesellschaft aus? Und welche Aufgaben haben Helden heute? Die Kindheit war gestern, die Zeit der großen Weltentwürfe ist jetzt! Von der Bürgerbühne als international erfolgreichem Theatermodell lesen Sie auf p Seite 72 Barbara Bürk wurde in Köln geboren und studierte Regie an der Theaterakademie in Ulm. Sie inszenierte u. a. am Theater Basel, am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, am Schauspiel Hannover, am Theater Freiburg und am Hans Otto Theater in Potsdam. Eine lange Zusammenarbeit verbindet sie mit dem Autor Lutz Hübner, ihre Inszenierung von „Hotel Paraiso“ wurde beim Berliner Theatertreffen 2005 gezeigt. 2012 wurde Barbara Bürk für ihre Inszenierung von Lewis Carrolls „Alice im Wunderland“ am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg mit dem Theaterpreis „Der Faust“ ausgezeichnet. Am Staatsschauspiel Dresden inszenierte sie bereits die Lutz Hübner-Uraufführungen „Frau Müller muss weg“ und „Was tun“ sowie Falladas „Kleiner Mann, was nun?“, Brechts „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ sowie Horváths „Geschichten aus dem Wiener Wald“. Kristo Šagor wurde 1976 in Niedersachsen geboren. Er studierte Linguistik, Literatur- und Theaterwissenschaft an der FU Berlin und am Trinity College Dublin. Seinen Durchbruch als Autor schaffte er 2000 mit „Durstige Vögel“ am Schauspielhaus Bochum. Mit demselben Stück debütierte er 2002 am Volkstheater München als Regisseur. Von 2002 bis 2004 war er Hausautor am Theater Bremen. Seine Stücke wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Publikumspreis des Heidelberger Stückemarktes. Er inszenierte u. a. am Schauspielhaus Hamburg, am Schauspielhaus Bochum, am Nationaltheater Mannheim, am Schauspiel Stuttgart und am Schauspiel Hannover. 2007 entstand unter seiner Regie die Uraufführung von Philipp Löhles „Genannt Gospodin“, mit der er zu den Mülheimer Theatertagen eingeladen wurde. 2008 erhielt er den Theaterpreis „Der Faust“ in der Kategorie Beste Regie im Kinder- und Jugendtheater für seine In­szenierung von Robert Musils „Törleß“. Darüber hinaus hat Kristo Šagor Lehraufträge für Dramatisches Schreiben an der Universität Hildesheim und der Zürcher Hochschule der Künste. 28 Zwischenspiel nach dem Roman von Monika Maron Uraufführung am 5. Oktober 2014 im Kleinen Haus 3 Regie: Malte Schiller Miss Sara Sampson Bürgerliches Trauerspiel von Gotthold Ephraim Lessing Premiere am 1. November 2014 im Kleinen Haus 1 Regie: Sebastian Kreyer p Bühne: Thomas Dreissigacker p Kostüm: Maria Roers Irgendwie ist dieser Morgen anders. Erst zieht eine einzelne Wolke am Himmel in die entgegengesetzte Richtung, dann sitzt plötzlich die tote Schwiegermutter Olga im Sessel, zu deren Beerdigung Ruth an diesem Tag fahren will. Auf dem Weg zum Friedhof verfährt sie sich denn auch gründlich, und als in dem Park, in dem sie landet, Olga neben ihr auf der Bank Platz nimmt, wundert sie sich eigentlich kaum noch. Im Gespräch mit der Toten, zu der sich bald ein weiterer gesellt, tastet sich Ruth langsam zurück in die Vergangenheit und stellt sich die Fragen nach Schuld und Verantwortung vielleicht zum ersten Mal wirklich – in privatem, künstlerischem und politischem Zusammenhang. Hat auch sie sich vielleicht schuldiger gemacht, als sie dachte? Und wie hätte die richtige Wahl zwischen zwei falschen Entscheidungen ausfallen können? Mit Klugheit, Sanftmut und feinem Humor schickt Monika Maron ihre Protagonistin auf eine Reise in ihre Vergangenheit und ihr eigenes Unterbewusstes. Die 1941 geborene Autorin, die in der ddr aufwuchs und 1989 in die brd emigrierte, fragt in ihrem jüngsten Roman nach den Konsequenzen von Entscheidungen und nach der bisweilen gewagten oder geschönten Konstruktion einer eigenen Biografie. 25 Jahre nach dem Ende der ddr kreisen diese Fragen immer noch wie Gespenster um die (Über-)Lebenden, verfolgen sie, prägen sie und lassen sie nicht los. Und 25 Jahre friedliche Revolution, Mauerfall und Wende bieten eine Gelegenheit, sie erneut ins Zentrum zu rücken. Monika Marons Debüt „Flugasche“ wurde wie ihre folgenden Bücher (u. a. „Das Missverständnis“ und „Stille Zeile Sechs“) vom Fischer Verlag in Frankfurt am Main veröffentlicht, sodass sie bereits vor 1989 auch einem westdeutschen Publikum bekannt wurde. Zuletzt erschienen von ihr „Bitterfelder Bogen. Ein Bericht.“ sowie „Zwei Brüder: Gedanken zur Einheit 1989 – 2009“. Der Literaturredakteur Michael Hametner über „Zwischenspiel“ als Totenbeschwörung p Seite 73 Sara verlässt ihren liebenden Vater und brennt mit ihrem Geliebten Mellefont durch. Der steigt mit ihr in einem Gasthof ab, kann sich aber nicht entschließen, den nächsten Schritt zu tun, nämlich Sara zu heiraten. Die Wochen vergehen, Sara verzweifelt und Mellefont zaudert. Als der unentschiedene Verführer schließlich in Gestalt der Marwood, seiner verlassenen Geliebten, von der Vergangenheit heimgesucht wird, entspinnt sich eine Dreiecksgeschichte voller Leidenschaft, Hass und Begehren, an deren Ende zwei der liebeskranken Herzen zu schlagen aufhören. Und als die Katastrophe wirklich nicht mehr abzuwenden ist, taucht auch noch Saras Vater in der Absteige auf, um seiner Tochter unter Tränen zu vergeben. Lessing brachte mit „Miss Sara Sampson“ 1755 das erste bürgerliche Trauerspiel der deutschen Literatur auf die Bühne. Darin behauptet sich das Bürgertum dem Adel gegenüber erstmals als selbstbewusster, ernst zu nehmender Stand. Die beginnende Emanzipation von Religion und Politik wird spürbar, individuelle Glücksansprüche befeuern ein neues bürgerliches Selbstbewusstsein, und die Liebe ist plötzlich die entscheidende Kraft, wenn es darum geht, eine Ehe, eine Familie oder einen Staat zu führen. Bis heute hat dieses Gefühl den höchsten Stellenwert in unserem Leben – das über 250 Jahre alte Drama macht dies zwischen den Zeilen voll schwärmerischer Rhetorik sichtbar. Lessing schickt seine Männer und Frauen unter dem Banner der Liebe in einen Kampf um Vernunft und Leidenschaft, Besonnenheit und Gier, der mal komisch und dann wieder tieftragisch ist. Seine Sara, die ihre Liebe über alles stellt, und sein Mellefont, der glaubt, dass irgendwo immer eine noch schönere, bessere, noch perfekter passende Möglichkeit wartet, finden auch heute viele Schwestern und Brüder im Geiste. Die Autorin Dagrun Hintze sucht Sara Sampsons heutige Gestalt p Seite 78 Malte Schiller wurde 1983 bei Hamburg geboren. Er studierte Germa­ nistik und Geschichte in Göttingen, wo er erste Theatererfahrungen am Jungen Theater Göttingen und in der Offszene sammelte. Anschließend assistierte er am Deutschen Theater Berlin. Seit der Spielzeit 2012/2013 ist Malte Schiller Regieassistent am Staatsschauspiel Dresden. Hier arbeitete er u. a. mit den Regisseuren Tilmann Köhler, Armin Petras, Barbara Bürk und Thomas Birkmeir zusammen. In der Spielzeit 2013/2014 richtete er E. T. A. Hoffmanns „Der Sandmann“ im Kleinen Haus 3 ein. Außerdem ist er mitver-antwortlich für die Theaterreihe „Schund Royal – Bibliothek der billigen Gefühle“. Sebastian Kreyer wurde 1979 in Hannover geboren. Er studierte Theaterwissenschaft, Philosophie und Soziologie in Leipzig und Berlin. Neben seinem Studium war er als Dozent für kulturelle Bildung an der Volkshochschule und als freier Verlagsmitarbeiter in Berlin tätig. Anschließend arbeitete er als Regieassistent am Schauspiel Köln mit Karin Beier, Karin Henkel und Herbert Fritsch. Mit seiner Inszenierung von Tennesse Williams’ „Die Glasmenagerie“ am Schauspiel Köln wurde er 2013 zum Festival „Radikal jung“ nach München eingeladen. Weitere Arbeiten führten ihn u. a. an das Volkstheater München, das Theater Kassel und das Theater Bonn. 29 mein deutsches deutsches Land von Thomas Freyer Uraufführung am 27. November 2014 im Kleinen Haus 2 Regie: Tilmann Köhler p Bühne: Karoly Risz Katzelmacher von Rainer Werner Fassbinder Erzählt von jungen Dresdnerinnen und Dresdnern Premiere am 12. Dezember 2014 im Kleinen Haus 3 Eine Produktion der Bürgerbühne Regie, Video und Raum: Robert Lehniger p Kostüm: Irene Ip Ein derartiges Verbrechen, wie es die jahrelange Mordserie Rainer Werner Fassbinder (1945–1982) gilt als der bedeudes nsu war, wird es in diesem Land nicht mehr geben? tendste Vertreter des Neuen Deutschen Films der 1970erWeil wir seitdem gewarnt sind vor dem rechten Terror, den und 1980er-Jahre, dem er auch international zum Durchwir in diesem Ausmaß schon vor den Morden nicht für bruch verhalf. Sein kritischer und gleichzeitig liebevoller möglich hielten? Weil wir jetzt die Zeichen früh erkennen? Blick auf die Menschen und ihre Lebenswelten erreicht den Uns nicht mehr sicher fühlen? Weil wir nach der Aufarbei- Zuschauer bis heute. tung dieser Mordserie bereits die Anfänge des Terrors „Katzelmacher“ ist ein Schimpfwort aus dem süddeutschen erkennen? Und weil wir wissen, dass wir an ähnlichen Raum. Musikanten, fahrenden Händlern und in den 1960erTaten nicht mehr vorbeischauen werden, auch wenn sie in Jahren schließlich Gastarbeitern wurde vorgeworfen, als streunende Kater unterwegs zu sein und einheimische einem anderen Gewand daherkommen? Die Theaterserie „mein deutsches deutsches Land“ blickt Frauen zu schwängern. Als Rainer Werner Fassbinder 1968 in sechs ineinandergreifenden Episoden durch die Augen das Stück schrieb, waren die ersten Gastarbeiter in Westder Täter. Durch die Augen derer, die nicht vom Rand, deutschland angekommen. sondern mitten aus unserer Gesellschaft kommen. Wir Jorgos, der Grieche, wird für die orientierungslose Jugend begleiten den Hass dreier Menschen. Sehen, wie sie aufein- in einem Vorort von München zur Zielscheibe ihrer Aggresandertreffen. Sehen, wie der Plan entsteht, ihren Hass zu sionen und Vorurteile. Man neidet ihm den Erfolg bei den Mädchen und heizt Gerüchte an, um ihn zu kriminalirichten. Und sehen dabei ein Land, das uns fremd ist. Warum wir uns zu sicher fühlen. Warum wir vorbeischauen sieren. „Traut sich daher und ist ein so einer. Verboten werden. Und warum wir die Zeichen nicht erkennen, ob- gehört er!“ Für Moral und Ehre tut man sich zusammen wohl wir doch wissen müssten, wie Hass entsteht und wo und rechnet in einer Schlägerei mit dem Außenseiter ab. Fassbinder vermeidet dabei das Märtyrerstück: Als Jorgos er sich entlädt. Hausregisseur Tilmann Köhler blickt auf p Seite 80 auf seine lang- erfährt, dass er einen türkischen Kollegen bekommen wird, jährige Zusammenarbeit mit dem Dramatiker Thomas Freyer zurück reagiert er mit ebenjenen Vorurteilen, deren Opfer er selbst wurde. Der Kreislauf subtiler und offener Gewalttätigkeit schließt sich. Eine ausländerfeindliche Einstellung ist in Westdeutschland ein Problem der älteren Jahrgänge, in Ostdeutschland vor allem eines der Jugend. Zu diesem Schluss kommt die Studie „Rechtsextremismus der Mitte“ der Universität Leipzig aus dem Jahr 2013. Fast 75 % der Westdeutschen, aber nur gut 36 % der Ostdeutschen haben Kontakt zu Migranten. Gruppen ohne solche Kontakte zeigen eine deutlich höhere Ausländerfeindlichkeit. Fassbinders Thema bleibt präsent. Vier Theatermacher berichten von ihrer Bürgerbühne p Seite 72 Tilmann Köhler ist seit 2009 Hausregisseur am Staatsschauspiel Dresden und durch eine langjährige Zusammenarbeit mit Thomas Freyer verbunden. Er brachte die meisten seiner Stücke, wie u. a. 2007 „Separatisten“ in Berlin, 2008 „Und in den Nächten liegen wir stumm“ in Hannover sowie 2011 „Das halbe Meer“ am Staatsschauspiel Dresden zur Uraufführung. Weitere biografische Informationen lesen Sie auf p Seite 20 30 Robert Lehniger wurde 1974 in Weimar geboren und studierte Mediengestaltung an der Bauhaus-Universität Weimar. Er produzierte zunächst Videos und Filme für Inszenierungen u. a. von Stefan Bachmann, Lars-Ole Walburg und Stefan Pucher, bevor er 2001 selbst zu inszenieren begann. Seine Regiearbeiten bewegen sich an der Schnittstelle von Theater und Neuen Medien mit einem Schwerpunkt auf Romanadaptionen und Filmstoffen. Eigene Inszenierungen entstanden u. a. am Schauspielhaus Zürich, am Schauspiel Frankfurt, an den Münchner Kammerspielen, an der Volksbühne Berlin, am Burgtheater Wien und am Schauspiel Hannover. 2008 wurde er mit dem Projekt „Friday, I’m in love“ zum Festival „Radikal jung“ nach München eingeladen. „Der Ring: Next Generation“ war 2013 an der Deutschen Oper Berlin zu sehen. Am Staatsschauspiel Dresden inszenierte er in der vergangenen Spielzeit die Uraufführung „Schneckenmühle“ von Jochen Schmidt. Die Panne Komödie von Friedrich Dürrenmatt Premiere im Januar 2015 im Kleinen Haus 1 Regie: Roger Vontobel p Kostüm: Ellen Hofmann Superhirn oder Wie ich die Photonenklarinette erfand von Clemens Sienknecht Uraufführung im Februar 2015 im Kleinen Haus 3 Regie und Musik: Clemens Sienknecht p Bühne und Kostüm: Anke Grot Alfredo Traps, reisender Textilienvertreter, hat eine Autopanne und muss seine Heimreise unterbrechen. In einem nahe gelegenen Örtchen findet er für eine Nacht Unterkunft bei einem älteren Herrn. In dessen Haus hat sich an jenem Abend eine gesellige Runde eingefunden, der Traps sich fröhlich anschließt. Bald wird klar, dass er Teil einer Spielrunde geworden ist. Seine Gastgeber sind allesamt in ihrem Berufsleben Angestellte der Justiz gewesen. Der Hausherr war Richter, seine Gäste sind ein ehemaliger Staatsanwalt, ein Verteidiger und der Henker des Ortes. Nur der Angeklagte fehlt. Diese Rolle übernimmt Traps. Der lässt sich auf das Spiel ein, ist er sich doch keinerlei Schuld bewusst. Doch als die alten Herren ihn im Spiel befragen, treten Dinge zutage; der Alkohol tut schließlich sein Übriges, um Traps in heillose Verwirrung zu stürzen. Am Ende des Abends liegt ein Todesurteil auf dem Tisch, und die Grenzen des Spiels sind verwischt. Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) gehört zu den bedeutendsten schweizerischen Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Das Tragisch-Groteske zieht sich durch sein dramatisches Werk ebenso wie durch die Prosa. Auch „Die Panne“ steht in einer Tradition von Texten, die an der Grenze zwischen Tragödie und Satire die Untiefen der bürgerlichen Seele ausleuchten. Gedanken zum Genre der Groteske von Klaus C. Zehrer finden Sie auf p Seite 81 Clemens Sienknecht hat die Häschenorgel erfunden, das wissen die wenigsten. Er kann Goldfische pürieren, ohne dabei aus dem Takt zu kommen. Er entlockt Gegenständen Musik, denen andere nicht einmal einen Ton entlocken. Er hat ein Faible für Brillen und für unvorteilhafte Kleidung. Er ist entfernt verwandt mit Jacques Tati und Loriot und ist mit Stan Laurel und Oliver Hardy zur Schule gegangen. Clemens Sienknechts musikalische Theaterabende sind seltsame, virtuose Gratwanderungen zwischen Feinsinn und grobem Unfug. Er schafft – immer auch selbst auf der Bühne stehend – einen ganz eigenen, hochkomischen und traurig-schrägen Kosmos, in dem sich die eigenartigsten Zeitgenossen tummeln. Verstaubte Vinylfetischisten, einsame Kleintierliebhaber, Radiomenschen und geniale Irre. In Dresden, der Stadt der Ingenieure, wird er ein selbstgebasteltes Universum für Tüftler, Frickler, Genies und Superhirne entstehen lassen. Einen Text, in dem Clemens Sienknecht nicht beschreibt, wie er die Photonenklarinette erfand, finden Sie auf p Seite 84 Roger Vontobel inszenierte am Staatsschauspiel Dresden Schillers „Don Carlos“, Kleists „Der zerbrochne Krug“ und Shakespeares „Hamlet“. Ausführliche biografische Informationen finden Sie auf p Seite 20 Clemens Sienknecht wurde 1964 in Hamburg geboren. Er studierte zunächst Sport und Musik auf Lehramt, bevor er in verschiedenen Bands zu spielen begann. Es folgten Engagements als Theatermusiker. Seit 1993 verbindet ihn eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit Christoph Marthaler, in dessen Inszenierungen er häufig als Bühnenmusiker zu sehen ist, so u. a. in „Schutz vor der Zukunft“, „Platz Mangel“ und „Riesenbutzbach. Eine Dauerkolonie“, alle drei Inszenierungen wurden zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Sein erster eigener Liederabend entstand 1999 unter dem Titel „Letzte Lieder“ am Theater Basel. Weitere musiktheatralische Projekte inszenierte er am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, am Schauspiel Köln, am Schauspiel Hannover sowie am Schauspielhaus Zürich. Zuletzt entstand am Schauspiel Köln unter seiner Regie der Liederabend „Werner Schlaffhorst – Ein Leben, zu wahr, um schön zu sein“. 31 André Kaczmarczyk 32 Anna-Katharina Muck 33 Christian Friedel 34 Mischpoke Eine jüdische Chronik von 1945 bis heute Uraufführung im Februar 2015 im Kleinen Haus 3 Eine Produktion der Bürgerbühne Regie: David Benjamin Brückel p Text: Dagrun Hintze p Bühne und Kostüm: Jeremias Böttcher Ein neuer Text Uraufführung im März 2015 im Kleinen Haus 2 Regie: Jan Gehler Von den ehemals mehr als 7 000 Juden in Dresden und Umgebung lebten im Mai 1945 noch rund siebzig in der Stadt. Siebzig Jahre später zählt die Jüdische Gemeinde an die 700 Mitglieder und hat sich in ihrer Struktur stark verändert. Im Rahmen des Rechercheprojektes „Mischpoke“ lassen jüdische Bürger verschiedener Generationen ihr Leben zwischen 1945 und 2015 in Form einer Chronik Revue passieren. Sie kommen aus der ehemaligen Sowjetunion, aus den usa oder aus Deutschland. Heute leben sie in Dresden. Auf der Bühne erzählen sie von einem Land im Jahre null, vom Aufwachsen in der ehemaligen ddr als Kinder von Überlebenden, von Diffamierungen als „wurzellose Kosmopoliten“ unter Stalin und von ihrem Alltag als moderne Europäer. Gemeinsam bilden sie ein Panorama jüdischer Identitäten in den letzten siebzig Jahren, eine „Mischpoke“. Das ursprünglich jiddische Wort bedeutet „Familie“, im erweiterten Sinne auch „verschworene Gemeinschaft“, „Gesellschaft“ oder „Gruppe“. Ihre Geschichten handeln nicht nur von zerstörten Stammbäumen und dem langen Schatten der Shoah, sondern auch von Neubeginn und Zuversicht. Von Tradition und Erneuerung. Von Wandel und Widersprüchlichkeit. Von Diversität und Subkultur. Stereotypen Zuschreibungen von außen werden selbstbestimmte jüdische Innensichten entgegengesetzt. Biografische Erfahrungen werden verknüpft mit Geschichten und Motiven aus der Musik, die noch einmal die ganze Palette des Jüdischseins beinhalten: von Verfremdungsklezmer über chassidischen Punk bis hin zu Radical Jewish Culture, einer avantgardistischen jüdischen Musikbewegung, die sich gegen Angepasstheit und gesellschaftliche Unauffälligkeit wendet. Die Bürgerbühne erweist sich als internationales Erfolgsmodell. Mehr dazu auf p Seite 72 Jan Gehler ist ein Spezialist für die leisen Töne, für das Behutsame. Seit der Spielzeit 2013/2014 ist er Hausregisseur am Staatsschauspiel Dresden. Schon zuvor war er dem Haus als Regieassistent verbunden und arbeitete u. a. mit Armin Petras, Sebastian Baumgarten und David Marton. 2011 inszenierte er erstmals selbst in Dresden, zunächst Robert Walsers „Jakob von Gunten“. Kurz darauf landete er mit seiner Uraufführung von Wolfgang Herrndorfs „Tschick“ einen Sensationserfolg. Die Inszenierung wurde vielfach eingeladen und mit Preisen ausgezeichnet. Inzwischen gehört „Tschick“ zu den meistgespielten zeitgenössischen Stücken und wurde an mehr als fünfzig Theatern im Inund Ausland nachgespielt. Jan Gehler arbeitete seither u. a. am Volkstheater München, am Maxim Gorki Theater Berlin und am Theater Freiburg. In Dresden zeigte er außerdem „Aus dem Leben eines Taugenichts“ von Eichendorff und „Supergute Tage“ von Mark Haddon und Simon Stephens. Jan Gehler hat in seiner Arbeit zu einem eigenen Stil gefunden, der sich als roter Faden durch seine Inszenierungen zieht. Es ist ein sehr zärtlicher, empathischer Blick auf die Figuren und ihre Motive. Seine Regie geht einfühlsam mit ihrem Personal um, egal welche Motive es sind, die die Figuren treiben. Es ist eine Interpretationsweise, die Freiraum gibt und die den Zweifel, die andere Möglichkeit, immer miterzählt. Einen von Jan Gehler ausgefüllten Theaterfragebogen finden Sie auf p Seite 85 David Benjamin Brückel wurde 1982 in Freiburg im Breisgau geboren und wuchs in der Schweiz auf. Von 2002 bis 2006 studierte er Theater-, Film- und Medienwissenschaft sowie Cultural Studies an der Universität Wien. Bereits während des Studiums arbeitete er regelmäßig als Regieassistent an verschiedenen Theatern im deutschsprachigen Raum und ging in dieser Funktion 2006 an das Schauspiel Hannover. Dort inszenierte er in der Spielzeit 2008/2009 „hamlet ist tot. keine schwerkraft“ von Ewald Palmetshofer. Es folgten Regiearbeiten am Staatsschauspiel Dresden, auf dem Brecht Festival in Augsburg, am Staatstheater Saarbrücken, am Stadttheater Bern sowie am Heimathafen Neukölln. Seit der Spielzeit 2013/2014 ist David Benjamin Brückel Dramaturg und Produktionsleiter an der Bürgerbühne des Staatsschauspiels Dresden. Dort inszenierte er 2009 bereits die Uraufführung „Alles auf Anfang! Fünf Dresdner lassen sich neu erfinden“. Jan Gehler wurde 1983 in Gera geboren und studierte Szenische Künste an der Universität Hildesheim. In der Saison 2014/2015 inszeniert er am Staatsschauspiel außerdem Shakespeares „Wie es euch gefällt“ p Seite 22 35 Soldaten Ein Dokumentartheater über Helden, Heimkehrer und die Zukunft des Krieges Uraufführung im März 2015 im Kleinen Haus 3 Eine Produktion der Bürgerbühne in Kooperation mit dem Militärhistorischen Museum Dresden Regie: Clemens Bechtel Alles im Fluss Ein Projekt über die Elbe und den Wandel der Zeit Uraufführung im April 2015 im Kleinen Haus 3 Eine Produktion der Bürgerbühne Regie: Uli Jäckle Krieg erleben die meisten Menschen in Deutschland nur als medial vermittelte Wirklichkeit. Einige immerhin üben in der Bundeswehr für den „Ernstfall“, wenige andere haben den Krieg wirklich kennengelernt: die ältesten noch vor 1945, die jüngeren erst vor Kurzem, beispielsweise in Afghanistan. Für den Rest bleiben die Bilder: aus Syrien, aus entlegenen Provinzen im Kaukasus, aus Spielfilmen oder vom Computer. Aber hat diese virtuelle Wirklichkeit mit der Lebensrealität von Bundeswehrsoldaten etwas zu tun? Wer und was sind Soldaten heute? Wie unterscheiden sich die Dienste in der Bundeswehr vor ’89, in der nva oder in einer Rebellenarmee etwa in Sierra Leone? Was haben Drohnenangriffe im 21. Jahrhundert noch mit den Schützen­ gräben der Weltkriege zu tun? Bedeuten heute klassische militärische Tugenden wie Ehre, Gehorsam, Heldentum noch etwas? Nur wenige deutsche Städte sind historisch so stark vom Militär geprägt wie Dresden: Die Offiziersschule, in der immer noch ausgebildet wird, der Bombenangriff 1945, zahlreiche ehemalige Kasernen in der Albertstadt, das Militärhistorische Museum und die Sowjetarmee, die zwischen 1945 und 1989 hier stationiert war – all das hat Spuren hinterlassen. Gemeinsam mit Dresdner Soldaten erzählen wir, wie der Wehrdienst sie geprägt hat, was Soldat sein gestern und heute bedeutet und morgen bedeuten könnte. Über die Arbeit anderer Bürgerbühnen von Berlin bis Aalborg berichten deren Leiter auf p S­ eite 72 Alles fließt: die Elbe, Tränen, elektrischer Strom, Körpersäfte, die Zeit, das ganze Leben. Alles bewegt sich fort, nichts bleibt. Der Fluss ist eine Metapher für die Prozessualität der Welt, für das Dynamische des Lebens, das ewige Werden und den stetigen Wandel. Oder wie Goethe es ausdrückt: „Ach, und in dem selben Flusse schwimmst du nicht zum zweitenmal.“ Mit dem Phänomen Fluss beschäftigen sich Menschen, seit sie existieren. Die einen eher abstrakt oder metaphorisch als Dichter, Philosophen oder Komponisten, die anderen ganz konkret als Wasserversorgungstechniker, Kanalbauer oder Naturschützer. Flüsse sind heilig, und um Flüsse gibt es Kriege. Wer Glück hat, wohnt in der Nähe eines Flusses und kann an ihm spazieren gehen. Wer Pech hat, der erleidet einen Hochwasserschaden. Der Regisseur des Landschaftstheaters in ReinhardtsdorfSchöna, Uli Jäckle, wirft gemeinsam mit Dresdnern und Bewohnern der Sächsischen Schweiz einen Blick auf Flüsse, die uns verbinden: auf die Elbe und auf das Werden und den Wandel des Lebens. Uli Jäckles Inszenierung ist der letzte Teil einer Trilogie, die sich zum Ziel gesetzt hatte, kulturelle Verbindungslinien zwischen Dresden und der Sächsischen Schweiz zu ziehen. In den vorangegangenen Spielzeiten waren „Der Fall aus dem All“ und „Wildnis“ auf großen Zuspruch gestoßen. Vier Perspektiven auf vier Bürgerbühnen finden Sie auf p S­ eite 72 Clemens Bechtel, geboren 1964 in Heidelberg, studierte an der Universität Gießen Angewandte Theaterwissenschaft. Er inszenierte u. a. in Deutschland, der Schweiz, Ungarn, Rumänien, Dänemark sowie in Mali und Malawi. Seine Inszenierung „Staatssicherheiten“ am Hans Otto Theater in Potsdam, in der 15 ehemalige Häftlinge über die Gefängnisse der Staatssicherheit berichten, wurde mit dem Friedrich-Luft-Preis 2009 als beste Inszenierung in Berlin und Brandenburg ausgezeichnet. Zuletzt inszenierte Clemens Bechtel Verdis „Requiem“ an der Oper Köln, ein Projekt über Entwicklungshilfe am Nanzikambe Theatre in Blantyre, Malawi, sowie „Global Players“, ein Projekt über die Folgen der Globalisierung, das am Landestheater Tübingen entstand. In der Spielzeit 2013/2014 übernahm Clemens Bechtel die künstlerische Leitung des internationalen Projekts „Hunger for Trade“ am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, wo er auch den deutschen Beitrag des Projekts „Cargo Fleisch“ inszeniert. Am Staatsschauspiel brachte er die Bürgerbühnenproduktion „Meine Akte und ich“, eine Recherche über die Staatssicherheit in Dresden, heraus. Uli Jäckle wurde 1961 geboren und arbeitet seit 1993 als freier Regisseur. Er hat an den Theatern in Frankfurt, Stuttgart, Freiburg, Hamburg und Hildesheim über achtzig Stücke inszeniert. Bekannt wurde Uli Jäckle mit seiner freien Gruppe aspik und seinen Landschaftstheaterprojekten, in denen er mit Hunderten von Laiendarstellern ländliche und städtische Räume inszeniert. Seit 1999 nimmt er unterschiedliche Lehraufträge wahr, u. a. an der Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel und den Schauspielschulen Bern, Zürich und Verscio. Seit 2010 ist Uli Jäckle Professor im Fach „Kunst in Aktion“ an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig. An der Bürgerbühne des Staatsschauspiels Dresden inszenierte er „Eins, zwei, drei und schon vorbei. Ein Spiel vom Anfang und Ende der Dinge“ und die Landschaftstheater-Projekte mit Bewohnern der Sächsischen Schweiz „Der Fall aus dem All“ und „Wildnis“. 36 Alle meine Söhne von Arthur Miller Premiere im Mai 2015 im Kleinen Haus 1 Regie: Sandra Strunz Die Bergwanderung oder Sexualität heute von Martin Heckmanns Uraufführung im Juni 2015 im Kleinen Haus 2 Krieg ist immer für alle, Unschuldige lässt er nicht zurück. Drei Elternpaare treffen sich zu einem Problemgespräch. Das ist die bittere Erkenntnis, die Arthur Millers Stück Ihre Kinder sind zum zweiten Mal gemeinsam unterwegs „Alle meine Söhne“ aus dem Jahr 1947 eingeschrieben ist. auf einer Bergwanderung. Das ist nicht das Problem. Aber Von Schreibtischtätern erzählt Miller, von Schuldverdrän- der Gesamtschullehrer Michael Küster und seine Frau Hanne haben auf dem Computer ihrer Tochter einen Film gung und davon, wie sie die Menschen wieder einholt. Josef Keller hat es weit gebracht. Er lebt mit seiner Frau im entdeckt, der die Jugendlichen am Ende der ersten WandeWohlstand, den er seiner Fabrik verdankt. Im Weltkrieg hat rung bei sexuellen Aktivitäten in der Berghütte zeigt. Im er die amerikanische Luftwaffe mit Zylinderköpfen versorgt Gespräch mit den betroffenen Eltern soll nun eine gemein– das hat ihm Geld und gesellschaftliches Ansehen gebracht. same Strategie entwickelt werden, wie die Kinder bei ihrer Dass sein Sohn Larry im Krieg in seinem Kampfflugzeug Rückkehr empfangen und über Sexualität und Internet aufums Leben kam, bietet dem Vater die Gelegenheit, die Rolle geklärt werden können. Dabei zeigt sich vor allem, wie die Beziehungsmodelle des vom Schicksal gebeutelten Patrioten einzunehmen. Doch der alte Keller hat Leichen im Keller. Er trägt die der Eltern alternieren und konkurrieren und wie schnell Schuld am Tod von 21 Soldaten, deren Flugzeuge aufgrund das Unverständnis für abweichendes Verhalten in Verachvon fehlerhaften Bauteilen abstürzten. Keller hat die Ver- tung und Verbote umschlägt. Das Gastgeberehepaar ist in antwortung dafür seinem Geschäftspartner Steve Deever Therapie, die Sängerin und der Musiktherapeut führen anhängen können. Deever sitzt seitdem im Gefängnis. So eine offene Beziehung und erzählen einander von ihren hat sich Keller sein Leben in der amerikanischen Vorstadt Seitensprüngen, und der Unternehmensberater tauscht seine Partnerin regelmäßig gegen eine jüngere aus. Als am eingerichtet und sein Gewissen ruhiggestellt. Bis seine Verbrechen ans Licht kommen und mit ihnen ein Ende die Tochter des Hauses vom Ausflug zurückkehrt, ist die Mutter betrunken, die Wohnung in Unordnung, weiteres dunkles Geheimnis der Familie Keller … Arthur Miller, 1915 in New York geboren, avancierte in den und der Unternehmensberater sucht seine Hose. Die ver1940er- und 1950er-Jahren zum wichtigsten amerikanischen sammelte Elternschar ist sich nicht einig geworden, und Dramatiker der Neuzeit. Seine Stücke wie „Hexenjagd“ und die Kinder sehen ein, dass sie es auf ihre eigene Weise „Tod eines Handlungsreisenden“ sind Plädoyers gegen den versuchen müssen. „american way of life“, gegen Raffgier und gesellschaftliche „Die Bergwanderung“ ist eine Komödie über die UnordKälte, denen er die ethische Verantwortung des Individu- nung des Begehrens, konkurrierende Sexualmoral und die Schwierigkeit, die Freiheit auszuhalten. ums und einen moralischen Humanismus entgegensetzt. Die Regisseurin Sandra Strunz über Verantwortung, Schuld und Einen ersten Auszug aus Martin Heckmanns’ neuem Stück finden Sie auf p ­Seite 87 Familien p Seite 86 Sandra Strunz, geboren 1968 in Hamburg, studierte Regie an der Hochschule der Künste in Hamburg. Sie arbeitete am Luzerner Theater, am Staatstheater Stuttgart, am Schauspiel Frankfurt, am Schauspiel Hannover, am Schauspiel Freiburg sowie am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Am Staatsschauspiel Dresden inszenierte sie bereits die Uraufführung von Dirk Lauckes „Für alle reicht es nicht“, die 2010 zu den Mülheimer Theatertagen eingeladen wurde. Außerdem führte sie hier Regie bei Tom Waits’ musikalischer Version von Büchners „Woyzeck“, der Uraufführung „Reckless II – Lebendige Schatten“ nach dem Roman von Cornelia Funke, der BürgerbühnenInszenierung „Die Zärtlichkeit der Russen“ von Dagrun Hintze sowie bei Lessings „Emilia Galotti“. Seit 2013 ist Sandra Strunz leitende Dozentin für Regie an der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg. Martin Heckmanns wurde 1971 in Mönchengladbach geboren. Er studierte Komparatistik, Geschichte und Philosophie. Neben Kurzprosa, die er in Zeitschriften und Anthologien veröffentlicht, schreibt er Theaterstücke, die bisher in mehr als zehn Ländern zur Aufführung gekommen sind. 2002 wurde er in der Kritikerumfrage der Fachzeitschrift „Theater heute“ zum Nachwuchsautor des Jahres gewählt. Für „Schieß doch, Kaufhaus!“ gewann er 2003, für „Kränk“ 2004 den Publikumspreis der Mülheimer Theatertage. Seine Stücke wurden bereits mehrfach zum Heidelberger Stückemarkt eingeladen, so u. a. 2007 „Wörter und Körper“ sowie 2008 „Kommt ein Mann zur Welt“. Am Staatsschauspiel Dresden war Martin Heckmanns von 2009 bis 2012 als Hausautor und Dramaturg tätig. Sein Theaterprolog „Zukunft für immer“ eröffnete die Spielzeit 2009/2010. Es folgte in der Saison 2011/2012 die Uraufführung von „Vater Mutter Geisterbahn“, die 2012 zu den Mülheimer Theatertagen und zum Heidelberger Stückemarkt eingeladen wurde. Zuletzt entstanden für das Schauspiel Stuttgart 2012 „Wir sind viele und reiten ohne Pferd“ sowie für das Schauspielhaus Bochum 2013 „Es wird einmal“. 37 Und außerdem … Theater zu Gast in Dresden In der Jubiläumsspielzeit des Schauspielhauses waren fünf der wichtigsten und traditionsreichsten Theater aus Deutschland, Österreich und der Schweiz am Staatsschauspiel Dresden zu Gast. Ein spannendes Theatertreffen eigens für das Dresdner Publikum, dessen positive Zuschauerresonanz uns angespornt hat, diese Reihe mit hochkarätigen Gastspielen renommierter Bühnen fortzusetzen. In der Spielzeit 2013/2014 haben das Deutsche Theater Berlin, die Münchner Kammerspiele, das Thalia Theater Hamburg und das Wiener Burgtheater ihre Inszenierungen in Dresden gezeigt. Auch in der Spielzeit 2014/2015 werden wir wieder ein Programm mit herausragenden Gastspielen u. a. aus Berlin, Stuttgart und Hamburg präsentieren. Eine Woche im Oktober. 25 Jahre friedliche Revolution Im Oktober 2014 jähren sich die entscheidenden Ereignisse zur Wende in Dresden zum 25. Mal: Am 4. Oktober 1989 passierten die Züge mit den ddr-Flüchtlingen aus der Prager Botschaft den Dresdner Hauptbahnhof, vor dem Ausreisewillige protestierten. Die Tage bis zum 9. Oktober waren geprägt von breitem Widerstand: Das Ensemble des Staatsschauspiels trug die berühmte Resolution „Wir treten aus unseren Rollen heraus“ vor, es gab Massendemonstrationen in der Prager Straße, die am 9. Oktober zu Gesprächen zwischen der „Gruppe der 20“ und der Stadtregierung führten. Ein Monat später, am 9. November 1989, fiel die Berliner Mauer – bis heute das Symbol für den Zusammenbruch eines ganzen Systems. Das Staatsschauspiel plant ein Festival, das das Kleine Haus eine Woche lang in ein Zentrum der Revolution verwandelt und sich den Tagen im Oktober 1989, dem Phänomen Revolution und der Frage nach lebbaren Modellen von Gesellschaft heute widmet: Wie sieht Revolution heute aus? Welche Formen von Protest sind möglich? Und wie klingen eigentlich die Forderungen von 1989 heute? Geplant sind u. a. die Uraufführung von Monika Marons „Zwischenspiel“, Vorträge, Diskussionsrunden, Filme, Konzerte und eine Vielzahl von performativen und theatralen Aktionen. Über die Zukunft des Theaters Gemeinsam mit dem Schauspiel Leipzig und in Kooperation mit der Sächsischen Akademie der Künste wollen wir in einer vierteiligen Veranstaltungsreihe über das Theater nachdenken. Dazu werden wir Künstler, Wissenschaftler, Kritiker und Politiker bitten, Thesen oder Visionen zu entwerfen, wie ein Theater der nahen und fernen Zukunft aussehen könnte. Alternierend in Dresden und Leipzig stattfindend, suchen wir Antworten auf Fragen nach Position und Kurs unserer Bühnen. Die Reihe entstand auf Initiative des Regisseurs Wolfgang Engel. September bis Dezember 2014 Die vom Staatsschauspiel Dresden mit der Sächsischen Zeitung veranstaltete Reihe Dresdner Reden besteht seit 1992, und bisher haben sich rund achtzig Künstler, Politiker, Schriftsteller, Architekten, Journalisten und Historiker auf der Bühne des Schauspielhauses zu aktuellen Themen der Zeit- und Kulturgeschichte geäußert. In der vergangenen Spielzeit waren das Heribert Prantl, Roger Willemsen, Jürgen Trittin und Sybille Lewitscharoff. Wir setzen die Reihe im Februar / März 2015 fort. Wichtige gesellschaftliche Themen entwickeln sich in öffentlichen Debatten weiter. Aus dieser Überzeugung heraus bringen die Wochenzeitung die zeit und das Staatsschauspiel Dresden regelmäßig Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Gesellschaft im ZEIT Forum Politik zur Diskussion auf der Bühne zusammen. In der Reihe MDR-FIGARO-Café werden – zum Teil auch in Kooperation mit der zeit – Podiumsdiskussionen zu Theater, Kultur und Zeitgeschehen live übertragen. Weiterdenken ist eine Einrichtung der politischen Bildung der Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen e.V. für Erwachsene in Sachsen und präsentiert gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Internationale Politik an der tu Dresden eine Vortragsreihe im Kleinen Haus zu aktuellen gesellschaftlichen Themen. Die Theater- und Konzertagentur Andreas Grosse lädt internationale Musiker aus den verschiedensten Ländern und Kulturen in das Kleine Haus ein. Zwischen Tradition und Moderne, Ost und West sind die Konzerte der Reihe Musik zwischen den Welten angesiedelt. Das Programm ist so vielfältig wie die Weltmusik selbst, mit Einflüssen aus Folk, Jazz, Rock, Pop und Klassik. Die Konzerte finden jeweils sonntags statt. Der Kulturpalast wird umgebaut. Daher freuen wir uns, auch in der Spielzeit 2014/2015 die Dresdner Philharmonie mit Konzerten im Schauspielhaus zu Gast zu haben, unter der musikalischen Leitung von Chefdirigent Michael Sanderling. Möchten Sie auch mal wieder so richtig Tango Argentino tanzen? Ob Sie tanzunkundig sind oder parkettsicher, allein oder zu zweit: Jeder ist willkommen! Gemeinsam mit Jens Klant und Kathrin Peine, den Profis der Dresdner Tango-Tanzschule „studio24 – Tango Argentino“, laden wir an ausgewählten Sonntagen Anfänger und Könner zum Tangotanztee ein. In der Kabarettreihe Creme frech zeigen Deutschlands renommierteste Kabarettisten im Schauspielhaus politisches Kabarett auf höchstem Niveau. In Zusammenarbeit mit der Herkuleskeule. Am 21. März 2015 findet zum vierten Mal die Lange Nacht der Dresdner Theater statt: Von 18 bis 24 Uhr zeigen die Dresdner Theater und Ensembles auf über dreißig Bühnen Kostproben ihres Schaffens. Theater, Tanz, Oper, Operette, szenische Lesung, Figurentheater, Kabarett und Konzert. Die dreißigminütigen Vorstellungen beginnen im Stundentakt. 38 Und außerdem … Unsere Kooperationspartner Das Staatsschauspiel Dresden praktiziert in Partnerschaft mit der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendels­sohn Bartholdy“ Leipzig eine besondere Ausbildungsform: Nach dem Grundstudium an der Hochschule werden die Studierenden im dritten und vierten Studienjahr im Schauspielstudio Dresden weiter unterrichtet. Die Studentinnen und Studenten wirken neben ihrer Ausbildung an Produktionen des Staatsschauspiels mit und er­arbeiten eine eigene Studioinszenierung. Jährlich kommen ein bis zwei Inszenierungen der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ Dresden im Kleinen Haus zur Aufführung. Die Hochschule für Bildende Künste Dresden ist eine langjährige Kooperationspartnerin in der Ausbildung. Studenten der Studiengänge Bühnen- und Kostümbild sowie Theaterausstattung können praktische Erfahrungen am Staatsschauspiel Dresden sammeln. Studierende des Hauptstudiums an der Palucca Hochschule für Tanz sammeln mit den Auftritten ihrer Kompanie – dem Palucca Tanz Studio – im Kleinen Haus pro­ fes­sionelle Bühnenerfahrung. Die Kooperation der Dresden School of Culture mit dem Staatsschauspiel Dresden ermöglicht Studentinnen und Studenten des Masterstudiengangs Kultur + Management, akademische Lehre und Praxiserfahrung miteinander zu verbinden. Das Kultur Quartier Dresden ist ein Verbund aus Dresdner Kultureinrichtungen mit überregionaler Ausstrahlung sowie gehobener Hotellerie. Ziel ist die Förderung Dresdens als Kulturstadt. Mitglieder sind: Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste, Staatliche Kunstsammlungen, Semperoper, Staatsschauspiel, Frauenkirche, Kreuzkirche, Deutsches Hygiene-Museum, Militärhistorisches Museum, Musikfestspiele, Philharmonie, Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen, Städtische Museen, Gläserne Manufaktur, Dresden Marketing GmbH, Hilton Hotel, Hotel Taschenbergpalais Kempinski, The Westin Bellevue, Steigenberger – Hotel de Saxe, Maritim Hotel Dresden & icc. Gastronomie william ist das neue Restaurant im Schauspielhaus und dabei mehr als nur Theatergastronomie. Es ist ein neuer kulinarischer Anziehungspunkt mitten in der Stadt, wo Küchenchef Marcel Kube und sein Team täglich beweisen, dass eine saisonale und authentische Küche ebenso spannend wie abwechslungsreich ist. Unabhängig vom Theaterbesuch lädt das william ganztägig und an sieben Tagen in der Woche zum Genießen ein. Ob Frühstück, BusinessLunch oder Abendessen, Champagnertag an jedem Freitag oder Sonntagsbrunch mit Musik an jedem letzten Sonntag im Monat – das Angebot ist vielfältig. Theaterbesucher können ihren Abend in Bar und Lounge entspannt beginnen und ausklingen lassen und auch während der Pause aus der Snackkarte wählen. william – Restaurant · Bar · Lounge im Schauspielhaus Öffnungszeiten: Mo bis Fr 11 bis 23 Uhr, Sa und So 10 bis 23 Uhr E-Mail: [email protected] Telefon: 0351 . 44 00 88 00 Das bean&beluga-Team verwöhnt mit seiner Theatergastronomie unsere Gäste mit herzhaften Highlights sowie einer hochwertigen Getränkekarte an verschiedenen Tresen im Zuschauerbereich. Reservierungen für individuelle Pausenarrangements nimmt das Team jederzeit gern entgegen. bean&beluga – Theatergastronomie im Schauspielhaus E-Mail: [email protected] Telefon: 0351 . 44 00 88 00 Im Kleinen Haus bietet das Klara – Bistro und Kantine mit dem Team um René Kuhnt ein umfangreiches Angebot von Getränken über Snacks bis zu gehobenen Speisen. Und nicht nur im Sommer lädt der Lounge-Bereich auf der Terrasse zum Verweilen ein. Klara – Bistro und Kantine Öffnungszeiten: Mo bis Sa 9–24 Uhr. An Sonn- und Feiertagen zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn. E-Mail: [email protected] Telefon: 0351 . 49 13 – 615 39 Rosa Enskat 40 Christian Erdmann 41 Torsten Ranft 42 Hannelore Koch 43 Schöne neue Welt nach dem Roman von Aldous Huxley, neu für die Bühne bearbeitet Uraufführung am 12. September 2014 im Schauspielhaus Regie: Roger Vontobel Ja, ich fordere diese Rechte, alle. Huxleys Herzkatheter Wie die „schöne neue Welt“ die Gesundheitsindustrie erschaffen hat von Heribert Prantl Im Jahr 2050 werden in Europa mehr als 70 Millionen Menschen über achtzig Jahre alt sein. Aldous Huxley hat die Probleme, die sich daraus ergeben, mechanistisch gelöst: Die Alten werden in Spezialkliniken abgeschaltet. Das ist die schöne neue Welt. Die schöne alte Welt: Es war in der Zeit, in der die Zahnärzte noch Dentisten hießen und sich noch nicht jeder Deutsche die dritten Zähne leisten konnte. Wenn meine Tanten damals der Großmutter ihre neugeborenen Enkelkinder präsentierten, dachte die alte Frau anschließend über eine anthropobiologische Frage nach: Wie es denn komme, so sinnierte sie, dass man gemeinhin die kleinen Kinder ohne Zähne als possierlich, die zahnlosen Alten aber als hässlich betrachte? Die Zahnlosigkeit der Alten akzeptierte sie unter Bezugnahme auf das Bibelwort „Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelreich eingehen“ als eschatologische Notwendigkeit; und so war, theologisch höchst fragwürdig, aber für meine Großmutter sehr befriedigend, der körperliche Verfall erklärt und eingebettet in die Volksfrömmigkeit. Großmutter ist, nach einem Leben in der Großfamilie, 1962 gestorben. Sie war 77. 44 Seitdem sind bekanntlich immer mehr Menschen immer älter geworden. Die Rückentwicklung alter Menschen zum Säugling (meist ohne dessen Zufriedenheit) hat es immer gegeben, aber nie in dieser Zahl und für so viele Jahre. Das gilt der Gesellschaft offenbar als eine natürliche Schuld, die Sanktionen nach sich ziehen muss, welche in Altenund Pflegeheimen vollzogen werden. Die Pflege der Alten erinnert oft weniger an Pflege als vielmehr an Strafe. Die Erklärung der bisweilen grausigen Zustände, die in viel zu vielen dieser Alten- und Pflegeheime herrschen, gelingt nur einem solchen Zynismus, der das Fesseln an Bett und Stuhl, Fixierung genannt, als Bestrafung der Alten dafür betrachtet, dass sie so lange leben. Aus dieser zynischen Sicht wird das Windeln der alten Menschen, auch wenn sie noch selbst zur Toilette gehen könnten, zu einem Akt der Generalprävention; das Hungern- und Durstenlassen wird zu einem Akt der Spezialprävention; und das Foto von der alten Frau, die nackt auf einem Toilettenstuhl sitzt, das Essen vor sich auf dem hochgeklappten Tischchen, wird zu einem Werbeplakat für die Sterbehilfe. Solche organisierte Entwürdigung der Alten ist nicht die Regel, aber auch nicht die Ausnahme. Das ist die schöne neue Welt. Weil Deutschland so versiert im Exportieren ist, schafft es sich dadurch auch Probleme vom Hals: Müll wird exportiert. Atommüll, alte Arzneimittel, Batterien und Essensreste landen, legal oder illegal, dort, wo die Entsorgung billiger ist als in Deutschland. Grenzüberschreitende Abfallverbringung nennt man das. Export ist ein Denk-, Handlungs-, und Lösungsprinzip. So kommt es wohl, dass nun auch pflegebedürftige Menschen exportiert werden sollen. Man kann das grenzüberschreitende Altenverbringung nennen. Pflegeheime in Thailand, Spanien und Osteuropa sind billiger als deutsche. Kranken- und Pflegekassen zeigen sich daher interessiert am Greisenexport. Es wird allen Ernstes über den Oma- und Opa-Export nachgedacht. Wie groß oder klein ist da noch der Schritt zu Huxleys Welt? Er hat die Ökonomisierung der Daseinsvorsorge und Daseinsbeendigung und die Probleme mit den Alten radikal zu Ende gedacht – zu Ende im Wortsinn. Die schöne neue Welt bei Huxley zeigt sich auch darin, wie alt gewordene Menschen in Kliniken entsorgt werden. Sie werden ausgeschaltet und abgewrackt wie alte, verrostete Maschinen. Kinder werden regelmäßig in diese Entsorgungskliniken geführt und dort mit Schokolade gefüttert, damit sie sich an den Vorgang des Abschaltens gewöhnen und für sich akzeptieren lernen, dass Leben technisch produziert und technisch beendet wird. Bei Huxley, in der schönen neuen Welt, wird das Leben als Produkt betrachtet, das der Kontrolle, der Überprüfung, der Herstellung und der Entsorgung bedarf. Ist das die Gesellschaft, in der man leben will? In der Medizin, die zur Gesundheitsindustrie geworden ist, ist Huxleys Welt partiell Realität. Das Krankenhaus ist aus dieser Warte keine soziale, sondern eine mechanistische Einrichtung – ein Pendant zur Kfz-Werkstatt. Da werden Teile ausgewechselt, da wird lackiert und repariert, solange es sich rentiert und rechnet. Der Mensch ist zum Kostenfaktor geworden. Dreißigjährige Bubis der Betriebswirtschaft, auf deren Laptops es kein Programm für „soziales Kapital“ gibt, bestimmen über Wohl und Wehe. Ökonomisiert und rationalisiert wurden und werden von ihnen nicht nur Wirtschaftsbetriebe, sondern auch Universitäten, Kinderläden, Schwimmbäder, Bibliotheken, Theater – und Krankenhäuser, auch psychiatrische Kliniken, auch Altenund Pflegeheime. Die Ökonomisierung ergreift auch das ärztliche Handeln und Denken. Und Ökonomisierung meint dabei nicht einfach Wirtschaftlichkeit, das wäre ja in Ordnung, sondern ein neues Denkprinzip und ein neues Menschenbild. Ein radikaler Ökonomismus glaubt ja, er könne auch noch aus einem Gefängnis ein Profit-Center machen. Er glaubt, dass die Summe der rationalisierten Betriebe sich zu einem wunderbaren Standort und zum Wohlstand des Gemeinwesens fügt. Es ist dies wohl ein Midas-Glaube. Midas ist das Urbild des Rationalisierers. Midas, der König von Phrygien, wollte bekanntlich alles zu Gold machen und wäre daran fast zugrunde gegangen. Er hatte sich, so geht die Sage, von Dionysos gewünscht, dass alles, was er berühre, zu Gold werde. Als Midas auf dem Heimweg einen Zweig streifte, einen Stein in die Hand nahm, Ähren pflückte, wurden Zweig, Stein und Ähren zu reinem Gold. Dasselbe geschah mit dem Brot, wenn er sich an den gedeckten Tisch setzte. Auch die Getränke und das mit Wein vermischte Wasser, das er sich in den Hals goss, wurden zu Gold. Midas lief Gefahr, vor Hunger und Durst zu sterben, sodass er schließlich Dionysos bat, ihn von dieser verhängnisvollen Gabe zu befreien. Der Gott erlöste Midas durch ein Bad in einer Quelle, die seither Goldsand führt. Unsere Gesellschaft braucht solche befreienden Bäder. Sie berauscht sich daran, alles zu Gold zu machen. Dabei fehlt die Erkenntnis, die Midas gerade noch rechtzeitig hatte. Diese Erkenntnis lautet: Man kann am eigenen Erfolg auch krepieren. Der Unterschied zwischen Midas und dem radikalen Ökonomismus ist allerdings der, dass an der Sucht des letzteren erst einmal die anderen krepieren – die eingesparten Arbeitskräfte, die Freigesetzten, die Entlassenen, die nutzlos Gemachten. Später leiden dann womöglich auch diejenigen, die man Kunden nennt. Neuerdings nennt man auch in den Krankenhäusern die Patienten immer öfter Kunden. Werden die Ärzte dem Druck standhalten, der durch ein kommerzialisiertes Gesundheitssystem auf sie ausgeübt wird? Dieser Druck ist erfinderisch. In zahlreichen privaten Krankenhäusern werden sogenannte Chefarzt-BoniVerträge abgeschlossen, wie wir sie aus der Finanz- und Bankenwelt kennen- und fürchten gelernt haben. Bei diesen Verträgen erhält der Chefarzt am Jahresende ein Extra- Heribert Prantl ist Mitglied honorar, wenn er auf eine bestimmte Zahl von besonders der Chefredaktion der „Süddeutschen Zeitung“ und profitablen Leistungen kommt – dazu zählen die Implantaleitet dort das Ressort Innentionen von Prothesen oder auch Herzkatheteruntersuch- politk. Der ehemalige Staatsungen. Kommt es eines Tages so weit, dass die Patienten anwalt sitzt im Ethikrat der hinter individuellen ärztlichen Maßnahmen geldgesteu- Hamburger Akademie für Publizistik und gehört dem erte Handlungsanweisungen vermuten können? Schöne pen-Zentrum Deutschland an. neue Welt. Es heißt bisweilen noch immer, das Gesundheitswesen leide auch an einem zu eingeschränkten Wettbewerb. Leidet es nicht eher daran, dass es ein Markt ist, an dem zuallererst verdient werden will? Gesundheit hat ja nicht nur mit körperlicher Intaktheit zu tun, nicht nur mit Pillen und Skalpell, sondern auch mit der Psyche: mit Vertrauen, mit Selbstvertrauen, mit Ängsten, mit Lebensunsicherheiten. Unser Gesundheitssystem krankt wohl auch am mangelnden „Sichkümmern“, denn dies wird nicht bezahlt. Kaufleute und Betriebswirte haben aus der Medizin eine Industrie gemacht. Sie haben die Krankenbehandlung ökonomisiert. Das bekommt den Ärzten nicht – und den Patienten auch nicht. Für Kranke sind Faktoren wichtig, die in betriebswirtschaftlichen Programmen keine oder kaum eine Rolle spielen: Zeit, Geborgenheit und – ja, auch dies, ja, auch wenn es altmodisch klingt – Barmherzigkeit! Manchmal besteht ärztliche Kunst auch darin, abzuwarten und vorerst nichts zu tun; diese Kunst lässt sich nicht betriebswirtschaftlich optimieren. Schöne alte Welt. 45 Drei Schwestern von Anton Tschechow Premiere am 4. Oktober 2014 im Schauspielhaus Regie: Tilmann Köhler Drei Schwestern und ich Der Autor Wladimir Kaminer erzählt von der russischen Lust an der Sehnsucht und einem Leben ohne Konzept Als Tontechniker in einem Moskauer Theater begleitete ich in den 1980er-Jahren mehr als 200 „Drei Schwestern“-Aufführungen und bin dadurch beinahe zum Jungalkoholiker geworden. „Die Musik spielt so lustig, so fröhlich, es scheint noch ein wenig, und wir werden verstehen, wozu wir gelebt, wofür wir gelitten haben! Wenn man nur wüsste, wenn man nur wüsste.“ Die Schauspielerin, die eine der drei Schwestern spielte, verzehrte sich auf der Bühne, die anderen Bühnenkollegen machten Faxen, das Publikum, durch die verzweifelte Schwester an die Sinnlosigkeit des eigenen Seins erinnert, schluchzte. Ich saß auf dem Balkon, als Tontechniker war ich für die musikalische Begleitung des Stückes zuständig. Statt Musik liefen während des ganzen Dramas und beim Finale Feuerwehrglocken vom Band. Die Kleinstadt, in der die Schwestern lebten, brannte, aber sie brannte sehr langsam. Sie qualmte vielmehr wie ein brennendes Torfmoor. Immer wieder stiegen giftige Wolken von der Hinterbühne auf. Mein Kollege, der Lichttechniker, der die ganze Zeit neben mir saß, weinte am Ende ebenfalls wie ein Krokodil, das seine Eier vergraben und vergessen hat, wo. Obwohl er, genau wie ich, die „Drei Schwestern“-Aufführung schon mindestens 200-mal gesehen hatte, konnte er sich im Finale doch nicht einkriegen. Die Aufführung war lang, sie ging erst kurz vor Mitternacht zu Ende. Der Lichttechniker hatte Angst, allein nach Hause zu fahren, stattdessen gingen wir zusammen ins Restaurant „Der Schauspieler“, das einzige, das so spät in Moskau noch auf hatte, und tranken dort selbsterfundene „Drei Schwestern“-Cocktails: Orangenlikör mit Wodka vermischt, dazu eine Salzgurke. Das sinnlose Leiden der Schwestern machte uns platt. Wenn man nur wüsste, warum die Schwestern litten, warum alle Russinnen und Russen litten, das ganze Land um uns herum. Diese schönen jungen Frauen, gebildet und begabt, wussten nicht, wohin mit sich. Die Männer, die sie umgaben, waren uniformiert und infantil. Die ewig qualmende Kleinstadt, in der sich alles kannte und grüßte und in der sich doch jeder endlos einsam fühlte, taugte als Ebenbild unseres Landes, von der restlichen Welt isoliert, von ideologischen, geografischen, politischen Mauern und Barrieren eingekesselt, von jedem Wind der Veränderung geschützt. Im Stück träumten die Schwestern von Moskau, in ihrer Vorstellung war Moskau eine andere Welt, in der alle ihre Wünsche und Hoffnungen wahr werden konnten, in der sie sich als attraktive, aktive Bürgerinnen ausleben konnten. 46 Zum Glück war für sie Moskau unerreichbar, für immer ein Traum. Wir saßen dagegen in der Hauptstadt am wichtigsten Platz, im Restaurant „Der Schauspieler“, und wussten daher, dass diese Stadt genauso versumpft ist wie das Land draußen, wenn nicht noch mehr. Wir träumten von weiten Reisen, unser Moskau war London, Paris, Berlin. Es ist längst bekannt, dass Menschen immer dort das Paradies vermuten, wo sie nicht sind. Das Kulturministerium war mit unserer „Drei Schwestern“-Inszenierung unzufrieden. Zu wenig Optimismus, meinten sie, anstatt die Menschen in ihrem positiven Lebensgefühl zu stärken, was die eigentliche Aufgabe der Kunst sei, sät eurer Tschechow nur Zweifel und Zukunftsangst. Die Theaterdirektion hatte dauernd Probleme mit der Interpretation von Tschechows Werken. Auch achtzig Jahre nach seinem Tod galt Tschechow noch als Dissident, ein ungewöhnlicher Fall für die russische Literatur. Diese Literatur ersetzte lange Zeit in Russland die Wladimir Kaminer ist privat bürgerliche Gesellschaft, die Politik, die Theologie und die ein Russe und beruflich deutscher Schriftsteller und Philosophie, sie ersetzte die öffentliche Meinung, sie spruKolumnist russisch-jüdischer delte vor Ideen, vor Offenbarungen und Sinn. Ob Tolstoj Herkunft. Seine Romane wie oder Dostojewskij, jeder anständige große russische Schrift- „Militärmusik“ und der Erzählband „Russendisko“ machten steller hatte ein Rezept zur Rettung Russlands und folglich ihn international bekannt. der Welt, er wusste, worin der richtige Glaube sich vom falschen unterscheidet, was böse und was gut war, was man zu tun und wie man zu sterben hatte. Die Literatur in Russland war diktatorisch, totalitär, wegweisend. Erst mit Tschechow kam eine andere Literatur – eine Literatur des Zweifelns und des Grübelns – auf. Tschechows Botschaft konnte man in einem Wort zusammenfassen, sie lautete: „Zweifelt!“ Während die Helden der großen russischen Romane nach alles umfassenden Lebenskonzepten gierten, litten die Tschechow’schen Helden unter der Last allzu schwerer Ideen und Konzepte. Tschechow selbst trat für ein Leben ohne Konzept ein. Nicht der Inhalt der großen, die Menschheit errettenden Ideen störte ihn, sondern der Umgang mit diesen Ideen, der Eifer, den die Menschen an den Tag legten, um diese Ideen und Konzepte zu verwirklichen. Besonders skeptisch war Tschechow Politikern und Hellsehern gegenüber, die Visionen hatten und oft und gerne über die Zukunft anderer Menschen und ihrer Länder plauderten. Tschechow bezweifelte, dass Menschen fähig sind, auch nur einen Tag ihres Lebens zu verstehen, ganz zu schweigen davon, dass sie fähig sind, in die Zukunft zu blicken. „Dafür hat der Mensch zu wenig Wissen und Gewissen“, schrieb er. Man muss dazu sagen, dass Russland, damals wie heute, ein sehr fruchtbarer Boden für alle möglichen Ideen ist, für die Ideen von sozialer Gerechtigkeit, von Marxismus und Anarchismus, von allen möglichen Konzepten zur Beglückung der Menschheit. Was meinen Landsleuten im Umgang mit solchen Konzepten fehlt, ist der notwendige Abstand, die Skepsis, die innere Freiheit, das Wissen um die Beschränktheit jeder Theorie und jedes Glaubens. Jemand, der seine Idee oder seinen Glauben für der Weisheit letzten Schluss hält, kann kein freier Mensch sein, er verwandelt sich in einen Sklaven seiner Überzeugungen. Er muss immer im Recht sein und ist nicht bereit, sein Recht mit dem Recht des anderen zu teilen. „Wer von sich behauptet, alles zu wissen und zu verstehen, ist entweder ein Dummkopf oder ein Scharlatan“, schrieb Tschechow einmal in einem Brief. Er suchte nach dem verbindenden Element, nach etwas, was die Menschen zusammenbrachte. Es war nicht der Reichtum, nicht das Wissen, sondern die Schwere des Lebens, sie machte die Menschen solidarisch. Und was die Bedeutung des Lebens betrifft, nicht immer hat ein konkretes Leben einen ausgeprägten Sinn. Aber jedes Leben hat seine Gründe und Abgründe. Heute, so bilde ich mir ein, hätten die drei Schwestern mehr Sinn im russischen Leben gefunden. Sie wären wahrscheinlich in die Politik gegangen und hätten eine kompromisslose Opposition zu den heutigen Machthabern gegründet. Dann hätten sie, wer weiß, an den Präsidentenwahlen 2017 teilgenommen und dreimal so viele Stimmen wie der amtierende Präsident bekommen. Sicher wäre es für Russland ein Segen, wenn das Land nicht von kgb-Offizieren aus dem vorigen Jahrhundert, sondern von den drei Schwestern regiert würde. Wären die drei Schwestern vor zwei Jahren nach Moskau gefahren, wären sie heute wahrscheinlich Pussy Riot. Entweder man weiß, wozu man lebt, oder es ist alles Quatsch, Blablabla. 47 Thomas Braungardt 48 Thomas Eisen 49 Tom Quaas 50 Das Gespenst von Canterville Kinder- und Familienstück nach Oscar Wilde für alle ab 10 Jahren Premiere am 31. Oktober 2014 im Schauspielhaus Regie: Susanne Lietzow Zwillinge, die durch die Halle fliegen Die Regisseurin Susanne Lietzow über ihre Pläne mit Oscar Wildes „Das Gespenst von Canterville“ Es gibt Geschichten, in denen Gespenster den Menschen Angst einjagen, und solche, in denen Gespenster selbst ängstlich sind. Wie ist das Gespenst von Canterville? Das Gespenst Simon de Canterville ist in unserer Geschichte ein über 300 Jahre altes gefürchtetes, verwöhntes, ausgesprochen angesehenes britisches Gespenst mit einer blutrünstigen menschlichen Vergangenheit, das leider nicht eben zeitgemäße Schauerlichkeiten ausübt und sehr irritiert und auch schreckhaft auf die Invasion einer amerikanischen Familie und vor allem auf antiautoritär erzogene Kinder reagiert. Die furchtlose amerikanische Familie glaubt nicht an Gespenster, muss die Existenz dieses Gespensts aber irgendwann akzeptieren. Warum? Weil sie in einer ungewollten Wohngemeinschaft lebt. Wie versucht die Familie, dem Gespenst beizukommen? Zuerst mit Logik, dann mit Fallen und später sogar mit einem Zeitplan … Friedliche Koexistenz, Vertreibung, Erlösung – jedes Familienmitglied hat seine eigene Strategie. Welche ist dir am sympathischsten? Alle Strategien sind auf ihre Weise charmant, natürlich sind die intensive Annäherung und das Verstehen zwischen der Tochter und dem alten, müden Gespenst herzzerreißend. Der zweite Teil der Erzählung ist von einem anderen Ton geprägt. Welche Abzweigung nimmt die Geschichte? Das verrate ich nicht … In der Geschichte wimmelt es von Dingen, die man gern im Theater sehen möchte. Können Sie schon etwas von Ihren Plänen verraten? Es gibt selten eine schönere Figurenkonstellation. Es gibt Slapstick, Rauch, riesige Schatten, Nebel, Gewitter, englische Himmelslandschaften, einen irritierten, manchmal Dudelsack pfeifenden Butler, eine schreiend ängstliche Köchin, tobende akrobatische Zwillinge, die am Lüster hängend durch die Halle fliegen, einige Zaubereien, die das Gespenst schon noch ganz gut kann, und ganz sicher eine herzerweichende Traurigkeit, wenn wir das sich nach ewiger Ruhe sehnende Gespenst näher kennenlernen … Wir freuen uns, folgende Vorstellungstermine zu Das Gespenst von Canterville bereits zum 1. Mai 2014 in den Vorverkauf geben zu können: Für welche der Figuren schlägt Ihr Herz? Ich neige dazu, mich in alle Figuren zu verlieben, und bin schon dabei … Wir spielen das Kinder- und Familienstück Klaus im Schrank von Erich Kästner für alle ab 6 auch in der Spielzeit 2014/2015 weiter. Folgende Termine sind ab 1. Mai 2014 im Vorverkauf. Nach „Reineke Fuchs“ und „Klaus im Schrank“ kannst du als Spezialistin für große, fantasievolle Erzählungen für die ganze Familie gelten. Wird es diesmal wieder ein Spektakel für alle werden? Diese Geschichte hat meine Kindheit begleitet und hat jetzt, beim Wiederentdecken als schon etwas älteres Mädchen, nichts von ihrer Qualität und ihrem Zauber eingebüßt. Also denke ich, dass sie auch für Eltern und Großeltern eine Freude ist. 31.10.2014 23.11. 2014 30.11. 2014 1.12. 2014 2.12. 2014 3.12. 2014 13.12. 2014 14.12. 2014 29.12. 2014 2. 11. 2014 8. 11. 2014 5. 12. 2014 6. 12. 2014 7. 12. 2014 8. 12. 2014 25. 12. 2014 17 Uhr Premiere 15 und 19 Uhr 16 Uhr 10:30 Uhr 10:30 Uhr 10:30 Uhr 19 Uhr 10:30 und 17 Uhr 19:30 Uhr 16 Uhr 18 Uhr 18 Uhr 15 und 19 Uhr 10:30 und 16 Uhr 10:30 Uhr 17 Uhr Die Ostsächsische Sparkasse Dresden unterstützt die Kinderund Familienstücke „Das Gespenst von Canterville“ wird manchmal kleineren Kindern erzählt. Warum wird Ihre Inszenierung für Kinder ab zehn sein? Ich denke, die kulturellen Unterschiede zwischen den Amerikanern und dem alten englischen Gespenst sowie die hoffentlich gestochen scharfen schwarzhumorigen Dialoge, die Jähzornsanfälle von Simon de Canterville, die Glaubensfrage des Übernatürlichen und die Liebesgeschichte zwischen der amerikanisch aufgeklärten Tochter und dem jungen englischen Earl sind Komponenten, die eine Bearbeitung für Menschen ab zehn interessanter machen. Susanne Lietzow arbeitete in den letzten Jahren kontinuierlich am Staatsschauspiel. Ihre Inszenierungen wie „Klaus im Schrank“ stehen weiterhin im Spielplan. Eine ausführliche Biografie finden Sie auf A Seite 21 51 Faust Der Tragödie erster Teil von Johann Wolfgang von Goethe Premiere am 29. November 2014 im Schauspielhaus Regie: Linus Tunström Protect me from what I want Ein Porträt des schwedischen Regisseurs Linus Tunström von Armin Kerber Das schwedische Theater ist meist realistisch bis ins Mark. nur einmal im Jahr selbst Regie zu führen. Mit dieser Armin Kerber lebt in Zürich Ein Schauspieler, der in Schweden auf die Bühne kommt, Entscheidung verwandelte Tunström das kleine Theater und ist seit einigen Jahren als freier Dramaturg und Autor ist in erster Linie eine klar umrissene Figur. Ein Stück, das Uppsala innerhalb von wenigen Jahren in ein theatrales vorwiegend in Schweden, im Theater erzählt wird, wird immer noch in erster Linie Feldforschungslager, in dem Theaterleute mit den unter- Griechenland und der Schweiz erzählt. Diese Liebe zum Realismus betrifft nicht nur das schiedlichsten Handschriften zusammentreffen. Er holte engagiert. Zuvor war er u. a. Intendant am Theaterhaus Theater, sondern genauso die Literatur und den Film, man sie aus der Ukraine, aus Finnland und aus der schwedischen Gessnerallee Zürich sowie könnte auch sagen, das ganze Land möchte vor allem eines Offszene, aus Deutschland kam die Performancegruppe Chefdramaturg auf Kampnagel sein: realistisch. She She Pop, um in einem Workshop neue performative Hamburg und am Stadttheater Geht es um das Trinkverhalten, dann ist es realistisch, die Abmischungsformen mit den Schauspielern des festen Bern. Seit 2010 ist er auch Alkoholvorräte in den Läden ab 18 Uhr zu verschließen und Ensembles auszuprobieren. Für eine Popmusikrevue im Redakteur beim Schweizer Kulturmagazin „DU“. Er untersie danach in den Bars sündhaft teuer zu verkaufen. Geht Dokumentartheaterstil engagierte er Tomas Alfredson, der richtet an der Zürcher Hoches um das Sterben auf den Autostraßen, ist das strikteste später den Oscar-prämierten Hollywoodfilm „Dame, König, schule der Künste und schreibt für „Theater heute“ und Tempolimit Europas realistisch. Geht es um eine Gesell- As, Spion“ drehte. schaft mit möglichst wenigen Risiken und Nebenwirkun- Innerhalb kürzester Zeit wurde aus Linus Tunström, dem „Theater der Zeit“. Mit Linus Tunström arbeitet Armin gen, dann sind Höchststeuersätze realistisch. Anders ge- „jungen Wilden“, eine der gewieftesten Führungskräfte der Kerber seit acht Jahren sagt: Realismus ist in Schweden keine ästhetische Haltung, schwedischen Kulturszene. Im Jahr 2009 gewann er den regelmäßig zusammen. sondern eine Art Vollkaskoversicherung der Realität gegen Schwedischen Kritikerpreis, der normalerweise an Schausich selbst. „Protect me from what I want“ – dieser von Jenny spieler oder Regisseure für ihre künstlerische Arbeit vergeHolzer zum geflügelten Kunstslogan geadelte Songtitel ben wird. Tunström erhielt ihn explizit als Intendant, der könnte als Schlüssel zu vielen Spielregeln des schwedischen das beschauliche Stadttheater Uppsala in „Schwedens Alltags dienen. Denn wer hier zu Höhenflügen anhebt, macht dynamischste Bühne“ verwandelt hatte. Als Regisseur zieht sich schnell der Abgehobenheit verdächtig, wen es in die sich Linus Tunström zurück, um dann einmal jährlich mit Tiefe zieht, den umarmt die freundliche Gruppe, wer große Mut zu emotionalen Crashkursen, choreografischen AchterGefühle offenlegt, auf den wartet die Supervision – und bahnfahrten und ästhetischen Wechselbädern künstlerinicht das Theater. sche Akzente zu setzen. Linus Tunström liebt Höhenflüge und große Gefühle. Es 2008 brachte Linus Tunström in seiner ersten Inszenierung ist hilfreich, dies zu wissen, denn Tunström kommt aus in Uppsala die Dramatisierung des Romans „Der Dieb“ Schweden, macht Theater und geht gelegentlich am Wo- zur Uraufführung, geschrieben von seinem Vater Göran chenende Fallschirmspringen. Außerdem ist er leiden- Tunström, einem in Schweden viel gelesenen Schriftsteller. schaftlicher Taucher. Seine Theaterausbildung hat er nicht Die schwer zu ertragende Realität des Buches gründet in zu Hause in Schweden gemacht. Mit zwanzig Jahren ist er einem Sumpf aus Inzucht, Gewalt, Alkoholismus und Denach Paris gegangen auf die Schauspielschule von Jacques pressivität, den Linus Tunström trockenlegte, indem er Lecoq, die für ihren antirealistischen, um intensiven Kör- jeden Realismus im Keim erstickte und die geknechtete, perausdruck bemühten Ansatz bekannt ist. Nach seiner vom Unglück gekreuzigte Hauptfigur in einen Stand-upRückkehr Mitte der 1990er-Jahre konnte er sich in Schwe- Comedian verwandelte, der großzügig Alkohol ans Publiden mit Aufführungen, die sich dank ihrer Expressivität, kum ausschenkt und die Bitterkeit seines Schicksals in ihrer körperlichen Rasanz und ihrer Lust am Pathos deut- Lachsalven ertränkt. lich vom schwedischen Realismus abgrenzten, rasch als Regisseur durchsetzen – zunächst in der Offszene, dann an den Staatstheatern von Göteborg, Malmö und Stockholm, dazwischen gab es Ausflüge nach Kopenhagen, London, in die Schweiz und nach Cannes, wo er mit einem Kurzfilm den Preis der Kritik gewann. Linus Tunström war gerade mal Mitte dreißig, als er zum Intendanten des Stadttheaters Uppsala berufen wurde. Im Unterschied zu diversen regieführenden Intendanten entschied er sich dafür, das Haus nicht als zentrifugales Gefäß für seine eigenen Inszenierungen zu benutzen, sondern 52 Du bist noch nicht der Mann, den Teufel festzuhalten! Ingmar Bergmans nordisches Weihnachtsmärchen „Fanny rennen auf der Autobahn. Ein Realismus, der so weit auf und Alexander“ holte Tunström aus der protestantischen die Spitze getrieben wird, dass er die Realität erschlägt, die Kühle heraus und versetzte es in ein südlich-magisches er zeigt, steht quer zum schwedischen Kanon der FreundDämmerlicht à la Visconti. Nicht die Bestrafungsrituale ei- lichkeit und der gesellschaftlichen Transparenz. nes sadistischen Priesters bildeten den Grundakkord für In Dresden wird Linus Tunström zum ersten Mal in seine Inszenierung, sondern – in einer Art Gegenentwurf Deutschland inszenieren: Goethes „Faust I“, der mit Höhenzu Thomas Mann – die erotischen Sehnsuchtsträume und flügen, Tiefenschürfungen und großen Gefühlen nicht Lustorgien des untergehenden Bürgertums mit seinen surre- geizt und sich in seiner Formenvielfalt jedem Realismus alen Höhenflügen und Albträumen, alle gemeinsam getrie- a priori entzieht. Wie kein anderes deutsches Stück Literatur hat „Faust“ die Zerrissenheit als Lieblingskategorie im ben von einer fast kindlichen Heimatliebe zum Theater. Auf die melodramatische Publikumsverführung mit Ingmar deutschen Befindlichkeitshaushalt etabliert. Auf der Bühne Bergman folgte vor einem Jahr ein pechschwarzer „Hamlet“ erscheint gewöhnlich unter dem Leitmotiv „Zwei Seelen ohne Netz, aber mit einigen doppelten Böden, die lautstark wohnen, Ach! in meiner Brust“ das virtuose Duett zweier aufeinanderkrachten. Mit filmischen Anleihen bei David widersprüchlicher Männer, die gemeinsam ein junges MädLynch schuf Tunström einen dreckigen Zombie-Reigen, chen verführen und zerstören. Linus Tunström nimmt sich sein Hamlet ist kein zweifelnder Intellektueller, sondern Goethes „Faust“ wohl etwas anders zur Brust. Ihm geht es ein Wikinger-Körperpaket im schmutzigen Unterhemd, um die Transparenz der Triebkräfte, um den Moment, als wäre ein blonder Marlon Brando dem Nordmeer ent- wenn alle Sicherungen der Realität durchzubrennen drostiegen. Das tödliche Finale bildet ein Motocross-Splatter- hen. Vielleicht haben aus seiner Sicht alle Beteiligten im Spektakel, bei dem Hamlet plötzlich von auferstandenen „Faust“ einfach zu wenig auf das schwedische Credo gehört: Untoten umzingelt wird, zum Revolver greift und sich „Protect me from what I want.“ Und damit kennt sich Linus selbst in die Schläfe schießt, ohne dabei zu sterben. Immer Tunström wirklich aus. und immer wieder drückt er ab, bis er erkennt, dass er aus demselben unzerstörbar-zerstörerischen Fleisch geschaffen ist wie alle seine Gegenspieler: Die Frage nach Sein oder Nichtsein hatte sich genauso radikal selbst erledigt, wie sich das Publikum und die Kritik bereits bei der Premiere in zwei unversöhnliche Lager gespalten hatten – ein Vorgang, der in Schweden etwa so selten vorkommt wie ein Auto- 53 Wie es euch gefällt Komödie von William Shakespeare Premiere im Januar 2015 im Schauspielhaus Regie: Jan Gehler Wer ist wer, wie ist und wie scheint man? Der Shakespeare-Spezialist Norbert Kentrup wirft einen Blick hinter die bunten Kulissen der elisabethanischen Verwechslungskomödie Geburtstag! Der 450., die ganze Welt feiert William Kirchen und Unternehmer Arbeit Arbeit sein. Sie ruderten Shakespeare. Belegt ist im Taufregister, dass am 26. April über die Elbe – nein, die Themse – zur Bankside ins außer1564 ein „Gulielmus filius Johannes Shakspere“ getauft halb der Stadt liegende Vergnügungsviertel mit seinen wurde. Man nimmt an, dass er drei Tage vorher, also am 23. Kneipen, Bordellen und Theatern. April, geboren wurde. Der Todestag nach 52 Jahren ist da- Neugierig wollte man die neuesten Geschichten anschauen, den Klatsch und Tratsch vom jüdischen Kaufmann, der gegen mit Sicherheit belegt: der 23. April 1616. Man weiß sehr wenig über diesen Mann aus Stratford- einem Christen das Herz rausschneiden will, oder vom upon-Avon. Der größte Dichter der Welt, und nur Vermu- schwarzen Krieger, der eine weiße Senatorentochter heiratet und sie umbringt, oder von der gefährlichen Flucht von tungen, Spekulationen, Ungewissheiten, kaum Fakten. Wie wurde Shakespeare Shakespeare? Die Wissenschaftler Rosalind und Celia und dem Werben von Orlando im Wald interpretieren die wenigen Fakten immer wieder auf neue von Arden. Art, aber dadurch wird nicht deutlicher, wer er war. Seine Theaterstücke fand er nicht wichtig, oder vielleicht „Wie es euch gefällt“, das nicht nur in Deutschland so bewollte er, dass kein Beweismaterial gegen ihn vorlag. War er liebte Burgruinen-, Park- und Freiluft-Sommertheaterstück. womöglich heimlicher Papist? Er verlegte seine Stücke nicht. „As You Like It“, um 1599 entstanden, das heitere VerkleiNur die Sonette, die er unter seinem Namen herausgab, dungsspiel, das liebenswerte Schäferstück aus der guten schienen ihm kostbar. Seine Stücke kennen wir nur durch alten Zeit, die Pastorale mit Musik und Tanz über das Ledie „First Folio“-Ausgabe, die seine Freunde 1623, sieben ben auf dem Land und in der Stadt mit den witzigen Liebeständeln der bunten Komiker. Jahre nach Shakespeares Tod, herausgaben. Als der junge William etwa 1580 nach London kam, war das Der Zuschauerraum und die Bühne im hellen Tageslicht Medium Theater das Aufregendste, Neueste. Man hatte verschmelzen zu einem gemeinsamen Erlebnisraum, eientdeckt, dass man, wenn man beim Eintritt kassierte, mit nem Event, wenn Jacques in gutem Englisch so amüsant über unsere sieben Lebensalter philosophiert. Der dekoraTheater Geld verdienen konnte. Dafür brauchte man Gebäude und neue Stücke. 1562 boomte tive Wald von Arden gibt eine prachtvolle Kulisse für die Londons Theaterwelt, zu jener Zeit war die Stadt etwa halb Komödie mit ihren Irrungen und Wirrungen in schönen so groß wie heute Dresden mit seinen 500 000 Einwohnern. historischen Kostümen. Hier gibt es in der Semperoper 1 300 Plätze, im Schauspiel- Das ist eine Lesart dieses Stückes. haus 800 und in der Staatsoperette 600. London aber hatte Aber wenn man anlässlich der Dresdner Premiere an einem mit nur etwa 250 000 Einwohnern sechs bis zehn große nasskalten Januartag 2015 gedanklich in das 1997 rekonTheater, die ständig bespielt wurden. Es gab jeden Nach- struierte Globe Theatre an der Themse zurückkehrt, im mittag ein Platzangebot für 6 000 bis 10 000 Zuschauer. menschenleeren Zuschauerraum steht, in den es durch das Die Architektur der Theater war aus den Gasthof-Innenhö- große Loch in der Decke reinregnet, und die leere, nackte fen und den Bärenhatz-Arenen entwickelt worden. Die erhöhte Bühne ohne Dekoration nur mit ihren bemalten Schauspieltruppen bestanden aus zwölf Männern und drei Säulen ansieht, diesen runden Holzbau, in dem die Wucht Knaben, es gab keine Regie, dafür war der Souffleur mit der Shakespeare’schen Sprache, seine Wort,- Ton- und der wichtigste Mann, denn der hatte als Einziger das kom- Spielkulisse, die Einheit von Bühne und Zuschauerraum, das gemeinsam gelebte und erlittene Leben der Schauspieplette Textbuch. Um 14 Uhr läuteten die Glocken zum Nachmittagsgottes- ler und Zuschauer alles erfüllte, dann entsteht im Kopf eine dienst, und Tausende nahmen das als Zeichen. Die Lehr- Reise in Shakespeares Zeit, in der das Stück wohl nicht nur linge, Angestellten, Handwerker, Buchhalter, Höflinge, nett und komisch war. Man blickt auf die damalige Zeit, auf Mägde und Handwerkerfrauen ließen sehr zum Ärger der eine Welt voller Umbrüche. 54 England war bis 1531 katholisch, dann kam unter Heinrich viii. die Loslösung von Rom. Die Katholiken wurden verfolgt, ebenso unter Edward vi., der, als Neunjähriger zum König geworden, nur von 1547 bis 1553 regierte. Die katholische Maria machte alles wieder rückgängig, sie regierte fünf Jahre, nun wurden die Protestanten gejagt, gefoltert und hingerichtet. Unter Elisabeth i. ging es ab 1558 wieder andersrum, nun waren die Papstanhänger wieder das Ziel des Hasses. Eine gefährliche, aufregende Zeit. Die spanische Armada wurde besiegt, die Welt wurde neu vermessen, Amerika und Indien wurden entdeckt, Musik, Theater, Malerei waren Tagesgespräch. Die Angst, was wird, wenn die Königin stirbt oder umgebracht wird und alles wieder anders ist, war fühlbar. Die Debatte darüber aber war gesetzlich verboten. Ein funktionierendes System von Spitzel- und Geheimdiensten deckte verschiedene Verschwörungen und Komplotte auf, die Missetäter wurden unter großem Jubel hingerichtet. Schon ein Verdacht – trinkt der Gläubige beim pflichtgemäßen sonntäglichen Kirchenbesuch, wie es sich nun nach dem neuen Ritus gehört, mit aus dem Kelch oder vermeidet er es, ist er vielleicht ein verdeckter verkleideter Katholik, kein loyaler Untertan? –, eine Verleumdung vom Pfarrer, der als staatstragendes Organ seine Gemeinde kontrollierte, konnte eine Anklage nach sich ziehen und unausweichlich ohne juristische Verteidigung zum Schafott führen. Die Zuschauer, geifernd und von Grusel erfasst, hörten die letzten Worte des Delinquenten, sahen, wie der Kopf abgehackt und auf einem Spieß an der London Bridge zur Warnung für Nachahmer aufgestellt wurde. In so einer Zeit spielt „Wie es euch gefällt“. bei einem öffentlichen Ringkampf töten zu lassen. Der weggeputschte alte Herzog flieht mit seinen letzten Getreuen in den unwirtlichen, kalten Wald von Arden. Der Darsteller der Rosalind, verkleidet als Frau, verwandelt sich wieder zurück in einen Mann, um nicht auf der Reise überfallen zu werden. Die männliche Verkleidung ist kein Spaß, sondern der einzige Schutz vor Verfolgung und Vergewaltigung. Der Schauspieler nimmt sich vielleicht von einem an der Bühne stehenden Zuschauer den Hut, damit er nicht mehr adelig aussieht, sondern so wie die für einen Penny stehenden armen Leute aus der Menschenmenge vor der Bühne, die sogenannten Groundlings. Es gab damals eine klare, kontrollierte hierarchische Kleiderordnung, man durfte nur die seinem Rang oder seiner Profession vorgeschriebenen Gewänder und Hüte tragen. Theater in Shakespeares Zeit war etwas Direktes, etwas zum Anfassen. Es war voller Überraschungen, Wunder, Unwahrscheinlichkeiten und Monstrositäten, wüst, blutig, grausam und brachial komisch, denn die Liebesszenen der Landbevölkerung waren sicherlich nicht politisch korrekt. Wenn Jacques über die sieben Lebensalter spricht, sieht er vielleicht im Zuschauerraum eine Amme, die ein quäkendes Kind stillt, im Gentlemen-Room seitwärts hinter der Bühne einen dicken Richter, den er anspielt, oder ihm gegenüber, im ersten Rang, einen hageren Greis im Jugendwahn und unten als Groundling einen bärtigen Soldaten mit stolzgeschwellter Brust, mit dem er Einverständnis über unsere Reise zum Tod herstellt. Wie überlebte man in einer Welt voller Spione, kirchlicher Kontrollen und staatlicher und gesellschaftlicher Gebote und Strafen? Wer ist wer, wie ist und wie scheint man – das war zumindest zu Shakespeares Zeiten mehr als ein Verwechslungsspiel. Norbert Kentrup ist Schauspieler, Regisseur und Mitbegründer des Theaterensembles „Shakespeare und Partner“. Er war Vorstandsmitglied der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft, und hat – als bisher einziger Deutscher – im Globe Theater in London den Shylock gespielt. Schon beim ersten Auftritt breitet sich eine repressive Welt aus, wie unter einer Diktatur. Zwei junge Frauen (von jungen Männern gespielt, denn damals war es Frauen bei Strafe verboten, auf einer Bühne zu stehen), zitternd vor Angst, planen ihre Flucht vom Hof. Ein alter treuer Diener wird von seinem jungen Herrn auf die Straße zu den Bettlern geworfen. Ein gewissenloser Jüngling engagiert einen Killer, um seinen von der Erbfolge benachteiligten Bruder Ich würde küssen, ehe ich spräche. 55 Christian Clauß 56 Christine Hoppe 57 Sascha Göpel 58 Ina Piontek 59 Die Verschwörung des Fiesko zu Genua Ein Republikanisches Trauerspiel von Friedrich Schiller Premiere im Februar 2015 im Schauspielhaus Regie: Jan Philipp Gloger Verlacht vom Fiesko Der junge Journalist Simon Strauß lässt sich von Schiller verstören, denkt über die Revolution nach und wirft eine Kaffeetasse gegen die Wand Er sitzt und hört zu und zählt die vielen „sozusagen“, die und Abschied tauschen sie flüchtig Wangenküsse, als sei Füllsel, die neben ihm der gemütlich klagende Freund in nichts weiter – Mitte zwanzig und schon alles vorbei. Und seine Rede streut. Der Mut zum Wagnis sei ihnen längst der Mohr warnt, „dass Genuas großer Mann Genuas großen abhandengekommen. Der Wohlstand habe alle schläfrig ge- Fall verschlafe“. Er nimmt es sich vor, morgen also. Das macht. Eigener Vorteil und Zukunftsangst stünden im Zen- Spiel ohne Maske. Anstiftung zum Krieg oder zur Liebe. trum, schwach der Blick fürs Ganze, das Allgemeine inter- Und er geht auf die Feiern und Plätze, in die Parlamente, essiere nicht mehr. Sport und Ernährung, beinah fromme Seminare und Redaktionen der Stadt. Brüllt laut ins Gesicht Güter, fast schon Religionsersatz. Sozusagen. Kein Kampf der Arglosen und Überraschten: „Ein Diadem erkämpfen ist sei mehr zu führen, keine Väter zu morden. Die Ideologien groß. Es wegwerfen ist göttlich.“ Sogar eine Kaffeetasse hätten längst alle Trümpfe ausgespielt. Was dagegen lebe, schmeißt er gegen die Wand. Aber zurück blicken nur glaseien Facebook und das Bioobst. Sozusagen. Ein Achselzu- sig-blasse Augen. Müde lächeln sie sein Pathos zu Boden. cken, ein Blick auf den schimmernden Schirm – vor der Tür „Seitdem das Pulver erfunden ist, kampieren die Engel nicht steht ein Car to go, und zu Hause wartet die Freundin. mehr“, höhnt Schillers ausgetrockneter Hofmann und „Tatort“ und Yogitee – wer braucht da noch Revolutionen? zuckt mit den Achseln. „Leben heißt träumen. Weise sein Auf ein nächstes Mal. Von sich selber satt schlendert die heißt angenehm träumen.“ Gegenwartsanalyse durch den Feierabend. Aber im „Fiesko“ Aber er denkt jetzt groß und hitzig. Er bäumt sich auf: gegen steht: „Wer will sich zum Pharao setzen und die Zeit mit Spie- die lustlose Ironie, den kranken Zynismus. So geht es nicht len betrügen? Wir sind gewohnt, sie mit Taten zu bezahlen.“ weiter. Ihr selbst zerbrecht doch beim ersten Windstoß. Er sitzt im Café und empfängt seine Mitteilungen. „Keine Los jetzt. Was ist euer innerster Antrieb? Kennt ihr den Zeit“, schreibt er hastig zurück. „Viel zu tun.“ Draußen eilen Zweifel, die Anfechtung, die Gefahr? Was bedeuten euch die Lebensziele vorbei. Er ahnt: Sein Denken und Fühlen be- Politik und die Pflicht, ein Bürger zu sein? Schätzt ihr den wegt sich auf längst schon ausgetretenen Pfaden. Ein Pio- Wert eures Gemeinwesens? „Scheitert der Euro, scheitert nier zu sein, dazu fehlt ihm die Kraft, das starke Motiv. Da Europa.“ Kann das ein Bannerspruch sein? Ließen sich dagibt es doch klügere Menschen, erfahrenere als ihn. Aber mit Tyrannen stürzen, Unfreiheit und Terror vertreiben? hat er selbst nicht hin und wieder besser geredet als andere, Seid ihr im Geringsten gewappnet für einen Kampf ? Denn tiefer gedacht und mehr gesehen? Ihm, gerade ihm müsste was, wenn morgen einer käme und riefe laut und überzeudoch etwas Eigenes, Schneisenschlagendes gelingen. Ein gend: „Republikaner Fiesko? Herzog Fiesko?“ Würdet ihr Gedanke, eine Rede, ein Aufruf. Er müsste nur die Angst vor ihm antworten können? Ihr, die ihr den Unterschied nicht dem Grinsen der Zyniker überwinden, sich nicht scheuen, kennt, nie gefühlt habt, was Entscheidung heißt. Kann pathetisch zu klingen, naiv sogar. Es gäbe doch so viele nicht nur der, der selbst einmal gefährlich gedacht, selbst Gründe, unduldsam zu sein, scharfe Sätze zu sagen: gegen einmal am Tisch des Feindes gesessen hat, darauf eine entden Egoismus und für das Gemeinsame, für Moral, Freiheit schiedene Antwort geben? Kann nicht nur der den Herzog und Recht – vor allem gegen die Kälte, fürs Feuer im Blut. von der Brücke stoßen, wenn er prahlt, „dass ich der größte Maximen könnten auf den Tisch geschleudert, Banner ent- Mann bin in ganz Genua und die kleinen Seelen sollen sich rollt werden, risk, risk anything – aber der Fiesko fragt nicht unter die große versammeln“? listig: „Die Worte, die du mir hinterbracht hast, sind gut; Längst sind ihm da schon die Zuhörer abhandengekommen. lassen sich Taten draus schließen?“ Schon verliert er den Die ewig Unberührbaren! Sie wissen alles und fühlen nichts. Mut, hastig kehrt er zurück zum Gewohnten. Beim Aufste- Zurück bleibt der Kaffeefleck, ein Zornesmal an der Wand. hen zieht er den Kopf ein, duckt sich weg vor der Verach- Und er träumt weiter. Sehnt sich. „Wer keinen Menschen tung, denn der Fiesko ruft hämisch: „Machst Republiken mit zu fürchten braucht, wird er sich eines Menschen erbareinem Pinsel frei – kannst eigene Ketten nicht brechen? Geh! men?“ Er müsste doch einmal so einen treffen, einen, der keine Angst hat vor blinder Leidenschaft. Der würde sein Deine Arbeit ist Gaukelwerk – der Schein weiche der Tat.“ Er schleicht nach Hause. Gekrümmt und zerknirscht. Wie- Freund werden. Und dann sein Feind? Gegen ihn könnte er der ein Tag ohne Tat. Und wieder verlacht vom Fiesko. Am seine Ideale verteidigen. Mit ihm könnte er träumen von der Abend bleibt er allein. Er liest weiter und träumt von Ver- großen Veränderung. Allein wird es damit nichts werden. schwörung. Träumt von Geheimbund und Heldentat. Die Jungsein für sich ist kein Programm. So läuft er abends – Angst packt ihn und die Sehnsucht, am Ende, wenn Schiller den „Fiesko“ unterm Arm – durch die Straßen und fragt das Publikum mahnt, „dass unsere besten Keime zu Gro- einen jeden wie ganz nebenbei: Gibt es denn nichts zu tun? ßem und Gutem unter dem Druck des bürgerlichen Lebens Nichts zu wagen? Und einer weist ihm den Weg zum Theabegraben sind“. Auf der Straße sieht er die Freunde laufen, ter. Da gäbe es Antwort auf seine Fragen ... hört ihr Gequengel und trauriges Allerlei. Zu Begrüßung 60 Simon Strauß, geboren 1988, promoviert derzeit in Alter Geschichte an der HumboldtUniversität Berlin und schreibt als freier Mitarbeiter für das Feuilleton der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Amerika nach dem Roman von Franz Kafka Premiere März 2015 im Schauspielhaus Regie: Wolfgang Engel Der Geruch von Veroneser Salami Der Schriftsteller Jochen Schmidt schreibt über seinen Lieblingskafka Im August 1989 saß ich auf den Stufen einer Prager Kirche, von den Irländern den Neuankömmlingen in Amerika droals Landstreicher verkleidet, was damals die Mode der Auf- hen“. Amerika, das ist neueste Technik: Man wohnt in Häusässigen war, und versuchte, Franz Kafkas Erzählungen sern aus Eisen, duscht unter einem Sieb, das sich über die zu lesen, in einer ddr-Reclam-Ausgabe, die ich in einer ganze Länge und Breite der Wanne spannt, schreibt an eiPrager Buchhandlung ergattert hatte, denn zu Hause war nem Schreibtisch mit einer Kurbel, über die sich verschiedas Bückware. Leider war ich von der Lektüre vollkommen dene Aufsätze und Ablagen umgruppieren lassen, ständig überfordert, da mir die nötige Reife fehlte. Andererseits wird telefoniert, der Telegrafensaal der Firma des Onkels war es eine schöne Zeit, weil die Literatur das Leben noch ist größer als der von Roßmanns Vaterstadt, das Grüßen nicht ersetzt hatte, ich war ja gerade praktisch ohne Essen in den großen Firmen ist aus Zeitgründen abgeschafft, durch die Karpaten gewandert und erlebte eine historische Frauen nötigen einen mit Jiu-Jitsu ins Bett, bei Tisch wird Situation, den Zusammenbruch des Ostblocks. Aber statt fast rohes Fleisch verzehrt, man trinkt eine „schwarze Flüsdiesen Prozess aufmerksam zu beobachten, las man Kafka, sigkeit, die im Halse brennt“ (mit anderen Worten Coca aus eskapistischen Gründen, weil seine vermeintliche Ver- Cola), und stützt dabei die Ellbogen auf. Wer etwas werden weigerung von Sinn eine Provokation war in einer Zeit, in will, arbeitet tagsüber, studiert nachts auf dem Balkon und der es verboten war, am höheren Sinn unserer gesellschaft- hält sich mit schwarzem Kaffee wach, schlafen kann man lichen Entwicklung zu zweifeln, Nonsens war Sabotage. nach dem Examen. Es habe Neuankömmlinge gegeben, die Abends beim Einschlafen zählte ich gewöhnlich keine Schäf- „tagelang auf ihrem Balkon gestanden und wie verlorene chen, sondern stellte mir immer wieder meine abenteuerli- Schafe auf die Straße hinuntergesehen hätten“. che Ausreise in den Westen vor, spektakuläre Fluchtversu- Es ist ein Amerika, wie ich es aus einer Geschichte in den che oder Entführungen, und eine triumphale Ankunft bzw. „Lustigen Taschenbüchern“ kenne. Onkel Dagobert besucht das Scheitern in dieser unmenschlichen Welt jenseits der einen amerikanischen „Kollegen“, dessen Ländereien und Mauer, die so viele Verlockungen bot, aber jeden kleinen Gebäude unüberschaubar sind. Die Eingangstür seines AnFehler unbarmherzig bestrafte. Sollte man bleiben oder wesens ist ein Trapez, oben breiter als unten, bei der Aussollte man gehen? Was wäre, wenn? Die Frage, die sich gangstür ist es umgekehrt, denn selbst stolze Besucher wie heute viele Menschen nur noch in Bezug auf ihre Ehe stel- der reiche Dagobert kommen mit einem großen Kopf und len, drehte sich damals für große Massen um das Auswan- verlassen das Haus gebückt und voll Demut angesichts der dern. Und heute lese ich „Amerika“ und frage mich, warum unfassbaren Reichtümer und Dimensionen. ich damals nicht gesehen habe, wie gut Kafkas Text zu mei- Wäre es mir im Westen auch so gegangen? Ein reicher Onner Situation passte. Der Roman ist eine Genugtuung für kel nimmt mich auf und stellt mich in seiner Firma an, ich jeden Autor, der zum Stubenhockerdasein neigt, denn er enttäusche ihn und werde verstoßen, die Geheimtasche im beschreibt das, was das Leben zum Abenteuer macht, näm- Rockfutter nützt mir nichts, in der ersten eigenen Stellung lich eine Reise ohne die Möglichkeit einer Rückkehr, und er werde ich gemobbt und rausgeworfen, zweifelhafte Reiseerspart es gleichzeitig seinem Autor, diese Reise antreten begleiter hängen sich an mich (wie bei „Pinocchio“), ich zu müssen, denn das noch größere Abenteuer, das größte werde eingesperrt und als Sklave missbraucht. Und immer wenn ich „den Erwachsenen“ etwas erklären will, selbst überhaupt, ist ja das Schreiben. Aber das ist alles schon viel zu sehr vom Inhalt her gedacht, den Wohlwollendsten, komme ich nicht zu Wort und sie das Großartige an Kafka ist ja die Ausführung. Jemand, der glauben mir nicht (wie bei „Alfons Zitterbacke“). in einem Brief eine Selbstmordvision beschreibt, bei der er Die Wirklichkeit war schneller. Die Einschlaffantasie, in sich selbst durch ein Treppenhaus fallen sieht, „kopfschüt- den Westen zu gehen und dort als Redner im Bundestag für telnd vor Ungeduld“, weil der Sturz offenbar zu lange dau- Furore zu sorgen, hat bei mir einer anderen Fantasie Platz ert, bewegt sich auf einer höheren Ebene von Humor. Kafka gemacht, mir durch mein Schreiben im Jenseits einen Platz ist ein Slapstickautor, der nicht zu erwähnen vergisst, dass im selben Trompetenensemble zu erarbeiten, in dem dort die Kleidung in Karls Koffer tagelang vom Geruch einer mit auch Kafka tätig ist: „Karl erhoffte sich in der ersten Zeit eingepackten Veroneser Salami durchtränkt ist. Oder wenn viel von seinem Klavierspiel und schämte sich nicht, es von einem Slowaken auf dem Schiff heißt: „Aber kaum wenigstens vor dem Einschlafen an die Möglichkeit einer war die Nacht gekommen, erhob er sich von Zeit zu Zeit unmittelbaren Beeinflussung der amerikanischen Verhältvon seinem Lager und sah traurig zu Karls Koffer hinüber.“ nisse durch dieses Klavierspiel zu denken.“ Wer hätte je einen Dieb traurig auf sein künftiges Diebesgut schauen lassen? Was muss man von Amerika wissen, um es zu beschreiben? Kafka kennt nur Gerüchte, wie dass Gefahren „besonders Jochen Schmidt, geboren 1970 in Berlin, studierte Informatik, Germanistik und Romanistik. Schmidt ist Mitbegründer der Berliner Lesebühne „Chaussee der Enthusiasten“ und verfasst regelmäßig Kolumnen für verschiedene Tageszeitungen. Nach „Triumphgemüse“ (2000), „Müller haut uns raus“ (2002), „Schmidt liest Proust“ (2008), „Weltall. Erde. Mensch.“ (2010) und „Dudenbrooks“ (2011) erschien 2013 der Roman „Schneckenmühle“, dessen Bühnenadaption in der Regie von Robert Lehniger am Staatsschauspiel Dresden uraufgeführt wurde. 61 Bernarda Albas Haus Tragödie von Federico García Lorca Premiere im April 2015 im Schauspielhaus Regie: Andreas Kriegenburg Bittere Systeme Der Regisseur Andreas Kriegenburg über die Wiederbegegnung mit einem Dichterkosmos Zweimal ist mir Federico García Lorcas „Bernarda“ schon begegnet, zweimal schon habe ich dieses wunderbar dunkle Stück inszenieren dürfen, in München und in Hamburg, war zu Gast in ihrem „Haus des Schweigens“, ihrem „Haus der Trauer“, habe Zeit verbracht mit ihren Töchtern, habe sie beobachtet, mit ihnen gelebt. Und schon zweimal hat der Selbstmord der Jüngsten, Adela, der Wilden, Unzähmbaren, die sich nicht einsperren lassen will, ihre Gier auf Leben, auf Sinnlichkeit und Liebe, auf Freiheit, mich in dunkelste Trauer gestürzt. Und nach beiden Arbeiten wusste ich, ich bin noch nicht fertig mit Lorcas Stück, und ich weiß schon, auch wenn ich „Bernarda Albas Haus“ jetzt in Dresden wieder auf die Bühne bringen darf, werde ich immer noch nicht „fertig“ sein mit diesem sehr besonderen Werk. Nicht weil „Bernarda Albas Haus“ so kompliziert ist, so komplex und schwierig. Im Gegenteil, eigentlich ist es ein sehr einfaches Stück mit einer sehr einfachen, klaren Geschichte. Auch wenn diese umso schmerzvoller ist. Die Witwe Bernarda Alba, vor wenigen Tagen verstarb der ungeliebte Mann, verhängt über ihr Haus, über sich und ihre fünf Töchter, eine acht Jahre dauernde Trauerzeit, Schweigenszeit. Sie folgt der Tradition, erfüllt, was die Gesellschaft von ihr erwartet. Obwohl sie diese Gesellschaft insgeheim verachtet, überall sieht sie nur Missgunst und Neid. Aber nie würde sie sich gegen die Tradition, gegen die Ordnung stellen können, sie hat von ihrer Mutter gelernt, was sie jetzt an ihre Töchter weitergibt. „So war es schon immer“ steht auf den Mauern ihres Gefängnisses, in das sie sich verkrochen hat, von der Freude hat sie sich vor langer Zeit verabschiedet, Disziplin und Demut gegen Gott sind ihre Begleiter. Und auch die Angst, einmal zu sein wie ihre Mutter, die „verrückt“ geworden ist, zerbrochen am freudlosen Leben, und die in ihrem Zimmer eingesperrt gehalten wird, völlig abgeschieden von der Welt, und dennoch alles am klarsten zu sehen scheint. Dieses Haus ist voll von Leben, genauer, ist eigentlich voll von Leben. Fünf junge Frauen warten auf die Liebe, auf ihre zukünftigen Ehemänner, auf die Sinnlichkeit, warten darauf, dass ihr eigenes Leben endlich beginnt. Für sie ist das Diktat ihrer Mutter, Jahre in Trauer und Schweigen zu verbringen, grausame Folter. Weitere Jahre in Duldungsstarre stehen ihnen bevor, sie sehen ihr Leben entschwinden, durch Gitter und Mauern von aller Lust getrennt. Nur 62 nachts dürfen sie das Haus verlassen, dürfen den Abend Andreas Kriegenburg zählt zu im Hof verbringen, in ihre schwarzen Trauerkleider einge- den prägenden Regisseuren des zeitgenössischen Theaters. zwängt hören sie den Hengst im Stall mit den Hufen schla„Bernarda Albas Haus“ ist seine gen, weil er die Stute des Nachbarn wittert. Und auch in dritte Schauspielregie in ihnen bebt die Begierde, die Gier nach Leben, nach Lust, Dresden. Eine ausführliche Biografie finden Sie auf nach Männern, nach Freiheit. A Seite 23 Lorcas „Bernarda“ ist ein Stück über die Freiheit, über die Folter des Eingesperrtseins, darüber, wie Menschen in zu engen Kammern verbogen werden und am Ende am Verlust der Freiheit zerbrechen. Aber es ist auch eine bittere Analyse, wie Systeme der Unterdrückung funktionieren, wie sie sich immer wieder selbst reproduzieren, wie immer wieder eine gequälte Seele ihren Schmerz auf eine andere überträgt, wie Unrecht immer wieder neues Unrecht stiftet. Die fünf Schwestern, alle gemeinsam eingesperrt, gleichermaßen unglücklich, belauern einander, beobachten und bespitzeln sich, sie bestehlen einander, denunzieren einander gar, jede neidet der anderen das kleinste bisschen erträumte Freiheit. Als Adela sich heimlich ihr grünes Kleid anzieht, wenige Minuten am Tag nicht im Schwarz der alles überwuchernden Trauer verbringt, erntet sie von ihren Schwestern nur Spott und Verachtung und Gewalt. Es scheint, als seien die Schwestern sowohl Insassen ihres Gefängnisses als auch dessen strengste Wärter. Dantons Tod von Georg Büchner Premiere im Mai 2015 im Schauspielhaus Regie: Friederike Heller Gezi – Tahrir – Majdan Ein (etwas) ratloser Versuch über Revolution, Glück und Moral von Justus H. Ulbricht Wer immer in den legendenhaft verklärten altbundesrepu- („Dantons Tod“, I. Akt, 3. Szene). Robespierre wurde für blikanischen 1970er-Jahren in einer studentischen Wohn- mich zum Antityp der von uns ersehnten revolutionären gemeinschaft das denkbar stillste Örtchen aufsuchte, fand Aktion, an deren Notwendigkeit wir festhielten, ohne zu sich umstellt von den Ikonen der (Welt-)Revolution und er- wissen, wie Umbrüche ohne Leichen zu bewerkstelligen wären. Dass die Revolution schließlich auch Robespierre so munternden Sentenzen einzelner ihrer Vordenker. Da lächelte von oben herab Angela Davis auf den nach- wie andere ihrer Kinder fraß, tröstet(e) wenig … denklich Hockenden. Ihr gegenüber Lenin oder der gut Heute sind wir älter, weiser (?), bequemer (!) geworden, aussehende Zigarrenraucher aus dem bolivianischen distanzierte Augenzeugen revolutionärer Umtriebe jegliDschungel, der bei den Kommilitoninnen besonders gut cher Art. Wir gewahren in sicherem Abstand auf europäiankam. Ernst schaute uns auch der Rauschebart aus Trier schen Flachbildschirmen das Umschlagen von Freiheitszu, dessen „Kapital“ war, dass wir es noch lasen in freiwilli- wünschen in Tötungsfantasien und Mord. Schon die gen Arbeitsgemeinschaften. Wenn wir uns nicht gar mit iranische Revolution kippte einst ins diktatorische Gegender „Dialektik der Aufklärung“ quälten. Wo allerdings teil, und der „Leuchtende Pfad“ führte ins „Herz der FinsErich Frieds Satz „Es ist was es ist, sagt die Liebe“ zu lesen ternis“. Aus dem Arabischen Frühling ist der Winter mitwar, musste man davon ausgehen, dass die WehGe-nossen menschlicher Werte geworden. Die revolutionären Ideen das markige Motto des jungen Alfred Kurella vergessen auf dem Tian’anmen wurden einst von den Panzern der hatten: „Mädchen machen zufrieden, aber nicht revolutio- Macht zermalmt, die Demonstranten vom Tahrir löschten när!“ – ein Satz, den Büchners Danton vermutlich unter- die Flamme der Freiheit selber aus und entzündeten den schrieben hätte. Auch das Antlitz Bonhoeffers oder gar Brand des Bürgerkriegs. Ob die schleichend-diktatorische die sanfte Miene Sophie Scholls legten den Verdacht nahe, Erdoganisierung der Türkei die Blütenträume vom Gezidass der kämpferische Elan politisch-revolutionären Ein- Park verdorren oder neu erblühen lassen wird, ist offener greifens weicheren Haltungen gewichen war. Härte ver- denn je. Zehn Jahre nach 2004 schauen wir beunruhigt zum bürgten hingegen die Konterfeis von „Meinhof und Baader“. Majdan und fragen, ob die Orangene Revolution im Grau Schließlich ließ uns der Satz Blochs „Auf 1000 Kriege der Apparatschiks, der Oligarchen und der Gewöhnlichkeit kommt nur eine Revolution. So schwer ist der aufrechte politischer Korruption zu verblassen droht. Gang!“ stutzen – welchen wir dann im Aufstehen übten, Auf der Bühne sehen wir nicht, wo es langgeht – aber wo um uns weiteren Tagesgeschäften zuzuwenden wie den un- es enden kann, wenn man bestimmte Pfade nach Utopia zähligen Blaumatrizen abgerungenen Flugblättern, der beschreitet, auf Abwege gerät und in Sackgassen endet, nächsten Diskussion um den am entferntesten liegenden weil man vergessen hat, dass der Mensch ein Mensch ist … Und weil das so ist, gilt für das Leben und die Geschichte, Konflikt, der nächsten Aktion … und so fort. Über die „notwendige“ Gewalt beim revolutionären Wan- für Revolten und Revolutionen das, was Beckett den Schaudel der Welt sprachen wir viel, über die Opfer weniger; es spielern, Regisseuren und Dramaturgen ins Stammbuch sei denn, es handelte sich um die jeweiligen Revolutionäre geschrieben hat: „Ever tried, ever failed. No matter. Try selbst, die von der jeweiligen „Konterrevolution“ und „dem again. Fail again. Fail better!“ Faschismus“ bedroht oder gar ausgelöscht wurden. Jara, Schauen wir also Danton und den Seinen beim Scheitern Theodorakis, Dylan und Baez sangen im Hintergrund, zu, geben wir uns selbst Gedankenfreiheit, lassen wir uns wenn wir tote Polizisten, bombenzerfetzte GIs, sterbende erschüttern durch die Abgründe, von denen jeder Mensch Banker und liquidierte Arbeitgeberpräsidenten allzu leicht- einer ist (wie Woyzeck meint). fertig als „Kollateralschäden“ der Weltgeschichte abbuch- „Und – Leute – nüch vajessen“ (Mario Barth): „Du lass dich nicht verhärten, in dieser harten Zeit“ („Ermutigung“, Wolf ten (das verzeihe ich uns nie). Dann, in ein und demselben Semester: Büchner-Seminar, Biermann) – auch wenn man weiß: „morgen sind wir durchSolschenizyns „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“, gelaufene Schuhe, die man der Bettlerin Erde in den Schoß das erste Seminar zum Stalinismus. Da dämmerte Huma- wirft“ (Danton zu Camille). nitäres herauf, das – einst christkatholisch begründet – nie ganz verschwunden war und stille Zweifel am Recht von Menschenopfern je schon genährt hatte. Irgendwie wurde man dann allmählich zu Danton: des Kämpfens müde, ernüchtert von der blutigen Spur des „Kampfes“ für den „Fortschritt“ der Weltgeschichte, angeekelt von der Symbiose von Tugend und Terror, die ein asketischer Rechtsanwalt vor dem Jakobinerklub in intellektueller Brillanz mit amoralischer Härte entfaltete Justus H. Ulbricht ist als Germanist, Historiker und Pädagoge ein Grenzgänger zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit (Erwachsenen- und Jugendbildung, Ausstellungen). Zahlreiche Vorträge, Bücher und Aufsätze zur Geschichte des deutschen Bildungsbürgertums, zur Kulturgeschichte Mitteldeutschlands und zur Religionsgeschichte im 20. Jahrhundert. Er lebt als freier Wissenschaftler und Publizist seit Oktober 2009 in Dresden. 63 Lehman Brothers. Aufstieg und Fall einer Dynastie von Stefano Massini Deutschsprachige Erstaufführung im Mai 2015 im Schauspielhaus In Kooperation mit dem Schauspiel Köln Regie: Stefan Bachmann Von da oben, von droben, wird Le Brothers die Erd Der Untergang der Titanic Stefano Massini beendet „Lehman Brothers.“ 1984 mit dem Verkauf der Bank an American Express, das Ende, den Zusammenbruch spart er aus. Die Finanzjournalistin Meike Schreiber erinnert sich unter dem Eindruck von Stefano Massinis Epos an die letzten Tage der Bank im September 2008. „Was, wenn alle auf einmal ihr Geld zurückhaben wollen?“, fragt Robert Lehman in Stefano Massinis „Lehman“-Trilogie, es ist die Zeit kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Und nur einen Wimpernschlag der Geschichte später, 1929, wollen plötzlich tatsächlich alle ihr Geld zurück – an den Börsen wie an den Bankschaltern. Schwarzer Freitag, Inflation, Massenarbeitslosigkeit, der Aufstieg der Nazis: Die Ereignisse von damals haben sich auch in das Gedächtnis späterer Generationen eingebrannt. Das Bankhaus Lehman Brothers indes überlebt den großen Crash. So, wie es Jahre zuvor schon den Amerikanischen Bürgerkrieg überlebt hat. Lehman scheint unverwundbar. 2008, knapp achtzig Jahre später also, geht erneut die Angst um. Davor, dass den Banken die Kunden weglaufen und das Misstrauen überhandnimmt. Nichts da, beschwichtigen die Banker und sprechen davon, dass es sich „nur“ um eine Vertrauenskrise handelt. Sie wissen, dass Vertrauen ihr wichtigstes Gut ist. Sie hoffen, dass sich die Krise in Luft auflöst. Sie ahnen, dass sie dieses Mal nicht davonkommen werden. Und sie lügen: Fundamentale Probleme? Gibt es nicht. Der Schwächeanfall der us-Wirtschaft, des Häusermarkts? Nur kleine Wachstumsdellen. „Also lächeln“, wie es in Massinis Epos heißt. Doch damals wie heute erweist sich der zur Schau gestellte Optimismus als trügerisch und falsch. Der Name Lehman Brothers ist fortan ein Menetekel des Untergangs. Wie der Ozeanriese Titanic, wie das Luftschiff Hindenburg. 157 Jahre nach ihrer Gründung durch drei Auswanderer aus dem fränkischen Rimpar, 2008 also, ist Lehman Brothers 64 die viertgrößte Investmentbank der Welt. An der Börse Mil- Meike Schreiber ist Journalistin liarden wert, mit mehr als 28 000 Mitarbeitern weltweit – in Frankfurt. Von 2002 bis 2012 war sie Redakteurin bei der viermal so viele, wie Rimpar Einwohner hat. Geführt wird „Financial Times Deutschland“ die Bank von London und New York aus. Von Managern, die (ftd) und berichtete in dieser pro Jahr zweistellige Millionenboni kassieren und mit allem Zeit über Banken und die zocken, was möglich ist. Sie sind die Masters of the Uni- Finanzkrise. Nach dem Ende der ftd gründete sie zusammen verse, allenfalls vergleichbar mit denen von Goldman Sachs. mit Heinz-Roger Dohms das Was hat Lehman nicht alles erlebt, überlebt in den letzten Pressebüro SchreiberDohms. Jahren: 1984 die Übernahme durch American Express, 1994 die Rückkehr an die Börse, das Ende der Dotcom-Euphorie zur Jahrtausendwende, natürlich die Terroranschläge vom 11. September 2001, die das Lehman-Datencenter im Nordturm des World Trade Center zu einem Klumpen Stahl haben schmelzen lassen. Mit Baumwolle und Kaffee wie einst dealt Lehman schon lange nicht mehr. Selbst der Aktienhandel spielt keine so große Rolle wie bei der Konkurrenz. Es ist das Geschäft mit Anleihen, vor allem aber mit Immobilienkrediten, das Lehman zu einem Riesen der Wall Street macht. Und ihren Managern Kraft, Stolz und Übermut verleiht. Als 2007 die Hauspreise in den usa zu fallen beginnen, leidet auch Lehman. Und trotzdem kauft der expansionswütige Bankchef Dick Fuld Archstone, die zweitgrößte Wohnungsgesellschaft der usa. Der Preis von sagenhaften 22 Milliarden Dollar ist Ausdruck der Maßlosigkeit einer Epo- n ganz oben ehman de beherrschen. che und ihrer Protagonisten, die wie auf Droge scheinen. Auch der Staat als letzte Bastion springt nicht ein. Verkörpert Ihre Drogen sind Macht und Geld. Und Süchtige wie Fuld, wird er ausgerechnet von US-Finanzminister Henry „Hank“ der wegen seines rauen Umgangstons „Gorilla“ genannt Paulson, einem früheren Chef des Erzrivalen Goldman Sachs. wird und für 2007 rund 40 Millionen Dollar Bonus kassiert, Wie sagen die Lehman-Brüder in Massinis Stück zum Ausbruch der Weltwirtschaftskrise: „Die ersten Banken, die in gibt es viele. Doch es ist das letzte Bonusjahr für Fuld. Seit dem Frühjahr die Krise geraten, werden sie ungebremst abstürzen lassen, 2008 kämpft er mit einem Gegner, der genauso ruchlos ist ohne einen Finger zu rühren: Der Staat muss zeigen, dass er wie er – und vielleicht noch gieriger: David Einhorn, Grün- uns nicht hilft.“ Das Verhältnis zwischen Staat und Banken, der und Chef des Hedgefonds Greenlight, wettet gnadenlos es war schon immer ein heikles. auf den Verfall der Lehman-Aktie. In aller Öffentlichkeit se- Undenkbar ist heute, dass Staaten nochmals eine Großbank ziert er die Bilanz der Bank, weist Fuld Ungereimtheiten unkontrolliert in die Pleite rutschen lassen. Das zeigt sich, nach und treibt ihn zur Weißglut. „Ich will ihm das Herz als nur drei Wochen nach der Lehman-Tragödie in Deutschherausreißen und es vor seinen Augen essen, während er land plötzlich die Hypothekenbank Hypo Real Estate am lebt!“, brüllt Fuld seinen Managern entgegen, als die Spra- Abgrund steht und mit 100 Milliarden Euro Steuergeldern che auf Einhorn kommt. Es ist ein episches Drama, und aufgefangen werden muss. Es ist nicht der letzte „LehmanMoment“, Rettungen in letzter Sekunde gab es seither eiFuld ahnt, dass er seinen Meister gefunden hat. Im September 2008 überschlagen sich die Ereignisse. Am nige: Commerzbank, Griechenland, die Eurozone. zehnten des Monats meldet Lehman abermals einen milli- „Die Banken werden nicht länger frei sein: Der Staat wird ardenhohen Quartalsverlust und geht ebenso verzweifelt uns kontrollieren wollen, sie werden Regeln, Normen, wie vergeblich auf die Suche nach frischem Kapital. Grenzen setzen“, lässt Massini die Lehman-Brüder 1929 Fusionsverhandlungen mit Wettbewerbern scheitern, Kun- sagen. Wie weitsichtig. Das Vertrauen aber, es ist nicht den ziehen ihr Geld ab. Das Vertrauen, diese schwachbrüs- zurück. Bis heute nicht. tige Währung, ist weg. Für immer. Am 15. September, einem Montag, meldet Lehman Insolvenz an – die wohl folgenreichste der Wirtschaftsgeschichte. Fuld hat seine Bank so krachend und gewaltig versenkt wie einst Edward John Smith die Titanic im Nordatlantik oder Max Pruss die Hindenburg in Lakehurst, New Jersey. Bis heute gilt sein Gesicht als gierige Fratze des Kasinokapitalismus. 65 Lars Jung zu lang!! 66 Jan Maak 67 Duran Özer 68 Karina Plachetka 69 Wir sind keine Barbaren! von Philipp Löhle Premiere am 14. September 2014 im Kleinen Haus 1 Regie: Barbara Bürk WIR bleiben z Wo S Am Schönsten Winnetou oder der Fremde in uns Die Begegnung mit dem Fremden und die Angst vor dem Unbekannten sind zentrale Themen im Stück „Wir sind keine Barbaren!“ Der Dramaturg und Kurator Arved Schultze denkt über diese Motive aus einer ganz anderen Richtung nach und geht unter Zuhilfenahme eines wohlbekannten sächsischen Literaturhelden auf die Suche nach dem Umgang mit dem Anderen. Kaum verklingen die letzten Töne des „Ave Maria“ in der Prärie, da haucht Winnetou Old Shatterhand die letzten Worte ins Ohr: „Charly, ich glaube an den Heiland. Winnetou ist ein Christ. Leb wohl …“ Er stirbt in seinen Armen. Über ihnen auf einem Felsen stehen zu einem Chor vereint die Settler aus dem Fichtelgebirge, die mit dem Lied der „Königin des Himmels“ den letzten Wunsch des sterbenden Apatschenhäuptlings erfüllt haben. Der Kampf mit den feindlichen Sioux hat ihn niedergestreckt, aber gerade noch rechtzeitig gelingt es den Freunden, die aus so verschiedenen Welten kommen, ihre Blutsbrüderschaft auch auf geistiger Ebene zu besiegeln, im christlichen Glauben. Wir wissen, dass Karl May niemals Nordamerika betreten hat und seine Geschichten pure Fiktion sind. Doch für ihn lagen Dichtung und Wahrheit so nah beieinander, dass er am Ende diese nicht mehr zu trennen wusste. Winnetou, einst der Fremde, wurde zu einem unverzichtbaren Teil seiner eigenen Identität. Und so komponierte er sogar den 70 Chorsatz des „Ave Maria“ selbst. Er lässt ihn feierlich sterben, aber Winnetou darf nicht in seinem Glauben an den Großen Manitu aus der Welt treten, denn dann würden die Freunde an der Schwelle des Todes getrennt. Winnetou würde in den ewigen Jagdgründen verschwinden, in die Karl ihm – trotz aller Verbundenheit – nicht folgen möchte. Und so ist es an Winnetou, sich zu bekehren, um ein posthumes Wiedersehen im Paradies zu ermöglichen. Noch tief im kolonialistischen Sendungsbewusstsein des 19. Jahrhunderts steckend, treibt May hier die Harmonisierung der Freundschaft bis zur Perfektion. zuhause n ist Das Überraschende an dieser Sterbeszene ist, dass der Leser, nachdem er über gut 1 500 Seiten durch den Wilden Westen geritten ist, fiese Indsmen und Widersacher erlegt hat, am Pfahl gemartert, Kalumet geraucht, Blut mit und für seinen Bruder vergossen und mit Sam Hawkens in der Badewanne gesessen hat, schließlich mit der eigenartigen Erhabenheit des aus bayerischen Kehlen strömenden „Ave Maria“ wieder in seine eigene langweilige Existenz zurückgeschickt wird. Dieser Kontrast setzt auf eine emotionale Wendung der Geschichte, die den tiefen Wunsch ausdrückt, dass die Freundschaft, in der Old Shatterhand eine Heimat gefunden hat, alle kulturellen Differenzen auflöst und sich das Fremde einverleibt. Das letzte „Un-heimliche“ des Fremden wird eliminiert. Doch warum kann das Fremde nicht bleiben – parallel weiterexistieren in seiner Unauflösbarkeit? Wenn das Fremde die ästhetische Harmlosigkeit des Exotischen überschreitet, entstehen – so scheint es – damals wie in der Gesellschaft von heute Angst und Unbehagen. Und obwohl unser Zusammenleben vielfältiger, globalisiert, schneller im Wandel und Austausch mit dem Anderen geworden ist, sind Xenophobie, Rassismus und offene Fremdenfeindlichkeit allgegenwärtig. Die bulgarisch-französische Philosophin und Psychoanalytikerin Julia Kristeva verknüpft in ihrer Untersuchung „Fremde sind wir uns selbst“ das Phänomen der kollektiven Angst vor dem Fremden mit der Angst des Individuums vor einer eigenen, ihm fremden „verborgenen Seite“. Hierbei geht sie von der existenzialphilosophischen Position aus, dass jedes Individuum in seiner Subjektivität gefangen und mit sich allein ist. Der Mensch kann sich selbst nicht sehen, nicht vollständig erkennen. Eine Sicherheit darüber, wie und was er ist, wird es nie geben, auch nicht wenn er versucht, seine Individualität in die explizit vereinheitlichte Identität einer Gruppe einzugliedern. Eine Gesellschaft, so Kristeva, kann sich nur dann ändern, wenn der Staatsbürger aufhört, sich als Teil des Kollektivs zu betrachten, und seine eigene unaufhebbare Fremdheit entdeckt. Erst wenn wir erkennen, dass wir alle eine Gemeinschaft aus Fremden bilden, dann entsteht die Möglichkeit der offenen, angstfreien Begegnung mit dem Anderen. In der Erzählung „Satan und Ischariot“, die Karl May einige Jahre nach der „Winnetou“-Trilogie veröffentlichte, schildert er einen Überraschungsbesuch in Dresden: „Und da stand er unter der Thür! Winnetou, der berühmte Häuptling der Apatschen in Dresden! Und wie sah der gewaltige Krieger aus! Eine dunkle Hose, eine ebensolche Weste, um welche ein Gürtel geschnallt war, einen kurzen Saccorock; in der Hand einen starken Stock und auf dem Kopfe einen hohen Cylinderhut. Ich sprang auf ihn zu. Wir Arved Schultze ist Dramaturg küßten uns wieder und immer wieder, betrachteten uns in und Kurator an diversen Theatern sowie für Festivals im den Zwischenpausen und brachen schließlich in ein herzlideutschsprachigen Raum und ches Gelächter aus, was bei dem Apatschen noch nie vorge- in Südamerika. Er kuratierte kommen war. Die Gestalt, in welcher er seinen Shatterhand u. a. das Kleistfestival zum 200. vor sich sah, war gar so zahm, und die Figur, welche der Todestag des Dichters 2011 am Maxim Gorki Theater Berlin tapferste Krieger der Apatschen bildete, war so friedlich und war in Dresden mitverantund so drollig, daß ein Hexenmeister dazu gehört hätte, wortlich für die Ausstellung sich des Lachens zu enthalten.“ „Das neue Deutschland. Von Beide Freunde haben sich inzwischen verwandelt. Der Migration und Vielfalt“ im Deutschen Hygiene-Museum. Apatsche wirkt plötzlich europäisiert, sein unerwartetes Lachen markiert in diesem Moment den Höhepunkt seiner Assimilation. Aber was ist das für ein Lachen? Der Schrecken über die Zivilisation, die sie am Ende unterworfen hat, bricht lachend heraus und verbindet die beiden. Die vermeintliche Heimat Dresden wird zur Fremde, die die Abenteurer zur Verkleidung zwingt. Wovor müssen wir mehr Angst haben? Vor dem Fremden oder vor einer Zivilisation, in der unsere unterschiedlichen Formen von Fremdheit nicht parallel existieren dürfen? Offenbar zweifelte auch Karl May später an der Echtheit heimatlicher Harmonie. In dieser Szene wird das Fremde nur versteckt, aber es bleibt als geheimes Freundschaftszeichen bestehen. Die vertraute Fremdheit Winnetous bedeutet für den alt gewordenen Charlie das Versprechen, dass auch die Idee der individuellen Freiheit bewahrt bleibt. Denn: „Ich ahnte, weshalb er den Hut nicht abnahm; er hatte die Fülle seines reichen, dunkeln Haares unter denselben verborgen. Ich nahm ihm den Cylinder ab; da wurde es frei und fiel ihm wie ein Mantel über die Schultern und weit auf den Rücken herab.“ 71 Die Inszenierungen der Bürgerbühne 2014/2015 Merlin oder Das wüste Land von Tankred Dorst Premiere am 27. September 2014 im Kleinen Haus 2 Regie: Kristo Šagor Katzelmacher von Rainer Werner Fassbinder Premiere am 12. Dezember 2014 im Kleinen Haus 3 Regie: Robert Lehniger Mischpoke Eine jüdische Chronik von 1945 bis heute Uraufführung im Februar 2015 im Kleinen Haus 3 Regie: David Benjamin Brückel Soldaten Ein Dokumentartheater Uraufführung im März 2015 im Kleinen Haus 3 Regie: Clemens Bechtel Alles im Fluss Ein Projekt über die Elbe und den Wandel der Zeit Uraufführung im April 2015 im Kleinen Haus 3 Regie: Uli Jäckle Wir glauben daran, dass Theater mit Bürgern eine neue Kunstform ist! Auch in dieser Saison zeigt die Bürgerbühne wieder fünf Inszenierungen. Doch auch anderswo wird kräftig Bürgertheater gemacht – wir baten vier Bürgerbühnen um einen Blick auf ihre Arbeit Stefanie Bub (Koordinatorin der Bürgerbühne Mannheim): In Mannheim existiert die Bürgerbühne seit 2012 – gegründet wurde sie auf Initiative des Schauspielintendanten Burkhard C. Kosminski, der regelmäßig in Dresden inszeniert und dort die Bürgerbühne als große Bereicherung für Theater und Stadt erlebt. Die Mannheimer Bürgerschaft fühlt sich ihrem Theater sehr verbunden, außerdem ist Mannheim eine bunte, vielfältige und offene Stadt. Es wäre absurd, wenn sich dies nicht auch im Theater widerspiegeln würde. Das Besondere bei unserer Bürgerbühne ist, dass sich alle Sparten an der Arbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern beteiligen. Die Oper hat kürzlich das Geräuschorchester gegründet, dort entstehen musikalisch-szenische Kompositionen von und mit Mannheimer Bürgern. Im Schauspiel realisieren wir unterschiedlichste Projekte: Romanadaptionen, biografisches Theater, das auf Interviewmaterial der Spieler beruht, und eigens von Autoren für die Bürgerbühne geschriebene Stücke. Insgesamt bringen wir pro Spielzeit zwei bis drei Produktionen zur Premiere, die im Repertoire verankert sind – zwei im Schauspiel und eine in unserer Kinderund Jugendtheatersparte „Schnawwl“. Wir bieten außerdem zehn Spielclubs und einen Workshop pro Monat an. Birgit Lengers (Leiterin Junges dt, Berlin): Das Junge dt existiert seit Beginn der Intendanz von Ulrich Khuon in der Spielzeit 2009/2010. Wie positioniert man sich in so einer großen und diversifizierten Stadt, in der es zahlreiche andere Theater und Kulturangebote gibt? Wie schafft man eine Durchlässigkeit, überschreitet die Grenzen oder inszeniert die Schwelle zwischen dem Theater und der Stadt? Wie kann man sich mit unterschiedlichen Gruppen, Themen und Stimmen verbinden? Wir schaffen künstlerische Arbeiten mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen für ein Publikum jeden Alters. Neben den drei bis vier Inszenierungen, die in einem professionellen Rahmen entstehen und im Repertoire gezeigt werden, gibt es bei uns zwei Spielclubs. Wichtig ist uns außerdem das Herbstcamp, eine große Ferienakademie. Dort kommen junge Leute in Kontakt mit ganz unterschiedlichen Künstlern und Kunstformen. Zu Beginn haben viele gedacht: Warum braucht jetzt ausgerechnet das Deutsche Theater so etwas? Aber im Laufe der Zeit hat sich unsere Arbeit im Haus immer stärker durchgesetzt. Mittlerweile gibt es übrigens immer mehr gemeinsame Projekte, die mit Profischauspielern und mit Laien besetzt sind. Es spielt immer weniger eine Rolle, ob eine Inszenierung vom Jungen dt oder vom dt kommt. Diese Grenzverwischung ist absolut positiv. 72 Jens Christian Lauenstein Led (Dramaturg der Borgerscenen des Aalborgteater, Dänemark): Wir haben in Aalborg eine Bürgerbühne nach dem Dresdner Vorbild gegründet. Aalborg ist eine klassische Arbeiterstadt. Unsere Bürgerbühne arbeitet oft mit dokumentarischem Material, wie zum Beispiel in unserem Projekt „Romeo og Julie lever!“, in dem ältere Eheleute darüber erzählen, was gewesen wäre, wenn Romeo und Julia sich nicht nur eine Woche gekannt hätten, sondern viele Jahre. Wir benennen darin Dinge so, wie sie tatsächlich sind und nicht wie es sich ein Autor ausgedacht hat. Und das kommt in Aalborg an. Andererseits sind die Bürger noch ein bisschen zurückhaltend, und die meisten wollen lieber zuschauen als sich beteiligen. Wir machen zwei Inszenierungen pro Spielzeit und haben den „Bürger-Donnerstag“ erfunden: An einem Donnerstag probten wir beispielweise als Sprechchor den Aufstand unter dem Motto „wütende Bürger“ ein andermal hieß das Thema „gläubige und zweifelnde Bürger“ und an einem weiteren Donnerstag haben wir ein Bürgerdinner nach dem Dresdner Vorbild veranstaltet. Jan Linders (Schauspieldirektor des Badischen Staatstheaters Karlsruhe): Wir wollten in Karlsruhe den Dresdner Begriff nicht kopieren und haben unsere neue Sparte 2011 in provokanter Absicht Volkstheater genannt. Es ging los mit „100 Prozent Karlsruhe“ in Zusammenarbeit mit dem Bundesverfassungsgericht. Hier wurden 100 Karlsruher als Repräsentanten der Stadt von der Performancegruppe Rimini Protokoll befragt. Außerdem haben wir mit dem französischen Regisseur Pascal Rambert die Performance „Eine (mikro)ökonomische Weltgeschichte, getanzt“ auf Karlsruhe übertragen. Derzeit arbeiten wir mit Gerardo Naumann, einem Deutsch-Argentinier, an „100 Dokumente“. Darin entwickeln wir 100 kurze Soli mit 100 Karlsruhern. Alle diese Stücke haben wir für unsere große Schauspielbühne produziert. Daneben steht die theaterpädagogische Arbeit der Spielclubs. Im Konzertbereich haben wir sogenannte „geteilte Pulte“ eingeführt, das heißt, Laien und Profis musizieren jeweils gemeinsam an einem Pult. Auch im Tanzbereich bringen wir alle zwei Jahre ein Projekt heraus, das Karlsruher Volkstheater ist also ähnlich wie die Mannheimer Bürgerbühne spartenübergreifend. Unsere Motivation ist es, einerseits den Kontakt zur Stadt zu finden, weil wir als künstlerisches Team neu in der Stadt sind, andererseits aber auch eine neue Ästhetik zu entwickeln, die mit professionellen Schauspielern, Sängern, Tänzern, Musikern so nicht möglich ist. Wir glauben fest daran, dass Theater mit Bürgern eine neue Kunstform ist! Zwischenspiel nach dem Roman von Monika Maron Uraufführung am 5. Oktober 2014 im Kleinen Haus 3 Regie: Malte Schiller Geistergespräche im Park Der Literaturredakteur Michael Hametner über „Zwischenspiel“ als Totenbeschwörung Heiner Müller hat 1988 in einem Gespräch erklärt: „Die Funktion von Drama ist Totenbeschwörung – der Dialog mit den Toten darf nicht abreißen, bis sie herausgeben, was an Zukunft in ihnen begraben worden ist.“ Der Roman von Monika Maron betreibt Totenbeschwörung. Vergangenheit ist, das sieht Monika Maron nicht anders als Heiner Müller, der entscheidende Stoff, aus dem Zukunft wird. Es beginnt so: Ruth, 61, Mitarbeiterin in einem Museum für bildende Kunst in Berlin, hat an diesem Tag eine Verabredung. Eine von der Art, wie wir sie nicht so gern haben. Ruth will zum Friedhof. Olga, die Neunzigjährige, wäre beinah Ruths Schwiegermutter geworden und hat die letzte Verabredung kurz zuvor abgesagt. Nachgeholt werden kann sie nicht mehr, Olga ist tot. Heute ist ihre Beerdigung. Aber Ruth, die am Vortag Blumen gekauft hat, sich im Büro entschuldigt hat, wird den Friedhof nie erreichen. Schuld ist eine Himmelsbeobachtung. Als sie auf ihrem Balkon eine Zigarette raucht, sieht sie am Himmel Wolken ziehen, alle in eine Richtung, alles normal, wäre da nicht eine kleine Wolke, die in die entgegengesetzte Richtung schwebt. Das überraschende Phänomen beobachtet Ruth etwas zu lange, denn die gleißende Sonne blendet sie. Danach ist ihr Sehen fürs Erste verändert. Eine Sehstörung. Statt des Friedhofs erreicht Ruth einen ihr bisher unbekannten Park. Und dort trifft sie Olga, die tote Olga. Alles eine Sehstörung? Vielleicht. Plötzlich kann das Gespräch mit Olga nachgeholt werden. Wie kann man mit einer Toten reden? In Monika Marons Roman funktioniert es und ist nicht einmal großer Hokuspokus. Für die Autorin sind es nach außen gewendete Selbstgespräche, und weil Friedhofstag ist, sind es Selbstgespräche mit Toten. Schließlich hat Ruth zurzeit eine Sehstörung, also warum sollte sie Olga nicht neben sich auf der Bank im Park sehen, wo sie doch sowieso im Moment den reinsten und schönsten Pixelimpressionismus vor Augen hat. Jetzt, wo Olga tot ist und trotzdem neben ihr auf der Bank sitzt, muss es doch besprochen werden: Warum ist Ruth nicht Olgas Schwiegertochter geworden? Warum hat sie im letzten Moment den Hochzeitstermin mit Olgas Sohn Bernhard abgesagt? Weil sie nicht zu ihrem eigenen Kind auch noch Bernhards behinderten Sohn miterziehen wollte. Deshalb ist sie geflüchtet. Ruth hat damals ihr Herz hart gemacht, um sich ein Stück Freiheit zu erhalten. Jetzt kann Ruth Olga endlich eingestehen, dass sie sich schuldig gefühlt hat. Und hört von Olga, dass sie Ruth ein Stück für deren Mut bewundert hat. Ja, sagt Olga, man will immer sein, wer man nicht ist … Aber man hat nur ein Leben. Dass kann Ruth nicht bestätigen. Ruth hatte mehr als ein Leben, vielleicht vier, vielleicht sechs, sagt sie. Und sie kann sich gar nicht mehr an alle Leben erinnern. Sie erkennt nicht, wer plötzlich neben ihr auf der Bank sein Bier trinkt. Bruno? Aber Bruno, der beste Freund von Ruths zweitem Mann Hendrik, ist doch tot. Natürlich bin ich tot, sagt Bruno. Bruno hätte Schriftsteller werden können, verzichtete aber darauf, sein Talent zum Schreiben zu benutzen, weil er die Welt nicht mit durchschnittlichen Büchern behelligen wollte. Hendrik aber wurde Schriftsteller. Er nutzte die Treffen mit Bruno, um dessen Weisheiten zu notieren. Michael Hametner, geboren Bruno war ein klassischer Verweigerer. Er wurde Säufer aus Schuldvermeidung. In den ddr-Verhältnissen, wo Intelli- in Rostock, studierte Journalistik in Leipzig und war u. a. genz keine Chance hatte, wollte er sich nicht einrichten und Leiter des Studententheaters versoff lieber vorsätzlich seine geistigen Gaben. Damit er- der Leipziger Universität. Er ist Theater-, Literatur- und sparte er sich Unglück und Anpassung. Hendrik beklaute Hörspielkritiker und seit 1994 Bruno und arbeitete die Dialoge mit Bruno in seinen Roman Literaturredakteur beim mdr. ein. Ruth und Hendrik beantragten die Ausreise und ginAußerdem ist Hametner als gen nach Westberlin. Hendrik ohne Bruno als Souffleur freier Autor und Herausgeber schrieb nur noch durchschnittliche Bücher, die Ehe schei- tätig, zuletzt erschien terte. Und Ruth hat Bruno, das versoffene Wrack, vergessen. „Einkreisen. Ein Porträt des Malers Sighard Gille“. Wieder ein Stück Schuld aus einem anderen ihrer vier oder sechs Leben. Wem begegnet sie als Nächstem im Park der Toten? Einem Hund, blond und mit blauen Augen. Ruth, die Hundeliebhaberin, nennt ihn Nicki. Der gibt ein kleines dunkles Grollen von sich, als ein Paar energisch auf sie zusteuert: Margot Honecker mit Erich Honecker im Schlepptau. Aber weder Margot noch Erich sind einsichtig. Sie wissen nichts von Schuld. Für Bruno ist das nur Nicki gestattet! Wäre Heiner Müller auch im Park der Toten erschienen, hätte er zu Ruth gesagt: „Aber je stärker die Versuche waren, die Toten unter den Teppich zu kehren, je mehr versucht wurde, von ihnen nicht zu sprechen, desto sperriger sind dann ihre Überreste gewesen. Es ist an der Zeit, die Toten unter dem Teppich hervorzuholen und sie auf die Bühne zu bringen.“ Monika Marons Romanfigur Ruth hätte ihm nicht widersprochen, denn der Roman „Zwischenspiel“ bereitet ihnen eine Bühne: für Geistergespräche im Park. Angesichts all der Toten im Roman, für die eine momentane minimale Sehschwäche ausreicht, sie als Lebende zu sehen, streichelt Ruth den Hund Nicki umso lieber. Mit Nicki wird der Gespenster-Roman zu einer leisen, wenn auch traurigen Komödie. Ein Happy End hat sie im Roman aber nicht. Mitnehmen kann Ruth den Hund aus diesem Park nicht. 73 Ines Marie Westernströer 74 Matthias Luckey 75 Holger Hübner 76 Yohanna Schwertfeger 77 Miss Sara Sampson Bürgerliches Trauerspiel von Gotthold Ephraim Lessing Premiere am 1. November 2014 im Kleinen Haus 1 Regie: Sebastian Kreyer Armes Herz! Die Autorin Dagrun Hintze sieht fern und liest Lessing Oberärztin Dr. April Kepner und Rettungssanitäter Matthew Taylor haben es geschafft: Sie stehen vor dem Traualtar. Doch bevor der Pfarrer überhaupt mit seiner Ansprache beginnen kann, springt in der Kirche einer auf – Dr. Jackson Avery, Oberarzt der Plastischen Chirurgie und Exfreund der Braut. Er bekennt seine Liebe zu April und bittet sie, Matthew nicht zu heiraten. Neben Jackson sitzt seine Freundin Stephanie, versteinert. So geschehen in einer der jüngsten Folgen der us-amerikanischen Krankenhausserie „Grey’s Anatomy“. Die vielleicht nicht zu den besten TV-Serien gehören mag, in einem jedoch unschlagbar ist: in der Konstruktion von Emotionen. Immer wieder gelingt es dem Autorenteam, die größtmögliche Fallhöhe herzustellen – und deshalb verdrücken Menschen, die ansonsten durchaus zurechnungsfähig sind, immer wieder ein paar Tränen vor dem Fernseher. April rennt mit ihrem Exfreund Jackson aus der Kirche, die beiden brausen mit dem Auto davon. Aber wohin? Auch Miss Sara Sampson ist mit dem Mann, den sie liebt, durchgebrannt. Sie hat ihren Vater enttäuscht und in den Augen der Gesellschaft ihre Tugend verloren, nun sitzt sie seit acht Wochen in einem schäbigen Gasthaus und weint. Denn Mellefont zögert, sie zu heiraten, sosehr sie ihn auch drängt. Für Sara gibt es nur diese eine Möglichkeit, nur eine Trauung könnte die sittliche Ordnung wiederherstellen. Ohne Zeremonie bleibt sie eine Sünderin, die Gott strafen wird – auf das Durchbrennen, das man durchaus als emanzipatorischen Akt der Selbstverwirklichung begreifen kann, folgt die Selbstanklage. Vordergründig beruht Mellefonts Zögern auf einer Erbschaftsangelegenheit, die noch geregelt werden muss, bevor er Sara heiraten kann. Doch als sich die Dinge zum Guten wenden – Saras Vater verzeiht seiner Tochter und akzeptiert Mellefont als Schwiegersohn –, offenbart sich seine innere Zerrissenheit. Er liebt Sara, das schon. Aber ihn schreckt der Verlust von Freiheit und Leidenschaft, der für ihn mit einer Ehe einhergeht, er wünscht sich Sara als Geliebte und nicht als Ehefrau – und weiß doch, dass er das diesem tugendhaften Geschöpf niemals wird zumuten können. 2014, eine Kneipe in Hamburg, ein Mann und eine Frau im Gespräch. Er: „Langjährige Beziehungen haben den Vorteil, dass alles geklärt ist – in welcher Kinoreihe man sitzt, was man kocht, um dem anderen eine Freude zu machen, wie man beim Frühstück die Zeitung aufteilt. Man hat zwar kaum noch Sex miteinander, weiß aber, wo gestreichelt werden muss und auch wie, wer auf welcher Seite des Betts schläft und dass Freundschaft ein wichtiger Bestandteil von dauernder Liebe ist. Das alles weiß ich sehr zu schätzen und möchte es wirklich nicht missen.“ Pause. „Aber wenn ich mir vorstelle, auch die nächsten 15 Jahre noch so zu verbringen, werde ich einfach verrückt.“ Da ist sie in heutiger Gestalt, die Ambivalenz, die auch Mellefont umtreibt: die Sehnsucht, bei einem Partner zu bleiben – und das Wissen darum, dass das Vergehen von Zeit und das Einhalten von Konventionen Spontaneität und Leidenschaft entgegenstehen. Und damit auch dem Gefühl persönlicher Freiheit und Selbstverwirklichung. Die Einzige, die sich diesem Dilemma schmerzlich stellt, ist bei Lessing die Böse: Marwood, Exgeliebte von Mellefont und Mutter einer gemeinsamen Tochter. Sie kennt Eros’ auf- und abziehende Macht und weiß, mit wem sie es bei Mellefont zu tun hat, sie verlangte dem Geliebten nie eine Ehe ab und duldete seine Affären. Als sie nun begreift, dass sie ihn endgültig an Sara verloren hat, verfällt Marwood in Raserei, geht erst (erfolglos) mit einem Dolch auf Mellefont Dagrun Hintze studierte Germanistik, Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft in Würzburg und Antwerpen. Seit 1999 lebt sie als Autorin in Hamburg. Dagrun Hintze widmet sich essayistisch und literarisch der Vermittlung zeitgenössischer Kunst. Sie veröffentlichte Lyrik und Kurzprosa in diversen Zeitschriften und Anthologien und wurde für ihre Arbeit mehrfach ausgezeichnet. Ihr Stück „Die Zärtlichkeit der Russen“ wurde 2012 am Staatsschauspiel Dresden uraufgeführt. Ach, Sarche 78 los und vergiftet schließlich ihre Rivalin. Böse ist das ohne Zweifel. Doch erinnert man sich selbst nur zu gut an Verletzungen in Liebesdingen, an zerschmissenes Geschirr, vom Balkon geworfene Klamotten und Schlimmeres, als dass man nicht dem Satz zustimmen würde, den Lessing in seinem späteren Stück „Emilia Galotti“ die Gräfin Orsina sagen lässt: „Wer über gewisse Dinge den Verstand nicht verlieret, der hat keinen zu verlieren.“ Voraussetzung für eine solche Empathie mit Marwood wäre, dass sie Mellefont tatsächlich liebt und nicht nur aus gekränktem Stolz durchdreht. Denn zumindest Frauen beherrschen sie doch, die eindeutige und nicht widersprüchliche Liebe. Oder? Zurück in der Hamburger Kneipe. Jetzt erzählt die Frau: „Vor ein paar Tagen dachte ich plötzlich, mein Mann hätte eine Affäre. Er war so distanziert, ich hatte das Gefühl, ihm gar nichts mehr zu bedeuten, und dass er mich verlassen würde, stand für mich fest. Am nächsten Tag liebte auch ich ihn nicht mehr, es war klar, wir würden uns trennen. Als ich am dritten Tag aufwachte, war er auf einmal derjenige, mit dem ich unbedingt alt werden wollte.“ Pause. „Es ist doch zum Wahnsinnigwerden: immer derselbe Mann. Nur ich bin jeden Tag anders.“ So viel dazu. Die Liebe, die nicht romantisch-abstrakte Idee bleibt, sondern real gelebt wird, scheint zu Verunsicherungen zu führen – sowohl was die eigene Identität als auch was Lebensentwürfe und -träume angeht. Aus dieser Verunsicherung entsteht Ambivalenz. Sie ist – symbolisch gesprochen – das Gift, das Saras Vorstellung von der Liebe tötet. Vielleicht wäre Emilie du Châtelet nicht nur Sara, sondern auch Marwood eine gute Ratgeberin gewesen. Diese bemerkenswerte Dame, die sechs Jahre vor der Uraufführung von „Miss Sara Sampson“ starb, war nicht nur Mathematikerin, Physikerin, Philosophin und Übersetzerin, sie lebte auch zehn Jahre lang in wilder Ehe mit Voltaire. In ihrem wunderbaren Essay „Rede vom Glück“ heißt es: „Ich weiß indes nicht, ob die Liebe jemals zwei so sehr füreinander geschaffene Menschen vereint hat, dass sie der Lust nie überdrüssig wurden, nie die Erkaltung im Gefolge der Sicherheit, nie Gleichgültigkeit und Lauigkeit erfuhren, die so oft aus der Bequemlichkeit und Beständigkeit eines Verhältnisses entspringen […] Aber wie lächerlich wäre es, sich dieser Lust zu verweigern, aus Angst vor künftigem Unglück, das Sie vielleicht erst empfinden, nachdem Sie sehr glücklich gewesen sind – und selbst dann würden Sie entschädigt und müssen daran denken, sich zu heilen, nicht, zu bereuen.“ Auf den Rausch folgt die Ernüchterung. So war das im 18. Jahrhundert, so ist es bis heute. Diese Einsicht zu bejahen erfordert Mut. Volles Risiko gehen und nicht bereuen empfiehlt Madame du Châtelet. Die Autoren von „Grey’s Anatomy“ scheinen das ähnlich zu sehen: April und Jackson fahren nach ihrer Flucht aus der Kirche direkt nach Las Vegas – es gibt offenbar auch heute noch Situationen, die nur durch eine Blitzhochzeit bereinigt werden können. Und denjenigen, die nicht so mutig sind, bleiben immerhin ein paar Tränen vor dem Fernseher. en, Sarchen! 79 mein deutsches deutsches Land von Thomas Freyer Uraufführung am 27. November 2014 im Kleinen Haus 2 Regie: Tilmann Köhler Geschichtsarbeiter Der Regisseur Tilmann Köhler über den gemeinsamen Weg mit dem Dramatiker Thomas Freyer und das Zwischen-den-Zeiten-Stehen als künstlerischer Impuls Thomas Freyer und ich sind in Gera aufgewachsen. Seither sind wir uns immer wieder begegnet – das Erleben einer Zeit aus dem Blickwinkel unserer Generation verband uns für alle folgenden gemeinsamen Projekte. Gera vor der Wende: 130 000 Einwohner, eine rote Bezirksund Industriestadt. Heute leben dort 95 000 Einwohner, Tendenz abnehmend. In den 1990er-Jahren schlossen nahezu alle industriellen Betriebe, Gera wurde eine sterbende Stadt, die alle, die noch gehen konnten, schnellstmöglich verließen, sobald sie alt genug waren. Das bedeutete einerseits Freiraum für alle möglichen Versuche und bot die Möglichkeit, in vielem der Erste zu sein. Andererseits war in unserem Umfeld eine äußerst pragmatische Sicht auf die Zukunft üblich. Die neugewonnene Freiheit entpuppte sich sehr stark auch als ein Auslöser von Angst – Angst vor der Zukunft. 2002 schrieb sich Thomas Freyer für Szenisches Schreiben an der Universität der Künste Berlin ein. Ein Jahr zuvor war ich dorthin gegangen, um Regie an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ zu studieren. Es entstand der Gedanke eines gemeinsamen Stückes, welches während des Probenprozesses entstehen sollte. Das war der Beginn von „Amoklauf mein Kinderspiel“, das über mehrere Etappen mit drei Schauspielern entwickelt wurde, unter ihnen Thomas Braungardt, der heute in Dresden im Ensemble ist. Unser Ausgangspunkt war der Amoklauf in Erfurt im Jahr 2002, der in uns die Frage entstehen ließ, ob so etwas auch an unserer Schule möglich gewesen wäre. Und warum. Erstaunlich war für uns, dass der Amokläufer Robert Steinhäuser ausschließlich auf Lehrer hatte schießen wollen, nur „zufällig“ fielen zwei Schüler seinen Schüssen zum Opfer. Uns schien es ein Wüten gegen die Alten gewesen zu sein, eine Abrechnung mit der Eltern- und Lehrergeneration der Nachwendezeit. Gemeinsam mit den Schauspielern begannen wir, über unsere eigene Schulzeit nachzudenken und sie einem imaginären Amoklauf gegenüberzustellen. Das endgültige Stück wurde später oft als Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Amoklaufs interpretiert und entsprechend nachgespielt. Ich aber halte es eigentlich für ein Stück über die Nachwendezeit. Verrückterweise berührten die Wut und die Angriffslust des Textes Zuschauer aus der Elterngeneration am stärksten. Ausgehend von diesem Thema war auch Thomas’ zweites Stück, „Separatisten“, ein Text, der vom Leben in der Nachwendezeit in den schrumpfenden Städten des Ostens erzählte. Ich hatte, als ich „Separatisten“ das erste Mal las, sofort das Geraer Plattenbaugebiet Lusan vor Augen, einen Ort, den Thomas sehr gut kannte und der exemplarisch für die sterbenden Städte stand. Der Versuch der Separatisten ging von folgenden Fragen aus: Wie macht man diese Welt 80 lebenswert? Woran knüpft man an? Kann man diese Menschen überhaupt noch mobilisieren? Thomas’ Texte zeichnen sich durch eine sehr feine, dramatische, erst im Sprechen „begreifbare“ Sprache aus. Seine Figuren sind immer tiefgründig, es hat mich fasziniert, dass oft gerade ältere Schauspieler besonders viel mit seiner Sprache anfangen konnten, sich in seinen Figuren wiederfanden. Bei den Jungen schien es mir verständlich, da er meistens über die eigene Generation schreibt. Aber wie schafft es ein junger Autor, sich so tief in Figuren, die doppelt so alt sind wie er, hineinzubegeben, dass er ihre Gedanken authentisch erzählen kann? Auch „Und in den Nächten liegen wir stumm“, dessen Uraufführung ich 2008 in Hannover inszenierte, spielt im Plattenbau und ist oberflächlich gesehen eine Ostgeschichte. Viel mehr ist es jedoch eine Geschichte über den Umgang mit Abschied, Tod und Trennung. Dieses Stück war bis dahin Thomas’ persönlichster Text. Aus der Szenerie der Plattenbausiedlung erwächst ein expressionistisches Bild, ein Ausbruch, Ausdruck für Gefühle und Gedanken, die eigentlich nicht nur aus der inneren Logik der Figuren stammen. Thomas Freyer erzählt nicht vom Rande einer Gesellschaft, sondern aus ihrem Zentrum heraus, er beleuchtet jene Winkel, die man nicht so gerne sehen will. Und er ist ein Arbeiter an Geschichten, ein wirklicher Dramatiker. Seine Texte müssen gesprochen werden, er seziert Sprache, schreibt ihr Rhythmus ein und zelebriert sie. Thomas kennt seine Figuren sehr genau, lässt sich von ihnen entführen. Ich bin immer wieder davon beeindruckt, wie interessiert, angst- und vorbehaltlos er den Kontakt zu denen sucht, die seine Stücke inszenieren und spielen. Durch ihr Lesen führen sie die Arbeit am Verlauf der Geschichte und der Ausgestaltung der Figuren fort. Im kommenden Herbst nähern wir uns gemeinsam einer neuen Geschichte, deren Entstehen von unseren Gesprächen begleitet ist. Er schreibt „mein deutsches deutsches Land“ für das Dresdner Theater und erzählt darin sechs Episoden von drei jungen Menschen, die sich treffen und den Plan fassen, ihrem diffusen Hass künftig ein Ziel zu geben. Der rechte Terror, dessen Ausmaß und Verbreitung lange Zeit kaum jemand in Deutschland für möglich gehalten hat, lässt die Gegenwart und das Land, in dem wir leben, plötzlich fremd erscheinen. Thomas Freyer wird also ein weiteres Mal von unserer Gesellschaft erzählen und jene Ecken ausleuchten, die gerne im Dunkeln gelassen werden. Tilmann Köhler ist seit 2009 Hausregisseur am Staatsschauspiel Dresden. Hier waren auch seine Uraufführungen von Thomas Freyer, „Und in den Nächten liegen wir stumm“ sowie „Das halbe Meer“ zu sehen. Eine ausführliche Biografie finden Sie auf A Seite 20 Die Panne Komödie von Friedrich Dürrenmatt Premiere im Januar 2015 im Kleinen Haus 1 Regie: Roger Vontobel Welt der Pannen, Welt der Verantwortungslosigkeit Klaus Cäsar Zehrer über „Die Panne“ von Friedrich Dürrenmatt Hephaiston, so heißt das synthetische Gewebe, mit dem der Der Novelle stellt er einige programmatische ÜberlegunHandelsreisende Alfredo Traps in Friedrich Dürrenmatts gen voran. Es sei, so Dürrenmatt, das „Schreiben schwieriKomödie „Die Panne“ Geschäfte macht. Das Material – so ger und einsamer, auch sinnloser“ geworden, denn in einer lautet jedenfalls Traps’ Werbesprüchlein – ist „ebenso ver- „Welt der Pannen“ werde das Schicksal nicht mehr von den wendbar in der Industrie wie in der Mode, für den Krieg wie Charakteren und ihrem Handeln bestimmt, sondern von für den Frieden, der vollendete Stoff für Fallschirme und zu- Unfällen. Konkret nennt er „Verkehrsunfälle, Deichbrüche gleich die pikanteste Materie für Nachthemden schönster infolge Fehlkonstruktion, Explosion einer AtombombenDamen“. Hephaistos, der Namensgeber von Hephaiston, fabrik, hervorgerufen durch einen zerstreuten Laboranten, war der Kunstschmied unter den griechischen Göttern, der falsch eingestellte Brutmaschinen“. Im Theaterstück von seine Frau Aphrodite und ihren Liebhaber Ares in einem fei- 1979 lässt er Richter Wucht weitere Katastrophen aufzählen, nen, aber unzerstörbaren Netz gefangen nahm. die das Leben des Einzelnen jederzeit aus der Bahn bringen Wir ahnen es schon: Um unentrinnbare Verstrickungen können: „undichte Virenkulturen, gigantische Fehlspekugeht es in dem Stück, um unklare Verhältnisse und darum, lationen, explodierende Chemieanlagen, unermessliche dass Rechtschaffenheit und Verbrechen manchmal so nah Schiebungen, durchschmelzende Atomreaktoren, zerbersbeieinander liegen wie der Stoff für ein Negligé und Fall- tende Öltanker“ und so fort. Es sei eine „Welt der schuldischirmseide. Angesichts solch verschwimmender Grenzen gen Schuldlosen und der schuldlosen Schuldigen“, eine zwischen harmlos und gefährlich, zwischen Gut und Böse „Welt, in der niemand mehr schuldig sein will, in der die hat die reguläre Justiz ihre Schwierigkeiten, Schuld von schändlichsten Verbrechen begangen werden, weil sie anUnschuld zu trennen. geblich entweder unvermeidbar sind, um das Weltgetriebe Diese Aufgabe übernimmt im Stück das Feierabendgericht, in Gang zu halten, oder notwendig, um die Veränderung das der greise Exrichter Wucht gemeinsam mit seinen dieses Weltgetriebes herbeizuführen“. Freunden, allesamt ehemalige Juristen, betreibt. Die Pensionäre führen als Hobby, ihre alten Berufe nachspielend, in In der Welt von heute sind die schändlichen Verbrechen, Wuchts Privathaus Prozesse durch. Traps, der wegen einer bei denen die Schuldfrage diffus bleibt, nicht geringer geAutopanne zufällig in der Runde landet, erklärt sich dazu worden. Ob im Golf von Mexiko das Meer von einem unbereit, in einem solchen Prozess die Rolle des Angeklagten dichten Ölbohrloch verseucht wird oder in Bangladesch zu übernehmen – nichts als ein „vergnügliches Gesellschafts- eine Textilfabrik einstürzt, ob Südseeinseln vom steigenspiel“, wie er glaubt. Zwar gibt es kein konkretes Vergehen, den Meeresspiegel verschlungen oder in Duisburg junge das Traps zur Last gelegt werden könnte, aber das ist, so Menschen auf dem Weg zu einer Tanzparty in der Menge Richter Wucht, das geringste Problem: „Ein Verbrechen zerquetscht werden: All diese Katastrophen sind Pannen, lässt sich immer finden.“ von niemandem beabsichtigt und doch menschengemacht. In der Tat: Als während der – von einem opulenten Gast- Und nirgendwo findet sich ein Alfredo Traps, der seinen mahl und einem exzessiven Weinbesäufnis begleiteten – Ver- Schuldspruch einsichtig, ja begierig annimmt und sich handlung Traps’ Leben durchleuchtet wird, stößt der alte empört dagegen wehrt, von seiner Verantwortung freigeStaatsanwalt Zorn schnell auf einen wunden Punkt. Herr sprochen zu werden. Eine so unwahrscheinliche Figur Gygax, Traps’ ehemaliger Chef, starb an einem Herzinfarkt, kommt, wie es scheint, nur in der Komödie vor. woraufhin Traps dessen gut dotierten Posten übernehmen Wie es dem Schuldlos-Schuldigen ergeht, das bleibt bei konnte. Ist Traps der Todesfall anzulasten? Das ist Ansichts- Dürrenmatt einmal mehr variabel. Die verschiedenen Fassache. Der Staatsanwalt interpretiert das Ereignis als raffi- sungen von „Die Panne“ enden unterschiedlich. Im Hörniert verdeckten heimtückischen Mord. Kummer, der den spiel und in der Fernsehfassung erwacht Traps am nächsStrafverteidiger spielt, deutet es als Unglücksfall, an dem ten Morgen verkatert, aber unversehrt. In der Erzählung Traps keine Schuld hat. Beide Sichtweisen sind in sich vollstreckt er das Todesurteil selbst und erhängt sich. Das schlüssig, und so spricht Richter Wucht denn auch zwei Ur- Theaterstück führt das Motiv der Katastrophe als Zufallsteile: Einmal verurteilt er Traps zum Tode, einmal spricht er produkt am konsequentesten zu Ende: Traps richtet sich ihn frei. versehentlich selbst hin – ein tödlicher Schicksalsschlag, Nicht nur den Richterspruch gibt es in verschiedenen Versi- ausgeteilt vom Zufallsgenerator des modernen Lebens. onen. Dürrenmatt hat „Die Panne“ mehrfach erzählt, zuerst Eine Panne. 1956 als Hörspiel für den Bayerischen Rundfunk; kurz darauf schrieb er es zur Novelle um, dann noch einmal zum Drehbuch für ein Fernsehspiel. Mehr als zwanzig Jahre später folgte die Bühnenfassung. Klaus Cäsar Zehrer ist f­ reier Autor und Herausgeber und lebt in Berlin. Er hat zum Thema Dialektik der Satire promoviert und schreibt u. a. Humorkritiken für das Satiremagazin „Titanic“. Zuletzt veröffentlichte er ge­­­meinsam mit dem Illustrator Fil das Kinderbuch „Der Kackofant“. 81 Max Rothbart Nina Gummich 82 Lukas Mundas Pauline Kästner Justus Pfankuch Tobias Krüger Kilian Land Nadine Quittner 83 Superhirn oder Wie ich die Photonenklarinette erfand von Clemens Sienknecht Uraufführung im Februar 2015 im Kleinen Haus 3 Regie und Musik: Clemens Sienknecht Ich war der Mann mit dem Sternenstaub in der Tasche Wie ich die Photonenklarinette erfand von Clemens Sienknecht Während einer Wanderung durch den Stadtwald von Kassel fand ich einen braunen Stein. Unregelmäßig und glatt. Er wog schwer und machte einen leicht geschmolzenen Eindruck. Ich erinnere mich, wie ich ihn einem weisen, bärtigen Pastor aus Clausthal-Zellerfeld zeigte. Dessen Haus war prall gefüllt mit interessantesten Sammelsurien seines langen Lebens. Als der alte Mann den Stein sah, bebten seine buschigen Augenbrauen. Er sah mich an und sagte: „Mein Sohn, dies ist ein Meteorit – ein Stern!“ Danach verfiel er für 84 drei Tage in dumpfes Schweigen. Aber ich hatte meine Bestimmung gefunden: Ich war der Mann mit dem Sternenstaub in der Tasche, dem Schlüssel zur Quelle. Ich war der Superdenker, auserwählt für die große Suche nach dem Wunder von morgen. Clemens Sienknecht erfindet seit Jahren als Musiker und Regisseur seltsame, skurrile und wunderbar verschrobene musikalische Theaterabende – immer oszillierend zwischen Feinsinn und grobem Unfug. Ein ausführliche Biografie finden Sie auf A Seite 31 Ein neuer Text Uraufführung im März 2015 im Kleinen Haus 2 Regie: Jan Gehler Das schönste Mädchen von Gera Der Regisseur Jan Gehler beantwortet einige Theaterfragen Können Sie sich daran erinnern, warum Sie sich einmal für das Theater als Kunstform entschieden haben? Die Wahrheit? Das schönste Mädchen von Gera, ach, von ganz Thüringen hatte sich in der Achten in der Theater-ag meiner Schule angemeldet. Ich hab meinen Namen direkt unter ihren auf die Liste geschrieben. Sie ist dort nie erschienen, und ich fand mich in einem Klatschkreis wieder. Da bin ich geblieben, bis heute. Spielt der jeweilige Ort, an dem Sie inszenieren, eine Rolle für Ihre Arbeit? Eigentlich nicht. Ich würde immer sagen, dass Theater universal ist, vor allem in unserem Kulturkreis, das heißt verständlich von Dresden bis Bochum und von Stuttgart bis Hamburg. Aber jede Stadt hat auch ihre speziellen Themen. Ich mag Theater, das sich regional verortet und trotzdem über den Ort hinausweist. Was hat Dresden? Dresden hat eigentlich alles, was eine Großstadt auszeichnet. Es ist ein Vergnügungspark für Touristen, hat Plattenbauten, grüne Auen, alternative Subkulturen. Die Bereiche scheinen nur abgeschotteter voneinander zu sein als anderswo. Deswegen erscheint es provinzieller, aber gleichzeitig ehrlich. Eine ehrliche Spießigkeit. Was fehlt der Stadt? Definitiv: ein Meer mit Dünen. Können Sie Ihren Stil beschreiben? Suchen. Suchen. Weitersuchen. Was ist bei der Arbeit zuerst da? Der Raum? Der Text? Eine Idee? Etwas vollkommen anderes? Das ist natürlich unterschiedlich. Aber das Stadttheater ist schon sehr vom Text geprägt. Welche Stoffe zu einem passen, wird schon immer dialogisch mit dem jeweiligen Haus vereinbart. Und hat man sich dann geeinigt, was man erzählen will, geht es schnell um das wie. Und da ist der Raum die nächste Komponente, denn der gibt immer schon sehr stark das Spiel vor. Viele Entscheidungen hebe ich mir aber gerne für die Proben auf. Manchmal habe ich auch erst ein Gefühl für einen Stoff, bevor ich ihn ganz durchdrungen habe. Jan Gehler ist seit der Saison Sie haben schon mehrfach Romanbearbeitungen auf die Bühne gebracht. Was kann ein Roman auf der Bühne? 2013 Hausregisseur am Staatsschauspiel Dresden, wo unter Was nicht? anderem seine Inszenierung Bei einer Romanbearbeitung auf der Bühne ist die Grund- von Wolfgang Herrndorfs situation sofort klar. Ein Ensemble erzählt eine Geschichte „Tschick“ für Furore sorgte. nach. Es erzählt und springt in Spielszenen. Dieser Wech- Eine ausführliche Biografie finden Sie auf A Seite 22 sel ist großartig. Außerdem gibt es genügend Leerstellen, die man ausfüllen kann. Andererseits sind Zuschauer vielleicht voreingenommen, weil die beim Lesen gemachten Vorstellungen von Figuren und Bildern nicht dem entsprechen, was auf der Bühne passiert, also eine Erwartungshaltung nicht erfüllt wird. Ein Probenritual, das Sie pflegen, ist die Entwicklung der Figuren aus Rollenspielen und Recherchetouren heraus. Was hat es damit auf sich? In der Probe geht es ja nicht darum, Gänge und Töne von Sätzen einzustudieren, sondern am Ende muss so was wie ein Mensch auf der Bühne zu sehen sein. Um das zu erreichen, schicke ich die Figuren gerne auch in die reale Welt. Dabei geht es weniger um „Method Acting“, also das Einfühlen in eine fremde Person, sondern darum, die Schauspieler mit Situationen zu konfrontieren, in denen sie intuitiv reagieren müssen. Diese Erfahrungen können sie dann auf die Bühne mitnehmen, denn dass Schwierigste ist ja meist die Reproduktion, also jeden Abend die Geschichte neu zu erfinden. Außerdem sterbe ich fast jedes Mal vor Lachen, wenn ich mich heimlich hinter parkenden Autos verstecke und beobachte, wie Tschick, der Taugenichts oder Christopher Boone durch Dresden stapfen. Was soll das Theater? Das Theater ist im besten Fall ein utopisches Spiegelbild unserer Zeit. Es soll die richtigen Fragen stellen, es soll unterhalten und irritieren. Es ist ein lebensnotwendiger Luxus. Was nicht? Theater darf sich niemals nur um sich selbst drehen, das heißt zu einem chiffrierten Spektakel werden, das nur Experten decodieren können. Gibt es einen idealen Schauspieler? Ja. Nein. Doch. Ja. Schauspielerinnen und Schauspieler, die bereit sind, in jedes Becken zu springen und auch eine Bauchlandung zu riskieren, die Lust haben zu spielen und logisch: solche, die alles machen, was ich sage, und gut mit dem Ball umgehen können. 85 Alle meine Söhne von Arthur Miller Premiere im Mai 2015 im Schauspielhaus im Kleinen Haus 1 Regie: Sandra Strunz Schuld schreibt sich ein Die Regisseurin Sandra Strunz über Lebenslügen als Überlebenstrieb und die kulturelle Dimension der Schuldfrage „Alle meine Söhne“ zeigt die Kehrseite der Medaille des amerikanischen Traums. Dabei erzählt das Stück einerseits von den psychischen Abgründen der Figuren und folgt andererseits einem Krimiplot, in dem die schwere Schuld der Hauptfigur nach und nach entlarvt wird. Mich interessieren diese schuldhaften Verstrickungen, die Verdrängungen sehr. Das Stück zeigt den Versuch der Eltern, alles richtig zu machen, die besten Entscheidungen zu treffen. Und es zeigt ihr Scheitern daran, weil ihre Lebenslügen Grundlage ihres gesamten Seins geworden sind. Alle Figuren, auch der Vater, vielleicht er sogar am meisten, kämpfen darum, das Richtige zu tun, das macht das Stück sehr reich. Gleichzeitig interessiert mich, dass „Alle meine Söhne“ in einer Zeit geschrieben wurde, die geprägt war von einem gerade zu Ende gegangenen Krieg, also von einem Neuanfang. In einer solchen Zeit prallt viel aufeinander. Das Stück wurde verfasst, als sich die amerikanische Gesellschaft nach einer großen, verantwortungsvollen Tat für die Welt, nämlich der Kriegsintervention der usa, anderen Dingen widmete. Statt zu weltpolitischer Verantwortung bekannte man sich nun mehr denn je zu einem Konzept von Ehrgeiz und Gier, zum ungebremsten Kapitalismus. Im Mittelpunkt stand nun die Akkumulation von Macht und Kapital. Dieses dem Stück eingeschriebene Spannungsverhältnis zwischen Ehrgeiz und Verantwortung ist ein Thema auch unserer Tage. Wir erleben ja vielleicht gerade das Ende dieser Entwicklung. Wir erleben große Katastrophen, ökologische und ökonomische, die durch Gier entstanden sind. Immerhin gibt es zumindest punktuell Initiativen, die wieder vermehrt Verantwortung übernehmen wollen und ein Bewusstsein haben von der sozialen Dimension allen Handelns. Macht ist ja eigentlich nicht das Gegenteil von Verantwortung. Umso mehr fragt man sich, warum beide nur selten gemeinsam in Erscheinung treten. Warum die Verantwortung für das Allgemeine, das große Ganze, zugunsten der eigenen Selbstoptimierung betäubt wird. Genauso selbstbetäubt handelt auch Joe Keller, der Vater, der ein glückliches Leben auf Schuld und Verrat aufgebaut hat. Damit muss er umgehen. Menschen versuchen, sich ihre Biografie ja so zu konstruieren, dass sie ihnen sinnhaft erscheint, dass im Nachhinein Dinge mit Bedeutung aufgeladen werden, um eigentlich Unschlüssiges zu einem ganzen, in sich geschlossenen Leben zusammenzufügen. Und dieser manchmal verzweifelte Versuch löst immer wieder Empathie aus. So geht es mir auch bei Joe Keller. Es ist ja das Perfide an der Lebenslüge, dass wir sie ab einem 86 bestimmten Punkt selbst glauben. Man muss dazu kein böser Mensch sein. Es kann aus zwischenmenschlicher Abhängigkeit, aus Liebe zu den Kindern, aus innerer Not geschehen, und trotzdem bleibt es, von außen betrachtet, falsch. Es ist ein besonderes Phänomen der menschlichen Existenz, dieses Bedürfnis nach Plausibilität, nach Sinnhaftigkeit. Und das Ende von Joe Keller zeigt, dass eine solche Lebenslüge sogar dem Überleben des Einzelnen dienen kann, also eine Art Selbstschutz ist. Wenn sich Joe Keller seiner Schuld in vollem Masse bewusst wird, sie sich eingesteht und ihr wahrhaft gegenübertritt, erscheint ihm der Freitod die einzige Lösung, die einzige logische Konsequenz. Hier entpuppt sich die Lebenslüge als ein Überlebenstrieb, und hier wird die letzte große Frage des Stücks aufgeworfen: ob es ein Ende von Schuld gibt. Ich glaube nicht, dass es einen Punkt gibt, an dem qua Beschluss eine Schuld endet. Genauso wenig wie es ein Ende von Geschichte gibt. Schuld schreibt sich ein, wird wiederholt und neu heraufbeschworen. Das sage ich als Kind der protestantischen deutschen Nachkriegsgeneration. Jemand aus einem buddhistischen oder südamerikanisch-katholischen Kontext würde mit der Frage anders umgehen. So wie jede moralische Frage ist auch die nach der Schuld eine zutiefst kulturell verwurzelte, und das bedeutet eben auch, dass sie fortwährend neu verhandelt werden muss. Sandra Strunz arbeitete an zahlreichen großen Theatern im deutschsprachigen Raum und ist seit 2013 leitende Dozentin für Regie an der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg. In Dresden inszeniert sie seit 2009 regelmäßig, zuletzt „Woyzeck“ und „Emilia Galotti“. Eine ausführliche Biografie finden Sie auf A Seite 37 Die Bergwanderung oder Sexualität heute von Martin Heckmanns Uraufführung im Juni 2015 im Kleinen Haus 2 Die Urszene hat Sigmund Freud die Konstellation genannt, in der ein Kind seine Eltern beim Geschlechtsverkehr beobachtet. Freud vermutet, dass diese Szene als Fantasie oder erlebte Begebenheit in der Analyse bei allen Menschenkindern aufzufinden und von pathogener Wirkung sei. Das Kind wohne nachträglich dem reinszenierten Akt seiner Entstehung bei. Der eigene Ursprung werde dem Kind unheimlich. Martin Heckmanns’ neues Stück beschreibt die umgekehrte Perspektive. Wir drucken hier als Einblick in die Schreibwerkstatt einen ersten Ausschnitt aus dem Stück ab, an dem bis zum Herbst 2014 noch geschrieben wird. michael Findest du das wirklich eine gute Idee? hanne Bitte, Michael, wir hatten uns entschieden. michael Du hattest entschieden. hanne Weil es unsere Pflicht ist. michael Müssen wir das denn gleich in der großen Gruppe besprechen? Wir hätten doch telefonieren können. hanne Ich finde, alle Eltern haben ein Recht darauf, zeitgleich informiert zu werden. Und ich würde gerne gemeinsam klären, wie wir damit umgehen. michael Wir machen uns lächerlich. Wegen eines 3-Minuten-Films. hanne Diesen 3-Minuten-Film hat die Tochter der Braumeisters ins Internet gestellt. Und da frage ich mich, warum macht die so was. michael Ihre Gesichter kann man nicht erkennen. Das ist doch die Hauptsache. hanne Es geht doch nicht nur um den Film. Deine Tochter war Teil einer Orgie. michael Unter fünf Personen spricht man sicher nicht von einer Orgie. hanne Da kennst du dich aus. michael Und so genau ist da doch überhaupt nicht zu sehen, was passiert. hanne Ich sag mal: ausreichend. Absolut ausreichend. Mir hat’s gereicht. Den Rest kann ich mir denken. michael Das sind Kinder. hanne Das ist es ja. michael Die probieren sich aus. hanne Und wir sind die Erziehungsberechtigten. Und wir sind nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, die Grenzen dieses Ausprobierens festzulegen. Da brauchen wir eine einheitliche Linie. Wir schauen uns das gemeinsam an und entscheiden dann, wie weiter vorzugehen ist. michael Bei dir klingt das, als würden wir eine Regierungserklärung vorbereiten. hanne Während es dich wie immer null interessiert, was deine Tochter mitmachen muss. michael Im Film sieht es nicht aus, als wäre sie zur Teilnahme gezwungen worden. hanne Das weißt du doch gar nicht. Das ist der GruppenMartin Heckmanns zählt zu druck. Den kann man nicht sehen. michael Das wird auf uns zurückfallen. Der Bote und die den wichtigsten zeitgenössischen deutschen Dramatikern. Botschaft. Das wird immer ver, ver, ver ... Seine Theaterstücke wurden hanne Verwechselt? international gespielt und michael Verdreht. Die Bote und das Botschaft. Das kennt vielfach ausgezeichnet. Zudem sind sie regelmäßig zu renomman doch. mierten Festivals für neue hanne Und deshalb sagen wir besser nichts? Sind wir Dramatik eingeladen, u. a. zu Memmen oder Menschen? Michael? Mäuschen oder Mann? den Mülheimer Theatertagen und zum Heidelberger Feigling oder, ich sag mal, du weißt, was ich meine. michael Bitte, Hanne, ich will gemeinsam mit den Brau- Stückemarkt. Am Staatsschauspiel Dresden war Martin meisters keinen Sexfilm sehen. Mit unseren Kindern in den Heckmanns von 2009 bis 2012 Hauptrollen. Ich will überhaupt keine Sexfilme mit denen als Hausautor und Dramaturg sehen. Gar keine Filme will ich mit denen sehen. tätig. Sein Theater­prolog „Zukunft für immer“ eröffnete hanne Denkst du, mir macht das Freude? die Spielzeit 2009/2010, michael Den Wolfgang hab ich seit Jahren nicht mehr „Vater Mutter Geisterbahn“ gesprochen. Und jetzt lad ich ihn ein zum Pornogucken. inszenierte Christoph Frick in hanne Das tut mir sehr leid für dein Verhältnis zum der Saison 2011/2012. Wolfgang. Du hättest ihn gerne früher einmal zu uns einladen können. Ich mag den Wolfgang. michael Das ist neu. hanne Ich kenn ihn kaum. michael Wahrscheinlich magst du ihn deshalb. Der Wolfgang kann ziemlich ausfallend werden. Früher hat der sogar unsere Lehrer angepöbelt. Ich sehe schwarz, wenn der auf die Susanne trifft. Das kenn ich noch von früher. Da haben die sich auch schon ständig gefetzt. hanne Hast du nicht gesagt, dass die mal ein Paar waren in eurer Jugend. michael So was kann ganz schnell ausarten. Da sind Emotionen im Spiel. hanne Ja. Wenn es um Sex geht, sind Emotionen im Spiel. Das lässt sich wahrscheinlich nur schwer verhindern. Und jetzt zieh dir bitte ein frisches Hemd an. Wir bekommen Gäste. michael Wir können immer noch sagen, wir machen uns einfach nur einen schönen Abend. 87 Nele Rosetz 88 Benjamin Pauquet 89 Antje Trautmann 90 Matthias Reichwald 91 Ben Daniel Jöhnk 92 Die Bürgerbühne Liebe Bürgerinnen und Bürger, unsere Welt ist voll von Bildern. Bilder, die in einem bestimmten Verhältnis zu dem stehen, was wir Wirklichkeit nennen. Bilder können verführerisch oder manipulativ wirken, wahrhaftig oder konstruiert, bedrohlich oder beruhigend, abstrakt oder realistisch. Je nachdem wer sie entwirft, an wen sie sich richten und zu welchem Zweck dies geschieht, verändert sich ihr Wesen. Das Verhältnis zwischen Bild und Wirklichkeit spielt in Bürgerbühnen-Produktionen eine besonders wichtige Rolle. Denn mit den für das Theater erfundenen Bildern ist eine Wirklichkeit verbunden, die unmittelbar aus dem Leben derjenigen abgeleitet ist, die auf der Bühne stehen. Sie ist deshalb nicht wahrhaftiger, auch an der Bürgerbühne wird dramatisiert, zugespitzt und gelogen, aber sie spricht den Zuschauer direkt und lebendig an. Es erscheint uns an der Bürgerbühne am wichtigsten, dass unsere Stoffe und Bilder etwas mit der Wirklichkeit der Darsteller und unserer Zuschauer zu tun haben, dass Themen zur Sprache und auf die Bühne kommen, die für unsere Stadt und ihre Bürger relevant sind. Wenn in „Merlin“ von Tankred Dorst von der Utopie einer neuen Gesellschaftsordnung die Rede ist und wenn „Katzelmacher“ von Rainer Werner Fassbinder Muster von Diskriminierung, Rassismus und Ausgrenzung thematisiert, dann können die jungen Darsteller in den Stoffen Wirklichkeiten entdecken, die mit ihrem eigenen Leben zu tun haben, sie können sich wiederfinden in den Stücken und Figuren, und die Bilder der Inszenierungen erzählen uns anschließend davon. In den beiden Rechercheprojekten „Mischpoke“ und „Soldaten“ gibt es keinen Stoff, den ein Autor erfunden hat. Der Stoff ist die Wirklichkeit selbst, die bearbeitet und in theatrale Bilder übersetzt wird. Persönliche Perspektiven werden gesellschaftlichen Vorstellungen von „den Juden“ und „den Soldaten“ gegenübergestellt. Das fünfte Projekt in der Spielzeit 2014/2015 ist eine Fortführung der Zusammenarbeit mit der Sächsischen Schweiz. Doch dieses Mal holen wir in „Alles im Fluss“ die Landschaft auf die Bühne. Unter Fluss verstehen wir sowohl die Elbe mit ihren Geschichten und Gefahren als auch ein Sinnbild dafür, dass alles fließt und sich verändert: das Leben, die Zeit und auch das Theater. Freuen Sie sich gemeinsam mit uns auf fantasievolle, knallharte, rührende, komische, hoffnungsvolle, traurige, entlarvende, intelligente, überraschende und neue Bilder von Wirklichkeiten. Der Filmemacher Edgar Reitz hat einmal einen Satz gesagt, der auch auf die Arbeit der Bürgerbühne zutrifft: „Alles, was erzählt wird, hat sich wirklich ereignet – nichts hat sich so ereignet, wie es erzählt wird.“ In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und uns eine schöne neue Spielzeit. Miriam Tscholl, David Benjamin Brückel und Silke zum Eschenhoff Leitung der Bürgerbühne Informationen zu allen hier vorgestellten Produktionen der Bürgerbühne erhalten Sie im Internet unter: www.staatsschauspiel-dresden.de p Telefon: 0351.49 13 – 740 p E-Mail: [email protected] Wenn Sie den Newsletter der Bürgerbühne erhalten möchten, können Sie ihn per E-Mail bestellen: Einmal im Monat bekommen Sie alle aktuellen Informationen zu den Aufführungen, Veranstaltungen und Ausschreibungen der Bürgerbühne per E-Mail zugeschickt. 93 Die Inszenierungen der Bürgerbühne Merlin oder Das wüste Land von Tankred Dorst Ein Weltentwurf mit Dresdner Jugendlichen Premiere am 27. September 2014 im Kleinen Haus 2 Regie: Kristo Šagor Ein überbordendes Dramenmaterial aus 97 Szenen: Das ist „Merlin“. Hier treffen die Mythen des Mittelalters auf unsere Gegenwart: Die Menschen irren durch eine Zeitenwende und suchen neue Werte und Orientierung. Die Hauptfigur ist der Zauberer Merlin, der als Sohn des Teufels von einer Riesin geboren wird. Bei der Geburt assistiert ein Clown. Merlin weiß nie, ob seine Pläne zum Guten oder zum Bösen ausschlagen. Mit im Spiel sind der Satan, König Artus und seine Gemahlin Ginevra, der Ritter Lancelot, Mark Twain, der Tod, eine Puffmutter, der kleine alte Papst, die kichernde Jeschute und unzählige weitere Gestalten, die man kennenlernen sollte. Gemeinsam mit dem Regisseur Kristo Šagor untersuchen Dresdner Jugendliche die große Saga und stellen sich den Fragen des Seins und des Werdens, die Tankred Dorst darin aufwirft. Denn die Kindheit war gestern, und die Zeit der großen Weltentwürfe ist jetzt! Wir suchen junge Leute zwischen 14 und 24 Jahren, die selbst nach Utopien und Weltentwürfen suchen. Ein Infotreffen findet am 13. Mai 2014 um 18 Uhr im Kleinen Haus Mitte statt. Geprobt wird zwischen Mai und September. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Ausführliche Informationen zum Stück p Seite 28 Katzelmacher von Rainer Werner Fassbinder Erzählt von jungen Dresdnerinnen und Dresdnern Premiere am 12. Dezember 2014 im Kleinen Haus 3 Regie und Raum: Robert Lehniger Der Grieche Jorgos wird für die Jugend in einem Vorort von München zur Zielscheibe ihrer Aggressionen und Vorurteile. Man neidet ihm den Erfolg bei den Mädchen und heizt Gerüchte an, um ihn zu kriminalisieren. Am Ende rechnen Erich, Peter und Franz in einer Schlägerei mit dem Außenseiter ab. Die Parallelen zwischen unserer Gesellschaft und dem Vorort in Fassbinders „Katzelmacher“, geschrieben 1968, sind nicht zu übersehen: Die Angst vor dem Fremden ist dort am größten, wo man ihm selten begegnet. Wir suchen jüdische Bürger aus aller Welt, die heute in Dresden leben und auf der Bühne aus ihrem Leben erzählen möchten. Ein Infotreffen findet am 20. Oktober 2014 um 18 Uhr im Kleinen Haus Mitte statt. Geprobt wird zwischen November 2014 und Februar 2015. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Ausführliche Informationen zum Stück p Seite 35 Soldaten Ein Dokumentartheater über Helden, Heimkehrer und die Zukunft des Krieges Uraufführung im März 2015 im Kleinen Haus 3 Eine Inszenierung der Bürgerbühne in Kooperation mit dem Militärhistorischen Museum Dresden Regie: Clemens Bechtel Wer und was sind Soldaten heute? Wie unterscheidet sich ihr Dienst in der Bundeswehr von dem vor ’89, von dem in der nva oder von dem in anderen Ländern dieser Erde? Nur wenige Städte in Deutschland wurden so stark vom Militär geprägt wie Dresden. Zur Vergangenheit und zur Identität Dresdens gehören der Bombenangriff 1945, die zahlreichen ehemaligen Kasernen in der Albertstadt, die Offiziersschule, das Militärhistorische Museum und die Sowjetarmee, die zwischen 1945 und 1989 hier stationiert war. All das hat Spuren hinterlassen, so wie auch der Wehrdienst in der nva viele Dresdner geprägt hat. Wir suchen Dresdner Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr und der NVA, Angehörige oder Bedienstete der Sowjetarmee sowie Menschen, die nach Dresden gezogen sind und an anderen Orten Soldaten waren. Außerdem Bürger und Bürgerinnen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, als Wissenschaftler, Hobbyexperte oder Computerspieler. Der Stücktext entsteht u. a. aus Interviews mit den Teilnehmern. Ein Infotreffen findet am 1. Oktober 2014 um 18 Uhr im Kleinen Haus Mitte statt. Geprobt wird zwischen November und März. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Ausführliche Informationen zum Stück p Seite 36 Alles im Fluss Ein Projekt über die Elbe und den Wandel der Zeit Uraufführung im April 2015 im Kleinen Haus 3 Regie: Uli Jäckle Wir suchen junge Männer und Frauen zwischen 16 und 30 Jahren, die in Dresden und Region leben. Ein Infotreffen findet am 26. September 2014 um 18 Uhr im Kleinen Haus Mitte statt. Geprobt wird zwischen Oktober und Dezember. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Ausführliche Informationen zum Stück p Seite 30 Der Regisseur Uli Jäckle wirft gemeinsam mit Dresdnern und Bewohnern der Sächsischen Schweiz einen Blick auf Flüsse, die Menschen verbinden: auf die Elbe sowie auf das Werden und den Wandel des Lebens. Nach „Der Fall aus dem All“ und „Wildnis“ ist dies der letzte Teil der Trilogie, die Stadt und Landschaft verbindet. Mischpoke Eine jüdische Chronik von 1945 bis heute Uraufführung im Februar 2015 im Kleinen Haus 3 Regie: David Benjamin Brückel Wir suchen Dresdner und Bewohner der Sächsischen Schweiz zwischen 8 und 88 Jahren, die Lust haben, sich in einem Theaterprojekt mit Flüssen auseinanderzusetzen. Mit dem Fluss ihres eigenen Lebens, mit dem Fluss vor ihrer Haustür oder mit dem Fluss ihrer Körpersäfte. Spezialist ist hier jeder. Homöopathen, Philosophen, Schiffer, Kanalbauer, Wasserversorgungstechniker, Angler und andere Experten sind ebenfalls herzlich willkommen. Ein Infotreffen findet am 11. Februar 2015 um 18 Uhr im Kleinen Haus Mitte statt. Geprobt wird von März bis April 2015. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Ausführliche Informationen zum Stück p Seite 36 Was war bei Kriegsende 1945 übrig vom jüdischen Leben in Dresden? Wie stellt es sich heute dar? Und was ist in der Zwischenzeit passiert? In Form einer Chronik lassen jüdische Bürger aus aller Welt, die heute in Dresden wohnen, ihr Leben zwischen 1945 und 2015 Revue passieren. Ihre Geschichten handeln von Tradition, Aufbruch, Erneuerung, Migration, Würde, Rache, Essen, Religion und Familie. Familie heißt im Jiddischen „Mischpoke“. 94 Die Clubs der Bürgerbühne Auch in dieser Spielzeit laden wir Menschen aller Altersstufen aus Dresden und Umgebung ein, an unseren Clubs teilzunehmen. Im Rahmen der einmal pro Woche stattfindenden Proben wollen wir gemeinsam mit euch Theater spielen. Die Ergebnisse werden in Werkstattaufführungen präsentiert. Ein Infotreffen für alle Clubs findet am 19. September um 17:30 Uhr im Kleinen Haus Mitte statt. Anmeldungen für die Clubs sind bis 20. September möglich. E-Mail: [email protected] p Telefon: 0351.49 13 – 740 Club der utopischen Bürger von 14 bis 24 Jahren In seinem Zukunftsroman „Schöne neue Welt“ entwirft Aldous Huxley das erschreckende Bild einer genormten Gesellschaft. Der Club der utopischen Bürger bezieht die Themen des Romans auf unsere Wirklichkeit: Hinterfragen wir das System, in dem wir leben? Und wie weit sind wir von der schönen neuen Welt entfernt? Leitung: Christiane Lehmann (Theaterpädagogin) p September bis Januar, mittwochs 18–21 Uhr + 3 Wochenenden Club der flanierenden Bürger von 14 bis 18 Jahren Nur wenige Dresdner wissen, dass im Zwingerteich eine Meerjungfrau lebt. Kaum jemand konnte bisher Gräfin Cosel beim Shoppen in der Prager Straße beobachten. Die flanierenden Bürger werden an scheinbar bekannten Orten unserer Stadt unbekannte Geschichten entdecken. Leitung: Philipp Lux (Schauspieler), Norman Schaefer (Theaterpädagoge) p September bis Juni, dienstags 16–18 Uhr Club der (in)toleranten Bürger von 14 bis 99 Jahren Mal grenzen wir andere aus, mal werden wir ausgegrenzt. Wo die Toleranzgrenze verläuft, untersuchen wir mit geduldeten, vernachlässigten, idealistischen, privilegierten und lebensmutigen Bürgern aus Deutschland und der ganzen Welt. Leitung: Jan Gehler (Regisseur), Olga Feger (Schauspielerin) p September bis Juni, donnerstags 16–18 Uhr Club der erzählenden Bürger von 20 bis 99 Jahren 2015 feiern wir Hans Christian Andersens 210. Geburtstag. Im Club der erzählenden Bürger fragen wir, wann wir uns als „hässliches Entlein“ fühlen, welche „Schneekönigin“ unser Herz zu einem Eisklumpen gefrieren lässt und welche „neuen Kleider“ Politiker heute tragen. Leitung: Norman Schaefer (Theaterpädagoge) p September bis Februar, freitags 18–21 Uhr + 2 Wochenenden Club der dramatischen Bürger von 18 bis 99 Jahren In diesem Jahr beschäftigt sich der Club der dramatischen Bürger mit dem Roman „Amerika“ von Franz Kafka. Wir begleiten Karl Roßmann auf seiner Reise und untersuchen, was Aufbruch, Ankunft und Zugehörigkeit im Leben eines Menschen bedeuten. Leitung: Katja Heiser (Theaterpädagogin) p September bis Juni, dienstags 18–21 Uhr Club der informierten Bürger von 14 bis 40 Jahren Wie wird unsere Meinung gemacht, und wie beeinflussen Medien unsere Entscheidungen? Frei nach dem Motto „Das Medium ist die Botschaft“ wollen wir die Kommunikationsmedien genauer unter die Lupe nehmen. Leitung: Sophie Püschel (Dramaturgieassistentin) p September bis Juni, mittwochs 16–18 Uhr Club der aufgeklärten Bürger von 33 bis 88 Jahren Wie war dein erstes Mal? Wie verändert sich die Lust mit dem Älterwerden? Wie stellst du dir deinen letzten Kuss vor? Wir erkunden ein Thema, dem sich niemand entziehen kann. Leitung: Christiane Lehmann (Theaterpädagogin) p Januar bis Juli, mittwochs 18–21 Uhr + 3 Wochenenden Club der verrückten Bürger von 14 bis 99 Jahren Wie verrückt sieht es in dir drin aus? Wie normal ist die Welt da draußen? Wir verlegen die Bretter, die die Welt bedeuten, aufs harte Pflaster der Normalität, um es ordentlich zu erschüttern. Leitung: Nora Otte (Regieassistentin), Ansgar Prüwer (Bühnenbildassistent) p September bis Juni, samstags 15–17 Uhr Club der blabla Bürger von 16 bis 24 Jahren Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man bekanntlich schweigen. Spielen werden wir aber trotzdem! Wir erzählen Geschichten ohne Worte oder zumindest ohne Worte, die es schon gibt. Leitung: Malte Schiller (Regieassistent) p September bis Juni, montags 16–18 Uhr Club der spielenden Bürger von 16 bis 40 Jahren Life’s a game – let’s play! Angelehnt an den Brettspielklassiker performen wir live unsere Version des „Spiels des Lebens“ – mit eigenen Regeln und Strategien, mit Aufgaben, die es zu bewältigen gilt, und mit hohen Einsätzen. Leitung: Ulrich Reinhardt (Theaterpädagoge) p September bis Juni, montags 18–21 Uhr Club der lehrenden Bürger für Pädagogen und Referendare In Kooperation mit der Sächsischen Bildungsagentur, Regionalstelle Dresden Sie sind Wissensvermittler, Freund und Darsteller in einem. Lehrende Bürger brauchen starke Nerven, klare Visionen, eine gut sitzende Stimme und gespitzte Bleistifte. Lehrkräfte aller Schularten und Bildungseinrichtungen lernen im Club der lehrenden Bürger verschiedene theaterpädagogische Methoden und theatrale Spielformen kennen und erarbeiten daraus ein besonderes Lehrstück. Leitung: Bettina Seiler p Termine: September bis Juli, vierzehntägig donnerstags 18–20 Uhr Club der anders begabten Bürger von 14 bis 99 Jahren Hier dreht sich alles um den Lebensalltag der Teilnehmer. Wo stoßen sie durch ihre Behinderung an Grenzen? Und wie sieht eine Welt aus, in der Inklusion kein Fremdwort ist? Aus persönlichen Geschichten und kurzen filmischen Beiträgen entsteht ein Theaterabend, der essenzielle Lebensbereiche aus der Perspektive von Menschen mit Behinderung untersucht und offen diskutiert. Der Club wird vom Sächsischen Ministerium für Soziales gefördert und durch Spenden unterstützt. Leitung: Jacqueline Hamann, Silke Schmidt (Theaterpädagoginnen) p Januar bis Dezember, montags 9–16 Uhr Club der erinnernden Bürger von 20 bis 99 Jahren Das Parfum unserer Großmutter. Der erste Kuss. Wir können uns nicht erinnern. An den Namen unserer Geigenlehrerin. Was Fenster auf Italienisch heißt. Im Club der erinnernden Bürger kramen wir in unserem lückenhaften Gedächtnis, lesen in Aufzeichnungen berühmter Personen und erfinden nie da gewesene Ereignisse. Leitung: Norman Schaefer (Theaterpädagoge) p Februar bis Juli, freitags 18–21 Uhr + 2 Wochenenden 95 Theater und Schule Alte Stücke, neue Lesarten, performative Ansätze, partizipative Formate, mediatisierte Theaterformen – das Spektrum im zeitgenössischen Theater ist breit. Es ist uns ein Anliegen, Lernenden und Lehrenden das Theater als Ort der kritischen und lebendigen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Fragen zu öffnen. In Workshops, Projekten oder Fortbildungen wollen unsere Theaterpädagoginnen als Vermittlerinnen zwischen dem Staatsschauspiel Dresden und Bildungseinrichtungen Lust auf das Theater von heute machen, das Potenzial des Theaterspielens ausloten, Rezeptionskompetenzen entwickeln, Fragen aufwerfen und die Wahrnehmung der Zuschauer zurück in die künstlerischen Teams spiegeln. Auch in der Spielzeit 2014/2015 laden wir Sie herzlich dazu ein, gemeinsam mit uns künstlerische und Kunst vermittelnde Praxisfelder zu erkunden und das Staatsschauspiel Dresden für sich und Ihre Schüler als attraktiven außerschulischen Lernort immer wieder oder ganz neu zu entdecken. Die Theaterpädagoginnen Bettina Seiler und Christiane Lehmann freuen sich auf Sie! Bitte richten Sie Ihre Anfragen an Bettina Seiler Telefon: 0351.49 13 – 742 p E-Mail: theaterpaedagogik@ staatsschauspiel-dresden.de Angebote für Schulklassen Theaterworkshops In vorbereitenden Workshops ermöglichen wir Schulklassen einen spielerischen Zugang zum Theaterbesuch. Durch eine praktische Auseinandersetzung mit Thema, Inhalt, aber auch Spielweise oder Ästhetik der jeweiligen Inszenierung möchten wir Brücken zwischen der Aufführung und der eigenen Lebenswelt der Schüler schlagen, deren Wahrnehmung schärfen und natürlich die Neugier auf das Theatererlebnis wecken. In nachbereitenden spielpraktischen Workshops treten die Schüler mit uns in einen Austausch über Gesehenes und Wahrgenommenes, werfen Fragen auf und finden mögliche Antworten. Termine: nach Absprache p Dauer: max. 90 Minuten p Ort: Schule oder Theater Theaterführungen Wo befindet sich die Königsloge? Was hat der Eiserne Vorhang mit Theatergeschichte zu tun? Wozu braucht man eine Tischversenkung? Wie lange dauert die Fahrt eines Hubpodiums? Wo sitzt eigentlich die Souffleuse? Im Rahmen von Führungen durch unser Haus können Schulklassen und Kita-Gruppen das Theater einmal nicht „nur“ vom Zuschauerraum aus erleben. Wir ermöglichen Blicke hinter die Kulissen, stellen Theaterberufe vor und öffnen Türen, die für das Publikum eigentlich verschlossen sind. Kosten: 1,50 € pro Person p Termine: wochentags 8:30 Uhr oder nach Absprache p Dauer: ca. 60 Minuten p Ort: Schauspielhaus p Treffpunkt: Bühneneingang Theaterquartal Das Theaterquartal ist ein Theaterpaket für Schüler mit dem Ziel, das Staatsschauspiel Dresden unter konkreten Forschungsfragen zu erkunden: p Modul 1: Theaterworkshop p Modul 2: Theaterbesuch p Modul 3: Theaterführung p Modul 4: Meet the artist – wir treffen eine an der Produktion beteiligte Person und kommen mit ihr ins Gespräch. Die Reihenfolge der Module ist variabel. Mindestens drei Module müssen in Anspruch genommen werden. Angebot für Oberschulen ab Klassenstufe 8 p Ort: Theater oder Schule p Zeitraum: Oktober bis Dezember 2014 oder April bis Juni 2015 Was für ein Drama? Beckett, Brecht, Büchner, Bernhard? Nachdem Sie mit Ihrem Kurs eine Aufführung im Staatsschauspiel besucht haben, reflektieren wir das Gesehene auch unter dramentheoretischen Schwerpunkten und untersuchen mit den Schülern spielerisch verschiedene Theaterkonzepte: Wie unterscheidet sich das epische Theater vom aristotelischen Drama? Was kennzeichnet das dokumentarische Theater, und wann spricht man von postdramatischen Theaterformen? Angebot für Grund- und Leistungskurse Deutsch p Termine: nach Absprache p Dauer: 90 Minuten p Orte: Schule oder Theater Das erste Mal Theater! Sie waren mit Ihrer Klasse noch nie im Theater? Wir freuen uns über Neueinsteiger, denen wir geeignete Inszenierungen mit konkreten Spielterminen empfehlen, zu denen Sie und Ihre Schüler Eintrittskarten für nur 3,00 € erwerben können. Der Theaterbesuch wird nach Absprache theaterpädagogisch vor- oder nachbereitet. Die genauen Termine erhalten Sie zu Beginn der Spielzeit 2014/2015 an unseren Theaterkassen, im Internet oder über die Theaterpädagogik. 96 Theater und Schule Angebote für Pädagogen Informationen, Termine und Anmeldung unter: [email protected] Fortbildungen für Pädagogen Informationen, Termine und Anmeldung unter: [email protected] Newsletter Sie wollen bestimmte Aufführungstermine für Ihre Planung rechtzeitig wissen? Sie möchten über Premieren, Fortbildungen, schulrelevante Sonderveranstaltungen oder Gastspiele informiert werden? Abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter für Lehrer, Referendare, Kursleiter und Dozenten per Post oder E-Mail. Pädagogischer Tag Sie planen einen pädagogischen Tag für das Lehrerkollegium oder einen Fachthementag für Referendare? In Anlehnung an den Besuch einer unserer Repertoireinszenierungen erkunden wir gemeinsam die Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit der jeweiligen Inszenierung aus theaterpädagogischem Blickwinkel und erproben konkrete spielpraktische Übungen. Termine und Ort nach Absprache Theaterpädagogische Materialmappen Zu ausgewählten Produktionen bieten wir Materialmappen mit theoretischen Impulsen und konkreten spielpraktischen Anregungen für die Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuchs an. Fragen Sie uns, wir schicken Ihnen unsere Mappen gerne zu. Lehrervorschau Wir laden Sie und jeweils eine begleitende Person ein, unsere Neuinszenierungen zum Preis von 8,00 € „vorzukosten“. Im Gespräch mit Dramaturgen und Theaterpädagogen erfahren Sie mehr über die Lesart des Stücks, die Spielweise, das Konzept und die Ästhetik der Inszenierung sowie die mögliche Einbettung des Theaterbesuchs in Ihren Unterricht. Die Termine und Zusatzinformationen entnehmen Sie bitte unserem Newsletter oder erfragen sie in der Theaterpädagogik! Lehrervorschau-Pass Mit dem Lehrervorschau-Pass vereinfachen wir für Sie den Kartenbestellvorgang. Dieser Pass berechtigt Sie, Karten für die Lehrervorschau – ohne Reservierung über die Theaterpädagogik – direkt an unseren Vorverkaufskassen unter dem Stichwort „Lehrervorschau“ zu erwerben. Bitte beachten Sie die entsprechenden Abholfristen, die wir Ihnen im Newsletter mitteilen. Bestellen Sie den Pass telefonisch oder per Mail in der Abteilung Theaterpädagogik. Er kostet nichts, ist personengebunden und gilt für die ganze Spielzeit. Workshop zu „Schöne neue Welt“ von Aldous Huxley Anhand der Bühnenfassung des bekannten dystopischen Romans von 1932 untersuchen wir in diesem Workshop spielerisch, wie frei und selbstbestimmt wir in der heutigen Gesellschaft sind. Hinterfragen wir das System, in dem wir leben? Welchen Preis haben Glück und Wohlstand heute? Wie wertvoll ist die Fähigkeit zu Kritik und Selbsterkenntnis, und wie weit hat die moderne Gesellschaft sie mit ihren hedonistischen Angeboten geprägt? Für Lehrkräfte an Oberschulen, Gymnasien, Beruflichen Gymnasien p Leitung: Christiane Lehmann p Termin: Oktober 2014 (14–18 Uhr Workshop / 19:30 Uhr Besuch der Vorstellung) Einführung in die szenische Interpretation anhand von Goethes „Faust“ Wofür würde ich meine Seele verkaufen? Welchen Sinn hatte mein bisheriges Leben? Wo steckt der Teufel in mir? Wie lautet meine persönliche Gretchenfrage? Die Teilnehmer dieser Fortbildung erkunden den performativen Ansatz der Produktion und lernen verschiedene Methoden der szenischen Interpretation und deren Übertragung auf den Unterricht kennen. Ausgehend von der literarischen Vorlage Goethes gehen sie auf kreative Art und Weise faustischen Fragen und Motiven nach. Für Lehrkräfte an Oberschulen, Gymnasien, Beruflichen Gymnasien p Leitung: Bettina Seiler p Termin: März 2015 (14–18 Uhr Workshop / 19:30 Uhr Besuch der Vorstellung) Lehrerclub In Kooperation mit der Sächsischen Bildungsagentur, Regionalstelle Dresden Auftreten, Präsenz zeigen, wahrnehmen, bewegen, Spannung halten, improvisieren, reflektieren, Figuren skizzieren, Szenen entwickeln und gestalten. Lehrkräfte aller Schularten, die eine Theater-ag leiten, das künstlerische Profil unterrichten oder sich selbst im Theaterspiel ausprobieren möchten, lernen im Lehrerclub verschiedene theaterpädagogische Methoden und theatrale Spielformen kennen und erarbeiten gemeinsam ein ganz besonderes Lehrstück. Leitung: Bettina Seiler p Termine: September 2014 bis Juni 2015, vierzehntägig donnerstags 18–20 Uhr 97 Unsere Kulturförderung: Gut für die Sinne. Gut für die Region. Seit über 100 Jahren bringt das Staatsschauspiel Dresden Geschichten auf die Bühne. Hier wird gesagt, was sich schwer sagen lässt. Hier wird vernommen, was schwer zu Gehör zu bringen ist. So verbindet das Theater Menschen aller Generationen. Die Ostsächsische Sparkasse Dresden ist Projektpartner für die Kinder- und Jugendstücke am Staatsschauspiel. Denn junge Menschen für Theater zu begeistern, ist Theater mit Zukunft mitten in unserer Stadt! 98 SAISON 2014 / 15 semperoper Peter Ronnefeld Lucia Ronchetti NACHTAUSGABE MISE EN ABYME / WIDERSPIEGELUNG Deutsche Erstaufführung Ekkehard Klemm, Manfred Weiß 4. Oktober 2014 Uraufführung Felice Venanzoni, Axel Köhler 22. Februar 2015 Leoš Janáček DAS SCHLAUE FÜCHSLEIN Tomáš Netopil, Frank Hilbrich 18. Oktober 2014 Helmut Oehring DIE BRÜDER LÖWENHERZ RICHARD-STRAUSS-TAGE Uraufführung Manfred Weiß 14. März 2015 6. bis 23. November 2014 Richard Strauss ARABELLA Carl Maria von Weber Christian Thielemann, Florentine Klepper 7. November 2014 DER FREISCHÜTZ Christian Thielemann, Peter Schneider, Axel Köhler 1. Mai 2015 Engelbert Humperdinck KÖNIGSKINDER Lothar Koenigs, Jetske Mijnssen 19. Dezember 2014 William Forsythe IMPRESSING THE CZAR Claude Debussy 22. Mai 2015 PELLÉAS ET MÉLISANDE Mikko Franck, Àlex Ollé (La Fura dels Baus) 24. Januar 2015 Wolfgang Amadeus Mozart LE NOZZE DI FIGARO / DIE HOCHZEIT DES FIGARO David Dawson TRISTAN + ISOLDE Omer Meir Wellber, Johannes Erath 20. Juni 2015 Uraufführung 15. Februar 2015 PA R T N E R D E R S E M P E R O P E R Informationen & Karten T 0351 4911 705 semperoper.de SO_A_Staatsschauspiel_RZ.indd 1 01.04.14 10:38 99 + grafik + druck + verteilung + plakatierung Flyerverteilung Bunte Medien GmbH + Leipziger Straße 31 + 01097 Dresden + T. 0351 821 139 0 + [email protected] DIGITALE GROSSBILDLÖSUNGEN FÜR MESSE, SHOP & ARCHITEKTUR © Asisi Dresden 1756 Das monumentale Panorama des historischen Dresden wurde von Marx & Moschner auf 3000 qm Textil digital gedruckt. Es entfaltet sich über 27 m Höhe in einem Durchmesser von 35 m im Panometer Dresden. Weitere Panoramen sind zu sehen in Leipzig „Völkerschlacht 1813“ und Berlin „Die Mauer“. © Holzwerkstatt Eichhorn Marx & Moschner druckt und präsentiert digitale Großbilder für namhafte Unternehmen wie Daimler, Warsteiner, Krombacher, Opel, Siemens, Audi, S.Oliver oder das Staatsschauspiel Dresden in höchster Perfektion und Brillanz. Wigeystr. 18 - 20 • 57368 Lennestadt Tel.: 0 27 23 | 96 68-0 [email protected] www.marx-moschner.de ® www.paul-von-maur.de û Die Welt bewegt sich mit uns • weltweite Umzüge • Möbelaufzüge • Packmittel • Selbsteinlagerung • Aktenlagerung • Archivlogistik • Lagerlogistik • Betriebsverlagerung Paul v. Maur GmbH Internationale Spedition Betrieb: Inselallee 20 - 24, 01723 Kesselsdorf Tel. 03 52 04/ 7 12 10 · Fax: 03 52 04/ 7 12 11 Stadtbüro: Bremer Str. 16 b 01067 Dresden û Your Global Relocation Solution 100 03 51 - 4 90 13 35 Dresdens Klang. 2014 / 2015 Bertrand de Billy Michael Sanderling Xavier de Maistre Markus Stenz L‘UBA ORGONÁŠOVÁ Jean-Yves Thibaudet KAZUKI YAMADA Martin Grubinger Julian Steckel Giuliano Carmignola IAN BOSTRIDGE Hans Graf TABEA ZIMMERMANN V A D I M G L U Z M A N Dennis Russell Davies RENÉ PAPE Dmitri Kitajenko Marina Prudenskaja ALEXANDER LIEBREICH Besucherservice der Dresdner Philharmonie · Weiße Gasse 8 · 01067 Dresden +49 (0) 351 | 4 866 866 · [email protected] · www.dresdnerphilharmonie.de 101 Wir wünschen Ihnen faszinierendes Theater. Unsere Dienstleistungen: Personenschutz Mobile Sicherheitsdienste Objektschutz Veranstaltungsschutz Werkschutz Einzelhandelssicherheit Feuerwehrdienste Sicherheitskonzeption Sicherheitstechnik Ergänzende Sicherheitsservices Notruf- und Service-Leitstelle Einlass-, Kassen- und Garderobendienste Am Brauhaus 8 b, 01099 Dresden Telefon: 0351/ 88 959 88 Telefax: 0351/ 88 959 77 E-Mail: [email protected] www.power-gmbh.de BERLIN · DRESDEN · FRANKFURT · HAMBURG · KÖLN · LEIPZIG · LüBEcK · LüNEBURG MüNcHEN · PRITZWALK · RENDSBURG · STUTTGART · ATHEN POWER. Das ist sicher. www.wgaufbau-dresden.de RZ_Power_AnzTheather_200x95,7_220313.indd 1 102 22.03.13 09:41 Einziehen + Wohlfühlen Wohnungsgenossenschaft Aufbau Dresden eG, Henzestr. 14 • 01309 Dresden • Tel (0351) 44 32-0 • Fax 44 32-299 Öffnungszeiten: Mo. / Mi. 09 – 12 Uhr, 13 – 16 Uhr / Die. / Do 09 – 12 Uhr, 13 – 18 Uhr / Fr. 09 – 12 Uhr Staatsoperette Dresden, 2. bis 10. Mai 2015 buchbar ab 29. April 2014 Sa 2 19:30 Cagliostro Operette von Johann Strauss Premiere So 3 19:30 Die Fledermaus Operette von Johann Strauss Di 5 19:30 Eine Nacht in Venedig Operette von Johann Strauss Mi 6 19:30 Cagliostro Operette von Johann Strauss Do 7 19:30 Frühlingsstimmen Johann-Strauss-Konzert Fr 8 19:30 Fledermaus zu dritt Gastspiel mit Michael Quast Sa 9 19:30 Frühlingsstimmen Johann-Strauss-Konzert So 10 17:00 Cagliostro Operette von Johann Strauss www.staatsoperette-dresden.de JSFD_Staatsschauspiel.indd 1 17.03.2014 14:32:47 103 Ensemble und Mitarbeiter 2014/2015 Schauspieler p Ensemble: Cathleen Baumann, Sonja Beißwenger, Thomas Braungardt, Christian Clauß, Thomas Eisen, Rosa Enskat, Christian Erdmann, Albrecht Goette, Sascha Göpel, Christine Hoppe, Holger Hübner, Ben Daniel Jöhnk, Lars Jung, André Kaczmarczyk, Hannelore Koch, Jonas Friedrich Leonhardi, Matthias Luckey, Philipp Lux, Jan Maak, Ahmad Mesgarha, Anna-Katharina Muck, Duran Özer, Benjamin Pauquet, Ina Piontek, Karina Plachetka, Tom Quaas, Torsten Ranft, Matthias Reichwald, Nele Rosetz, Lea Ruckpaul, Yohanna Schwertfeger, Antje Trautmann, Ines Marie Westernströer p Studentinnen und Studenten des Schauspielstudios: Nina Gummich, Pauline Kästner, Tobias Krüger, Kilian Land, Lukas Mundas, Justus Pfankuch, Nadine Quittner, Max Rothbart p Gastschauspieler: Annedore Bauer, Mathias Bleier, Simon Esper, Arantza Ezenarro, Christian Friedel, Jürgen Haase, Gerhard Hähndel, Stefko Hanushevsky, Benjamin Höppner, Vera Irrgang, Ilhun Jung, Benedikt Kauff, Thomas Kitsche, Burghart Klaußner, Annett Krause, Günter Kurze, Philip Lehmann, Peter Lobert, Jacqueline Macaulay, Hagen Matzeit, Nadja Mchantaf, Romy Petrick, Anton Petzold, Julia Kathinka Philippi, Oda Pretzschner, Martin Reik, Dominik Schiefner, Annika Schilling, Cornelia Schmaus, Thomas Schumacher, Laina Schwarz, Lore Stefanek, Atef Vogel, Picco von Groote, Hanns-Jörn Weber, Sebastian Wendelin, Helga Werner Regie Stefan Bachmann, Sebastian Baumgarten, Clemens Bechtel, Thomas Birkmeir, David Benjamin Brückel, Bettina Bruinier, Barbara Bürk, Nuran David Calis, Wolfgang Engel, Holk Freytag, Jan Gehler (Hausregisseur), Jan Philipp Gloger, Friederike Heller, Julia Hölscher, Uli Jäckle, Tilmann Köhler (Hausregisseur), Burkhard C. Kosminski, Sebastian Kreyer, Andreas Kriegenburg, Malte C. Lachmann, Robert Lehniger, David Lenard, Susanne Lietzow, Hauke Meyer, Armin Petras, Tobias Rausch, Matthias Rebstock, Stephan Reher, Matthias Reichwald, Malte Schiller, Kristo Šagor, Clemens Sienknecht, Simon Solberg, Sandra Strunz, Miriam Tscholl, Linus Tunström, Roger Vontobel Bühnenbildner und Kostümbildner Olaf Altmann, Elena Anatolevna, Tine Becker, Julia-Elisabeth Beyer, Esther Bialas, Jeremias Böttcher, Su Bühler, Alexandre Corazallo, Thomas Dreißigacker, Barbara Drosihn, Florian Etti, Dagmar Fabisch, Irène Favre de Lucascaz, Anke Grot, Ulrike Gutbrod, Sabine Hilscher, Volker Hintermeier, Ellen Hofmann, Irene Ip, Cornelia Kahlert, Judith Kästner, Irmgard Kersting, Justina Klimczyk, Johannes Köhler, Sabine Kohlstedt, Andreas Kriegenburg, Aurel Lenfert, Marie Luise Lichtenthal, Ute Lindenberg, Hartmut Meyer, Belén Montoliú Garcia, Marion Münch, Wolf Münzner, Jelena Nagorni, Philipp Nicolai, Karoly Risz, Maria Roers, Claudia Rohner, Sabrina Rox, Thomas Rump, Andrea Schaad, Matthias Schaller, Susanne Scheerer, Irina Schicketanz, Christina Schmitt, Christoph Schubiger, Daniela Selig, Michael SieberockSerafimowitsch, Bernhard Siegl, Maike Storf, Katja Strohschneider, Susanne Uhl, Anna van Leen, Teresa Vergho, Magda Willi p Video: Sabine Beyerle, Sami Bill, Stefan Bischoff, Immanuel Heidrich, Joscha Sliwinski, Clemens Walter, Petra Zöpnek Musik p Musikalische Leitung: Michael E. Bauer, Vivan Bhatti, Johannes Birlinger, Hans-Jörn Brandenburg, Christiane Büttig, Christoph Clöser, Gilbert Handler, Thomas Hertel, Knut Jensen, Sven Kaiser, Sebastian Katzer, Roman Keller, Kriton Klingler-Ionnaides, Johannes Lehniger, Thomas Mahn, Jan Maihorn, Keith O’ Brien, Hans Platzgumer, Peter Thiessen, Felice Venanzoni, Tobias Vethake, Henrik von Holtum, Jörg-Martin Wagner p Bühnenmusiker: Christoph Clöser, Marc Dennewitz, Dieter Fischer, Tom Götze, Christoph Hermann, Philine Jobst, Heiko Jung, Sven Kaiser, Thomas Mahn (Ensemble), Florian Mayer, Keith O’ Brien, Christian Patzer, Tobias Peschanel, Christian Rien, Benjamin Rietz, Thomas Seibig, Friedemann Seidlitz, Marie Stosiek, Peter Thiessen, Sebastian Vogel, Georg Wieland Wagner, Woods Of Birnam, Dietrich Zöllner p Sprecherziehung: Sabine Haupt p Choreografie: Claus Großer, Johanna Roggan 104 Intendanz Intendant: Wilfried Schulz p Mitarbeit und Sekretariat: Jeanette Seeger p Künstlerische Produktionsleiterin (Koproduktionen, Gastspiele, Sonderveranstaltungen): Mary Aniella Petersen p Kaufmännischer Geschäftsführer Sächsische Staatstheater: Wolfgang Rothe p Stellvertretender Kaufmännischer Geschäftsführer Schauspiel: Pierre-Yves Bazin p Sekretariat und Mitarbeit: Felicitas Brendel, Jaquelin Grumbt Dramaturgie Chefdramaturg: Robert Koall p Mitarbeit und Sekretariat: Sophie Püschel p Dramaturgie: Beret Evensen, Janine Ortiz, Julia Weinreich, Felicitas Zürcher, Armin Kerber (Gast) Die Bürgerbühne und Theaterpädagogik Leitung: Miriam Tscholl p Stellvertretende Leitung, Dramaturgie und Produktion: David Benjamin Brückel, Silke zum Eschenhoff p Theaterpädagoginnen: Christiane Lehmann, Bettina Seiler Schauspielstudio Dresden der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig Leitung: Tilmann Köhler, Felicitas Zürcher p Mitarbeit: Simone Wiemer Künstlerisches Betriebsbüro Künstlerischer Betriebsdirektor: Jürgen Reitzler p Leitung Künstlerisches Betriebsbüro: Ralf Schindler p Mitarbeit: David Eberhard, Simone Wiemer p Regieassistenz: Nora Otte, Julia Palus, René Rothe, Malte Schiller p Inspizienz: Michael Fleischer, Andreas Lötzsch (Leitung Statisterie), Detlef Müller, Matthias Tetzlaff p Soufflage: Viola Barkleit-Schlese, Uta Erler, Christina Loose Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Leiterin: Martina Aschmies p Mitarbeit und Sekretariat: Birgit Bräuer, Angela Rümmler p Grafik und Konzept: Johannes Erler, Henning Skibbe, Peter von Freyhold (ErlerSkibbeTönsmann) p Grafikerin: Andrea Dextor p Gestalterin für visuelles Marketing: Monika Brock p Mitarbeiterin visuelles Marketing: Kerstin Theurich p Mitarbeiterin Video: Martina Andrä p Fotografen: Matthias Horn (Konzept), David Baltzer, Daniel Koch p Illustrationen: Patrick Klose Technische Direktion Technischer Direktor: Christian Voß p Technischer Leiter Schauspielhaus und Stellvertretender Technischer Direktor: Franz Dextor p Technischer Leiter Kleines Haus und Stellvertretender Technischer Direktor: Bodo Garske p Technisches Betriebsbüro: Simone Krause, Antje Lindner, Gisela Reinhard p Technischer Produktionsleiter: Magnus Freudling p Technischer Assistent: Daniel Wolski p Konstruktionsabteilung: Hansi Borchers, Jörg Kittel, Michael Rethberg, André Thomas p Bühnenbildassistenz: Nora Ludwig, Ansgar Prüwer, Anne-Alma Quastenberg p Künstlerische Produktionsleitung Kostüm: Irène Favre de Lucascaz p Kostümbildassistenz: Lisa Edelmann, Pia Sophia Starke Die Bühnenbilder und Kostüme werden in den Werkstätten der Sächsischen Staatstheater gefertigt. Technischer Dienst und Gebäudemanagement Leitung: Roland Oertel p Haus- und Betriebstechnik (Leitung): Frank Ruder p Mitarbeiter Hausbetriebstechnik (Vorarbeiter): Olaf Teller p Mitarbeiter Hausbetriebstechnik: Nico Baumgart, Andreas Beyer, Thomas Hirche p Hausinspektion: Wolf Richter p Haus- und Betriebshandwerker: Thomas Giersemehl p Bühnenund Hausarbeiter: Peter Mende, Manfred Nixdorf, Detlef Richter, Daniel Weise p Pforte: Frank Schmidt, Mitarbeiter der Firma Kötter p Auszubildender Anlagenmechanik: Sebastian Mittag Bühnentechnik Theaterobermeister: Klaus-Peter Klunker p Theatermeister: André Dietze, Jens Kelm, Bernd Mahnert, Frank Scheibner, Helge Wittig p Vorarbeiter Maschinentechnik: Frank Beate p Seiten- bzw. Schnürmeister: Volker Blümel, Steffen Büttner, Pan Langhammer, Ronald Matthes, Gerd Müller, Udo Nitzsche, Jens Ørsted, Daniel Oertel, Michael Pohle, Steffen Riegel, Thomas Schubert, Georg Weber p Maschinisten: Frank Adam, Mario Dietrich, Lutz Ebert, Valentin Klunker, Christoph Lößner, Bernd Schulz p Bühnentechniker: Andreas Arnold, Heiko Barth, Uwe Becker, Torsten Bruhn, Andreas Dähner, Frank Domel, Gerd Eichhorn, Martin Eulitz, Lutz Feilotter, André Felsner, Ralf Gaitzsch, Thomas Glaß, Matthias Glauche, Jürgen Hage, Lutz Hänsel, Herbert Herzmann, Johannes Holzmann, Andreas Kallenbach, Matthias Kannenberg, Bernhard Klesse, Stefan Küchler, Axel Ladwig, Ingo Lenk, Rüdiger Liebthal, Ralph Löwe, Jens Lüttich, Daniel Meinl, Manuel Meinl, Mario Niese, Frank Pohle, Wilfried Richter, Frank Ruhland, Ronald Sämann, Rolf Socka, Henry Sorms, Sebastian Stefek, Michaela Thiel, Andreas Weiß, Jörg Zeidler Veranstaltungstechnik Veranstaltungstechniker: Matthias Hübner, Felix Langner p Auszubildende: Anne Dietrich, Debora Ernst, Daniel Reppe, Julian Schuppe Beleuchtung und Video Leitung: Michael Gööck p Stellvertretende Leitung Schauspielhaus: Andreas Barkleit p Stellvertretende Leitung Kleines Haus: Björn Gerum p Beleuchtungsmeister: Jürgen Borsdorf, Rolf Pazek, Olaf Rumberg p Stellwerksbeleuchter: Jens Clausnitzer, Carola Dregely, Henry Hillig, Robert Irrgang, Henryck Wecker, Thomas Wildenhain p Beleuchter: Achim Frank, Eric Frederich, Oliver Goy, Bruno Grotsch, Andreas Hanisch, Peter Köhler, Andreas Kunert, Jens Leopold, Petra Pazek, Christian Pöge, Elke Radtke, Andreas Rösler, Sven Schade, Olivia Walter p Videotechniker: Thomas Schenkel Ton Leitung: Manja Schreyer p Stellvertretende Leitung und Tonmeister: Torsten Staub p Tonmeister: Martin Schmitz p Tontechniker: Ulrich Berg, Hernán Ferrari, Peter Franke, Uwe Lahmann, Marion Reiz Maske Chefmaskenbildnerin: Gabriele Recknagel p Stellvertretende Chefmaskenbildnerin: Silvia Siegert p Erste Maskenbildnerin: Marika Hinkel p Maskenbildnerinnen: Kerstin Bähr, Jana Dittrich, Karoline Franz, Barbi Mederacke, Ines Pfitzner, Tatjana Richter, Cornelia Ulrich, Lisa Warnecke, Ulrike Weise, Ellen Wittich Requisite Leitung: Heike Jordan p Requisiteure: Heike Böhme, Steffi Engelmann, Christiane Findeisen, Kathrin Friedrich, Susanne Glauche, Heike Lieberum, Matthias Schulz, Ines Taggesell, Mareile Weller p Spezialeffekte Bühne, Waffenkammer: Tilo Ebert, Ramon Stage Ankleider Leitung: Ulrike Huste p Kostüm-, Änderungsschneiderin, Ankleiderin: Katrin Gehler p Ankleiderinnen: Heike Burmester, Daniela Kral, Beatrice Kubis, Antonia Lindenthal, Susanne Steffens Zentrale Dienste der Sächsischen Staatstheater / Staatsoper Dresden und Staatsschauspiel Dresden Kaufmännischer Geschäftsführer: Wolfgang Rothe p Referentin: Christin Otto p Assistentin: Kirstin Tittel p Stellvertretender Kaufmännischer Geschäftsführer: Pierre-Yves Bazin p Mitarbeit: Felicitas Brendel, Jaquelin Grumbt p Leiter Controlling: Sven Peschel p Mitarbeit Controlling: Cathleen Hofmann p Interne Revision und Organisation: Sylvia Bittner p Leiterin Personal: Solveig Eckert p Stellvertretender Leiter Personal: Uwe Behnisch p Mitarbeit Personalabteilung: Ulrike Bauer, Ilka Dietze, Doreen Fritzsche, Petra Helm, Cornelia Kamprath, Claudia Rüthrich, Jürgen Thürmann, Marie-Luise Weidner p Leiterin Rechnungswesen: Heike Sobkowiak p Mitarbeit Rechnungswesen: Hannelore Adam, Claudia Domine, Viola Kucher, Annett Jeschke, Bärbel Müller, Martina Oehme, Edelgard Proksch, Anja Schliemann p Leiterin Recht: Theda Kokenge p Mitarbeit Recht: Manuela Münzer p Leiter Datenverarbeitung-Organisation: Sven Born p Mitarbeit Datenverarbeitung-Organisation: Peter Gerstenberger, Marcel Hein, Maik Strohbach, Peter Zabelt p Post-, Boten- und Kopierzentrale: Gabriele Hatzmannsberger, Carmen Socka, Jana Walter p Betriebsärztin: Dr. med. Kathrin Rüllich, Fachärztin für Allgemein- und Betriebsmedizin / Psychotherapie Besucherservice und Vertrieb Leitung Schauspiel: Angelika Heine p Stellvertretende Leitung: Birgit Kaltenhäuser p Mitarbeit: Angela Bauer, Ulrike Ladwig, Alexander Materni, Birgit Mehlig, Heidi Müller, Silke Rehwald p Leitung Vorderhauspersonal: Anja Linhart, Jaqueline Rau (Vertretung) p Besucherservice und Vorderhauspersonal: Personal der Firma Power GmbH Fahrer Jürgen Hamann Örtlicher Personalrat Staatsschauspiel Dresden: Vorsitzender: Georg Weber p Stellvertreter: Tilo Ebert p Mitglieder: Holger Hübner, Andreas Lötzsch, Jens Ørsted, Benjamin Pauquet, Ellen Wittich p Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte: Angela Rümmler p Suchtbeauftragter: Thomas Giersemehl p Schwerbehindertenvertretung: Detlef Richter p Sekretariat: Gisela Merbitz p Vertreter des Schauspiels im Gesamtpersonalrat Sächsische Staatstheater: Tilo Ebert, Holger Hübner, Georg Weber, Ellen Wittich Verwaltungsrat Vorsitzender: Dr. Henry Hasenpflug (Staatssekretär im Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst) p Stellvertretender Vorsitzender: Hansjörg König (Staatssekretär im Sächsischen Staatsministerium für Finanzen) p Mitglieder: Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Donsbach (Geschäftsführender Direktor des Instituts für Kommunikationswissenschaft der Technischen Universität Dresden), Anne Frank (Geschäftsführerin tms Messen-Kongresse-Ausstellungen GmbH), Thomas Früh (Abteilungsleiter Kunst im Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst), Alexandra Gerlach (Journalistin), Prof. Jürgen Hubbert, Frank Ruder (Leitung Haus- und Betriebstechnik am Staatsschauspiel Dresden), Prof. Markus Schächter (zdf-Intendant a. D.), Prof. Dr. Brigitte Voit (Wissenschaftliche Direktorin Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V.), Petra von Crailsheim (Verhinderungsvertreterin des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden), Hubert Waltl (Mitglied des Markenvorstandes Produktion und Logistik der Volkswagen Aktiengesellschaft), Dr. Wilhelm Zörgiebel (Geschäftsführender Gesellschafter der Grundbesitz Hellerau GmbH) Ehrenmitglieder Karl von Appen, Charlotte Basté, Reinhold Bauer, Erich Baumgart, Marie Bayer-Bürck, Emil Devrient, Antonia Dietrich, Wolfgang Engel, Charlotte Friedrich, Dieter Görne, Friedrich Haase, Martin Hellberg, Peter Herden, Georg Kiesau, Klaus Dieter Kirst, Friedrich Lindner, Franz Lommatsch, Frank Ostwald, Paul Paulsen, Erich Ponto, Alfred Reucker, Traute Richter, Max Rothenberger, Clara Salbach, Hermann Stövesand, Pauline Ulrich, Paul Wiecke, Johannes Wieke, Albert Willi, Gerhard Wolfram Das Staatsschauspiel Dresden und die Sächsische Staatsoper Dresden bilden gemeinsam die „Sächsischen Staatstheater“. 105 Liebes Publikum, verehrte Gäste, wir freuen uns sehr, dass unser Programm so viele Dresdnerinnen und Dresdner zu Freunden des Theaters hat werden lassen und dass auch ein überregionales Publikum unsere Arbeit am Staatsschauspiel regelmäßig verfolgt. In der Spielzeit 2012/2013 haben wir über 850 Vorstellungen für Sie gespielt, insgesamt haben 250 000 Zuschauer Abend für Abend den Vorhang aufgehen sehen. Wir möchten uns recht herzlich bei Ihnen bedanken, verehrtes Publikum. Ihr Zuspruch und Ihr Interesse sind für uns Bestätigung und Ansporn zugleich. So halten wir auch in der Spielzeit 2014/2015 wieder ein vielfältiges Kartenangebot für Sie zur Auswahl bereit, in dem vom klassischen Anrecht bis zu Angeboten für Kurzentschlossene für jeden Geschmack, jedes Alter und jeden Geldbeutel etwas dabei ist. Da auch wir betroffen sind von Preis- und Lohnerhöhungen in allen Bereichen, werden wir mit Beginn der Spielzeit moderat die Preise in allen Kategorien erhöhen. Natürlich möchten wir unseren hohen künstlerischen Anspruch und den guten Service für Sie erhalten. Jeder Dresdner sollte sich einen Besuch im Staatsschauspiel leisten können. Die Vielfalt der Anrechte, mit denen Sie die unterschiedlichsten Inszenierungen unseres Spielplans kennenlernen können, gibt Ihnen die Möglichkeit zur individuellen Preisgestaltung. Bitte richten Sie Ihr Augenmerk auch auf unser Jugendwahlanrecht. Nach wie vor ist es unser größtes Anliegen, für alle Theaterbegeisterten ein vielseitiges und erschwingliches Angebotsspektrum bereitzuhalten. Bemerkenswerte Preisvorteile können Sie weiterhin bei den im Monatsplan als „Blaue Tage“ gekennzeichneten Vorstellungen genießen, die zu einem besonders günstigen Preis von 10,00 € auf allen Plätzen angeboten werden. Achten Sie auch auf unsere Angebote zu Ostern und zur Weihnachtszeit. Schüler und Studenten kommen für 7,00 € in alle Repertoirevorstellungen, dasselbe gilt für Inhaber des Dresdner Sozialpasses und Arbeitslose. Studierende im ersten Semester zahlen nur 3,50 €, und Hartz-IV-Empfänger zahlen nach wie vor nur 1,00 € an der Abendkasse. Die Kinderbetreuung bei den „Schnullertagen“ im Kleinen Haus erfreut sich bei theaterinteressierten Eltern mit kleinen Kindern ebenfalls großer Beliebtheit. Professionelle Erzieherinnen kümmern sich für die Dauer einer Nachmittagsvorstellung liebevoll um den Nachwuchs, während die Großen im Zuschauerraum Platz nehmen. Nutzen Sie das neu gestaltete Eingangsfoyer im Schauspielhaus, um sich mit Familie, Freunden und Bekannten vor der Vorstellung zu treffen, und lassen Sie den Abend im Theaterrestaurant william oder im Kleinen Haus im Theaterbistro Klara ausklingen. Im Kassen- und Servicezentrum werden Sie zu allen Angeboten kompetent beraten, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich auf Sie! Unser Haus hält viele Türen für Sie offen. Welche auch immer Sie wählen – seien Sie herzlich willkommen! Ihr Staatsschauspiel Dresden Prämienaktion: Empfehlen Sie uns weiter! Wer bis zum 31. Oktober 2014 einen neuen Anrechtsinhaber für das Staatsschauspiel wirbt, kann zwischen vielen schönen Prämien wählen, z. B. p Eine Jahreskarte für die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden p Business-Lunch und Begrüßungssekt im william – Restaurant im Schauspielhaus p Ein Büchergutschein für Richters Buchhandlung p Weitere Infos im Anrechtsbüro unter 0351 . 49 13 – 567 Bitte beachten Sie: p Bedingt durch Inszenierung und Bühnenbild kann es vorkommen, dass die von Ihnen reservierten Plätze nicht zur Verfügung stehen oder die Sicht auf die Bühne eingeschränkt ist. In diesen Fällen bieten wir Ihnen selbstverständlich vergleichbare Ersatzkarten an. p Natürlich bemühen wir uns stets um Zuverlässigkeit und Termingenauigkeit. Gegen Erkrankungen und technische Pannen sind aber auch wir nicht gefeit. Sollte es deshalb ausnahmsweise zu Verschiebungen kommen, bitten wir Sie um Nachsicht. 106 Die Schauspielanrechte Gönnen Sie sich die Vorteile eines Schauspielanrechts! Sie bestimmen den Wochentag, an dem Sie ins Theater gehen möchten, und die Preisgruppe. p Wenn Ihnen ein Termin Ihres Anrechts nicht zusagt, können Sie diesen kostenfrei gegen eine andere Vorstellung eintauschen. p Nutzen Sie den Preisvorteil von bis zu 60 % gegenüber dem Normalpreis. p Darüber hinaus erhalten Sie 10 % Ermäßigung beim Kauf von weiteren Eintrittskarten für Repertoirevorstellungen. p Auf Wunsch senden wir Ihnen unsere Monatsspielpläne zu, sodass Sie frühzeitig über anstehende Premi­eren, Zusatzveranstaltungen und die Vorstellungstermine informiert sind. p Sie erhalten druckfrisch das Spielzeitheft mit ausführlichen Informationen über das Programm der kommenden Saison. p Schauen Sie doch einmal hinter die Kulissen. Führungen durch das Schauspielhaus mit spannenden Informationen über das Staatsschauspiel, Einblicken in die Bühnentechnik und die Architektur des Hauses und vielem mehr sind für die Anrechtsinhaber kostenfrei. Die Termine entnehmen Sie bitte den Monatsspielplänen. Die Premierenanrechte Erleben Sie die besondere Atmosphäre eines Premierenabends! Wir freuen uns darauf, im Anschluss an die Vorstellung mit Ihnen anzustoßen, uns mit Ihnen auszutauschen und mit Ihnen zu feiern. Das Premierenanrecht bietet gegenüber dem Kassenpreis bis zu 15 % Ermäßigung. Das Programmheft erhalten Sie am Abend kostenfrei! Sie sehen vom Saisonstart an wahlweise acht Premieren im Schauspielhaus, sieben Premieren im Kleinen Haus oder insgesamt sechs Premieren in beiden Spielstätten. Premierenanrecht 8 x Schauspielhaus Fr 12.09.2014 Schöne neue Welt Sa 04.10.2014 Drei Schwestern Sa 29.11.2014 Faust. Der Tragödie erster Teil Sa 17.01.2015 Wie es euch gefällt Sa 14.02.2015 Die Verschwörung des Fiesko zu Genua Sa07.03.2015 Amerika Do 02.04.2015 Bernarda Albas Haus Sa 23.05.2015 Lehman Brothers. Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Preise Preisgruppe 1: 184,00 ¤ Preisgruppe 2: 160,00 ¤ Preisgruppe 3: 140,00 ¤ Premierenanrecht 7 x Kleines Haus So 14.09.2014 Wir sind keine Barbaren! Sa 01.11.2014 Miss Sara Sampson Do 27.11.2014 mein deutsches deutsches Land Fr 09.01.2015 Die Panne Do 26.03.2015 Ein neues Stück Fr 15.05.2015 Alle meine Söhne Sa 06.06.2015 Die Bergwanderung oder Sexualität heute Kleines Haus Kleines Haus Kleines Haus Kleines Haus Kleines Haus Kleines Haus Kleines Haus Preise Einheitspreis: 119,00 ¤ Premierenanrecht 4 x Schauspielhaus, 2 x Kleines Haus Sa 04.10.2014 Drei Schwestern Sa 01.11.2014 Miss Sara Sampson Sa 29.11.2014 Faust. Der Tragödie erster Teil Fr 09.01.2015 Die Panne Sa07.03.2015 Amerika Sa 02.05.2015 Dantons Tod Schauspielhaus Kleines Haus Schauspielhaus Kleines Haus Schauspielhaus Schauspielhaus Preise Preisgruppe 1: 126,00 ¤ Preisgruppe 2: 114,00 ¤ Preisgruppe 3: 104,00 ¤ Für die Premieren „Das Gespenst von Canterville“ und ­„Dantons Tod“ erhalten Sie ein Vorkaufsrecht mit 10 % Ermäßigung. 107 Die Tagesanrechte Der Klassiker unter den Anrechten: Wählen Sie Ihren Lieblingswochentag, suchen Sie sich eine feste Preisgruppe aus und erleben Sie fünf Inszenierungen der neuen Spielzeit im Schauspielhaus. Sie sparen bis zu 60 % auf den regulären Kassenpreis. Zusätzlich dürfen Sie sich eine Vorstellung im Kleinen Haus aussuchen, hierfür erhalten Sie einen Gutschein. Entscheiden Sie – und begeben Sie sich mit uns auf eine spannende Reise durch den Spielplan! Montag I Mo06.10.2014 Mo03.11.2014 Mo29.12.2014 Mo16.02.2015 Mo20.04.2015 Dämonen Drei Schwestern Das Gespenst von Canterville Die Verschwörung des Fiesko zu Genua Bernarda Albas Haus Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Montag II Mo20.10.2014 Mo08.12.2014 Mo19.01.2015 Mo16.03.2015 Mo22.06.2015 Schöne neue Welt Faust. Der Tragödie erster Teil Wie es euch gefällt Der Selbstmörder Lehman Brothers. Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Dienstag Di 14.10.2014 Di 02.12.2014 Di 27.01.2015 Di 24.02.2015 Di28.04.2015 Drei Schwestern Faust. Der Tragödie erster Teil Schöne neue Welt Wie es euch gefällt Amerika Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Preise Preisgruppe 1: 91,00 ¤ Preisgruppe 2: 78,50 ¤ Preisgruppe 3: 71,00 ¤ p in jeder Preisgruppe erhalten Sie zusätzlich einen Gutschein für eine Vorstellung Ihrer Wahl im Kleinen Haus Mittwoch Mi 17.09.2014 Mi 26.11.2014 Mi 07.01.2015 Mi 18.02.2015 Mi15.04.2015 Die Jüdin von Toledo Schöne neue Welt Drei Schwestern Wie es euch gefällt Amerika Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Preise Preisgruppe 1: 91,00 ¤ Preisgruppe 2: 78,50 ¤ Preisgruppe 3: 71,00 ¤ p in jeder Preisgruppe erhalten Sie zusätzlich einen Gutschein für eine Vorstellung Ihrer Wahl im Kleinen Haus Donnerstag Do18.09.2014 Do 13.11.2014 Do 22.01.2015 Do 05.03.2015 Do 30.04.2015 Dämonen Schöne neue Welt Faust. Der Tragödie erster Teil Drei Schwestern Wie es euch gefällt Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Preise Preisgruppe 1: 86,00 ¤ Preisgruppe 2: 73,50 ¤ Preisgruppe 3: 66,00 ¤ p in jeder Preisgruppe erhalten Sie zusätzlich einen Gutschein für eine Vorstellung Ihrer Wahl im Kleinen Haus Freitag Fr 26.09.2014 Fr 21.11.2014 Fr 06.02.2015 Fr 20.03.2015 Fr 24.04.2015 Der Parasit Drei Schwestern Faust. Der Tragödie erster Teil Wie es euch gefällt Die Verschwörung des Fiesko zu Genua Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Preise Preisgruppe 1: 101,00 ¤ Preisgruppe 2: 88,50 ¤ Preisgruppe 3: 81,00 ¤ p in jeder Preisgruppe erhalten Sie zusätzlich einen Gutschein für eine Vorstellung Ihrer Wahl im Kleinen Haus Samstag Sa 18.10.2014 Sa 27.12.2014 Sa 21.02.2015 Sa 11.04.2015 Sa 16.05.2015 Der Selbstmörder Schöne neue Welt Faust. Der Tragödie erster Teil Wie es euch gefällt Bernarda Albas Haus Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Preise Preisgruppe 1: 101,00 ¤ Preisgruppe 2: 88,50 ¤ Preisgruppe 3: 81,00 ¤ p in jeder Preisgruppe erhalten Sie zusätzlich einen Gutschein für eine Vorstellung Ihrer Wahl im Kleinen Haus Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Schauspielhaus Preise Preisgruppe 1: 91,00 ¤ Preisgruppe 2: 78,50 ¤ Preisgruppe 3: 71,00 ¤ p in jeder Preisgruppe erhalten Sie zusätzlich einen Gutschein für eine Vorstellung Ihrer Wahl im Kleinen Haus Sonntag (Beginn 19 Uhr) So 21.09.2014 Schöne neue Welt So 23.11.2014 Das Gespenst von Canterville So 28.12.2014 Drei Schwestern So 01.03.2015 Wie es euch gefällt So 31.05.2015 Dantons Tod 108 Preise auf allen Plätzen 61,00 ¤ p zusätzlich erhalten Sie einen Gutschein für eine Vorstellung Ihrer Wahl im Kleinen Haus Preise auf allen Plätzen 61,00 ¤ p zusätzlich erhalten Sie einen Gutschein für eine Vorstellung Ihrer Wahl im Kleinen Haus Die Sonntagnachmittags-Anrechte Das Sonntagnachmittags-Anrecht ist ein Angebot für Jung und Alt! Es ist besonders geeignet für Familien, die gerne gemeinsam Sonntagnachmittage im Theater verbringen wollen, oder für ältere Menschen, denen der Vorstellungsbesuch am Abend oft zu spät ist. Beginn ist jeweils 16 Uhr – abends sind Sie wieder zu Hause. Die Sonntagnachmittags-Anrechte sind außerdem besonders günstig: Sie sparen bis zu 55 % auf den regulären Kassenpreis! Sonntagnachmittags-Anrecht 5 x Schauspielhaus, 1 x Kleines Haus (Beginn 16 Uhr) So 12.10.2014 Ein Exempel Kleines Haus So 30.11.2014 Das Gespenst von Canterville Schauspielhaus So 04.01.2015 Faust. Der Tragödie erster Teil Schauspielhaus So 08.03.2015 Die Verschwörung des Fiesko zu Genua Schauspielhaus So 03.05.2015 Schöne neue Welt Schauspielhaus So 14.06.2015 Dantons Tod Schauspielhaus Preise Preisgruppe 1: 81,00 ¤ Preisgruppe 2: 68,50 ¤ Preisgruppe 3: 61,00 ¤ Sonntagnachmittags-Anrecht 4 x Schauspielhaus (Beginn 16 Uhr) So 30.11.2014 Das Gespenst von Canterville Schauspielhaus So 04.01.2015 Faust. Der Tragödie erster Teil Schauspielhaus So 08.03.2015 Die Verschwörung des Fiesko zu Genua Schauspielhaus So 03.05.2015 Schöne neue Welt Schauspielhaus Preise Preisgruppe 1: 56,00 ¤ Preisgruppe 2: 46,50 ¤ Preisgruppe 3: 40,00 ¤ Neue Blicke / Neue Stücke – 5 x gegenwärtiges Theater! Dieses Angebot wendet sich an alle, die Lust haben, sich mit neuer Dramatik und zeitgenössischen Stoffen auseinanderzusetzen. Gleichzeitig beinhaltet es Inszenierungen von Regisseuren, die eine neue, heutige, oft ungewöhnliche und überraschende Art finden, sich einem klassischen Text zu nähern. Neue Blicke / Neue Stücke-Anrecht 1 x Schauspielhaus, 4 x Kleines Haus Sa 04.10.2014 Wir sind keine Barbaren! Kleines Haus Sa 29.11.2014 mein deutsches deutsches Land Kleines Haus Do 08.01.2015 Schöne neue Welt Schauspielhaus Do 02.04.2015 Ein neues Stück Kleines Haus Do 11.06.2015 Die Bergwanderung oder Sexualität heute Kleines Haus Preise Preisgruppe 1: 60,00 ¤ Preisgruppe 2: 57,50 ¤ Preisgruppe 3: 56,00 ¤ 6 Richtige: Das Wahlanrecht 6 x haben Sie die Wahl p 6 x Theater an Ihren Wunschterminen p 6 x allein, 3 x zu zweit oder mit Freunden. Einfacher geht es nicht. Hier haben Sie alles selbst in der Hand. Sie erwerben sechs Gutscheine (für eine Preisgruppe) für das Schauspielhaus, sechs Gutscheine für das Kleine Haus oder wählen vier und zwei Gutscheine für beide Häuser. Sie wählen die Inszenierungen aus, die Sie am meisten interessieren. Sie wählen auch die Termine. Jetzt müssen Sie die Gutscheine nur noch im Vorverkauf oder an der Abendkasse in Eintrittskarten für die Vorstellungen aus dem Schauspielrepertoire tauschen. Sie erhalten die besten noch verfügbaren Plätze! Seien Sie spontan! Sie können bereits für 19,00 ¤ im Schauspielhaus in der ersten Reihe sitzen. Eine der günstigsten Möglichkeiten, ins Theater zu kommen! Achten Sie auch auf unser Jugendwahlanrecht für junge Zuschauer bis 26 Jahre. Sie können wählen 6 Gutscheine für das Schauspielhaus 114,00 ¤ (Preisgruppe 1) 6 Gutscheine für das Kleine Haus 66,00 ¤(Einheitspreis) 4 Gutscheine für das Schauspielhaus und 2 Gutscheine für das Kleine Haus 98,00 ¤(Preisgruppe 1) Unser Jugendwahlanrecht 6 Gutscheine für Schauspielhaus / Kleines Haus für alle bis 26 Jahre 39,00 ¤ (Einheitspreis) 93,00 ¤ (Preisgruppe 2) 84,00 ¤ (Preisgruppe 3) 84,00 ¤(Preisgruppe 2) 78,00 ¤ (Preisgruppe 3) p Gilt nicht für Gastspiele und Sonderveranstaltungen. Für Premieren steht ein Kontingent zur Verfügung. 109 Gemischte Anrechte Das Schauspiel-Operetten-Anrecht 3 x Schauspielhaus und 3 x Operette Kombinieren Sie drei Vorstellungen aus dem Schauspielrepertoire mit drei Vorstellungen der Staatsoperette (Operette, Spieloper und Musical). Termine und Stückinfos entnehmen Sie bitte dem Internet. Preise Preisgruppe 1: Preisgruppe 2: Preisgruppe 3: Fr, Sa, So abends 114,75 ¤ 101,25 ¤ 88,50 ¤ So nachmittags 108,75 ¤ 95,25 ¤ 79,50 ¤ Mo – Do 105,00 ¤ 90,75 ¤ 75,75 ¤ Das Dreieranrecht 3 x Staatsschauspiel ( 2 x Schauspielhaus, 1 x Kleines Haus), 2 x Herkuleskeule und 2 x Theaterkahn. Die Kombination von Staatsschauspiel, Herkuleskeule und Theaterkahn ist eine gute Gelegenheit, hochkarätiges Kabarett und Schauspiel preiswert zu erleben. Die Termine werden Ihnen ca. sechs Wochen vor den jeweiligen Vorstellungen mitgeteilt. Preise Preisgruppe 1: 99,00 ¤ Preisgruppe 2: 94,00 ¤ Preisgruppe 3: 91,00 ¤ Dresdner Anrecht Staatsschauspiel Dresden, Sächsische Staatsoper Dresden, Staatsoperette Dresden. Die drei traditionsreichsten Dresdner Theater in einem Anrecht. Das einzigartige Dresdner Anrecht bietet vielfältige Möglichkeiten und Kombinationen für unterhaltsame Theaterabende. Die genauen Termine und Vorstellungen erfahren Sie im Anrechtsbüro oder unter www.staatsschauspiel-dresden.de. 110 Ermäßigungen und Geschenke Blaue Tage Mindestens einmal im Monat können Sie zu einem Sonderpreis von 10,00 ¤ ausgewählte Vorstellungen besuchen. Die Termine entnehmen Sie bitte den Monatsspielplänen. Schüler, Studenten, Auszubildende zahlen nur 7,00 ¤ Junge Menschen in der Ausbildung – Schüler, Studenten u. a. – zahlen 7,00 ¤ auch im Vorverkauf (im Schauspielhaus in der Regel ab Preisgruppe 2, Reihe 12). An der Abendkasse gibt es 7,00 ¤-Karten eine halbe Stunde vor Beginn der Vorstellung je nach Verfügbarkeit in allen Preiskategorien. Ausgenommen sind Gastspiele und Sonderveranstaltungen. Schulklassen zahlen pro Schüler 5,50 ¤ für alle Vorstellungen im Schauspielhaus sowie im Kleinen Haus auf allen Plätzen. Dies gilt bereits für den Vorverkauf. Wir behalten uns vor, die Kontingente zu begrenzen. Reservieren Sie rechtzeitig! Studentinnen und Studenten im 1. Semester zahlen nur 3,50 ¤ Bitte als Nachweis die Immatrikulations­ bescheinigung vorlegen. Das erste Mal … im Theater! Lehrerinnen und Lehrer, die mit ihren Schulklassen noch nie im Theater waren, erhalten beim ersten Besuch Eintrittskarten für 3,00 ¤ pro Person. Zusätzlich erhalten die Schüler vor der jeweiligen Aufführung eine Stückeinführung im Theater und nach Absprache eine theaterpädagogische Vor- und Nachbereitung. Inhaber des Dresdner Sozialpasses und Arbeitslose zahlen ebenfalls nur 7,00 ¤, auch im Vorverkauf. Ausgenommen sind Gastspiele und Sonderveranstaltungen. Karten für Hartz-IV-Empfänger Berechtigte erhalten gegen entsprechende Nachweise Karten für 1,00 ¤ an der Abendkasse. Ausgenommen sind Gastspiele und Sonderveranstaltungen. Senioren erhalten nach Vorlage eines entsprechenden Ausweises eine Ermäßigung von bis zu 35 % im Schauspielhaus und bis zu 20 % im Kleinen Haus. Schwerbehinderte, die auf eine Begleitung angewiesen sind (das ist im Schwerbehindertenausweis mit einem B vermerkt), erhalten für sich und ihre Begleitperson eine Eintrittskarte mit je 50 % Ermäßigung. Die Theatercard Das Angebot für Stammgäste: Sie erhalten die Theatercard kostenlos an den Vorverkaufskassen im Schauspielhaus. Unsere Kassenmitarbeiter tragen jeden Theaterbesuch auf der Karte ein. Ab dem fünften Besuch erhalten Sie für jede weitere Eintrittskarte ca. 30 % Ermäßigung. Ab dem neunten Besuch steigert sich diese Ermäßigung auf ca. 50 %. Die Theatercard gilt nur für den Einzelverkauf von Repertoirevorstellungen und für die Dauer eines Jahres ab dem ersten Vorstellungsbesuch. Anrechtsinhaber Alle Inhaber eines Dresdner Anrechts oder eines Schauspielanrechts erhalten ca. 10 % Ermäßigung auf jede weitere Eintrittskarte bei Repertoirevorstellungen. Gruppenermäßigungen für Gruppen ab 20 Personen auf Anfrage. Theatergutscheine Verschenken Sie Theater mit Theatergutscheinen im Wert von 10, 20, 30, 40, 50 oder 100 ¤. Die Beschenkten lösen den Gutschein dann im Laufe eines Jahres in Eintrittskarten für eine Repertoirevorstellung nach eigener Wahl ein. Der Kauf der Gutscheine ist auch im Internet möglich. Schnullertag! – Kostenlose Kinderbetreuung im Theater Im Kleinen Haus bieten wir ausgewählte Vorstellungen sonntagnachmittags an. Sie geben Ihre Kinder im Theater in die Obhut ausgebildeter ­Pädagoginnen, die die Kleinen liebevoll beaufsichtigen und mit ihnen spielen, während Sie zwei ungestörte Theaterstunden erleben. Die Kinderbetreuung kostet nichts extra, Sie bezahlen lediglich Ihre Theaterkarten. Die Termine der Schnullertage entnehmen Sie bitte den Monatsspielplänen. Wir bitten um vorherige Anmeldung. p Grundsätzlich ist eine Addition von Ermäßigungen nicht möglich. Wir behalten uns vor, die Ausweise, die zu einer Ermäßigung berechtigen, beim Einlass zu kontrollieren. 111 Bühne 1 2 1 3 2 5 3 2 1 3 2 1 4 2 1 4 3 4 3 1 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 20 21 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 21 22 23 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 1 2 3 4 21 22 23 24 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 1 2 3 4 25 5 6 7 8 9 10 21 22 23 24 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 1 2 3 4 23 24 25 26 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 9 2 3 4 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 24 25 26 27 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 10 1 2 3 4 25 26 27 28 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 11 1 2 3 4 26 27 28 29 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 12 1 2 3 4 26 27 28 29 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 17 1 2 4 3 6 7 5 4 6 5 8 7 6 7 26 27 28 29 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 24 25 26 27 8 9 10 11 18 19 20 21 22 23 8 27 23 24 25 26 18 19 20 21 22 9 10 Parkett 3 5 37 35 8 7 32 31 33 30 4 37 38 5 4 35 36 36 35 34 5 Stehplätze 112 3 32 2. Rang 30 6 4 13 1 31 32 9 2 2 2 14 28 12 15 3 3 31 27 16 13 6 2 0 1 3 7 18 7 14 9 4 4 24 25 9 19 2 23 20 2 22 21 8 15 28 28 6 16 1 7 9 5 5 2 3 7 17 18 2 6 10 7 19 20 21 22 23 24 25 2 30 26 11 1 8 5 6 9 2 2 2 12 9 2 13 14 3 24 28 25 10 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 27 4 1 2 1 6 2 6 6 4 12 5 23 13 14 5 24 2 2 1 15 16 17 24 22 23 6 1 2 21 2 2 20 18 19 3 7 2 0 3 8 9 19 2 22 4 10 11 17 18 21 16 12 13 5 15 0 14 2 6 19 7 8 17 18 9 10 11 16 15 12 13 14 5 3 L 2 32 10 4 2 30 33 11 9 3 1 31 10 8 2 32 9 7 33 8 6 34 6 7 5 1 12 1 42 34 3 1 11 41 40 Loge 2 Loge 1 Loge 4 3 Loge 3 4 2 3 1 4 1 2 4 3 Loge 1 3 1 3 Loge 2 2 39 Loge 3 14 29 6 4 13 30 29 8 2 31 27 26 30 4 25 2 9 2 28 22 23 8 27 7 2 2 26 26 4 25 25 22 23 2 4 2 23 1 22 2 0 21 18 19 2 3 2 1 4 1. Rang 15 32 11 5 4 2 2 31 12 10 4 2 3 3 14 16 17 1 8 19 20 21 1 5 8 16 17 1 9 8 10 19 20 21 11 12 1 13 1 4 15 2 16 17 3 1 2 4 7 34 32 11 9 3 12 35 33 10 8 2 1 1 Loge 4 1 36 9 34 6 1 13 3 34 7 2 33 6 5 1 2 3 4 1 2 3 42 41 38 39 40 4 2 2 41 4 40 36 37 38 3 9 1 3 5 33 2 4 7 3 1 16 1 3 6 36 2 5 1 1 15 4 41 3 39 4 0 2 35 1 35 14 28 29 30 31 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 34 2 37 38 1 8 33 13 7 Stehplätze R 4 Preise Schauspielhaus Fr – Sa / Premiere 27,00 ¤ 23,00 ¤ 20,00 ¤ 15,00 ¤ So – Do 25,00 ¤ 21,00 ¤ 18,00 ¤ 11,00 ¤ Preisgruppe 1 Preisgruppe 2 Preisgruppe 3 Preisgruppe 4 Kleines Haus Kleines Haus 1 p großer Saal, bis maximal 400 Plätze Kleines Haus 2 p hinter dem Eisernen, bis maximal 150 Plätze Kleines Haus 3 p unter dem Dach, bis maximal 100 Plätze So – Do 18,00 ¤ 16,00 ¤ 10,00 ¤ Fr, Sa / Premiere 20,00 ¤ 18,00 ¤ 12,00 ¤ Schüler, Studenten und andere Ermäßigungsberechtigte zahlen in allen Spielstätten und für alle Vorstellungen nur 7,00 ¤. p Senioren erhalten eine Ermäßigung von bis zu 35 % auf den Kartenpreis im Schauspielhaus und bis zu 20 % im Kleinen Haus. p Schwerbehinderte, die auf eine Begleitung angewiesen sind, erhalten für sich und ihre Begleitperson eine Eintrittskarte mit je 50 % Ermäßigung. p Abweichende Preise bei Gastspielen und Sonderveranstaltungen entnehmen Sie bitte den Monatsspielplänen. p Bei ausgewählten Vorstellungen bieten wir zusätzlich Stehplätze an. Schauspielanrechte Die Premierenanrechte Preisgruppe 1 Preisgruppe 2 Preisgruppe 3 8 x Schauspielhaus 184,00 ¤ 160,00 ¤ 140,00 ¤ 6 x gemischt 126,00 ¤ 114,00 ¤ 104,00 ¤ 7 x Kleines Haus 119,00 ¤ (Einheitspreis) Die Tagesanrechte Schauspielhaus Preisgruppe 1 Preisgruppe 2 Preisgruppe 3 5 x Schauspielhaus und ein Gutschein für das Kleine Haus Di, Mi, So Fr, Sa Do 91,00 ¤ 101,00 ¤ 86,00 ¤ 78,50 ¤ 88,50 ¤ 73,50 ¤ 71,00 ¤ 81,00 ¤ 66,00 ¤ Mo 61,00 ¤ auf allen Plätzen Die Sonntagnachmittags-Anrechte Preisgruppe 1 Preisgruppe 2 Preisgruppe 3 5 x Schauspielhaus 1 x Kleines Haus 81,00 ¤ 68,50 ¤ 61,00 ¤ 4 x Schauspielhaus 56,00 ¤ 46,00 ¤ 40,00 ¤ Das Wahlanrecht 6 x Schauspielhaus Preisgruppe 1 Preisgruppe 2 Preisgruppe 3 114,00 ¤ 93,00 ¤ 84,00 ¤ 4 x Schauspielhaus 2 x Kleines Haus 98,00 ¤ 84,00 ¤ 78,00 ¤ 6 x Kleines Haus 6 x Schauspielhaus / Kleines Haus 66,00 ¤ (Einheitspreis) 39,00 ¤ (für alle bis 26 Jahre) 113 Freunde und Förderer des Staatsschauspiels Dresden Förderverein Staatsschauspiel Dresden und Junger Freundeskreis Mit der Gründung des Fördervereins Staatsschauspiel Dresden e.V. entstand 1995 eine Gemeinschaft von Freunden und Förderern unseres The­aters, die sich als eine kommunikative Brücke zwischen Theater und Publikum versteht. Der Förderverein fühlt sich dem Staatsschauspiel nicht nur ideell nahe und verfolgt dessen Arbeit mit aktivem Interesse, sondern er leistet mit den Mitgliedsbeiträgen und zusätzlich eingeworbenen Spenden auch finanzielle Unterstützung. Die Bandbreite der Aktivitäten erstreckt sich dabei von der Realisierung ungewöhnlicher Projekte über die Mitfinanzierung von Gastspielen und Sonderveranstaltungen bis hin zur Förderung des Engagements namhafter Künstler. Alle zwei Jahre vergibt der Förderverein den mittlerweile weit über die Landesgrenzen hin­aus bekannten und in erster Linie der Nachwuchsförderung dienenden Erich-Ponto-Preis für herausragende darstellerische Leistungen an ein Mitglied des Ensembles. Der Förderverein hat einen „Jungen Freundeskreis“ gegründet. Alle Theaterbegeisterten von 16 bis 28 Jahren sind herzlich eingeladen. Der Freundeskreis bietet ein umfangreiches Programm an Workshops, Gesprächen, Probenbesuchen u.v.m. Unter dem Motto „Wir verdoppeln euren Einsatz“ erhält jedes Mitglied für den Jahresbeitrag von 12,00 € zwei Theaterkarten. Die Mitglieder des Fördervereins werden regelmäßig über das Geschehen vor, auf und hinter der Bühne informiert und erhalten bevorzugt Kaufkarten für Premieren, Gastspiele oder Sonderveranstaltungen. Exklusiv können sie das Staatsschauspiel Dresden bei verschiedenen Veranstaltungen auch „hinter den Kulissen“ erleben: p Treffpunkt premiere – Der Premierenempfang mit dem Intendanten! p Treffpunkt probe – Als Beobachter bei Arbeitsproben dabei sein! p Treffpunkt spielzeitvorschau – Wissen, was die neue Spielzeit bringt! p Treffpunkt zur person – Theaterleute hautnah erleben! p Treffpunkt theaterfahrt – Andere Theater kennenlernen! Präsident des Fördervereins Staatsschauspiel Dresden ist der ehemalige Geschäftsführer des Geschäftsbereiches Bildung der ihk Dresden und jetzige Präsident des Europäischen Instituts für postgraduale Bildung an der Technischen Universität Dresden Dr.-Ing. Werner Mankel. Der Mitgliedsbeitrag pro Jahr beträgt für Mitglieder 50,00 ¤, für fördernde Mitglieder 255,00 ¤, für Firmenmitglieder 800,00 ¤. Der Verein dient ausschließlich gemeinnützigen Zwecken. Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar. Kontakt: Geschäftsstelle des Fördervereins Staatsschauspiel Dresden e.V., c / 0 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Staatsschauspiels Dres­den, Theaterstraße 2, 01067 Dresden p Telefon: 0351 . 49 13 – 755 p Fax: 0351 . 49 13 – 760 p E-Mail: foerderverein@staatsschauspiel -dresden.de und [email protected] IG Schauspiel – Interessengemeinschaft Schauspiel Dresden e. V. Liebe Dresdner! Liebe Gäste der Stadt! Liebe Theaterfreunde! Seien Sie neugierig und gewinnen Sie mit der ig Schauspiel dem Theater noch mehr ab! Wie das geht? Mit uns erhalten Sie tiefere Einblicke in das Theatergeschehen. Wir bieten regelmäßige kommunikative Foren mit Gesprächen über das Geschehen auf und hinter der Bühne an oder den Besuch einer der ersten Vorstellungen einer Neuinszenierung mit anschließendem Gespräch in Anwesenheit von Mitgliedern des künstlerischen Produktionsteams und des Ensembles. Für diese Vorstellungen erhalten ig-Mitglieder ein vergünstigtes Theateranrecht mit ca. 30 bis 50 % Ermäßigung auf den regulären Kassenpreis. p Die Reihe „Vorgestellt“ präsentiert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theaters, deren Tätigkeiten und Arbeitsplätze nicht im Rampenlicht stehen (von a wie Ankleider bis z wie Zentrale Haustechnik). p In den Podiumsgesprächen der Reihe „Das Porträt“ geben Mitglieder des Ensembles Einblicke in künstlerische Arbeitsprozesse. p Der IG Schauspiel angeschlossen ist die literarische Reihe „Dichterwort – Sprache der Welt“. Prof. Dr. Stefan Welz (Universität Leipzig), Wolfgang E. Heinold (Hamburg) und Dr. Elisabeth Leeker (TU Dresden) stellen Literatur und Literaten der Welt vor und führen durch sechs Doppelveranstaltungen. Helga Werner und Lars Jung vom Staatsschauspiel Dresden werden wieder lesen, ebenso Nicole Haase aus Berlin und Gäste. Der Plan für den 59. Jahrgang des „Dichterworts“ ist ab dem Sommer abrufbar per Faltblatt und im Internet. Die Veranstaltungen können einzeln und im Abonnement besucht werden. Sie finden jeweils sonntags von 17 bis 20 Uhr im Gemeindesaal der Christuskirche Dresden-Strehlen, ElsaBrändström-Straße 1, statt. Kontakt: Gundula Voigt, Telefon: 0351 . 84 84 344. Die Interessengemeinschaft Schauspiel feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen und ist dem Staatsschausspiel Dresden als unmittelbare Begleiterin und kritische Partnerin eng verbunden. Sie pflegt darüber hinaus Kontakte zu anderen Bühnen im Großraum Dresden und organisiert für ihre Mitglieder Fahrten zu Aufführungen in andere Städte. Der jährlich zu entrichtende Mitgliedsbeitrag ist nach Einkommen gestaffelt. Schon ab 10,00 € im Jahr ist es möglich, das vielseitige Angebot der ig Schauspiel zu nutzen. Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Kontakt: Karin und Horst Mattern, Döbelner Straße 112, 01129 Dresden p Telefon und Fax: 0351 . 85 80 447 p E-Mail: [email protected] Adressen p Schauspielhaus Theaterstraße 2, 01067 Dresden (Zuschauereingang Postplatz) p Kleines Haus Glacis­straße 28, 01099 Dresden p Telefon Zentrale: 0351 . 49 13 – 50 p Intendanz: 0351 . 49 13 – 912 p Kaufmännische Geschäfts­führung: 0351 . 49 13 – 927 p Dramaturgie: 0351 . 49 13 – 963 p Künstlerisches Be­triebs­büro: 0351 . 49 13 – 922 p Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: 0351 . 49 13 – 755 p Theaterpädagogik: 0351 . 49 13 – 742 / – 740 p Die Bürgerbühne: 0351 . 49 13 – 849 Anrechtsservice: anrecht@staatsschauspielp E-Mail Kartenreservierung: [email protected] p dresden.de p Allgemein: [email protected] p Intendanz: [email protected] p Kaufmännische Geschäftsführung: [email protected] p Dramaturgie: [email protected] p Künstlerisches Betriebsbüro: [email protected] p Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: [email protected] p Theaterpädagogik: [email protected] p Die Bürgerbühne: [email protected] p Internet www.staatsschauspiel-dresden.de p Facebook www.facebook.com/staatsschauspieldd 114 Öffnungszeiten Anrechtsbüro im Kassen- und Servicezentrum im Schauspielhaus Das Anrechtsbüro ist montags bis freitags von 10 bis 18:30 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. p Während der Theaterferien hat das Anrechtsbüro in der Zeit vom 14. 7. bis 1. 8. 2014 montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Vom 2. 8. bis 17. 8. 2014 ist das Kassen- und Servicezentrum geschlossen. Ab dem 18. 8. 2014 gelten die regulären Öffnungszeiten. p Grundsätzlich können Sie im Anrechtsbüro immer – also auch während der Öffnungszeiten in den Theaterferien – Karten für das Staatsschauspiel kaufen. p Telefon: 0351 . 49 13 – 567, Fax: 0351 . 49 13 – 967, E-Mail: [email protected] Vorverkaufskassen p Das Kassen- und Servicezentrum im Schauspielhaus ist montags bis freitags von 10 bis 18:30 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. p Die Vorverkaufskasse im Kleinen Haus ist montags bis freitags von 14 bis 18:30 Uhr geöffnet. p Auch hier können Karten für alle Veranstaltungen des Staatsschauspiels gekauft werden. p In den Theaterferien läuft der Kartenvorverkauf für die neue Saison zu den angegebenen Öffnungszeiten. p Zusätzlich sind an vielen Dresdner Vorverkaufskassen Eintrittskarten für Repertoirevorstellungen des Staatsschauspiels erhältlich. p Die Abendkassen öffnen eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir ab diesem Zeitpunkt den Vorverkauf nur noch eingeschränkt leisten können und die Abendkasse Vorrang hat. Kartenkauf und Kartenreservierungen Gebührenfreier Kartenservice Telefon: 0800 . 49 13 – 500 (Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr) Telefonischer Kartenverkauf Telefon: 0351 . 49 13 – 555 Gruppenreservierungen Telefon: 0351 . 49 13 – 567 Schriftliche Reservierungen per Post: Staatsschauspiel Dresden, Besucherservice, Theaterstraße 2, 01067 Dresden p per E-Mail: [email protected] p per Fax: 0351 . 49 13 – 967 Kartenkauf im Internet www.staatsschauspiel-dresden.de Spielplanauskunft Telefon: 0351 . 49 13 – 570 Weitere Informationen Wenn Sie kontinuierlich an unserem Spielplan interessiert sind, schicken wir Ihnen auch gerne den Monatsleporello per Post oder den digitalen Newsletter zu, für den Sie sich unter www.staatsschauspiel-dresden.de anmelden können. Gastronomie william – Restaurant · Bar · Lounge im Schauspielhaus geöffnet Mo bis Fr von 11 bis 23 Uhr, Sa und So von 10 bis 23 Uhr p Telefon: 0351.44 00 88 00, E-Mail: [email protected] p www. bean-and-beluga.de, www.facebook.com/restaurant.william Klara – Bistro und Kantine im Kleinen Haus geöffnet von 9 bis 24 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 2 Stunden vor Vorstellungsbeginn p Telefon: 0351 . 49 13 – 615, E-Mail: [email protected] Behindertenservice Sowohl das Schauspielhaus als auch das Kleine Haus verfügen über Aufzüge, Rollstuhlplätze in den Sälen und Toiletten für Rollstuhlfahrer. p Hörschleifen für eingeschränkt hörende Besucher mit dafür geeigneten Hörgeräten sind ebenfalls vorhanden. Funkempfänger sind beim Abendpersonal erhältlich. Besucher sollten ihre diesbezüglichen Wünsche bereits bei der Kartenreservierung angeben, da in beiden Häusern nur eine begrenzte Zahl an Rollstuhlplätzen und Funkempfängern zur Verfügung steht. Impressum p Herausgeber: Staatsschauspiel Dresden, Intendant: Wilfried Schulz, Redaktion: Dramaturgie / Öffentlichkeitsarbeit p Redaktionsschluss: 2. 4. 2014 p Gestaltung: ErlerSkibbeTönsmann p Ensemblefotos: Matthias Horn p Inszenierungsfotos: David Baltzer, Matthias Horn p Illustration: Patrick Klose p Druck: Neue Druckhaus Dresden GmbH p Soweit nicht anders gekennzeichnet, entstanden alle Autorenbeiträge im Auftrag des Staatsschauspiels Dresden. 115 Titelzitat von Wolfgang Herrndorf