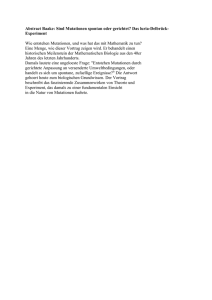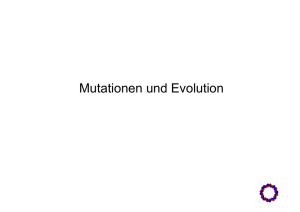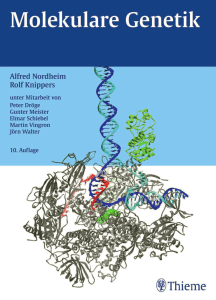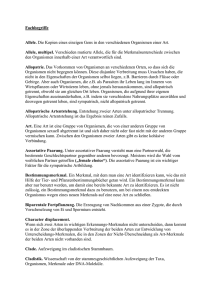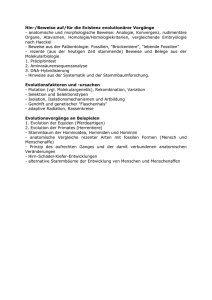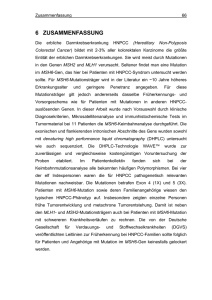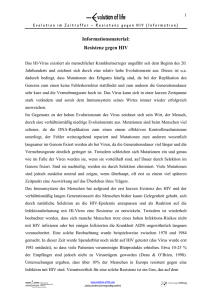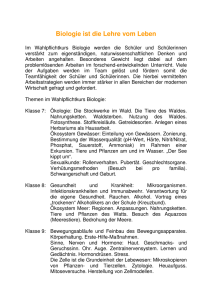1.3 Adaptive Landschaften
Werbung

1.2 Proximate Mechanismen und ultimate Ursachen 19 | 1.8 | Warum pflanzen sich die Menschen fort? John Lennon: »Neunzig Prozent der Menschen auf diesem Planeten, vor allem im Westen, verdanken ihre Existenz einer Flasche Whisky in einer Samstagnacht. Meist bestand nicht die Absicht, Kinder zu haben. Neunzig Prozent von uns sind Missgeschicke – ich kenne niemanden, der ein Kind geplant hat. Wir alle sind Samstagnachtsonderausgaben.« (The Beatles Anthology. Ullstein, München 2000) Miloslav Stingl: »… wenn ich nun die Spuren des Sexuallebens der Steinzeitmenschen erörtere, muss ich gleich am Anfang die vielleicht überraschendste Tatsache erwähnen: einige australische Einheimische oder zumindest Angehörige einiger lokaler Stämme, verstanden bzw. kannten die Beziehung zwischen Geschlechtsverkehr und Empfängnis nicht. Sie wussten nicht, dass der Mann beim Koitus die Frau befruchtet … Weil also der Geschlechtsverkehr mit der Kinderzeugung nicht in Zusammenhang gebracht wurde, betrachteten die ursprünglichen Australier den Beischlaf nicht als etwas, das von wesentlicher Bedeutung für die Erhaltung des Klans wäre, sondern als eine angenehme Unterhaltung, Freude, die sie sich im möglichst größten Maße und so lange gönnen wollten, wie es ihnen die Gesundheit erlaubt.« (Sex na peti kontinentech [Sex auf fünf Kontinenten]. Jota, Brno 2006) | 1.9 | Warum lieben wir Babys? Die Kombination von Körpermerkmalen und Verhaltensweisen, die beim Menschen eine als Betreuungsreaktion deutbare Gefühlstönung, Zärtlichkeitshandlungen und insgesamt eine positive Einstellung auslöst, wird als Kindchenschema bezeichnet (Abb. 1.3). Hierzu gehören kindliche Proportionen (relativ großer, runder Kopf mit „Pausbacken“,großen Augen und kleiner Stupsnase), aber auch eine unbeholfene Motorik. Es besteht eine gewisse Parallele zwischen den ins Kindchenschema fallenden Merkmalen und den Jugendmerkmalen vonTieren (z. B. Jugendkleid, Sperrrachen vieler Vögel), die Auslöser für Brutpflegehandlungen darstellen und Aggressionen hemmen (bzw. keine aggressiven Handlungen auslösen). Das Kindchenschema wurde zunächst von Konrad Lorenz (1903–1989, Verhaltensforscher, Nobelpreis für Medizin oder Physiologie 1973 ( S. 319), zusammen mit Karl von Frisch und Niko Tinbergen) postuliert. Erwachsene verhalten sich gegenüber Individuen, die Merkmale des Kindchenschemas tragen, stärker beschützend, fürsorglicher und weniger aggressiv, als sie sich gegenüber Merkmalen älterer Individuen verhalten. Auch sogenannte „Schoßtiere“ des Menschen weisen mitunter eine der Merkmalskombination des Kindchenschemas entsprechende Kopfform auf, und es erscheint nicht ausgeschlossen, dass an ihrer Entwicklung eine bewusste Zuchtwahl beteiligt war. Das Kindchenschema führt wahrscheinlich zu einem Anstieg des Prolaktinspiegels. Prolaktin löst bei allen bislang getesteten Säugetierarten sowie auch bei vielen anderen Wirbeltieren Brutpflegeverhalten aus, und zwar sowohl bei Weibchen als auch bei Männchen, wenn diese an der Brutpflege beteiligt sind. 1.3 Die wichtigsten Merkmale des von Konrad Lorenz entwickelten Kindchenschemas sind große Augen, hohe Stirn, „Pausbacken“ und „Stupsnase“. Diese Merkmale lösen beim Menschen eine positive, als Betreuungsreaktion deutbare Gefühlstönung aus. (Nach Veselovský 2005) 20 1 Einleitung Die meisten Organismen sind sich weder ihrer Existenz noch ihres Verhaltens bewusst, dennoch „streben“ sie danach, die ultimaten Ziele zu erreichen. unvollkommenen, aber mehr oder weniger gut funktionierenden Programmen zu behaupten, denn der zusätzlicher Reproduktionserfolg, den es seinen Trägern bringen könnte, ist – falls überhaupt vorhanden – eigentlich ganz gering. Billiger ist es, sich mit den zeitweiligen Fehlern abzufinden. Alles geschieht so, wie es sich in der Vergangenheit bewährt hat und wie es wahrscheinlich auch in der Gegenwart erfolgreich sein wird. Im folgenden Text werden wir immer wieder behaupten, dass der Organismus oder das Allel etwas „will“, sich um etwas bemüht, etwas vermeidet. Ein sehr einfaches Gegenargument wäre, dass die Organismen, geschweige die Allele, natürlich nichts wollen, weil sie sich weder ihrer Existenz noch ihrer Ziele bewusst sind. Aber darum geht es nicht. Die Organismen sind sich bestimmt nicht ihres Verhaltens bewusst, was sie jedoch nicht daran hindert, sich so zu verhalten, dass sie diese ultimaten Ziele, besser oder schlechter, erreichen. Es ist wie mit der Funktion unserer inneren Organe. Die Nieren dienen uns, ohne dass sie sich ihrer Aufgabe bewusst sind. Und nicht nur das: Die Nieren funktionieren, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, ohne dass wir wissen, was und wie sie es machen sollen und ohne dass wir ihre Tätigkeit irgendwie bewusst steuern können. Das ist auch besser so. Jeder vor uns, der sich selbst aktiv um die Funktion seiner Nieren kümmern müsste, wäre bald tot. Eine Pflanze kennt die Struktur von Chlorophyll nicht und trotzdem läuft bei ihr die Photosynthese ab. Ein Hund kann die Bahn des geworfenen Stockes nicht berechnen und fängt ihn trotzdem. Auch in sozialen und sexuellen Beziehungen stellt niemand Berechnungen an, welches Verhalten seinen Allelen zugutekommt. Nur einige Sozialverhaltenstypen sind erfolgreich, andere sind nicht erfolgreich, und falls sie genetisch bedingt sind, haben die Allele, die verschiedene Verhaltenstypen beeinflussen, unterschiedliche Fähigkeit zu überdauern. Der Mensch hat – ähnlich wie die Nachtigall – natürlich eine vollkommene persönliche Freiheit. Üblicherweise nutzt er sie zugunsten seiner Allele, von deren Existenz er aber vielleicht noch nie gehört hat. 1.3 Adaptive Landschaften Das erfolgreiche Leben eines Individuums führt sekundär zur Anpassung seiner Art. Die Arten passen sich ihrer Umwelt so an, dass die Individuen dieser Arten im „Fortpflanzungswettbewerb“ unterschiedlich erfolgreich sind. Und sie sind deshalb unterschiedlich erfolgreich, weil sie unterschiedliche Eigenschaften besitzen. Das hat mehrere wichtige Konsequenzen. Vor allem ist es wichtig zu erkennen, dass sich die Arten nebenbei adaptieren, denn die Anpassung einer Art ist die sekundäre Konsequenz des erfolgreichen Lebens eines Individuums, nicht das Ziel eines Individuums. Aber das bedeutet auch, dass das Ergebnis solch einer Anpassung manchmal etwas anders aussieht, als wir es uns vorstellen würden. Die Lebensweisen von Wolf und Löwe ähneln sich mit Sicherheit stärker als die von Wolf und Schimmelpilz, und zwar unabhängig davon, wie wir diese „Ähnlichkeit“ messen. Die Millionen Lebensweisen verschiedener Arten unterscheiden sich selbstverständlich in Millionen verschiedener Parameter, mit denen wir sie beschreiben können. Aber wir können versuchen, diese extrem kom- 1.3 Adaptive Landschaften 21 1.4 Bildhafte Darstellung einer Fitnesslandschaft: Die Eigenschaften der Organismen werden in den horizontalen Koordinaten abgebildet. Ändert sich der Phänotyp des Organismus, ändert sich auch seine Position in der Landschaft. Die Höhe beschreibt den Reproduktionserfolg unterschiedlicher Phänotypen: Die Organismen können im Laufe ihrer Evolution nur ihre Fitness erhöhen, d. h. bergauf steigen (z. B. entlang der hier rot, gelb und blau dargestellten „Bergwege“). plizierte multidimensionale „Struktur“ verschiedener Lebensstrategien in eine vereinfachte zweidimensionale „Karte“ zu transferieren. Eine solche Karte muss unser Wissen von der Welt nicht wesentlich verzerren, sofern in ihr die Lebensweisen von Wolf und Löwe näher beieinanderliegen als die von Wolf und Schimmelpilz. Wenn wir noch eine dritte Dimension hinzufügen – den Erfolg der jeweiligen Lebensweise – entsteht die „adaptive Landschaft“ mit den adaptiven Gipfeln als Orten des Erfolgs und Tälern der tiefen Hoffnungslosigkeit zwischen ihnen ( Box 1.10, Abb. 1.4). Die Position einer Art auf der Karte der adaptiven Landschaft ergibt sich also aus ihren morphologischen, genetischen, ökologischen oder physiologischen Eigenschaften; im Prinzip können es völlig beliebige Eigenschaften sein. Unter Evolution verstehen wir dann irgendeine Veränderung dieser Eigenschaften, also die Verschiebung der Position einer Art auf der Karte. Natürlich können wir in die adaptive Karte von dem Ort ausgehend, wo sich die Art gerade befindet, einen Pfeil in beliebiger Richtung zeichnen. Allerdings geht das nur bei der zweidimensionalen Karte. Bestimmte Änderungen der Eigenschaften der Arten sind nämlich verboten, da die Evolution in einer bestimmten Richtung verläuft: Über die tatsächlichen evolutionären Veränderungen entscheidet die dritte „Höhendimension“, die aus der Karte eine Landschaft macht. Die adaptive Evolution wäre dann ein langsames Hinaufsteigen an den Hängen der adaptiven Berge hin zu ihren Gipfeln. Auf diesem Weg kommt es also zu einer „Verbesserung“ der Organismen, von einer ursprünglichen Art am Bergfuß zu einer abgeleiteten Art am Gipfel. Die Evolution kann adaptive Eigenschaften der Organismen hervorbringen, aber üblicherweise nur allmählich, in kleinen Schritten, mit vielen Übergangsgliedern. Jeder dieser „Zwischenschritte“ muss natürlich ein realer, lebender und sich fortpflanzender Organismus sein. Jeder „Zwischenschritt“ muss lebensfähig sein, und dies zumindest genauso gut wie, wenn nicht sogar besser als sein Vorgänger. Wenn nämlich ein Organismus mit einer neuen Eigenschaft schlechter wäre als sein Vorgänger, könnte er diesen nicht reproduktiv überholen und damit verdrängen, sodass sich die neu erworbene Die adaptive Landschaft ist ein Modell der Evolution der Organismen in ihrer Umwelt: Die KartenKoordinaten stellen zwei unterschiedliche Eigenschaften der Organismen dar, die Höhe - repräsentiert ihre Fitness. Mit einer Veränderung der Eigenschaften kommt es zur Verschiebung der Position einer Art auf der Karte der adaptiven Landschaft und damit zur Evolution. Adaptive Eigenschaften der Organismen entstehen üblicherweise in kleinen Schritten, mit vielen Übergangsgliedern, wobei jeder „Zwischenschritt“ lebensfähig sein muss, und dies zumindest genauso gut wie sein Vorgänger. 22 1 Einleitung Eigenschaft auch nicht durchsetzen kann. Die Folge dieser adaptiven Evolution ist eine bestimmte Festlegung, die Arten können nur zu dem Gipfel emporsteigen, an dessen Fuß sie entstanden sind, und je höher sie gekommen sind, desto geringer wird die Chance, dass sie diesen Gipfel wieder verlassen können und irgendwo anders hin aufbrechen. Auch wenn der benachbarte adaptive Gipfel höher ist (und eine erfolgreichere Lebensweise anbietet), so kann man ihn nicht | 1.10 | Adaptive Landschaft Die Metapher der „adaptiven Landschaften“ bzw. „Fitnesslandschaften“ führte Sewall Wright ( S. 31) in den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts ein. Nach diesem Modell kann man sich die Evolution der Organismen bzw. Populationen in der Umwelt als plastische topographische Karte einer hügeligen Landschaft vorstellen (Abb. 1.4). Die Koordinaten x und y entsprechen den zwei Eigenschaften eines hypothetischen Organismus, z. B. Körpermasse und Laufgeschwindigkeit, oder (im Falle einer Population) den Allelfrequenzen an zwei unterschiedlichen Loci. Die Höhe (z-Achse) beschreibt den Reproduktionserfolg (Fitness) unterschiedlicher Phänotypen oder Genotypen: DieTäler in dieser Landschaft bedeuten einen geringeren Reproduktionserfolg, Berge einen höheren. Die Oberflächenform (Hügeligkeit) der adaptiven Landschaft ist vorgegeben und unabhängig von den Eigenschaften der Organismen; sie bestimmt die Verteilung der Nischen ( Box 6.14) in der jeweiligen Umwelt. Da sich die Umwelt ständig ändert, verschieben sich auch die Gipfel in der Landschaft. Offensichtlich werden unterschiedliche Kombinationen von Eigenschaften, d. h. unterschiedliche Koordinaten, auf unterschiedliche Orte der adaptiven Landschaft abgebildet, weisen somit also unterschiedliche Höhen und damit auch unterschiedliche Fitness auf und sind unter dem Gesichtspunkt der natürlichen Selektion unterschiedlich vorteilhaft. Durch Mutationen ändern sich die Eigenschaften und damit auch die Koordinaten, sodass die Organismen auf der Karte verschoben werden. Die natürliche Selektion kann nur solche Mutationen fixieren, die einen Organismus in der Ebene der Karte bergauf (also in Richtung eines höheren z-Werts) verschieben. Eine evolvierende Population steigt in der Fitnesslandschaft in vielen kleinen Schritten durch genetische Änderungen bergauf, bis das lokale Optimum erreicht wird. Dort bleibt sie, bis irgendeine seltene Mutation den Weg zu einem neuen, noch höheren Fitnessgipfel öffnet. Da die Morphologie der Landschaft dynamisch ist, müssen die Organismen (Populationen) den Gipfeln in einer nie endenden Reise folgen. Falls zwischen zwei Gipfeln ein tiefesTal liegt, können die Organismen nicht von einem Gipfel zum anderen gelangen, denn ein Mutant, der an einen tief liegenden Ort geraten ist, wird durch natürliche Selektion eliminiert. So kann es passieren, dass bestimmte Orte auf der Karte der adaptiven Landschaft unbesetzt bleiben (in der Sprache der Ökologen sagt man, dass einige Nischen nicht realisiert werden). Mit anderen Worten, bestimmte Kombinationen von Eigenschaften gibt es nicht, weil ihre Koordinaten in einem Tal mit niedriger Fitness liegen, bzw. selbst wenn sie auf einen Gipfel projiziert würden, wäre dieser nur über ein tiefesTal zu erreichen. Dies bedeutet, dass die Evolution nicht optimiert – dazu müsste sie die Täler in der adaptiven Landschaft überwinden; die Evolution kann nur verbessern. Sie findet auch keine globalen, sondern nur die lokalen Maxima. Es gibt keine Säugetiere, die mithilfe ihrer Ohrmuscheln gleiten oder sogar fliegen könnten. Dieser Gipfel („fliegende Ohren“) ist in der adaptiven Landschaft frei geblieben, denn die Zwischenstufen von Ohrmuscheln normaler Größe zu Ohrmuscheln enormer Größe, die das Fliegen ermöglichen würden, sind selektiv nachteilig. Eventuelle Mutanten befinden sich in den tiefen Tälern der adaptiven Landschaft. Das Wright‘sche Modell ist etwas komplizierter als hier umrissen. Im Prinzip handelt es sich um ein anspruchsvolles mathematisches Modell, bei dem auch weitere Faktoren, u. a. die Populationsgröße, eine Rolle spielen. Das Konzept der Fitnesslandschaft gewann auch für die Methoden der evolutionären Optimierung an Bedeutung. Hierbei versucht man, die Probleme unserer realen Welt (wie z. B. logistische Probleme) durch Nachahmung der Dynamik der biologischen Evolution zu lösen. 23 1.3 Adaptive Landschaften über das Tal hinweg erreichen, denn der Weg hinunter ins Tal würde zumindest vorübergehend einen Sieg der weniger angepassten, also weniger lebensfähigen oder weniger reproduktiv erfolgreichen Individuen bedeuten. Daraus folgt allerdings, dass die Evolution keine vollkommenen, durch und durch optimalen Lösungen anstreben kann, da jeder Evolutionsschritt fest mit einem konkreten „Ort“ in der adaptiven Landschaft verbunden ist. Das ist an und für sich nichts Seltsames (dass die Anerkennung der Bedeutung vergangener – und damit einzigartiger – Änderungen wesentlicher Bestandteil der Evolutionsidee ist, haben wir schon gesagt), aber trotzdem ist es wichtig, sich klar zu machen, dass die allmählichen Änderungen der realen Organismen, die sich zu einer bestimmten Zeit und in einem bestimmten Raum abspielen, keine „Ingenieurslösung“ ihrer Probleme sind. Oft können wir uns eine „bessere“ Lösung vorstellen als die von den Organismen tatsächlich umgesetzte, aber was wir uns vorstellen oder nicht vorstellen können, spielt hier keine Rolle. Die Organismen haben bei der Auswahl der Lösungen nicht die notwendige Freiheit, eben weil sie die historische Kontinuität nicht unterbrechen können, die sie mit ihrer Vergangenheit, also mit ihren Vorfahren verbindet. Wenn jede Art unabhängig von allen anderen entstehen würde, könnten die Organismen viel perfekter sein, als sie es sind. Gerade die augenscheinliche Unvollkommenheit der Organismen wird so zu einem „Beweis“ der Evolution. Die so verstandene Evolution ist kein allgemeines Prinzip, das über das Schicksal der Welt herrscht, sondern eine allmähliche Lösung der momentanen Probleme, mit denen die Organismen konfrontiert werden, wobei die alternative Lösung dieser Probleme der Tod des Individuums oder das Aussterben einer Art ist. Wir erwähnen dies, weil es auch Leute gibt, die die evolutionäre Geschichte zu ernst und mystisch nehmen und die EVOLUTION oft groß schreiben, sozusagen als Pendant zu GOTT). Nicht jede „Evolutionstheorie“ ist mit der gegenwärtigen Evolutionsbiologie vereinbar. Die Evolution, wie sie von der Evolutionsbiologie verstanden wird, ist vor allem nicht jemandes Ziel. Die Organismen haben keine Pflicht oder einen Bedarf sich zu ändern und die Arten, die sich langfristig nicht ändern, sind deswegen nicht schlechter als die, die sich Allmähliche Änderungen der realen Organismen zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort stellen keine „Ingenieurslösung“ ihrer Probleme dar. Wir selbst können uns oft „bessere“ Lösungen vorstellen. Die augenscheinliche Unvollkommenheit der Organismen kann als Beweis der Evolution angesehen werden. 1.5 Beispiele für evolutionär ursprüngliche Arten oder Linien, die seit Langem relativ unverändert als Taxa überleben und damit auch Vorteile manch konservativer Eigenschaften zeigen. Von links nach rechts, untere Reihe: Brückenechse, Ginkgo, Quastenflosser, Farne; obere Reihe: Pfeilschwanzkrebs, Skorpion, Hai, Gürteltier. 24 1 Einleitung ständig ändern. Eher ist es umgekehrt: Die stark konservativen Arten sind doch die, die sich nicht zu ändern brauchen, und damit dem am nächsten kommen, was wir vielleicht als „Vollkommenheit“ bezeichnen würden (Abb. 1.5). 1.4 Genetik und Neodarwinismus Damit die Organismen um den Fortpflanzungserfolg konkurrieren können, muss die Fortpflanzung mit der Vererbung verbunden werden. Die Übertragung der Eigenschaften auf die nächste Generation darf nicht 1:1 erfolgen, damit die Variabilität der Eigenschaften in der Nachkommenschaft gewährleistet wird. Die Grundlage der biologischen Variabilität, also die primäre Quelle evolutionärer Neuheiten, konnte Darwin nicht erklären. Damit wir zwischen konkreten Individuen überhaupt einen reproduktiven Wettlauf erwarten können, der seit Darwins Zeiten als Motor evolutionärer Veränderungen gilt, müssen wir ein paar Dinge voraussetzen. Zunächst müssen die Eigenschaften von Generation zu Generation verlässlich weitergegeben werden, weil die Individuen sterblich sind. Ein Individuum muss Nachkommen hinterlassen und die Nachkommenschaft muss ihren Eltern (zumindest einem der Elternteile) mehr oder weniger ähneln. Eine notwendige Bedingung ist also die mit der Vererbung verbundene Fortpflanzung. Diese Bedingung ist natürlich erfüllt, wie auch immer dies erreicht wird (Darwin selbst war sich darüber nicht im Klaren). Eine weitere Bedingung ist aber paradoxerweise gerade, dass die Übertragung der Eigenschaften zwischen den Generationen nicht vollkommen zuverlässig abläuft. Daraus ergibt sich die zufällige Variabilität der Eigenschaften in der Nachkommenschaft, sodass potenzielle Paarungspartner unter verschiedenen Varianten wählen können, wodurch sich die Sieger von den Verlierern im reproduktiven Wettbewerb unterscheiden. Auf diese Weise können die vorteilhafteren Eigenschaften erhalten bleiben, sich in der Population manifestieren und sich allmählich verbessern. Mit jedem Evolutionsschritt unterscheiden sich die Nachkommen sowohl von ihren Eltern wie auch untereinander. Manche dieser Abweichungen beeinflussen ihr Leben (bzw. ihren Fortpflanzungserfolg) nicht, manche verschlechtern es und wiederum andere (die wenigsten) verbessern es. So bekommt die Selektion das Material, mit dem sie effektiv arbeiten kann. Indem sie das Überdauern von nur wenigen Eigenschaften erlaubt, arbeitet die Selektion natürlich gar nicht „zufällig“, sondern sie ist im Gegenteil der Hauptgestalter der Ordnung. Die Natur der biologischen Variabilität, also die primäre Quelle der Evolutionsneuheiten, war der Ursprung einiger Kontroversen, die den Darwinismus Anfang des 20. Jahrhunderts beinahe begraben hätten. Darwin wusste zwar sehr wohl, dass Variabilität notwendig ist, damit die Selektion verschiedene Alternativen testen kann, aber den Ursprung der Variabilität kannte er nicht. Er nahm an, dass neue Eigenschaften während des Lebens eines Individuums durch das aktive Anpassen an die Umwelt entstehen – solch einen Mechanismus als Hauptmotor der Evolution hatte bereits ein halbes Jahrhundert zuvor JeanBaptiste Lamarck vorgeschlagen. Weiterhin ist Darwin aus Erfahrung davon ausgegangen, dass die variable Nachkommenschaft irgendwie durch Kreuzung der Eltern entsteht, wobei ihm die Prozesse unklar gewesen sein mussten. Die Behauptung, dass Darwins Vorstellungen von Erblichkeit und Entstehung der Variabilität irrtümlich waren, ist allerdings nicht ganz berechtigt, denn Darwin gab eindeutig zu, dass es in diesem Bereich Dinge gibt, die er nicht versteht. 25 1.4 Genetik und Neodarwinismus Die Geburtsstunde der Genetik, die eng mit Darwins Zeitgenossen, dem Brünner Abt Gregor Mendel ( s. u.), verbunden ist, bedeutete für Darwins Theorie zunächst allerdings einen großen Rückschlag. Die Versuche von Mendel zeigten nämlich, dass die Variabilität der Nachkommen nicht mit der Entstehung neuer Eigenschaften zusammenhängt, die dann von der natürlichen Auslese getestet werden können. Für die Variabilität sind vor allem neue Kombinationen von unveränderlichen und gegenseitig unabhängigen „Anlagen“ für diese Eigenschaften verantwortlich, und diese waren schon bei den Eltern vorhanden (obwohl sie bei ihnen vielleicht nicht zum Ausdruck kamen). Eine dieser Anlagen des Nachkommens vererbt der Vater, eine weitere die Mutter, im Nachkommen kommt aber vielleicht auch nur eine von ihnen zum Ausdruck. Die Variabilität entsteht durch die Kombination von etwas bereits Existentem, nicht durch die Entstehung von etwas Neuem, und das Vorkommen von bestimmten Eigenschaften bei den Nachkommen kann man, wenn auch nur statistisch gesehen, voraussagen. (Wir wissen nicht, welcher konkrete Nachkomme welche Eigenschaft erbt, aber wir können sagen, wie viele Nachkommen sie wahrscheinlich haben werden.) Es schien, dass der Darwin‘schen Evolution kein genetisches Material für die Entstehung von etwas wirklich Neuem zugrunde liegt. Darwins Konzept der Evolution haben erst die Mutationen, d. h. die Änderungen der Erbanlagen, gerettet, die Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt wurden. Man stellte fest, dass jene Anlagen, die von einer Generation in die nächste übergehen, nicht ganz unveränderlich sind. Damals wusste niemand, welcher Art diese Anlagen sind und erst recht konnte man nicht ahnen, dass gelegentlich eine Abweichung entsteht, die es vorher nicht gab ( Box 1.11). Als die Kontroversen zwischen dem Darwinismus und der Genetik nach und nach gelöst wurden, entstand in den 20er- bis 40er-Jahren des 20. Jahrhunderts die neuere Form der Evolutionstheorie, die wir „Synthetische Evolutionstheorie“ oder einfach „Neodarwinismus“ nennen (und die die Evolutionsbiologie bis heute beherrscht) ( Box 1.13, Abb. 1.7). Es kam allmählich auch zu einer Änderung der Sichtweise. Der klassische Darwinismus hat die Auslese unter den Nachkommen der Elterngeneration zugeschoben, ganz einfach deshalb, weil nicht alle Nachkommen ihrerseits eigene Nachkommenschaft zeugen. Wenn wir allerdings die Anlagen für die Eigenschaften der Organismen ins Johann Gregor Mendel Lebensdaten: 1822–1884 Nationalität: tschechisch Leistung: Begründer der modernen Genetik. Augustinermönch und Naturforscher, der die Regeln der Vererbung beschrieb, die als Mendel‘sche Gesetze (heute Mendel‘sche Regeln) allgemein bekannt sind. In den 20erund 30er-Jahren des 20. Jh. diente Mendels Arbeit als Basis für die moderne Evolutionsbiologie. Mit der Erkenntnis, dass sich die genetische Gesamtinformation eines Organismus aus einzelnen Genen zusammensetzt, wurden Einwände von Gegnern der Selektionstheorie entkräftet. Diese hatten behauptet, dass neu entstandene Merkmale durch „mischende Vererbung“ im Lauf der Generationen ausgedünnt und verschwinden würden. Mendel zeigte, dass die Variabilität auf neuen Kombinationen von bereits existierenden Anlagen beruht, was für den Darwinismus zunächst einen Rückschlag bedeutete. Erst mit der Entdeckung der Mutationen wurde klar, wie neue Varianten entstehen können. Die Vereinigung der Konzepte des Darwinismus und der Genetik führte zum Neodarwinismus (auch „Synthetische Evolutionstheorie“). 26 1 Einleitung Die Populationsgenetik betrachtet die Evolution als Änderung in den prozentualen Anteilen einzelner Erbanlagen in den Populationen. Die natürliche Auslese ist nach neodarwinistischer Auffassung ein Wettbewerb zwischen den verschiedenen Anlagen für die gegebene Eigenschaft. Dabei konkurrieren Allele um einen bestimmten chromosomalen Locus. 1.6 Schema der Proteinbiosynthese anhand der in der DNA verankerten genetischen Information. Auge fassen, betrachten wir etwas, das sich kaum oder nur selten ändert, und sicherlich nicht bei jedem Fortpflanzungsakt. Es handelt sich also weniger um die Auslese zwischen den Individuen, sondern um die Auswahl zwischen verschiedenen Anlagen in ganzen Populationen, denn verschiedene Individuen tragen dieselben Anlagen in sich (wenn auch in verschiedenen Kombinationen), und unter dem Gesichtspunkt der Erhaltung einer bestimmten Anlage ist es eigentlich egal, in welchem Körper sie sich gerade befindet. Wenn wir uns mit der natürlichen Selektion auf dieser Ebene beschäftigen wollen, müssen wir die Ausbreitung, Konkurrenz und Überdauerung von nichtveränderlichen oder sich sehr langsam ändernden Anlagen in den Populationen untersuchen. Das war die Geburtsstunde der Populationsgenetik, die Evolution vor allem als Änderung in den prozentualen Anteilen einzelner Anlagen in den Populationen betrachtet. Die Populationsgenetik wurde zu einer wichtigen Gedankenquelle des Neodarwinismus. Die natürliche Auslese ist nach der neodarwinistischen Auffassung ein Wettbewerb zwischen den verschiedenen Anlagen für eine gegebene Eigenschaft. Es konkurrieren allerdings nur solche Anlagen, die wechselseitig alternativ sind, die sich also gegenseitig ersetzen können. Diese alternativen Anlagen nennen wir Allele, und der Satz von sich gegenseitig vertretenden Allelen, die verschiedene Versionen einer Eigenschaft oder Funktion bestimmen, ist ein Gen. Das, wodurch sich die Allele eines Gens unterscheiden, sind die Mutationen; eine Mutation kann aus einem Allel ein anderes Allel machen. So schließt z. B. das „Gen für die Blütenfarbe der Rose“ mehrere konkurrierende Allele ein, z. B. „das Allel für gelbe Blütenfarbe“ und „das Allel für rote Blütenfarbe“. Ihre Konkurrenz besteht darin, real existierenden Rosen, von denen es auf der Welt natürlich eine endliche Anzahl gibt, die entsprechende Ausprägungsform aufzuzwingen. Heute wissen wir, dass wir Gene räumlich identifizieren können, nämlich als bestimmte Loci (Orte) auf den Chromosomen, und dass die Allele, also verschiedene Versionen eines Gens, deshalb konkurrieren, weil an einem Locus eines Chromosoms nicht mehr als eine Variante der jeweiligen Anlage vorhanden sein kann. (Hier stoßen wir zum ersten Mal auf ein bedeutendes terminologisches Problem – unter dem Begriff „Gen“ versteht man in der gegenwärtigen 1.4 Genetik und Neodarwinismus 27 | 1.11 | Genetisches Repetitorium Nach der klassischen Vorstellung beginnt Evolution mit einer zufällig entstandenen, durch Mutationen hervorgerufenen Variabilität. Es handelt sich um kleine Änderungen im „genetischen Material“, also im Molekül der Desoxyribonucleinsäure (DNA), das wir in jedem Zellkern finden. Dieses Kettenmolekül besteht aus vier verschiedenen Bausteinen, den Nucleotiden (konkret Adenosin-, Cytidin-, Guanosin- und Thymidin-Monophosphat). In der Reihenfolge dieser Nucleotide ist die Information enthalten, vergleichbar mit der Information, die in der Anordnung der Zahlen einer Telefonnummer verborgen ist. Eine kleine Abweichung von der richtigen Reihenfolge genügt, und Sie erhalten keine Verbindung zum gewünschten Gesprächspartner. Diese genetische Information wird in eine Reihenfolge von Aminosäuren übersetzt, die schließlich die Proteine, also Eiweiße, bilden. Die Übersetzung erfolgt so, dass jeder konkreten Dreiergruppe der Nucleotide (Basentriplett oder Codon) genau eine Aminosäure entspricht (die Umkehrung gilt jedoch nicht, da dieselbe Aminosäure durch verschiedene Codons bestimmt werden kann). Der eigentliche Prozess der Proteinherstellung besteht aus zwei Schritten: der Transkription (der Synthese von Ribonucleinsäure [RNA] – also eines DNA-ähnlichen Zwischenprodukts – , aufbauend auf der DNA-Information) und der Translation (der Synthese eines völlig anderen Produkts – nämlich des Proteins –, aufbauend auf der RNA-Information) (Abb. 1.6). Das nichtzufällige, systematische Schema, mit dem die Information aus den Nucleinsäuren in die Information der Proteine übersetzt wird, ist der genetische Code, der bei allen Organismen bis auf einige geringe Abweichungen identisch ist. Daher ist es Unsinn, was man immer wieder in Zeitungen liest, dass Wissenschaftler den genetischen Code des Menschen oder des Reises geknackt haben bzw. zu knacken versuchen. Der genetische Code, also die Art der Übersetzung aus der Sprache der Nucleinsäuren in die Sprache der Proteine ist seit Langem bekannt, und das, womit sich die Biologen heutzutage beschäftigen, ist die konkrete Sequenz der Nucleotide im Genom des Menschen oder des Reises. Der genetische Code ist ein einfaches Nucleotid-Aminosäuren-Wörterbuch, in dem es nichts zu lösen gibt. Dagegen stellen die Genome der Millionen von Arten von Organismen Millionen von unterschiedlich langen Büchern dar, von denen bislang nur ein paar Hundert, üblicherweise die kürzeren, gelesen, jedoch nicht verstanden wurden. Proteine (Eiweiße) sind große und komplizierte Moleküle, die nicht nur eine der Hauptkomponenten der Zellen und der zwischenzellulären Substanz darstellen, sondern insbesondere auch die notwendigen biochemischen Reaktionen ermöglichen, die ohne die Beteiligung von Eiweißkatalysatoren (Enzymen) praktisch nicht ablaufen könnten. Weiterhin bilden Proteine auch die Zellrezeptoren, also Fenster, durch die bestimmte Moleküle aus der Außenwelt kontrolliert in die Zelle eintreten (bzw. an ihrem Zutritt gehindert werden) oder sie fungieren als Signalmoleküle, die Informationen innerhalb der Zelle oder aus der Zelle nach außen übertragen. Ohne Proteine kann also kaum irgendein biologischer Vorgang ablaufen, und die Funktion der Proteine, die unmittelbar durch ihre Aminosäurenstruktur bestimmt ist, geht aus der genetischen Information der DNA hervor. In jeder lebenden Zelle (und der menschliche Körper besteht aus Billionen lebender Zellen) finden wir DNA, die bei der Zellteilung repliziert werden muss. Der alte DNA-Strang wird im Verlauf der Replikation zum Muster für die Synthese zweier neuer Stränge. Beim Kopieren der Information schleichen sich jedoch gelegentlich Fehler ein. Wie schnell das geht, können Sie leicht ausprobieren, indem Sie versuchen das Alte Testament oder den Faust fehlerfrei abzuschreiben. Und da in den nächsten Replikationsrunden die kopierte und somit schon leicht veränderte Version als Muster dient, häufen sich die Kopierfehler allmählich an. Diese Fehler nennen wir Mutationen und sie treten rein zufällig auf. (Die Mutationen können auf der Veränderung der Abfolge der Nucleinbasen oder der Chromosomenstruktur oder -zahl beruhen.) Ändern Mutationen die Struktur des entstehenden Proteins so weit, dass sich auch seine Funktion ändert, so unterliegt diese Funktionsänderung ebenfalls dem Zufall. Manchmal wird die Funktion des Proteins dadurch verschlechtert, manchmal verbessert; oft ändert sich zwar die Struktur, aber die Funktion bleibt unverändert. Entsprechend können wir die Mutationen in negative, positive und neutrale einteilen. Neben den Mutationen, die ganz spontan entstehen, kommen jedoch auch solche Mutationen vor, die durch Umwelteinflüsse (z. B. Chemikalien oder Strahlung) induziert werden. Aber auch diese Mutationen sind in dem Sinne zufällig, als dass sie nicht zielgerichtet zur besseren Anpassung des betroffenen Organismus an die Umwelt führen, die für die Auslösung der Mutation verantwortlich ist. 28 1 Einleitung Die Eigenschaften entstehen nicht völlig aus dem Nichts, sondern aufgrund einer überdauernden Information, die vererblich ist. Evolutionsbiologie manchmal das „Allel“, manchmal den „Locus“ und manchmal noch etwas anderes). Die „Konkurrenz“ von verschiedenen Allelen desselben Gens ist natürlich kein aktiver oder sogar absichtlich geführter Kampf, es ist lediglich unsere Beschreibung der Tatsache, dass unterschiedliche Allele in der Besetzung von verfügbaren Loci unterschiedlich erfolgreich sind, und dass sie daher unterschiedlich lange in der Population bleiben. Dass verschiedene Erscheinungen (z. B. Merkmale, Funktionen oder Verhaltensweisen) unterschiedlich lange überleben, und dass dies oft auf Kosten der Konkurrenten erfolgt, ist ein ganz allgemeines Prinzip, das alle Erscheinungen, nicht nur die Allele, betrifft. Allerdings ist die Mehrheit der Erscheinungen in der Biologie ohnehin von kurzer Dauer und kann langfristig nicht überleben, weil zum Leben auch der Tod eines Individuums gehört. Im Prinzip haben alle Individuen denselben Lebenslauf: Sie entstehen, vermehren sich und sterben anschließend – Individuen haben keine nennenswerte Geschichte. Formen, Farben, Verhalten und konkrete Kombinationen der Allele in den Zellen gehen mit dem Tod eines Individuums unter. In den einzelligen Stadien, den Keimzellen (Gameten) und im befruchteten Ei (Zygote), die vielzellige Organismen durchlaufen, finden wir weder Formen, Farben noch Verhalten der erwachsenen Individuen, und während der individuellen Entwicklung (Ontogenese) müssen all diese Eigenschaften erneut entstehen. Die Eigenschaften sind dabei vererblich, sodass sie offensichtlich nicht ganz aus dem Nichts entstehen, sondern aufgrund einer überdauernden Information. Daher muss uns interessieren, welche Strukturen oder Informationen den Tod eines Individuums überleben, was also | 1.12 | Meiose, Rekombination, Segregation Die Meiose, auch Reduktions- bzw. Reifeteilung genannt, ist ein Vorgang, bei dem sich (ausschließlich) die Keimzellen teilen. Bei derTeilung kommt es zur Halbierung des diploiden Chromosomensatzes, sodass anschließend ein haploider Satz vorliegt. Durch die Verschmelzung zweier haploider Gameten entsteht wieder eine diploide Zelle, die Zygote. Die Meiose ist somit die Voraussetzung jeder sexuellen Fortpflanzung, denn ohne sie würde jede nachfolgende Befruchtung zur Verdopplung des Chromosomensatzes führen. Die Meiose ist auch die Grundlage der Entstehung der genetischen Variabilität und Amphimixis (= Mischung von Allelen). Sie ist durch zwei Prozesse gekennzeichnet: die genetische Rekombination und die Segregation. Bei der Rekombination kommt es bei zwei homologen Chromosomen an derselben Stelle zum Bruch der DNA-Moleküle. Die beiden Bruchstücke können sich wieder korrekt verbinden, oder aber der Faden des einen Chromosoms verbindet sich mit dem Faden des anderen Chromosoms; in diesem Fall kommt es zur Rekombination. Das rekombinierte Chromosomenpaar wird sich nun in der Kombination seiner Allele von den ursprünglichen Chromosomen unterscheiden. Vor der Rekombination konnten wir sagen, dass ein Chromosom vom Vater und das andere von der Mutter stammt. Dagegen enthalten die rekombinierten Chromosomen jeweils einen Teil der Allele vom Vater und einen Teil der Allele von der Mutter. Bei der Segregation trennen sich die Chromosomenpaare und die homologen Chromosome wandern zu den gegenüberliegenden Polen der Zelle. Welches Chromosom des jeweiligen Paares zum einen oder zum anderen Pol der Zelle wandert, bestimmt der Zufall. Auch wenn zuvor keine Rekombination stattgefunden hätte, würde allein die Segregation bereits dafür sorgen, dass jede der neu entstandenen Zellen eine andere Kombination von Allelen trägt als jedes der beiden Elternteile. 1.4 Genetik und Neodarwinismus 29 genau von einer Generation an die nächste übergeben wird, was überhaupt in Millionen und Milliarden Jahren der Geschichte der Organismen irgendwie zum Ausdruck gebracht werden kann. Bei den sich geschlechtlich fortpflanzenden Organismen sind dies die einzelnen Allele. Die Genome dieser Organismen, also die Sätze der von den Vätern und Müttern vererbten Allele, werden nämlich nicht im Ganzen an die Nachkommen weitergegeben. Das Genom der jeweiligen Elternteile wird während der Bildung der Keimzellen in einem Prozess, den wir Rekombination nennen, „aufgebrochen“, die ursprünglich väterlichen und die ursprünglich mütterlichen Allele trennen sich voneinander und gehen auf die verschiedenen Nachkommen über, allerdings in neuen Kombinationen ( Box 1.12). Daher ist jeder von uns genetisch einzigartig: Unsere Allele haben wir von unseren Eltern geerbt, aber 1.7 Chronologische Darstellung der Geschichte der Evolutionsbiologie und ihrer Hauptrepräsentanten. Länge und Position der einzelnen Balken entsprechen den Lebensdaten der jeweiligen Wissenschaftler. Der rote Vertikalstrich kennzeichnet das Jahr der Publikation der bedeutenden Entdeckungen bzw. Konzepte. 30 1 Einleitung Hugo de Vries Lebensdaten: 1848–1935 Nationalität: niederländisch Leistung: Botaniker, Genetiker, Pflanzenphysiologe. Einer der Wiederentdecker der von G. Mendel aufgestellten Vererbungsregeln. Mit seinen 1901 und 1903 erschienenen Schriften zur Mutationstheorie gab er der Evolutionsforschung neue Impulse. In ihnen postulierte er, dass eine neue Art außer durch graduelle Evolution auch sprunghaft entstehen kann (Saltationismus). Was de V. als „Mutation“ bezeichnete, entspricht jedoch nicht ganz dem heutigen Begriff der genetischen Mutation. William Bateson Lebensdaten: 1861–1926 Nationalität: britisch Leistung: Genetiker und Hauptpopularisierer der Ideen von Gregor Mendel. B. prägte die Begriffe „Genetik“, „Epistase“, „Homeosis“. Zusammen mit Reginald Punnett entdeckte er die Genkopplung, also das Phänomen, dass manche durch Gene kodierte Merkmale stets gemeinsam vererbt werden. Wie de Vries war er ein Vertreter des Saltationismus. Thomas Hunt Morgan Lebensdaten: 1866–1945 Nationalität: US-amerikanisch Leistung: Genetiker, Embryologe. Durch Kreuzungsversuche und Studien von Mutationen bei der Taufliege Drosophila melanogaster klärte M. die grundlegende Struktur der Chromosomen auf. Er zeigte, dass Gene hintereinander auf den Chromosomen liegen und ermittelte ihre Reihenfolge und Abstände zueinander. Der genetische Abstand zweier Loci auf einem Chromosom wird in der nach ihm benannten Einheit Centimorgan bestimmt und bildet die Grundlage für die Chromosomenkarten (Genkarten). 1933 erhielt er den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Dank seiner Arbeit wurde Drosophila zu einem Modellorganismus in der Genetik. Sir Ronald Aylmer Fisher Lebensdaten: 1890–1962 Nationalität: britisch Leistung: Einer der bedeutendsten theoretischen Biologen, Genetiker, Evolutionstheoretiker und Statistiker des 20. Jh. und einer der Mitbegründer der Populationsgenetik. F. trug wesentlich zur Entstehung des Neodarwinismus bei. Er führte u. a. das Maximum-Likelihood-Prinzip und das statistische Verfahren der Varianzanalyse (ANOVA, ANalysis Of VAriance) ein. Nach ihm ist die sogenannte F-(Fisher)Verteilung benannt. Er entwickelte Konzepte zur sexuellen Selektion, zur Mimikry und zur Evolution der Dominanz. F. zeigte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mutation die Fitness des Organismus erhöhen wird, mit dem Ausmaß der Mutation sinkt. Er bewies, dass größere Populationen mehr Variation tragen und damit höhere Überlebenschancen haben als kleinere. Einflussreich war sein Buch The Genetical Theory of Natural Selection (1930), das eine mathematische Grundlage für die Evolutionsgenetik lieferte.