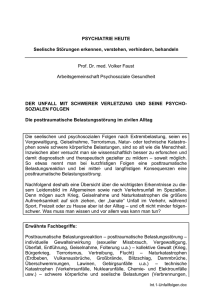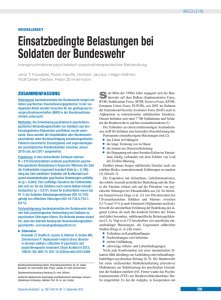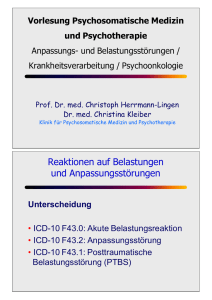Prävention und Behandlung posttraumatischer Störungsbilder im
Werbung

S c h r i f t e n r e i h e B a n d 11 Psychosomatische Fachklinik Bad Pyrmont Klinik für Psychosomatische Medizin und Verhaltenstherapie Eberhard Okon · Rolf Meermann (Hrsg.) Prävention und Behandlung posttraumatischer Störungsbilder im Rahmen militärischer und polizeilicher Aufgabenerfüllung Schriftenreihe der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont Ein Unternehmen der Band 11 › Ihre Ansprechpartner in der Klinik Chefarzt: Prof. Dr. med. Rolf Meermann Sekretariat: Anke Voigts Tel.: 0 52 81 / 619 – 635 Posttraumatische Belastungsstörung: Eberhard Okon, Dipl.-Psychologe Tel.: 0 52 81 / 619 – 642 Verwaltungsdirektor: Horst Schiller, Dipl.-Kaufmann Sekretariat: Gundula Greve Tel.: 0 52 81 / 619 – 630 Aufnahmesekretariat: Ute Cölven Tel.: 0 52 81 / 619 – 509 Postadresse: Psychosomatische Fachklinik Bad Pyrmont Bombergallee 10 31812 Bad Pyrmont Internet: www.ahg.de/Pyrmont E-Mail: [email protected] Telefonzentrale: 0 52 81 / 619 – 0 Telefax: 0 52 81 / 619 - 666 › Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort der Herausgeber 7 Grußworte anläßlich der Tagung „Posttraumatische Belastungsstörung vom 8.10.-10.10.2001“ 8 Okon, Eberhard Diagnostische Kriterien der Posttraumatischen Belastungsstörung 13 Furtwängler, Jürgen Ph. Historischer Abriß der Psychotraumatologie ­ eine Geschichte der Kriegstraumatisierungen 19 Meermann, Rolf Combat Stress und seine kurz- und langfristigen Folgen 23 Kreim, Günter; Meermann, Rolf Präventive Aspekte bei der Personalauswahl und Schulung von KSK-Soldaten 29 Biesold, Karl-Heinz; Hahne, Hans-Heiner Präventions- und Behandlungskonzept zur Bewältigung einsatzbedingter psychischer Belastungen bei Soldaten der Bundeswehr 35 Barre, Klaus; Biesold, Karl-Heinz Therapie psychischer Traumatisierungen bei Soldaten der Bundeswehr 41 Biesold, Karl-Heinz; Barre, Klaus Auswirkungen von Streß und Traumatisierungen bei Soldaten der Bundeswehr 47 Weber, Wolfgang W. Organisation des Critical Incident Stress Managements in der Bundeswehr 53 Varn, Alexander Konzeptentwicklung und Klinische Erfahrungen zu posttraumatischen Belastungsstörungen auf dem Hintergrund der Vietnam-Veteranen 63 Grube, Achim Der Sozialwissenschaftliche Dienst der Polizei Niedersachsen 73 Hallenberger, Frank Polizeilicher Schußwaffengebrauch: Erleben und Folgen 77 Platiel, Peter Belastungen des Botschaftspersonals des Auswärtigen Amtes und Betreuungskonzepte nach Gewalterfahrung 85 › Vorwort der Herausgeber Im Oktober 2001 trafen sich in der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont etwa 200 Teilnehmer und an die 40 Referenten, um Fragen der Diagnostik, Prävention und Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung zu diskutieren. Vor dem Hintergrund der Terroranschläge in den USA erhielt unsere Tagung ungewollt politische Aktualität. Diese Aktualität zeigte sich an dem großen Medieninteresse, so drehte das ZDF einen Beitrag für "heute", der Hörfunk des Norddeutschen Rundfunks produzierte zwei Sondersendungen basierend auf den Ergebnissen der Tagung und Vertreter verschiedener Printmedien nutzten die Möglichkeit, mit den Veranstaltern und einigen der Referenten in Kontakt zu treten, um sich zu dem tagesak­ tuellen Geschehen Hintergrundinformationen zu holen. Ebenfalls ausgelöst durch die Ereignisse am 11. September und sich daran anschließenden Überlegungen bezüglich eines AfghanistanEinsatzes deutscher Soldaten gewann das Thema Prävention und Behandlung Posttraumatischer Belastungsstörungen bei Soldaten zusätzlich Interesse. Gleiches gilt für die Gefährdung von Polizeibeamten, die im Rahmen der Terrorismusbekämpfung und ebenfalls notwendiger Auslandseinsätze etwa im ehemaligen Jugoslawien einem zum Teil verwandten Gefährdungspotential ausgesetzt sind. Gerade die positiven Rückmeldungen der Teilnehmer über die Möglichkeit eines zivilmilitärischen Austausches über Posttraumatische Belastungsstörungen ermunterte uns als Veranstalter, die Inhalte in einem Band unserer Klinik- Schriftenreihe darzustellen. In diesem hiermit vorgelegten mittlerweile 11. Band der Schriftenreihe der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont finden Sie Beiträge führender ärztlicher und psychologischer Vertreter aus den Bereichen Militär und Polizei, die aus ihrem jeweils ganz speziellen Tätigkeitsfeld die Prävention und Behandlung Posttraumatischer Belastungsstörungen beleuchten. Wir wünschen Ihnen, daß Sie die vorliegenden Beiträge mit Gewinn lesen. Bad Pyrmont, im Frühjahr 2002 Dipl.-Psych. Eberhard Okon Ltd. Psychologe Prof. Dr. med. Rolf Meermann Chefarzt 7 › Grußworte anläßlich der Tagung „Posttraumatische Belastungsstörung vom 8.10.-10.10.2001“ Grußwort des VDR Wenn wir von dem Anspruch ausgehen, daß die Rehabilitation ein den gesamten Menschen betreffendes Hilfsangebot darstellt, können Konzept, Diagnostik und Therapie nur unter einem dynamischen Aspekt gesehen werden. So gewinnt zum Beispiel die Verhaltensmedizin als Integral zwischen den klassischen Disziplinen der Medizin und der Psychologie mit ihrem verhaltenstherapeutischen Ansatz eine zunehmende Aktualität und Wirkmächtigkeit in den Rehabilitationskliniken. In einer Gesellschaft, die geprägt ist durch multiplurale Lebensformen und Erlebnishorizonte und durch unterschiedliche ethnische Bevölkerungsgruppen, die des weiteren geprägt ist durch massive und hoch belastende situative Anpassungsleistungen im Alltagsvollzug, drängen sich Krankheitszustände wie die sogenannten posttraumatischen Belastungsstörungen, auch in der Rehabilitation, immer stärker in den Vordergrund. Wir sind selbst unter Umständen Zeuge von schweren Verkehrsunglücken, Gewaltausübungen und Geiselnahme. Im persönlichen Umgang mit Kriegsflüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien haben wir Schilderungen grausigster Schandtaten, Verletzungen und Tötungen vernommen. Manche Asylbewerber, die Integration in unsere Gesellschaft begehren, haben in ihren Herkunftsländern Bedrohung, Inhaftierung und Folterung erleben müssen. Die schweren und schwersten seelischen Belastungszustände in unserem eigenen zivilisierten Alltag zum Beispiel bei Bahnpersonal und Polizei geraten häufig nicht so spektakulär in unser Bewußtsein, sind jedoch ebenso tiefgreifend für den Betroffenen und behandlungs­ bedürftig. Dieses Pilotseminar, welches der VDR gemeinsam mit der Psychosomatischen Fachklinik in Bad Pyrmont veranstaltet, soll Aufmerksamkeit bei sozialmedizinischen Gutachtern und Rehabilitationsmedizinern wecken und die fachkompetente Auseinandersetzung mit dieser weitgehend neuen Materie nach Kräften fördern. Frankfurt, im August 2001 Dr. med. Winfried Hackhausen 8 Grußwort des Inspekteurs des Sanitätsdienstes der Bundeswehr Sehr geehrte Seminarteilnehmer, jeder militärische Einsatz ist mit einem Risiko für Gesundheit und Leben der Soldaten behaftet. Dies gilt auch für die psychische Gesundheit. Es ist bekannt, dass die Auseinandersetzung mit Einsatz- und Kriegserlebnissen, ihre psychische Verarbeitung und Bewältigung auch erfahrene Soldaten nicht kalt lässt, sondern zu erheblichen psychophysischen Reaktionen führen kann. Auch bei der Bundeswehr hat sich bestätigt, dass kriegs- und einsatzeigentümliche Ereignisse bei ungenügender Verarbeitung der traumatischen Erlebnisse zu psy­ chosomatischen Störungen von Krankheitswert – den Posttraumatischen Belastungsstörungen – führen können. Und genau das ist ja das Thema Ihres Fachseminars. Mit zunehmendem internationalem Engagement hat die Bundeswehr zeitgemäße Konzepte für den Umgang mit einsatzbedingten Belastungen entwickelt, insbesondere zur Prävention vor und Intervention bei einsatzbedingten Belastungen. Auch nach einem Einsatz soll eine Reihe von Reintegrations- und Nachsorgemaßnahmen die Wiedereingliederung erleichtern und besonders belasteten Soldaten Hilfen zur Wiederherstellung und Erhaltung der psychischen Gesundheit geben. Hier sind Ärzte, Psychologen, Seelsorger und militäri­ sche Führer gemeinsam gefordert. Besondere Bedeutung hierbei hat die Fortentwicklung der wissenschaftlichen Erkenntnisse, insbesondere durch Evaluierung der prakti­ schen Erfahrungen auf dem noch recht neuen Fachgebiet der Psychotraumatologie. Es bestehen z.B. noch erhebliche Unsicherheiten über die richtigen Wege sowohl in Diagnostik und Therapie wie auch bei der Begutachtung der Posttraumatischen Belastungsstörungen. Wichtig erscheint mir insbesondere der Informationsaustausch zwischen Vertretern verschiedener Nationen, Körperschaften und Organisationen, die Einsatzkräfte in potenziell traumatisierende Szenarien entsenden. Um so mehr freue ich mich, dass dieses Seminar ein Forum bietet, in dem die Erfahrungen aus all diesen Bereichen diskutiert werden können. Wir können und wollen eine Menge voneinander lernen! In diesem Sinne wünsche ich dem Seminar einen guten Verlauf und Ihnen einen fruchtbaren Gedankenaustausch zum Wohle der uns anvertrauten Patienten. Ihr Dr. med. Karl Wilhelm Demmer Generaloberstabsarzt Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr 9 Grußwort der AHG Der ganz normale Wahnsinn! Unter dem Begriff "Posttraumatische Belastungsstörungen“ (PTBS) sind Krankheitsmerkmale zusammengefaßt, die bei Menschen nach dem Erleben und Überleben von Katastrophen auftreten. Die häufigsten Traumen sind eine ernsthafte Bedrohung des eigenen Lebens, bzw. der körperlichen Integrität, ernsthafte Bedrohungen oder Schädigung der eigenen Kinder, des Partners bzw. naher Verwandter und Freunde, eine plötzliche Zerstörung des eigenen Zuhauses sowie das Mitansehen, wie andere Personen infolge von Unfällen oder kör­ perlicher Gewalt gerade oder vor kurzem ernsthaft verletzt wurden oder starben. Die Prävalenzraten für PTBS nach traumatischen Ereignissen werden zwischen 8% bis 13% für Männer angeben und zwischen 20% bis 30% für Frauen. Die Lebenszeitprävalenz für eine PTBS wird zwischen 12% bei Frauen und 6% bei Männern geschätzt. Zu den Ereignissen, die posttraumatische Belastungsstörungen hervorrufen, gehören • Naturkatastrophen • unvorhergesehene Unglücksfälle, (z.B. Autounfälle bzw. Bahnunfälle mit schweren körperlichen Verletzungen, Flugzeugabstürze, Großbrände, Zerstörung der physikalischen Umwelt) • absichtlich verursachte Katastrophen (Anschläge, Folterungen) • absichtlich verursachte Unglückfälle (Anschläge im Verkehrswesen, Suizide mit Hilfe von Verkehrsmitteln) • soziale Gewalterfahrungen (z.B. militärische Gefechte, Überfalle, Geiselnahme), sexuelle Gewalterfahrungen (sexueller Mißbrauch in Kindheit und Jugend, Vergewaltigung im Erwachsenenalter) Manchmal gibt es begleitende körperliche Komponenten des Traumas: Verbrennungen, andere Großwunden, Amputationen, Verlust der körperlichen Integrität, aber auch geringgradige Verletzungen. Die AHG AG hat in ihren psychosomatischen Fachkliniken bereits 1985 mit konzeptionellen Ausarbeitungen zur Behandlung von Patienten mit Gewalterfahrungen begonnen und mit gezielten Fortbildungsaktivitäten, mit Fachtagungen und mit entsprechenden kli­ nischen und wissenschaftlichen Veröffentlichungen die Professionalisierung der therapeutischen Mitarbeiter vorangetrieben. Qualifizierung und Spezialisierung sind bei der Weiterentwicklung von Behandlungskonzepten für PTBS unabdingbar, wenn man sich nicht mit unspezifischen Breitbandverfahren bescheiden will. Solche Spezialisierungen verdichten sich in bezug auf folgende Behandlungsindikationen: Behandlungsindikationen • Patienten als Geschädigte von technischen Katastrophen mit körperlichen Folgeschäden, die nicht mehr primär akutmedizinisch versorgt werden müssen, bzw. Patienten ohne körperliche Folgeschaden • Patienten nach konfliktbedingten Einsätzen im Rahmen Militärischer Aktionen • Patienten als professionelle Einsatzkräfte (Polizei, Feuerwehr, Sanitätsdienste) oder als paraprofessionelle Einsatzkräfte (DRK, THW) bei der Katastrophenbewältigung mit nachfolgenden posttraumatischen Belastungsstörungen • Patienten mit Zuständen nach sozialen Gewalterfahrungen (Geiselnahme, Folterungen, sonst. Lebensbedrohungen) • Patienten mit Zuständen nach sexuellen Gewalterfahrungen Die Fachtagung umfaßt die gesamte Spannbreite möglicher Primärereignisse von Gewalterfahrungen und versucht, eine Verbindung herzustellen zwischen präventiven Ansätzen, sozialmedizinischen Problemstellungen der Begutachtung, therapeutischen und wissen­ schaftlichen Bemühungen um eine Optimierung der Behandlungskonzepte und langfristig angelegten Nachsorgeaktivitäten. Das Aufgreifen der Thematik im Rahmen der sozialmedizinischen Weiterbildung des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger VDR unterstreicht die zunehmende Bedeutung von PTBS im Krankheitsgeschehen und in der medizinischen Rehabilitation. Ich wünsche den Tagungsteilnehmern interessante Tage und einen intensiven Erfahrungsaustausch zu einem Problembereich, dessen Brisanz nach unserer Einschätzung eher weiter zunehmen wird. Hilden, im August 2001 Manfred Zielke 10 Grußwort der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont Seit 14 Jahren werden in unserer Klinik auch Patienten mit der Diagnose PTSD stationär verhaltenstherapeutisch behandelt. Der Begriff der Posttraumatischen Belastungsstörung wurde auf Druck von Vietnam-Veteranen bzw. deren juristischer Vertretungen 1980 in das Diagnostische und Statistische Manual der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft (APA) aufgenommen (DSM III, 1980). Auch 20 Jahre später ist die Diskussion um die medizinische Notwendigkeit bzw. Wissenschaftlichkeit dieser Diagnose noch nicht erlo­ schen (vgl. z. B. Shephard 2000). So uneinheitlich wie die verschiedenen Ursachen und Äußerungsformen dieses Störungsbildes sind auch die Behandlungsempfehlungen in der Literatur. Dabei scheint bisweilen die „Lautstärke“, mit der ein bestimmtes Einzelverfahren propagiert wird, im umgekehrten Zusammenhang zum klinischen Erfahrungshintergrund der Autoren zu stehen. Wir bevorzugen ein multimodales verhaltenstherapeuti­ sches Breitband-Behandlungsprogramm, welches auf einer individuellen Verhaltensanalyse der spezifischen Probleme, aber auch der vorhandenen positiven Ressourcen unserer Patienten aufbaut. Wir denken, daß nur in einem komplexen psychiatrisch-psychologischen Gesamtbehandlungsplan PTSD-Patienten adäquat geholfen werden kann. Dabei ist das sogenannte „bio-psycho-soziale Modell“ mittler­ weile eine triviale Grundvoraussetzung. Über das Angebot des VDR, in unserer Klinik eine entsprechende gemeinsame Fachtagung zu veranstalten, haben wir uns sehr gefreut. Die Liste der Referenten verspricht eine dichte Arbeitsatmosphäre, hohen Informationsgewinn und lehrreiche Diskussionen. Bad Pyrmont, im August 2001 Rolf Meerman Literatur: Ben Shephard A War of Nerves Soldiers and Psychiatrists 1914 – 1994 London, Jonathan Cape, 2000 11 Grußwort des Generalarztes Dr. med. Manfred Neuburger Sehr verehrter Herr Prof. Meermann, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst darf ich Ihnen die Grüße des Inspekteurs des Sanitätsdienstes der Bundeswehr überbringen. Er hat ja bereits in seinem Grußwort, welches Sie in Ihrem Programmheft abgedruckt finden, zu der Bedeutung, die diese Tagung für die Bundeswehr hat, Stellung genommen. Er bedauert, nicht selbst an der Veranstaltung teilnehmen zu können und wünscht nochmals auf diesem Weg einen erfolgreichen Verlauf dieser Tagung sowie viele gute Gespräche. Gestatten Sie mir - ohne Sie lange von den interessanten Vorträgen abhalten zu wollen - noch einige ergänzende Anmerkungen zum Engagement des Sanitätsdienstes der Bundeswehr auf dem Gebiet der PTBS. Wie Sie dem Programm entnehmen können, werden auch Vertreter des Sanitätsdienstes in Vorträgen Ihre Erfahrungen auf diesem Gebiet berichten. Ohne diesen im Detail vorgreifen zu wollen, möchte ich auf die Entwicklung innerhalb der Bundeswehr eingehen. In der Zeit des kalten Krieges war man von der Konfrontation des Militärs im traditionellen Sinne ausgegangen. Im Rahmen dieser krie­ gerischen Auseinandersetzung bedeutete dies für den Sanitätsdienst der Bundeswehr, daß man grundsätzlich mit einem Massenanfall von Verwundeten zu rechnen hatte. Eine friedensmäßige medizinische Versorgung wäre unter diesen Bedingungen nicht mehr möglich gewesen. Dank der Balance der militärischen Blöcke blieb uns diese Erfahrung erspart und die Bundeswehr war zu dieser Zeit mit dem Problem der PTBS - damals sprach man im angelsächsischen Raum von „battle stress“ oder auch von „battle fatigue“ - nur rein theore­ tisch befaßt. Im wesentlichen verfügten damals z.B. Länder wie die USA (Stichwort „Vietnamkrieg“) und Israel (Stichwort „6-Tage- Krieg“) über praktische Erfahrungen auf diesem Gebiet. Die israelischen Streitkräfte verfügten schon sehr frühzeitig über sog. „battle stress rehabilitation units“ in möglichst großer Nähe zum Frontbereich. Die Situation änderte sich grundlegend mit der neuen geopolitischen Lage ab 1990. Mit der zunehmend intensiveren Beteiligung deut­ scher Soldaten an Auslandseinsätzen bei gleichzeitigem Fortbestehen der Friedenssituation in Deutschland wurde uns das Problem der PTBS immer bewußter. Die Soldaten wurden einerseits mit den schrecklichen Ereignissen konfrontiert, die sie sich bislang nicht real vorstellen konnten (z.B. Geiselnahmen und sog. „menschliche Schutzschilde“), andererseits erforderten die Auslandseinsätze Trennung von der familiären und gewohnten Umgebung bis zu einem halben Jahr und mehr. Beides führte in der Bundeswehr zu einem deutli­ chen Anstieg von psychotraumatischen Erkrankungen. Inzwischen sind im Sanitätsdienst der Bundeswehr entsprechende Konzepte ins­ besondere zu Prävention und Nachbehandlung diesbezüglicher Erkrankungen erstellt und umgesetzt worden. Zwischen zivilen und militärischen Großschadensereignissen ergeben sich heute viele Parallelen im Rahmen der Entstehung und Be­ handlung von PTBS. Auch außerhalb von klassischen militärischen Aktionen müssen wir - wie die jüngsten Ereignisse in den USA ge­ zeigt haben - mit dieser Art von Psychotraumatologie rechnen. Eine zivilmilitärische Zusammenarbeit drängt sich deshalb geradezu auf. Zudem ist Ihre Mitgliedschaft im Wehrmedizinischen Beirat des Bundesministeriums für Verteidigung - Herr Prof. Meermann - bereits Ausdruck einer fruchtbaren und engen Kooperation zwischen Sanitätsdienst und zivilem Gesundheitswesen. Auf einer der letzten Ausschußsitzungen des Wehrmedizinischen Beirates haben wir uns ausführlich mit der Psychotraumatologie befaßt und Sie haben uns dabei in dankenswerter Weise tatkräftig unterstützt. Mit der zunehmenden Bedeutung der PTBS tauchen jedoch auch unverkennbar Schattenseiten im Umgang mit diesem hochsensiblen Fachgebiet auf. So wird bei der Öffentlichkeit manchmal der Eindruck vermittelt, es sei besonders modern oder schick, sich in eine dementsprechende Behandlung zu begeben. Die Zunahme sogenannter „selbsternannter Seelenheiler“ sollte uns aufmerksam machen. Wir brauchen deshalb verbesserte differentialdiagnostische Möglichkeiten, um den wirklich „psychisch kranken“ Menschen erkennen und fachgerecht behandeln zu können. Qualitätsmanagement muß auch hier - wie in so vielen anderen Fachgebieten - auf allen Ebenen - von der Prävention bis zur Therapie - Eingang finden. Ich hoffe, daß diese Tagung einen Beitrag dazu leisten wird. Ich wünsche uns allen noch interessante Diskussionen und gute Gespräche. Vielen Dank. Dr. med. Manfred Neuburger Bundesministerium für Verteidigung 12 Diagnostische Kriterien der Posttraumatischen Belastungsstörung* Eberhard Okon Kurzfassung Die diagnostischen Kriterien der Posttraumatischen Belastungsstörung nach ICD-10 werden kurz vorgestellt. Es findet eine kurze differenti­ aldiagnostische Erörterung verwandter Störungsbilder statt. Zusätzliche Konzepte wie das Victimisierungssyndrom nach Ochberg oder das komplexe psychotraumatische Belastungssyndrom nach Herman ergänzen die o.g. diagnostischen Kriterien. Das klinische Erscheinungsbild der Posttraumatischen Belastungsstörung (Synonyme: PTBS, PTSD) ist gekennzeich­ › net durch eine Reihe von Einzelsymp­ tomen wie Intrusionen, Flashbacks, bela­ stende Alpträume, ein erhöhtes psycho­ ICD-10 Kriterien der Posttraumatischen Belastungsstörung (F 43.1) A: Die Betroffenen sind einem kurz- oder langanhaltenden Ereignis oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung mit katastrophalem Ausmaß ausgesetzt, das nahezu bei jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde. physiologisches Erregungsniveau, emo­ tionale Abstumpfung, z.T. Amnesien, häu­ fig auch Tendenzen zur erhöhten Reizbarkeit und Hypervigilanz. Hervorgerufen wird diese Störung mit einer Latenz (nach ICD 10) von einigen Wochen bis zu 6 Monaten nach einem Belastungsereignis von außer­ gewöhnlicher Bedrohung mit katastro­ phalem Ausmaß, welches bei nahezu jedem tiefgreifende Verzweiflung auslö­ B: Anhaltende Erinnerungen oder Wiedererleben der Belastung durch aufdring­ liche Nachhallerinnerungen, lebendige Erinnerungen, sich wiederholende Träume oder durch innere Bedrängnis in Situationen, die der Belastung ähneln oder mit ihr in Zusammenhang stehen. sen würde. Die einzelnen Kriterien nach ICD-10 finden sich in Abb. 1. C: Umstände, die der Belastung ähneln oder mit ihr in Zusammenhang stehen, werden tatsächlich oder möglichst vermieden. Dieses Vermeiden bestand nicht vor dem belastenden Ereignis. Im einzelnen finden sich also folgende fünf Haupt­ kriterien: D: Entweder 1 oder 2: 1) Teilweise oder vollständige Unfähigkeit, einige wichtige Aspekte der Belastung zu erinnern. 2) Anhaltende Symptome (nicht vorhanden vor der Belastung) mit zwei der folgenden Merkmale: Schlafstörungen, Reizbarkeit/Wutausbrüche, Konzentrationsprobleme, Hypervigilanz, erhöhte Schreckhaftigkeit • Erlebnis eines Traumas, • Intrusionen, • Vermeidungsverhalten und allge­ meiner emotionaler Taubheitszustand, • anhaltendes physiologisches Hyperarousal, • die Symptome dauern länger als einen Monat. E: Die Kriterien B, C, D treten innerhalb von 6 Monaten nach dem Belastungsereignis oder nach Ende einer Belastungsperiode auf. In einigen Fällen kann ein späterer Beginn berücksichtigt werden, dies sollte aber gesondert angegeben werden Abb. 1 * Vortrag gehalten auf dem dreitägigen Fachseminar Posttraumatische Belastungsstörung vom 08.-10. Oktober 2001 in der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont. 13 Differentialdiagnostisch muß die Post­ traumatische Belastungsstörung von einer Reihe Störungen unterschieden werden, die z.T. verwandte Symptome aufweisen. Zu denken ist hierbei an alle › Arten depressiver Erkrankungen inklusive der Anpassungsstörungen, an die Gruppe der Angststörungen, die dissoziativen Störungen sowie die andauernde Per­ sönlichkeitsveränderung nach Extrembe­ Differentialdiagnosen Depressionen (F 32. 0 – F32. 8, F 33.0 – F33.9) Akute Belastungsreaktion (F43.0) Anpassungsstörung (F43.2) Dissoziative Störungen (F 44.0 – F 44.9) Andauernde Persönlichkeitsveränderung nach Extrembelastung (F 62.0) Trauerreaktion (normale Trauer als Z-Kodierung) Angststörungen organische Psychosyndrome Abb. 2 Menschlich verursachte Traumen („man made disasters“) • • • • • • • sexuelle/ körperliche Mißhandlungen in der Kindheit kriminelle und familiäre Gewalt Vergewaltigungen Kriegserlebnisse zivile Gewalterlebnisse (Geiselnahmen) Folter, politische Inhaftierung Massenvernichtung (KZ) Katastrophen, berufsbedingte und Unfalltraumen • Naturkatastrophen • technische Katastrophen • berufsbedingte z.B. Militär, Polizei, Feuerwehr • Arbeitsunfälle, Verkehrsunfälle nach Maercker, 1997 Abb. 3 Kurzdauernde traumatische Ereignisse (Typ I – Traumen) • • • • Naturkatastrophen Unfälle technische Katastrophen kriminelle Gewalterfahrungen Kennzeichen: akute Lebensgefahr, Plötzlichkeit, Überraschung lastung. Bis auf Letztgenannte erfüllen die anderen Störungen nicht das klini­ sche Vollbild gemäß der ICD-10 Kriterien, können aber vom klinischen Erschei­ nungsbild dem der Posttraumatischen Belastungsstörung ähneln. Für die Diag­ nose der Posttraumatischen Belastungs­ störung muß immer das Kriterium des Traumas erfüllt sein. Bei der Art des Traumas ist dabei zu berücksichtigen, dass tatsächlich das Argument der Schwere und Bedrohung ausführlich gewürdigt wird, in der Literatur finden sich z.T. auch Versuche, Erlebnisse wie partnerschaftliche Trennungen oder Arbeitsplatzverlust als Auslöser für eine Posttraumatische Belastungsstörung zu benennen. Ob diese Ereignisse das Kri­ terium einer Traumatisierung erfüllen, muß zumindest ausgiebig diskutiert werden. Eine Zusammenfassung der Differen­ tialdiagnosen finden sich in (Abb. 2.) In letzter Zeit finden sich Hinweise da­ rauf, dass es „die“ Posttraumatische Be­ lastungsstörung nicht gibt, sondern dass die Symptomatik deutlich variieren kann, abhängig von der Art des Traumas und dessen zeitlichen Verlaufes. Für die Symptomatik, die Prognose und die Therapie der Störung ist es durchaus bedeutsam, ob es sich etwa um einmali­ ge Unfallereignisse oder langjährige, menschlich verursachte Traumatisie­ rungen wie etwa andauernde sexuelle oder körperliche Mißhandlung in der Kindheit, politische Inhaftierung oder Kriegserlebnisse (sog. „man made disa­ sters“) handelt. Maercker (1997) schlägt deshalb eine Unterteilung in verschiede­ ne Dimensionen vor, die sowohl die Ur­ sache des Traumas als auch den zeit­ lichen Verlauf der Traumatisierung berücksichtigt. Er unterscheidet zwischen Traumen, die im Rahmen eines sozialen Kontextes verursacht sind, von Kata­ strophen, berufsbedingten und Unfall­ traumen (Abb. 3). Längerdauernde, wiederholte Traumen(Typ II – Traumen) • • • • • Vom zeitlichen Verlauf her unterscheidet er kurzdauernde traumatische Ereignisse und längerdauernde, wiederholte Trau­ men (s. Abb. 4). Geiselhaft mehrfache Folter Kriegsgefangenschaft KZ-Haft wiederholte Gewalterfahrungen in Form von Mißbrauch, Mißhandlung Kennzeichen: verschiedene Einzelereignisse, geringe Vorhersagbarkeit des weiteren Verlaufs nach Maercker, 1997 Abb. 4 14 Primäre Traumatisierung beschreibt das eigene Erleben eines Traumas, sekundäre Traumatisierung findet sich bei Be­ › Komplexe Posttraumatische Belastungstörung 1. Unterworfensein unter totalitäre Kontrolle über einen längeren Zeitraum (Monate bis Jahre) mit Beispielen wie Geiselhaft, Kriegsgefangenschaft, Überleben von Konzentrationslagern und einiger religiöser Kulte. Weitere Beispiele sind die Opfer totalitärer Systeme im sexuellen und familiären Bereich, wie Überlebende von familiärer Gewalt, Kindesmißhandlung, sexuel­ lem Kindesmißbrauch und organisierter sexueller Ausbeutung. 2. Veränderungen von Affektregulierung mit anhaltenden dysphorischen Verstimmungen, chronischer Beschäftigung mit Suizidideen, Neigung zu Selbstverletzungen, explosiver oder extrem unterdrückter Wut (ev. im Wechsel), zwanghafter oder extrem gehemmter Sexualität (ev. im Wechsel). 3. Veränderungen des Bewußtseins, wie Amnesie oder Hypermnesie für traumati­ sche Ereignisse, dissoziative Episoden, Depersonalisation/ Derealisation, Wiedererleben der traumatischen Erfahrungen entweder in Form intrusiver Symptome oder in Form von ständigem Grübeln. 4. Veränderungen des Selbstbildes mit Gefühlen von Hilflosigkeit und Initiativverlust; Scham, Schuldgefühlen und Selbstanklage; eigener Wertlosigkeit oder Stigmatisierung; Gefühl, völlig verschieden von anderen zu sein (etwas Besonderes beispielsweise, Erleben äußerster Einsamkeit, die Überzeugung, von niemandem verstanden werden zu können oder nicht menschlich zu sein). 5. Veränderungen in der Wahrnehmung des Täters, wie ständige Beschäftigung mit ihm (z.B. auch in Form von Rachegedanken); eine unrealistische Sichtweise des Täters als übermächtig (Vorsicht! Das Opfer kann die Macht des Täters unter Umständen realistischer einschätzen als der Therapeut!); Idealisierung des Täters oder paradoxe Dankbarkeit ihm gegenüber; das Gefühl einer besonderen oder übernatürlichen Beziehung zum Täter; Übernah­ me von Weltanschauung oder Rechtfertigungen des Täters. 6. Veränderung der sozialen Beziehungen mit Isolation und Rückzug, Abbruch von intimen Beziehungen, fortgesetzte Suche nach einem Retter (kann wech­ seln mit Isolation und Rückzug), ständigem Mißtrauen, wiederholtem Versagen beim Schutz der eigenen Person. 7. Veränderung von Stimmungslagen und Einstellungen wie Verlust von Zuversicht, Gefühle von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Herman, 1992, nach Fischer und Riedesser 1998 Abb. 5 obachtern von der Bedrohung, Verletzung oder Tötung Dritter, etwa bei Zeugen oder Helfern. In der Literatur werden ergänzend zur Posttraumatischen Belastungsstörung als Diagnose, wie sie derzeit im ICD-10 geführt wird, auch alternative diagnosti­ sche Konzepte diskutiert wie etwa das Victimisierungs-Syndrom nach Ochberg (1993) oder das komplexe psychotrauma­ tische Belastungssyndrom nach Herman (1992). Fischer und Riedesser (1998) schlagen vor, die heute bekannte Posttraumatische Belastungsstörung als basales psycho­ traumatisches Belastungssyndrom (bPTBS) zu bezeichnen, um damit die Möglichkeit zu haben, auch komplexere Störungsbilder aufbauend auf diesem basalen Syndrom zu beschreiben. Bereits im ICD-10 vorhanden ist die andauernde Persönlichkeitsveränderung nach Extrem­ belastung. Die komplexe Posttraumatische Belas­ tungsstörung (Abb. 5) nach Herman faßt die Symptomatik von Personen zusam­ men, die zusätzlich zur Symptomatik nach ICD-10 weitergehende Veränderungen erleben, das beschriebene Störungsbild findet sich häufig bei Typ IITraumatisierten. Zusätzliche Symptome in diesem Zusammenhang sind vor allen Dingen Veränderungen in der Affekt- und Impulsregulation, ausgeprägte dissoziati­ ve Tendenzen, ein deutlich beeinträchtig­ tes Identitätsgefühl, ausgeprägte interak­ tionelle Störungen, eine Revictimisierungsneigung sowie ein depressiv getönter allgemeiner Sinnverlust. Darüber hinaus neigen die betreffenden Patienten dazu, stark mit somatischen Symptomen zu reagieren. Das Victimisierungssyndrom nach Och­ berg (Abb. 6) beschreibt einige sympto­ matische Ergänzungen, die bei Patienten auftreten nach „man made disasters“, also für Menschen, die zwischenmen­ schliche Gewalterfahrungen gemacht haben. Hier finden sich vor allen Dingen Gefühle, täglichen Aufgaben und Ver­ pflichtungen nicht mehr gewachsen zu sein, dies auch über die traumatisierende Situation hinaus gehend, das Gefühl einer dauerhaften Beschädigung in der Inte­ grität der eigenen Person, Vertrauens­ verlust gegenüber anderen Menschen, eine reduzierte Fähigkeit im Umgang mit Ärger, die Tendenz, sich selber für den Vorfall als schuldig zu erleben sowie Ten­ denzen zur Täterschonung und Entschul­ digung. Die andauernde Persönlichkeitsverände­ rung nach Extrembelastung (Abb. 7) beschreibt ein Störungsbild, das auch Aspekte interaktioneller Veränderungen nach einer Traumatisierung berücksich­ tigt. Hier sind insbesondere zu nennen eine feindliche und mißtrauische Haltung der Welt gegenüber, sozialer Rückzug, Gefühle der Leere oder Hoffnungslosig­ keit, ein chronisches Gefühl von Nervo­ sität wie bei ständigem Bedrohtsein, Entfremdung. Bzgl. des Kriteriums der Traumatisierung wird eine so extreme Belastung gefordert, dass die Vulnerabilität der betreffenden Person als Erklärung für die tiefgreifende Auswirkung auf die Persönlichkeit nicht ausreicht. Beispiele werden genannt: Erlebnisse in einem Konzentrationslager, Folter, Katastrophen, langjährige Geisel­ haft oder Gefangenschaft mit drohender Todesgefahr. Die andauernde Persönlich­ keitsveränderung nach Extrembelastung kann einer Posttraumatischen Belas­ tungsstörung zeitlich folgen, kann aber auch ohne diese auftreten. Kurzzeitige Lebensbedrohungen wie etwa bei einem 15 › Victimisierungsyndrom nach Ochberg A. Die Erfahrung einer oder mehrerer Episoden von psychischer Gewalt oder psy­ chischem Mißbrauch oder Nötigung zu sexueller Aktivität, dies entweder als Opfer oder als Zeuge. B. Die Entwicklung von mindestens x (Anzahl muß noch festgelegt werden) der folgenden Symptome (nicht vorhanden vor der Victimisierungserfahrung): 1. Ein Gefühl, den täglichen Aufgaben und Verpflichtungen nicht mehr gewachsen zu sein, welches über das Erlebnis von Ohnmacht in der spezi­ ellen traumatischen Situation hinausgeht (z.B. allgemeine Passivität, mangelnde Selbstbehauptung, oder fehlendes Vertrauen in die eigene Urteilsfähigkeit). 2. Die Überzeugung, dass man durch die Victimisierungserfahrung dauerhaft beschädigt ist (z.b. wenn ein mißbrauchtes Kind oder ein Opfer von Vergewaltigung der Überzeugung ist, dass es für andere nie mehr attraktiv sein kann). 3. Gefühle von Isolation, Unfähigkeit, anderen zu vertrauen oder mit ihnen Intimität herzustellen. 4. Übermäßige Unterdrückung oder exzessiver Ausdruck von Ärger. 5. Angemessene Bagatellisierung von zugefügten (psychischen oder physi­ schen) Verletzungen. 6. Amnesie des traumatischen Erlebnisses. 7. Die Überzeugung des Opfers, an dem Vorfall eher die Schuld zu tragen als der Täter. Autounfall würden die genannten Krite­ rien der Traumatisierung nicht erfüllen, da in diesem Zusammenhang von einer vorbestehenden psychischen Vulnerabi­ lität ausgegangen werden muß. Abschließend bleibt noch zu bemerken, dass – eigentlich eine Selbstverständ­ lichkeit – auch bei der Posttraumatischen Belastungsstörung ein sauberes diagnos­ tisches und differentialdiagnostisches Vorgehen gefordert ist. Leider können in der klinischen Praxis zwei Beobachtungen immer wieder gemacht werden: Das Vorhandensein eines Traumas führt zu einer automatischen Vergabe der Diagnose PTSD, auch wenn die geforder­ ten Symptome nach ICD 10 nicht vorlie­ gen. Deshalb soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass nach einer Traumatisierung auch eine Depression, Ängste oder andere Störungsbilder auf­ treten können. 8. Eine Neigung, sich der traumatischen Erfahrung erneut auszusetzen. 9. Übernahme des verzerrten Weltbildes des Täters in der Einschätzung von sozial angemessenem Verhalten (z.B. die Annahme, dass es in Ordnung ist, wenn Eltern sexuelle Beziehungen zu ihren Kindern unterhalten oder dass es in Ordnung ist, wenn ein Ehemann seine Kinder schlägt, damit sie gehorchen). 10. Idealisierung des Täters. C. Dauer des Syndroms von mindestens einem Monat. Ochberg, 1993, nach Fischer und Riedesser 1998 Abb. 6 › Andauernde Persönlichkeitsveränderung nach Extrembelastung (F 62.0) Die Persönlichkeitsänderung muß andauernd sein und sich in unflexiblem und unangepaßtem Verhalten äußern, das zu Beeinträchtigungen in zwischenmensch­ lichen, sozialen und beruflichen Beziehungen führt. Die Persönlichkeitsänderung sollte fremdanamnestisch bestätigt werden. Zur Diagnosestellung müssen folgende, bei dem Betroffenen zuvor nicht beob­ achtete Merkmale vorliegen: 1. 2. 3. 4. 5. Eine feindliche oder mißtrauische Haltung der Welt gegenüber. Sozialer Rückzug. Gefühle der Leere oder Hoffnungslosigkeit. Ein chronisches Gefühl von Nervosität wie bei ständigem Bedrohtsein. Entfremdung. Die Persönlichkeitsänderung muß über mindestens 2 Jahre bestehen und nicht auf eine vorher bestehende Persönlichkeitsstörung oder auf eine andere psychi­ sche Störung außer einer Posttraumatischen Belastungsstörung zurückzuführen sein. Eine schwere Schädigung oder Krankheit des Gehirns, die gleiche klinische Bilder verursachen können, muß ausgeschlossen werden. Abb. 7 16 Zum anderen hat man manchmal das Gefühl, dass dissoziative Symptome, Alp­ träume und ängstliches Verhalten gerade bei weiblichen Patientinnen zu einer Schlussfolgerung verleiten, dass etwa frühkindlicher Mißbrauch und/ oder Ge­ walterfahrung vorliegen müssen, ohne dass die Patientin von sich aus solche Erlebnisse anspricht. Hier wird aber mög­ licherweise eine Hypothese verfolgt, die für die Patienten mehr Schaden als Nutzen bringt, wenn sie aktiv exploriert wird. › Literatur Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlicher Medizinischer Fachgesellschaften: Leitlinie Posttraumatische Belastungsstörung, AWMF online, AWMF-Leitlinien-Register 051/010 Entwicklungsstufe 1 + IDA, im Internet: http://www.uni-duesseldorf.de/awmf/ Bauer, M.; Priebe, S.: Psychopharmakotherapie. in: Maercker, A. (a.a.O) Dreßing, H., Berger, M. (1991). Posttraumatische Streßerkrankungen, Nervenarzt, 62, 16 – 26 Ehlers, A. (1999). Posttraumatische Belastungsstörung, Göttingen: Hogrefe Fischer, G.; Riedesser, P.( 1998). Lehrbuch der Psychotraumatologie München: Reinhardt-Verlag Frommberger, U.; Angenendt, J.; Nyberg, E.; Anders, B.; Berger, M. (1999) Differentialindikation therapeutischer Verfahren bei der PTBS, psycho, 25, 458 – 462 Herman, J. L. (1992): Trauma and Recovery. Basic Books, New York Maercker, A. (Hrsg.) (1997). Therapie der Posttraumatischen Belastungsstörung; Berlin Heidelberg: Springer Ochberg, F. M. (1993): Posttraumatic therapy. In: Wilson, J.P., Raphael, B.(Hrsg): International handbook of traumatic stress syndroms. New York : Plenum Press Saigh, P.A. (Hrsg.)(1995): Posttraumatische Belastungsstörung. Bern: Huber 17 Historischer Abriss der Psychotraumatologie – eine Geschichte der Kriegstraumatisierungen Jürgen Ph. Furtwängler Kurzfassung Die Geschichte der Psychotraumatologie ist auch eine Geschichte der Kriege des 19. und 20. Jahrhunderts mit ihren verheerenden Auswirkungen. Die Wandlungen der klinischen Erscheinungsbilder bei Soldaten vom shell-shock und den Kriegszitterern des 1. Weltkrieges über Psychosomatisierungen und verdrängte Psychotraumata im 2. Weltkrieg bis hin zu den Posttraumatischen Belastungsstörungen der Vietnam-Veteranen und den psychischen Folgen des Golfkrieges werden dargestellt und diskutiert. Einleitung Die Möglichkeit des Menschen, auf extrem bedrohliche Ereignisse in der Art und Weise zu reagieren, die wir heute als „traumatisch“ oder „posttraumatisch“ bezeichnen, dürfte entwicklungsge­ schichtlich mit zum ältesten Erbe in unserem Verhaltensrepertoire gehören. Dabei haben wir von unseren früh­ menschlichen Vorfahren an erster Stelle nicht etwa einfach Angst – z. B. vor irgendwelchen menschenfressenden Raubtieren – geerbt, sondern überhaupt „die Fähigkeit, schnell und nachhaltig Angst vor ihnen zu entwickeln“ (Ehrenreich, 1999). Ehrenreich vertritt recht plausibel die Hypothese, dass unse­ re Vorfahren, ehe sie sich in die Lage ver­ setzen konnten, als Jäger Beute zu machen, selber vorzugsweise gejagte Beute ihnen weit überlegener Raubtiere waren. „Wir, die wir heute leben, sind die Nach­ fahren derjenigen Frühmenschen (sog. ,Homoniden’), die angesichts der Gewalt reflexartig reagierten, sei es durch Flucht, sei es durch gemeinsame Verteidigung. Deswegen kann auch in unserer weitge­ hend raubtierfreien modernen Lebens­ welt der Anblick von Blutvergießen die Flucht- oder Kampf-Reaktion, bzw. sowohl physiologische als auch unphy­ siologische Varianten dieses Reaktions­ musters auslösen: Herzschlag und Atem­ frequenz beschleunigen sich, die Haut wird blasser und die Eingeweide ziehen sich zusammen. Wir sind angespannt und wachsam.“ Wir kennen diese und weitere Reaktionen als die klassischen Stress-Symptome. Die einzige Art und Weise, Stress zu charak­ terisieren, schreibt der Begründer der Stress-Forschung Hans Selye, besteht darin: ihn als nichtspezifische Reaktion des Körpers auf jede beliebige Art von Anforderung zu bezeichnen [...] Man soll­ te und kann Stress nicht vermeiden; ihn total auszuschalten, würde bedeuten, das Leben selbst zu zerstören. Wenn man keine Anforderungen an seinen Körper stellt, ist man tot.“ Unabhängig davon, von welchem Standpunkt aus man die hier ins Auge zu fassenden Verhaltensmuster betrachtet, ob unter der „Opfer-Perspektive“ („Distress“) oder unter der Perspektive von Steigerungsmöglichkeiten der menschlichen Lebensqualität („Eustress“), dürften die Muster von Herausforderung, Trauma und Bewältigung die gesamte Menschheitsgeschichte in immer neuen Erscheinungsformen begleitet, ja in ihren Erfolgen und Fehlschlägen sogar bestimmt haben. „Achill in Vietnam“ Jonathan Shay hat wichtige Einsichten für seine Arbeit als Psychiater für eine Gruppe amerikanischer Veteranen mit Kampferfahrungen im Vietnamkrieg, die an schweren posttraumatischen Per­ sönlichkeitsstörungen (PTSD) leiden, aus Homers Ilias bezogen. Dabei ergaben sich über die gängige Betrachtungsweise 19 posttraumatischer Störungen hinaus zwei „innovative Konzepte, die in Fachkreisen noch nicht allgemein akzeptiert sind, was etwa die Bedeutung des Berserkertums oder den Verrat an dem betrifft, was (für das Verständnis von Soldaten) Recht ist, im Rahmen der Ätiologie der chronischen posttraumatischen Belastungsstörung nach dem Kampfeinsatz“ (Shay, 1998). Shay orientierte sich in seinen Betrach­ tungen sehr dicht an Homers Schilderung der Geschichte des Achill: „Agamemnon, der Befehlshaber des Achill, verrät „alles, was recht ist“, indem er unrechtmäßiger­ weise dessen Preis der Ehre an sich reißt; indignierter Zorn verengt den gesell­ schaftlichen und moralischen Horizont des Achill, bis er sich schließlich nur noch für die kleine Gruppe seiner bewährten Kampfgenossen interessiert; sein engster Freund in diesem Kreis, sein militärischer Stellvertreter und Adoptivbruder Patroklos, fällt im Kampf; tiefe Trauer und Selbstmordverlangen nehmen von Achill Besitz; er hat das Gefühl, bereits tot zu sein; er ist von Schuldgefühlen gequält und davon über­ zeugt, dass besser er anstelle seines Freundes hätte sterben sollen; er strebt nicht mehr danach, in die Heimat zurückzukehren; er wird zum Berserker und verübt Schandtaten gegen Lebende und Tote“ Dies sei die wirkliche Geschichte des Achill in der Ilias und nicht eine meta­ phorische Übersetzung. Ebendiese Geschichte aber hätten auch viele Frontveteranen erlebt, sei es in Vietnam, sei es in anderen lang währenden Kriegen. Obwohl nun die atavistischen Reaktions­ muster, mit denen der Mensch auf extre­ me Belastung und gewaltsame Überfor­ derung reagiert, einerseits in ihren phy­ siologischen und psychologischen Grund­ zügen (u. a. entwicklungsgeschichtlich bedingt) durch unterschiedliche zeitliche Epochen hindurch und quer durch die unterschiedlichsten Kulturen anthropolo­ gisch ein hohes Maß an Übereinstim­ mung aufweisen, so verschieden haben sie sich im Laufe der Menschheits­ geschichte gerade unter kriegerischen Bedingungen dargestellt. Es scheint näm­ lich eine pathoplastisch höchst präge­ wirksame Wechselbeziehung zwischen 20 den sozio-kulturellen Lebensbedingungen des Menschen – nicht zuletzt verankert in bestimmten Vorstellungen einer Gesellschaft davon, wie sich der Einzelne aufzuführen hat, was er darf und was nicht – und der Art und Weise, in der er speziell psychosomatische Krank­ heitsbilder hervorbringt, zu bestehen. Besonders für den Verlauf posttraumati­ scher Belastungsstörungen ist die Art und Weise, wie man damit umgeht, von ausschlaggebender Bedeutung. Jonathan Shay vertritt dazu die aus seiner Arbeit mit den Vietnamveteranen abgeleitete These: „Moralische Verletzungen stellen einen Kernbestandteil eines jeden Fronttraumas dar, das zu einer lebenslangen psychi­ schen Schädigung führt. Gewöhnlich können sich Veteranen von Schrecken, Furcht und Trauer erholen, wenn sie ins Zivilleben zurückkehren, es sei denn, zusätzlich wurde auch noch gegen „das, was recht ist“ verstoßen“. Solche Verstöße können sowohl aus Er­ fahrungen der Soldaten während des Einsatzes als auch danach resultieren, nicht zuletzt, wenn es beispielsweise um die Durchsetzung ihrer Entschädigungs­ ansprüche für die empfangenen seeli­ schen Verletzungen geht. Wenn die Ideale, die der Soldat davon hegt, „was recht ist“, plötzlich nicht mehr mit dem übereinstimmen, was davon gesellschaft­ lich gang und gäbe ist, steigert das die psychische Vulnerabilität des Soldaten ganz außerordentlich, weil er sich von der Gesellschaft, für deren Interessen er in den Krieg gezogen ist, im Stich gelas­ sen, ja verraten fühlt. Viele Veteranen vertreten (nach J. Shay) eine „Dolchstoßlegende“, ähnlich der, die deutsche Kriegsteilnehmer nach dem Ersten Weltkrieg vertraten – danach wäre der Krieg leicht zu gewinnen (und ein Trauma zu vermeiden) gewesen, hät­ ten die Fronttruppen sich nicht von Politikern an der Heimatfront verraten fühlen müssen. Diese Wechselwirkung zwischen Umge­ bung und den (gesundheitlichen) Proble­ men des Individuums ist auch den ameri­ kanischen Militärpsychiatern Ingraham und Manning aufgefallen, die festgestellt haben, dass der seelische Zusammen­ bruch von Soldaten eigentlich eine Art von „Berufskrankheit“ sei, die typisch für eine ganz bestimmte Umgebung ist, nämlich für den Krieg. Wie diese Ausfallserscheinungen dann aussehen, hänge von zweierlei ab: von der „Natur des Krieges“ – also von der Art der Kriegsführung – und davon, wie man mit solchen Ausfällen verfahre (Ingraham und Manning, 1980). Jeder Krieg erzeugt, vereinfacht gesagt, sein traumatisches Syndrom (z.B.: Gulf-War-Syndrom). Verhältnisse in den deutschen Streitkräften während des Ersten und Zweiten Weltkrieges Der Einfluß sozio-kultureller Faktoren auf die Ausgestaltung psychosomatischer Leiden (Shorter, 1994) dürfte jedenfalls maßgeblich dafür verantwortlich sein, dass bei aller Ähnlichkeit in den anthro­ pologischen Grundmustern traumatischer Reaktionen deren Erscheinungsformen und vor allem ihre Bewertung zu unter­ schiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Kulturen und Kriegen nicht unerheblich variierten. Wenn sich beispielsweise in der neueren Kriegsgeschichte trauma­ tisch bedingte Ausfälle bei deutschen Soldaten des Ersten und des Zweiten Weltkrieges, sowie deren militärpsychia­ trische Bewertung und Behandlung von den Verhältnissen in anderen Armeen zumindest teilweise unterschieden haben, dann sind diese Unterschiede in erster Linie durch die unterschiedlichen sozio-kulturellen Bedingungen zu erklären, unter denen die Kriegsteil­ nehmer jeweils angetreten waren und weniger als Ausdruck eines immer wieder ominös beschworenen „deutschen Sonderweges“. Solche Mutmaßungen über Besonder­ heiten in der psychischen Konstitution des deutschen Soldaten reichten bis hin zu der lange Zeit ernsthaft vertretenen Auffassung, seitens deutscher Soldaten habe es während des Zweiten Welt­ krieges – anders als im Ersten Weltkrieg – so gut wie gar keine psychischen Ausfälle gegeben. Nun kann es nicht Sache dieser kurzen essayistischen Betrachtung sein, detaillierte Infor­ mationen im Sinne einer umfassenderen Studie psychisch bedingter Ausfälle vorzulegen. Deswegen sei der Anschau­ lichkeit halber an dieser Stelle einmal auf die Erinnerungen zweier berühmter deutscher Nervenärzte aus der Zeit des Ersten Weltkrieges zurückgegriffen. Max Nonne aus Hamburg erinnert sich unter der Überschrift: „Kriegsneurosen“ (Nonne,1971): Der Krieg brachte uns in Eppendorf gewaltige Arbeit. Wir bekamen bald traurige Bilder zu sehen von Amputier­ ten, von durch Kopfschüsse halbseitig Gelähmten, von durch Rückenmarkschüsse an beiden Beinen, an Blase und Mastdarm Gelähmten, Epileptiker, die durch Kopfschüsse Anfälle bekommen hatten. Aber schon nach wenigen Monaten zeigte sich bei uns ein Bild, das wir früher nur ganz selten gesehen hat­ ten – das Bild der Hysteria virilis, der „männlichen Hysterie“. Es war ein solches Bild schon von Charcot in Paris gezeich­ net worden. Wir hatten damals gesagt: „So etwas kommt nur bei den Franzosen vor, in Deutschland gibt es keine Hysterie der Männer“. Jetzt sahen wir sie oft und in allen Formen. Als Stimmbandlähmung, als Stummheit, als Lähmung der oberen und unteren Extremitäten, als Zittern in den verschiedensten Formen, als Verkrampfung der einzelnen Muskeln und Muskelgruppen, als Taubheit, als Seh­ und Gehstörungen, als Verrenkungen in den vertracktesten Formen.... Auch der berühmte Münchner Psychiater Emil Kraepelin war vom Reichsausschuss für Kriegsbeschädigtenfürsorge zur Mitarbeit aufgefordert worden. Kraepelin erinnert sich wie folgt (Kraepelin, 1983): Schon damals tauchte die Frage der Kriegsneurosen auf. Wir Irrenärzte waren alle einig in dem Bestreben, der freigiebi­ gen Rentengewährung entgegenzuwir­ ken, weil wir dadurch ein rasches Anwachsen der Krankheitsfälle und der Ansprüche fürchteten. Trotzdem ließ sich das Unheil nicht verhüten. Namentlich, als mit der längeren Dauer des Krieges immer mehr auch minderwertige Persönlichkeiten in das Heer eingestellt werden mussten und die allgemeine Kriegsmüdigkeit zunahm, wirkte die Tatsache verhängnisvoll, dass allerlei mehr oder weniger ausgeprägte nervöse Krankheitserscheinungen nicht nur die langfristige Überführung in ein Lazarett, sondern auch die Entlassung aus dem Heeresdienst mit reichlich bemessener Rente herbeiführen konnten. Dazu kam das öffentliche Mitleid mit den an­ scheinend schwer geschädigten Kriegszitterern, die auf den Strassen die allge­ meine Aufmerksamkeit auf sich zogen und reichlich beschenkt zu werden pfleg­ ten. Wie eine Flutwelle verbreitete sich unter diesen Umständen die Zahl derer, die durch einen „Nervenschock“, beson­ ders aber durch „Verschüttung“ das Anrecht auf Entlassung und weitere Versorgung erworben zu haben glaubten... Diese beiden authentischen Zitate lassen einige wesentliche psychotraumatologi­ sche Aspekte erkennen. So wird deutlich, dass die Kampfreaktionen der Soldaten durchaus als psychogen erkannt wurden, obwohl seinerzeit in der (deutschen) Medizin und Nervenheilkunde grundsätzlich eine organische Orientierung vorherrschte. So schreibt der im Ersten Weltkriege gefallene Nervenarzt Dr. Ludwig Scholz in seinen Aufzeichnungen „Seelenleben des Soldaten an der Front“ (Scholz, 1920): „Alle diese eigenartigen Symptome beru­ hen [...] nicht auf organischen Schädigungen des Nervenapparates, wie die Patienten (und anfangs übrigens auch die Ärzte – J.Ph.F.) meist steif und fest glauben, sondern sie sind seelischen Ur­ sprungs, und zwar gewöhnlich unbe­ wußte Produkte der Angst, unter der die Kranken leiden“. Freilich erfuhren diese seelisch verursachten Symptome und ihre Träger, wie sich unschwer aus Kraepelins Aufzeich­ nungen herauslesen läßt, eine für das heutige Empfinden recht problematische Bewertung, wenn da von „minderwerti­ gen Persönlichkeiten“ die Rede ist, die offensichtlich nur darauf aus wären, sich „das Anrecht auf Entlassung und weitere Versorgung erworben zu haben“. Auch Ludwig äußert sich zu diesen Aspekten: „Die psychologische Erklärung liegt in folgendem: Der Kranke hat dank dem erlittenen großen Schrecken eine begreifliche Abneigung gegen die Front bekommen. Die Folge davon: er möchte heraus, fort, möglichst für immer! Wie soll er das anfangen? Einfach: er ergreift, freilich nur bildlich gesprochen, die Flucht, indem er sich vor unbequemen Zumutungen, denen er sich auch innerlich nicht mehr gewachsen fühlt, in den Hafen einer Krankheit rettet. Damit weiß er sich geborgen, – für seine Leiden ,kann er nichts‘, er ist eben krank und niemand wird ihm hieraus einen Strick drehen. Also er simuliert, er schwindelt? Keineswegs. Seine Zuckungen, Läh­ mungen usw. übertreibt er vielleicht ein bißchen, im übrigen aber sind sie echt [...] Ein täuschendes Kleid, eben die Krankheit, hüllt die Furcht und Unlust ein, und der Hysteriker schauspielert vor sich selbst, ohne eine Ahnung davon zu haben, – er ist ein betrogener Betrüger...“ Die aus den hier angeführten Zitaten erkennbare Haltung gegenüber psychoso­ matischen Störungen im Allgemeinen und gegenüber Kampftraumata im Besonderen hat sich in der deutschen Militärpsychiatrie vor allem bei den bera­ tenden Psychiatern des deutschen Heeres 1939 bis 1945 (und nebenbei bemerkt im Entschädigungswesen bis auf den heuti­ gen Tag) im Großen und Ganzen fortge­ setzt, wobei für die Verhältnisse in der Wehrmacht zu berücksichtigen ist, dass aus der dort praktizierten Psychiatrie Einflüsse der Freud`schen Lehre ja wei­ testgehend ausgeklammert blieben. Selbst da, wo während des Zweiten Weltkrieges bei deutschen Soldaten versucht wurde, psychogenen Reaktionen ansatzweise gesprächstherapeutisch abzuhelfen, wurden einem Bericht von Schott (Berger, 1998) dem Soldaten drei – fatale – Alternativen „angeboten“: „Wahrscheinlich sei seine Krankheit eine leichte nervöse Störung, die sich schnell bessern werde. Sei dies nicht der Fall, kämen folgende ,Differentialdiagnosen’ in Frage: Es handele sich um einen ,Schlechtwilligen’, der strafrechtlich ver­ folgt werden müßte, oder um einen ,Geisteskranken’, der in ,dauernde Irrenanstaltsverwahrung‘ gehöre ...“ Dieses kurze Zitat mag belegen, dass „psychogene Reaktionen“ auch bei den Soldaten der Wehrmacht während des Zweiten Weltkrieges vor allem gegen Kriegsende, eine nicht unbedeutende 21 Rolle spielten, deren Erfassung und wissenschaftliche Bewertung nach heutigen Kriterien sich allerdings als äußerst schwierig erweist, wie Georg Berger in seiner vorzüglichen Studie über: „Die beratenden Psychiater des deutschen Heeres 1939 bis 1945“ herausgearbeitet hat. Diese Studie kann jedem, der sich sachlich, also frei von ideologischen Tendenzen, über die deutsche Militärpsychiatrie im Zweiten Weltkrieg informieren will, bestens empfohlen wer­ den. Im Übrigen ist auf die durchaus fun­ dierten, dabei indessen mit plakativen Titeln wie: „Aufrüstung der Seelen“ und: „Maschinengewehre hinter der Front“ sozialkritischen Arbeiten von Peter Riedesser und Axel Verderber hinzuwei­ sen (Riedesser & Verderber, 1985; Riedesser & Verderber, 1996). Auf dem Weg zur posttraumatischen Belastungsstörung – Verhältnisse in der Bundeswehr Unter dem Primat einer Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die sich in der Zeit des sog. „Kalten Krieges“ ganz und gar dem Gedanken der Abschreckung ver­ schrieben hatte, war in der Phase der Aufstellung der Bundeswehr und darüber hinaus bis in die achtziger Jahre der Gedanke an den unmittelbaren Einsatz deutscher Streitkräfte und die damit auch im Bereich der Militärpsychiatrie zu gewärtigenden Weiterungen gegenüber der frie­ densmäßigen Versorgung der Soldaten in den Hintergrund getreten. Soweit Aspekte einer einsatzbezogenen Militärpsychiatrie maßgeblich z. B. von Rudolf Brickenstein zur Diskussion gestellt wurden, stand im Mittelpunkt der entsprechenden Überle­ gungen, die sich im übrigen hauptsächlich auf WK-II-Erfahrungen stützten, der Begriff der „Panik“. Modernere, aus dem internationalen Kontext bezogene Konzepte begannen › sich in der Bundeswehr nicht zuletzt unter Federführung der Inneren Führung von Anfang der achtziger Jahre an zu etablie­ ren. In diesem Zusammenhang sei an die Führungshilfe: „Menschenführung unter Extrembelastung“ erinnert. Diese Konzepte orientierten sich überwiegend an der Stresstheorie und bezogen moderne psy­ chologische und psychotherapeutische Überlegungen bereits mit ein, die sich nunmehr auf Erfahrungen im Korea- und Vietnamkrieg und vor allem auf Israelische Erfahrungen stützten. Der entscheidende Anstoß dazu, schließ­ lich im Anschluß an die internationalen Gepflogenheiten und Klassifikationen das Konzept der posttraumatischen Belas­ tungsstörungen in der Militärpsychiatrie und Psychologie der Bundeswehr zu eta­ blieren, resultierte aus der neueren Auftragslage und den damit verbundenen Einsätzen der Streitkräfte. Über die Moda­ litäten und den Sachstand der militärpsychiatrischen und psychologischen Konzeptualisierung von Maßnahmen zur Betreuung traumatisierter Soldaten geben die nachstehenden Beiträge Auskunft. Literatur Berger, G. (1998). Die beratenden Psychiater des deutschen Heeres 1939 bis 1945. Frankfurt am Main: Peter Lang Ehrenreich, B.(1999). Blutrituale – Ursprung und Geschichte der Lust am Krieg. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag. Ingraham, L.H. & Manning, F.J (1980). Psychiatric Battle Casualties: The Missing Column in a War Without Replacement, Military Review, Aug. 1980, page 20 ff. Kraepelin, E. (1983). Lebenserinnerungen. Berlin: Springer-Verlag. Nonne, M. (1971). Anfang und Ziel meines Lebens – Erinnerungen. Hamburg: Hans Christians Verlag. Riedesser, P. & Verderber, A. (1985). Aufrüstung der Seelen – Militärpsychiatrie und Militärpsychologie in Deutschland und Amerika. Freiburg im Breisgau: Dreisam-Verlag. Riedesser, P. & Verderber, A. (1996) Maschinengewehre hinter der Front – Zur Geschichte der deutschen Militärpsychiatrie. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. Scholz, L. (1920). Seelenleben des Soldaten an der Front. Tübingen: Paul Siebeck. Shay, J. (1998). Achill in Vietnam – Kampftrauma und Persönlichkeitsverlust. Hamburg: Hamburger Edition. Shorter, E. (1994). Moderne Leiden – Zur Geschichte der psychosomatischen Krankheiten. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag. 22 Combat Stress und seine kurz- und langfristigen Folgen* Rolf Meermann Kurzfassung Ausgehend von den Erkenntnissen der Verhaltensforschung (Ethologie) und der Psychobiologie kann Combat Stress als Streßreiz (Stressor, Streßauslöser) beschrieben werden, welcher in Abhängigkeit von biologischem Programm des Organismus und subjektiver individueller Bewertung eine Streßreaktion hervorrufen kann. Abhängig von z.B. Dauer und Intensität des Traumas, aber auch getriggert durch z.B. Primärpersönlichkeit, Komorbiditäten und Verlaufsfaktoren können gesundheitliche Folgeschäden (acute stress disorders, generalisierte Angststörung, sonstige psychiatrische oder psychosomatische Störungen) ebenso auftreten wie langfristige Gesundheitsbeeinträchtigungen (PTSD, Leistungsminderung, Arbeitsplatzverlust, Berentung). Die Streßreaktion stellt eine ursprünglich biologisch sinnvolle Coping- bzw. Überlebensstrategie auf außergewöhnliche bzw. bedrohliche Signale oder Situationen dar. Streßbedingte Krankheitsfolgen lassen sich am besten im Rahmen eines bio-psycho-sozialen Krankheitsmodells beschreiben. Verhaltensmedizinische (verhaltenstherapeutische) Behandlungsansätze sind gut geeignet zur Prävention und Therapie von Streßfolgeschäden. „We don’t want any damned psychiatrists making our boys sick“ US General, 1944 zit. n. Shephard (2000) In diesem Grundsatzreferat will ich mich bemühen, einige begrifflich-definitori­ sche Klärungen zum Thema Streß bei militärischen Einsätzen vorzunehmen. › Biopsychosoziales Krankheitsmodell • Biologie, Humanmedizin, Genetik, Endokrinologie, Ethologie • Psychiatrie, Psychologie • Sozialmedizin Hier gibt es in der wissenschaftlichen Literatur und vor allem auch in der Laienpresse bisweilen Unschärfen, insbe­ sondere zwischen den Begrifflichkeiten Streß bzw. Streßreaktion. Die Tatsache, dass psychiatrisch-psychologische Aspekte im Rahmen der (militärischen) Einsatzmedizin in der BRD Beachtung finden, ist ja relativ neu und Sie sehen am Eingangszitat, welche Schwierig­ keiten nach wie vor bestehen, wenn Fachleute des nervenheilkundlichen Gebietes militärische Phänomene kom­ mentieren. Die Doppeldeutigkeit oder wenn Sie so wollen die hohe Ambivalenz der Aussage spricht für sich. Wenn wir über das Phänomen Streß bzw. Streßreaktion (incl. Combat Stress) reden, dann immer nur im konzeptionellen Rah­ men des biopsychosozialen Krankheits­ modells (Abb. 1) (Meermann, 1998). Neben (1) Erkenntnissen der Biologie, Körper­ medizin, Genetik, PsychoneuroEndokrinologie und PsychoneuroImmunologie sowie der vergleichen­ den Verhaltensforschung (Ethologie) müssen (2) an zweiter Stelle die Erkenntnisse der Psychiatrie und Psychologie sowie (3) sozialmedizinische Aspekte Berücksichtigung finden. Medizin ohne Psychologie bzw. Psychologie ohne Medizin sind Konzepte ohne Zukunft. Sozialmedizin bedeutet u.a., dass menschliches Erleben und Verhalten moderiert wird durch gesell­ schaftliche Einflüsse wie Werte und Normen, durch Ideologien oder auch durch Fanatismus. Abb. 1 * Vortrag gehalten auf dem dreitägigen Fachseminar Posttraumatische Belastungsstörung vom 08.-10. Oktober 2001 in der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont. 23 › Combat Stress Combat Stress Soldiers heart (DA COSTA 1871) Herzneurose Effort-Syndrom (LEWIS 1917) GOK Irritable Heart Syndrome Shell Shok Kriegszitterer Granatschock Abb. 2 Zum Begriff Combat Stress (Abb. 2): Combat Stress ist ein buntschillernder Begriff, der in der medizinischen Literatur spätestens seit dem Sezessionskrieg (1861-65) eine Rolle spielt. Da Costa (1871) hat als Arzt Soldaten im Amerikanischen Bürgerkrieg untersucht und psychovegetative Symptome und Beschwerden bei seinen › Soldaten beschrieben, die wir heute (ohne organpathologisches Korrelat) am ehesten dem Formenkreis der Herzneu­ rose bzw. Angststörung zuordnen. In der Deutschen Literatur finden sich Begriffe wie Kriegszitterer oder Neurasthenie. Lewis hat 1917 amerikanische Soldaten in Europa im 1. Weltkrieg untersucht, von ihm stammt der Begriff des EffortSyndroms, also Erschöpfungssyndroms. Die Sanitäter, welche Soldaten nach Verschüttungen oder Granateinwirkungen in den rückwärtigen Linien primär versor­ gen mußten, haben an die Verwundeten kleine Kärtchen geheftet mit einer Be­ handlungsdiagnose. Neben den Statis­ tiken über die Anzahl der Brandverletzten und der chirurgisch versorgungspflichtigen oder erblindeten Patienten findet sich bei manchen dieser Karten die Diagnose GOK („God only knows“). Dies zeigt Ihnen das mangelnde professionelle Verständnis für die bizarren psychiatrischen Krankheits­ bilder, die unter menschlichen Extrem­ belastungen, unter maximaler Todesangst entstehen können (Shephard 2000). Symptomwandel im traumatischen Prozeß Trauma Wir unterscheiden in der Streßforschung 3 Ansätze (Nitsch 1981): a) die Beschreibung der Streßauslöser, Stressoren oder Streßreize, b) die Streßreaktion als solche und c) die subjektive Bewertung und Verarbeitung der Streßreize, welche zur Streßreaktion führen. (a) Der Begriff Streß stammt ursprünglich aus der Materialforschung und be­ schreibt so etwas wie Belastbarkeit oder Reißfestigkeit von technischen Produkten. Neben der Qualität sind sicherlich Dauer und Intensität von Streßreizen Bedingungen, um die Reizschwelle zum Auslösen der Streß­ reaktion zu überschreiten bzw. die genannten Variablen moderieren das Ausmaß einer Streßreaktion. (b) Der 2. Ansatz bezieht sich auf die Streßreaktion im engeren Sinne, d.h. auf das, was im Erleben des Men­ schen, im Körper und auf der direkt beobachtbaren Verhaltensebene abläuft (Selye 1974). Aus verhaltens­ analytischer Sicht werden 4 Beschrei­ bungsebenen der Streßreaktion unter­ schieden: „Zuviel“-Symptomatik • • • • Alkohol/ Drogen traumatische Flashbacks/Alpträume Reaktion 10.1 43.1 Irritierbarkeit Überregung Depressive Reaktion Ängste / Panik Vermeidung 62.0 43.21 sozialer Rückzug Kognitive Ebene Emotionale Ebene Physiologische Ebene Verhaltensebene Ärgerausbrüche 43.0 Depression Dissoziation 44.8 Verlust der Zukunftsperspektive Dissoziation „Zuwenig“-Symptomatik 43.0 akute Belastungsreaktion 43.1 PTBS 44.8 Dissoziative Identitätsstörung 43.21 depressive Reaktion (Anpassungsstörung) 62.0 Persönlichkeitsveränderung nach Extremtraumatisierung 10.1 Sucht (Alkohol) (nach: Post et al. 1997) Abb. 3 24 Zum Begriff Streß: (c) Ein 3., besonders aktueller Ansatz der Streßforschung beschäftigt sich mit der black box zwischen Auslöser und dem Ergebnis. Er beschreibt Prozesse sowohl biologischer als auch psycho­ logischer Natur im Sinne einer sub­ jektiven Bewertung und Verarbeitung von Streßreizen auf der Grundlage der Lerngeschichte des Organismus ein­ schließlich genetischer Faktoren, aber auch negativer „life events“ oder Werthaltungen. Die subjektive Bewer­ tung einer Streßsituation ist im we­ sentlichen abhängig vom Ausmaß der Selbstkontrolle, den eigenen Coping­ fertigkeiten und sozialer Unter­ stützung (Lazarus und Launier 1978). Gerade dieser Ansatz scheint erfolg­ versprechend nicht nur zum Verständ­ › Adrenalin-Urin-Ausschüttung ADR. ng/min zept der Salutogenese (Schüffel et al 1998). Salutogenese (als Antagonist zur Pathogenese) ist ein Konzept von Aaron Antonowsky, welcher dies 1987 publi­ zierte; 10 Jahre später wurde sein Buch ins Deutsche übersetzt. Die Arbeitsgruppe um Antonowsky hat versucht, die Bedingungen herauszuarbeiten, wie die Wege der Gesundheitsentstehung und der Gesundheitsaufrechterhaltung kon­ zeptualisiert werden: Der bedeutsamste salutogenetische Faktor ist ein Sense of coherence (Kohärenzgefühl). Er wird bereits in der Kindheit angelegt und bewirkt, dass wir sowohl mit alltäglichen Belastungen wie auch mit massiven Traumata in individual-spezifischer Weise umgehen. Kohärenz läßt sich auf drei Ebenen beschreiben: Vp mit Panikattakke 30 25 20 15 1. Verstehbarkeit: Auf dieser kognitiven Ebene geht es darum, Ereignisse im Leben zu struk­ turieren oder als strukturiert zu erle­ ben und auf diese Art und Weise kognitiv verstehbar und damit vorher­ sehbar zu machen. 10 5 0 Zeit 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 Abb. 4 nis von Streßreaktionen, sondern auch den Schlüssel für therapeutische Interventionen aller Art incl. Prä­ vention/Prophylaxe darzustellen. Aus verhaltenstherapeutischer Sicht ist sodann von Interesse, wie die kurz­ und langfristigen Konsequenzen von Streß auf einer Zeitachse aussehen. In Abhängigkeit vom zeitlichen Verlauf lassen sich unterschiedliche psychiatrisch klar definierte Krankheitsbilder nach dem ICD 10 beschreiben (Abb. 3). Abb. 4 (aus LEVI 1968) zeigt die Adre­ nalin-Urin-Ausschüttung bei 14 Soldaten in 25 aufeinanderfolgenden 3 Stunden­ Intervallen (Gefechtsübung). Man sieht deutlich eine exzessive Adrenalin-Ausschüttung bei einer Person mit akuter Panikattacke. Diese Arbeit ist medizin­ historisch insofern bedeutsam als hier klar der Begriff Streßreaktion mit Angst­ reaktion synonym gesetzt wird. Die Streßreaktion stellt als solche zunächst eine biologisch durchaus sinnvolle ontogenetisch und phylogenetisch be­ deutsame Überlebensstrategie insofern dar, als unsere Vorfahren bei maximal angstauslösenden und lebensbedrohli­ chen Reizen, ohne groß nachzudenken, durch die Streßreaktion in einer stereotypen Weise zur Flucht bzw. zum Angriff präpariert wurden (Bereitstellungs­ reaktion). Dieses ursprüngliche Streß­ konzept stammt von Cannon (1939) und wird mit dem Terminus verdeutlicht „fight or flight“. In bezug auf die subjektive Bewertung gibt es ein neueres Forschungskonzept, welches richtungsweisend für Prävention bzw. Personalauslese sein kann: das Kon­ 2. Handhabbarkeit: Diese Dimension beschreibt u.a. die Hilfsquellen, die dem Individuum selbst oder durch wichtige Bezugspersonen zur Verfügung stehen, aber auch Werthaltungen und Welt­ anschauungen. 3. Bedeutsamkeit: Bedeutet die gefühlsmäßige (emotionale) Komponente, etwa mit dem Gedanken „es lohnt sich für mich und das was ich hier mache ist wichtig, wird von der Gesellschaft unterstützt, wird von der Gesellschaft mitgetragen und es hat auch für mich subjektiv eine Bedeutung und einen Wert“. Die Combat-Streßreaktion wäre dann die kurzfristige stereotyp ablaufende Reaktion auf der physiologischen, erlebnis­ mäßigen und Verhaltensebene nach Combat-Ereignissen, also durch Combat­ Streß erzeugte Combat-Streßreaktionen. Eine kurzfristige Folge (Abb. 5) der Combat-Streßreaktion kann übrigens auch Gesundheit (Well being) sein, das bedeutet, dass nicht zwangsläufig nach maximaler Streßeinwirkung ein patholo­ 25 › Combat-Stress-Reaktion Auslöser Stressor Streßreiz Streßauslöser hier: Combat-Streß „Filter A“ „Filter B“ Biologisches Programm des Organismus - Genetik - Lerngeschichte z.B. negative life-events - Werthaltungen Subjektive Bewertung Stressreaktion kurzfristige Folgen langfristige Folgen Well being Leistungsminderung acute stress disorders Chronifizierung Combat Stress Reaction abhängig von - Selbstkontrolle - Coping - Social support Trauma „Critical Incident“ Arbeitsplatzverlust generalisierte Angststörung Berentung Sonstige psychiatrische oder psychosomat. Störungen PTSD ..... getriggert durch - Primärpersönlichkeit - Komorbidität - Verlaufsfaktoren Dauer Intensität Abb. 5 gischer Zustand die Konsequenz sein muß. Hier scheint mir ein wichtiger Forschungsansatz zu liegen, die Bedingungen genauer zu erforschen, unter denen Soldaten trotz maximal › belastender Ereignisse seelisch gesund bleiben (Eustress vs. Disstress). Abb. 6 gibt ein Beispiel aus dem militärischen Bereich im engeren Sinne, nämlich Verhaltensreaktion in und nach militärischen Belastungssituationen Militärische Belastungssituation Adaptives, funktionales Verhalten Postitive Belastungsreaktion Nichtadaptives, dysfunktionales Verhalten Verfehlungen kriminelle Handlungen Akute Belastungsreaktion Posttraumatische Belastungsstörung Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung Potentielle kurz-, mittel- und langfristige Verhaltensreaktionen in und nach militärischen Belastungssituationen. (Nach Leaders‘ Manual for Combat Stress Control, 1994) Abb. 6 26 aus einem Manual für militärische Füh­ rungskräfte der USA aus dem Jahr 1994. Bedeutsam in diesem Diagramm ist zum einen der Hinweis, dass es durchaus positive (gesunde) Belastungsreaktionen gibt, zum anderen, dass neben seelischen Störungen auch forensisch bedeutsame, dissoziale (kriminelle Handlungen) Konsequenzen auftreten können (Stichwort: Mi Lai oder „Fragging“, d.h. das Töten von Offizieren durch Soldaten mit Handgranaten im Vietnamkrieg). Abb. 7 skizziert die Behandlungsmöglich­ keiten mit den beiden psychotherapeuti­ schen Hauptverfahren, die in der Bundes­ republik krankenkassentechnisch und wissenschaftlich akkreditiert sind, näm­ lich die psychodynamischen Ansätze einerseits und die Verhaltenstherapie auf der anderen Seite. Die Psychoanalyse im engeren Sinne (Behandlung im Liegen) ist eigentlich unter Versor­ gungsaspekten eher zu vernachlässigen, weil sie nicht mehr als 5 % der psycho­ therapiebehandelten Fälle in der Bundes­ republik ausmacht. Ansonsten werden schätzungsweise die übrigen Patienten zu 2/3 tiefenpsychologisch und zu 1/3 verhaltenstherapeutisch ambulant oder stationär versorgt. › Psychotherapeutische Behandlungsmöglichkeiten Abb. 8 gibt eine Definition der Ver­ haltenstherapie, welche insbesondere die Aspekte der Physiologie und Neurophy­ siologie (also den biopsychosozialen Ansatz) bereits in einer 30 Jahre alten Definition impliziert. Psychotherapie Psychodynamische Ansätze Psychoanalyse › Kognitiv behaviorale Ansätze Tiefenpsychologie Verhaltenstherapie Abb. 7 Definition Verhaltenstherapie Verhaltenstherapie Aus der Kritik an den traditionellen Formen der Psychotherapie, insbesondere der Psychoanalyse, entstandene Psychotherapieform (Eysenck London, Skinner USA, Wolpe Südafrika). Grundlage: Lerntheorien, Definition nach Yates 1970 „Versuch, den Bereich empiri­ schen und theoretischen Wissens, der aus der Anwendung der experimentellen Methode in der Psychologie und angrenzenden Fachbereichen (Physiologie und Neurophysiologie) hervorgegangen ist, zu nutzen, um die Genese und Aufrechterhal­ tung von abnormen Verhaltensmustern zu erklären; dieses Wissen sollte zur Behandlung und Prävention dieser Abnormitäten angewendet werden, Beschreibung und Heilung sollte sich ferner kontrollierter Einzelfallstudien bedienen.“ › Abb. 8 Definition Verhaltensmedizin „Verhaltensmedizin ist das interdisziplinäre Feld, das sich mit der Entwicklung und Integration von verhaltens- und biomedizinischem Wissen und Techniken beschäf­ tigt, die für Krankheit und Gesundheit wichtig sind, sowie mit der Anwendung die­ ses Wissens und dieser Techniken auf Prävention, Diagnose, Behandlung und Rehabilitation.“ (Schwartz und Weiss 1980) Abb. 9 › Dimension psychologischer Gesundheit (aus Lutz & Mark 1995) Skalen­ nummer Skalenname Item­ anzahl 1 Autonomie 17 2 Willensstärke 14 3 Lebensbejahung 4 Natürlichkeit 5 Selbstreflexion 6 Integration 10 7 Sinnfindung 8 8 12 7 Beispielhafte Aspekte zur Skalenbeschreibung Selbstverantwortlichkeit Selbstsicherheit Normenunabhängigkeit Durchsetzungsvermögen Durchhaltevermögen Entscheidungsfähigkeit Optimismus Lebensmut Bejahung der eigenen Persönlichkeit Selbstöffnung Spontaneität Flexibilität bewußtes Leben realistische Selbsteinschätzung dynamisches Selbstkonzept soziale intakte Sozialbeziehungen soziales Engagement Einfühlungsvermögen Orientierung an Lebenswerten innerer Halt konstruktive Bewältigung von Leid Das Konzept der Verhaltensmedizin (Abb. 9) wird schwerpunktmäßig in den verhal­ tenstherapeutischen psychosomatischen Fachkliniken in der BRD erfolgreich prak­ tiziert. Das verfügbare verhaltensthera­ peutische Know-how wird integriert mit biomedizinischem Wissen und dürfte zu einem wesentlichen Teil zur Leistungs­ fähigkeit, aber auch zur subjektiven Zu­ friedenheit der Mitarbeiter solcher Kli­ niken beitragen. Erlauben Sie mir abschließend einen Hin­ weis auf das Konzept der Gesundheits­ psychologie bzw. Präventivmedizin. Die Dimensionen psychologischer Gesundheit sollten intensiver beforscht werden. Die Abb. 10 zeigt verschiedene Dimensionen psychologischer Gesundheit, wie sie ins­ besondere im Bereich Personalauslese, Training, Schulung, Fortbildung von Mitarbeitern praktisch aller streßbelaste­ ten Berufe relevant sein können. Ich möchte mit 2 Bemerkungen schließen: Zum einen hatte Generalarzt Neuburger bereits gestern auf die Bedeutung der zivilmilitärischen Zusammenarbeit hinge­ wiesen und ich denke, es ist eine Selbst­ verständlichkeit, dass das Know-how aus Psychiatrie und Psychologie in der Bun­ desrepublik sowohl von niedergelassenen Psychotherapeuten als auch in den ent­ sprechenden Psychosomatischen Fach­ kliniken auch zur Behandlung von Pa­ tienten mit Combat-Streß-Folgen zur Verfügung gestellt wird. Viele schwerwie­ gende psychiatrische Krankheitsbilder lassen sich nur unter stationären Bedin­ gungen erfolgreich therapieren. Auch stellen die neuen Krankheitsbilder häufig gutachterliche Herausforderungen dar, die meines Erachtens nur im Rahmen einer mindestens dreitägigen stationären Verhaltensbeobachtung möglich sind (Meermann 1996). Bei den Fachkliniken ist es sicherlich wichtig, unter Qualitäts­ sicherungsaspekten (Meermann 1995) die Spreu vom Weizen zu trennen. Fach­ psychotherapie bei solch komplexen Abb. 10 27 Störungsbildern wie der Posttraumatischen Belastungsstörung benötigt fundierte psychiatrische und psychologische Kompetenz und ist nicht in unspezifischen Drei – Wochen – Kuren mit marginaler psychologischer Unterfütterung durch einige Einzelgespräche oder Entspannungsverfahren seriös zu behandeln. Gefragt sind spezialisierte Einrichtungen auf kognitiv-verhaltenstherapeutischer Basis, die unter Qualitätssicherungsaspekten (etwa dem Wissens- und Weiterbildungsstand der Mitarbeiter) dem gegenwärtigen Stand der Forschung entprechen müssen. › Eine zweite abschließende Frage wäre, ob wir aus psychiatrisch-psychologischer Sicht mit dem Begriff der posttraumatischen Belastungsstörung unter therapeutischen und gutachterlichen Aspekten eine glückliche Wahl getroffen haben. Der Begriff der PTSD wurde auf Druck von Vietnamveteranen bzw. deren juristischer Vertretungen 1980 in das diagnostische und statistische Manual der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft (APA) aufgenommen (DSM III, 1980). Auch 20 Jahre später ist die Diskussion um die medizinische Notwen­ digkeit bzw. Wissenschaftlichkeit dieses Syndroms noch nicht erloschen (Shorter 1999, Shephard 2000). Eine distanziert vergleichende Betrachtung der Syndrome, die im ICD 10 bzw. DSM IV unter der Begrifflichkeit PTSD aufgelistet wer­ den, zeigt ein weites Spektrum verschie­ denartiger seelischer Störungen, welches möglicherweise einer klaren definitorischen bzw. sozialrechtlichen Klärung in Richtung Berufskrankheit oder Wehrdienstbeschädigung eher im Wege steht. Literatur CANNON, W. B. (1939).The wisdom of the body. New York : Norton LAZARUS, R. S. & LAUNIER, R. (1978). Stress-related transactions between person and environment. in: PERVIN, L. A & LEWIS, M. (Hrsg). Perspectives in interactional psychology., New York: Plenum Leaders Manual for Combat Stress Control, U.S. Dptm of the Army 1994, Washington, DC, Field Manual 22-51: 2-12 zit. n. WOTHE K & SIEPMANN K, Soldaten nach militärischen Einsätzen, in: MAERCKER A (Hrsg), Therapie der posttraumatischen Belastungsstörungen, Springer, Berlin 1997 LEVI, L. (1968). Sympatho-adrenomedullary and related biochemical reactions during experimentally induced emotional stress. In: MICHAEL, R. P. (Hrsg), Endocrinology and Human Behaviour, Oxford Univ. Press, London, 200-219 LUTZ, R. & MARK, N. (Hrsg) (1995).Wie gesund sind Kranke? Göttingen: Hogrefe MEERMANN, R. (1995). Strukturelle Auswirkungen des Qualitätssicherungsprogramms der Rentenversicherung in einer Psychosomatischen Rehabilitationsklinik, Praxis Klin. Verhaltensmedizin u. Rehabilitation, 8, 282-290 MEERMANN, R. (1996 2). Stationäre Verhaltenstherapie in der Psychosomatischen Klinik. In: MEERMANN, R.& VANDEREYCKEN, W. (Hrsg) Verhaltenstherapeutische Psychosomatik. Klinik, Praxis, Grundversorgung (231-256). Stuttgart: Schattauer MEERMANN, R. (1998) Aus den Anfängen der Verhaltenstherapie: Biologie- und medizinhistorische Wurzeln. Spektrum der Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, 27, 2-9 NITSCH, J.R. (Hrsg) (1981) Stress: Theorien, Untersuchungen, Maßnahmen. Bern: Huber POST , R.M.; Weiss, S.R.B.; Smith,M.; McCann,U. (1997). Psychobiology of posttraumatic stress disorder. Editors and Conference Organizer, Annals of the New York Academy of Science PUZICHA, K. J. et al. (Hrsg)(2001) Psychologie für Einsatz und Notfall, Bonn: Bernard & Graefe SCHÜFFEL, W. et al. (Hrsg) (1998) Handbuch der Salutogenese: Konzept und Praxis. Wiesbaden: Ullstein Medical SCHWARTZ, G. & WEISS, S. M. (1980). Behavioral Medicine revisited: An amended definition. J. Behav. Med.,1, 249-251 SELYE, H.(1976) Stress in health and disease, Boston: Butterworth SHORTER, E. (1999) Geschichte der Psychiatrie. Berlin: Fest SHEPHARD, B. A. (2000) War of Nerves: Soldiers and Psychiatrists 1914-1994, London: Cape YATES, A. (1970) Behavior Therapy. New York: Wiley 28 Präventive Aspekte bei der Personalauswahl und Schulung von KSK-Soldaten* Günther Kreim, Rolf Meermann Kurzfassung Stressbelastbarkeit (Stressresistenz) stellt ein Anforderungs- bzw. Auswahlkriterium im Rahmen des Eignungsfeststellungsverfahrens für Soldaten des Kommandos Spezialkräfte dar. Der Bewerber soll beweisen, dass er auch unter enormer körperlicher Belastung handlungsfähig bleibt und dass er Denken, Fühlen und Handeln auch in Ausnahmesituationen koordinieren kann. Tests, Fragebogen, Interviews und video­ gestützte Rollenspiele („Verhaltenstests“) sind die Informationsquellen im Rahmen der Psychodiagnostik. Leitlinie der Personalauslese ist ein ressourcenorientierter Ansatz und die Betonung des Auswahlverfahrens als „dynamischer Prozess“, d.h. als Erkenntnis- und Bewertungsdialog, bei dem der Bewerber über sein Leistungsbild informiert wird und seine Stärken und Schwächen durchgesprochen sowie Entwicklungsperspektiven und Trainingsmöglichkeiten gemeinsam mit ihm diskutiert werden. Stressmanagement beim Kommando Spezialkräfte ergänzt das allgemeine Stresskonzept der Bundeswehr und umfasst Seminare, schriftli­ che Informationsmaterialien, audiovisuelle Hilfsmittel und Workshops. Sportlehrer und Militärgeistliche werden neben Kommandoarzt und Kommandopsychologe in die Schulung mit einbezogen. Die Themen eines einwöchigen Seminars behandeln u.a. Ruheübungen, Imagi­ nationsverfahren, positives Denken, Konzentrationsübungen, autogenes Training, progressive Muskelrelaxation, Yoga. Für die Fortschreibung des Stressmanagement-Konzeptes beim KSK sind insbesondere Ansätze der Gesundheitspsychologie, des salutoge­ netischen Paradigmas und der Präventivmedizin richtungweisend. 1. Entwicklung / Entstehung Im Sommer 1995 wurden in einer inter­ national und querschnittlich angelegten Studie die notwendigen und erwünschten Fähigkeiten erfasst, welche hochqualifi­ zierte Polizisten und Soldaten auszeich­ nen. Danach wurde aus den Ergebnissen des Fragebogens zur Arbeitsanalyse (FAA) das Anforderungsprofil erstellt. Dieses Profil umfasst 32 Eignungsdimen­ sionen, die sich wiederum in zwei Grob­ kategorien einteilen lassen, 18 Fähig­ keitsdimensionen wie bspw. Hörsensibilität oder Reaktionsfähigkeit, die durch einen Testwert repräsentiert sind und 14 Persönlichkeitseigenschaften oder Verhaltensstile, wie bspw. Zuverlässigkeit, Belastbarkeit oder Soziale Kompetenz, welche mit erheblichem Aufwand, in der Regel multimethodal, erfasst werden müssen. 2. Methoden Die psychologische Datenerhebung ge­ schieht in einem sorgfältig konzipierten methodisch variablen Assessment-CenterVerfahren (JESERICH, 1981, Sarges, 1996, Kleinmann, 1997): Tests, Fragebogen und Verhaltensbeobachtung, jeweils in Situationen mit und ohne Belastung, wechseln ab mit Selbstauskunft in freier Form und teil­ standardisiertem Interview (Schuler, 1986). 3. Bewerber Der ideale Bewerber ist Feldwebel oder Offizier in stabiler Beziehung mit vielsei­ tigen Interessen und gradliniger Lebens­ planung. Er sollte notwendige Lehrgänge bereits absolviert haben. Unteroffiziere werden bis zum Alter von 32 Jahren, Offiziere bis zum Alter von 30 Jahren akzeptiert. Es ist eine Verwendungsdauer von mindestens 6 Jahren notwendig (Berufsförderungszeit im Anschluss). Folgende Kerneigenschaften müssen sich zeigen: • lernbereit • teamfähig • körperlich leistungsfähig * Vortrag gehalten auf dem dreitägigen Fachseminar Posttraumatische Belastungsstörung vom 08.-10. Oktober 2001 in der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont. 29 • psychisch belastbar und willensstark • geistig beweglich • verantwortungsbewusst und verschwiegen Die Soldaten müssen sich dienstlich be­ währt haben und in geordneten Verhält­ nissen leben. 4. Der dynamische Auswahl­ prozess mit Rückkopplung Potentielle Bewerber werden durch den Personalwerbetrupp des KSK angespro­ chen, erfahren von Kameraden, durch Medien und Zeitschriften oder das Inter­ net, wo sie sich für eine erste Kontakt­ aufnahme hinwenden können. Die Be­ werbungsunterlagen werden dann zuge­ sandt oder können aus dem Internet her­ untergeladen werden. Vom KSK erhält der Bewerber eine schriftliche Eingangs­ bestätigung mit den Regularien und Bestimmungen des Eignungsfeststell­ ungsverfahrens (EFV) sowie einen Trai­ ningsplan des Sportlehrers, damit die notwendige körperliche Fitness bis zum Prüfungstermin sichergestellt werden kann. Rechtzeitig wird ihm der Termin für die psychologische Vorauswahl beim Psychologischen Dienst KSK mitgeteilt. 4.1 Im computergestützten Vortest wird ein differenziertes kognitives Leistungsprofil des Bewerbers erhoben, wozu auch aus­ gesuchte Persönlichkeitsdimensionen und der Stressverarbeitungsfragebogen von JANKE gehören. Die Reihenfolge der Prüfaufgaben ist mit der Tagesleistungs­ kurve (Birbaumer, 1996) abgestimmt › und stellt allein schon durch den Umfang eine hohe Anforderung an die Konzen­ trationsfähigkeit und Belastbarkeit der Prüfungsteilnehmer im kognitiven Be­ reich. 4.2 Im nächsten Schritt erfolgt die Bewer­ tung und Einschätzung der Verhaltens­ potentiale des Bewerbers durch Psycho­ logen und erfahrene Einsatzkräfte. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Bewertung von Verhaltensmustern in belastenden Situationen, von Bewältigungsstrategien in emotional fordernden Gegebenheiten und der Einschätzung von Entwicklungs­ perspektiven. Zunehmend wurde in der Weiterentwicklung der Verfahren dabei mehr Gewicht auf die Verhaltensprobe gelegt, da bei diesem Verfahren die Möglichkeit der Beobachtung unter­ schiedlicher Verhaltensebenen besonders gegeben ist (Schuler und Funke, 1991). Hier kann man am ehesten erkennen, ob das Gesamtverhalten ein in sich stimmi­ ges Bild ergibt. Parallel dazu wird die sportliche Eignungsprüfung abgenom­ men. Es scheidet aus, wer die definierten Standards nicht erfüllt. Alle Teilnehmer erhalten eine differenzierte Rückmeldung über die von Ihnen erzielten Leistungen. Stärken werden diskutiert, Schwächen angesprochen und, wo sinnvoll, Trainings­ programme erarbeitet und aufgegeben. Die bis dahin erfolgreichen Bewerber bereiten sich in der Ausbildungs- und Trainingswoche intensiv auf den Umgang mit Karte und Kompass, das Arbeiten mit Skizzen, das Marschieren, Orientieren und Leben im Felde vor. Eine systemati­ Ergebnisse des Eignungsfeststellungsverfahrens (EFV) in Prozent 50 40 30 20 10 4.3 Den dritten Schritt bildet die Härte- und Durchschlageübung, bei der es von Mon­ tag- bis Freitagabend gilt, überwiegend nachts in zahlreichen Teamaufgaben und einer Marschleistung von über 100 km unter Beweis zu stellen, dass die mentale und körperliche Vorbereitung umfang­ reich und vielseitig war und der Wille dabei zu sein über die mit Sicherheit aufkommenden Zweifel siegt. Der Leiter der Auswahlkonferenz eröffnet dem Bewerber den Eignungsgrad und teilt ihm festgestellten Förder- und Entwicklungs­ bedarf mit. 4.4 Für die nichterfolgreichen Bewerber fin­ det durch den Personalwerbetrupp ein Debriefing statt. Gegebenenfalls wird den Soldaten, die zu einer weiteren Prüfung zugelassen sind, mit dem Sportlehrer KSK ein auf ihn zugeschnittener individueller Trainingsplan erarbeitet, um Defizite ge­ zielt zu beheben. 5. Bewertung des Verfahrens Das Eignungsfeststellungsverfahren im Kommando Spezialkräfte ist ein transpa­ rentes Untersuchungsverfahren, bei des­ sen Zusammenstellung großer Wert auf unabhängige, psychologisch-wissen­ schaftliche Personalauswahl gelegt wurde. Qualitätssicherung wird für das eingesetzte Personal und die Methoden kontinuierlich durchgeführt. Bewährungsdaten, bis hin zur differen­ zierten Vorgesetztenbewertung nach drei Jahren, helfen die Gültigkeit der Eignungsprognose abzusichern (Wottawa, 1983). 6. Ergebnisse Ausfälle vor Beginn Statistische Berechnungen wurden mit dem Programmpaket STATISTICA der Firma StatSoft durchgeführt. (Abb. 1) Ausfälle während des EFV Wie leicht zu erkennen ist, überwinden 20 % der Bewerber die Eingangsschwelle. Nach dem Überlebenslehrgang scheiden im weiteren Verlauf der Ausbildung weniger als 1% der Soldaten aus. Es Bestanden 0 Abb. 1 30 sche Beobachtung der Teilnehmer findet in dieser Phase nicht statt. ergibt sich, dass Motivation, Willens­ stärke und Durchhaltevermögen ein guter Prädiktor für die Eignung zum Komman­ dosoldaten sind. Wer auch die dritte Woche erfolgreich übersteht, hat in der Regel die gewünschten Eigenschaften. Nur ein sehr kleiner Anteil dieser Be­ werber wird dann noch wegen fehlender, aber nicht kompensierbarer Eigenschafts­ mängel nicht angenommen. Andersherum betrachtet ist unter denen, die von sich aus aufgeben oder an der Belastung scheitern, der Anteil deutlich höher, der die allgemeinen Eignungs­ kriterien nicht erfüllen würde. Die Bewerber können grob in zwei Grup­ pen eingeteilt werden: Bewerber, die mit der Absicht kommen, in ihrem bereits eingeschlagenen Berufsweg die höchste Stufe zu erreichen, was für sie gleichbe­ deutend mit der Ausbildung im KSK ist, und solche Bewerber, die nach oder wegen Veränderungen in ihrem Lebens­ vollzug eine neue Orientierung suchen und/oder es noch einmal wissen wollen. Sie unterscheiden sich wenig in Bezug auf das Antwortverhalten im Persönlich­ keitsinventar. In Punkto Leistungsbereit­ schaft, Ausdauer und gesundheitliche Sorgen würden die jeweiligen End­ ausprägen genügen, um unsere Klientel hinreichend zu beschreiben. Erstaunlich aber ist schon, dass das Gros der ausge­ schiedenen Bewerber sich in den Per­ sönlichkeitsfragebogen nicht signifikant von den geeigneten unterscheidet. Signifikante Unterschiede konnten wir auf dem 5%-Niveau in Bezug zu Präven­ tion und Stress im Stressverarbeitungs­ fragebogen in den Dimensionen: Aggression, Pharmakaeinnahme und Reaktionskontrolle feststellen. Wer sich besser im Griff hat, keine Medikamente, Alkohol oder ähnliches benötigt um ruhig zu bleiben und weniger mit seinen eige­ nen Reaktionen beschäftigt ist, hat die Nase auch unter extremer Belastung vorn, könnte man diese Ergebnisse zu­ sammenfassen. Nun ist es nicht uninter­ essant zu wissen ob Testverfahren, die vorgeben Leistung unter Belastung zu messen, sich auch in unserer Gruppe als tauglich erweisen. Wir führen den Kon­ zentrationsbelastungstest von KIRSCH (KBT) durch und stellen fest, dass Teilnehmer mit guter Konzentrations­ leistung signifikant weniger Pharmaka einnehmen und signifikant weniger zum Stressbewältigungsmittel „Ersatzbefrie­ digung“ greifen. 7. Problembereiche Aus den vorhandenen Interessenten wer­ den zu wenig ernsthafte Bewerber ge­ wonnen. Dies liegt zum einen an der unzureichenden körperlichen Leistungs­ bereitschaft und Willensstärke, zum anderen aber an der zu geringen Attrak­ tivität der Verwendung. So beträgt die Zulage für Kommandosoldaten netto ca. 70.-- €, die weiteren beruflichen Perspektiven sind noch zu undeutlich und es fehlt ein durchgängiges Karriere­ konzept. Die Ausbildungs- und Auftrags­ dichte im KSK steht einem geordneten Familienleben entgegen. So ist es nicht verwunderlich, dass Trennung vom Le­ benspartner als häufige Reaktion auf die außerordentliche dienstliche Belastung festzustellen ist. Besondere Aufgaben erfordern besondere Charaktere. Spezialisten sind nicht von der Stange zu haben. Gelegentlich bedeutet fachliche Spezialisierung auch eine allgemeine Verengung der Wahrneh­ mungs- und Interessenlage. Der eigene Lebensentwurf kann nicht zur Deckung gebracht werden mit dem Anforderungs­ profil (Auftrag) oder mit anderen Lebens­ entwürfen (Teamfähigkeit, soziale Kom­ petenz, Leadership). Solche einseitigen persönlichen Schieflagen zu erkennen und zu analysieren, ist mit die heikelste Aufgabe der Selektion und führt oft zu unbefriedigenden Urteilen. Dabei befin­ den wir uns in dem Dilemma, geeignete Bewerber fälschlicherweise abzulehnen (wird in der Statistik als Fehler erster Art bezeichnet), um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren ungeeignete Bewerber einzustellen. 8. Stressmanagement Stressmanagement ist bei zeit- und res­ sourcenkritischen Führungsaufgaben ein zentrales Problem und gewinnt mit wachsender Aufgabenvielfalt für die deutschen Soldaten an Bedeutung (Materialien, Zentrum Innere Führung, 1990). Die Bewältigung dieser neuen Aufgaben verlangt auch neue Wege in der Aufgabenbegleitung. Neben dem all­ gemeinen Stresskonzept der Bundeswehr hat das KSK erkannt, dass die besondere Aufgabenstellung ein gesondertes Kon­ zept zur Prävention und Betreuung ver­ langt. Im Hinblick auf Stressbewältigung kann man prinzipiell auf zweifache Weise einwirken: auf sich selbst und auf die Umstände. So kann man selbst seine Belastbarkeit erhöhen: Körperlich, indem man Sport betreibt, physiologisch durch eine Umstellung der Ernährung, mental durch Gehirnjogging oder sozial durch intensivere Kontakte im Freundeskreis. Die Belastung kann man reduzieren durch eine klare Zeit- und Aufgaben­ struktur, durch gewichten, delegieren, ablehnen, durch das Ausnutzen aller Ressourcen und den Aufbau eines sozia­ len Netzwerkes. So zum Beispiel in: (Sicherheitsreport 4, 1994) oder (Man­ gelsdorff, 1993, Meichenbaum, 1993). Wir haben in diesem Zusammenhang eine begleitende Untersuchung zum Thema Informationsverarbeitung unter Belastung durchgeführt und erstaunliche Resultate erhalten. Es wurden fünf typi­ sche Aufgabengebiete für je sechs Kom­ mandosoldaten untersucht: Taktischer Marsch in schwierigem Gelände, An­ näherung im Boot bei Wellengang, ein­ satzmäßige Schießausbildung, Zugriff bei einer Geisellage und Aufstieg im Fels. Für jede dieser fünf Gruppen gab es dazu eine Vergleichssituation „Ruhe“, in wel­ cher die Soldaten lediglich zu warten hatten. Die Aufgabenstellung bestand nun darin, einen typischen militärischen Auftrag aufzunehmen (in 3 Minuten aus­ wendig zu lernen) und diesen etwa eine Stunde später an seine Einheit (darge­ stellt durch ein Tonbandgerät) weiterzu­ geben. Die Fehler in der Informations­ übermittlung wurden als abhängige Variable erfasst. Zum besseren Ver­ ständnis kann man sich dies in etwa so vorstellen, als ob man in einer völlig fremden Stadt einen Plan erhält und sich in drei Minuten einen bestimmten Weg anhand von vier genau bezeichneten Punkten, drei Anschriften, vier Tele­ fonnummern, drei Codezahlen und zwei Datumsangaben, einprägen muss, welche eine Stunde später ohne Unterlagen exakt wiederzugeben sind. 31 › Informationsverlust bei fünf Aufgaben unter Ruhe- und Belastungsbedingungen 9. Ausblick und Schlussbemerkung Der leistungsfähige, hochspezialisierte Mensch als „Ressource“ für außerge­ wöhnliche Tätigkeiten ist begrenzt und so stellt sich regelmäßig die Frage, ob nicht über der intensiven Suche nach dem Besten, die Hege und Pflege des Nachwuchses vergessen wird. Das neue Personalkonzept wird genau in diesem Punkt Neuerungen bringen und Soldaten vor dem Eintritt in das KSK rechtzeitig in der Ausbildung und Qualifikation an diese besondere Aufgabe heranführen. Anzahl Fehler 9 6 3 0 Marsch Wasser Zugriff Belastung Schießen Gebirge Ruhe Abb. 2 Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in Abb.2 dargestellt. Die Verrechnung erfolgte wieder mit Statistica Vers. 6.0 im zweifaktoriellen varianzanalytischen Design. Der Haupteffekt (Ruhe/Belastung) ist signifikant. Knapp das 10%-Niveau verfehlt haben die Mittelwertsunter­ scheide bei den Bedingungen „Wasser“ und „Gebirge“. Dies aber sind genau jene Lagen, in denen mit den meisten unkal­ kulierbaren Risiken zu rechnen ist. Ein Fehltritt kann unmittelbar lebensgefähr­ dende Folgen haben: einen Sturz ins Wasser oder den Absturz am Berg. Die andern Situationen sind weitgehend standardisiert und vielfach geübt worden. Zwar nur ein statistischer Trend, der aber für weitere Untersuchungen viel ver­ spricht. Wir können daraus entnehmen, dass mit steigender Belastung die Behaltensleis­ tung abnimmt und dürfen vermuten, dass Übung und Automatisierung von Verhal­ tenssequenzen, wie im Stresskonzept vermutet, kognitive Kapazität für das Be­ halten von relevanter Information frei­ setzt. Das sportliche Trainingskonzept KSK (Kommandotraining) wurde also so aus­ gerichtet, dass die Soldaten lernen, viele Handlungssequenzen in den Bereich der automatisierten Handlungen zu verlagern um damit mehr Kapazität für neue Gege­ benheiten zur Verfügung zu haben. Die Zeitansätze für Sport- und Leistungstrai32 ning sind entsprechend großzügig. Die Ernährung wird in besonderer Weise zu­ sammengestellt und trägt zur Leistungs­ stabilisierung bei. In Seminaren erlernen die Soldaten das Konzept des Debriefings im Stressma­ nagementmodell nach Mitchell (Everly und Mitchell,1994, Igl und Müller-Lange, 1998). Sie setzen sich aktiv mit verschie­ denen Entspannungsverfahren auseinan­ der, erlernen das Verfahren der progressi­ ven Muskelrelaxation (PMR) nach Jacobson (Jacobson,1978) und haben die Gelegenheit, die für ihre Tätigkeit opti­ mierten Ruhe-, Konzentrations- und Imaginationsübungen einzuüben. Die wesentlichen Punkte stehen auf Falt­ karten zur Verfügung und können auch im Einsatz jederzeit nachgeschlagen wer­ den (Field Manual,1994, Mangelsdorff, 1993). Die Unterweisungen werden in regelmäßigem Turnus bzw. vor Einsätzen wiederholt. Zeit zur Kontemplation bietet vor allem die Militärseelsorge. Dort wird für ethisch sinnstiftenden Gedankenaus­ tausch Raum gegeben, den Familien wird abseits des dienstlichen Alltags Zeit zur Entspannung geboten und es wird durch interessante Angebote z. B. zur Medita­ tion und Selbstfindung zur Persönlich­ keitsentwicklung beigetragen. Der einzel­ ne Soldat ist aktiv an dieser Ausbildung beteiligt, er muss lediglich das für seine Bedürfnisse passende Stressvermeidungs­ repertoire zusammenstellen. Jede Auswahl zielt auf die jeweils Besten. Jede Testsituation ist insofern künstlich als sie hinter der Realität zurück bleibt. Wie in jedem risikoreichen Beruf gefähr­ det unkontrolliertes Handeln des Kom­ mandosoldaten den Auftrag und Men­ schen. Unser Ziel muss es also sein, mit der Vorhersage die Verhaltensmuster der Realität so gut wie möglich zu erreichen ohne dabei ethische Grenzen zu verletzen oder wissenschaftliche Standards zu missachten. Die Prüfung muss einerseits fordernd und realitätsnah stattfinden, andererseits aber, bei größtmöglicher Rückmeldung, fair und transparent für den Bewerber sein. Wir hoffen, dass unser Bemühen, das Eignungsfeststellungs­ verfahren im Kommando Spezialkräfte an diesen Kriterien auszurichten, deutlich wurde. › Literatur Arbeitsberichte des Psychologischen Dienstes der Bundeswehr. (2000) Bonn: BMVg PSZ II 4 Arbeitspapier (1997). Stressmanagement – oder: Wie bleibe ich stark? Koblenz: Zentrum Innere Führung. Bestimmungen zur Methodik der Eignungsfeststellung bei Bewerbern für die Ausbildung zum Kommandosoldaten im Kommando Spezialkräfte. (1997). Bonn: BMVg. Birbaumer, N., Schmidt, R. F. (1996). Biologische Psychologie. Berlin: Springer. Everly, G. S., Mitchell, J. T. (1994) Human Elements Training For Emergency Services, Public Safety and Disaster Personnel. Ellicott City: Chevron. Field Manual (1994). Leaders’ Manual For Combat Stress Control. Washington, DC: Headquarters Department Of The Army. Igl, A., Müller-Lange, J. (1998). Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen. Edewecht: Stumpf und Kossendey mbH. Jacobson, E. (1978). You must relay. New York: McGraw-Hill. Jeserich, W. (1981). Mitarbeiter auswählen und fördern. Assessment-Center-Verfahren. München: Hanser. Kleinmann, M. (1997). Assessment-Center: Stand der Forschung – Konsequenzen für die Praxis. Göttingen: Verlag für Angewandte Psychologie. Kreim, G.B. (2001) Eignungsfeststellung für Kommandosoldaten der Bundeswehr in: Puzicha, K.J. et al. (Hrsg.) Psychologie für Einsatz und Notfall. Bonn: Bernard & Graefe Mangelsdorff, D. (1993) Psychological Support To Military Personnel: State Of The Art In The United States Of America. Reader, International Stress Workshop. San Antonio, Tx.. S.120 – 136 Materialien (1990). Stressbewältigung durch Selbststeuerung –Grundlagen-. Koblenz: Zentrum Innere Führung. Meichenbaum, D. (1993). Application Of Stress Inoculation Training To Military Population: A Cognitve-Behavioral Approach. Reader, International Stress Workshop. San Antonio,Tx.. S. 89-113. Sarges, W. (Hrsg.). (1996). Weiterentwicklungen der Assessment Center Methode. Göttingen: Verlag für Angewandte Psychologie. Schuler, H., Funke, U. (Hrsg.). (1991). Eignungsdiagnostik in Forschung und Praxis. Stuttgart: Verlag für Angewandte Psychologie. Schuler, H., Stehle, W. (1986). Biographische Fragebogen als Methode der Personalauswahl. Stuttgart: Verlag für Angewandte Psychologie. SICHERHEITSREPORT (1994). Stress – was ist das. 4, 4-16. Hamburg: Verwaltungs-Berufsgenossenschaft. Wottawa, H. (1983). Neuere Methoden der Analyse und Bewertung der diagnostischen Urteilsfindung und deren Anwendung auf Ausleseverfahren der Bundeswehr. Wehrpsychologische Untersuchungen Nr. 3/83. Bonn: BMVg. 33 Präventions- und Behandlungskonzept zur Bewältigung einsatzbedingter psychischer Belastungen bei Soldaten der Bundeswehr Hans-Heiner Hahne, Karl-Heinz Biesold Kurzfassung Auf der Basis jahrzehntelanger Erfahrungen anderer Armeen in Kriegs- und humanitären Einsätzen, in Verbindung mit eigenen Erfahrungen und Untersuchungen, wurde in der Bundeswehr ein Rahmenkonzept zur Prävention und Behandlung einsatzbedingter psychischer Belastungen entwickelt, das in seinen Einzelheiten (drei Phasen – drei Ebenen) erläutert wird. Es wird auf die spezifischen Stressoren in humanitären Einsätzen hingewiesen und Untersuchungsergebnisse des Sozialwissenschaftlichen Institutes der Bundeswehr vorgestellt. Vorliegende Erfahrungen Mit dem Beginn der Auslandseinsätze der Bundeswehr in Kambodscha (1992), Somalia (1993-94), aber insbesondere dann in Bosnien (IFOR; SFOR seit 1995) und schließlich im Kosovo (KFOR seit 1999) mussten vorher angestellte Überle­ gungen zu psychischen Belastungen der Soldaten und dadurch möglicherweise bedingten Ausfällen vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus den großen Kriegen des 20. Jahrhunderts (1. Weltkrieg 1914­ 18, 2. Weltkrieg 1939-45), aus dem KoreaKrieg (1950-53) und Vietnam-Krieg (1965­ 75), aus den Kriegen im Nahen Osten (Yom-Kippur-Krieg 1973, Libanonkrieg 1982) und dem Golfkrieg „Desert Storm“ (1991) auch in der Bundeswehr zu einem Konzept zur Bewältigung einsatzbedingter psychischer Belastungen führen. Seit 1995 wurden verschieden Konzepte vorgelegt, die letztlich in dem vorläufig endgültigen „Rahmenkonzept zur Bewäl­ tigung psychischer Belastungen bei Sol­ daten“ vom 07.03.2000 (BMVg, 2000) zusammengefasst wurden. Auf welche Erfahrungen konnte zurück­ gegriffen werden? Für den 1. und 2. Weltkrieg nimmt man je nach Literaturquelle Ausfallraten bis zu 40 % an, die durch psychische Kampf­ reaktionen bedingt waren; die Amerikaner gehen hier von 23 % für den 2. Weltkrieg aus. Für den Korea- und Vietnam-Krieg nen­ nen die Amerikaner 12 % psychisch Ver­ wundete (psychiatric casualties) nach­ dem man die „one-year-rotation of com­ bat troops“ etabliert hatte, sowie eine Repatriierungsrate (evacuation rate) auf­ grund psychischer Symptome – ein­ schließlich Drogenmissbrauch – von 6 %. Die Israelis geben für die beiden Kriege im Nahen Osten (Yom-Kippur 1973, Libanon 1982) an, dass bis zu 30 % der Ausfälle auf psychische Verwundungen zurückzuführen waren (Solomon 1997). Es zeigte sich, dass eine frontnahe Behandlung wichtig war, bei der 60 % der Soldaten zu ihren Einheiten und in ihre frühere Funktion zurückkehrten, gegenüber nur 22 % derer, die in Zivilkrankenhäusern behandelt wurden. Bei frontnaher Behandlung entwickelten später 40 % der Soldaten eine posttrau­ matische Belastungsstörung (PTBS) gegenüber 71 %, die in Zivilkranken­ häusern behandelt wurden. Ähnliche Ergebnisse hatte es schon im 1. Weltkrieg gegeben: Die britische Armee in Frankreich evakuierte zunächst die Soldaten mit „shell-shock“ und Kriegs­ neurosen als Diagnose nach England, wodurch die psychischen Störungen chronifizierten, sodass dadurch 30 % der Entlassungen aus der Armee bedingt wurden. Erst als die deutschen U-Boote die Repatriierung nicht mehr erlaubten, wurde frontnah behandelt, wodurch 66 % nach 6-tägiger Behandlung wieder kampffähig wurden. Ebenso verhielten sich die Franzosen: von den 91 % front­ nah behandelten Soldaten wurde über 70 % wieder kampffähig. Bei UN-Einsätzen wird die Häufigkeit ein­ satzbedingter posttraumatischer Belas­ tungsstörungen heute zwischen 1,6 und 8 % angegeben (Weisaeth, 1997), allge­ meine psychische Probleme erreichen je nach Einsatz sogar Werte bis zu 45 %. 35 Bei Repatriierung (evacuation) in den UNEinsätzen spielen in über 30 % psychi­ sche Probleme eine bestimmende Rolle. Behandlungsgrundsätze für die Combat-Stress-Reaction Aus allen Erfahrungen konnten die fol­ genden fünf – heute unbestrittenen – Grundsätze der Behandlung von CombatStress-Reaction abgeleitet werden (IPESS): 1. Immediacy = sofort eingreifen, Zuwarten führt zur Chronifizierung 2. Proximity = frontnah behandeln, nicht abschieben, nicht aus dem militärischen Milieu entfernen 3. Expectancy= zuversichtliche Hal­ tung vermitteln „gute Prognose“ 4. Simplicity = einfache Methoden anwenden (food, sleep, exer­ cise, hopefull attitude) 5. Shortness = kurzes Behandlungs­ programm im militäri­ schen Rahmen Das Einhalten dieser Grundsätze im Sinne einer abgeschlossenen Endbehandlung ist auf jeder Ebene (Kameradenhilfe, Vorge­ setztenführung, Truppenarzt, Feldlazarett) erforderlich! › › Erst wenn ein solches Vorgehen in einer angemessenen Frist (4-6 Tage) keinen Erfolg erbringt, darf und sollte der Patient repatriiert werden! Stressoren in humanitären Einsätzen Mit welchen Belastungen (Stressoren) ist im Rahmen von Einsätzen der UN bzw. der NATO zu rechnen? Sicher sind die Soldaten solcher Missionen in der Regel keinen heftigen Krampfhandlungen wie zuletzt 1991 im Golfkrieg (Crago, 1997) ausgesetzt, dennoch bestehen gewichti­ ge, spezifische Stressoren (Wothe, 2001): - Antizipation von Tod und Verwundung - Gefahr durch Geiselnahme und Gefangenschaft - Bindung an Einsatzgrundsätze, die keine angemessene Lösung der aktuel­ len Situation zulassen („rules of enga­ gement“), dadurch erforderte Passi­ vität, Gefühle der Ungeschütztheit - Erleben von Gräueltaten, Konfrontation mit verletzten oder toten Zivilisten, insbesondere mit Kindern - Unsicherheit bei mangelhafter Infor­ mation, unbekanntem soziokulturellem Umfeld, mangelnde Sprachkenntnisse (Sprachbarriere) - Unsicherheit bei schnell wechselnden Lagen, sich widersprechenden Stressoren / Bedrohungen bei humanitären Einsätzen • • • • • • • • • • Minengefahr Versagen von Vorgesetzten in gefährlichen Situationen Gefährliche Situationen außerhalb des Lagers Unberechenbares Verhalten von Kameraden Unfall oder Krankheit Unfall mit Waffen Selbst Waffengewalt einsetzen zu müssen Aufgaben nicht gewachsen zu sein Bewaffnete Übergriffe auf das Lager Tod 83 46 37 36 35 24 13 9 6 5 % % % % % % % % % % Bei der überwiegenden Zahl der psychi­ schen Belastungen, die zur Beratung, zum ärztlichen oder psychologischen Gespräch oder gar zur nervenärztlichen Intervention führen, steht heute bei frie­ denserhaltenden Missionen nicht die akute Kampfreaktion (Combat-StressReaction) im Vordergrund, sondern viel­ mehr einzelne oder additiv traumatisie­ rend wirkende Stressoren. Eine Untersuchung des Sozialwissen­ schaftlichen Institutes der Bundeswehr hat 1998/99 die in Tab. 1 aufgeführten Ergebnisse bei Befragungen von Soldaten des V. Kontingent SFOR (Sarajevo/ Bosnien) hinsichtlich der Stressoren bzw. konkreter Bedrohung erbracht (SOWI, in Vorbereitung). Am meisten bedrückte die Soldaten der Hass zwischen den Bevölkerungsgruppen, die Situation der Kinder und die Bilder der Zerstörung und des Terrors. Die Häufigkeit, mit der „psychisch sehr bela­ stende Situation“ in dieser Untersuchung in den einzelnen Dienstgradgruppen genannt wurden, war im Mittel 29,6 %. Diese Daten zeigen, dass es notwendig ist, auch bei UN-Einsätzen und NATO­ peace-keeping-Maßnahmen Prävention zu betreiben und auf die Behandlung psychisch traumatisierender Belastungen und Ereignisse vorbereitet zu sein. Das Konzept zur Bewältigung psychischer Belastungen Tab. 1 Clausewitz-Zitat „Es ist unendlich wichtig, dass der Soldat, hoch oder niedrig, auf welcher Stufe er auch stehe, diejenigen Erscheinungen des Krieges, die ihn beim erstenmal in Verwunderung und Verlegenheit setzen, nicht erst im Krieg zum erstenmal sehe; sind sie ihm früher nur ein einziges Mal vorgekommen, so ist er schon halb damit vertraut.“ Clausewitz Abb. 1 36 Aufträgen, unklare Rollenzuweisung - Gefahr durch Minen - Trennung von Partnerin/Partner/Familie - Einschränkung der Intimsphäre, Einschränkung der Sexualität Das „Rahmenkonzept zur Bewältigung psychischer Belastungen bei Soldaten“ ist aus dem „Medizinisch-psychologischen Stresskonzept der Bundeswehr“ hervor­ gegangen (BMVg, 2000). Die Grundannahmen sind, dass • (Combat) Stress reaction eine nor­ male Reaktion auf ein nicht normales Ereignis bzw. auf eine nicht normale, außergewöhnliche Situation ist. • Jeder kann unabhängig von Stellung und Dienstgrad davon betroffen sein. • Sie ist kein Anzeichen von Feigheit oder für eine Charakterschwäche oder › (= Phasen) des Einsatzes: Einsatzvor­ bereitung, Einsatzdurchführung und Einsatznachbereitung. Drei Phasen des Einsatzes Phase 1 Vor dem Einsatz (Vorbereitung) Phase 2 Im Einsatz (Begleitung) Auseinandersetzung mit den zu erwartenden Belastungen Erkennen akuter psychi­ scher Belastungen und Stressreaktionen Maßnahmen zur Stärkung des inneren Gleichgewichts Sofortmaßnahmen (z.B. CISM nach Mitchell) zur Vermeidung von Folgeschäden (PTBS) Phase 3 Nach dem Einsatz (Nachbereitung) Reintegration Erkennen und Behandeln von Folgeschäden (PTBS) Einsatzvorbereitung Der Schwerpunkt liegt bei den Auslands­ einsätzen der Bundeswehr auf der Vor­ bereitung, d.h. in der Phase I, d.h. auf der Prävention, die sehr sorgfältig und um­ fangreich durchgeführt wird: Organisatorische und administrative Maßnahmen zur Minimierung von Stressoren Abb. 2 › Drei Ebenen psychischer Betreuung Phase 1 Vor dem Einsatz (Vorbereitung) Phase 2 Im Einsatz (Begleitung) Phase 3 Nach dem Einsatz (Nachbereitung) Ebene 1 Selbst- und Kameradenhilfe; Hilfe durch Vorgesetzte; Peers Ebene 2 Truppenarzt, Truppenpsychologe (unterstützt durch Militärpfarrer, Sozialarbeiter, Peers) Abb. 3 Es ist wichtig, dass jeder Soldat diese Grundannahmen verinnerlicht hat, des­ halb ist ihre Vermittlung ein essentieller Baustein in der Vorausbildungsphase. Eine wesentliche Präventivmaßnahme ist - Personalauswahl (persönliche Fitness, emotionale Stabilität), - Reduzierung trennungsbedingter Fak­ toren, Herstellen von Kommunikations­ möglichkeiten, - Informationen über Auftrag, Gefähr­ dungsrisiko, Lebensbedingungen im Einsatz, - gezielte Vorbereitung auf Critical Incidents (Training in Rollenspielen), - Lernen, Stress-Symptome zu erkennen, - Erlernen von Stressbewältigungs­ strategien, - Ausbildung der Führer (Führen unter Belastung, Gesprächsführung, Stress­ bewältigung). In der Einsatzbegleitung muß beachtet werden: Ebene 3 Psychiater, Ärztlicher / Psychologischer Psychotherapeut für eine mit Defiziten behaftete Person (wie noch von der Militärpsychiatrie im 2. Weltkrieg behauptet). • Man kann sich vorbereiten, Strategien gegen Stress-Reaktionen lernen: Stress-Desensibilisierung, d. h. Stär­ kung der psychischen Belastbarkeit vor dem Einsatz ist möglich. Das Drei-Ebenen-Konzept umfasst die Stufen (= Ebenen) der Hilfen bei psychi­ schen Belastungen im Einsatz entspre­ chend der Behandlungsgrundsätze (IPESS) je nach Ausmaß und Notwen­ digkeit. (Abb.3) natürlich eine realitätsnahe militärische Vorbereitung auf die Einsätze, wie sie in der Vorausbildung umgesetzt wird (Matyschock 2001; Folkerts 2001; Bucher 2001), gemäß dem alten ClausewitzZitat: (Abb.1) Die tragenden Säulen des medizinisch­ psychologischen Stress-Konzeptes sind das Drei-Phasen-Modell und das DreiEbenen-Konzept. (Abb.2) Das Drei-Phasen-Modell regelt die Maß­ nahmen in den verschiedenen Stadien - Erkennen und Reagieren auf akute psychische Stressreaktionen - Prävention von Folgeschäden (Debriefing, Psychiater, ggf. Kriseninter­ ventionsteam) - Erholungsphasen schaffen - allgemeine Betreuung (Sport, Unter­ haltungsangebote, Betreuungsfahrten, Kurzurlaub) - Angehörigenbetreuung im Heimatland (Familienbetreuungszentren) In der Einsatznachbereitung ist wichtig: - Beginn schon im Einsatzland (Informationen, Gesprächsrunden) - Urlaub nach Einsatzende - Reintegrationsphase mit Reintegrationsseminaren. 37 › Gesamtkonzept der Einsatzbegleitung EINSATZBEGLEITUNG ZInFü 1) Im Einsatz PEERS Psychol. Selbstu. Kameradenhilfe Prävention: - Vorbereitung - Ausbildung Nachbereitung „Defusing“ (Konfliktbewältigung) örtlich ENG BwKrHs 3) 2) ggf. Psychotherapie Truppenarzt Psychologe Psychiater im Einsatz FAMILIEN- UND ANGEHÖRIGENBETREUUNG Sozialpädagogen / -arbeiter, Militärpfarrer, Psychologen, militärisches Personal In Planung: - Unfälle im Inland - Katastrophen im Inland 1) Zentrum Innere Führung der Bundeswehr 2) Einsatznachbereitungsgruppe 3) Bundeswehrkrankenhaus ggf. ZWEI KRISENINTERVENTIONS-TEAMS (für Psychotraumata befähigte Debriefer) 1 Psychiater / Psychotherapeut 1 Psychologe 2 kompetente Helfer (Uffz) Abb. 4 Reintegrationsseminare werden für alle Soldaten über 1 – 2 Tage in Gruppen von ca. 20 Teilnehmern durch dafür ausge­ bildete „Moderatoren“ durchgeführt, die von Militärseelsorgern, Sozialarbeitern, Psychologen, ggf. auch Psychiatern, unterstützt werden. Ziele sind: - emotionale Spannungen abbauen - erlebte Störungen und Belastungen offen ansprechen - sich auf die weitere Zukunft einzustel­ len (Dienst in der Heimat) - Angebot von Einzelgesprächen oder Partnerberatung, wenn erforderlich - Erkennen von Behandlungsbedarf, vor allem von posttraumatischen Belastungsstörungen. Das umfassende Konzept soll sicher stel­ len, dass durch eine intensive Vorberei­ tung psychische Belastungen primär bes­ ser antizipiert werden, sekundär rechtzei­ 38 tig erkannt und richtig abgebaut werden und tertiär – soweit erforderlich – einer adäquaten Behandlung zugeführt wer­ den, sodass selbst bei Auftreten von posttraumatischen Belastungsstörungen die Prognose für die seelische Gesundheit der Soldaten insgesamt als positiv einge­ schätzt werden darf. (Abb.4) › Literatur BMVg – Bundesministerium der Verteidigung, Fü S I 3 (2000). Rahmenkonzept zur Bewältigung psychischer Belastungen bei Soldaten. Bonn. Bucher, E. (2001). Truppenpsychologische Aspekte der Kontingentausbildung am VN-Ausbildungszentrum der Bundeswehr. In K. Puzicha, D. Hansen & W. Weber (Hrsg.), Psychologie für Einsatz und Notfall (S.135-139). Bonn: Bernard & Graefe Verlag. Crago, M. (1997). Ein Bericht über persönliche Stresserfahrungen im Golfkrieg. In T. Sporner (Hrsg.), Stressbewältigung und Psychotraumatologie im humanitären Hilfseinsatz (S.13-35). Beiträge Wehrmedizin und Wehrpharmazie, Bonn: beta-Verlag. Folkerts, H.-J. (2001). Die VN-Ausbildung in Hammelburg. In K. Puzicha, D. Hansen & W. Weber (Hrsg.), Psychologie für Einsatz und Notfall (S.128-134). Bonn: Bernard & Graefe Verlag. Matyschock, A. (2001). Stressimpfungsprogramme der Bundeswehr. In K. Puzicha, D. Hansen & W. Weber (Hrsg.), Psychologie für Einsatz und Notfall (S.106-120). Bonn: Bernard & Graefe Verlag. Solomon, Z. (1997). Akute Kampfreaktion und PTSD – Die israelische Erfahrung. In T. Sporner (Hrsg.), Stressbewältigung und Psychotraumatologie im humanitären Hilfseinsatz (S.92 – 112). Beiträge Wehrmedizin und Wehrpharmazie, Bonn: beta-Verlag. SOWI – Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr, Strausberg – Studie: Nikutta-Wasmuth, U., Konfliktbewältigungsstrategien, Verhalten in Extremsituationen, Umgang mit Verwundung und Tod – bisher nicht veröffentlicht. Weisaeth, L. (1997). Streß bei friedenserhaltenden UN-Einsätzen. In T. Sporner (Hrsg.), Stressbewältigung und Psychotraumatologie im humanitären Hilfseinsatz (S.113-125). Beiträge Wehrmedizin und Wehrpharmazie, Bonn: beta-Verlag. Wothe, K. (2001). Belastungsfaktoren im Einsatz. In K. Puzicha, D. Hansen & W. Weber (Hrsg.), Psychologie für Einsatz und Notfall (S.65-71). Bonn: Bernard & Graefe Verlag. 39 Therapie psychischer Traumatisierungen bei Soldaten der Bundeswehr Klaus Barre, Karl-Heinz Biesold Kurzfassung Traumatherapie ist eine spezifische Form der Psychotherapie. Sie orientiert sich schulübergreifend am Drei-Phasen-Modell von P. Janet. Im Bundeswehrkrankenhaus Hamburg werden seit 1994 Soldaten mit einsatzbedingten und einsatzunabhängigen psychotraumatischen Syndromen behandelt. Dabei wird im Rahmen eines integrativen Therapieansatzes insbesondere Eye-Movement-Desensitization-andReprocessing (EMDR) als therapeutische Methode eingesetzt. Der therapeutische Ansatz wird erläutert. Auf die spezifischen Bedingungen im soldatischen Umfeld und anderen Gefahrenberufen wird eingegangen. Einleitung Heute wird im Umfeld von „Gefahren­ berufen“ vielerorts immer noch wie selbst­ verständlich davon ausgegangen, dass Helfer auch mit den schrecklichsten und grausamsten Erlebnissen umgehen kön­ nen, als wären sie wie Siegfried in der Nibelungensage (seelisch) in Drachenblut gebadet und daher unverletzbar. Dabei lehrt gerade der Siegfried-Mythos, dass Unverwundbarkeit für Menschen nicht zu haben ist: Trotz aller Abhärtung durch das Meistern von Notsituationen bleibt doch immer eine verwundbare Stelle. Viele Soldaten, Feuerwehrleute, Polizisten und Notfallhelfer habe diese bittere Erfahrung machen müssen, wenn die Bilder von Grauen und Entsetzen auch nachts nicht weichen wollen und die Fähigkeit, dienst­ lich und privat ein normales Leben zu führen mehr und mehr zerstört wird. Traumatherapie ist eine spezielle Form der Psychotherapie, mit dem Ziel, den Er­ holungsprozess und die Transformation der traumatischen Erfahrung in Gang zu setzen, zu unterstützen und zu beschleu­ nigen, wenn die natürliche Verarbeitung des Traumas (Fischer & Riedesser,1998) steckengeblieben ist. Pharmakotherapie Pharmakotherapie kann die Psychothera­ pie nur unterstützen und ist auf die je­ weils im Vordergrund stehenden Symp­ tome auszurichten. Posttraumatische Störungen sind pharmakotherapeutisch nur schwer zu behandelnde Erkrankun­ gen. Ein Spezifikum zur Behandlung aller Symptome der PTBS gibt es nicht. Therapieerfahrungen liegen mit der An­ wendung antidepressiv wirksamer selek­ tiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI), Serotonin-Noradrenalin-Wieder­ aufnahmehemmer (SNRI) und MAO- Hemmer Typ A, sowie Tranquilizern, Anxiolytika, Antikonvulsiva, Lithium, aty­ pischen Neuroleptika und OpiatAntagonisten vor. Die SSRI gelten heute als Mittel der ersten Wahl. Der Einsatz von Psychopharmaka sollte nur bei PTB-Syndromen mit ausgeprägter klinischer Symptomatik in Betracht gezo­ gen werden, bzw. wenn bisherige psycho­ therapeutische Bemühungen erfolglos geblieben sind oder eine Psychotherapie momentan nicht möglich ist. Psychotherapie Das Stufenmodell von P. Janet gilt heute als Standard der Psychotraumatherapie. Danach hat die Therapie in mehreren Schritten zu erfolgen (Abb. 1): - Stabilisierung - Traumabearbeitung - Integration - Neuorientierung 41 › Schritte der Traumtherapie Vertrauens- und Beziehungsaufbau Stabilisierung • Herstellen von Sicherheit • Erklärung der postexpositorischen Symptome als normale Folge der anomalen Situation („Psychoedukation“) • Erlernen von Entspannungs- und Stabilisierungstechniken, Imaginativen Verfahren Trauma-Bearbeitung durch • psychodynamisch eingebettetes EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) nach Francine Shapiro oder • MPTT (mehrdimensionale psychodynamische Traumatherapie) nach G. Fischer • traumaorientierte Verhaltenstherapie Neuorientierung • Wiedergewinnung des Vertrauens in zwischenmenschliche Hilfe und Zuverlässigkeit, Aufbau gestörter Beziehungen • Wiederherstellung der Identität und des Selbstverständnisses • Transformation des Traumas (Sinnfindung) – z. B. soziales Engagement Abb. 1 Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist dabei, die Vermeidung von Reizen, die mit dem Trauma in Verbindung stehen, aufzuhe­ ben und durch eine Bewältigungserfah­ rung zu ersetzen (Maercker,1997). 1. Phase: Stabilisierung Die exzessive Vermeidung aller Reize, die an Traumaerfahrung erinnern, kann ein­ geordnet werden als Ergebnis eines Ab­ gleichs zwischen befürchteter Belastung und individuellen Bewältigungsmöglich­ keiten. Ist die Traumaerfahrung zu intensiv, und/oder sind die Bewältigungs­ möglichkeiten zu gering, müssen zu­ nächst Maßnahmen der Stabilisierung eingeleitet werden, damit eine Durch­ arbeitung des Traumas nicht am Wider­ stand des Patienten scheitert (Redde­ mann &. Sachsse 1997). Die Stabilisie­ rung hat den Sinn, den Patienten soweit zu stärken, dass es in der nachfolgenden Konfrontationsphase nicht zu einer Über­ flutung mit Traumaerinnerungen kommt. Dies käme einer Retraumatisierung gleich, die u.U. zu einer erheblichen Symptomverschlechterung führen kann und eine häufige Ursache für Therapie­ abbrüche darstellt. 42 Als Folge einer traumatischen Erfahrung stellt sich ein verändertes Erleben ein, das als „disorder of arousal“, als ein Zu­ stand fast ständig erhöhter Erregung und Anspannung treffend charakterisiert wor­ den ist (Mitchell & Everly, 1998). Betroffene erleben dies mit großer Beun­ ruhigung, besonders, wenn sie sich ihren Zustand nicht erklären können. Gerade Angehörige von Hoch-Risiko-Berufen emp­ finden dies gemeinhin als beschämenden Verlust der Kontrolle über sich selber und ihre Lebenssituation. Sie verlieren das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und leben daher oft in der Befürchtung, Kame­ raden könnten ihren labilen Zustand be­ merken und die Achtung vor Ihnen ver­ lieren. Die Angst, „nicht mehr normal“ zu sein, schleicht sich ein. Große Energie wird darauf verwendet, die Fassade der „Normalität“ aufrecht zu erhalten und die aufdrängenden Erinnerungen an das Erlebte zu unterdrücken – nicht selten durch Alkohol. In einem Teufelskreis fehl­ geschlagener Bewältigungsversuche ge­ raten viele Betroffene immer tiefer in einen Symptomstrudel, aus dem sie sich allein nicht mehr zu befreien vermögen. Dem Aufbau einer tragfähigen, vertrau­ ensvollen Beziehung gleich zu Beginn kommt daher besonders in diesem Um­ feld eine zentrale Bedeutung zu. Sie ori­ entiert sich an dem Modell einer „distan­ zierten Parteilichkeit“ (Reddemann & Sachsse, 1997). Der Patient muss das Gefühl von Schutz und Sicherheit ent­ wickeln können. Es wird alles vermieden, was zu einer Retraumatisierung führen könnte, insbesondere jede Form von Sensationslust und Voyeurismus. Die the­ rapeutische Haltung sollte von empathi­ scher Sachlichkeit getragen sein. Ganz bewusst wird dem Traumatisierten ein aktiver Part im therapeutischen Prozess überlassen. Die Metapher eines LKWFahrers, der beim rückwärts rangieren einen Einweiser beizieht, nicht weil die­ ser besser fahren kann, sondern weil er einen anderen Blickwinkel hat, wird von den Betroffenen schnell verstanden und oft erleichtert angenommen. Selbstverständlich darf nicht aus dem Blickfeld geraten, dass die Arbeit im Bundeswehrkrankenhaus für Soldaten innerhalb eines „betriebsärztlichen“ Systems erfolgt, dem der Patient deshalb eventuell mit Misstrauen begegnet. Tranzparenz, Aussprache darüber und verlässliche Solidarität mit dem Betroffenen sind daher umso wichtiger. Auf dieser Basis hat sich in der Zusammenarbeit mit vielen Soldaten erwiesen, dass in der Wahrnehmung der Betroffenen dieser anfängliche Nachteil durch den Vorteil der Vertrautheit der Therapeuten mit den technischen, ma­ teriellen, strukturellen und soziokulturel­ len Gegebenheiten in der Bundeswehr mehr als wett gemacht wird. Gerade Soldaten, die sowohl in zivilen wie auch Bundeswehr-Institutionen behandelt worden sind haben dies nachdrücklich bestätigt. Normalisierung und Psychoedukation Dem Betroffenen wird vermittelt, dass es sich bei seiner Störung um eine „normale Reaktion“, einer „normalen Person“ auf eine unnormale, d.h. krankmachende Situation handelt (Mitchell & Everly, 1998). Die Zusammenhänge zwischen Extremsituation, Psychologie und Psychophysiologie der Stressreaktion werden dabei adressatengerecht ver­ ständlich vermittelt. Diese „Psychoedukation“ ist ein unverzichtbarer Schritt, um Information, Orientierung und Struktur zu vermitteln. Allein dies wirkt meist angstreduzierend und entlas­ tet vom „Symptomdruck“. Addressieren der Besonder­ heit des Berufes Es hat sich in unserer Arbeit als günstig erwiesen, das Besondere der Berufssitu­ ation anzusprechen, indem wir hervorhe­ ben, dass der Betroffene seine Trauma­ tisierung gerade deshalb erfahren hat, weil er standhält und handelt, wo andere Menschen weglaufen oder gelähmt rea­ gieren. Oft führt dies zu einer spontanen Entlastung von Scham und Versagens­ gefühlen, weil es die Störung in einen positiven, wenn man so will „starken“ Kontext einbindet, mit dem sich die Patienten identifizieren, der zu ihrer „corporate identity“ gehört. Würdigen der Bewältigungs­ versuche Sehr früh werden auch die bisherigen Bewältigungsversuche angesprochen und auch dann positiv bewertet, wenn sie von außen gesehen nicht gelungen erschienen. Diese Reaktionen sind Versuche, den verlorenen Zustand „vor dem Trauma“ wieder herzustellen. So ist es durchaus funktional, wenn ein Soldat, der während des Einsatzes im Schlaf ver­ letzt worden ist, mit Überwachheit, Unruhe bei Dunkelheit und Schlafstörungen reagiert. Es hat die Funktion, ihn vor erneuter Gefahr zu schützen. stark (Shapiro, 1998a). Ganz allgemein kommt dem Aspekt der Fürsorge durch die Truppe eine eminent wichtige Bedeutung zu. Jeder Soldat (Feuerwehrmann, Polizist) vertraut dar­ auf, dass er von seinem Dienstherrn unterstützt wird, wenn er bei der Ausübung seines Dienstes Schaden nimmt. Wird diese Erwartung enttäuscht, weil Entscheidungsträger in diesen Orga­ nisationen oder Kameraden/Kollegen die Bedeutung des Traumas für den/die Be­ troffene unterschätzen, kommt es nicht selten zu tiefer Verbitterung, die die Chronifizierung der PTBS erst bewirkt. Der Betroffene empfindet dann seinen Einsatz und damit seine Person entwer­ tet, reagiert mit Depression, Hass und psychosomatischen Störungen. Zu der Belastung der traumatisierenden Situation addiert sich das bittere Gefühl, verraten worden zu sein (Shay, 1998). Therapieziel Stabilisierungsverfahren Imaginative und Entspannungsverfahren sind zentraler Bestandteil unserer Sta­ bilisierungsarbeit. Sie haben das Ziel, die Verarbeitungskapazität des Patienten zu stützen oder zu verbessern. Hierzu ge­ hören Selbstkontrolltechniken und Ent­ spannungsverfahren zur Erregungskon­ trolle (Autogenes Training, Jacobsenent­ spannung, Lichtstromtechnik, Selbstin­ struktionstechniken etc.), aber auch ima­ ginativer Ressourcenaufbau (Innere Hel­ fer, Baumübung, etc.) (Reddemann, 2001). Diese Fähigkeiten und Fertigkeiten können z.T. in Gruppenarbeit geübt wer­ den. Bei leichteren Akuttraumata und sehr stabilen Rahmenbedingungen kann die Stabilisierungsphase deutlich abgekürzt werden. Traumabearbeitung – Konfrontation Äußere Belastungsfaktoren Bei der Regelung äußerer Belastungs­ faktoren (Beerdigung, anstehende Ge­ richtsverfahren, Straferwartung, finanzi­ elle Not, unversorgte Angehörige etc.) können die Sozialdienste und Militär­ seelsorge, aber in hohem Mass auch die Kooperationsbereitschaft von Vorge­ setzten und Kameraden von großer Be­ deutung sein. Ungelöste Sorgen und Nöte belasten sonst den Therapieprozess sehr angemessene Form der Konfrontation mit inneren und äusseren Aspekten des Trau­ mas gesucht. Die eigentliche Trauma-Bearbeitung er­ folgt im Bundeswehrkrankenhaus Ham­ burg in Einzeltherapie und bedient sich dabei unterschiedlicher Verfahren (insbe­ sondere EMDR (Shapiro, 1998a,b; Hofmann, 1999), kognitive Verhaltens­ therapie (Heiland & Maercker, 2000; Maercker, 1997), imaginative Distanzie­ rungs- und Dosierungstechniken (Reddemann, 2001). Das Therapieprogramm beinhaltet darü­ ber hinaus Körpertherapie und Ergo­ therapie (Ausdruck und Verarbeitung durch Gestaltung), Entspannungsver­ fahren, sowie meditative Übungen wie Chi-Gong (Selbstkontrolle), Massage und Aromatherapie (Vermittlung „Guter Erfahrungen“). In der Verarbeitungsphase kommt es dar­ auf an, auf der Basis der Stabilisierung eine Konfrontation mit den belastendsten Aspekten des Traumas zu ermöglichen, die Vermeidung zu überwinden und durch eine Bewältigungserfahrung zu er­ setzen. Während also in der ersten Phase zunächst die Arbeitsvoraussetzungen wie Beziehung, Vertrauen, Sicherheit und Kompetenzerweiterung geschaffen wer­ den, wird in der zweiten Phase eine Eine traumatische Erfahrung führt nicht zu konstruktivem Lernen, sondern im all­ gemeinen zu einem Verlust von Kompe­ tenz, Entscheidungs- und Handlungs­ autonomie. Das Erlebens- und Verhal­ tensrepertoire wird nicht erweitert son­ dern eingeengt. Das Ziel der Therapie bei einem psychischen Trauma besteht des­ halb darin: • Destruktiv verarbeitete Erlebnisse in konstruktive Erfahrung zu verwandeln. • Die schmerzliche und quälende Erfahrung in eine neue, angemessene Perspektive zu integrieren (z.B.: „vor­ bei“, „ich bin in Sicherheit“, „ich habe getan, was ich konnte“). • Belastende Affekte (z.B. Angst) zu ent­ laden. • Psycho-vegetative und motorische Reaktionen zu löschen • Neue Handlungsmöglichkeiten aufzu­ bauen. Welche Ziele sich ein Patient inhaltlich im Einzelnen setzt muss selbstverständ­ lich individuell erarbeitet werden. Exkurs: EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing nach Francine Shapiro) In unserer traumatherapeutischen Arbeit setzen wir seit 1994 EMDR ein. Die 43 Methode wurde seit 1987 von F. Shapiro in Palo Alto (USA) entwickelt und mit Beginn der 90er Jahre zunächst in der Behandlung von Vietnam-Veteranen mit eindrucksvollen Ergebnissen eingesetzt. Obwohl der Wirkmechanismus bis heute nicht geklärt ist, gilt EMDR z.Zt. als eine der empirisch am besten evaluierten traumatherapeutischen Methoden (Flatten et al., 2001). Eine zentrale Modellvorstellung von F. Shapiro ist das Postulat eines „Accellerated Information ProcessingSystems“. Danach besitzt jeder Mensch ein Informations-Verarbeitungs-System (IVS). Es ist darauf abgestimmt, seelische Störungen und Irritationen in einen Zu­ stand der Gesundheit zu überführen. Analog den Selbstheilungskräften des Körpers arbeitet dieses IVS in Richtung einer positiven Auswertung von Ereig­ nissen. Erlebtes wird als Erfahrung verar­ beitet und gespeichert, um in der Zu­ kunft effektiv benutzt werden zu können. Dabei wird Brauchbares verinnerlicht, und mit den dazu passenden Affekten gespeichert, dysfunktionales wird ver­ worfen. Bei einem Trauma kommt das IVS in ein Ungleichgewicht: Erlebtes wird zustandsspezifisch (unverarbeitet) gespeichert. Ein Lernprozess findet nicht statt. Es kommt zu keiner Verknüpfung mit etwas angemessenem. Im Ergebnis bewirkt die EMDR-Methode nach diesem Modell, dass zwei neuronale Informations-Netzwerke (ein destruktiv­ traumatisches und ein konstruktiv-kom­ petentes) miteinander verbunden werden, wobei es zu einer beschleunigten Assi­ milation des schmerzlichen Materials in eine neue, distanzierte Perspektive kommt (z.B. dass das Erlebnis der Vergangenheit angehört). Damit einher geht eine Entladung der belastenden Affekte und vegetativen Reaktionen und es stellt sich eine Generalisierung positi­ ver Gedanken über die bis dahin isolier­ ten Gedächtnisinhalte ein (z.B. „ich bin in Sicherheit“). Der Klient ist dann fähig, traumatische Erinnerungen aufzurufen, die nun aber keinerlei oder nur geringfü­ gige Belastung mehr erzeugen. Eine cha­ rakteristische Formulierung am Ende eines solchen Verarbeitungsprozesses ist: „Ich weiß, dass es geschehen ist, aber es belastet (überflutet) mich nicht mehr.“ Sie geht meist mit einer deutlichen Beruhigung einher. 44 Vorgehen 1. Während einer EMDR-Sitzung sitzen sich Klient und Therapeut seitlich ver­ setzt gegenüber. A. Vorbereitung: 2. Nach einer angemessenen Erklärung des Vorgehens fordert der Therapeut den Klienten auf, seine Aufmerksam­ keit auf eine (meist) bildliche Wieder­ errinnerung des beunruhigenden Erlebnisses zu richten und zugleich zu achten auf: • damit verbundene Affekte ( z.B. Angst, Scham, Wut) • Körperempfindungen (z.B. Schwitzen, Herzklopfen) • (negative) Kognitionen (z.B. „ich bin in Gefahr“) B. Desensitisierung 3. Währenddessen führt der Klient schnelle saccadische Augenbewegun­ gen durch, in dem er der wiederholten Finger-Handbewegung des Therapeu­ ten vor seinen Augen folgt . 4. Nach einem Satz von Augenbewegun­ gen, gewöhnlich ca. 20 Sek., berichtet der Klient kurz jede Veränderung der bildhaften Erinnerung oder andere Wahrnehmungen. 5. Er stellt sich dann dem nächsten Satz von Augenbewegungen und konzen­ triert sich währenddessen auf das neue, spontan aufgetauchte Material. 6. Der Zirkel von Vorstellungskonfron­ tation in Verbindung mit Augenbewe­ gungen und anschließendem feed­ back durch den Klienten wird fortge­ setzt, bis der Klient • keine bedeutsamen Assoziationen mehr hervorbringt, • sich ruhig und ausgeglichen fühlt, • die ursprüngliche Ereigniserinnerung keinen unangenehmen (Körper-) Zustand mehr hervorruft. C. Installation / Verarbeitung 7. Zu diesem Zeitpunkt wird eine positive Vorstellung mit der Originalszene ge­ paart, indem der Pat. aufgefordert wird, die belastende Erinnerung und eine positive Vorstellung (z.B. „ich bin in Sicherheit“) im Bewusstsein zu hal­ ten und dabei wiederum Augen­ bewegungen durchzuführen. 8. Die Prozedur wird solange fortgeführt, bis der Grad der subjektiven Belastun­ gen bei dem Pat. deutlich gesunken ist und er gleichzeitig die positive Vorstel­ lung für sich ohne Vorbehalte mit den Erinnerungen verbinden kann. Fallbeispiel Traumatisches Erlebnis: Der Patient, Stabsunteroffizier, 23 J., wurde wegen einer Belastungsstörung vorgestellt , die sich in seinem Einsatz in Kroatien 1996 nach dem Erleben eines Minenunfalls eingestellt hatte, bei dem ein kleines Mädchen schwer verletzt wurde und innerhalb weniger Minuten verstarb. Der Patient befand sich auf ei­ nem Konvoi und wurde aus sicherer Ent­ fernung von seinem Fahrzeug aus Zeuge des Unglücks. Erlebnisverarbeitung: Der Patient war geschockt. Er fühlte sich hilflos und schuldig, weil auf Grund der Minenlage ein Eingreifen der Konvoisol­ daten nicht möglich war. Symptome: Es stellten sich über 4 Wochen Alpträume ein, in denen sich das Geschehen immer wiederholte. Dabei erlebte der Patient das Ereignis jedoch nicht aus großer Entfernung, sondern immer aus nächster Nähe. Vor Ort hatte der Pat. Aussprache mit einem Militärgeistlichen gesucht und darin zunächst auch Hilfe gefunden. Entwicklung: Nach ca. 1 Jahr Latenzzeit stellten sich die vorübergehend nicht mehr vorhande­ nen plastischen Alpträume wieder ein. Die Exploration ergab, dass er sich zu dieser Zeit in einer belastenden dienstli­ chen Situation befand. Er war versetzt worden, fühlte sich durch die Verantwortung als stellvertretender Zugführer sehr gefordert und litt unter dem konfliktbelasteten Verhältnis zu sei­ nem Vorgesetzten . Einen erneuten Einsatz fürchtete er aus Angst, ein ähnli­ ches Erlebnis nicht aushalten zu können. Therapie: Obwohl der Patient Schwierigkeiten hatte, sich auf die besondere EMDR-Therapie­ methode einzustellen kam es schon wäh­ rend der ersten Sitzung zu einer schnel­ len Abnahme der subjektiven Belastung. Die Erinnerungsbilder verblassten und die positive Selbstvorstellung: „Ich habe getan, was ich konnte“ etablierte sich für den Pat. überzeugend. Verzweiflung, Schuldgefühle und Körperreaktionen schwanden. Katamnese: Der Therapieerfolg stellte sich als stabil heraus. Der Pat. war 1 Jahr später in der Lage, sein Erleben ohne Belastung in einem Fernsehbeitrag darzustellen. Er hatte sich für einen erneuten Einsatz gemeldet und fühlte sich diesem gewachsen. Stellenwert, jedoch verschiebt sich der Schwerpunkt im Prozess von der Stabilisierung über die Konfrontation zur Integration. Ablauforganisation der Traumatherapie im Bundeswehrkrankenhaus Hamburg 3. Phase: Trauma-Integration Traumatisierte Soldaten werden in der Regel durch den Truppenarzt angemeldet. Besteht eine begründete Annahme, dass es sich um eine belastungsbezogene Störung handelt, wird der Betreffende direkt einem Traumatherapeuten vorge­ stellt, der dann abklärt, ob • die Aufnahme zu einer stationären Therapie • eine ambulante Kurzintervention (2-6 Termine) • eine einmalige Diagnostik mit inte­ grierter Beratung angemessen ist. In dieser Phase kommt es darauf an, die Bedeutung des Geschehenen für das eigene Leben zu erarbeiten, daraus neue Perspektiven für die Zukunft zu ent­ wickeln und die Bedeutung des Traumas für das Selbst- und Weltbild zu überden­ ken. Lebensplanungen, berufliche und familiäre Folgen werden im Gespräch erörtert und Angehörige soweit wie möglich einbezogen. In der Integrationsphase wird versucht, die Vermeidung in einem weit allgemei­ neren Sinne aufzulösen. Während die Vermeidungsreaktion darauf abzielt, das Trauma aus dem Leben zu verbannen (mit dem paradoxen Ergebnis, dass es gerade deshalb nicht weicht), zielt die Traumatherapie auf Integration der trau­ matischen Erfahrung in das Leben des Opfers. Dabei muss der Pat. darin unterstützt werden, Verlust zu akzeptieren, Trauer zuzulassen, neuen Sinn zu finden, Vergebung und Selbstvergebung Raum zu geben, neue Verhaltensweisen zu erlernen etc. Selbstverständlich werden die drei Hauptphasen der Traumatherapie nicht linear durchlaufen. Alle drei Aspekte haben zu jeder Zeit im Prozess einen Traumbedingte psychische Störungen BwK HH 1995 - 2000 60 53 50 Patientenzahl › Im stationären Setting hat es sich be­ währt, die Patienten zu einem einwöchigen diagnostischen Aufenthalt einzube­ stellen. Dabei wird den diagnostischen Maßnahmen der therapeutische Aufwand abgeschätzt, der Aufbau einer belastbaren Vertrauensbeziehung eingeleitet, sowie das Krankheitsmodell erklärt. Der Betroffene erhält eine Einweisung in das therapeutische Vorgehen. Für die eigentliche Therapiephase wird ein ca. 6-wöchiger Aufenthalt eingeplant, der je nach Therapieverlauf verkürzt, verlängert oder durch eine oder mehrere weitere 42 40 30 20 21 13 10 18 16 14 10 1 3 2 1997 1998 stationäre Therapiesequenzen ergänzt werden kann. Eine ambulante Nachbe­ treuung wird angeboten oder vermittelt. Dabei hat es sich als günstig erwiesen, durch Verlängerung der ambulanten Sitzungsintervalle ein behutsames Ausschleichen zu gewähren. Ein wichti­ ger Gesichtspunkt in dieser Phase ist der Umgang mit Rückschlägen. Es kommt ganz wesentlich darauf an, realistische Erwartungen hinsichtlich der weiteren Entwicklung zu unterstützen. Dies ist besonders bei Traumata mit bleibenden Körperschäden, bei Verlusten (z.B. durch Tod) sowie bei stark veränderten (eingeschränkten) Lebensperspektiven der Fall. Eigene Erfahrungen im Bundeswehrkrankenhaus Hamburg Wir haben seit 1994 praktisch-therapeu­ tische Erfahrung mit ca. 200 Patienten gewonnen, die wir bis jetzt stationär un­ tersucht und behandelt haben. Darüber hinaus wurde in dieser Zeit eine große Anzahl von PTBS-Patienten ambulant untersucht, zur Therapie weitervermittelt oder begutachtet. Anfänglich spielten die einsatzbedingten psychischen Störungen zahlenmäßig nur eine untergeordnete Rolle. Seit Beginn des Kosovo-Einsatzes im Juni 99 hat dieser Anteil aber deutlich zugenommen und in den ersten 4 Monaten 2000 haben wir mehr einsatzbedingte psychi­ sche Störungen gesehen als insgesamt in den 5 Jahren zuvor. Fast alle 53 ein­ satzbedingten PTBS-Fälle des Jahres 2000 stammten aus dem Kosovo-Einsatz. (Abb. 2) Obwohl die Situation im Kosovo stabiler geworden ist als zu Beginn der Invasion, ist auch weiterhin mit einer hohen Pati­ entenzahl zu rechnen, da die psychotrau­ matische Störungen erst mit einer Latenz von Monaten bis Jahren auftreten können, bzw. Betroffene sich erst mit großer Verzögerung in Behandlung begeben. 0 1995 1996 einsatzunabhängig 1999 2000 einsatzbedingt Die Therapiedauer ist sehr unterschied­ lich und variiert zwischen wenigen The­ rapiestunden und monatelanger statio­ närer Behandlung. (Abb. 3) Abb. 2 45 Durchschnittliche Therapiesitzungen und Traumatyp1 40 Anzahl Sitzungen › 30 20 10 0 1995 1996 1997 Trauma Typ I 1998 Trauma Typ II Abb. 3 Eine geplante Evaluierung in einer Therapiestudie steht noch aus, kann aber momentan aufgrund der nicht ausreichenden personellen Ausstattung nicht durchgeführt werden. Traumatherapie ist eine sehr zeit- und personalintensive Arbeit, für die die psychiatrischen Abteilungen der Bundeswehrkrankenhäuser mit ihrer traditionell diagnostisch-gutachterlichen Orien- 1 › tierung nur unzureichend eingerichtet sind. Dies betrifft sowohl Ausbildung und Anzahl des Personals als auch Art und Gestaltung der räumlichen Gegebenheiten. In einem Bericht (Süddeutsche Zeitung, 2000) über das Schicksal des kanadischen Oberbefehlshabers der UN-Mission in Ruanda, General Dallaire, der schwer psychisch traumatisiert dienstlich und privat nicht wieder Fuß fassen konnte, wird dieser mit den Worten zitiert: „Der Zorn, die Wut, der Schmerz und die kalte Einsamkeit, die einen von der Familie, Freunden und von der täglichen Routine der Gesellschaft trennen, sind so macht­ voll, dass die Option, sich selber zu zer­ stören, real und attraktiv ist.“ Weiter heißt es: „In Kanada beginnt man zu begreifen, welchen Preis die Friedens­ soldaten für ihren Einsatz gezahlt haben. Die Armee steckt mehr Geld in Thera­ piekliniken, die den seelisch verwundeten Soldaten helfen sollen ...“ Mittlerweile haben die Kanadischen Streitkräfte über das Land verteilt 5 Traumazentren einge­ richtet. Unsere Bemühungen zielen darauf, den deutschen Soldaten, die traumatisiert aus dem Einsatz zurückkehren effektive Hilfe dabei zu leisten, in die „Normalität“ zurück zu finden. Die bisherigen Erfah­ rungen belegen, dass dies möglich ist, wenn die notwendige personelle, materi­ elle und organisatorische Unterstützung gewährleistet wird. Typ-I-Traumen sind kurzdauernde traumatische Ereignisse, die meist durch akute Lebensgefahr, Plötzlichkeit und Überraschung gekennzeichnet sind. Typ-II-Traumen sind längerdauernde, wiederholte Traumen mit Serien verschiedener traumatischer Einzelereignisse und geringer Vorhersagbarkeit des weiteren traumatischen Geschehens. Literatur Fischer, G., Riedesser, P. (1998): Lehrbuch der Psychotraumatologie, UTB (Reinhardt) München . Fischer, G., (2000) Mehrdimensionale Psychodynamische Traumatherapie: MPTT, Asanger, Heidelberg. Flatten et. al. (Hrsg) (2001) Posttraumatische Belastungsstörung, Reihe Leitlinien Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Schattauer, Stuttgart. Heiland, T., Maercker A. (2000) Konfrontation und kognitive Umstrukturierung – Kognitive VT in der Verarbeitung von Gewalterfahrungen, Psychotherapie im Dialog 1 , 21-27. Hofmann, A. (1999) EMDR in der Therapie psychotraumatischer Belastungssyndrome, Thieme Stuttgart. Maercker A. (Hrsg.) (1997) Therapie der posttraumatischen Belastungsstörungen. Springer, Berlin. Mitchell, J. T. & Everly G. S. (1998). Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen. Stumpf und Kossendey, Edewecht. Reddemann, L., (2001) Imagination als heilsame Kraft, Reihe: Leben lernen 141, Pfeiffer bei Klett-Cotta, Stuttgart. Reddemann, L., Sachsse, U. (1997) Stabilisierung, Persönlichkeitsstörungen 1997 ; 3 : 113 – 147 . Shapiro, F. (1998a) EMDR – Grundlagen und Praxis, Junfermann, Paderborn. Shapiro, F. (1998b) EMDR in Aktion, Junfermann, Paderborn. Shay, J. (1998) Achill in Vietnam: Kampftrauma und Persönlichkeitsverlust, Hamburger Edition HIS, Hamburg. Süddeutsche Zeitung vom 10.August 2000, Seite 8 46 Auswirkungen von Stress und Traumatisierungen bei Soldaten der Bundeswehr Karl-Heinz Biesold, Klaus Barre Kurzfassung In der Abteilung Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie des Bundeswehrkrankenhauses Hamburg beschäftigen wir uns seit Beginn der internationalen Einsätze in Kambodscha, Somalia und jetzt auf dem Balkan schwerpunktmäßig mit der Diagnostik und Therapie einsatzbe­ dingter psychischer Störungen. Dabei handelt es sich vom Erscheinungsbild und Verlauf her um vielgestaltige Krankheitsbilder. Sie äußern sich nicht nur in der Symptomatik, die in der ICD-10 als Posttraumatische Belastungsstörung beschriebenen ist. Es treten zahlreiche Symptomüberlappungen, bzw. Komorbiditäten mit anderen psychiatrischen Erkrankungen auf. Die differentialdiagnostischen Probleme wer­ den erörtert und ein neurophysiologisches Modell vorgestellt. Einleitung Die besonderen Bedingungen friedens­ schaffender oder -sichernder internationa­ ler Einsätze im Rahmen von UN- und NATO-Missionen stellen außergewöhnliche Anforderungen an die Soldaten der Bundeswehr. Sie werden mit Leichen und Verstümmelungen, mit Chaos und Zer­ störung, unklaren Konfliktlagen, evtl. Gefangenschaft, mit fremden Kulturen, langdauernder Trennung von zu Hause, permanenter Überforderung aber auch Langeweile und Unterforderung konfron­ tiert. Oft und nicht zuletzt besteht die Belastung in dem Gefühl totaler Hilflosig­ keit gegenüber Not und Elend im Einsatz­ land (Wothe, 2001; Weerts, 2001). Gesellschaftlicher Auftrag (humanitärer Einsatz) und persönliche Motivation (hel­ fen wollen) stehen mitunter in deutlichem Gegensatz zu Einstellung und Haltung der Bevölkerung in den Hilfsgebieten. Manchmal werden die Soldaten als Be­ satzer gesehen oder geraten zwischen die Fronten rivalisierender Gruppen. Nicht sel­ ten schlagen ihnen Ablehnung und Hass entgegen. Aber auch im Heimatland treffen Soldaten der Bundeswehr oft auf Zweifel, Unver­ ständnis, Gleichgültigkeit, ja Ablehnung ihres Einsatzes. Nicht einmal bei den eige­ nen Kameraden zu Hause können sie immer auf Verständnis zählen, da die ihre Arbeit in den Heimatverbänden mit erledi­ gen mussten. Sie waren deshalb oft genug ebenfalls stark belastet, ohne dafür öffent­ liche Anerkennung in der Presse, Orden oder eine besondere Bezahlung zu erhal­ ten. Und auch die eigene Partnerin oder die Familie können manchmal kaum ver­ stehen und akzeptieren, was der Einzelne erlebt und wie sehr ihn dies verändert hat. In kurzfristigen oder länger dauernden Extremsituationen wird die Fähigkeit zur Belastungsverarbeitung von Menschen oft überfordert, eine intensive, überwältigende und desorganisierende Erfahrung bzw. Erleben zerstört Orientierungen und halt­ gebende Selbst- und Weltbilder. In der Folge kommt es u.U. zur Entwicklung einer seelischen Störung, die sich schleichend (bei Dauerbelastung) oder akut (bei Extremerlebnissen) entwickeln kann. Sie tritt nicht selten verzögert auf und entfal­ tet ihre schädigende Wirkung möglicher­ weise auch dann weiter, wenn der Einsatz oder das schädigende Ereignis längst vor­ bei sind. Im Bundeswehrkrankenhaus Hamburg (BwK HH) haben wir seit 1994 kontinuier­ lich einen Behandlungsschwerpunkt für psychotraumatische Störungen mit einem spezifischen Therapieangebot aufgebaut. Die Behandlungserfahrungen machten deutlich, dass herkömmliche Kriseninter­ ventionsmaßnahmen und allgemeine Psychotherapie oft nicht ausreichen, um schwer traumatisierten Menschen ange­ messen und wirksam zu helfen. Es war deshalb erforderlich, spezifische trauma­ therapeutische Kompetenz zu erwerben und im Bundeswehrkrankenhaus Hamburg zu etablieren. 47 › Faktoren bei der Entwicklung posttraumatischer psychischer Prozesse Ereignisfaktoren Risikofaktoren • • • • • Alter zum Zeitpunkt der Traumatisierung (sehr jung, sehr alt) • frühere belastende Erfahrungen • frühere psychische Störungen • niedrige sozioökonomische Schicht Traumaschwere Unerwartetheit mangelnde Kontrollierbarkeit peritraumatische Dissoziation - Posttraumatische psychische Prozesse - + Schutzfaktoren • Kohärenzsinn • soziale Unterstützung • Bewältigungsprozesse modifiziert nach A. Maercker Abb. 1 Diagnostik Die akute Belastungsreaktion Differentialdiagnostisch müssen wir un­ terscheiden zwischen einsatzbedingten psychischen Störungen, entstanden durch die allgemeinen Stressoren des Einsatzes und den psychotraumatischen Störungen im engeren Sinne, die an das Erleben be­ sonders belastender Ereignisse gebunden sind. Zunächst kommt es nach einem „Psycho­ trauma“ häufig zu einer vorübergehen­ den Störung von beträchtlichem Schweregrad. Auch bei einem psychisch gesunden Menschen entwickelt sie sich als „Extrem-Stress-Reaktion“ auf die außergewöhnliche Belastung. Es tritt ein gemischtes und gewöhnlich wechselndes Bild auf: nach dem anfänglichen Zustand von „Betäubung“ werden Depression, Angst, Ärger, Verzweiflung, Überaktivität und Rückzug beobachtet. Diese Reaktion klingt meist ohne weitere Maßnahmen innerhalb von Stunden oder Tagen wieder ab, was man als eine Art „Selbstheilungsprozess“ versteht (Fischer & Riedesser, 1998). Untersuchungen zum Spontanverlauf von psychischen Traumatisierungen haben gezeigt, dass nach einer Woche noch 94% der Betroffenen Symptome zeigten, es dann aber im Verlauf der ersten 3 – 6 Monate bei Zweidrittel bis Dreiviertel ohne therapeutische Maßnahmen zu einer Besserung kam und danach die Zahl der symptomatischen Fälle fast sta­ bil blieb. Dies sind die Fälle, die den psychotraumatologisch tätigen Psychotherapeuten beschäftigen. In der Internationalen Klassifikation psy­ chischer Störungen der Weltgesundheits­ organisation ICD-10 (International Classification of Diseases) von 1991 sind die „Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen“ in der Kate­ gorie F 43 erfasst (Dilling et al., 1991). Zu diesen Krankheitsbildern wird einlei­ tend ausgeführt: „Zusammen gefasst handelt es sich um Reaktionen, die als direkte Folge einer akuten schweren Be­ lastung oder eines kontinuierlichen Trau­ mas entstehen. Das belastende Ereignis oder die andauernde bedrohliche Situa­ tion sind der primäre und ausschlagge­ bende Kausalfaktor, und die Störung wäre ohne seine Einwirkung nicht ent­ standen.“ Es werden folgende Reaktionsbilder unterschieden: F 43.0 F 43.1 48 akute Belastungsreaktion und posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) . Der weitere Verlauf, d.h. ob es zu einer Stabilisierung im psychischen Befinden des Betroffenen kommt oder ob sich eine posttraumatische Belastungsstörung ent­ wickelt, ist von verschiedenen Faktoren abhängig, die den Heilungsprozess för­ dern oder behindern können. Sowohl traumaabhängige, wie auch persönliche und insbesondere soziale Faktoren spie­ len dabei eine Rolle (Maercker, 1997). (Abb.1) Ereignisfaktoren: Die Schwere des Traumas und das Aus­ maß der Folgen stehen in direktem Zu­ sammenhang (Dosis-Wirkungs-Bezie­ hung). Die Unerwartetheit oder Plötzlich­ keit ist ein weiterer Faktor, dessen nega­ tive Bedeutung für die Entstehung von PTBS in der Literatur gut belegt ist. Der Verlust der Kontrollierbarkeit, das heißt das Gefühl, während des Traumas völlig ausgeliefert zu sein und die Autonomie verloren zu haben, verschlechtert die Prognose des Verarbeitungsprozesses ebenfalls. Auch das Auftreten bzw. die Ausprägung peritraumatischer Dissozia­ tionen korrelieren mit dem Risiko eine PTBS zu entwickeln. Risikofaktoren: Jugendliches und sehr hohes Lebensalter, frühere belastende Erfahrungen, psychi­ atrische Störungen in der Vergangenheit sowie niedrige sozioökonomische Schichtzugehörigkeit sind Risikofaktoren, die die Folgen der Extrembelastungen verstärken, bzw. ihnen erst zur Mani­ festation verhelfen. Ob vor dem Trauma bestehende Persön­ lichkeitseigenschaften, bzw. -merkmale eine Rolle spielen, bzw. einen Prädiktor für die Entwicklung von PTBS darstellen, ist wiederholt untersucht worden, ohne dass sich Hinweise für diese Annahme ergeben haben. Nach Untersuchungen des Psychologischen Instituts der Uni­ versität Köln und des Deutschen Instituts für Psychotraumatologie (DIPT) an Ge­ waltopfern ist der „Kölner-Risiko-Index“ – Bewertungsbogen entwickelt worden, der Ereignis- und Risikofaktoren erfasst und der Früherkennung besonderer Risikogruppen dient, die später nach einer akuten Belastungsreaktion eine PTBS entwickeln. Hier wird von 1/3 Risikopatienten, 1/3 Selbsterholern und 1/3 Wechseltypen gesprochen (Fischer & Becker-Fischer & Düchting, 1998). Es laufen zur Zeit im Auftrag des Psycho­ logischen Dienstes der Bundeswehr ent­ sprechende Untersuchungen zur Erstellung eines Risiko-Fragebogens für Soldaten, um danach differenzierte frühe Interventionsmaßnahmen zu entwickeln. Schutzfaktoren: Der Kohärenzsinn, d.h. die Fähigkeit, das Geschehene geistig einordnen, verstehen und ihm einen Sinn geben zu können, hat einen günstigen Einfluss darauf, Extrembelastungen ohne psychische Störungen zu überstehen. Auch der Grad sozialer Unterstützung ist maßgeblich, wenn es darum geht, das Risiko PTBS zu entwickeln gering zu halten. Mit Bewältigungsprozessen, die ebenfalls Schutzfaktoren sind, sind die Fähigkeit und Möglichkeit über das Trauma zu reden, Arztbesuche oder andere Hilfe in Anspruch zu nehmen gemeint. Nach jetzigen Erkenntnissen scheint der Verlauf vor allem auch von den getroffe­ nen Erstmaßnahmen abhängig zu sein. Zur frühzeitigen Intervention (early inter­ vention) nach belastenden Ereignissen, die bei der Bundeswehr ja nicht nur im Rahmen der Auslandseinsätze auftreten können, sondern z.B. auch bei inländi­ schen Katastrophen (z.B. Helfer beim ICE-Unglück von Eschede), wurden Einsatznachbereitungsgruppen (ENG) gebildet, die mit Betroffenen Debriefings auf der Basis des Critical-IncidentStress-Management (CISM) nach Jeffrey › T. Mitchell durchführen können (Mitchell & Everly, 1998). Die Effektivität dieser CISM-Maßnahmen ist derzeit allerdings wissenschaftlich umstritten, da es an­ geblich nicht ausreichend zielgruppenori­ entiert durchgeführt werden könne und bei 5% der Teilnehmer sogar zu einer Verschlechterung des Befindens führe. Eine nachweisbare PTBS-prophylaktische Wirkung bestehe nach bisherigen Un­ tersuchungen nicht. Dennoch werden zunehmend solche CISM-Maßnahmen für Opfer und Helfer bei Katastrophen von der Öffentlichkeit und den Betroffenen selbst gefordert, zumindest wenn bei Großschadensereignissen Individual­ versorgung nicht möglich ist. Da die Erfahrungen aus der Untersuchung von Gewaltopfern gezeigt haben, dass frühe Interventionen (Einzeltherapie) ausgewählten Risikopatienten hilft, ist es wichtig, solche Risiko-Gruppen zu erken­ nen. Zusätzlich stellt sich dann natürlich auch die Frage, welche Interventionsform zu welchem Zeitpunkt effektiv ist und unter welchen Bedingungen die Maßnahmen stattfinden sollen. Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) Selbst bei optimaler Erstversorgung Psychotraumatisierter klingen nicht alle Belastungsreaktionen nach ihrer akuten Symptome der Posttraumatischen Belastungsstörungen Wiedererinnerung (Intrusion) • Wiederholte aufdrängende Erinnerung oder Wiederinszenierungen der Ereignisse in Gedächtnis (Nachhallerinnerungen, flashbacks), Tagträumen oder Träumen Erhöhtes Erregungsniveau • Zustand erhöhter vegetativer Übererregbarkeit mit Vigilanzsteigerung, übermäßiger Schreckhaftigkeit und Schlaflosigkeit Rückzug (Konstriktion) • Andauerndes Gefühl von Betäubtsein und emotionaler Stumpfheit, Gleichgültigkeit und Teilnahmslosigkeit gegenüber anderen Menschen, Anhedonie • Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen können, • Angst und Depressionen mit Suizidgedanken, Alkoholmissbrauch und Drogenkonsum • akute Ausbrüche von Angst, Panik, Aggression, ausgelöst durch Erinnerung / Wiederholung des Traumas, sog. triggern Phase wieder ab. Es kann sich als verzö­ gerte oder protrahierte Reaktion auf das belastende Ereignis eine Posttraumati­ sche Belastungsstörung entwickeln. Unserer Erfahrung nach treten Symptome nicht selten erst nach vielen Monaten, gelegentlich auch erst nach vielen Jahren auf. Abgesehen davon versuchen die Betrof­ fenen oft lange Zeit mit ihren Problemen (Symptomen) alleine klar zu kommen. Sie haben Angst als „verrückt“ zu gelten, wissen oft auch gar nicht, dass es Thera­ piemöglichkeiten gibt, sodass sie erst verzögert um Hilfe nachsuchen. Die Leiden spielen sich dann oft im Verbor­ genen und wenig spektakulär ab. Schamgefühle und Sprachlosigkeit auch im sozialen Umfeld (Familie / Kame­ radenkreis) erschweren die Integration in die „Normalität“. Häufig folgt eine Ausgrenzung aus dem beruflichen und familiären Leben, Dienstunfähigkeit, eventuell Flucht in Alkohol oder Drogen als Selbstbehandlungsversuch und damit schließlich auch noch die moralische Abwertung durch das soziale Umfeld. Die Suizidrate ist unter psychisch Trauma­ tisierten deutlich erhöht. Um den Begriff des Traumas nicht infla­ tionär für jeden Zwischenfall zu benut­ zen, definiert die ICD-10 es als „eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung für die Sicherheit oder körperliche Unver­ sehrtheit des Betroffenen oder anderer Personen, die bei fast jedem eine tiefe Verstörung hervorrufen würde (Katastro­ phen, Kampfhandlungen, schwere Unfälle, Zeuge gewaltsamen Todes, Opfer von Folterung, Terrorismus, Vergewal­ tigung)“. Prämorbide Faktoren können den Verlauf beeinflussen, sind aber weder nötig noch ausreichend, um das Auftreten der Stö­ rung zu erklären. D.h. jeder auch psy­ chisch stabile, gesunde Mensch kann da­ von betroffen werden, unabhängig von Dienstgrad, Vorbildung, Ausbildung und allgemeiner psychischer Belastbarkeit, wenn die traumatischen und peritrauma­ tischen Verhältnisse entsprechend über­ wältigend sind. Typisch für die PTBS ist die Symp­ tomtrias: Wiedererinnerung, erhöhtes Erregungsniveau und Rückzug. (Abb.2) Abb. 2 49 Unbehandelt bleiben bei ungefähr der Hälfte der PTBS-Patienten die Symptome länger als 1 Jahr bestehen, bei einem Drittel (das sind 10% aller Traumatisier­ ten) mehr als 10 Jahre. Nach amerikani­ schen Untersuchungen litten noch 15 Jahre nach Ende des Vietnamkrieges so­ gar die Hälfte der 1 Million traumatisier­ ten amerikanischen Soldaten unter dem Vollbild einer PTBS (Kulka, 1990). Die klinischen Erscheinungsbilder trau­ mabedingter Störungen sind vielfältig und gehen über die oben genannte Symptomkonstellation der „klassischen“ PTBS hinaus. Die Symptomatologie kann sich im Laufe des traumatischen Prozesses und der Verarbeitung des Traumas ändern. Nach dem zunächst vorliegendem typischen Bild einer PTBS kann dann z.B. vorübergehend eine Angstsymptomatik oder eine Depression im Vordergrund stehen oder eine Suchtproblematik auftreten. Man muss also daran denken, dass sich auch hinter zahlreichen anderen psychiatrischen Krankheitsbildern durch ein Psycho­ trauma verursachte Störungen verbergen können. Die Komorbiditätsrate mit ande­ ren psychischen Störungen, insbesondere mit Depressionen, Angsterkrankungen und Sucht, beträgt fast 90%. Mittlerweile ist auch erwiesen, dass dis­ soziative Störungen, die bei 5 – 15 % › aller psychiatrischen Patienten auftreten, fast alle durch psychische Traumatisierungen verursacht sind (Fiedler, 2001). Neurophysiologie des Traumas Es ist schon lange bekannt, dass psychi­ sche Traumatisierungen sowohl eine psy­ chische als auch eine organische Genese haben (Physioneurosis) (Kardiner, 1941), was sich heute durch den Nachweis neu­ robiologischer und endokrinologischer Veränderungen belegen lässt. Die normale Informationsverarbeitung im Gehirn geschieht durch ständige Filterung der Hunderte Millionen von Impulsen, die pro Minute das Gehirn aus der sensorischen Peripherie erreichen. Im Thalamus erfolgt eine Wertung in wich­ tig und unwichtig und nur ein kleiner Teil der Informationen erreicht den Kortex bzw. das Bewusstsein. Die Zuordnung der Wichtigkeit – das Setzen der Reiter auf die Info-Karteikarte – erfolgt im Mandelkern (Amygdala). Die gefilterten Informationen werden dann in den sen­ sorischen kortikalen Arealen modalitä­ tenspezifisch verarbeitet, werden aber nach kurzer Zeit durch neu eintreffende Informationen überschrieben. Nur wenige wichtige Informationen werden über das „hippocampale“ Erinnerungssystem gespeichert, wo sie aber nicht mehr mit Informationsverarbeitungsblockade bei psychischer Traumatisierung frontaler Kortex (sensorische und kognitive Integration) Hippocampus Amygdala Emotionale Bedeutung Zuordnung von Signifikanz „kognitive Weltkarte“ Thalamus Psychotrauma Reiz „Filter“ für sensorische Informationen Visuell akustisch olfaktorisch kinästhetisch gustatorisch Abb. 3 50 starken Gefühlen belastet sind. Sie sind zeitlich, räumlich, inhaltlich geordnet und bilden eine „kognitive Weltkarte“ und stehen für weitere Planungs- und Entscheidungsprozesse zur Verfügung. Im Moment der Traumatisierung kommt es nun zu einer akuten Reizüberflutung des Gehirns mit massiver Aktivierung noradrenerger und corticotroper Systeme sowie endogene Opiate produzierender Systeme, die den kontinuierlichen Zu­ strom auch solcher eintreffender Infor­ mationen unterbrechen, die für das Überleben der erlebten akuten Lebens­ gefahr wichtig sind. Die Spätfolgen der Reizüberflutung und Unterbrechung des Informationsstroms – das ist die Wunde nach einer seelischen Traumatisierung – zeigen sich in Form der PTBS-Symptome. Die Informationsverarbeitungsprozesse werden blockiert. Die sensorische Infor­ mation, die auch während eines trauma­ tischen Ereignisses in der Schaltstelle des Thalamus zum Mandelkern weitergeleitet wird, bleibt im Umfeld dieses Erinne­ rungssystem praktisch „stecken“. Sie kann deshalb nicht in die weiteren Verarbei­ tungsmöglichkeiten des Hippocampus und Frontalhirns einbezogen, deshalb zu keiner „konstruktiven Erfahrung“ verar­ beitet werden (van der Kolk, 2000; Hofmann, 1999). (Abb.3) Durch diese Blockierung wird der gespei­ cherten traumatischen Erinnerung keine Zeit- und Raumachse beigefügt. Der Betroffene erlebt die flash-backs nicht wie Erinnerungen, sondern wie das akute Durchleben einer noch bestehenden Ge­ fahrensituation, verbunden mit allen da­ zugehörigen Ängsten, vegetativen Reak­ tionen und Emotionen. Für ihn ist die traumatisierende Situation nicht vorbei, sobald erinnernde Umstände fragmen­ tierte Informationen „triggern“. Es fällt den Betroffenen deshalb so schwer, das Erlebte „hinter sich zu lassen“, es in einen biographischen Kontext einzufü­ gen, wie man Bilder in ein Fotoalbum ordnen würde um sie anzuschauen, wenn man will. Weiterhin scheint gesi­ chert, dass das traumatische Gedächtnis nach dem „Alles-oder-Nichts“-Prinzip arbeitet. Traumatische Erinnerungen wer­ den niemals gelöscht. Die Zeit allein heilt keine Wunden! Der Blick auf das Erlebte kann aber spontan oder durch geeignete therapeutische Maßnahmen in eine heilende, konstruktive Perspektive gerückt werden. Traumaopfer zeigen auch entsprechende messbare psychobiologische Verände­ rungen der Hypothalamus-HypophysenNebennieren-Achse (HHNA), des noradrenergen Systems (Arousals / Schlafstörungen) und der endogenen Opiate. MRT-Untersuchungen haben gezeigt, › dass chronischer Stress zu neuronalen Zelluntergängen mit einer hippocampa­ len Atrophie (5-26% Volumenvermin­ derung) führt (Hippocampus = Ort komplexer Lernvorgänge: Zuordnung emotio­ naler Bedeutungen zu Ort und Stimuli). Unter Nutzung der Positronen-EmissionsTomographie (PET) lässt sich der regiona­ le cerebrale Blutfluss (rCBF) messen. Er zeigt bei PTBS-Patienten unter Provokationsbedingungen rechtslateral im Gyrus cinguli und in der Amygdala eine Erhöhung und linkslateral, insbeson­ dere in der Broca-Region eine Verminderung (Ehlert, 1999). Literatur Dilling, H.& Mombour, W. & Schmidt, M.H. (Hrsg) (1991). Internationale Klassifikation psychischer Störungen ICD-10 Kapitel V (F) Klinisch-diagnostische Leitlinien. Weltgesundheitsorganisation. Bern: Huber. Ehlert, U. (1999). Psychobiologische Aspekte der PTBS, Nervenarzt 70: 773-779 Fiedler, P. (2001). Dissoziative Störungen und Konversion. Weinheim: Beltz. Fischer, G.& Riedesser, P. (1998). Lehrbuch der Psychotraumatologie. München: UTB (Reinhardt). Fischer, G. & Becker-Fischer, M. & Düchting, C. (1998). Neue Wege in der Opferhilfe. Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell (KOM).Hrsg.: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Hofmann, A. (1999). EMDR in der Therapie psychotraumatischer Belastungssyndrome. Stuttgart: Thieme. Kardiner, A. (1941). The traumatic neuroses of war. New York: Hoeber Kulka, R.A.& Schlenger, W.E.& Fairbank, J.A. et al. (1990). Trauma and the vietnam war generation. New York: Brunner & Mazel Maercker A. (Hrsg.) (1997). Therapie der posttraumatischen Belastungsstörungen. Berlin: Springer. Mitchell, J. T. & Everly G. S. (1998). Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen. Stumpf und Kossendey, Edewecht. van der Kolk, B.A. & Mc Farlane, A.C.& Weisaeth, L. (Hrsg.) (2000). Traumatic stress, Paderborn: Junfermann. Weerts, J.M.P. (2001). Studies on Military Peacekeepers. In Danieli, Y. (Hrsg.) Sharing the frontline and the back hills: international protectors and providers (S.31-48). New York: Baywood publishing. Wothe, K. (2001). Belastungsfaktoren im Einsatz. In K. Puzicha, D. Hansen & W. Weber (Hrsg.), Psychologie für Einsatz und Notfall (S.65-71). Bonn: Bernard & Graefe Verlag. 51 Organisation des Critical Incident Stress Managements in der Bundeswehr* Wolfgang W. Weber Kurzfassung Mit Beginn der Unterstützung von Auslandseinsätzen verstärkte sich der Bedarf an primären Interventionsmaßnahmen, um die Belastung betroffener Soldaten zu minimieren. Nach der Analyse nationaler und internationaler Modelle bzw. Vorgehensweisen entschied sich der Bundesminister der Verteidigung zur Anpassung des Critical Incident Stress Managements nach Mitchell und Everly an die nationalen Bedürfnisse. Nach einem kurzen Rückblick auf die Entscheidungsgründe werden die bisher realisierten Stationen und ihre organisatorische Einbettung in bestehende Strukturen der Bundeswehr erläutert und aktuelle wissenschaftliche Begleituntersuchungen dargestellt. Bisherige Erfahrungen aus Einsätzen im In- und Ausland werden angesprochen. 1 Einleitung Schon immer haben sich Menschen um diejenigen gekümmert, die von einem besonders schlimmen Ereignis, dem Tode eines Angehörigen, einem Unfall etc. betroffen waren. Die Hilfe bzw. Unter­ stützung folgt in der Regel bestimmten Formen und ist häufig (z.B. durch Tragen von Trauerkleidung) ritualisiert. Zur Gruppe der von einem Extremereignis besonders Betroffenen gehören nicht nur Opfer und Zeugen eines solchen Gesche­ hens sondern auch die Helfer. In militäri­ schem Kontext könnten die „Rollen“ kon­ kret so aussehen: Ein Soldat, der in Kampfhandlungen verwickelt ist, wird verwundet. Ein anderer wird Augenzeuge, wie sein Kamerad getötet wird. Ein Drit­ ter wird dadurch extrem belastet, dass er die Leichen seiner Kameraden bergen muss. Psychologische Krisenintervention bei derartig Betroffenen dient dem Erhalt bzw. der Wiederherstellung der individu­ ellen Integrität, der Erlebnis- und Hand­ lungsfähigkeit sowie der Vermeidung von Spätschäden. Die systematischen Maß­ nahmen, die in einem unmittelbaren Zu­ sammenhang mit der Bewältigung eines solchen kritischen Ereignisses stehen, werden im Folgenden unter dem Begriff des ‚Critical Incident Stress Management’ (CISM) zusammengefasst und betrachtet. Nach hiesiger Kenntnis wird eine syste­ matische Krisenintervention in der Mili­ tärliteratur erstmalig durch Kardiner & Spiegel (1947) beschrieben. Diese Auto­ ren sprechen im Hinblick auf den Zeit­ punkt der Anwendung und der Ausge­ staltung zu applizierender Maßnahmen von einem ‚PIE‘–Modell. Dabei stehen die einzelnen Buchstaben P für proximity (Nähe zum Ereignis), I für immediacy (Unmittelbarkeit) sowie E für expectancy (Art, Form und Ziel der Unterstützung). Als Effekte der Krisenintervention stellen die Autoren heraus, dass das Verfahren die Würde des Individuums stärke, es sich positiv auf die Funktionsfähigkeit der betroffenen Gruppe auswirke und zu einer raschen Wiederherstellung der Ein­ satzfähigkeit der betroffenen Soldaten führe. Psychologische Krisenintervention im zivilen Umfeld (z.B. bei der Polizei, der Feuerwehr, Rettungs- und Notfalldien­ sten) erfuhr den Durchbruch mit der Ver­ öffentlichung von Mitchell (1983). 2 Critical Incident Stress Management (CISM) in der Bundeswehr Die Unterstützungsmaßnahmen für be­ sonders belastete Soldaten der Bundes­ wehr sind in die Vorgaben des ‚Rahmen­ konzept zur Bewältigung psychischer Belastungen bei Soldaten’ eingebunden. Es gilt für den Gesamtbereich der Streit­ * Vortrag gehalten auf dem dreitägigen Fachseminar Posttraumatische Belastungsstörung vom 08.-10. Oktober 2001 in der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont. 53 › Das Rahmenkonzept zur Bewältigung Psychischer Belastungen bei Soldaten Grundsätze Bewältigung psychischer Belastungen von Soldaten Phase I Einsatzvorbereitung Phase II Einsatzdurchführung Phase III Einsatznachbereitung Zu erwartende Belastungen Erkennen akuter psych. Belastungen Reintegration Streß Training Sofortmaßnahmen/ Erfassung d. Sold. Ebene 1 Selbst-/Kameradenhilfe Vorgesetzte/ ausgebildete Kameraden Ebene 2 TrPsych; TrArzt; Sozial­ dienst; MilSeelsorge Erkennen und Behandeln von Folgeschäden (PTSD) Ebene 3 Fachärzte klinische Psychologen Abb. 1 kräfte, d.h. die vier Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe, Marine und Sanitätsdienst. Aktuell liegt es in seiner neuesten Fas­ sung vom März 2000 vor. Es wird konti­ nuierlich überprüft und fortgeschrieben. Im Konzept werden drei Phasen eines Einsatzes angesprochen, in denen unterschiedliche Unterstützungsangebote vorgesehen sind. Diese gliedern sich wiede­ rum in jeweils drei qualitativ unter­ schiedliche Ebenen fachlicher Qualifikation. Daher ist das Konzept auch unter der Bezeichnung ‚Drei Phasen – Drei Ebe­ nen – Konzept’ bekannt (Abb. 1). Die drei Phasen sind • Phase I die Einsatzvorbereitung, • Phase II die Einsatzbegleitung und • Phase III die Einsatznachbereitung. Während der Phase I, der Einsatzvorbe­ reitung – das kann sowohl während der Allgemeinen Grundausbildung als auch im Zusammenhang mit einem geplanten Einsatz sein –, werden die Soldaten ganz allgemein über zu erwartende Belastun­ gen unterrichtet. Sie werden auf ihre eigenen Fähigkeiten zur Belastungsbe­ wältigung (fachlich: stress-coping) auf­ merksam gemacht und über die verschie­ denen vorgesehenen bzw. verfügbaren Unterstützungsmöglichkeiten hingewiesen. Die Tiefe dieser Informationen gliedert sich – wie vorgesehen – in drei Ebenen: 54 Ebene 1: Ebene 1 ist die Selbst- und Kameradenhilfe, die Unterstützung durch Vorgesetz­ te und/oder durch ausgebildete Kamera­ den (Peers). Ebene 2 Je nach Lage und zu erwartender Belas­ tung wird eine Informationsqualität gefordert, die durch den Truppenarzt, den Truppenpsychologen, den Sozialdienst und/oder den Militärpfarrer angeboten und an die Soldaten herangetragen wird. Ebene 3 Es kann erforderlich sein, die Soldaten durch Fachärzte (Psychiatrie und Neuro­ logie) und/oder klinisch arbeitende Psychologische Psychotherapeuten der Bundeswehrkrankenhäuser zu unter­ stützen. Während des Einsatzes, der Phase II, stehen dem besonders belasteten Soldaten genau die gleichen qualitativ unterschiedlichen Ebenen der Unterstützung zur Verfügung, wie während der Einsatz­ vorbereitung. Folgende Unterschiede sind allerdings bemerkenswert: eine Unter­ stützung durch den Sozialdienst ist z.Z. nicht im Einsatz selbst, sondern nur über die Familienbetreuungsorganisation im Heimatland verfügbar. Unterstützungs­ maßnahmen, die die Qualität der Ebene 3 erfordern, werden – wenn erforderlich – zur Entlastung der Truppe im Einsatz in Bundeswehrkrankenhäusern durchgeführt. Die Einsatznachbereitung, die Phase III, konzentriert sich sowohl auf den kogni­ tiven und auch emotionalen Abschluss des Einsatzes, der mit ihm verbundenen Erlebnisse und Erfahrungen als auch auf das Erkennen und Behandeln von Folge­ schäden, z.B. posttraumatischen Störun­ gen. In Reintegrationsseminaren (Pflicht­ teilnahme) sollen die am Einsatz beteilig­ ten Soldaten in ihren gewachsenen Kameradschaften Gelegenheit finden, den Einsatz mental abzuschließen, den Sinn des Einsatzes, den individuell erleb­ ten Erfolg und Misserfolg sowie ihr ggf. verändertes soziales Umfeld für sich selbst und in der Gruppe zu reflektieren, um sich abschließend auf die Aufgaben ihrer jeweiligen Stammeinheiten einzu­ stimmen. 3 Grundsätze Die fachlichen Grundsätze des CISM werden in einem Konzept (MedizinischPsychologisches Stresskonzept der Bun­ deswehr) zusammengefasst, das das Zusammenwirken ärztlicher und psycho­ logischer Fachkräfte beschreibt und da­ mit auch festlegt. Es ist entlang der durch das Rahmenkonzept zur Bewälti­ gung psychischer Belastungen vorgege­ benen Struktur gegliedert und enthält Festlegungen zu den verschiedenen Aus­ bildungen, die es zu durchlaufen gilt und zu den angestrebten Qualifikatio­ nen, die erreicht werden sollen (jeder Soldat, sei er Kamerad, Unteroffizier, Offizier, Vorgesetzter oder Untergebe­ ner). Als besonders qualifizierte Perso­ nenkreise werden die Peers, die Truppen­ ärzte und -psychologen sowie die Fach­ ärzte für Neurologie und Psychiatrie und Psychologischen Psychotherapeuten der Bundeswehrkrankenhäuser definiert. Die erforderlichen Qualifikationen, Aus­ bildungen und die erreichbaren Zertifi­ zierungen für die Übernahme der ver­ schiedenen Funktionen sind dement­ sprechend gegliedert. Die erforderlichen Maßnahmen zur Koordinierung des Sanitäts- und des Psychologischen Dienstes sowie der Ein­ satz von Einzelmaßnahmen (z.B. der Kri­ seninterventionsteams (KIT) s. Ziff. 4, 5) werden festgelegt: Zur fachlichen Füh- rung der Teams, d.h. der Ausbildungs­ steuerung, der Einsatzauswertung und zur Fortentwicklung ist auf der Ebene des Bundesministeriums der Verteidi­ gung die Arbeitsgruppe ‚Psychophysische Stressbewältigung’ (AGPS) eingerichtet, in der alle am Stressmanagement betei­ ligten Dienste zusammenarbeiten. Die Arbeitsgruppe Psychophysische Stressbewältigung (AGPS) plant den Ein­ satz der medizinischen und psychologi­ schen Kräfte vor, während und nach ei­ nem Einsatz. Die AGPS wird grundsätz­ lich über alle Einsätze informiert. Der Anhang enthält strukturierte Ausbil­ dungspläne sowie eine Reihe von Check­ listen (Anlagen 1-4) zum standardisierten Einsatz des KIT – Teams. Das Konzept wird von einem Glossar abgeschlossen, um ein einheitliches Ver­ ständnis der verwendeten Begriffe und Maßnahmen zu erreichen. Wie bereits erläutert sind alle Maßnah­ men des CISM konkrete Umsetzungen des Rahmenkonzepts und lassen sich gut als eine Aufeinanderfolge auf der Zeit­ › achse darstellen (Abb. 2: CISM). Vor und unmittelbar zu jedem Einsatz werden alle beteiligten Soldaten wie bereits ausgeführt über das Konzept des CISM und der vorhandenen Unterstüt­ zungsmöglichkeiten am Heimatstandort und im Einsatz unterrichtet. Geschieht ein belastendes Ereignis, das die Kriterien eines ‚Critical Incidents’ 1 erfüllt, kommt es zur Krisenintervention, d.h. zur Einleitung „rasch einsetzender emotionaler ‚Erster Hilfe’, um den psy­ chischen Zustand des Betroffenen zu sta­ bilisieren und akute Symptome von Stressbelastung zu reduzieren. Der Be­ troffene wird dabei unterstützt, zu einem Zustand angemessener Situationsanpas­ sung zurückzukehren“ (Everly & Mitchell, 1997). Nach der Akutversorgung der be­ lasteten Soldaten oder Zivilangehörigen, zu der die Maßnahmen der Demobilisie­ rung und des Defusing gehören können, wird durch den Truppenpsychologen zu­ nächst eine Informationsveranstaltung, ein ‚Psychologisches Briefing’, durchge­ führt, an dem alle Betroffenen teilneh­ men müssen. Zeitliche Aufeinanderfolge von CISM-Maßnahmen CISM-Grundsätze Rahmenkonzept für die Bewältigung von psychischen Belastungen Peer- und Teamleiter Ausbildung und Training Demobilization, Defusing, indiv. PTSD – Risiko Analyse Debriefing (CISD) One-on-One Beratung, MPTT (fachliche) Beobachtung Informationen über Maßnahmen der Einsatznachbereitung Klinisches Debriefing 2.-3.D 3.D-4W >6W Während des weiteren Einsatzes Vor Beendigung des Einsatzes Im Rahmen dieser Veranstaltung werden den Betroffenen Inhalte vermittelt, die denen der TEACHING-Phase nach MIT­ CHELL entsprechen: Die Betroffenen wer­ den über ihre möglichen individuellen Reaktionen auf das außergewöhnliche Ereignis unterrichtet (‚normale’ Reaktio­ nen auf ein außergewöhnliches Ereignis) und über die in der Folgezeit angebote­ nen CISM-Maßnahmen zur Kompensa­ tion des eigenen Erlebens informiert. Parallel führt der Truppenpsychologe eine Analyse zur Abschätzung der individuel­ len Risikofaktoren der Betroffenen im Hinblick auf die Entwicklung einer Post­ traumatischen Belastungsstörung (PTBS bzw. engl. PTSD 2) durch. Dazu kommt ein Fragebogen zum Einsatz, der in sei­ ner ursprünglichen Form unter der Bezeichnung ‚Kölner Risiko-Index’ in der Literatur bekannt geworden ist (FISCHER, 1998). Die verwendete Form ist ein Ergebnis eines seit 2000 laufenden For­ schungsprojektes des Bundesministeri­ ums der Verteidigung. Sie wurde an die spezifischen Bedürfnisse der Bundeswehr angepasst und evaluiert. Dieses Risiko­ assessment dient dem Ziel, die größere Zahl Betroffener grob einer von drei etwa gleichgroßen Gruppen zuzuordnen: derjenigen der PTSD-Gefährdeten, die der mit großer Wahrscheinlichkeit weniger Gefährdeten und diejenige der soge­ nannten Wechsler (FISCHER et al. a.a.O.). Diese Zuordnung erlaubt es, im weiteren Verlauf nach dem Ereignis, den Betroffe­ nen die jeweils adäquate Unterstützung anzubieten, d.h. ein Debriefing, eine One-on-One Beratung oder eine Mehrdi­ mensionale Psychotrauma Therapie (MPTT). In der Folgezeit sind Kameraden und Vor­ gesetzte gefordert, auf Veränderungen im Verhalten Betroffener zu achten und kameradschaftlich zu agieren, wenn die eigenen Möglichkeiten erkennbar nicht mehr ausreichen. Im Rahmen der Vorbereitung auf die Rückkehr in das Heimatland werden die positiven und auch negativen Erlebnisse angesprochen und die eigenen wie auch die möglichen Veränderungen des sozialen Nach dem Einsatz Critical Incident Abb. 2 1 2 Ein Critical Incident ist dadurch charakterisiert, dass es sich um ein Ereignis handelt, das zu einen akuten Verlust des psychischen Gleichgewichts führt und bei dem die gewohnten Bewältigungsmechanismen versagen und Symptome von Stressbelastung und funktionaler Beeinträchtigung auftreten (APA, 1994) Die deutsche Bezeichnung ‚Post-traumatische Belastungsstörung’ (PTBS) ist gleichbedeutend mit der englischen Posttraumatic Stress Disorder (PTSD). Eine weitere Bezeichnung für diese Art von Störungen ist ‚Post-traumatische Störung’ (PTS) 55 Umfeldes, der Partnerinnen/Partner, Kin­ der und Angehörigen diskutiert. Der Truppenpsychologe richtet im Rahmen dieser Maßnahmen seine Aufmerksam­ keit auf die Soldaten und Teileinheiten, die besonderen Belastungen ausgesetzt waren: Hat der Truppenpsychologe den Eindruck gewonnen, dass besonders belastete Soldaten noch nicht das oder die kritischen Ereignisse adäquat verar­ beiten konnten, vereinbart er mit deren Zustimmung und unter Einschaltung des Truppenarztes ein Gruppengespräch mit einer Einsatznachbereitungsgruppe (ENG) eines Bundeswehrkrankenhauses. Diese besonders und zusätzlich qualifizierten Gruppen sind in der Lage, das Restrisiko der Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung oder anderer Formen abweichenden Verhaltens zu diagnosti­ zieren und den Einzelnen über die wei­ teren Maßnahmen einer Behandlung zu beraten. Wichtig ist anzumerken, dass erst jetzt der ‚Fall’ erstmalig eine ärztli­ che Dokumentation erfährt, wenn nach diesem Gruppen- oder Einzelgespräch mit der ENG eine Indikation angezeigt ist und der/die Betroffenen zustimmt. Eine solche Dokumentation ist im Hin­ blick auf die Geltendmachung etwaiger Ansprüche an das Gesundheits- und › Sozialsystem notwendig und erforderlich, da so das kritische Ereignis in einen ursächlichen Zusammenhang mit den durchgängig beobachteten Verhaltens­ änderungen gebracht wird. 4 Ausbildung / Standardisierung Ausbildung und Qualitätsstandards fol­ gen dem seitens der World Health Orga­ nisation (WHO) anerkannten Verfahren des CISM. Alle Soldaten und zivilen Mit­ arbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich für eine Tätigkeit im Rahmen der CISMMaßnahmen insbesondere in einem KIT interessieren, werden in Präventions- und Kriseninterventionstechniken geschult; sie erhalten eine ausführliche Ausbildung im Stressmanagement (Abb. 3). Erfahrungsgemäß sind solche Personen für die Arbeit in einem KIT besonders geeignet, die sich durch • • • • • soziale Kompetenz, Lebenserfahrung, hohe Akzeptanz im Kameradenkreis, stabile Persönlichkeit, Interesse an einer solchen Tätigkeit und • Freiwilligkeit auszeichnen. Trainingsmodule für alle Soldaten Stress-Coping Verhalten, Selbst- und Kameradenhilfe Stress-Management Techniken für Vorgesetzte CISM, Kurse zur Verbesserung der allgemeinen und besonderen Kompetenz zur Gesprächsführung Identifizierung von Stress Symptomen Defusing für Peers CISM, Peer-Unterstützungsmaßnahmen Peer-Tätigkeit für Truppen- und Fachärzte & TruppenpPsychologen CISM- Maßnahmen, CISD-Team-Leiter-Kompetenz für Fachärzte (Neurologen, Psychiater, Psychologische Psycho-Therapeuten) CISM-Maßnahmen, Traumatologie, Trauma-Therapie Abb. 3 56 Bei der Bundeswehr werden als Leiter von Kriseninterventionsteams in der Regel besonders qualifizierte Ärzte und Psychologen mit Ausbildung in Stress­ managementverfahren und psycho­ diagnostischer Erfahrung herangezogen. Aus diesem Grund bauen die Aus­ bildungsinhalte für zukünftige KIT-Leiter auf dem während des Studiums der Medizin bzw. der Psychologie erworbenen Wissen auf. Lerninhalte sind unter ande­ rem: Psychotraumatologie, Psychosoma­ tik, Interventionstechniken, Gesprächs­ führung bei psychosomatischen Erkran­ kungen, stressbedingte Verhaltensstörun­ gen, Verbesserung der eigenen diagnostischen Kompetenz, spezifische Behandlungstechniken (insbesondere Kurzverfahren). Als (eigen-) verantwort­ licher Leiter eines KIT wird ein Arzt oder Psychologe erst eingesetzt, wenn er an mindestens vier Debriefings als Peer oder Co-Leiter teilgenommen hat, er sich die Aufgabe zutraut und seitens seiner Fach­ vorgesetzten für ausreichend kompetent gehalten wird. Eine Heranziehung weiterer Personen­ kreise erscheint denkbar, ist jedoch zur Zeit nicht geplant. Der Ausbildung der Peers wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet: Die Bundes­ wehr bildet ihre Peers in Lehrgängen aus, die 2 Wochen dauern. Die Begründung liegt darin, dass die ersten Erfahrungen mit der Peer-Ausbildung gezeigt haben, dass in den zunächst angebotenen 2 bis 3 Tagekursen die Einübung eines Rollenver­ haltens nur unvollkommen gelang. Aus diesem Grunde wurde der 14 Tage Lehr­ gang konzipiert, der nun ausreichend Zeit für die verschiedenen Gruppenübungen vorsieht. Der Lehrgang ist innerhalb der Bundeswehr standardisiert. Er wird an einer Reihe von Dienststellen durchge­ führt. Bei Eignung und Zustimmung des Lehrgangsteilnehmers wird für ihn die Vergabe einer eigenen Ausbildungs- und Tätigkeitsbezeichnung beantragt. Mittelfristig werden die Namen aus­ gebildeter Peers in einer zentralisierten Datenbank aufgenommen werden, um im Bedarfsfall die Personen heranziehen zu können, die von ihrer Truppengattung als auch militärischen Funktion her dem Anspruch an einen Peer genügen. Alle Militärgeistlichen und eine Reihe von Mitarbeitern des Sozialdienstes der Bundeswehr haben zwischenzeitlich eine Peerausbildung erhalten. Damit ist sichergestellt, dass an jedem Standort im Bedarfsfall eine zusätzliche qualifizierte Unterstützung zur Belastungsbewälti­ gung vorhanden ist. Peers wie KIT-Leiter haben die Möglich­ keit zu regelmäßiger Supervision. Dazu können sie auf eine Liste von regional verfügbaren Supervisoren zurückgreifen. 5 Alarmierung und Einsatz Die Verfügbarkeit der Krisentinterven­ tionsteams (KIT) der Bundeswehr ist bedarfsorientiert strukturiert: Drei in der Bundesrepublik regional verfügbare und ständig alarmbereite Teams können sofort eingesetzt und situationsabhängig und in angemessener Zeit (d.h. ein bis zwei Tage nach einem Ereignis) durch eine größere Anzahl weiterer Teams ergänzt werden. Ein KIT der Bundeswehr setzt sich aus einem Arzt oder Psychologen als Leiter und zusätzlichem geschulten Personal (Funktions-, Sanitäts- oder psycholo­ gisches Assistenzpersonal, Sozialarbeiter, Militärgeistlichen, und Peers) zusammen. Der Teamleiter wird in der Regel von zwei Peers unterstützt. Die Teams können im In- und Ausland überall dort eingesetzt werden, wo Ange­ hörige der Bundeswehr von Extremereig­ nissen betroffen wurden. KIT’s werden auf Anforderung durch die jeweiligen Kommandobehörden tätig. Bei zivilen Katastrophen und Notfällen, zum Beispiel beim Zugunglück in Eschede oder zuletzt in New York anlässlich des Attentats auf das World Trade Center am 11. Septem­ ber 2001, unterstützen Teams der Bundeswehr im Rahmen der gesetzlichen Regelungen der zivil-militärischen Zusammenarbeit und nach Anforderung auch zivile Einsatzkräfte. Unterstützt werden nicht nur die eingesetzten oder betroffenen Soldaten sondern auch zivile Betroffene, Opfer wie Helfer. Es ist vorgesehen, dass Inanspruchnahme und Alarmierung eines Krisentinterven­ tionsteams in den Alarmplänen bzw. einer Zentralen Dienstvorschrift geregelt werden. Für die Bundeswehr sind Kriseninterven­ tionsteams nach dem Kriterium einer gleichmäßigen regionalen Verteilung auf­ gestellt. In jedem der Wehrbereiche wer­ den in Kürze jeweils zwei bis drei Team­ leiter einsatzfähig sein. Militärische Peers werden im Bedarfsfall durch die Dienst­ stellen/Truppenteile abgestellt. Eine Reihe von Verbänden verfügt mit ‚ihrem’ Truppenpsychologen über einen eigenen Teamleiter. Alle Teamleiter unterstützen bei Bedarf die drei zentralen Alarmteams. • Im Norden ist dieses am Schiffahrt­ medizinischen Institut der Marine (SchiffMed InstM) eingerichtet; Hauptauftrag ist die Unterstützung der Marine. • In Koblenz steht ein Team beim Zen­ trum Innere Führung (ZInFü) zur Ver­ fügung. • Ein drittes Team wird beim Flugmedi­ zinischen Institut der Luftwaffe (FlMedInstLw) vorgehalten; dessen Hauptauftrag ist die Unterstützung der Luftwaffe sowie der Fliegenden Verbände aller drei Teilstreitkräfte. Werden Angehörige der Bundeswehr im Dienst von einem kritischen Ereignis betroffen, entscheidet der Einheitsführer oder seine Vorgesetzten, ob ein Krisenin­ terventionsteam zu alarmieren ist. Zur Entscheidungsfindung nutzt er die ‚Checkliste Entscheidungshilfe’ (Anhang 1). Die Alarmierung eines der drei ständig vorgehaltenen Teams erfolgt entweder durch das Führungszentrum der Bundes­ wehr, die jeweilige Kommandobehörde oder den Leitenden Sanitätsoffizier des betroffenen Verbandes. Es wird angestrebt, dass alle Teamleiter auf eine aktuelle Liste regional verfüg­ barer Peers zurückgreifen können. Im Zuge der Alarmierung entscheidet der erst-alarmierte Teamleiter anhand einer ‚Checkliste Vorbereitung des Teams/der Teammitglieder’ (Anhang 2), ob das eigene Team und/oder die ortsnah verfügbaren Kräfte ausreichen oder durch regional verfügbare Kräfte verstärkt werden müssen. Diese Entscheidung ist abhängig vom Ausmaß des kritischen Ereignisses, insbesondere von der Anzahl der Be­ troffenen. Sie wird in aller Regel in Abstimmung mit den zuständigen Fach­ referaten im Bundesministerium der Ver­ teidigung getroffen. Der alarmierte Teamleiter beginnt nach einer ersten telefonischen Absprache mit der betroffenen Einheit mit den Vorberei­ tungen seines Einsatzes. Dazu informiert er die Einheit grob über die beabsichtig­ ten Maßnahmen und kündigt ein Fax mit seinen Fragen zum Unterstützungsbedarf an (‚Checkliste Vorbereitungen in der Einheit‘; Anhang 3). Nach dem Abschluss der Akutversorgung bearbeitet der Teamleiter die ‚Checkliste Erfahrungsbericht‘ (Anhang 4). Dieser Bericht wird auf dem Dienstweg sowohl dem zuständigen Fachvorgesetzten als auch der Arbeitsgruppe Psychophysische Stressbewältigung zugeleitet. Dadurch ist sichergestellt, dass Stressmanagementein­ sätze nachträglich stets evaluiert werden. Die Unterstützung bei zivilen Unglücken kann nur im Rahmen der vereinbarten zivil-militärischen Zusammenarbeit (z.B. im Rahmen abgestimmter Katas­ trophenpläne) und dann auch nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Führungszentrums der Bundeswehr erfolgen. 6 Zusammenfassung Das Critical Incident Stress Management (CISM) ist in das ‚Rahmenkonzept zur Bewältigung psychischer Belastungen bei Soldaten’ eingebettet. Es gliedert sich in drei Phasen eines militärischen Einsatzes – der Einsatzvorbereitung, -begleitung und -nachbereitung. Die in jeder Phase verfügbaren Unterstützungsmaßnahmen unterscheiden jeweils drei Ebenen fach­ licher Qualifikation: Selbst- und Kameradenhilfe/Hilfe durch Vorgesetzte und Peers, Truppenärzte und Truppenpsychologen/Militärpfarrer/Sozial­ arbeiter und Fachärzte für Psychiatrie/ Psychologische Psychotherapeuten. Die erforderlichen Maßnahmen werden in einem medizinisch-psychologischen Fachkonzept definiert, aufeinander abge­ stimmt und organisatorisch festgelegt. Es enthält auch die Ausbildungsmodule, die für eine qualifizierte und standardisierte Funktionsausübung für erforderlich ge­ halten werden. Dies ermöglicht Betroffe­ nen und dem CISM-Fachpersonal, die Übersicht über den Sinn und die zeitliche Aufeinanderfolge der verschiedenen Un­ terstützungsmaßnahmen zu er- und zu behalten. Abschließend werden die Alar­ mierung und der Einsatzgrundsätze von Kriseninterventionsteams in der Bundes­ wehr erläutert. 57 › Literatur BMVg – Fü S I vom 07. März 2000 – Rahmenkonzept zur Bewältigung psychischer Belastungen bei Soldaten BMVg – InSan I 1/PSZ III 4 vom April 2000 – Medizinisch-Psychologisches Stresskonzept der Bundeswehr (Entwurf) Kardiner, A., & Spiegel, H. (1947). War Stress And Neurotic Illness. Paul B. Hörber New York Mitchell, J.T.(1983): When disaster strikes... The critical incident stress debriefing process. J. of Emergency Medical Services 8(1), S 36-39 Mitchell, J.T. & Everly, G.S. (1994). Human Elements Training for Emergency Services, Public Safety and Disaster Personnel: An Instructural Guide to Teaching Debriefing, Crisis Intervention and Stress Management Programs. Chevron Publishing Corp., Ellicott City, MD, USA Everly, G.S. & Mitchell, J.T. (1997). Critical Incident Stress Management: A New Era and Standard of Care in Crisis Intervention. Chevron Publishing Corp., Ellicott City, MD, USA Fischer, G., Becker-Fischer, M. & Düchting, C. (1998). Neue Wege in der Opferhilfe. Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfsmodell (KOM). Hg.: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrheinwestfalen.. Schriftenreihe des Ministeriums 58 › Anhang 1 Checkliste Entscheidungsfindung (Bei mehr als vier JA-Antworten oder wenn Ziffer 10 mit ,JA‘ beantwortet wird, ist die Anforderung eines Kriseninterventionsteams fachlich erforderlich) JA 1 Der Einsatz unterschied sich von der Routine, weil (Gründe:) ........................................................................................................................................................................................................... 2 Unterstellte Soldaten / Beteiligte waren extremen Belastungen ausgesetzt. 3 Bei dem Ereignis hat es Verletzte / Verwundete / Tote gegeben. 4 Die Art des Geschehens / der Verletzungen war besonders traumatisierend. 5 Soldaten / Zivilisten / Kinder sind / waren vom Vorfall betroffen. 6 Rettung, Bergung und Abtransport der Betroffenen / Verwundeten / Toten / Leichenteile war besonders schwierig und belastend. 7 Es waren Angehörige zu benachrichtigen. 8 Die Soldaten haben sich jetzt, ................ Stunden nach dem belastenden Ereignis, immer noch nicht beruhigt 9 Soldaten / Unterstützungspersonal zeigt(en) sich psychisch und / oder körperlich deutlich beeindruckt. 10 Die Betroffenen wünschen eine Betreuung durch Fachpersonal. Ich entscheide mich GEGEN eine Inanspruchnahme eines Kriseninterventionsteams, weil: ................................................................................................................................................................................... 59 › Anhang 2 Checkliste Vorbereitung KIT-Teamleiter/Teammitglieder ........................................... .................................................... Durchführende Dst Ort, Datum Az 66-55-00 Tel.: Fax: Post: Handy: 1 2 2.1 2.2 2.3 Gem. Anforderung vom .............................................................................................................. wird das Kriseninterventionsteam der/des ........................................................... am ....................................................... ab ........................................................ die angeforderte/angewiesene Debriefingmaßnahme durchführen. Das Kriseninterventionsteam Leiter des Teams ist : ........................................................................................................................................................................ Co-Leiter : ....................................................................................................................................................................... eingeteilte Peers : ....................................................................................................................................................................... 3 Die Einheit wurde am .................................. um ......................... per Fax über die zu treffenden Maßnahmen informiert (FormBl: Checkliste Vorbereitung in der Truppe) 3.1 Zahl der unmittelbar betroffenen Soldaten (Einheit, Anzahl, DstGrd, Funktionen) ............................................................................ 3.2 Zahl der mittelbar betroffenen Soldaten .......................................................................................................................................... 3.3 Verletzte/Tote (Verbleib (z.B. Krankenhaus, krank zu Hause etc.) ...................................................................................................... 3.4 Verursacher ..................................................................................................................................................................................... 3.5 Ist die Trennung von Funktionsträgern/Dienstgraden erforderlich .................................................................................................... 3.6 Angehörige ...................................................................................................................................................................................... 3.7 zufällige Zeugen, Beteiligte ............................................................................................................................................................. 3.8 Wer/wieviele Personen sind bereits wieder abgereist: ...................................................................................................................... (Zuständigkeit) ................................................................................................................................................................................. 3.9 Einsatznachbereitung/TrArzt, BwKrhs ............................................................................................................................................... 3.10 MilPf und/oder Sozialarbeiter ........................................................................................................................................................... 4 6 Was muss vor der Krisenintervention besprochen werden ? ............................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................... Was muss nach der Krisenintervention besprochen/abgestimmt werden? ........................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................... Nachbesprechung mit dem Kdr/Einheitsfhr/Arzt erforderlich ............................................................................................................ 7 Übernachtung/Verpflegung .............................................................................................................................................................. 8 Sonstige Unterstützung erforderlich (Abholung etc.) ........................................................................................................................ 9 Bericht über die Krisenintervention (Formblatt: Bericht über ...) ..................................................................................................... 5 .......................................................... Unterschrift 60 › Anhang 3 Checkliste Vorbereitung durch die Truppe ........................................... ........................................... Beauftragte Einheit Ort, Datum Az 66-55-00 Tel.: Fax: Post: Handy: An ...................................................... Truppenteil Betr.: Vorbereitung der Kriseninterventionsmaßnahme(n) durch die Truppe Bezug: 1 Gern. Anforderung vorn .............................................................................................................. wird das Kriseninterventionsteam der/des ......................................................... am ............................................................ ab ..................................................... die angeforderte/angewiesene Debriefingmaßnahme durchführen. Die Maßnahme wird zwischen 2 und 3 Stunden dauern. Teilnehmer sind alle unter Ziff. ........................ aufgeführten Soldaten/Angehörige. 2 2.1 2.2 Das Kriseninterventionstearn Leiter des Teams ist ...................................................................................................................................................................... eingeteilte Peers sind ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... 3 3.1 3.2 3.3 3.4 Bereiten Sie bitte vor (bis zum Eintreffen des oder der Teams). Liste der unmittelbar betroffenen Soldaten (Einheit, Name, DstGrd, Funktion). Liste der Angehörigen (soweit erforderlich bzw. zutreffend). Liste der Verletzten/Toten (Verbleib(z.B. Krankenhaus, krank zu Hause etc.)). Zusammenstellung der bereits eingeleiteten Maßnahmen. Bereiten Sie je einen größeren Raum für jeweils 15 Betroffene mit einer Bestuhlung für jeden Teilnehmer zuzüglich mindestens 4 Stüh­ len für das Debriefing-Team. Die Stühle sind kreisförmig anzuordnen. 3.5 Stellen Sie je Interventionsteam 1 Besprechungsraum bereit (Büroraum, Telefon), in dem sich die Teammitglieder vorbereiten können. 4 Bereiten Sie bitte einen Termin für eine Nachbesprechung mit dem Kdr/Einheitsfhr vor. 5 Bereiten Sie bitte Unterkunft und Verpflegung für ............ Angehörige des Kriseninterventionsteams vor. Im Auftrag .......................................................... Unterschrift 61 › Anhang 4 Checkliste CISD-Erfahrungsbericht ........................................................................................................................................................... ........................................... Amtsbezg., Name, Vorname Ort, Datum Tel.: Bericht über die CISM – Maßnahme(n) ........................................................................................................................................................... bei/im ..................................................................... von/bis ........................................................................ Kdr .................................................................................................................................................................................................................. ChdS/LSO ........................................................................................................................................................................................................ Leitverband / betr. Einheit(en) ......................................................................................................................................................................... Unterstützende / beteiligte Einheiten .............................................................................................................................................................. I Zusammenfassung II Vorbereitungsphase II.1 Unterstützung durch die entsendende Dienststelle /Vertretungsregelung II.2 Vorbereitende Maßnahmen (zentrale/dezentrale Aus- und Fortbildungsmaßnahmen) II.3 Einsteuerung in die Debriefing-Tätigkeit (Vorteile, Defizite etc.) III Einsatzerfahrungen III.1 Herausragende Ereignisse / Debriefings III.2 Tätigkeitsfelder / Tätigkeitsschwerpunkte (Fallzahlen, Schätzungen anteiliger Tätigkeiten, Zusammenarbeit/Inanspruchnahme durch andere Stabszellen, TrpVerw, RB, MilPf etc.) III.3 Akzeptanz, Einbindung, regelmäßige/einmalige Beiträge/Beteiligungen etc. (Teilnahme an Stabsbesprechungen, Kommunikation etc.) 62 III.4 Erfahrene Unterstützung IV Erfahrungen bei der Rückkehr in die Haupttätigkeit (Einsatznachbereitung) V Verbesserungs- bzw. Änderungsvorschläge Konzeptentwicklungen und klinische Erfahrungen zu Posttraumatischen Belastungsstörungen auf dem Hintergrund der Vietnam-Veteranen* Alexander Varn 1 Zusammenfassung Der Artikel gibt zuerst einen kurzen geschichtlichen Überblick zur Evolution der Posttraumatischen Belastungsstörung in Bezug auf Kampf­ handlungen, von den ersten Erwähnungen einer solchen Symptomatik im Sezessionskrieg bis hin zur endgültigen Anerkennung der Störung durch Aufnahme in das DSM III im Jahre 1980. Es wird aufgezeigt, dass im Vergleich zu vorhergehenden Kriegen die Anzahl der Soldaten, die im Vietnamkrieg aufgrund akuter psychischer Probleme dienstunfähig wurden, sehr gering war, dass aber die Prävalenzrate der Post­ traumatischen Belastungsstörung bei Veteranen dieses Krieges um ein vielfaches höher war als aus vorhergehenden Kriegen zu erwarten gewesen wäre. Die möglichen Gründe für diese Entwicklung sowie die Rahmenbedingungen des Krieges in Vietnam, die dieses begünstig­ ten, werden aufgezeigt. Anhand eines Fallbeispieles sowie anhand der einzelnen Symptome der Posttraumatischen Belastungsstörung wird gezeigt, wie sich diese Störung bei Vietnamveteranen manifestiert. Trotz der hohen Anzahl der Vietnamveteranen, die an dieser Störung lit­ ten und noch leiden wurden erst 1979 von offizieller Seite Wiedereingliederungsprogramme für Vietnamveteranen ins Leben gerufen. Diese Entwicklung der Hilfs- und Therapieangebote, angefangen von den Selbsthilfegruppen der Veteranen 1971 über die Errichtung staatlicher Hilfsprogramme und der offiziellen Anerkennung der Störung bis hin zu den Einrichtungen und Programmen, die heute für die Veteranen bereitstehen, wird aufgezeigt. In einem letzten Abschnitt wird kurz auf die drei Phasen der Therapie der Posttraumatischen Belastungsstö­ rung bei Kriegsveteranen eingegangen und die vier gängigsten Therapieansätze, nämlich die gruppentherapeutische, psychodynamische, kognitiv-verhaltensorientierte und pharmakologische, kurz erläutert. 2 Einleitung Die American Psychiatric Association definiert die Posttraumatische Belastungsstörung als einen Zustand, der bei Personen beobachtet werden kann, die einer starken Stresssituation ausgesetzt waren, die starke Angstgefühle, Hilflosigkeit und Entsetzen in ihnen auslöste. Obwohl die Symptome der Posttraumatischen Belastungsstörung seit langem bekannt sind, wurde die Störung erst 1980 in das Diagnostische und Statistische Manual mentaler Störungen (DSM) aufgenommen. Viele unterschiedliche traumatische Ereignisse (Naturkatastro- phen, Vergewaltigungen, Kriege usw.) können eine solche Störung auslösen. Krieg als ein traumatisches Erlebnis kann eine Posttraumatische Belastungsstörung bei Soldaten auslösen. Insbesondere der Vietnamkrieg hat bei vielen Soldaten, die dort im Einsatz waren, eine solche Störung hervorgerufen. Aufgrund des gehäuften Auftretens der Posttraumatischen Belastungsstörung bei diesen Veteranen und aufgrund der Tatsache, dass diese Betroffenengruppe maßgeblich an der offiziellen Anerkennung dieser Störung beteiligt war, soll die Posttraumatische Belastungsstörung bei Vietnamveteranen genauer dargestellt werden. 3 Die Evolution der Post­ traumatischen Belastungsstörung in Bezug auf Kampfhandlungen Hinweise auf panikbedingte Störungen gehen bis auf die Mitte des 19. Jahrhun­ derts zurück. Mit dem Aufkommen der Eisenbahn fanden sich bei Überlebenden der ersten Bahnunglücke dieselbe Symp­ tomatik – Ängste, Albträume und extreme Schreckhaftigkeit. Diese Symptomkonstel­ lation wurde unter dem Namen „railway hysteria“ (Bahnhysterie) in England be­ kannt. Die ersten Hinweise auf eine solche Störung in Bezug auf Kampfhandlungen * Vortrag gehalten auf dem dreitägigen Fachseminar Posttraumatische Belastungsstörung vom 08.-10. Oktober 2001 in der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont. 63 finden sich im Amerikanischem Sezes­ sionskrieg. Hier wurde 1876 der Begriff „soldier’s heart“ (Soldatenherz) eingeführt um eine Symptomatik, die unter anderen extreme Schreckhaftigkeit, Herzrasen und Hypervigilanz umfasste, zu beschreiben, an der viele Veteranen dieses Krieges lit­ ten (Fillmore, 2001). Im allgemeinen hat man jedoch vor dem Ersten Weltkrieg psy­ chisch bedingte Dienstunfähigkeit unter Soldaten als Feigheit oder mangelnde Dis­ ziplin beschrieben. Der starke Artillerie­ beschuss, dem die Soldaten im Ersten Weltkrieg ausgesetzt waren, führte zur Überlegung, dass psychisch bedingte Dienstunfähigkeit auch aufgrund der Kampfhandlungen auftreten können. Man glaubte, dass die durch explodierende Granaten verursachte Druckwelle zu einer physiologischen Schädigung führe. Diese Schädigung, die als „Shell Shock“ bezeich­ net wurde, wurde für solche psychischen Dienstausfälle verantwortlich gemacht (Glass, 1969). Im Vergleich zum Ersten Weltkrieg nahm die Anzahl der psychisch bedingten Aus­ fälle während der ersten Jahre des Zwei­ ten Weltkriegs um 300 Prozent zu, obwohl bei der Musterung drei- bis vier­ mal mehr Männer aufgrund einer psy­ chiatrischen Indikation abgelehnt wurden (Figley, 1978). Es gab Zeiten des Krieges, in denen mehr Soldaten aufgrund psychi­ scher Störungen entlassen wurden als neue eingezogen (Tiffany and Allerton, 1967). › Basierend auf Arbeiten von Albert Glass (1945) wurde im Koreakrieg eine erste systematische Intervention vorgenom­ men. Soldaten, die wegen erhöhten Stresses zusammenbrachen, wurden sofort behandelt, um ihre Diensttauglich­ keit wiederherzustellen. Dieses Vorgehen erwies sich als sehr erfolgreich. Nur 6 % aller Evakuierungen erfolgten aufgrund psychischer Störungen. Im Vergleich dazu waren es 23 % im Zweiten Weltkrieg (Goodwin, 1987). Während des amerikanischen Einsatzes in Vietnam verzeichnete man mit 1,2 % die bisher geringste Anzahl von psychisch bedingten Ausfällen (Bourne, 1970). Man nahm an, durch psychologische Betreu­ ung vor Ort und weitere Präventivmaß­ nahmen (die im einzelnen noch erläutert werden), das Problem gelöst zu haben. Als der Krieg in Vietnam mehrere Jahre anhielt, klagte eine zunehmende Anzahl von Soldaten, die seit längerer Zeit nicht mehr an kriegerischen Handlungen teilge­ nommen hatten, über eine ähnliche Symptomatik wie Soldaten, die aufgrund von akuten psychischen Ausfällen evaku­ iert wurden (Goodwin, 1987). Dieses Phä­ nomen wurde bereits im Zweiten Welt­ krieg beobachtet. Nach dessen Ende klag­ ten manche Soldaten über Schlafstörun­ gen, Ängste, Alpträume, Depressionen und Aggressionen. Diese Symptome traten sowohl bei Soldaten auf, die einen akuten psychischen Zusammenbruch während des Krieges erlitten hatten, wie auch bei Sol­ Häufigkeiten für das Auftreten einer Posttraumatischen Bela­ stungsstörung unter männlichen Veteranen des Vietnamkrieges (Kulka et al., 1990) in % Gesamtzahl der Männer, die in Vietnam Dienst taten (ungefähr) in Zahlen 3,14 Millionen Veteranen, die zur Zeit an einer Posttraumatischen Belastungs­ störung leiden 15 % 479.000 Veteranen, die zur Zeit an einer partiellen Posttraumatischen Belastungsstörung leiden 11,1 % 348.540 Lebensprävalenz für die Post­ traumatische Belastungsstörung 30,6 % 960.840 Tab. 1 64 daten, die während des Krieges keine psy­ chische Symptomatik gezeigt hatten. Anhand von Untersuchungen wurden sol­ che Symptome nach fünf Jahren (Futter­ man & Pumpian-Mindlin, 1951) und nach 20 Jahren festgestellt (Archibald & Tud­ denham, 1965). Die Anzahl der Vietnam­ veteranen, die über vergleichbare Sympto­ me klagten, war jedoch wesentlich größer als bei Veteranen des Koreakrieges und des Zweiten Weltkriegs. In diesen beiden Kriegen nahm die Anzahl der psychisch bedingten Ausfälle mit der Intensität der Kampfhandlungen zu. Als diese Kriege ihrem Ende zugingen, nahmen die psy­ chisch bedingten Ausfälle unter den Sol­ daten ab, bis sie in ihrer Häufigkeit das Niveau vor Kriegsbeginn erreichten (Good­ win, 1987). Die Anzahl der Veteranen, die unter verspäteten Posttraumatischen Belastungsreaktionen litten, war so gering, dass diese Tatsache wenig Beachtung fand. Im Gegensatz dazu nahm nach Abzug der amerikanischen Truppen 1973 aus Vietnam die Häufigkeit solcher Belas­ tungsreaktionen unter den Soldaten dras­ tisch zu (President’s Comission on Mental Health 1978). 4 Prävalenz der Posttrauma­ tischen Belastungsstörung unter Vietnamveteranen Seit Anfang der 80er Jahre gibt es ver­ stärkt Studien über die Auftretenshäufig­ keit der Posttraumatischen Belastungs­ störung bei Kriegsveteranen als auch bei der Gesamtbevölkerung. Jede dieser Studien bestätigte das Auftreten einer persistenten psychologischen Störung bei einigen Personen, die ein traumatisches Ereignis durchlebten. Die Studien diver­ gieren jedoch sehr stark im Hinblick auf die Auftretenshäufigkeit der Posttrauma­ tischen Belastungsstörung, sogar bei Personengruppen, die das gleiche Ereignis durchlebten. Diese unterschiedlichen Ergebnisse sind in aller Wahrscheinlich­ keit auf methodische Unterschiede zurückzuführen, wie zum Beispiel unter­ schiedliche Fragestellungen oder Daten­ erhebungsverfahren (Keane, 1990). Die National Vietnam Veterans Readjust­ ment Study (NVVRS) von Kulka et al. (1990) dürfte die methodisch einwand­ freieste Studie mentaler Störungen sein (Keane, 1990). Diese Studie hat, wie von Dohrenwend und Shrout (1981) vorge- schlagen, einen Multimethod-Ansatz zur Fallidentifizierung verwendet. Anhand eines zweistufigen Prozesses wurden Fälle ermittelt. Zuerst wurden Interviews durch hierfür ausgebildete Laien durch­ geführt. Die so ermittelten Daten wurden dann verwendet, um diejenigen Personen auszuwählen, die in einem zweiten Schritt von erfahrenen Klinikern inter­ viewt wurden. Weiterhin wurden multiple Maße verwendet, um das Vorhandensein einer Posttraumatischen Belastungsstö­ rung bei einer Person zu ermitteln. Diese Maße umfassten standardisierte Inter­ views sowie psychologische Tests. Will man die Auswirkungen des Vietnam­ krieges auf die beteiligten Soldaten betrachten, sollte man dieser Studie den Vorrang geben (Keane, 1990). Diese Stu­ die gibt die folgenden Häufigkeiten für das Vorhandensein einer Posttraumati­ schen Belastungsstörung unter Vietnam­ veteranen an (siehe Tab. 1). Die Prävalenz der Posttraumatischen Belastungsstörung sowie anderer psycho­ logischer Störungen nach dem Krieg war signifikant höher unter denjenigen, die verstärkt Kampfhandlungen und anderen Kriegsstressoren ausgesetzt waren im Vergleich zu Veteranen, die weniger mit solchen Stressoren belastet wurden. Weiterhin war die Prävalenz unter Viet­ namveteranen signifikant höher im Ver­ gleich zu Soldaten, die nicht in Vietnam dienten sowie zu Zivilisten (Kulka et al., 1990). 5 Mögliche Gründe für das verstärkte Auftreten von Posttraumatischen Belastungsreaktionen unter Vietnamveteranen Die geringe Anzahl von Soldaten, die während des Vietnamkrieges an akuten psychischen Ausfällen litten, sowie die hohe Prävalenzrate für eine verspätet auftretende Posttraumatische Belas­ tungsreaktion wirft die Frage auf, warum sich dieser Krieg so stark von anderen Kriegen unterscheidet. Dieser Abschnitt versucht mehrere Faktoren darzustellen, die möglicherweise für diese Entwicklung verantwortlich waren. 5.1 DEROS (date of expected return from overseas) Als klar wurde, dass die Amerikaner in Vietnam einmarschieren würden, stellte das Militär Überlegungen an, wie mögli­ che psychische Dienstausfälle unter den Soldaten zu verhindern seien. Die Erfah­ rung aus vorhergehenden Kriegen hatte gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit eines psychischen Ausfalls mit der zeit­ lichen Dauer, in der ein Soldat an kriege­ rischen Auseinandersetzungen teilnimmt, ansteigt. In Korea wurde aus diesem Grund ein Punktesystem eingeführt wur­ de, in dem jeder Soldat eine gewisse Anzahl von Punkten für jede Ausein­ andersetzung, an der er beteiligt war, bekam. Die gesammelten Punkte dienten als Indikator für die Belastung, der ein Soldat bisher ausgesetzt war. War eine bestimmte Punktzahl erreicht, wurde der Soldat unabhängig vom Kriegsverlauf nach Amerika versetzt. In Vietnam wurde dieses System durch die Einführung von DEROS (date of expected return from overseas) ersetzt. Die Zeitdauer des Dien­ stes in Vietnam wurde auf 12 Monate beschränkt, außer bei den Marines, die 13 Monate abzuleisten hatten. Jeder Sol­ dat, der nach Vietnam versetzt wurde, kannte den genauen Termin, an dem er wieder in die Heimat zurückkehren wür­ de (Goodwin, 1987). Durch DEROS wussten die Soldaten, dass sie nicht eine unbegrenzt lange Zeit an Kampfhandlungen teilnehmen würden. Sie hatten auch ohne körperliche Ver­ wundung oder psychischen Zusammen­ bruch einen vorzeitigen Ausweg aus dem Krieg. Dieses System dürfte für die gerin­ ge Anzahl an akuten psychischen Ausfäl­ len während des Vietnamkrieges mitver­ antwortlich gewesen sein. Der einzelne Soldat musste sich nur für 12 bzw. 13 Monate „zusammenraufen“, um dann in die sichere Heimat entlassen zu werden. Die Vorstellung der Heimkehr hat somit manchem Soldaten ermöglicht, weiterzu­ machen, obwohl er unter anderen Umständen einen psychischen Zusammenbruch erlitten hätte (Goodwin, 1987). Die Nachteile dieses Systems kamen erst wesentlich später zum Vorschein. Auf­ grund der Tatsache, dass jeder einzelne Soldat sein eigenes Versetzungsdatum hatte, wurde der Krieg als sehr indivi­ duell und einsam erlebt. Der Krieg begann für jeden einzelnen am Tag der Ankunft und endete am Tag der Abreise. Die Soldaten fühlten keine Zugehörigkeit zu anderen, die ein anderes Versetzungs­ datum hatten (Bourne, 1970). Dies führte zu einer geringeren Identifi­ kation mit der eigenen Einheit und somit zu einem verminderten Zugehörigkeits­ gefühl und einer geringeren Truppenmo­ ral (Kormos, 1978). Studien haben jedoch gezeigt, dass gerade dieses Zusammen­ gehörigkeitsgefühl als Puffer dient, um den erlebten Stress während der Kampf­ handlungen abzuschwächen (Grinker & Spiegel, 1945). Die Heimreise, die alleine und in sehr kurzer Zeit beendet wurde, war ein wei­ terer Nachteil. Während des Zweiten Weltkriegs waren die Einheiten als Ganze heimgekehrt. Die Heimreise dauerte per Schiff mehrere Wochen, wodurch die Soldaten Zeit hatten, ihre Erlebnisse in der Gruppe zu verarbeiten. Die Heimkeh­ rer aus Vietnam waren nach spätestens 48 Stunden wieder zu Hause. Aufgrund dieser kurzen und einsamen Heimreise hatten sie nicht die Möglichkeit einer solchen Verarbeitung (Goodwin, 1987). 5.2 Schuldgefühle In den letzten zwei Monaten vor ihrer Versetzung versuchte man die Soldaten weitestgehend aus Kampfhandlungen herauszuhalten. Da die Kameraden weiterhin im Feld bleiben mussten, kamen neben der Freude auf die baldige Heimkehr auch Schuldgefühle auf. Man überließ seine Kameraden einem unge­ wissem Schicksal und konnte ihnen nicht mehr mit den eigenen Fähigkeiten bei­ stehen. Es kam nur selten vor, dass Sol­ daten nach ihrer Heimkehr den zurück­ gebliebenen Kameraden in Vietnam Brie­ fe schrieben, was auf mögliche Schuld­ gefühle hindeutet (Howard, 1976). 5.3 Fehlende ideologische Basis Während des Zweiten Weltkrieges gab es einen klar erkennbaren Feind. In Vietnam war dies nicht der Fall. Der Vietnamkrieg war ein Guerillakrieg. Der Feind, in Form der Viet Cong, trug keine Uniform und erschien z.T. in Gestalt von Frauen und Kindern. Es gab keine klare Front, und jeder Ort konnte das Ziel eines Angriffs 65 werden. Aus diesem Grund erschien dem Soldaten das ganze Land feindlich (Goodwin, 1987). Die amerikanischen Truppen waren für einen konventionellen Krieg ausgebildet und somit für den Vietnamkrieg nicht vorbereitet. In einem konventionellem Krieg wird ein Feind angegriffen um ein Gebiet zu erobern. In Vietnam war der Feind selten sichtbar. Die meisten Solda­ ten wurden Opfer von Heckenschützen und Fallen. Wegen des Fehlens einer kla­ ren Front hatten die Soldaten das Gefühl, keine Fortschritte zu machen, sondern nur Verluste (Goodwin, 1987). Viele Soldaten zweifelten an dem Sinn ihrer Aufgabe in diesem Krieg und an den Gründen, aus denen sie kämpfen und möglicherweise sterben sollten. Dieses stand in einem starken Gegensatz beispielsweise zu den Soldaten im Zweiten Weltkrieg, die von der Richtigkeit ihres Handelns überzeugt waren (Goodwin, 1987). 5.4 Das Alter der Truppen Das Durchschnittsalter der Truppen in Vietnam betrug 19 Jahre (Wilson, 1980). In diesem Alter durchlaufen Jugendliche das Moratorium (Erickson, 1968). In die­ ser Phase versucht der Jugendliche eine stabile und überdauernde Persönlich­ keitsstruktur zu entwickeln. Durch den Vietnamkrieg wurde bei vielen der jungen Soldaten diese Entwicklungsphase massiv beeinträchtigt, was eine der Ursachen für später auftretende Probleme darstellt (Wilson, 1980). 5.5 Fehlendes Verständnis der Zivilbevölkerung für die Veteranen Im Zweiten Weltkrieg wurde die Zivilbe­ völkerung auf die heimkehrenden Vetera­ nen vorbereitet. Man hat sie beispiels­ weise durch Filme (z.B. The Man In The Grey Flannel Suit, The Best Years of Our Lives, Pride of the Marines) auf mögliche Probleme der Veteranen bei der Anpas­ sung an das zivile Leben sensibilisiert (DeFazio, 1978). Weiterhin wurden in Hotels Heimkehrerzentren eingerichtet, wo die Veteranen zwei Wochen mit ihren Familien verbringen konnten. Dies sollte die erste Anpassung erleichtern (Boros, 1973). Im Gegensatz dazu bekam die Zivilbevölkerung während des Vietnam66 krieges jeden Abend in den Sechs-Uhr­ Nachrichten die Grausamkeiten dieses Konfliktes vorgeführt. Dies hat bei gro­ ßen Teilen der Zivilbevölkerung zu Unverständnis, Abstumpfung und zum Teil auch Wut über diesen Krieg geführt, was die Heimkehrer auch zu spüren bekamen. Diese Abneigung der Zivilbevölkerung ging teilweise soweit, dass sie aktiv gegen diesen Krieg protestierte. und gehe dann. Manchmal werde ich wegen den kleinsten Dingen sehr wütend. Früher habe ich dann meine Frau geschlagen, aber in letzter Zeit schlage ich einfach gegen die Wand oder verlasse das Haus und fahre mit dem Auto einfach drauflos. Manchmal verbringe ich mit ziellosem Herumfahren im Auto mehr Zeit als ich zu Hause bin.“ 5.6 Frühzeitige Entlassung als Grund für die geringe Anzahl von akuten, psychisch bedingten Ausfällen „Ich habe eigentlich keine Freunde und bin in der Auswahl meiner Freunde sehr wählerisch. In dieser Welt muss der einzelne sehen, wo er bleibt, und niemand scheint sich um andere zu kümmern. Soweit es mich betrifft, fühle ich mich nicht als Teil dieser verkorksten Gesellschaft. Was mir gefallen würde, wäre ein Haus in den Bergen, weit weg von anderen Menschen. Manchmal rege ich mich so sehr darüber auf, wie die Dinge laufen, dass ich am liebsten die Verantwortlichen in die Luft sprengen würde. Ein paar mal im Jahr werde ich in Kneipen­ schlägereien verwickelt. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich suche mir immer den größten Typen aus. Normalerweise werde ich dann platt ge­ macht. Manchmal fahre ich auch ganz verrückt und schreie herum und beschimpfe die anderen Autofahrer.“ Soldaten, die während ihrer Zeit in Viet­ nam Drogenprobleme oder Verhaltens­ störungen zeigten, wurden wegen ihrer militärischen Untauglichkeit entlassen. Die Entlassung ging zumeist mit der Dia­ gnose einer Persönlichkeitsstörung einher. Soldaten, die z.B. aufgrund von Stresssymptomen zur Selbstmedikation griffen, wurden somit in den Statistiken nicht aufgeführt. Diese Praxis dürfte neben DEROS mitverantwortlich für die geringe Anzahl der akuten psychischen Ausfälle gewesen sein (Kormos, 1978). 6 Symptome der Posttrauma­ tischen Belastungsreaktion unter Vietnam-Veteranen Um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie sich eine Posttraumatische Belas­ tungsreaktion bei Vietnamveteranen äußert, beginnt dieses Kapitel mit der von Goodwin (1987) aufgeführten Schil­ derung eines Vietnamveteranen über sein Leben 10 Jahre nach dem Krieg. Nach der Schilderung werden die typischen Symp­ tome dieser Störung, unter denen Vietnamveteranen verstärkt leiden, näher erläutert. „Meine Ehe ist am Zerbrechen. Wir reden einfach nicht mehr. Verdammt, ich glaube wir haben niemals über irgend etwas geredet, nie. Ich verbrin­ ge die meiste Zeit zu Hause alleine im Keller. Natürlich reden wir über die Lebensmittel, die eingekauft werden sollen, oder wer das Auto volltanken soll, aber das ist auch alles. Sie versucht mir manchmal zu sagen, dass sie viel für mich empfindet, aber ich fühle mich bei solchen Gesprächen unwohl „Ich fühle mich oft ziemlich niedergeschlagen. Das ist schon jahrelang so. Es gab Zeiten, da war ich so depressiv, dass ich den Keller nicht mehr verlas­ sen habe. In solchen Situationen trinke ich sehr viel Alkohol. Manchmal denke ich dann an Selbstmord. Ich habe eine Pistole, die ich aus Vietnam zurückge­ schmuggelt habe. Ich habe mir öfters die geladene Waffe in den Mund ge­ steckt. Ich habe es aber nicht geschafft abzudrücken. Ich sehe dann immer meinen Freund Smitty in Vietnam und wie sein Gehirn auf den Bunkerwänden verteilt war. Verdammt! Ich habe einfach zu hart gekämpft, um wieder heil nach Hause zu kommen. Ich kann das doch jetzt nicht einfach wegwerfen. Warum habe ich überlebt und er nicht? Es muss doch irgend ein Sinn dahinter stecken.“ „Manchmal spielen sich die Erlebnisse in Vietnam in meinem Kopf ab. Egal was ich auch versuche, die Gedanken schleichen sich immer wieder ein. Es ist unheimlich schwer, sie wieder zu verdrängen. Es sind Gedanken über alte Freunde, ihre Gesichter, den Hinterhalt, ihre Schreie, ihre Gesich­ ter.... Wissen Sie, jedes Mal, wenn ich einen Hubschrauber höre oder eine Baumlinie sehe, laufen mir kalte Schauder den Rücken runter, und ich erinnere mich. Wenn ich wandern gehe, vermeide ich starke Vegetation und bleibe oberhalb der Baumgrenze. Wenn ich die Straße entlang laufe, fühle ich mich unwohl, wenn Menschen hinter mir sind und ich sie nicht sehen kann. Wenn ich mich setze, suche ich einen Stuhl aus, hinter dem etwas Großes und Stabiles steht. Am wohlsten fühle ich mich in der Ecke eines Zimmers, da mich Wände an bei­ den Seiten umgeben. Laute Geräusche gehen mir auf die Nerven, und plötzli­ che Bewegungen oder Geräusche brin­ gen mich aus der Fassung.“ „Nachts ist es für mich am schwersten. Ich gehe erst lange nach meiner Frau schlafen. Es scheint Stunden zu dauern, bis ich endlich einschlafe. Nachts muss ich sehr viel an meine Erlebnisse in Vietnam denken. Manchmal weckt mich meine Frau und schaut mich ganz entsetzt an. Ich bin dann schweißge­ badet und verspannt. Manchmal greife ich nach ihrem Hals, bis ich merke, wo ich bin. Ab und zu kann ich mich an den Traum erinnern; z.T. ist es Viet­ nam, manchmal nur Leute, die hinter mir her sind und ich nicht mehr weg­ laufen kann.“ „Ich weiß nicht, aber es geht schon lange so. Ich glaube, es wird immer schlimmer. Meine Frau spricht davon, mich zu verlassen. Ich glaube, das wäre nicht so schlimm, aber ich bin einsam. Ich habe ja sonst niemanden. Warum bin ich der einzige, der so ist? Was zum Teufel ist mit mir los?“ Diese Beschreibung ist typisch für die Art und Weise wie sich eine Posttrauma­ tische Belastungsreaktion bei Vietnam­ veteranen äußert. Die folgenden Abschnitte werden die einzelnen Symp­ tome unter denen diese Veteranen leiden näher schildern. 6.1 Depressionen Viele Vietnamveteranen leiden unter Depressionen. Sie zeigen die klassischen Symptome (DSM III, 1980) wie Schlafstö­ rungen, psychomotorische Beeinträchtigungen, Gefühle von Wertlosigkeit, Kon­ zentrationsschwierigkeiten usw. (Goodwin, 1987). Die meisten Veteranen haben Situationen im Krieg erlebt, in denen ein oder mehrere ihrer Kameraden ums Leben kamen. Aufgrund der besonderen Erfordernisse der Kriegssituation fand meistens keine Verarbeitung solcher Ereignisse statt. Im Krieg blieb den Soldaten wenig Zeit zur Trauer, da ihr Leben von ihrer ständigen Bereitschaft abhing. Nach dem Krieg versuchten die meisten, diese Ereignisse zu verdrängen. Die Vete­ ranen hatten das Gefühl, nicht darüber reden zu können. Sie glaubten, dass nur jemand, der das gleiche durchgemacht hat, sie verstehen könnte (Howard, 1976). Mit dieser Depression geht oftmals ein Gefühl der Hilflosigkeit oder eines, nichts an dem Zustand ändern zu können, ein­ her. Aufgrund der Tatsache, dass der Vietnamkrieg ein Guerillakrieg ohne erkennbaren Feind und ohne Bodenge­ winn war, hatte es für den Soldaten den Anschein, keine Fortschritte zu machen. Man kämpfte, sah Kameraden sterben und hatte das Gefühl, die ganze Sache bringe nichts. Dieses Gefühl, nichts an einer unangenehmen Situation ausrich­ ten zu können, führt nach Seligman (1967) zu einer erlernten Hilflosigkeit. 6.2 Einsamkeit Die meisten Veteranen haben nur wenige Freunde. Sie haben das Gefühl, dass die Dinge, die sie im Kampf tun mussten und die Ereignisse, die sie gesehen haben, bei anderen Unverständnis oder Ekel hervor­ rufen würden. Dieses führt bei vielen zu der Annahme, von Peers nicht akzeptiert zu werden. Viele berichteten, sich wie ein alter Mann in einem jungen Körper zu fühlen. Die fehlende positive Unterstützung durch die amerikanische Öffentlichkeit während des Krieges ist ein weiterer Fak­ tor für den sozialen Rückzug vieler Vete­ ranen. Nach ihrer Heimkehr wurden Veteranen von einem nicht unbeträchtli­ chem Teil der Bevölkerung als Kinder­ mörder und Schlächter beschimpft (DeFazio, 1978). Aus diesem Grund ver­ suchen manche Veteranen, sich und ihre Familie zu isolieren. Dieses äußert sich auch in Phantasien über ein Leben als Einsiedler in der Wildnis, weit weg von anderen Menschen. 6.3 Wut Viele Veteranen haben starke Wutaus­ brüche. Oftmals sind sie selbst genauso überrascht und verängstigt darüber wie die Personen in ihrer Umgebung. Diese Wutausbrüche haben viele Gründe. In der militärischen Ausbildung wurde Aggres­ sion als positiv und männlich dargestellt (Egendorf, 1975). Während der Kampf­ einsätze in Vietnam kam diese Wut und Aggression hoch, es gab jedoch oftmals keinen Gegner, an dem man sie ausleben konnte. Aus diesem Grund wurde die Wut oftmals an Unbeteiligten ausgelas­ sen, da keine geeigneteren Ziele vorhan­ den waren (Shatan, 1978). Nach ihrer Rückkehr wurde diese Wut oftmals gegen die Obrigkeit gerichtet, also gegen die Personen, die dafür ver­ antwortlich waren, dass sie nach Viet­ nam mussten und ebenso gegen Perso­ nen, die die Soldaten nicht unterstützten (Howard, 1976). Diese Wut äußert sich auch in einem Gefühl des Misstrauens gegenüber Autoritäten und dem System im allgemeinen. Viele Veteranen, die an einer posttraumatischen Belastungsreak­ tion leiden, haben z.B. eine Reihe von Arbeitsplatzwechsel hinter sich. Dies liegt an einem Misstrauen gegenüber dem Arbeitgeber, sowie dem Glauben, ausge­ nutzt zu werden. 6.4 Affektvermeidung Viele Veteranen beschreiben sich als emotional tot. Diese Emotionslosigkeit begann in der Grundausbildung. Hier haben sie gelernt, dass Vietnamesen kei­ ne Menschen seien, sondern "gooks" und "dinks" usw.. Diese Entmenschlichung des Gegners sollte es den Soldaten leichter machen zu töten. Sie wurde während des Krieges jedoch generalisiert und auch auf die eigenen Truppen bezogen (Shatan, 1973). Die verwendeten Pseudonyme dienten dazu, den Schrecken des Kamp­ fes zu dämpfen (DeFazio, 1978). Die emotionale Abstumpfung erhöhte die 67 Coping-Fähigkeiten der Soldaten und diente somit zum Überleben (Lifton, 1976). Sie ist ein Schutzmechanismus. Problematisch wird es, wenn dieser Effekt weiter bestehen bleibt, nachdem das Trauma vorüber ist. Viele Veteranen empfinden Emotionen wie Liebe und Mitgefühl als bedrohlich. Aufgrund ihrer verdrängten Emotionen haben sie Angst davor, solche Empfindungen zuzulassen, da diese dann eben­ falls durchbrechen könnten. verfolgt oder beschossen werden. Es wird auch häufig über Träume, in denen stän­ dig das gleiche Ereignis wiederholt wird, berichtet. Beispiele hierfür sind Träume über den Tod eines Freundes oder das Töten eines Feindes. Oftmals beschreiben die Ehepartner den Schlaf des Veteranen als unruhig. Auch Angriffe auf den Ehepartner in den ersten orientierungslosen Momenten nach dem Aufwachen werden häufiger beschrieben. 6.8 Wiederkehrende Gedanken 6.5 Schuldgefühle In Situationen, in denen Menschen ihr Leben lassen müssen, fragen sich die Überlebenden häufig, warum ausgerechnet sie verschont geblieben sind (Lifton, 1973). Die Schuldgefühle, die hierbei auftreten, können zu einem selbstzerstö­ rerischen Verhalten führen. Laut Shatan (1973) sind sie beispielsweise häufig in Autounfälle ohne Fremdbeteiligung ver­ wickelt. Häufige Schlägereien gegen überlegene Gegner sind ein weiteres Beispiel. 6.6 Angstreaktionen Viele Veteranen beschreiben sich selbst als äußerst wachsam. Aufgrund der stän­ digen Bedrohung im Krieg haben sie Reaktionen und Verhaltensweisen gelernt, die ihr Überleben sichern sollten. Veteranen, die an posttraumatischen Belastungen leiden, zeigen solche Reak­ tionen immer noch, obwohl die Situationen, in denen sie angebracht waren, längst vorüber sind. Beispiele solcher Reaktionen sind das Erschrecken bei plötzlichen Geräuschen oder ein Gefühl des Unwohlseins, wenn Personen nicht im Blickfeld sind. 6.7 Schlafstörungen und Alpträume Die wenigsten Veteranen, die an einer Posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, empfinden die letzten Stunden vor dem Schlafengehen als angenehm. Viele versuchen so lange wie möglich wach zu bleiben oder nehmen Betäubungsmittel. Der Grund für dieses Verhal­ ten ist die Angst vor ungewollten Erinne­ rungen, die in Phasen der Unaufmerksamkeit auftreten können. Viele berichten über Träume, in denen sie 68 Im Alltag können Geschehnisse oder Gegenstände, die von dem Veteranen mit dem Krieg in Verbindung gebracht wer­ den, traumatische Erinnerungen auslö­ sen. Beispiele sind Hubschrauber, der Geruch von Urin, Fehlzündungen oder ein verregneter Tag. Manche empfinden die Erinnerungen, die dadurch wachgerufen werden, als so unerträglich, dass sie sol­ che Geschehnisse oder Dinge aktiv mei­ den. Im Extremfall können solche Erinnerun­ gen "Flashbacks", d.h. eine Art Trance verursachen, in denen der Veteran die Kriegsgeschehnisse nochmals durchlebt, ohne die Welt um sich herum richtig wahrzunehmen. 7 Hilfe für Vietnamveteranen, die an einer Posttraumatischen Belastungsstörung leiden Die steigende Zahl von Soldaten, die nach ihrer Heimkehr an einer Posttraumatischen Belastungsreaktion litten, führte 1971 zur Organisation sogenann­ ter "Rap Groups" durch die Gruppierung "Vietnam Veterans Against the War" (VVAW). Diese Gruppen waren eine Art der Selbsthilfe, in denen es Veteranen möglich war, über ihre Kriegserlebnisse und Schuldgefühle offen zu sprechen und wo sie somit auch diese Erlebnisse verarbeiten konnten. Der Psychiater Robert Lifton half bei der Bildung dieser Gruppen. Diese haben über einen Zei­ traum von zwei Jahren erfolgreiche Arbeit geleistet. Viele der Veteranen, die an diesen Gruppen teilgenommen haben, sind danach dazu übergegangen, selbst Veteranen Hilfestellung zu leisten. Sie haben sich weitergebildet, sie sind öffentlich aufgetreten, haben Artikel ver- fasst, oder haben beratende Tätigkeiten übernommen (Brende and Parsons, 1986). Einer der Gründe für die Entstehung dieser Gruppen, war die Tatsache, dass die Veterans Administration (VA) nicht bereit war, sich den Problemen dieser Veteranen anzunehmen, obwohl diese Organisation hierfür zuständig wäre, wie die Selbstdarstellung ihrer Mission zeigt. To serve America’s veterans and their families with dignity and compassion and be their principle advocate in ensuring that they receive medical care, benefits, social support, and lasting memorials promoting the health, welfare, and dignity of all veterans in recognition of their service to this nation (VA website at http://www.va.gov/about_va/mission.htm). Die VA argumentierte, dass neuropsychi­ atrische Probleme, die mehr als ein Jahr nach der Entlassung aus dem Militär­ dienst auftreten, nichts mit der Dienst­ zeit zu tun haben können und erkannte sie somit nicht an. Eine Behandlung über die VA war somit schwer zu erhalten und es war völlig unmöglich, für solche Pro­ bleme Kompensation oder eine Behindertenrente zu erhalten (Goodwin, 1987). 1973 hat die Organisation der Disabled American Veterans das Forgotten Warrior Projekt finanziert. Diese Studie, durchge­ führt von John P. Wilson, Ph.D., war bahnbrechend (Williams, 1987). Es war die erste großangelegte nationale Studie, die sich mit Vietnamveteranen befasste, und dauerte bis 1980. Während dieser Zeit war Dr. Wilson für Präsident Carter beratend tätig und wurde Max Cleland, dem damaligen Präsidenten der Veterans Administration und Vietnamveteran, zur Seite gestellt. Präsident Carter war gera­ de dabei, eine landesweite Initiative ins Leben zu rufen, um Vietnamveteranen bei der Wiedereingliederung zu assistieren. Dr. Wilson hat bei der Entwicklung dieses Programms, das 1979 fertigge­ stellt wurde, eine sehr wichtige Rolle gespielt (Volpe, 1979). Das Department of Veterans Affairs hat aufgrund dieser Initiative "Vietnam Veterans Outreach Programme", die von ehrenamtlichen Helfern betreut wurden, in 90 Städten der USA eröffnet. Da sich das Konzept als erfolgreich erwies, hat der Kongress das "VA Vet Center Program" ins Leben gerufen (Williams, 1987). Diese Veterans Outreach Centers (Vet Centers) wurden entwickelt, um Vetera­ nen mit allgemeinen Problemen der Wiedereingliederung zu helfen. Sie waren auch die ersten offiziellen Behandlungs­ programme, die von der Department of Veterans Affairs ins Leben gerufen wur­ den, um Posttraumatische Belastungsstö­ rungen zu behandeln. Die Vet centers haben eine einzigartige Rolle innerhalb des Gesundheitsprogramms der VA inne. Sie befinden sich direkt in den Kommu­ nen und somit nicht in räumlicher Nähe der medizinischen Zentren und Kliniken der VA. Eines ihrer Hauptaufgaben ist es, die Vietnamveteranen zu erreichen, die Unterstützung und Beratung benötigen, aber zu wütend auf die Gesellschaft oder die Regierung sind, um diese Hilfe in den traditionellen Einrichtungen der VA in Anspruch zu nehmen. Die Vet centers be­ gannen, Vietnamveteranen als Therapeu­ ten und Berater einzusetzen, da es diesen leichter fiel, ein Vertrauensverhältnis mit ihren Klienten aufzubauen (Lehmann, 2000). Die Aufgabe dieser Wiedereinglie­ derungsberatung ist wie folgt: (a) Vietnamveteranen und Veteranen anderer Kriege zu erreichen; (b) Vete­ ranen und ihren Familien bei persön­ lichen, arbeitsbedingten und familiären Problemen zu beraten; (c) Beziehungen mit anderen öffentlichen Einrichtun­ gen aufzubauen um sie bei Wiederein­ gliederungsproblemen von Veteranen einzubinden; und (d) Therapeuten und therapeutische Einrichtungen bei der Erkennung und Behandlung von kriegsbedingten Wiedereingliederungs­ problemen beratend zur Seite zu ste­ hen (Gelsomino, 2000). Mitte der 80er Jahre gab der Kongress eine nationale Studie (National Veterans Readjustment Study (NVVRS)) in Auftrag, um die Prävalenz der Posttraumatischen Belastungsreaktion unter Vietnamvetera­ nen zu ermitteln. Die Ergebnisse dieser Studie führten zu entschiedenem Ein­ greifen sowohl von der Department of Veterans Affairs wie auch vom amerika­ nischem Kongress. Verschiedene Pro­ gramme zur Behandlung und zur Errei­ chung von Veteranen wurden landesweit in stationären und ambulanten Kliniken der Veterans Administration eingerichtet. Durch diese Initiativen wurden die Män­ ner und Frauen, die in Vietnam dienten, wesentlich besser versorgt. Klinische Behandlungsteams, spezialisiert auf Post­ traumatische Belastungsstörungen, kom­ binierte Behandlungsprogramme für Dro­ genmissbrauch und Posttraumatische Belastungsstörungen, und spezielle sta­ tionäre Programme für Drogenmiss­ brauch und Posttraumatische Belas­ tungsstörungen wurden entwickelt, um die Vet Center Programme und bereits vorhandene Behandlungsprogramme für Posttraumatische Belastungsstörungen zu ergänzen. Diese Initiativen halfen lan­ desweit sicherzustellen, dass Veteranen, die aufgrund von Kriegsgeschehnissen psychologischer Hilfe bedurften, diese auch bekamen (Keane, 1990). Als Reaktion auf eine Entscheidung des Kongresses hat die Veterans Administra­ tion 1989 die National Center for PTSD gegründet, um den Bedürfnissen von Veteranen mit kriegsbedingter Posttrau­ matischer Belastungsstörungen gerecht zu werden. Diese Institution wurde ent­ wickelt, um Informationen über alle For­ schungs- und Ausbildungsaktivitäten der Veterans Administration und anderer staatlicher und nicht-staatlicher Organi­ sationen in Bezug auf Posttraumatische Belastungsstörungen bereit zu stellen. Die Mission der National Center for PTSD lautet wie folgt: To advance the clinical care and social welfare of America’s veterans through research, education, and training in the science, diagnosis, and treatment of PTSD and stress-related disorders. Obwohl das Center keine direkten klini­ schen Aufgaben übernimmt, hatten seine Forschungsergebnisse, Weiterbildungs­ maßnahmen und Beratungstätigkeiten eine positive Auswirkung auf die klini­ sche Behandlung von Veteranen mit Posttraumatischen Belastungsstörungen. Weiter-hin hat das Center signifikant zur Literatur über diese Thema beigetragen (NCPTSD website at http://www.ncptsd.org/about/history/inde x.html). Heute hat die Veterans Health Adminis­ tration, welche einen Teil der VA darstellt und für die Behandlungsprogramme in Bezug auf Posttraumatische Belastungs­ störungen zuständig ist, ein Etat von mehr als $20 Mrd.. Medizinische Versor­ gung für Veteranen wird durch 173 medizinische Zentren, 771 ambulante kommunale Kliniken, 134 Pflegeheime, 206 Wiedereingliederungszentren, sowie durch viele weitere Einrichtungen sicher­ gestellt. (VA website at http://www.va.gov/about_va/orgs/vha/ind ex.htm). 8 Behandlung Die Behandlung von kriegsbedingten Posttraumatischen Belastungsstörungen unterscheidet sich nicht wesentlich von der Behandlung anderer Posttraumati­ scher Belastungsstörungen. Im allgemei­ nen kann die Therapie für diese Störung in drei Phasen unterteilt werden (Fried­ man, 1996). 1. In der ersten Phase wird eine durch Sicherheit und Vertrauen geprägte Umgebung mit dem Patienten aufge­ baut. Somit erarbeitet sich der Thera­ peut das Recht auf Zugang zu trauma­ tischen Inhalten. 2. Die zweite Phase beinhaltet die auf das Trauma gerichtete Therapie. Wäh­ rend dieser Phase werden die trauma­ tischen Inhalte genauestens beleuchtet und vom Patienten verarbeitet. 3. Die dritte Phase hilft dem Patienten, sich vom Trauma zu lösen und neuen Anschluss an Familie, Freunde und Gesellschaft zu finden. In dieser Phase haben die Patienten die posttraumati­ schen Ereignisse bereits integriert und können sich somit auf aktuelle Proble­ me z.B. in der Familie, in der Ehe, usw. konzentrieren. Psychodynamische, gruppentherapeuti­ sche, kognitiv-verhaltensorientierte, pharmakologische und kombinierte Ansätze werden zur Behandlung von Posttraumatische Belastungsstörungen eingesetzt (Friedman, 1996). Jeder dieser Ansätze soll im folgenden kurz darge­ stellt werden. 8.1 Gruppentherapie Gruppentherapie wird seit vielen Jah­ ren erfolgreich von den Vet Centers zur Behandlung von Veteranen, die an Posttraumatischen Belastungsstörun­ gen leiden, angewandt. Die positive 69 Peer-Group-Atmosphäre ist ideal für Traumapatienten, da eine Umgebung geschaffen wird, in der die posttraumati­ schen Emotionen, Erinnerungen, und Verhaltensweisen des Patienten validiert, normalisiert, verstanden und entstigmatisiert werden. Die Gruppenkohäsion, Empathie und Sicherheit, die eine solche Umgebung bietet, erleichtert das Offen­ legen von traumatischen Inhalten. Oftmals ist es einfacher für Traumapatienten, eine Konfrontation durch andere Überlebende, die gleiches oder ähnliches durchgemacht haben, zu akzeptieren, als eine Konfrontation durch einen profes­ sionellen Therapeuten, der nie solche Ereignisse durchlebt hat. Das Teilen der eigenen Erlebnisse mit der Gruppe, sowie das Feedback, das der Patient durch die anderen Gruppenmitglieder bekommt, ermöglichen ihm, sein eigenes Trauma besser zu verstehen und zu verarbeiten. Somit werden die durch das traumati­ sche Erlebnis bedingten Gefühle der Scham, der Wut, des Ärgers, der Angst, des Zweifels und der Selbstkasteiung abgeschwächt und die Patienten können sich zunehmend auf das Hier und Jetzt konzentrieren anstatt auf die Vergangen­ heit (Scurfield, 1993). 8.3 Kognitv-verhaltensorientierte Ansätze 8.2 Psychodynamische Psychotherapie Das zunehmende Wissen über die vielen neurobiologischen Abnormalitäten, die mit der Posttraumatischen Belastungsre­ aktion in Verbindung gebracht werden können, macht den Einsatz von Medika­ menten zur Behandlung dieser Störung immer vielversprechender. Symptome, die mit einer Posttraumatischen Belastungs­ reaktion einhergehen, wie z.B. Angst, Depressionen und Schlaflosigkeit, können mit Medikamenten bekämpft werden. Die Effektivität von Medikamenten zur Behandlung der zentralen Symptome der Posttraumatischen Belastungsreaktion wie z.B. Intrusion und Vermeidung ist jedoch noch nicht genau bekannt. Man­ che Studien zeigen diesbezüglich eine positive Wirkung von Pharmaka. Die von Southwick et al. (1992) durchgeführte quantitative Analyse zeigte, dass trizykli­ sche Antidepressiva und Monoaminoxi­ dase-Inhibitoren bei den Symptomen der Intrusion und Vermeidung wirkungsvoll eingesetzt werden können. Fluoxetine, Amitriptyline und möglicherweise Valproate haben bei Vermeidungssympto­ men Wirkung gezeigt (Fesler, 1991; Psychodynamische Psychotherapie kon­ zentriert sich auf das traumatische Ereig­ nis. Der Patient erzählt wiederholt das traumatische Ereignis zu einem ruhigen, empathischen, mitfühlenden und nicht verurteilenden Therapeuten. Dies hilft angepasste Schutzmechanismen und Coping-Strategien, sowie ein besseres Selbstverständnis zu entwickeln. Die Technik hilft auch bei der Modulation von starken Emotionen, die während den Sitzungen aufkommen können (Marmar, et al., 1995). Während der Therapie wird immer wieder auf die Beziehung zwi­ schen Posttraumatischen Belastungsreak­ tionen und aktuellem Lebensstress hinge­ wiesen. Der Patient lernt die derzeitigen Lebenssituationen zu identifizieren, die traumatische Erinnerungen auslösen und somit die Symptome der Posttraumati­ schen Belastungsstörung verstärken. 70 Es gibt zwei kognitiv-verhaltensorien­ tierte Ansätze, die Exposure Therapy und die Kognitive Verhaltenstherapie. Exposu­ re Therapy verwendet systematische Desensibilisierung, sowie invivo-Techniken und imaginale Techniken, wie z.B. Flooding. Im allgemeinen hat sich die Technik des Floodings als effektiver erwiesen als systematische Desensibilisierung (Friedman, 1996). Der zweite Ansatz, die Kognitive Verhaltenstherapie, verwendet Strategien des Anxiety Managements, um die Angst, die Patienten verspüren, zu reduzieren. Dieses wird durch den Einsatz von Techniken, wie z.B. Relaxionstechniken, Stressresistenztrainings, kognitive Restrukturierung, Atemtechniken, Biofeedbacks, die Vermittlung von sozialen Fertigkeiten, und Ablen­ kungstechniken (Foa, et al., 1995). Es wird angenommen, dass eine Kombina­ tion von Flooding und Anxiety Manage­ ment Strategien effektiver sind als die jeweiligen Ansätze für sich alleine (Foa, et al., 1991). 8.4 Pharmakologische Therapien Davidson, et al., 1990; Van der Kolk, et al., 1994). Bisher hat kein Medikament sich als definitive Therapie für die Post­ traumatische Belastungsreaktion hervor­ getan. Der Einsatz von Pharmaka ist jedoch hilfreich, um Symptome einzu­ dämmen, damit Patienten an Gruppen-, Psychodynamischen-, kognitiv-verhaltensorientierten, oder anderen Psycho­ therapien teilnehmen können (Friedman, 1996). Mein besonderer Dank gilt Chrys Harris, PhD. Family Therapy and Trauma Center 311 Bennett Center Drive Greer, SC 29650 USA der mich an seiner langjährigen Erfahrung in der Therapie traumatisierter Viet­ namveteranen teilhaben ließ und an meinen Vater Douglas Varn, SSG US-Army Ret., der selbst von 1968-1969 mit Spe­ cial Forces in Vietnam diente und mich als erster auf die Problematik der Viet­ namveteranen aufmerksam machte. › Literatur Archibald, H.E. & Tuddenham, R.D. (1965). Persistent stress reaction after combat: A twenty-year follow-up. Archives of General Psychi­ atry, 12, 475-481. Boros, J.F. (1973). Reentry: III. Facilitating healthy readjustment in Vietnam veterans. Psychiatry, 36(4), 428-439. Bourne, P.G. (1970). Men, stress and Vietnam. Boston: Little, Brown. Brende, J.O. & Parsons, E.R. (1986). Vietnam veterans : The road to recovery. New York: New American Library. Davidson, J., Kudler, H., Smith, R., et al. (1990). Treatment of post-traumatic stress disorder with amitriptyline and placebo. Archives of General Psychiatry, 47, 259-266. DeFazio, V.J. (1978) Dynamic perspectives on the nature and effects of combat stress. In C.R. Figley (Ed.), Stress disorders among Viet­ nam veterans: Theory, research and treatment. New York: Brunner/Mazel. Dohrenwend, B.D. & Shrout, P.B. (1981). Toward the development of a two-stage procedure for case identification and classification in psychiatry epidemiology. Research in Community and Mental Health, 2, 295- 323. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, Edition III (1980). Washington D.C.: American Psychiatric Association. Egendorf, A. (1975). Vietnam veteran rap groups and themes of postwar life. In D.M. Mantell & Pilisuk (Eds.), Journal of social issues: Soldiers in and after Vietnam, 31(4), 111-124. Erikson, E. (1968). Identity, youth and crisis. New York: W.W. Norton. Fesler, F.A. (1991). Valproate in combat-related post-traumatic stress disorder. Journal of Clinical Psychiatry, 52, 361-364. Fillmore, R. (2001, June 1). The war after the war: Understanding PTSD. The Stars and Stripes. Retrieved on September 10, 2001 from http://www.vvof.org/ptsdarticle.htm. Foa, E.B., Rothbaum, B.O., Murdock, T, et al. (1991). The treatment of PTSD in rape victims. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 715-723. Foa, E.B., Rothbaum, B.O., Molnar, C. (1995). Cognitive-behavioral therapy of PTSD. In M.J. Friedman, D.S. Charney, & A.Y. Deutch (Eds.), Neurobiological and clinical consequences of stress: From normal adaptation to PTSD. New York: Raven Press. Figley, C.R. (1978a). Introduction. In C.R. Figley (Ed.), Stress disorders among Vietnam veterans: Theory, research and treatment. New York: Brunner/Mazel. Figley, C.R. (1978b). Psychosocial adjustment among Vietnam veterans: An overview of the research. In C.R. Figley (Ed.), Stress disorders among Vietnam veterans: Theory, research and treatment. New York: Brunner/Mazel. Friedman, M.J. (1996, April). PTSD Diagnosis and Treatment for Mental Health Clinicians. Community Mental Health Journal, 32(2), 173-189. Futterman, S. & Pumpian-Mindlin, E. (1951). Traumatic war neuroses five years later. American Journal of Psychiatry, 108(6), 401-408. Gelsomino, J. (2000). Veterans resource centers. Retrieved on September 10, 2001 from http://www.ncptsd.org/treatment/literature/ veterans/cq_v2n2_rcs.html. Glass, A.J. (1945). Psychotherapy in the combat zone. American Journal of Psychiatry, 110, 725-731. Glass, A.J. (1969). Introduction. In P.G. Bourne (Ed.), The psychology and physiology of stress. New York: Academic Press. 71 Goodwin, J. (1987). The etiology of combat-related Post Traumatic Stress Disorder. Cincinnati: Disabled American Veterans. Grinker, R.R. & Spiegel, J.P. (1945). Men under stress. Philadelphia: Blakiston. Howard, S. (1976). The Vietnam warrior: His experience and implications for psychotherapy. American Journal of Psychotherapy, 30(1), 121-135. Keane, T. M. (1990, Fall). The epidemiology of Post-Traumatic Stress Disorder: Some comments and concerns. PTSD Research Quar­ terly 1(3), 1-7. Kormos, H.R. (1978). The nature of combat stress. In C.R. Figley (Ed.), Stress disorders among Vietnam veterans: Theory, research and treatment. New York: Brunner/Mazel. Lehmann, L. (2000). Perspectives on PTSD. Retrieved on September 10, 2001 from http://www.ncptsd.org/treatment/literature/vete­ rans/cq_v2n2_lehrcs.html. Lifton, R.J. (1973). Home from the war. New York: Simon and Schuster. Lifton, R.J. (1976). The life of the self. New York: Simon & Schuster. Marmar, C.R., Weiss, D.S. & Pynoos, R.B. (1995). Dynamic psychotherapy of post-traumatic stress disorder. In M.J. Friedman, D.S Charney, & A.Y. Deutch (Eds.), Neurobiological and clinical consequences of stress: From normal adaptation to PTSD. New York: Raven Press. Presidents commission on mental health (1978, February). Report of the special working group: Mental health problems of Vietnam era veterans. Washington. Scurfield, R. (1993). Treatment of PTSD in Vietnam veterans. In J.P. Wilson & B. Raphael (Eds.), The international handbook of trau­ matic stress syndromes. New York: Plenum Press. Seligman, M.E.P. & Maier, S.F. (1967). Failure to escape traumatic shock. Journal of Experimental Psychology, 74, 1-9. Shatan, C.F. (1973). The grief of soldiers: Vietnam combat veterans' self-help movement. American Journal of Orthopsychiatry, 43(4), 640-653. Shatan, C.F. (1978). Stress disorders among Vietnam veterans: The emotional content of combat continues. In C.R. Figley (Ed.), Stress disorders among Vietnam veterans: Theory, research and treatment. New York: Brunner/Mazel. Southwick, S.M., Krystal, J.H., Johnson, DR.., et al. (1992). Neurobiology of post-traumatic stress disorder. In A. Tasman (ED.), Annual review of psychiatry, Volume 11. Washington, DC: American Psychiatric Press. Tiffany, W.J. & Allerton, W.S. (1967). Army psychiatry in the mid-60s. American Journal of Psychiatry, 123, 810-821. Van der Kolk, B.A., Dryfus, D., Michaels, M., et al. (1994). Fluoxetine in post-traumatic stress disorder. Journal of Clinical Psychiatry, 55, 517-522. Volpe, J.S. (1999). Trauma response profile: John P. Wilson, Ph.D., B.C.E.T.S. The American Academy of Experts in Traumatic Stress, Inc. Williams, T. (1987). Post-Traumatic Stress Disorder: A handbook for clinicians. Cincinnati: Disabled American Veterans. Wilson, J.P. (1980). Conflict, stress and growth: The effects of the Vietnam War on psychosocial development among Vietnam vete­ rans. In C.R. Figley & S. Leventman (Eds.), Strangers at home: Vietnam veterans since the war. Praeger Press. 72 Der Sozialwissen­ schaftliche Dienst der Polizei Niedersachsen* Achim Grube Kurzfassung: In diesem Artikel wird die Arbeit des Sozialwissenschaftlichen Dienstes der Polizei bezogen auf die Unterstützung bei der Bewältigung von besonders belastenden dienstlichen Ereignissen von Polizeibeamten dargestellt. 1. Der Sozialwissenschaftliche Dienst (SWD) der Polizei des Landes Niedersachsen. Dem SWD wurden per Erlass 6 Aufga­ benbereiche, die hier kurz skizziert dargestellt werden, übertragen. 1991 wurde der Sozialwissenschaftliche Dienst der Polizei in Niedersachsen gegründet. Mit dem SWD wurde erstma­ lig eine Dienststelle eingerichtet, die mit der Betreuung der Personals beauftragt wurde. Der SWD ist heute als Zentraler Dienst (ZD 1) in das Bildungsinstitut der Polizei Niedersachsen integriert. Das Bil­ dungsinstitut selbst ist für die gesamte Fortbildung von über 20.000 Mitarbei­ tern/innen zuständig. Im SWD arbeiten 7 Mitarbeiter/innen: zwei Dipl.-Päd. (ehemalige Polizeibeamte), ein Dipl.-Sozialarbeiter, eine Dipl.­ Psychologin, ein Kriminalkommissar mit sozialwissenschaftlichem Studium, ein Dipl.-Sozalarbeiter und Dipl.-Supervisor und eine Verwaltungsangestellte. Bis auf die Verwaltungsangestellte und die Psychologin haben alle Mitarbeiter eine Supervisionsausbildung, ein Mitar­ beiter besitzt eine psychotherapeutische Ausbildung. 1.1 Einsatzberatung - Castortransport – Beratung des Gesamteinsatzleiters; Entwicklung eines Konfliktmanagementsystems - Moko (Mordkommission) – Beratung der Kommission, Methodenunterstützung - Soko (Sonderkommissionen) Metho­ denunterstützung 1.2 Entwicklung sozialwissenschaft­ licher Konzepte - Soziale Ansprechpartner innerhalb der Polizei 1.3 Supervision - Einzelsupervision - Teamsupervision - Gruppensupervision (Sachbearbeiter Sexualdelikte und Tötungsdelikte) - Coaching für Führungskräfte 1.4 Methodenunterstützung - Entwicklung sozialwissenschaftlicher Meßinstrumente - Fachartikel - Traumatherapie und Kurzzeittherapie (nur in besonderen Fällen) - Konzeption und Durchführung von Mitarbeiterbefragungen - Konzeption und Durchführung von Kundenbefragungen - Prozessbegleitung bei Veränderungs­ prozessen (OE und PE) - Entwicklung von methodisch-didakti­ schen Konzepten - Durchführung und Auswertung von Vorgesetzteneinschätzungen - Evaluation - Durchführung von Debriefings - Erstellen und Durchführen von Auswahlverfahren für Spezialeinheiten - Mentales Training für Angehörige von Spezialeinheiten - Erstellen von Täterprofilen - Konfliktmanagement * Vortrag gehalten auf dem dreitägigen Fachseminar Posttraumatische Belastungsstörung vom 08.-10. Oktober 2001 in der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont. 73 1.5 Unterstützung der zentralen Fortbildung - Fortbildung von SET-Trainern (Systemi­ sches Einsatztraining) 1.6 Koordination der Regionalen Bera­ tungsstellen (RBS) Seit dem 01.01.2000 ist die Zuständigkeit des SWD neu geregelt und die Imple­ mentierung von Regionalen Beratungsstel­ len in den Bezirksregierungen und Polizeidirektionen des Landes Nieder­ sachsen festgeschrieben worden. In die­ sem Rahmen übernimmt der SWD u.a. folgende Aufgaben: - Koordinierung und Durchführung von RBS-Treffen - Durchführung von Fortbildungsmaß­ nahmen von Mitarbeitern und Mitar­ beiterinnen der RBS - Unterstützung allgemein Folgende Aufgaben, die bisher vom SWD zentral wahrgenommen wurden, werden jetzt von den RBS dezentral wahrgenom­ men: - Einsatzberatung auf Bezirksebene - Krisenintervention im polizeilichen All­ tag nach traumatischen Erlebnissen - Beratung in besonderen persönlichen Problemsituationen - Unterstützung bei Konfliktmanage­ ment/ Coaching - Unterstützung der dezentralen Fortbil­ dung Die Regionalen Beratungsstellen sind unterschiedlich stark besetzt. In der Poli­ zeidirektion Hannover sind 7 Sozialarbei­ ter, in der Bezirksregierung Braunschweig 6 Polizeibeamte und in den anderen Be­ zirken 3 Polizeibeamte/innen eingesetzt 2. Prävention und Öffentlichkeitsarbeit Im Folgenden werden in Stichworten Präventionsmaßnahmen und Maßnah­ men der Öffentlichkeitsarbeit dargestellt, die dazu dienen und dienten, innerhalb der Polizei in Niedersachsen ein Bewußt­ sein für die Themen akute Belastungsre­ aktion und PTBS zu schaffen. • Vortrag für Ltd. Polizeidirektoren zum Thema Krisenintervention bei "Akuten Belastungsstörungen und PTBS" (1995) 74 • Aufklärung zum Thema PTBS mit Bera­ tungsangebot per Fernschreiben • Info-Material zum Thema und mit Tele­ fonnummern an alle Polizeidienststellen • Durchführung von Fortbildungsveran­ staltungen für - Schiessausbilder - Trainer SET (Systemisches Ein­ satztraining) - SEK und MEK - u.a. • Einführung des Systemischen Einsatz­ trainings • Unterrichtseinheiten zum Thema PTBS • Im Rahmen der Fachhochschulausbil­ dung • Im Rahmen des Aufstiegslehrganges zum gehobenen Dienst (AlgD) • Informationsveranstaltungen • Z.B. nach dem ICE Unglück • Debriefings • Einzelberatung • Beratung von Vorgesetzen • Stress- und Konfliktbewältigungs­ seminare (Zeitdauer 1 bis 3 Wochen, durchge­ führt von Trainern und Trainerinnen des Bildungsinstitutes) • Betreuung vor und nach Rehamaß­ nahmen • Supervision für Sachbearbeiter Tötungs- und Sexualdelikte • Pilotprojekt: Supervisonsangebot zum Thema „Überbringen von Todes­ nachrichten" 3. Krisenintervention nach ex­ tremen Ereignissen im po­ lizeilichen Aufgabenvollzug Der polizeiliche Alltag ist geprägt von Situationsabläufen, die mit polizeilichen Mitteln bewältigt werden können. Allerdings kommt es vor, daß diese erlernten Handlungsmuster nicht ausrei­ chen. Das ist besonders bei der Verarbei­ tung extremer Ereignisse polizeilicher Aufgabenwahrnehmung der Fall. Beispielhaft seien hier genannt: • Schusswaffengebrauch gegen Personen • Ernste Bedrohung gegen Leib oder Leben oder Körperverletzung durch Straftäter • Verkehrsunfall mit schwer oder tödlich Verletzten Dabei ist die Art der Beteiligung nicht von Belang, die Überforderung trifft den Zeugen bzw. die Zeugin genauso wie die handelnde Person. Die Folgen dieser unverarbeiteten Ereig­ nisse äußern sich u.U. in akuter Belas­ tungsreaktion, wie z.B. - anhaltende Angst - Zustand der Betäubung - Ärger - Hilflosigkeit, Ohnmacht - Überaktivität - Rückzug Zumeist sind die Symptome innerhalb weniger Stunden, manchmal aber auch erst nach Tagen wieder verschwunden bzw. nur noch stark eingeschränkt vor­ handen. Entscheidend ist, in welcher zeitlichen Unmittelbarkeit dieses Erlebnis verarbeitet und bewältigt wird. Um einer Posttraumatischen Belastungs­ störung vorzubeugen, stehen Vertreter/innen des Sozialwissenschaft­ lichen Dienstes (SWD), der Regionalen Beratungsstellen (RBS) und/oder des Medizinischen Dienstes bereit, um vor Ort zeitnah Gespräche mit Betroffenen und/oder Angehörigen anzubieten. 3.2 Zur Ablauforganisation: 3.2.1 Der/die Betroffene, die Dienststelle und/oder die Einsatzleitstelle benachrichtigen den SWD, Hannover, Tannenbergallee 11, Tel. 0511 - 9695-2443. Der SWD richtet keine Rufbereit­ schaft ein, ist allerdings auch außerhalb der Dienstzeit grundsätz­ lich über Mobilfunktelefon erreichbar. 3.2.2 Der SWD benachrichtigt bei Bedarf den Medizinischen Dienst. 3.2.3 Ein Kriseninterventionsteam begibt sich vor Ort und macht den Betrof­ fenen, bei Bedarf den Angehörigen wie auch den Führungskräften, ein Gesprächsangebot. 3.2.3 Das Kriseninterventionsteam entscheidet über weitere Maß­ nahmen - Angebot zu weiteren Gesprächen - Angebot zum Debriefing für alle Situationsbeteiligten - Angebot zur Therapievermittlung - Angebot zur speziellen Schießausbildung - Vermittlung von Seminarplät­ zen zur Stressbewältigung • 4. Therapiekonzept – was hat sich bewährt? In der Arbeit mit Polizeibeamten/innen, die besonders belastende Situationen durchlebt haben sind folgende Faktoren besonders förderlich • Die Herstellung einer vertrauensvollen Beziehung ist wesentliche Vorausset­ zung einer erfolgreichen Kriseninter­ vention oder Traumatherapie. • Eine Feldkompetenz bezogen auf Arbeitsinhalte, Rahmenbedingungen sowie Kenntnisse über die Aufbau- und Ablauforganisation der Berufsgruppe ist förderlich. Der Klient gewinnt das Gefühl, dass der Therapeut ihn versteht, sich in seiner Berufswelt auskennt. • Die Bearbeitung der zum Teil erschüt­ ternden Erlebnisse der Betroffenen setzt zum Selbstschutz des Therapeu­ ten eine professionelle Distanz voraus. Darunter verstehe ich die Fähigkeit sich einerseits abzugrenzen, die belas­ tenden Inhalte nicht zu dicht an sich herankommen zu lassen. Die Empathie darf andererseits nicht durch die Dis­ tanz verloren gehen. Ein warmes an­ nehmendes Arbeitsverhältnis ist anzustreben. • Hilfreich ist das Erzählen von „Ge­ schichten" anderer Polizeibeamter/ innen: „Es gibt viele Polizeibeamte/ innen, denen es genauso erging und die jetzt wieder ganz normal ihren Dienst versehen." Damit wird den Betroffenen die Angst genommen, sie seien nicht normal und hätten jetzt eine „psychische Macke." • Der Erfolg der ersten Sitzung ist von entscheidender Bedeutung für den Therapieverlauf. Der Klient geht mit einem Gefühl der Entlastung und hofft, wieder „ganz normal" sein zu können. • Der Klient lernt einen „gesunden" inneren Dialog, ein hilfreiches Gesprä­ che mit seiner Angst zu führen. Die Angst als Freund/Freundin zu verstehen, die sein Leben retten will. Eben als Wegbegleiter, als Teil seines • • • • • Wesens und damit auch als jene Instanz, die ihn rechtzeitig auf lebens­ bedrohliche Situationen hingewiesen hat ohne die er vielleicht heute nicht mehr „anwesend" sein würde. In diesem Zusammenhang lernt der Klient durch die Methode Focusing, die Angst auf einen angenehmen Raum zu reduzieren und anderen hilfreichen Kräften, wie dem Mut, der Zuversicht und der Hoffnung ebenfalls einen angemessenen Raum zu geben. Die Stabilisierung des Betroffenen steht immer an erster Stelle. Erst wenn der Klient in der Lage ist, in sich einen „sicheren Ort" zu schaffen und gelernt hat, sich von den belastenden Gefüh­ len durch bestimmte Techniken, die z.B. Frau Dr. Luise Reddemann in ihrem Buch „Imagination als heilsame Kraft" in hervorragender Weise beschrieben hat, zu distanzieren, kann mit der Traumabearbeitung begonnen werden. Mit einer einfachen Übung kann der Klient selbst körperlich erleben, was er mit seinen eigenen Gedanken in seinem Körper bewirken bzw. „anrichten" kann. Die Kraft der eigenen Gedanken wird auf eindringliche Weise körperlich erfahrbar. In diesem Zusammenhang lernt der Klient zu beobachten, welche Gedan­ ken er einlässt, weiter bewegt und spinnt bis er sich in diesem Gedanken­ netz verfängt oder sich in einem Gedankenkarussell befindet, aus dem er nicht mehr herausfindet oder aussteigen kann. Je schneller diese Gedanken durch den sogenannten Gedankenstop aufgehalten werden können, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Klient nicht wieder in krank machende Gedankenmuster fällt. Der Klient lernt, bestimmte psychosomatische Beschwerden wie z.B. Herz­ schmerzen, die bei ihm heftige Angst­ zustände und Panikattacke auslösen, umzudeuten. Die Umdeutung kann so aussehen, dass der Klient bei plötzlich auftretenden Schmerzen in der Herz gegend sagt: „Mein Herz schmerzt – also lebe ich. Ich lebe.!!! Ich lebe noch lange." Die von Gendlin entwickelte Methode Focusing hat sich in der Arbeit mit Traumatisierten besonders bewährt. Bei frühkindlich Traumatisierten bietet sich eine Kombination dieser Methode • • • • • • mit der Arbeit mit dem „inneren Kind" an. Die „Swish-Technik", das Wegschießen "eingefrorener Bilder" bei gleichzeiti­ gem Ersetzen positiv besetzter Bilder wirkt bei akuter Belastungsreaktion und PTBS ebenso schnell und nachhal­ tig wie die Methode EMDR. Abschiedsrituale können zum Ende der Therapie eingesetzt werden. Belastende Gedanken werden aufgeschrieben und feierlich dem Feuer übergeben. Einige Klienten die eine stärkere Bezie­ hung zum Wasser haben, projizieren ihre negativen Gedanken oder Bilder, eben das, was sie loswerden wollen, auf ein Stück Holz und übergeben die­ ses feierlich einem fließenden Gewäs­ ser. Von diesem Ritual prägt sich der Klient ein Bild mit möglichst verschie­ denen Sinneseindrücken ein. Taucht dann irgendwann wieder das belasten­ de Bild auf, führt der Klient sich das Bild vom Abschiedsritual vor Augen und sagt sich, dass er sich bereits von dem belastenden Material verabschie­ det hat. In anderen Fällen ist es hilfreich, mit einem Betroffenen einen Unfallort oder ein Grab aufzusuchen und sich von dem Ort des Geschehens oder von dem Verstorbenen zu verabschieden. Der psychologische Effekt ist bei die sen Ritualen nicht zu unterschätzen. Unterstützung und Verständnis von Vorgesetzen und Kollegen fördern den Therapieprozess in hohem Maße. Nicht selten müssen Vorgesetzte über die Auswirkungen einer PTBS bei einem betroffenen Mitarbeiter aufgeklärt werden. Evtl. ist es erforderlich, vorübergehend oder langfristig für den Betroffenen eine andere dienstliche Verwendung zu finden. Auf die den Heilungsprozess begünsti­ gende Unterstützung von Familienan­ gehörigen möchte ich hier nicht weiter eingehen. Der Klient erlangt die Gewissheit, nach der Therapie stärker als zuvor zu sein. Er integriert das Trauma in seine Bio­ grafie, bleibt nicht bei seinem trauma­ tischen Erlebnis stehen und gewinnt aus dem Schrecklichen einen Sinn. Schuld zu bearbeiten und loszulassen ist fast immer ein Thema in der Trau­ mabearbeitung. Hier haben sich Gleichnisse als sehr hilfreich erwiesen, 75 z.B. das Gleichnis von der Sünderin. Anhand dieses Gleichnisses kann dem Klienten aufgezeigt werden, dass die „Sühne" darin besteht, seine Kräfte auf die Bewältigung des Gegenwärti­ gen zu richten und sich damit eine Zukunft zu schaffen. Das Verbeißen im Vergangenen bindet dort die Kräfte. Erst das Loslassen, das „Seinen­ Lebensweg-weitergehen" führt aus der Krise. 76 • Neben der Traumatherapie sollte der Klient regelmäßig Sport treiben (Puls 130). So kann das innere Erregungsni­ veau gesenkt werden. Parallel dazu ist täglich mindestens einmal eine für den Klienten hilfreiche Entspannungstechnik zu üben. Geeignete erholsame Freizeitaktivitäten sind begleitend ebenso wichtig, wie das Lösen von aufgeschobenen oder verdrängten Problemen. • Auch gilt es, das Selbstwertgefühl, das häufig geschwächt wurde, zu entwickeln und zu stärken. Polizeilicher Schuss­ waffengebrauch: Erleben und Folgen* Frank Hallenberger Zusammenfassung Der Beitrag fasst die Studien zum polizeilichen Schusswaffengebrauch zusammen. Entgegen den Erwartungen konnten nur fünf Untersu­ chungen aus den USA, Kanada und Europa gefunden werden. Die in ihrer Systematik sehr unterschiedlichen Datenerhebungen zeigen jedoch einige Übereinstimmungen in ihren Ergebnissen. Beleuchtet wird der spontane und gezielte polizeiliche Schusswaffengebrauch mit seinem Erleben durch den Schützen. Die aus diesem zumeist traumatisierenden Ereignis resultierenden psychischen und sozialen Folgen werden mit ihren Bedingungsfaktoren dargestellt. Gliederung 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1 2.3.2 Der „sichere“ Schuss Hilfsmaßnahmen Literatur 1. Einleitung Die Medien, allen voran das Fernsehen beeinflussen das Weltbild des Konsumen­ Polizeilicher Schusswaffengebrauch in Rheinland-Pfalz Anzahl der Fälle gegenüber Menschen › Einleitung Der „unsichere“ Schuss Erleben des Schusswaffengebrauchs Belastungsreaktionen Einflüsse auf die Regeneration Soziale Unterstützung Zusätzliche psychische Verletzungen 3. 4. 5. 7 6 5 ten. Ein beliebtes Film- und Seriengenre sind Krimis und Polizeiarbeit. So zeigt ein Blick auf eine zufällig aufgeschlagene Seite des Fernsehprogramms vom 11. Mai 2000 z.B. „Ein Fall für zwei“, „Die Motor­ rad-Cops“, „Balko“, „Die Wache“, „Antho­ ny Dellaventura, Privatdetektiv“, „Wolffs Revier“, „Cagney und Lacey“, „Die Stra­ ßen von San Francisco“. Das waren erst sechs Programme. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, die hierbei im Polizeiein­ satz an- oder erschossenen Menschen zu zählen. Es geschieht jedoch an jedem Fernsehtag zu fast jeder Stunde. So kann leicht der Eindruck entstehen, dass der Schusswaffengebrauch eine routinemäßig eingesetzte Form der Polizeiarbeit sei. 4 3 2 1 0 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Erfassungszeitraum Dagegen ist in der Realität der Schuss­ waffengebrauch gegen Menschen in Deutschland ein eher seltenes Ereignis. Die folgende Grafik zeigt die Häufigkeit des Schusswaffengebrauchs gegen Men­ schen in Rheinland-Pfalz 1987 bis 1996, nach den Angaben des rheinland-pfälzi­ schen Innenministeriums (Abb. 1). Abb. 1 * Nachdruck mit freundlicher Genehmigung aus POLIZEI UND WISSENSCHAFT 1/2001 77 Insbesondere in den Filmmedien wird in aller Regel noch ein anderer Aspekt völlig falsch dargestellt: Die Belastungsreaktio­ nen der Polizeibeamten nach dem Schusswaffengebrauch. In allen Studien zum Schusswaffengebrauch wird von unterschiedlich starken Schockzuständen direkt nach dem Schießen berichtet (Manolias & Hyatt-Williams, 1993; Solo­ mon & Horn, 1986). Im Gegensatz dazu steckt der Zelluloid-Polizist die Waffe weg, schnauft bestenfalls kurz durch und jagt den nächsten bösen Buben. Die Filmwelt gaukelt uns also vor, dass es sich bei Schusswechseln um normale polizeiliche Situationen mit außerge­ wöhnlichen Menschen handelt – den Polizisten. Die Realität stellt sich demge­ genüber genau gegensätzlich dar: Es handelt sich um außergewöhnliche Situ­ ationen mit normalen Menschen! 2. Der „unsichere“ Schuss Hierunter soll der Schusswaffengebrauch 1 aus einer Aktion heraus ohne Planung, Schutz und präziser längerfristiger Zielsu­ che verstanden werden. Dagegen soll als „sicherer“ Schuss der geplante, präzise gezielte Schuss aus einer Deckung heraus – in der Regel der „Finale Rettungs­ schuss“ – bezeichnet werden. Die meisten amerikanischen Polizeibeam­ ten sehen den Schusswaffengebrauch als das belastendste Ereignis an, welches ihnen während ihres Berufslebens passie­ ren könnte. Zu diesem Schluß kommen Manolias und Hyatt-Williams (1993) nach einer Literaturübersicht. Eine Aufklärung dazu, warum Schießen höchsten Stress bedeuten kann, findet sich in den beiden gängigen Diagnose-Manualen. Bei einer möglicherweise traumatogen wirkenden Situation soll nach ICD 10 (1994) eine „außergewöhnliche Bedrohung“ oder ein „katastrophales Ausmaß“ vorliegen. Deut­ licher zeigt das DSM IV (1996), warum der Schusswaffengebrauch traumatisch wirken kann: „Die Person erlebte, beob­ achtete oder war mit einem oder mehre­ ren Ereignissen konfrontiert, die tatsäch­ lichen oder drohenden Tod oder ernsthaf­ te Verletzung oder eine Gefahr der kör­ perlichen Unversehrtheit der eigenen Per­ son oder anderer Personen beinhalteten.“ Individuelle, subjektive Komponenten 78 1 konstituieren in beiden Definitionen das Ereignis als „Trauma“ oder „kritisches Ereignis“. Im ICD 10 (1994) ist dies die Einschätzung, dass das Ereignis bei nahe­ zu jedem tiefgreifende Verzweiflung aus­ lösen würde. Das DSM IV (1996) beschreibt als Reaktionen intensive Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen. Mit anderen Worten: Der Schusswaffenge­ brauch kann für einen Polizeibeamten ein kritisches Ereignis darstellen und somit akute bzw. posttraumatische Belastungs­ reaktionen auslösen. Unterstützung erfahren diese Ausführungen durch zwei Befragungen. Bei Stratton, Parker und Snibbe (1984) sowie Solomon und Horn (1986) berichtet jeweils ca. ein Drittel der Polizeibeamten von geringen, mode­ raten bzw. starken Belastungsreaktionen. Die zu dem Thema „Post-Shooting“-Reak­ tionen veröffentlichten Studien weisen alle verschiedene methodische Mängel auf. So lag häufig eine geringe Proban­ denzahl vor oder es wurden Fragebögen ohne erkennbares Schema verschickt. Die Fragebögen enthielten zumeist Selbstbe­ schreibungen und -einstufungen anstatt verhaltensorientierter Fragen. Die Grup­ penzusammensetzung blieb unklar. Waren Präzisionsschützen dabei? Zog das Schie­ ßen den Tod eines anderen Menschen nach sich oder waren es geringere Schussverletzungen? Waren nur Schützen in der Gruppe oder auch Polizisten, die an dem Einsatz teilgenommen hatten, aber nicht geschossen haben? Die Kategorien­ bildungen und Auswertungen differieren stark. Der Einfluß sozialer Erwünschtheit oder noch anhängiger Ermittlungen wur­ den nie erfaßt und die Zeitspannen zwi­ schen Ereignis und Befragung schwanken beträchtlich. Die Ergebnisse der interna­ tionalen Untersuchungen (zweimal USA, je einmal Kanada, Niederlande und Groß­ britannien), deutscher Berichte und Erfahrungen aus der eigenen Gruppenund Einzelfallarbeit zeigen aber bedeut­ same Übereinstimmungen (Stratton, Par­ ker & Snibbe, 1984; Loo, 1986; Solomon & Horn, 1986; Gersons, 1989; Krolzig, 1992; Deutsche Polizei, 1995; Manolias & Hyatt-Williams, 1993). 2.1 Erleben des Schusswaffengebrauchs Zum Erleben des Schusswaffengebrauchs liegen nur von Manolias und Hyatt-Willi­ ams (1993) sowie Artwohl und Christen­ sen (1997) Veröffentlichungen vor. Die Angaben sind aber vergleichbar mit Ein­ zelfallberichten aus deutschen Polizeima­ gazinen und eigenen Erfahrungen mit Betroffenen. Die Schilderungen zum Erle­ ben beinhalten überwiegend psychische und physische Aktivitäten, die während bzw. kurz nach dem Schusswaffenge­ brauch vorgelegen haben sollen. Ob es sich um das tatsächliche Erleben oder um Gedächtnisrepräsentationen handelt, die nach dem Ereignis verändert wurden, ist kaum abzuschätzen: Überwiegend handelte es sich um die Eskalation einer Konfrontation bei ver­ suchter Täterfestnahme, Verfolgungsfahr­ ten oder Hausstreit. Am Punkt der größ­ ten Gefahr seien die meisten Befragten extrem ruhig und „klar im Kopf“ (clear­ headed) gewesen. Auch von „kalt“ wird gesprochen. Hier hat sich die Situation zugespitzt, oft handelte es sich um eine „Aug’ in Aug’“-Situation, wo es darum geht, wer von den Beteiligten überleben wird („Der oder ich!“). Nur wenige berich­ ten hierbei von intensiver Furcht, die aber sogleich durch überwältigende Wut ersetzt wurde. Hohe Anspannung oder Angst kam selten vor, am ehesten dann, wenn das Ereignis antizipiert werden konnte. Sehr häufig wird von reflexhaf­ tem Reagieren, einem automatischem Ablaufen antrainierter Abläufe, gespro­ chen (80% bei Artwohl & Christensen, 1997). Ein für die Vorbereitung und Pro­ phylaxe kritischer Ereignisse sehr wesent­ licher Befund, da Automatismen und reflexhaftes Verhalten erlernt und trai­ niert werden können. Ein richtiger und wichtiger Schritt in diese Richtung ist das Üben in den interaktiven Schießanlagen. Etwas überraschend sprechen fast die Hälfte der von Artwohl und Christensen (1997) befragten Polizisten davon, wäh­ rend des Geschehens intensiv gedanklich abgelenkt gewesen zu sein. Die Gedanken kreisten hierbei z.B. um Angehörige und Zukunftspläne. Direkt nach dem Schießen kommt es zu sehr unterschiedlichen Gefühlen, die von Erleichterung bis zu ernsthaftem Schock­ zustand reichen können. Einige sprechen nach dem Ereignis exzessiv und es kann Mundtrockenheit vorkommen. Selbst „Schusswaffengebrauch“ als Schussausgabe im Unterschied zu „Schusswaffeneinsatz“ im allgemeinen Umgang mit der Dienstwaffe (vgl. Lorei, 1999). wenn die Betroffenen zunächst sagen, dass sie völlig ruhig seien, kann es beispielsweise sein, dass ihnen Schreiben nicht möglich ist. Etwa 2/3 der Schützen wiesen auffällige emotionale Reaktionen nach dem Ereignis auf. Teilweise traten diese Reaktionen jedoch oft erst einige Stunden nach dem Vorfall auf (Manolias & Hyatt-Williams, 1993). Beim Schusswaffengebrauch muss den Angaben zufolge vor allem mit Wahrneh­ mungsverzerrungen gerechnet werden (Solomon & Horn, 1986; Manolias & Hyatt-Williams, 1993; Artwohl & Christensen, 1997). Am häufigsten ist die Zeitwahrnehmung betroffen. Ein Erleben der Situation wie in Zeitlupe wird von gut 2/3 und wie im Zeitraffer von ca. 1/6 der Befragten berichtet. Hierbei sind extreme Wahrneh­ mungsveränderungen möglich: Von fast Zeitstillstand, bis „zu schnell, um über­ haupt noch etwas zu erleben“. Auf das veränderte Zeiterleben müssen die Poli­ zisten vorbereitet werden, da dieses Angst hervorrufen kann („Warum bin ich so langsam?“, „Werde ich verrückt ?“). Deutlich über die Hälfte der Betroffenen beschreiben ein reduziertes Hörvermögen. Geräusche können gedämpft oder wie aus großer Entfernung oder auch überhaupt nicht gehört werden (eigene oder fremde Schüsse, Zurufe, Sirenen ...). Von ca. einem Sechstel wurden einige Geräusche verstärkt wahrgenommen. So wurde dem Autor berichtet, dass das Auftreffen der Kugel auf den Körper des Gegners gehört wurde. Angaben zum „Tunnelblick“ (intensives Fokussieren eines Bereichs, bei Ausblen­ dung der Randbereiche) finden sich bei Solomon und Horn (37%) und Artwohl (83%). Unterschiedlich häufig wird von Detailwahrnehmungen (Gesicht, Waffe, Kleidung) berichtet (18% bei Solomon & Horn, 1986, und 74% bei Artwohl & Christensen, 1997). Ein Grund für die unterschiedlichen Häufigkeiten ist mögli­ cherweise in einer uneinheitlichen Fragestellung zu sehen. Loslösungserleben im Sinne von Deperso­ nalisation (die Szenerie wie von außen sehen) und Derealisation (Gefühl zu träumen, „das ist nicht wahr“) wird von etwa der Hälfte der von Artwohl und Christensen (1997) Befragten angegeben. 2.2 Belastungsreaktionen Hier finden sich – je nach Fragestellung der Untersuchung – unterschiedlich viele Symptome der akuten bzw. posttraumati­ schen Belastungsreaktion. Daneben gibt es aber auch Angaben zu kognitiven, sozialen und anderen Aspekten, die in den Diagnosesystemen nicht aufgenom­ men sind. Die Reihenfolge der Belas­ tungsreaktionen ist – soweit dies mög­ lich war – an die Häufigkeit der Nennun­ gen in den Studien angelehnt. Eine hohe Beanspruchung – schon kurz nach dem Schusswaffengebrauch – stellt das meist reduzierte Erinnerungsvermö­ gen dar. Diese Beanspruchung wird durch die notwendigen Ermittlungen noch erhöht. Nach Schusstreffern muss eine staatsanwaltschaftliche Untersuchung – oft mit Befragungen oder Vernehmungen – erfolgen. Die Ermittlungen können einen erheblichen Einfluß auf das Befinden des Schützen nach sich ziehen und werden weiter unten angesprochen. Zum anderen befindet sich der Polizeibeamte auf einmal in einer Situation, die er in der Regel aus der gegenüberliegenden Perspektive kennt, er wird befragt oder vernommen. Wie oft machten Zeugen oder Vernehmende widersprüchliche Angaben und/oder hatten Erinnerungs­ probleme mit unterschiedlich hoher Glaubwürdigkeit? Hieraus können berufs­ bedingte Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Erinnerungsprobleme resultieren. So kann der nun betroffene Polizist davon ausgehen, dass der Kollege ihm gegenüber auch diese Zweifel hegt. Dies kann zu zusätzlichen Verwirrung und Unsicher­ heiten führen. Im einzelnen können folgende Erinnerungsverfälschungen auftreten (Artwohl & Christensen, 1997): Ca. 2/3 berichteten von reduziertem Erinnerungsvermögen. Teilabläufe konnten nicht erinnert werden. Wer war dabei, wie oft wurde geschossen, wie oft habe ich geschossen? Dagegen schilderten etwa 1/5 Ereignisse und Abläufe, die in Wirklichkeit nicht stattfanden. Es ist aber auch möglich, dass das Ereignis mit ungewöhnlicher Klarheit und mit vielen Details erinnert wird (ähnliche Angaben finden sich bei Stratton, Parker & Snibbe, 1984; Manoli­ as & Hyatt-Williams, 1993). Weiterhin weisen die beschriebenen Gedächtnisphänomene daraufhin, dass die Angaben zum Erleben des Schusswaf­ fengebrauchs (2.1) vorsichtig interpre­ tiert werden müssen. Aufgrund der vorliegenden Untersuchun­ gen (Stratton, Parker & Snibbe, 1984; Loo, 1986; Solomon & Horn, 1986; Ger­ sons, 1989; Manolias & Hyatt-Williams, 1993) müssen Intrusionen in der Zeit nach dem Schusswaffengebrauch als das herausragende Problem angesehen wer­ den. Hierbei handelt es sich um spontan auftretende teilweise sehr intensive, belastende Erinnerungen. Solomon und Horn (1986) hatten in ihrer Befragung keine eigenen Kategorien hinsichtlich belastender Erinnerungen. Diese wurden von ihnen möglicherweise unter dem Bereich „Einschleichende Gedanken (introducing thoughts) / Flashbacks“ sub­ sumiert, der auf Platz vier von 16 Kategorien rangierte. Bei Stratton, Parker und Snibbe (1984) war die Kategorie „flash­ backs / recurring thoughts“ auf dem ersten Platz der drei häufigsten Probleme. Flashbacks sind Erinnerungsattacken und treten unvorhersehbar mit hoher Lebendigkeit auf. Die Kategorienbildung oder Vermischung von Intrusionen und Flashbacks ist nachvollziehbar, gehören beide Bereiche doch zum „Erinnerungs­ druck“ nach DSM IV. Loo (1986) hatte „Flashbacks“ als eigene Kategorie benannt, die sowohl als häufiges als auch als recht schweres Problem genannt wurde. Hohe Bedeutung – im Sinne häufiger Nennungen – haben auch „Schlafschwierigkeiten“ (Stratton, Parker & Snibbe, 1984; Solomon & Horn, 1986; Gersons, 1989; Manolias & Hyatt-Williams, 1993). Hierbei ist aber in den Berichten nicht immer klar, ob nach „Ein- und Durchschlafstörungen“ oder „Alpträumen“ gefragt wurde. Nach Wut und Zorn wurde häufig gefragt und diese Emotionen wurden auch sehr oft benannt. Solomon und Horn (1986) berichten, dass diese Emp­ findungen oft auf die Person gerichtet sind, die die Veranlassung zum Schießen gab („God damm you for putting me in such a situation“ oder „God damm you for making me feel so vulnerable“). Ziel von Wut und Zorn kann auch der Part­ ner/Kollege sein. Es wird ihm angelastet, dass er nicht korrekt gehandelt haben 79 soll. Ein häufig gemachter Vorwurf ist hierbei, dass er nicht genug Schutz gege­ ben habe. Besonders sensibel und emo­ tionsbeladen werden die Aktivitäten seitens der Dienststelle bzw. anderer Insti­ tutionen der öffentlichen Verwaltung beachtet. Dazu später mehr (2.3). Bei Loo (1986) liegt „Wut über das Ereignis“ auf dem zweiten Platz der negativen Reak­ tionen, ähnlich den Ergebnissen von Solomon und Horn (1986). Diese Emotio­ nen halten nach Loo auch über einen Monat lang an. Stratton, Parker und Snibbe (1984) sprechen nur davon, dass ca. 2/3 der Befragten emotionale Reaktionen wie Depression, Wut u.a. hatten. Zukunftssorgen hinsichtlich eines mög­ lichen zukünftigen Waffengebrauchs wurden nur von Solomon und Horn (1986) erfragt. Hier gaben 40% der Befragten entsprechende Gedanken an („Werde ich zu schnell oder zu langsam ... womöglich gar nicht reagieren?“). Ein­ zig diese beiden Autoren bildeten den Bereich „Erhöhter Sensibilität für Gefahr“, oft unter dem Aspekt der Erkenntnis der eigenen Endlichkeit. Dies bedeutet, dass der Beruf, wohl in Folge des Erkennens der eigenen Verletzlichkeit, zukünftig als gefährlicher angese­ hen wird. Zukunftsgedanken im Sinne von „Furcht vor Untersuchung“ waren bei Stratton, Parker und Snibbe (1984) unter den drei am häufigsten genannten Pro­ blemen. „Furcht vor Untersuchungen“ beinhaltet z.B. die Ungewißheit darüber, welche Spuren die ermittelnden Beamten finden, welche Schlüsse sie daraus ziehen und für wie glaubwürdig die eigenen Aussagen dahingehend gehalten werden. Wie gesagt (2.2), kommt es nach dem Schusswaffengebrauch häufig zu Erinnerungsproblemen, hierdurch wird die „Furcht vor Untersuchungen“ nochmals verstärkt. Weitere Antworten können unter der Symptomgruppe „Vermeidung/emotionale Taubheit“, analog DSM IV zusammenge­ faßt werden. Solomon und Horn (1986) fanden häufig Empfindungslosigkeit (43%), Depression (42%) und immerhin 11% Suizidgedanken. Loo (1986) hatte die Kategorie „Überprüfung persönlicher Werte“, deren Bedeutung auch über einen Monat hinaus den Spitzenplatz einnahm. „Interessensverlust hinsichtlich der Arbeit“ und „Depression“ waren hier relativ gering ausgeprägt. Es kann aber 80 auch nicht ausgeschlossen werden, dass „Depression“ in den Befragungen unter­ schiedlich verwendet wurde, wie z.B. als Verstimmung, Sorgen oder im strengen klinischen Sinn. „Gefühlseinengung“ war mit 60% in der Gesamtgruppe auch ein bedeutsamer Aspekt bei Gersons (1989). Manolias und Hyatt-Williams (1993) sowie Stratton, Parker und Snibbe (1984) hatten nur die groben Bereiche „emotionale Reaktionen“, die in beiden Untersu­ chungen von 2/3 der Befragten berichtet wurden. Soziale Probleme wurden explizit nur von Solomon und Horn (1986) aufgegriffen. Isolation/Rückzug (45%), Entfremdungsgefühle (40%), Probleme mit Regeln und Autoritäten sogenannte „troublemakers“ (28%), familiäre Probleme (27%) und sexuelle Schwierigkeiten (18%) wurden genannt. Hieraus wird deutlich, wie wichtig es ist, die gesamte Familie zu betreuen. Die beiden Autoren gehen weiterhin davon aus, dass sexuelle Schwierigkeiten für Polizisten wohl sehr schwer zu akzeptieren sind. Demzufolge wird selten eine Behandlung aufgesucht und es entsteht zusätzlicher Druck. Neben den Partnerschaftsproblemen gab es in Einzelfällen aber auch Verbesserungen der Beziehungen. Unerwartet wenig wurde in Richtung der Symptomgruppe „chronische Übererre­ gung“ entsprechend DSM gefragt. Nur Gersons (1989) nahm teilweise das DSM als Grundlage seiner Studie, allerdings noch das DSM III. Immerhin berichteten 68% der Gesamtgruppe von Übererre­ gung, aber nur 5% (maximal 2 Personen!) von Gedächtnis- und Konzentrations­ schwierigkeiten. Auch nach Alkohol- oder Drogenabusus wurde nur von Solomon und Horn (1986) gefragt. 14% bejahten einen Substanz­ missbrauch. Ein übles Gefühl, welches in der „PostShooting“-Gruppe des Autors einmal mit „Verlust der Unschuld“ beschrieben wurde, wird recht häufig empfunden. Von Übelkeit, Appetitlosigkeit bis hin zum Gefühl des Abgestoßenseins sprechen Manolias und Hyatt-Williams (1993). Letzteres, weil die Tat für den Betroffenen im krassen Gegensatz zu dem stand, was für ihn Poli­ zei darstellte. Hinzu kamen psychosomati­ sche Reaktionen von chronischer Migräne und Gefühlsverlust in der rechten Körperhälfte. Solomon und Horn (1986) spra­ chen vom „Kainsmal“, dem Gefühl, von allen beobachtet zu werden, wohl als Pro­ jektion von Anklage- und Schamgefühlen, weil man im übertragenen Sinne einen Brudermord begangen hat. Dies führt zu einem sehr wichtigen und in der Praxis schwierigen Bereich, dem der „Schuld“. „Schuld“ im weiteren als nur dem rechtlichen Sinn, als persönliche Empfindung, einen Menschen ernsthaft verletzt oder getötet zu haben. Auch bei rechtlich eindeutiger Sachlage und Freisprechung von jeder juristischen Schuld kann für den einzelnen die Frage noch völlig ungelöst und problembehaftet sein. Vielleicht liegt es an der Komplexität und Vielschichtigkeit dieses Problems, dass nur Loo (1986) sowie Manolias und Hyatt-Williams (1993) es in nennenswer­ ter Weise betrachtet haben. Unter der Fragestellung, was der größte negative Effekt war, wurden bei Loo (1986) von 14% der Polizisten Schuldgefühle genannt. In diesem Zusammenhang dürfte es interessant sein, dass auch 14% den Wunsch hatten, das Geschehene ungetan machen zu können. Die Prozentangaben zu diesen beiden Rubriken verringerten sich auch nach einem Monat nicht stark. Zum Vergleich: „Depressionen“ äußerten nach einem Monat 13%. Die Befragung von Manolias und Hyatt-Williams (1993) zeigt andere Ergebnisse: Die Hälfte sprach davon, keine Schuldgefühle hinsichtlich des Schießens zu haben. Einige machten sich aber Sorgen um die Familie des Toten. Etwas weniger als die Hälfte fühlte sich schlecht oder schuldig, jemanden verletzt oder getötet zu haben. Im Vergleich mit den Erfahrungen der von mir betreuten „Post-Shooting“-Gruppe, erscheint dieser Bereich in den Veröffent­ lichungen stark unterrepräsentiert. „Schuld“ ist hier fast immer, auch Jahre nach dem Ereignis, ein Thema. Die Dauer, wie lange das Ereignis Probleme bereitet, ist stark unterschiedlich. Bei Stratton und seinen Kollegen (1984) lagen die Schießereien sechs Monate bis drei Jahre zurück. Gut drei Viertel der Gruppe gab an, dass das Ereignis noch frisch in der Erinnerung ist. 10% hatten es ein wenig, 5% zur Hälfte, 6% über­ wiegend und 1% vollständig vergessen. Loo (1986) fragte danach, wann die Betroffenen wieder normal zur Arbeit gegangen sind und ohne Schwierigkeiten am Familien- und sozialen Leben teilnah­ men. Die Angaben hierzu schwankten von weniger als eine Woche bis zu meh­ reren Jahren. Ähnlich sind die Angaben bei Manolias und Hyatt-Williams (1993). Die Schwierigkeiten dauerten einige Wochen bis mehrere Monate, in Extremfällen noch viel länger. Eine Person hatte noch nach zwei Jahren eine schwere Depression mit komplettem Rückzug aus Familien- und Kollegenkreis, und einmal wird von Weinkrämpfen noch 12 Jahre nach dem Vorfall berichtet. Solomon und Horn (1986) diskutieren den Einfluß von situativen Komponenten auf die Probleme nach dem Schusswaf­ fengebrauch. Sie zitieren Roberts (1982), der herausstellte, dass es wichtig sei, wie sich die Situation anbahnt, wie blutig sie ist und wie die Reputation der getroffe­ nen Person ist. Letzteres zielt auf den Unterschied ab, ob ein langgesuchter Schwerverbrecher getroffen wird oder ein Teenager. Solomon und Horn (1986) sprechen noch die Fairness der Situation an, d.h., wer war in der Überzahl, gab es unbeteiligte Personen im Schussfeld, war der Gegner gefährlicher bewaffnet (Schrotflinte)? Ist die Situation durch Unfairness gekennzeichnet, soll dies zu erhöhter Wut führen. Wesentlich soll auch das Empfinden der eigenen Verletz­ lichkeit und das Realisieren der eigenen Endlichkeit sein. Wer mit der Furcht und eigenen Verletzlichkeit umgehen konnte oder sich nicht so verletzlich fühlte, hat­ te weniger starke Schwierigkeiten als jemand, der sich verletzbarer fühlte oder starke Angst hatte. Ähnliche Angaben erhielten Manolias und Hyatt-Williams (1993). Die Schwierigkeiten waren vor allem dann erhöht, wenn der Gegner eine Waffenattrappe hatte, Unbeteiligte getroffen wurden oder der Getroffene eine Querschnittslähmung davontrug. helfer oder Soldat, können vier Aspekte die Soziale Unterstützung bzw. zusätzli­ che Traumatisierungen beeinflussen: Zunächst kann das – etwas überspitzt formuliert – eine Art „Psyphobie“ sein. Bei vielen Polizisten liegen noch immer Bedenken gegen alles vor, was mit „Psy...“ anfängt („Ich bin doch nicht verrückt“). Gersons (1989) berichtet aus Holland, dass keiner seiner 34 Befragten nach professioneller Hilfe gefragt hat. Völlig konträr hierzu stellt sich die Lage dar, wenn jemand die Gelegenheit hat, an einem Aufarbeitungsseminar teilzunehmen. Hierbei sind mir als Seminarleiter lange Anwärmphasen oder gar nervöses Schweigen unbekannt. Im Gegenteil, das Erlebte, die Gedanken und Emotionen sprudeln förmlich aus den Polizeibeam­ ten heraus. Weiterhin besteht mitunter die Sorge, dass die Inanspruchnahme psychosozialer Hilfe einen negativen Einfluß auf die spätere dienstliche Beurteilung durch den Vorgesetzten haben könnte. Wenn jemand so schwach ist und psychische Hilfe braucht, ist er dann nicht ein schlechterer – oder zumindest nicht so guter – Polizist? Mitunter könnte bei einigen Mitarbeitern und Vorgesetzten auch von einer „Sheriff-Mentalität“ gesprochen werden (ähnlich Loo, 1986; Gersons, 1989). Der Sheriff sorgt schnell und knallhart für Recht und Ordnung. Probleme gibt es nicht oder sie werden – mit der Waffe – weggesteckt. Ein ganz wesentliches Problem stellen die nach dem Schusswaffengebrauch mit Verletzungsfolge einzuleitenden Ermittlungen dar. Diese Verfahren können über einen längeren Zeitraum sehr stark be­ lasten. 2.3. Einflüsse auf die Regeneration Nach kritischen Ereignissen hat soziale Unterstützung eine hohe Bedeutung (z.B. Herman, 1993; Maercker, 1997; Lasogga & Gasch, 2000). Unterstützung von Kollegen ist die Regel. Bei Stratton, Parker und Snibbe (1984) gab es eine und bei Mano­ lias und Hyatt-Williams (1993) zwei Ausnahmen. Als zumindest etwas unterstützend wurden 97% der Kollegen der von Solomon und Horn (1986) befragten Poli­ zisten beurteilt. Nach Manolias und Hyatt-Williams (1993) wurden auch nur Wesentlich für den Verlauf der Schwierigkeiten nach einem kritischen Ereignis sind die soziale Unterstützung bzw. zusätzlichen Verletzungen. Selbstredend: Je höher die soziale Unterstützung und je weniger zusätzliche Verletzungen, desto weniger bzw. kürzer anhaltende Probleme (Solomon & Horn, 1986). Ähnlich anderen „Harte-Männer-Beru­ fen“ wie Feuerwehrmann, Katastrophen- 2.3.1 Soziale Unterstützung selten „Witze“ bezüglich des Ereignisses gemacht. Unüberlegte Kommentare gab es am ehesten, wenn Schwerverbrecher das Ziel der Schüsse waren. Am ausführlichsten behandelten Solomon und Horn (1986) den Einfluß von Kollegen, Vorgesetzten, Verwaltung und Untersucher. Natürlich ist es schwierig, diese US-amerikanischen Ergebnisse auf Deutschland zu übertragen. So sind die polizeilichen Ausbildungen, die Aufgaben der verschiedenen Institutionen und die Mentalität mitunter stark unterschiedlich. Die Ergebnisse liefern folgende Hin­ weise: Für alle vier untersuchten Perso­ nengruppen (fellow officers, supervisors, administration, investigation) gab es sig­ nifikante negative Korrelationen (-.23 bis -. 37) zwischen Unterstützung und Traumawerten. Mit anderen Worten: Je höher die Unterstützung, desto geringer die Schwere des Traumas. Die größten Korrelationen gab es für „Entfrem­ dung“ und „Probleme mit Autoritäten und Regeln“. Je mehr Unterstützung von den vier Personengruppen, desto geringer war der Problembereich „Entfremdung“ ausgeprägt. In die gleiche Richtung weisen die Korrelationen von „Problemen mit Autoritäten und Regeln“ mit den Zuwen­ dungen durch die Personengruppen „supervisors“, „administration“ und „investigation“. Geringere Unterstützun­ gen durch diese Gruppierungen gehen mit mehr „Problemen mit Autoritäten und Regeln“ einher. Etwas weiter inter­ pretiert werden die o.g. „troublemakers“ produziert, die Probleme mit Regeln und Autoritäten haben. Unterstützung erfährt diese Überlegung durch die eigene Arbeit mit Traumaopfern, die angeben, nach den kritischen Ereignissen mehr auf sich zu achten, egoistischer zu sein und „sich weniger gefallen zu lassen“. Für „fellow officers“ konnten keine signifikanten Zusammenhänge mit der Schwere des Traumas beobachtet werden. Dies könnte daran liegen, dass „fellow officers“ als Freunde eher bei privaten Problemen hel­ fen und andererseits – im Umkehrschluß – so gut wie nicht verletzend werden. Einen statistisch bedeutsamen positiven Zusammenhang zwischen dem Befinden zum Zeitpunkt der Befragung und der erlebten Unterstützung gab es nur mit „fellow officers“. Mit anderen Worten: eine bessere erlebte Unterstützung geht 81 mit einem besseren Befinden in der Zukunft einher. Diese Ergebnisse können laut Solomon und Horn (1986) durch verschiedene Mediatorvariablen beeinflusst sein. Hier­ zu zählt, wie eindeutig der Schusswaf­ fengebrauch war, ob ein Jugendlicher das Opfer war und ob die Reputation anderer Polizisten mit betroffen war. So könnte beispielsweise bei einer – vor allem rechtlich – nicht eindeutigen Situation oder einem Jugendlichen als Opfer ein unsensibles Vorgehen der Behörden (z.B. wenig Transparenz des Vorgehens, frag­ würdige Pressemitteilungen) besonders schädlich sein. Ist der gute Ruf anderer Polizisten betroffen, könnte dies zu Pro­ blemen mit der kollegialen Unterstützung führen. Hinsichtlich „critical incident support teams“ sprechen sich die beiden Autoren für den Einsatz von polizeilichen Kolle­ gen aus, die selbst Betroffene waren. Ihrer Ansicht nach hätten diese eine höhere Akzeptanz als Profis wie Psycho­ logen, Ärzte oder Sozialarbeiter. Der Fra­ ge hinsichtlich professioneller Unterstüt­ zung wurde differenzierter von Stratton, Parker und Snibbe (1984) und Loo (1986) nachgegangen. Übereinstimmend wurde in beiden Studien von den Polizisten angegeben, dass Unterstützung für ande­ re viel wichtiger ist als für die eigene Person. Loo (1986) sieht dies als Hinweis auf ein „Macho-Image“ innerhalb der Polizei, nach dem „andere Hilfe brauchen, ich aber nicht“. Bei Stratton und Kollegen hielten gut drei Viertel der Befragten Debriefings (Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen; vgl. Mitchell & Everly, 1998) zwar für andere für eine gute Idee, mehr als 40% gaben jedoch an, es selbst nicht zu brauchen. Ver­ gleichbar sind die Ergebnisse von Loo (1986). Zumindest „etwas wichtig“ für andere hielten zwischen 81% und 97% der Teilnehmer die Hinzuziehung eines Psychologen (innerhalb von drei Tagen), Einzeltherapie, psychologische Hilfe für die Familie oder einen „peer counsellor“ (Kollege, der selbst Betroffener ist). Auf sich selbst bezogen schwankten die Pro­ zentangaben bezüglich dieser Hilfen zwi­ schen 58% und 62%. Wurde dagegen gefragt, ob ein psychologisches Bera­ tungsangebot für die eigene Person zur Verfügung stehen sollte, so wurde dies von 80% befürwortet. Zum einen könnte 82 das Wissen um eine solche Beratung – im Sinne eines Reservefallschirms – beruhigend wirken, zum anderen wird eine unterstützende bzw. helfende Hal­ tung des Arbeitgebers deutlich, wenn er für eine solche Möglichkeit sorgt (vgl. Hallenberger, 1998). In der selben Untersuchung gaben die Polizisten auch an, dass es ihnen lieber sei, per Anweisung nach dem Schusswaf­ fengebrauch zu Hause bleiben zu müs­ sen, als sich womöglich das Stigma „krank“ einzuhandeln. Den familiären Bereich beleuchteten nur Manolias und Hyatt-Williams (1993) sowie Artwohl und Christensen (1997). Die Familie sei zwar mitunter durch das Ereignis schwer beansprucht, aber sie scheint doch fähig zu sein, wertvolle Unterstützung zu leisten. Über die pro­ blematische Situation wurde in der Fami­ lie in stark unterschiedlichem Ausmaß gesprochen: von sehr viel bis gar nicht, letzteres bei Vorliegen einer Depression. In dieser Untersuchung wurden keine Hinweise auf ernsthafte Effekte bei den Kindern der Polizisten gefunden. D.h. es gab keine Hinweise auf Belästigungen durch andere Personen oder sekundäre Traumatisierungen der Kinder. In der Befragung von Loo (1986) hielten etwas über die Hälfte der Betroffenen psycho­ logische Hilfe für ihre Familie zumindest für „etwas wichtig“, hinsichtlich der Familie anderer aber über 90%! In Zusammenhang mit den Aussagen bei Artwohl und Christensen (1997) kann aus den Ergebnissen von Loo (1986) geschlossen werden, dass die Familie als Rückhalt wichtig ist, diese unterstützen­ den Familienmitglieder selbst aber Unter­ stützung erfahren müssen. In diesem Zusammenhang ist ein Ergeb­ nis von Gasch (1998) interessant. Entge­ gen der Erwartungen steht hier die Zufriedenheit mit der sozialen Unterstüt­ zung aus dem familiären Bereich in einem gegenläufigen Zusammenhang mit den Erholungswerten nach belastenden Ereignissen. Anders ausgedrückt: Je zufriedener eine Person mit der sozialen Unterstützung war, desto geringer war die Erholung. Gasch (1998) interpretiert diesen Befund dahingehend, dass die Gespräche trotz subjektiver Zufriedenheit keine sinnvolle Bewältigungsstrategie bieten und dass dadurch, anstatt einer Lösung näherzukommen, möglicherweise eine zermürbende „Endlosschleife“ von Diskussionen beginnt. Letztlich führe dies zu Frustration und Resignation auf bei­ den Seiten. Dieses Ergebnis zeigt aber auch ganz deutlich, dass man sich den Frust nur scheinbar von der Seele reden kann. Nötig ist gezielte, systematische Aufarbeitung mit Lösungsansätzen. Dies kann in der Regel nur von psychothera­ peutisch geschulten Fachkräften gewähr­ leistet werden. 2.3.2 Zusätzliche psychische Verlet­ zungen Im Umkehrschluß zu dem Zuvorgesagten kann angenommen werden, dass bei geringerer sozialer Unterstützung die Folgen der Traumatisierung stärker sind. Oder noch schlimmer: das Umfeld macht Fehler (Solomon & Horn, 1986). Hierzu zählen vor allem Wertungen, egal ob im „positiven“ („Gut gemacht“, „der hat es verdient“, „toller Schuss“) oder im „nega­ tiven“ („Mußte das sein?“, „Hättest du ihm nicht das Licht auslöschen kön­ nen?“). Aus der Erfahrung mit der „PostShooting“-Gruppe werden jedoch detail­ lierte rechtliche Wertungen von Kollegen erwartet. Es wird auch häufig von „Witzen“ und „Sprüchen“ berichtet, die teilweise hohen Schaden anrichten („Na Killer.“, „Wieviel werden es heute?“, „Hätte ich doch an deiner Stelle sein können.“, „dead eye“). Solche Kommentare treffen jemanden, der selbst verwundet bzw. erschüttert (traumatisiert) wurde. Jemanden der zu diesem Zeitpunkt sehr empfindlich ist und der weiß, dass – wenn überhaupt – nur sehr wenige ihn verstehen können. Das gezeigte Unverständnis kann schließlich das Gefühl der Entfremdung und das Risiko der Isolation erhöhen (Solomon & Horn, 1986). Mitunter werden die Betroffenen auch geschnitten, oder im Gegenteil, es fragen viele sensationslüstern nach. Nach den Ergebnissen der vorliegenden Studien und eigenen Erfahrungen erscheint die Annahme gerechtfertigt, dass Fehler wohl seltener vom engsten Kollegenkreis gemacht werden, sondern von weiter entfernten Polizeibeamten. Die direkten Kollegen stehen nach den in Abschnitt 2.3.1 dargestellten Ergebnissen in einem sehr positiven Licht. Eine besondere Ver­ antwortung liegt bei den Vorgesetzten. Wenn diese den Kollegen nicht unter­ stützen, sich zurückziehen oder ihn gar vorschnell zur Rechenschaft ziehen, kön­ nen nicht wiedergutzumachende zusätz­ liche Verletzungen die Folge sein. In Anlehnung an Solomon und Horn (1986) muss mit Entfremdungsgefühlen, Isola­ tion und selbstgemachten „Quertreibern“ („troublemakers“) gerechnet werden. Der größte zusätzliche Stress entsteht durch die nachfolgenden Ermittlungen, Gerichtsverfahren und journalistischen Berichterstattungen. Das fängt damit an, dass dem Betroffenen die Waffe wegge­ nommen wird und er oft unverzüglich einen Rechenschaftsbericht anfertigen soll (vgl. Solomon & Horn, 1986; Manoli­ as & Hyatt-Williams, 1993). Auch in Deutschland wird die Waffe sofort einge­ zogen und mitunter eine sofortige Ver­ nehmung angestrebt. Ersteres ist für die Spurensicherung notwendig, kann aber einerseits sehr kalt oder andererseits in ruhiger und annehmender Art und Weise erfolgen. Rechenschaftsberichte oder Vernehmungen sind aufgrund des Schockzustands nicht nur schädlich für den Betroffenen, sondern auch rechtlich wertlos. Aufgrund der beschriebenen Wahrnehmungs- und Gedächtnisverfäl­ schungen können Falschaussagen zustande kommen. Diese Falschaussagen sind für den Schützen die erlebte Rea­ lität. Hieraus ergeben sich sodann krasse Widersprüche zu den kriminaltechni­ schen Erkenntnissen. Die mit den nach­ folgenden Untersuchungen verbundene Unsicherheit wird in den Veröffentlichun­ gen von Stratton und Kollegen (1984), Loo (1986), Solomon und Horn (1986) sowie Manolias und Hyatt-Williams (1993) betont. Letztere weisen noch dar­ auf hin, dass das nachfolgende Procedere teilweise schlimmer empfunden wird als das belastende Ereignis selbst. Ähnlich unangenehm können die Akti­ vitäten der Medien empfunden werden, die das Ereignis oft völlig falsch darstel­ len und womöglich sogar den Namen veröffentlichen. Es wird auch von Politi­ kern berichtet, die den Vorfall für sich ausnutzen wollten (Manolias et al., 1993). Aufgrund der eigenen Erfahrungen mit betroffenen Polizisten können die Berich­ te von Stratton und Kollegen (1984), Loo (1986), Solomon und Horn (1986) sowie Manolias und Hyatt-Williams (1993) nur noch einmal eindringlich unterstrichen werden. Eine höchst gefährliche, sehr blutige Situation mit destruktiven Vorge­ setzten, langwierigen Untersuchungen und entstellenden Pressemeldungen machen dem Kollegen das Leben auf vie­ le Jahre zur Hölle! 3. Der „sichere“ Schuss Hierunter wird der Schusswaffenge­ brauch aus sicherer Entfernung, also klassischerweise der „finale Rettungs­ schuss“, verstanden. Dieses sehr seltene Ereignis ist nach derzeitigem Kenntnis­ stand nicht systematisch aufgearbeitet worden. Für den Militäreinsatz kann auf Grossman (1996) verwiesen werden. In den zitierten Studien wurde zwischen diesen beiden Arten des „unsicheren“ und „sicheren“ Schusswaffengebrauchs nicht unterschieden. Die Empfindungen, Reak­ tionen und Folgen auf den Schusswaf­ fengebrauch sind den zuvorbeschriebe­ nen sehr ähnlich. Es ist jedoch keine zugespitzte „Der oder ich“-Situation. Man könnte sich nun fragen, warum auch hier hohe bis höchste Belastungsre­ aktionen zu beobachten sind. Sieht man sich noch einmal die situativen Merkma­ le traumatischer Situationen nach DSM IV an, so können diese beim finalen Ret­ tungsschuss als gegeben angesehen wer­ den: Die Person ist mit tatsächlichem oder drohendem Tod oder ernsthafter Verletzung – hier einer anderen Person – konfrontiert. Meist mit einer hohen Ver­ antwortung hinsichtlich der körperlichen Unversehrtheit einer weiteren Person, der Geisel. Was kann das persönliche Erleben „tief­ greifender Verzweiflung“ (ICD 10) oder intensiver Furcht, Hilflosigkeit, Entsetzen (DSM IV) hervorrufen? Versuchen wir, uns die Situation vorzu­ stellen: Auf dem Zielenden lastet eine ungeheuer große Verantwortung gegenü­ ber der Geisel. Trifft er nicht (richtig) muss er davon ausgehen, dass diese zumindest erheblich verletzt oder gar getötet wird. Der Fokus ist der Täter ­ wahrscheinlich zum Zielobjekt degradiert, – sonst nichts. Alle anderen Sinnesemp­ findungen sind abgeschaltet. Der Schütze hat ein Höchstmaß an Kontrolle über das Leben des anderen Menschen. Nur eine minimale Muskelkontraktion, und der andere ist – höchstwahrscheinlich töd­ lich – getroffen. Dann der Schuss. Danach ist die Situation völlig anders. Aus dem Höchstmaß der Kontrolle wird der totale Kontrollverlust, dem Schützen ist alles direkt Folgende aus den Händen genommen. Viele Gedanken schwirren durch den Kopf: Habe ich getroffen? Habe ich richtig getroffen? Hat der andere sich vielleicht noch kurz vor dem Einschlag bewegt und lebt noch? Oft ist der Getroffene nicht vollständig zu sehen. Die Handlung wird dem Schützen als Realität bewusst. Das (Ziel-) Objekt wird im Bewusstsein zum Subjekt. Der Polizist hat einen Menschen getötet. Was jetzt kommt, konnte nicht trainiert, nicht angesprochen werden. Erinnern wir uns an den Ausspruch „Verlust der Unschuld“. Weiterhin wird dem Schützen mit dem Tod des anderen auch die eigene Ver­ wundbarkeit und Endlichkeit zutiefst bewußt. Die rechtliche Seite ist abgesichert, die persönliche Schuldfrage und Moralemp­ findung kann aber trotzdem zum großen Problem werden. Besonders dann, wenn man sich vorher wenig oder gar keine Gedanken um den Schusswaffengebrauch und seine Folgen gemacht hat. Kurz dar­ auf können die Pressemeldungen nach­ gelesen werden. Wie wird hier das Ereig­ nis dargestellt: als Rettung eines bedroh­ ten Menschen durch einen bestens aus­ gebildeten Menschen oder – im Extrem­ fall – als Hinrichtung? Bei aller rationalen Klarheit und Recht­ mäßigkeit muss nun dieses Ereignis in das eigene Lebenskonzept – in die per­ sönliche Biografie – integriert werden. Die Emotionen müssen fassbar, verbali­ sierbar gemacht werden. Oft sind die Gefühle und Gedanken noch unaus­ sprechbar im Kopf der Betroffenen. In den Aufarbeitungsseminaren erfolgt die Schilderung der Situation dann logisch kühl und trotzdem werden die Augen feucht, die Tränen fließen. Ich hoffe, die Situation in aller Kürze gut genug beschrieben zu haben, so dass ein Aufkommen von tiefgreifender Verzwei­ flung, intensiver Furcht, Hilflosigkeit und /oder Entsetzen verstehbar wird. D.h., dass der finale Rettungsschuss traumato­ gen wirken kann und somit eine Akute Belastungsreaktion oder später auch eine Posttraumatische Belastungsstörung (DSM IV, 1996) auslösen kann. 83 4. Hilfsmaßnahmen Zunächst muss eine flächendeckende Sensibilisierung zu den Themen „Streß“ und „Trauma“ erfolgen. Nach diesseiti­ gem Kenntnisstand werden diese Themen mittlerweile im gesamten Bundesgebiet in den Polizeiausbildungen behandelt. Für Akutsituationen stehen in einigen Bundesländern Kriseninterventionsteams › zur Verfügung. Im Idealfall existiert eine 24stündige Rufbereitschaft für die sofortige Krisenhilfe. Hierin finden sich vor allem Ärzte, Diplompsychologen, Seelsorger und Polizeibeamte. Diese sind in der Regel in den Gebieten Kommunikation, Recht und Psychotraumatologie aus­ bzw. weitergebildet. Oft finden in dem Zeitraum 24 bis 72 Stunden nach dem Ereignis Debriefings statt, entweder als Folge- oder Erstmaß­ nahme. Idealerweise werden die Betrof­ fen dann etwa einen Monat später noch einmal kontaktiert. Weiterhin bieten viele Institutionen Seminare für Betroffene zu Post-Shoo­ ting und PTSD an. Oft auf Eigeninitiative wurden Workshops, Supervisionskreise und geleitete Selbsthilfegruppen von Polizeipsychologen und Polizeiseelsorgern aufgebaut. Literatur Artwohl, A. & Christensen, L. W. (1997): Deadly Force Encounters. Boulder, Colorado: Paladin Press Deutsche Polizei (1995): Interview „Was nach dem Schießen kommt, wird nicht gesagt“. Deutsche Polizei, 3/95, 6 -10 DSM-IV (1996): Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen der American Psychiatric Association. Göttingen: Hogrefe Gasch, U. (1998): Polizeidienst und psychische Traumen. Kriminalistik, 12, 819 – 823 Gersons, B. P. R. (1989): Patterns of PTSD among Police Officers following Shooting Incidents: A Two-Dimensional Model and Treatment Implications. Journal of Traumatic Stress, Vol. 2, No. 3, 247 – 257 Grossman, D. (1996): on killing. Boston: Little, Brown and Company Hallenberger, F. (1998): Erleben kritischer Ereignisse – Möglichkeiten der Prävention. Vortrag bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Traumaund Krisenbewältigung am 29.04.1998 Herman, J. L. (1993): Die Narben der Gewalt. München: Kindler ICD-10 (1994): Internationale Klassifikation psychischer Störungen Kapitel V (F). Bern: Huber Krolzig, M. (1992): Mit einem Schlag wird alles fremd. Deutsche Polizei, 12/92, 27 – 35 Lasogga, F. & Gasch, B. (2000): Psychische Erste Hilfe. Edewecht: Stumpf und Kossendey Loo, R. (1986): Post-shooting Stress Reactions Among Police Officers. Journal of Human Stress, 12, 27 – 31 Lorei, C. (1999): Der Schußwaffeneinsatz bei der Polizei. Berlin: wvb Maercker, A. (1997): Therapie der posttraumatischen Belastungsstörungen. Heidelberg: Springer Manolias, M. B. & Hyatt-Williams, A. (1993): Effects of Postshooting Experiences on Police-Authorized Firearms Officers in the United Kingdom. In Wilson, J. P. & Raphael, B. (Hrsg.): International Handbook of Traumatic Stress Syndromes. New York: Plenum Press Mitchel, J. T. & Everly, G. S. (1998): Streßbearbeitung nach belastenden Ereignissen. Edewecht: Stumpf und Kossendey Roberts, M. (1982): Post-Shooting Trauma Presentation, San Francisco Police Department, 4/82 Solomon, R. M. & Horn, J. M. (1986): Post-Shooting Traumatic Reactions: A Pilot Study. In Reese, J. T. & Goldstein, H.A. (Hrsg.): Psychologi­ cal Services For Law Enforcement. Washington D.C.: Federal Bureau of Investigation Stratton, J. G., Parker, D. A. & Snibbe, J. R. (1984): Post-Traumatic Stress: Study of Police Officers involved in Shootings. Psychological Reports, 55, 127 – 131 84 Belastungen des Botschaftspersonals des Auswärtigen Amts und Betreuungskonzepte nach Gewalterfahrung* Peter Platiel Kurzfassung Das Auswärtige Amt ist ein weltweit operierendes Unternehmen, das an 200 Orten in der Welt mit seinen 8000 Mitarbeitern tätig ist und zusammen mit de Familienangehörigen ca. 15.000 Personen umfaßt. Aufgrund des Gesetzes (§ 5 Konsulargesetz) ist das Auswärtige Amt auch verpflichtet, Deutschen im Ausland Hilfe zu leisten auch im Rahmen akuter (Groß-) Schadensereignisse unter der Leitung seines Kri­ senzentrums. Das Auswärtige Amt unterhält einen eigenen Gesundheitsdienst (entsprechend einem Betriebsärztlichen Dienst), zu dem 8 Regionalärzte gehören, die schwerpunktmäßig in Schwarzafrika und Südostasien eingesetzt sind. Zur psychologischen Betreuung ist ver­ antwortlich der Psycho-Soziale Dienst, Ref. 106-9, als teilweise eigenständige Arbeitseinheit innerhalb des Gesundheitsdienstes. Aufgrund seiner Erfahrungen über lange Jahre werden die Schwerpunkte: Umgang mit akuten Belastungsreaktionen und PTSD, die Verbindung zum Burn-out-Syndrom sowie Rückholungen und Nachbereitung/ Therapeutische Settings aufgezeigt. Das Auswärtige Amt ist ein weltweit operierendes Unternehmen, das an 200 Orten in der Welt mit ca. 8.000 Mitarbeitern tätig ist und zusammen mit den Familienangehörigen ca. 15.000 Personen erfasst. Betreuungskonzepte nach Gewalterfahrungen umfassen nicht nur Beschäftigte und Familienangehörige, sondern aufgrund des Konsulargesetzes (§ 5) ist das Auswärtige Amt auch verpflichtet, Deutschen im Ausland in Einzelfällen und bei Großschadensereignissen unter der Leitung des Krisenreak­ tionszentrums Hilfe zu leisten. Das Auswärtige Amt unterhält einen eigenen Gesundheitsdienst (Referat 106), der zwei Arbeitseinheiten umfaßt. Dies ist einmal der betriebsärztliche Dienst (Referat 106-1), zu dem auch die acht Regionalärzte (Personal-Betriebsärzte) gehören, die schwerpunktmäßig in Schwarzafrika und Südostasien einge- setzt sind. Neben dem betriebsärztlichen Dienst gehört zum Gesundheitsdienst des Auswärtigen Amts die Psychosoziale Beratungsstelle (Ref.106-9), die für die gesamte psychologische Betreuung im Auswärtigen Amt zuständig ist. Aufgrund der Erfahrung über lange Jahre liegen u.a. die Arbeitsschwerpunkte im Umgang mit Akuten Belastungsreaktionen und Post-Traumatik-Stress-Disorder (PTSD). Zu Beginn der 90er Jahre wurde Deutschland erstmalig mit Geiselnahmen konfrontiert, ein Thema, dem bis dahin, sicherlich aufgrund unserer Geschichte in Deutschland nicht mit Aufbau psychotraumatologischer Zentren Rechnung ge­ tragen wurde, anders als bspw. in den an-gelsächsischen/ skandinavischen Ländern. Diese Lücke wurde schmerzhaft bewusst, als das Auswärtige Amt nicht nur die Vorbereitung und Betreuung der Angehö­ rigen der Geiseln Kempten und Strübig geleistet hatte über dreieinhalb Jahre, sondern gleichzeitig auch für die in Iso­ lationsdunkelhaft lebenden beiden Deutschen ein Betreuungs- und Nachsorge­ konzept aufstellen musste. Die Zeiten der Geiselnahmen im Libanon, die Amerikaner und Briten bitter zu spüren bekom­ men hatten, führten dort bereits vorher zu einem Aufbau eines Geiselbetreuungs­ konzeptes, von dem das Auswärtige Amt profitierte. Die oben angesprochene Lücke in Deutschland führte zur Grün­ dung einer Arbeitsgemeinschaft aller Psychotherapeuten und Psychologen oberster Bundesbehörden, die seit 1993 regelmäßig tagt. Zwischenzeitlich sind eine Fülle weiterer akuter Ereignisse hinzugekommen, die das Auswärtige Amt mit seinen Stellen im In- und Ausland (Krisenreaktionszentrum, Botschaften und Generalkonsulate) * Vortrag gehalten auf dem dreitägigen Fachseminar Posttraumatische Belastungsstörung vom 08.-10. Oktober 2001 in der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont. 85 gemeinschaftlich lösen konnte, wie z.B. die Geiselnahme in der japanischen Botschaft in Lima, Betreuung der Deut­ schen beim Concorde-Unglück in Paris, die Geiselnahme dreier Deutscher in Luxor Anfang des Jahres 2001. Erstmalig ist jetzt auch ein Angehöriger des Aus­ wärtigen Amts als Geisel genommen worden und nach acht Wochen erst frei­ gekommen. Es war eine atypisch verlau­ fende Geiselnahme; sie hat sich von allen vorangegangenen 173 Geiselnahmen, die die deutsche Botschaft in Sanaa/Yemen zu betreuen hatte, deutlich unterschie­ den. Der Anschlag auf das World Trade Center am 11.09.01 ist ein Ereignis, das aus mei­ ner Sicht die Welt in die Zeit vor dem 11. September und die Zeit nach dem 11. September teilt: Eine Erschütterung der Welt in dem Sinne, dass der Glaube an ein wohlmeinendes Schicksal nach die­ sem Zeitpunkt zerstört ist. Lassen Sie mich deshalb, der ich gerade vor drei Tagen aus New York zurückge­ kommen, Handlungsabläufe und Funk­ tionsweise des Auswärtigen Amtes im Hinblick auf die Nachsorge/Fürsorge für Deutsche und für eigene Bedienstete schildern, nachdem ich 4 Tage nach dem 11.9. mit einer der ersten Maschinen am 15.9. nach NEW YORK geflogen bin. Mei­ ne Stellvertreterin war zur gleichen Zeit zur Betreuung in Sanaa in dem schon erwähnten Entführungsfall. Zunächst will ich einige Anmerkungen machen und Sie jetzt schon bitten, uns Ihre Unterstützung zur Betreuung von Deutschen anzubieten, wenn Sie als Fachleute in stationären oder ambulan­ ten Einrichtungen tätig sind. Es gibt zwei Kernsätze für mich: 1. Aus meiner kardiologischen Intensiv­ zeit: die Krise der Nacht ist ein schlechtes Management am Tag 2. Der alte Leitspruch des Krisenreak­ tionszentrums des Auswärtigen Amts: „Nach der Krise ist vor der Krise.“ , d.h. wir müssen immer wieder Vorbereitun gen treffen für die nächste Krise. Vorausschicken möchte ich, dass das Auswärtige Amt gem. § 5 Konsulargesetz verpflichtet ist, Hilfe für Deutsche im Ausland zu leisten und, dies ist neu, dass das Auswärtige Amt jetzt auch die nöti­ gen Haushaltsmittel vorrätig hält, deutschsprachige Teams zur Psychosozia­ 86 len Notfallversorgung zur Betreuung Deutscher bei Großschadensereignissen ins Ausland zu senden. Die Diskussion über die Notwendigkeit dieser Maßnah­ me wurde verstärkt im Auswärtigen Amt nach dem Birgen Air-Unglück geführt, hat nach dem Halifax-Unglück neue Nahrung erhalten und mit dem 11.09. in NEW YORK seine erste Umsetzung erlebt und diese Feuerprobe erfolgreich bestan­ den. Am 11.09.01 wurde sofort ein Krisenstab gebildet, interministeriell, mit alle rele­ vanten Ministerien unter der Leitung des Auswärtigen Amts Amts. Wir alle haben noch die Bilder der beiden Türme in Erin­ nerung, die immer wieder gezeigt wur­ den; sie haben eine große Unsicherheit und ein großes Bedürfnis nach Informa­ tion an den Tag gelegt, ein Bedürfnis, das dann verständlich wird, wenn Sie davon ausgehen, dass die Zahl der vermissten Deutschen mit über 1.000 geschätzt wurde. So erklärt sich, dass das Auswär­ tige Amt in den ersten Tagen mit 25.000 Anrufen fertig werden musste, dies wur­ de von spontan sich meldenden Kollegen in 3-Stunden-Schichten in einer bewun­ dernswerten Weise abgeleistet, wobei anzumerken ist, dass sie (aus unserer Erfahrung) in den jeweils 180 Minuten ihrer Tätigkeit 80 – 100 Gespräche abfangen mussten. Auch hat die Bot­ schaft Washington ein Krisenzentrum gebildet, ebenso wie das Generalkonsulat New York, bei dem 4.500 Anrufe einlie­ fen. Das GK New York stand insbesondere vor der Situation, dass es auf seine Weise das plötzlich über New York hereinbre­ chende Chaos, die Fragen der Angehöri­ gen, die Fragen nach Vermissten in einer kompetenten Weise beantworten musste und gleichzeitig die unterschiedlichen Informationswege in New York selbst wahrnehmen, bündeln, sichern und ver­ gleichen musste. Es dürfen in diesen noch so turbulenten und unübersicht­ lichen Zeiten nicht Falschmeldungen an die deutschen Bürger und ihre Angehöri­ gen, die ihre Vermissten suchten, hinaus­ gehen. In diesem Zusammenhang möchte ich unterscheiden zwischen den Aktivitäten der psychosozialen Beratungsstelle in Verbindung mit dem Krisenreaktionszen­ trum und dem Referat 511, das zuständig ist für die Betreuung Deutscher im Aus­ land, einerseits, sowie dem Aufbau eines sozialen Netzwerkes vor Ort und der Betreuung der Deutschen vor Ort ande­ rerseits. Krisenreaktionszentrum in Berlin: Wie oben erwähnt, wurde sofort ein Kri­ senzentrum gebildet. Aufgabe der psychosozialen Beratungsstelle 106-9 war es, ein lokales Netz vor Ort in NEW YORK aufzubauen und dafür zu sorgen, dass Deutsche, die in das Generalkonsu­ lat (GK) gekommen sind, optimal psycho­ sozial versorgt und betreut werden; dies geschah unter der Leitung des deutschen Vertrauens-arztes des GK New York, ein Psychiater/Psychotherapeut, der sich zur Verfügung stellte, zusammen mit deutschsprachigen Kollegen und dem lei­ tenden Pastor der deutschen Kirche in New York, die spontan Unterkünfte zur Verfügung stellte. Aus meinen Erfahrun­ gen können Personen mit akuten Belas­ tungsreaktionen nur in der Mutterspra­ che optimal betreut/behandelt werden. Als das Ausmaß des Desasters mit den Horrorzahlen von mehr als 1.000 deut­ schen Vermissten immer deutlicher wur­ de, ergaben sich daraus zwei Konsequen­ zen: Das Auswärtige Amt rechnete mit einer großen Zahl deutscher Angehöriger, die sofort nach Freigabe der Flüge von Euro­ pa nach USA nach Amerika kommen würden und die aus Sicht des Auswärti­ gen Amts zusammen mit der Rechts- und Konsularabteilung des GK New York eine entsprechende Betreuung erwarten konnten und erwarten durften. Aufgrund dessen wurden durch die psychosoziale Beratungsstelle 106-9 Teams der Unis München, Tübingen und Trier sowie das Kriseninterventionsteam aus München aufgerufen, ob sie bereit wären, kurzfris­ tig und als in sich geschlossene multidis­ ziplinäre Teams, die bereits gemeinsame Erfahrungen und Einsätze hatten, das Auswärtige Amt in New York zu unter­ stützen. Dies geschah relativ kurzfristig und in einer sehr positiven Art und Weise. Gleichzeitig wurden in diesen Tagen die Zentralen deutscher Firmen, von denen wir wussten, dass sie in den beiden Tür­ me des World Trade Centers ihren Sitz hatten, angefragt, ob das Auswärtige Amt in irgendeiner Weise eine psychoso­ ziale Unterstützung geben könne. Am Freitag, drei Tage nach dem Desaster, kam eine Anfrage von der Deutschen Bank, ob das Auswärtige Amt helfen könnte und „native speaker“-Teams zur Betreuung ihrer Leute nach New York senden könnte; hier ist anzumerken, dass die Deutsche Bank alle ihre Beschäftig­ ten im letzten Moment evakuieren konn­ te. Das Auswärtigen Amt hat am gleichen Tag diese Bitte zur Unterstützung an die Leitung der Psychologen der Luftwaffe der Bundeswehr weitergegeben, die auch sofort zu einem Einsatz bereit waren. Nach Genehmigung des Bundesministers für Verteidigung sind sie drei Tage später direkt nach New York geflogen und haben dort ihre Arbeit aufgenommen. Wie bereits oben erwähnt, hat sich durch eine bewundernswerte Arbeit und orga­ nisatorische Leistung des Generalkonsu­ lats New York – dort die Rechts- und Konsularabteilung mit dem Counterpart in der Zentrale in Berlin, Referat 511 – die Zahl der vermissten Deutschen auf ca. 450 eingrenzen lassen. Daraus ergab sich die Frage nach dem weiteren Betreuungsbedarf: Wie viele Angehörige werden kommen, was müssen wir an deutschsprachiger Betreuung vorhalten ? In der Rückschau hat sich diese Zahl bis zu meiner Abfahrt auf 40 vermisste Deutsche zurückgebildet, worauf zwei mal täglich ein logistischer Abgleich erfolgte, welche Hilfskräfte aus Deutsch­ land nachgezogen werden müssten. Neben diesem Teil der Arbeit war die unmittelbare Betreuung der Angehörigen zu leisten, die ihre Vermissten suchten. Es ging u.a.darum, gemeinsam mit einem Mitarbeiter der Rechts- und Konsularab­ teilung, den siebenseitigen Identifizie­ rungsbogen auszufüllen und die Angehö­ rigen neben der sachlich-fachlichen Arbeit des Kollegen/in der Rechts- und Konsularabteilung sein Durchgehen der gesamten Vorgänge psychologisch stüt­ zend zu begleiten. Es war für mich hier zu spüren, dass insbesondere die „Kon­ frontation“ mit dem siebenseitigen Iden­ tifizierungsbogen allmählich im Bewußt­ sein eine Realisierung bewirkte, dass der „Vermisste“ vielleicht tot sein könnte, und dass der positive Schutz der Ver­ drängung langsam der rationalen Erkenntnis Platz machte, dass der gelieb­ te Bruder oder Vater mgl. nicht mehr lebt. Hier galt und gilt es, in einer per­ sönlichen Art und Weise unaufdringlich Unterstützung und Hilfe anzubieten. Ein weiterer Punkt war die Betreuung der eigenen Mitarbeiter, die in ihrer Arbeits­ intensität weit über ihre Fähigkeiten hin­ auswuchsen und die zusammen mit den Mitarbeitern des Kriseninterventions­ teams München b.B.beraten wurden. Es wurden Nachbereitungsgespräche geführt, die ergebnisorientiert ausgerich­ tet waren, Gruppengespräche mit jungen deutschen Praktikanten, um ihnen die Sicherheit und den Schutz der Botschaft zu geben, gleichzeitig war auch die Organisationsberatung für die Leitung des GK's notwendig, um gemeinsam fest­ zustellen, dass in internen Abläufen so wenig wie möglich Reibungsverluste ent­ stehen in dieser hoch angespannten Situation. Nach der Katastrophe fanden sich unmittelbar ca. 60 Deutsche ein, die spontan von den Mitarbeitern/innen des Generalkonsulates versorgt wurden. Ich selbst hatte nicht erwartet, dass ich fünf Tage später in die Situation kommen würde, dass plötzlich Deutsche vor der Haustür des Generalkonsulats stehen mit dem Wunsch, unmittelbar mit jemandem sprechen zu können. Alle diese sechs Deutschen haben unmittelbar das Desas­ ter am World Trade Center erlebt, den Zusammensturz, waren teilweise auch unmittelbar aus dem Gebäude herausge­ kommen bzw. in die Staubwolke beim Zusammenbruch der beiden Türme gera­ ten. Diese akute und extreme Belas­ tungsreaktion führte zu den typischen Befindlichkeitsstörungen in einer solch anormalen Situation, u.a. in Form einer Betäubung, die teilweise bis über sieben Tagen anhielt, eine Dauer, die ich in die­ ser Art und Weise noch nie erlebt habe. Diese Betäubung diente wohl als positi­ ver Schutz gegen den „Zusammenbruch“ des Ich´s als Vermittler zwischen Innen­ welt und Außenwelt. Oft taucht eine Vielzahl archaischer Reaktionen auf. Meine Aufgabe sah ich darin, psychia­ trisch-psychotherapeutische Kriseninter­ vention zu leisten, zu erklären, was die normale Befindlichkeitsstörungen in die­ ser Situation bedeuten und welche Beschwerdesymptomatik als „normal“ zu bezeichnen ist. Weiterhin, nach stützen­ den äußeren Strukturen zu fragen, um damit eine innerpsychische Stabilisierung zu erzielen. Als Beispiel sei hier ein 45-jähriger Mann genannt, der sich wegen seines massiven Entsetzens an mich gewandt hatte und der mir mitteilte, dass er unmittelbar nach dem Desaster, dem er knapp ent­ kommen war, hasserfüllte E-Mails in alle Welt verschickt habe. Allmählich wich seine Betäubung, er wandte sich an mich und erzählte folgenden Traum: Er sei unten am Battery Park und schaue das World Trade Center an, und der Zusammensturz ereigne sich dadurch, dass eine Atombombe über New York explodiere. Im Traum wechselt die Szene dann, es ist die Zeit der Beerdigung der Opfer dieses Atombombenanschlages, dem er entkommen ist und in dem Moment, als die Särge in die Erde gesenkt werden, fällt erneut eine Atom­ bombe und er denkt, nicht einmal hier lassen sie uns in Ruhe, kann aber weg­ laufen. Beim Weglaufen überquert er die Brooklyn Bridge, sieht einen Hubschrau­ ber, der bunte kleine Luftballons abwirft, und er freut sich, dass wieder eine Nor­ malität eintritt. Als die Luftballons näherkommen, sieht er, dass sie kleine Atombomben sind, und zu dieser Sequenz wacht er schweißgebadet auf. In der vorsichtigen Deutung seiner Lebensgeschichte wurde deutlich, dass er mit seinem Vater Anfang der 50er, 60er Jahre immer vor dem Fernseher saß und erwartet hat, dass an der deutsch-deut­ schen Grenze unmittelbar ein Atom­ schlag bevorstehe. Als ihm das klar wur­ de, ging eine deutliche Veränderung in Haltung und Gesicht, Mimik bei ihm vor. Die Angstträume nahmen ab diesem Tag in ihrer Intensität ab. Für mich war das Erschreckendste, die Angst dieser Leute zu spüren, die Angst, die, wie oben erwähnt, ein wohlmeinen­ des Schicksal nicht mehr zulässt und eine Angst ist, die in die unendliche Zukunft reicht, ohne dass es ein Ende gibt. Diese Interventionsgespräche, die durch­ schnittlich 1 1/2 Stunden gedauert haben, waren so intensiv, dass ich selbst nicht mehr als drei Gespräche pro Tag führen konnte. Lassen Sie mich zu diesen Ereignissen noch einige Anmerkungen machen. 1. Aus meiner jetzt langjährigen Erfah­ rung mit Akuten Belastungsreaktionen und Posttraumatischem Stress Disorder bin ich mit dem Bundesministerium für Gesundheit einer Meinung, dass das 87 Tätigwerden bei akuten Belastungsre­ aktionen eine heilkundliche Tätigkeit ist. Dies bedeutet für mich eine klare Zuweisung der Verantwortung und Verantwortlichkeit, die fachlich einer fundierten Ausbildung bedarf und die nur ein ärztlicher oder psychologischer Psychotherapeut oder Psychiater mit zusätzlicher Kenntnis der Psychotrau­ matologie leisten kann. 2. Ich plädiere ausdrücklich für gemischte (männlich/weibliche), multiprofessio­ nelle Teams, zu denen kollegiale Ansprechpartner, Rettungsassistenten, Krankenschwestern, Pastoren mit ent­ sprechender Zusatzausbildung als Not­ fallseelsorger gehören. Ich werbe aus­ drücklich – wie seit Jahren – darum, dass diese multidisziplinären Teams eine psychotraumatologische Zusatzausbildung haben sollten bei ihren unterschiedlichen Berufen, dass aber Führung und Verantwortung wie oben erwähnt in der Hand eines Psycholo­ gen oder eines Arztes liegen sollten. Für mich gilt auch, dass es hier keinen Königsweg der Betreuung gibt. Im Mittelpunkt aber sollte eine Kombina­ tion von Gesprächs- und medikamen­ tösen Therapie unter der Leitung von Ärzten und Psychologen der o.g. Fach richtungen stehen. Sie wissen alle, dass es in Deutschland eine „wilde Szene“ gibt, in der es um viel Geld und Positionen geht – und damit um Macht. Umso mehr bitte ich Sie, sich als Fachgruppen zusammenzusetzen und gemeinsam an einem Konzept einer optimalen Betreuung bei Großschadensereignissen im Sinne eines Psychosozialen Notfall-Netzwerkes mitzuarbeiten. 88 3. Im November 2000 hat unter der Federführung des Bundesministeriums des Inneren (BMI) eine Katastrophen­ schutztagung stattgefunden; daraus entsteht die Durchführung eines Forschungsvorhabens des BMI zur Definition der inhaltlichen und operationalen Rahmenbedingungen eines Netzwerkes zur psychosozialen Notfallversorgung. Das Auswärtige Amt unterstützt aus­ drücklich dieses Vorhaben und wünscht eine rasche Bestandsaufnah me, insbesondere im Hinblick auf die o.g. fachlichen Eckpfeiler. 4. Die Nachhaltigkeit der Betreuung, insbesondere durch Firmen und Organisa­ tion muß unbedingt gewährleistet sein. 6 Wochen reichen in der Regel nicht aus. Gerade „das Vergessenwerden“, das Alleingelassenwerden nach dem Motto, „Es ist wieder alles in sei ner Normalität“, sollte nicht sein. Es bedarf mindestens einer ein- bis anderthalbjährigen Nachbetreuung und besonderen Sensibilität der jeweiligen Organisation, sei es eine Firma, sei es ein Ministerium oder eine kommunale Behörde, wo der Betroffene beschäftigt ist. Es scheint mir doch so zu sein, dass durch die Diagnose einer Akuten Belastungsreaktion bzw. PTSD eine Individualisierung des Geschehens und des Leidens bei den Betroffenen eintritt und damit eine weitere psychische Schädigung mit zunehmender Isolierung entsteht. 5. Unter diesen Gesichtspunkten bitte ich die Fachleute, den dehnbaren, unpräzi­ sen Begriff, den bereits der niederländische Kollege angesprochen hat, näm­ lich des Burn-Outs, diagnostisch deut­ licher zu betrachten. Aus meiner Erfahrung mit Anamnese und Vorberei­ tung zur Frage der Dienstfähigkeit stellt sich immer wieder heraus, dass sich anhäufende Mikrotraumen im Sinne einer kumulativen Stressreaktion oft für einen plötzlichen Zusammen bruch mit verantwortlich sind und sich dahinter eine Folge von Belastungsre­ aktionen und auch ein „chronifiziertes“ PTSD verbergen könnte. Zuletzt: Ich bitte Sie, dem Auswärtigen Amt Ihre Kapazitäten und Standorte zu nennen, da wir unsere Angehörigen, Bediensteten, die weltweit eingesetzt sind, oft nach einem akuten Ereignis an einen deutschen Wohnsitz zurückholen, zu dem sie soziale Bindungen haben. Gleiches gilt für andere Deutsche im Ausland, für deren Hilfe wir qua Gesetz zuständig sind. Deshalb bitten wir Sie, mit uns zusammenzuarbeiten, die Adressen Ihrer ambulanten, stationären oder teilstationären Einrichtung zu nennen. Unterstützen Sie uns hier, auch für den Fall, dass es erneut zu einem solchen Ereignis kommt, denn: Nach der Krise ist immer vor der Krise. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. › Autoren Klaus Barre Dipl.-Psychologe Bundeswehrkrankenhaus Hamburg Lesserstr. 180 22049 Hamburg ORR Günter Kreim Psychologischer Dienst Graf Zeppelin Kaserne 75365 Calw Dr. med. Karl-Heinz Biesold Arzt für Neurologie und Psychiatrie, Psychotherapie Bundeswehrkrankenhaus Hamburg Lesserstr. 180 22049 Hamburg Prof. Dr. med. Rolf Meermann Psychosomatische Fachklinik Bad Pyrmont Bombergallee 11 31812 Bad Pyrmont Tel. 05281/619-635 Internet: www.prof-r-meermann.de Dr.med. Jürgen Ph. Furtwängler Oberstarzt a.D. ehem. Ltd.Arzt Abteilung VI Bundeswehrkrankenhaus Hamburg Lesserstr. 180 22049 Hamburg Dipl.-Psych. Eberhard Okon Ltd. Psychologe Psychosomatische Fachklinik Bad Pyrmont Bombergallee 10 31812 Bad Pyrmont eMail: [email protected] Achim Grube Bildungsinstitut der Polizei Niedersachsen Sozialwissenschaftlicher Dienst Tannenbergallee 11 30163 Hannover Dr. med. Peter Platiel Auswärtiges Amt Beratungsstelle Ref. 106-9 Werderscher Markt 1 10117 Berlin Dr. med. Dipl.-Psych. Hans-Heiner Hahne Oberstarzt Leitender Arzt der Abteilung VI Bundeswehrkrankenhaus Berlin Scharnhorststr. 13 10115 Berlin-Mitte Alexander Varn C 3, 2-3 68159 Mannheim Tel: 0621-102611 e-mail: [email protected] Dr. rer. nat. Dipl.-Psych. Frank Hallenberger Gärtnerstr. 18-20 55262 Heidesheim RegDirektor Dipl.-Psych. Wolfgang Weber Referat Wehrpsychologie im Bundesministerium der Verteidigung Postfach 13 28 53003 Bonn 89 › Bisher erschienen in der Schriftenreihe der Psychosomatischen Fachklinik: Band 1: Meermann, R. et al. (1989). Zwei-Jahres-Bericht (1987 - 1989) der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont. Schriftenreihe der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont, Band 1. Band 2: Kehrer, H.E. & Meermann, R. (Hrsg.) (1990). 20 Jahre (1968 - 1988) Arbeitskreis für Verhaltensforschung und -therapie an der Universität Münster e. V. Schriftenreihe der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont, Band 2. Band 3: Meermann, R. et al. (1990). Optimierung der Rahmenbedingungen stationärer Rehabilitationsmaßnahmen. Referate der Fachkon­ ferenz Psychosomatische Rehabilitation 1989 am 16./17. Oktober 1989 in Bad Pyrmont. Schriftenreihe der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont, Band 3. Band 4: Meermann, R. et al. (1991). Anorexia und Bulimia nervosa: Psychotherapie und Selbsthilfe. Referate der Fachtagung für Initiato­ rinnen und Betreuerinnen von SH-Gruppen für Anorexia und Bulimia nervosa am 26. April 1991 in Bad Pyrmont. Schriftenreihe der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont, Band 4. Band 5: Meermann, R. et al. (1992). Fünf-Jahres-Bericht (1987 - 1992) der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont. Schriftenreihe der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont, Band 5. Band 6: Meermann, R. et al. (1992). Tagungsreader "Anorexia und Bulimia nervosa: Psychotherapie und Selbsthilfe." Referate der zweiten Fachtagung Initiatorinnen und Betreuerinnen von SH-Gruppen für Anorexia und Bulimia nervosa am 24. April 1992 in Bad Pyr­ mont. Schriftenreihe der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont, Band 6. Band 7: Meermann, R. et al. (1995). Handbuch der Rehabilitations-Pädagogischen Abteilung der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyr­ mont. Schriftenreihe der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont, Band 7. Band 8: Meermann, R. & Borgart, E.-J. (1997). Zehn-Jahresbericht (1987 - 1997) der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont. Schriftenreihe der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont, Band 8. Band 9: Borgart, E.-J. (Hrsg.) (1998). Selbsthilfebücher. Sammlung empfohlener (verhaltenstherapeutischer) Selbsthilfebücher mit Rezen­ sionen. Schriftenreihe der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont, Band 9. Band 10: Borgart, E.-J. & Meermann, R. (Hrsg.) (1999). Stationäre verhaltenstherapeutische Psychosomatik auf dem Weg in das Jahr 2000. Schriftenreihe der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont, Band 10. Band 11: Okon, E. & Meermann, R. (Hrsg) (2002) Prävention und Behandlung posttraumatischer Störungsbilder im Rahmen militärischer und polizeilicher Aufgabenerfüllung. Schriftenreihe der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont, Band 11. Demnächst: Band 12: Meermann, R. & Borgart, E.-J. (im Druck). Das verhaltenstherapeutische Konzept der Psychosomatischen Fachklinik. Schriftenreihe der Psychosomatischen Fachklinik Bad Pyrmont, Band 12. 90