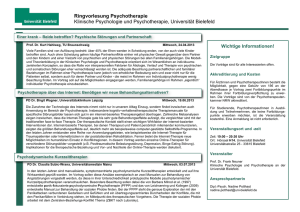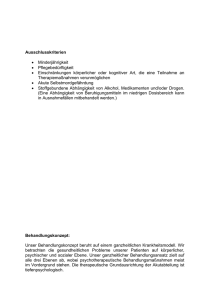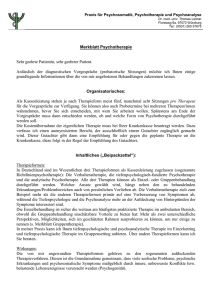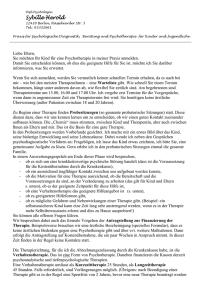Unterstützung durch bildgebende Verfahren
Werbung

W I S S E N S C H A F T Zukunft der Psychotherapie Unterstützung durch bildgebende Verfahren Die Wirksamkeit von Psychotherapiemethoden ist nicht immer leicht zu messen – darüber diskutierten Wissenschaftler beim 60. Psychotherapie-Seminar in Freudenstadt. D ass für die Behandlung psychogener Störungen tatsächlich die derzeit „schätzungsweise 300 verschiedenen Therapiemethoden und -techniken“ gebraucht werden, stellte Priv.Doz. Dr. med. Gerhard Reister, Zentrum für Psychiatrie in Calw, in seinem Eröffnungsvortrag zum 60. Psychotherapieseminar Freudenstadt Ende September infrage. Doch sei die „allgemeine Psychotherapie“ als Konglomerat aus verschiedenen Schulen, wie Klaus Grawe sie 1994 beschrieb, keine passende Alternative – die Lösung liege eher in einer Vielfalt überprüfter Methoden. Reister schlug einen Bogen zu Sigmund Freud, der „Zeit seines Lebens damit gehadert hat, dass er nicht wissenschaftlich beweisen konnte, was neurologisch während einer psychotherapeutischen Behandlung geschieht“. Diese Zeiten könnten nun endlich vorbei sein. „Bildgebende Verfahren bringen die Psychotherapie wieder zurück in die Neurowissenschaft“, sagte Prof. Dr. med. Dieter F. Braus, Arbeitsbereich Bildgebung im Zentrum für Psychosoziale Medizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Die funktionelle und metabolische Bildgebung ermöglicht die differenzierte Abbildung von Ort und Ausmaß der Aktivität in den Hirnarealen sowie deren plastische Veränderung. Zusammen mit molekularbiologischer Grundlagenforschung könne endlich gezeigt werden, was Tiefenpsychologen immer behauptet haben: In den ersten Lebensjahren finden Lernprozesse statt, die die Grundlage für die weitere Entwicklung bilden. Die Stressreaktivität wird bis zum Alter von etwa neun Monaten unter dem Einfluss der Umwelt angelegt und justiert für PP Heft 12 Dezember 2003 Deutsches Ärzteblatt das ganze Leben. In späteren kritischen Situationen wird bei geringer Stressreaktivität (etwa bei optimistischen Menschen) stärker der Hippocampus, bei hoher Stressreaktivität (zum Beispiel Angstpatienten) vermehrt die Amygdala aktiviert – bei Letzteren können Panikreaktionen die Folge sein. Doch Neuroplastizität, die Fähigkeit des Gehirns, sich an die Erfordernisse der Umwelt anzupassen, bestehe lebenslang, betonte Braus. Auch Psychotherapie beeinflusse die Plastizität unmittelbar und befreie von der Vorstellung eines genetischen Determinismus: „Durch Stimulation werden neuronale Netze aktiviert, und ein Dialog zwischen Synapse und Zellkern via Dopamin und Serotonin findet statt. Innerhalb von 20 bis 30 Minuten nach Stimulation können neue Synapsen entstehen.“ Wichtig für Therapeuten sei die Tatsache, dass besonders die mentale Überraschung, das „Aha-Erlebnis“ in der Therapie zum Erfolg führen kann. Psychotherapie braucht Effizienznachweise Die spezifische Wirkung von Psychotherapie kann also sichtbar gemacht und mit klinischen Befunden verglichen werden. Die Frage ist, ob so die Therapiemethoden gefunden werden können, die es wert sind, gefördert zu werden. „Zu hoffen ist,“ betonte Braus, „dass die Forschung unterstützt wird, die die therapeutischen Besonderheiten der unterschiedlichen Verfahren für kurzfristige und dauerhafte Erfolge identifiziert.“ Möglicherweise könne mithilfe der bildgebenden Verfahren PP die wissenschaftliche Fundierung und Anerkennung von Psychotherapiemethoden weitergebracht werden, hofft Prof Dr. med. Gerhard Buchkremer, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Tübingen und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie. Buchkremer wies darauf hin, dass die Psychotherapie in Zukunft um Effizienznachweise bei jeder einzelnen Störung nicht herumkommt. „Die Frage nach der zukünftigen Entwicklung der Psychotherapie ist eng verknüpft mit Fragen der Wirksamkeit und den ökonomischen Bedingungen“, erklärte er. Häufig sei die Wirkungsweise einer effektiven Therapie unbekannt. Als Beispiel nannte Buchkremer die pharmakologische Therapie, deren Wirkungsweise immer noch nicht im Detail verstanden werde. Der therapeutische Nutzen werde dadurch jedoch nicht geschmälert. „Es muss unser wissenschaftliches Interesse sein, die Art der Wirkung immer besser verstehen zu lernen“, betonte er. Nur randomisierte Studien hätten bei der Wahl geeigneter Kontrollgruppen ausreichende interne Validität. Sie sollten durch Anwendungsbeobachtungen ergänzt werden. Jeder Therapeut müsse eine therapeutische Intervention aufgrund einer Therapie-Rationale begründen können und einen Gesamtbehandlungsplan erstellen, der bio-, psycho- und soziotherapeutische Elemente enthält. Prof. Dr.Werner Deutsch,Technische Universität Braunschweig, vertrat die Ansicht, lineare Modelle zur Beschreibung des psychotherapeutischen Geschehens verfehlten die entscheidenden Wendepunkte – Fortschritte geschähen oft nicht kontinuierlich, sondern sprunghaft. Ebensowenig könnten Psychotherapiemethoden so erforscht werden wie Pharmaka. „Will man wissenschaftliche Objektivität und erlebte Subjektivität zusammenbringen, so kann man nicht nach festem Plan vorgehen. Zwar kann man Ziele vereinbaren, aber der Weg dorthin ist nicht starr festzulegen, sondern man muss auch dem Unbewussten folgen“, betonte Deutsch. Spontanes Geschehen, wie es in der Therapie auftritt, sei nicht standardisierbar. Am Beispiel des Psychodramas, das bisher nicht in die Richtlinientherapie aufgenommen worden ist, befasste sich Deutsch mit der Frage, ob Therapieerfol- 563 PP W I S S E N S C H A F T ge auch anders als über Versuchspläne mit randomisierten Behandlungs- und Kontrollgruppen erfasst werden können. „Im Psychodrama können unter bestimmten Rahmenbedingungen ‚magische Momente‘ auftreten, bei denen sich neue Möglichkeiten des Handelns auftun, die im Alltag noch nicht beschritten worden sind. In Analogie zur plötzlichen Einsicht bei der Lösung von Denkaufgaben, die seit Karl Bühler als ‚Aha-Erlebnisse‘ bekannt sind, werden solche magischen Momente als ‚Ja, so!‘-Erlebnisse bezeichnet“, erklärte Deutsch. Aus neurobiologischer Sicht seien diese Erlebnisse rational als Zustände des Gehirns erklärbar, bei denen Emotionen kognitive Prozesse in Gang setzten, die neue Erfahrungen ermöglichten. Doch die als „Ja, so!“-Erlebnisse bezeichneten „magischen Momente“ ließen sich nicht planmäßig im Sinne einer kausal wirksamen Technik hervorrufen, ihr Auftreten könne allerdings durch Kontextbedingungen, wie emotionale Einstimmung und therapeutische Beziehung begünstigt werden. Gleiches gelte für den Transfer auf Situationen des Alltags. Neue Wege in der Wirkungsforschung Die Wirksamkeit des Psychodramas in Bezug auf emotional bestimmtes neues Lernen könne theoretisch mithilfe eines nichtlinearen Ansatzes modelliert werden. Empirische Prüfungen seien möglich, indem die Bedeutung von Kontextbedingungen auf das Einsetzen von „Ja, so!“-Erlebnissen und ihre Übertragung auf den Alltag im Verlauf erfasst wird. Deutschs’ Fazit: „Auch bisher nicht zugelassene Psychotherapiemethoden wie das Psychodrama bieten ein höchst anregendes Potenzial, um neue Wege in der Wirkungsforschung zu gehen, die der gesamten psychotherapeutischen Praxis zugute kommen Dr. med. Ulrike Fangauf können.“ Das nächste Psychotherapie-Seminar Freudenstadt findet vom 19. bis 24. September 2004 in Freudenstadt im Schwarzwald statt. Rahmenthema: „Grenzen des Lebens und Grenzerfahrungen“. Auskünfte erteilt das Sekretariat des Psychotherapie-Seminars, Karl-von-Hahn-Str. 120, 72250 Freudenstadt, Telefon: 0 74 41/54 23 99, Fax: 0 74 41/54 25 04, E-Mail: Sekretariat.Psychiatrische.Klinik @kkhfds.de, Internet: www.pt-seminar-freudenstadt.de 564 Referiert Transplantierte Psychotherapeutische Begleitung sinnvoll M it einem Spenderorgan leben derzeit in Deuschland etwa 60 000 Menschen. Jährlich werden etwa 3 000 Organtransplantationen durchgeführt. Am häufigsten werden Nieren transplantiert, gefolgt von Leber, Herz, Lungen und Stammzellen. Über 13 000 Menschen stehen auf der Warteliste für einen solchen Eingriff. Organtransplantationen können psychisch sehr belastend sein.Viele Patienten bedürfen daher psychotherapeutischer Begleitung. Der Bedarf an Therapie oder Beratung kann bereits in der Orientierungsphase indiziert sein. In dieser Phase müssen sich die Patienten mit ihrem Zustand auseinander setzen und ihre Einstellung zur Transplantation klären. Sowohl das schnelle Fortschreiten als auch das Verdrängen der Erkrankung können zu psychischen Dekompensationen mit depressiver Lähmung oder zu Panikzuständen führen. Während der vorbereitenden Diagnostik müssen sich die Patienten definitiv entscheiden. In dieser Phase wird der Psychotherapeut als neutraler Ansprechpartner geschätzt, mit dem das Für und Wider einer Transplantation ohne Zeitdruck diskutiert werden kann. Im Laufe der Wartezeit auf die Transplantation verschlechtert sich der Gesundheitszustand der Patienten häufig. Sie leiden zunehmend unter Schwäche und Müdigkeit. Dazu kommt die Angst, die Transplantation nicht mehr zu erleben. „Die Wartezeit ist für die meisten Patienten die größte Belastung“, sagt Dr. med. Volker Köllner, Dresden. Es stellen sich Zweifel und Gefühle der Isolation, Unsicherheit und des Kontrollverlusts ein. Psychische Symptome wie Schlafstörungen, Depressivität und Affektlabilität treten gehäuft auf. Die zunehmende Abhängigkeit wird als starke Belastung erlebt. Im Verlauf der Wartezeit nehmen psychische Symptome und Schmerzen zu und verschlechtern die Lebensqualität. Psychotherapeutische Strategien zielen darauf ab, die Depressivität zu mindern und ein Minimum an Selbstkontrolle zu erhalten, unter anderem durch Physiotherapie und Entspannungsverfahren. In der frühen postoperativen Zeit sind Abstoßungskrisen und andere Komplikationen häufig. Zunächst erleben die Patienten jedoch eine euphorische Phase, da sie sich körperlich wohl fühlen. Bei einem Teil der Patienten tritt jedoch eine psychiatrische Komplikation auf: das organische Psychosyndrom (Durchgangssyndrom). Zu den Symptomen zählen Halluzinationen, Wahnwahrnehmungen sowie affektive und kognitive Störungen. Die Ursachen sind noch ungeklärt. Häufig kommt es zu Spontanheilungen. Drei bis zwölf Monate nach der Transplantation müssen Patienten und ihre Familien eine neue Normalität und neue Bewertungs- und Verhaltensmuster finden. Die Patienten sind mit den Anforderungen der Familie und der sozialen Umgebung konfrontiert und müssen ihre Krankenrolle aufgeben. Das gelingt oft nicht reibungslos und kann zu depressiven Verstimmungen, Schlaflosigkeit, Ängsten und sexuellen Problemen führen. Viele Patienten fühlen sich in dieser Phase erschöpft und überfordert. Tritt zudem eine Abstoßungsreaktion auf, nehmen Angst, Depressivität, Verzweiflung und Hilflosigkeit wieder zu.Auch die berufliche Integration ist nicht immer einfach und erfordert therapiebegleitend Sozialarbeiter und Rehabilitationsberater. Die Autoren halten kognitiv-verhaltenstherapeutische Therapieelemente aufgrund ihres pragmatischen und lösungsorientierten Ansatzes für die Betroffenen besonders geeignet. Sie plädieren für einen methodenübergreifenden Betreuungsansatz und ein abgestuftes Versorgungsmodell, in das Ärzte, Psychotherapeuten und Selbsthilfegruppen integriert sind und das sozialarbeiterische und sozialpädagogische ms Kompetenzen umfasst. Köllner V, Archonti C: Psychotherapeutische Interventionen vor und nach Organtransplantation. Verhaltenstherapie 2003; 13: 47–60. Dr. med. Volker Köllner, Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Fetscherstraße 74, 01307 Dresden, Telefon: 03 51/4 58 20 70, E-Mail: [email protected] Selbsthilfegruppe BDO (www.bdo-ev.de) PP Heft 12 Dezember 2003 Deutsches Ärzteblatt