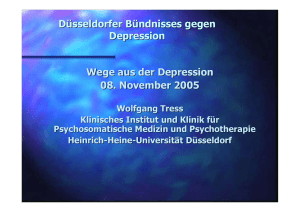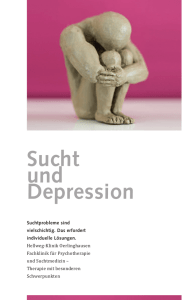Vorlage wiss. Arbeiten
Werbung
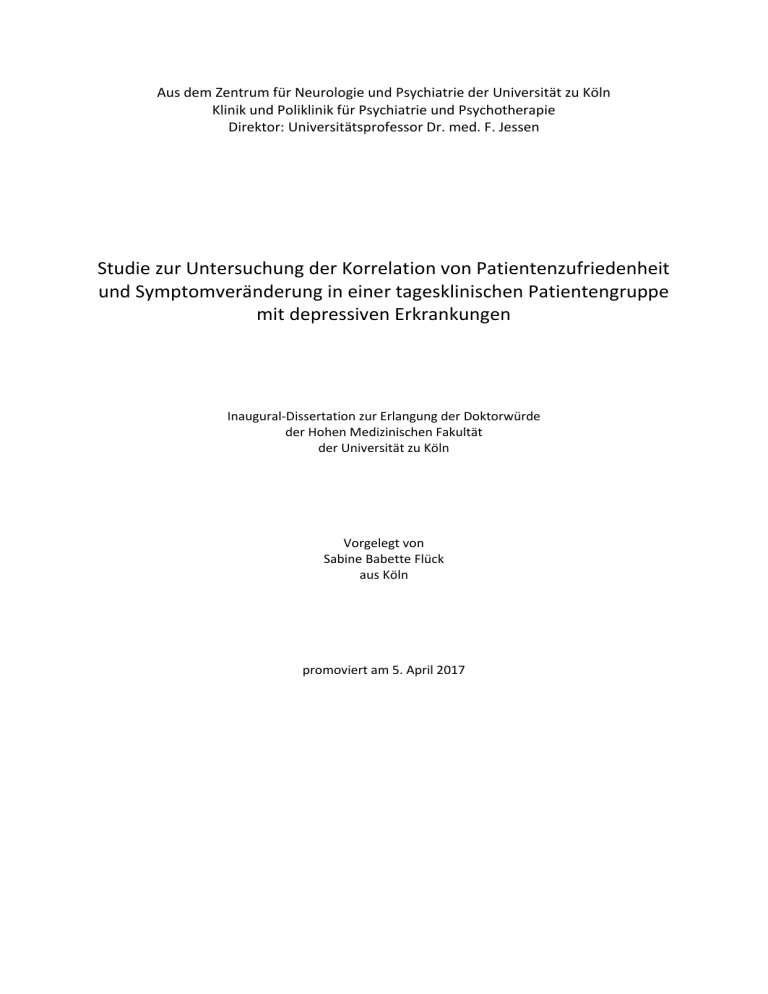
Aus dem Zentrum für Neurologie und Psychiatrie der Universität zu Köln Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Direktor: Universitätsprofessor Dr. med. F. Jessen Studie zur Untersuchung der Korrelation von Patientenzufriedenheit und Symptomveränderung in einer tagesklinischen Patientengruppe mit depressiven Erkrankungen Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln Vorgelegt von Sabine Babette Flück aus Köln promoviert am 5. April 2017 Aus dem Zentrum für Neurologie und Psychiatrie der Universität zu Köln Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Direktor: Universitätsprofessor Dr. med. F. Jessen Studie zur Untersuchung der Korrelation von Patientenzufriedenheit und Symptomveränderung in einer tagesklinischen Patientengruppe mit depressiven Erkrankungen Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln Vorgelegt von Sabine Babette Flück aus Köln promoviert am 5. April 2017 Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln, 2017 Druckerei: Digital Express 24 GmbH & Co KG, Friesenplatz 25, 50672 Köln Dekan: Universitäts Professor Dr. med. Dr. h.c. Th. Krieg 1. Berichterstatter: Universitätsprofessor Dr. med. J. Klosterkötter 2. Berichterstatter: Professor Dr. med. C.H. Albus Erklärung: Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Dissertationsschrift ohne unzulässige Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe; die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. Bei der Auswahl und Auswertung des Manuskripts habe ich keine unterstützenden Leistungen erhalten. Weitere Personen waren an der geistigen Herstellung der vorliegenden Arbeit nicht beteiligt. Insbesondere habe ich nicht die Hilfe einer Promotionsberaterin/ eines Promotionsberaters in Anspruch genommen. Dritte haben von mir weder mittelbar noch unmittelbar geldwerte Leistungen für Arbeiten erhalten, die im Zusammenhang mit dieser vorgelegten Dissertationsschrift stehen. Die Dissertationsschrift wurde von mir bisher weder im Inland noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt. Erklärung zur guten wissenschaftlichen Praxis: Ich erkläre hiermit, dass ich die Ordnung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten (http://typo3-819.rrz.unikoeln.de/fileadmin/templates/uni/PDF/Ordnung_gute_wiss_Praxis.pdf) der Universität zu Köln gelesen habe und verpflichte mich hiermit, die dort genannten Vorgaben bei allen wissenschaftlichen Tätigkeiten zu beachten und umzusetzen. Köln, den 6.9.16 Die dieser Arbeit zugrunde liegenden Daten wurden von mir selbst erhoben und ausgewertet. Bei der Erhebung der BDI-Werte bei der Aufnahme der Patienten unterstütze mich Herr Georgio Psomas, Krankenpfleger auf der Tageseinheit C, und Fr. Cornelia Ley, Krankenschwester auf der Tageseinheit C, Tagesklinik Alteburger Straße. Danksagung An erster Stelle, möchte ich mich bei dem ehmaligen Ärztlichen Leiter unserer Tagesklinik, Prof. Dr. F. Matakas bedanken, der mir immer mit Rat und Tat zur Seite stand und ohne den diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Er hat mich aufgebaut und mir immer geholfen, auch weil er den Glauben an dieses Projekt niemals aufgegeben hat. Das habe ich nie als selbstverständlich angesehen. Herzlichen Dank. Danken möchte ich auch Universitätsprofessor Dr.med. J.Klosterkötter, der mir in der entscheidenen Phase der Fertigstellung immer ein achtsamer und kritischer Berater gewesen ist und mir geistige Anrgungen gegeben hat. Besonders wertvoll war für mich auch, dass es ehrliche und offene Kritik gab, die mich immer ein Stück weiter gebracht hat. Für diese Ehrlichkeit bin ich sehr dankbar. Dankbar bin ich auch dem Team der Tageseinheit C, die mich in der Ausführung der Befragungen immer großartig unterstützt haben und ohne deren wundervolle, kompetente psychotherapeutische Arbeit ein Studienergebnis, wie es jetzt vorliegt, niemals möglich gewesen wäre. Der Dank gilt natürlich auch meiner Familie, hier insbesondere meinem Mann, der mich immer voll unterstützt hat. Dieser Beistand ist für mich nicht selbstverständlich, sondern den habe ich nur Dir und Deiner Geduld zu verdanken. Du bleibst ohnehin immer in meinem Herzen. Darüber hinaus gilt mein Dank allen Verwandten, Freunden und Bekannten, die mein Jammern und Klagen jahrelang ertragen und mich immer wieder aufgerichtet haben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wichtig dieser Rückhalt für mich war. Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis 1. Einleitung .......................................................................................................... 1 2. Depressive Erkrankungen ............................................................................... 3 2.1 Definition ..................................................................................................... 3 2.2 Einteilung .................................................................................................... 3 2.3 Epidemiologie.............................................................................................. 4 2.4 Ätiopathogenese .......................................................................................... 6 2.5 Klinik ......................................................................................................... 17 2.6 Diagnose .................................................................................................... 18 2.7 Therapie ..................................................................................................... 21 2.8 Prognose .................................................................................................... 24 2.9 Lebensqualität depressiver Patienten ........................................................ 26 2.10Komplikationen der Depression ................................................................ 26 2.11Bindungsmuster und Depression ............................................................... 27 3. Patientenparameter ........................................................................................ 33 3.1 Alltagskompetenz ...................................................................................... 33 3.2 Patientenzufriedenheit ............................................................................... 33 3.3 Lebensqualität............................................................................................ 38 3.4 Symptomveränderung................................................................................ 38 4. Diagnostische Messinstrumente in der Psychiatrie ..................................... 40 4.1 Variablen in der operationalen Diagnostik ................................................ 40 4.1.1 Reliabilität ........................................................................................... 40 4.1.2 Konsistenz ........................................................................................... 40 4.2 Messinstrumente zur Erfassung der Lebensqualität .................................. 40 4.3 Messinstrument zur Erfassung der sozialen Integration ............................. 41 4.4 Messinstrumente zur Erfassung der Depression ......................................... 42 4.5 Messinstrumente im Vergleich ................................................................... 43 4.5.1 BDI-II.................................................................................................. 43 4.5.2 SASSR ................................................................................................ 43 4.5.3 MFPB-18 ............................................................................................ 44 4.5.4 Sonstige Messinstrumente .................................................................. 44 5. Situation der Tageskliniken in Deutschland ................................................ 45 5.1 Verteilung der Tageskliniken in Deutschland ........................................... 45 5.2 Aufenthaltsdauer in den Tageskliniken ..................................................... 45 5.3 Tagesklinik mit psychotherapeutischem Setting ....................................... 45 5.3.1 Behandlungsansatz.............................................................................. 46 5.3.2 Vorteile ............................................................................................... 47 5.3.3 Nachteile ............................................................................................. 47 5.4 Tagesklinik Alteburger Straße gGmbH ..................................................... 47 5.4.1 Hintergrund der Behandlung von depressiven Patienten in der Tagesklinik Alteburger Straße gGmbH .............................................. 49 5.4.2 Behandlungsablauf auf der Tageseinheit C der Tagesklinik Alteburger Straße gGmbH ................................................................. 50 5.5 Die Tagesklinik in der Behandlung depressiver Patienten ........................ 57 5.6 Zukunftstrend ............................................................................................ 58 6. Material und Methoden ................................................................................. 59 6.1 Studiendesign ............................................................................................ 59 6.2 Forschungsgegenstand ............................................................................... 59 6.3 Studienkollektiv......................................................................................... 60 6.4 Datenerhebung ........................................................................................... 60 6.4.1 Ablauf der Literaturrecherche ............................................................. 60 6.4.2 Ablauf der Patientenbefragung ........................................................... 63 6.5 Datenanalyse.............................................................................................. 63 7. Ergebnisse ....................................................................................................... 65 7.1 Beschreibung der Stichprobe ..................................................................... 65 7.2 Soziale Integration, depressive Symptomatik und Patientenzufriedenheit .............................................................................. 66 7.2.1 Übersicht ............................................................................................. 66 7.2.2 Soziale Integration .............................................................................. 67 7.2.3 Depressive Symptomatik .................................................................... 68 7.2.4 Patientenzufriedenheit ........................................................................ 68 7.3 Korrelation der Patientenzufriedenheit mit Outcomes .............................. 71 7.3.1 Assoziation zwischen der Zufriedenheit und der Alltagskompetenz .. 71 7.3.2 Assoziationen zwischen Patientenzufriedenheit und Depressivität .... 71 8. Diskussion ........................................................................................................ 74 8.1 Hypothesenbildung ..................................................................................... 76 8.2 Der Stellenwert der Tageskliniken in der Depressionsbehandlung ........... 76 8.3 Die Tagesklinik Alteburger Straße und ihr psychoanalytischen Therapieansatz .......................................................................................... 79 8.4 Der Stellenwert der Tagesklinik in der Behandlung traumabedingter Depressionen und Depressionen im Kontext von Traumafolgestörungen ............................................................................. 80 8.5 Vergleich der Effizienz des psychotherapeutischen und psychoanalytischen Ansatzes in der tagesklinischen Behandlung von Depressionspatienten .................................................... 81 8.6 Vergleich Bearbeitung pathologischer Bindungsmuster im tagesklinischen und stationären Setting................................................... 83 8.7 Die multipersonelle Übertragung im tagesklinischen Setting ................... 85 9. Zusammenfassung und Ausblick .................................................................. 87 9.1 Zusammenfassung der forschungsfragenspezifischen Ergebnisse ............ 87 9.2 Fazit ........................................................................................................... 89 10. Literaturverzeichnis ...................................................................................... 92 11. Anhang 11.1. Tabellenverzeichnis ................................................................................ 108 11.2. Abbildungsverzeichnis ........................................................................... 109 11.3. SASSR - Fragebogen ............................................................................. 110 11.4. Beck - Depressions - Inventar ............................................................... 124 12. Lebenslauf .................................................................................................... 143 Abkürzungsverzeichnis BDI-II Beck-Depressions-Inventar BRMS Bech-Rafaelsen-Melancholie-Skala BRMAS Bech-Rafaelsen-Manie-Skala DNA Desoxyribonukleinsäure DSN Diagnostische Depressionsskala Newcastle DSI Depressionsstatusinventar GDS Geriatrische Depressionsskala nach Yesavage et al. GSI Globaler Schwere Index HADS-D Hospital Anxiety and Depression Scale – Deutsche Version ICD International Classification of Diseases IDCL Internationale Diagnosen Checklisten PTBS Posttraumatische Belastungsstörung SDS Selbstbeurteilungs-Depressionsskala SNP Single Nucleotid Polymorphism TGT Thematische Gestaltungs-Test-Salzbuger Einleitung 1 1 Einleitung Depressive Erkrankungen gehören heutzutage sowohl weltweit als auch in Deutschland zu den häufigsten Erkrankungen nach Herzkreislauferkrankungen und malignen Erkrankungen und verursachen aufgrund ihres oft chronischen Verlaufes hohe sozioökonomische wie auch klinikökonomische Kosten (vgl. Kempermann et al. 2008). Die weltweite Inzidenz depressiver Erkrankungen liegt bei 16-20 % (vgl. Härter et al. 2009; 2014). Die Punktprävalenz der unipolaren Depression als Form der depressiven Erkrankungen liegt in Deutschland in der Altersgruppe der 18-65-Jährigen bei etwa 6 %, wonach mehr als 3 Millionen Deutsche von dieser Erkrankung betroffen sind (vgl. Härter et al. 2009; Härter 2014). Man geht davon aus, dass 25 % der Klinikaufenthalte eine depressive Erkrankung zugrunde liegen (vgl. Härter 2014). Entsprechend den epidemiologischen Daten des Robert Koch Institutes ist in den nächsten Jahren mit einem weiteren Anstieg der depressiven Erkrankungen zu rechnen. Vor allem die Chronizität der depressiven Erkrankungen erschwert sowohl die Therapie als auch die Versorgung der betroffenen Patienten. Daten der WHO zeigten bereits 2001, dass depressive Erkrankungen, wie die unipolare Depression, mit einer hohen Krankheitsdauer assoziiert sind (vgl. Härter et al. 2007). Dabei unterteilt sich die klassische Depression in verschiedene Erkrankungsformen und der Begriff „Depression“ wurde vom Begriff der „depressiven Erkrankung“ abgelöst. Ebenso wurde die neue Einteilung der depressiven Erkrankungen auch in die aktuelle ICD-10 übernommen (vgl. Härter et al. 2009; 2014) und stellt sich dort u. a. als depressive Episode (F32), rezidivierende depressive Störung (F33) und anhaltende affektive Störung (F34) dar (vgl. Krollner & Krollner. 2014). Bei depressiven Erkrankungen sind sowohl die Lebensqualität als auch die soziale Integration oftmals deutlich eingeschränkt. Um sowohl die Lebensqualität als auch die soziale Integration zu verbessern, wurde die Versorgungsstruktur dieser Patienten optimiert und verzahnt. Nach Härter stellt die Versorgung von Patienten mit depressiven Erkrankungen eine komplexe Verzahnung verschiedener Bereiche dar (vgl. Härter 2014). Zu diesen Bereichen, die in die Versorgung dieser Patientengruppe einfließen, gehören (vgl. Härter et al. 2009; Härter 2014): Hausärzte, Einleitung 2 Fachärzte für Innere Medizin und Geriatrie, Fachärzte für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Ärzte mit den Zusatzqualifikationen in Psychotherapie und Psychoanalyse, Psychologen, Ergotherapeuten, Soziotherapeuten, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Betreuer und ambulantes Pflegepersonal, Fachkliniken und Fachabteilungen, Gerontopsychiatrische Ambulanzzentren, Institutsambulanzen und Tageskliniken sowie Rehabilitationseinrichtungen. Tageskliniken stellen dabei eine wichtige Einrichtung in der Versorgung depressiv Erkrankter dar und gewährleisten in Deutschland die Versorgung dieser Patienten sowohl in Kombination als auch getrennt von einem stationären Aufenthalt der Patienten. In Deutschland gibt es ein flächendeckendes Angebot an Tagesklinik für Patienten mit depressiven Erkrankungen, wobei die Kliniken vor allem im städtischen Raum angesiedelt sind. Die Mehrzahl der Tageskliniken verfolgt dabei das Konzept eines psychiatrischen Settings. Die Anzahl der Tageskliniken, die nach einem psychotherapeutischen Konzept arbeiten, ist in diesem Sektor gering. Dabei kommt das psychotherapeutische Setting der Tagesklinik einer vollstationären Psychotherapie gleich. Inwieweit sich die verschiedenen tagesklinischen Therapiemodelle auf die Lebensqualität und den Krankheitsverlauf der Patienten mit depressiven Erkrankungen auswirken, ist noch nicht hinreichend untersucht. Man weiß jedoch, dass das subjektive Erleben des Patienten hinsichtlich der Behandlung eine wichtige Rolle im Krankheitsverlauf spielt. Depressive Erkrankungen 3 2 Depressive Erkrankungen 2.1 Definition Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert Depression als „eine weit verbreitete psychische Störung, die durch Traurigkeit, Interesselosigkeit und Verlust an Genussfähigkeit, Schuldgefühle und geringes Selbstwertgefühl, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Müdigkeit und Konzentrationsschwächen gekennzeichnet sein kann“ (WHO 2014a, Onlinequelle). Die Ausprägung der Depression ist dabei unterschiedlich und bezieht im Allgemeinen alle Lebensbereiche der Betroffenen mit ein, was zu einer Beeinträchtigung des Lebens, des Lernens und des Arbeitens führt. Die Nationale Versorgungsleitlinie (S3-Leitlinie), herausgegeben von den im Bereich der Psychiatrie verantwortlichen Arbeitsgemeinschaften und Gesellschaften, gibt eine genauere Definition der depressiven Störung, indem sie diese als „psychopathologische Syndrome von bestimmter Dauer innerhalb der diagnostischen Kategorie der affektiven Störungen“ (DGPPN et al. 2009, Onlinequelle) definiert. Damit fallen in den Bereich der depressiven Störungen, die in der ICD-10 als F32, F33, F34, F38 und F39 kategorisierten Erkrankungen. 2.2 Einteilung Die Einteilung der Depression orientiert sich an dem Auftreten und der Dauer der Haupt- und Zusatzsymptome sowie somatischer und psychotischer Symptome (vgl. Härter et al. 2007) und führt zur Einteilung der depressiven Episoden hinsichtlich ihres Schweregrades, ihres Verlaufes und ihrer Frequenz (vgl. DGPPN et al. 2009). Wichtig dabei ist, dass sowohl Haupt- als auch Zusatzsymptome mindestens zwei Wochen vorliegen müssen, bevor man von einer depressiven Episode sprechen kann. Liegen zwei Hauptsymptome und zwei Nebensymptome vor, so spricht man von einer leichten depressiven Episode. Bei zwei Hauptsymptomen und drei bis vier Zusatzsymptomen handelt es sich um eine mittelgradige depressive Episode. Das Vorliegen von drei Hauptsymptomen und mindestens vier Zusatzsymptomen führt zu einer schweren depressiven Episode (vgl. DGPPN et al. 2009). Zusätzlich zu den Haupt- und Zusatzsymptomen bestimmen das somatische Syndrom und das psychotische Syndrom die Einteilung der depressiven Episode. Zieht man nun das somatische und psychotische Syndrom hinzu, lassen sich die depressiven Episoden noch in monophasi- Depressive Erkrankungen 4 sche, rezidivierende und bipolare depressive Episoden unterteilen. Als monophasisch wird dabei eine depressive Episode bezeichnet, die nur einmal auftritt und wenn es in der Anamnese des Patienten auch zuvor keine depressiven Episoden gab. Demgegenüber beschreibt rezidivierend das Vorliegen einer aktuellen depressiven Episode, bei der es bereits in der Anamnese mindestens eine weitere depressive Episode gab. Die Bezeichnung bipolar wird für depressive Episoden verwendet, die in der Anamnese mindestens eine manische, hypomanische oder gemischte affektive Störung aufweisen (vgl. Härter et al. 2007; DGPPN et al. 2009). So wird eine leichte depressive Episode ohne somatische Symptome als monophasisch bezeichnet, während das Vorliegen somatischer Symptome zur Einteilung in die rezidivierenden depressiven Episoden führt (vgl. Härter et al. 2007). Gleiches gilt für die mittelgradig depressiven Episoden, die entsprechend dem Vorliegen bzw. Nichtvorliegen somatischer Symptome in monophasische oder rezidivierende depressive Episoden unterteilt werden (vgl. Härter et al. 2007). Bei den schweren depressiven Episoden spielt das Auftreten psychotischer Symptome eine Rolle. Eine schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen wird dabei als bipolare depressive Episode und ohne psychotische Symptome als rezidivierende depressive Episode bezeichnet (vgl. Härter et al. 2007), kann bedingt jedoch auch den monophasischen depressiven Episoden (F32.2, F32.3) zugeordnet werden. 2.3 Epidemiologie Die Lebenszeitprävalenz der unipolaren Depression liegt bei 15-18 % (vgl. Kempermann et al. 2008) und zeigt eine Präferenz des weiblichen Geschlechtes (vgl. WHO 2014a). Entsprechend den Daten der WHO aus der EU, aus Island, Norwegen und der Schweiz leidet einer von 15 Menschen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren an einer Majordepression, während insgesamt 23 % der Menschen dieser Altersgruppe an einer psychischen Störung allgemein leiden (vgl. WHO 2014c). Von den Patienten, die bereits eine depressive Episode erlitten haben, erkranken 50-85 % im Verlauf ihres Lebens erneut an einer depressiven Episode, was bedeutet, dass das Wiedererkrankungsrisiko mit jeder depressiven Episode zunimmt (vgl. Kempermann et al. 2008). Ebenso erhöht jede depressive Episode die Therapieresistenz und das Chronifizierungsrisiko. So liegt beispielsweise die Rezidivwahrscheinlichkeit nach dem Auftreten von mindestens 3 Episoden einer Majordepression bei 90 % (vgl. Kempermann et al. 2008). Die Rezidivwahr- Depressive Erkrankungen 5 scheinlichkeit nach einer einmaligen depressiven Episode liegt im Follow-up nach 10 Jahren bei immerhin noch 58 % (vgl. Kempermann et al. 2008). Das Rezidivrisiko steigt nach Kempermann nach jeder depressiven Episode um 16 % (vgl. Kempermann et al. 2008). „Der mittlere zeitliche Abstand zwischen zwei depressiven Episoden liegt bei vier bis fünf Jahren und nimmt mit dem Alter ab“ (Kempermann et al. 2008, S. 73). Zur Beschreibung der Prävalenz und der Auswirkung der Depression im Spezifischen sowie der neuropsychiatrischen Erkrankungen im Allgemeinen werden die sogenannten DALYs (disability-adjusted life years) und YLDs (years lived with disability) herangezogen. Dabei macht die unipolare depressive Episode mit 5,6 % den Hauptanteil der DALYs bezogen auf neuropsychiatrische Erkrankungen aus und nimmt in der Gesamtstatistik der 15 häufigsten lebensbeeinträchtigenden Erkrankungen Platz drei ein (vgl. WHO 2014c). Bezogen auf YLDs führen die neuropsychiatrischen Erkrankungen die Statistik an und auch hier ist die unipolare depressive Episode mit 12,4 % am häufigsten in Europa vertreten (vgl. WHO 2014c). Der WHO-Report „Health for the world’s adolescents“ definiert die Depression als einen der Hauptfaktoren für die Entwicklung weiterer psychischer Erkrankungen und Störungen bei Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis neunzehn Jahren. Sie stellt zudem eine der Hauptursachen für Suizide unter Jugendlichen dar (vgl. WHO 2014b). Es wurde eine Reihe von Risikofaktoren verifiziert. Neben den ätiopathogenetisch wirkenden Faktoren begünstigen diese die Entstehung einer depressiven Episode. Zu diesen Risikofaktoren gehören (vgl. DGPPN et al. 2009): depressive Episoden in der Anamnese, ein Mangel an sozialer Unterstützung, eine positive Familienanamnese bzgl. bipolarer und/oder depressiver Erkrankungen, Komorbiditäten, Substanzmissbrauch, akute einschneidende Lebensereignisse und Suizidversuche in der Eigen- und Familienanamnese. Depressive Erkrankungen 6 2.4 Ätiopathogenese Die Ätiopathogenese der depressiven Erkrankungen ist ein multifaktorielles Geschehen. Verantwortlich für die Ausbildung einer depressiven Erkrankung können dabei sein (vgl. Wittchen et al. 2010): biopsychosoziale Faktoren, neurologische Faktoren, pharmakologische Faktoren, Drogen und Komorbiditäten. Hierbei werden die einzelnen Faktoren den beiden Gruppen psychosoziale Aspekte und neurobiologische Aspekte zugeordnet (vgl. Wittchen et al. 2010), welche in der folgenden Tabelle darstellt werden. Tabelle 1 Gruppierung der ätiopathogenetischen Faktoren nach Hegerl. In Anlehnung an Wittchen et al. (2010, S. 14) und Hegerl et al.(2005) Psychosoziale Aspekte Neurobiologische Aspekte Vulnerabilität Negative Lebenserfahrungen Genetische Aspekte Depressiver Zustand Depressive Symptomatik Auslöser Akute und chronische psychosoziale Belastung Therapie Psychotherapie Überaktivität der Stresshormonachse Neurochemische Dysregulation bzgl. Serotonin und Noradrenalin Pharmakotherapie Psychosoziale Faktoren Es gibt eine Reihe von sozialen Rahmenbedingungen und Ereignissen, die eine depressive Erkrankung bedingen, forcieren oder auslösen können. Einige von ihnen begründen nach ICD-10 und DSM-V auch eigene Subspezifitäten der depressiven Erkrankungen wie beispielsweise die Wochenbettdepression oder die Schwangerschaftsdepression. Soziale Gründe für die Ausbildung einer depressiven Erkrankung können beispielsweise sein: drohende, eingetretene oder bestehende Arbeitslosigkeit, Depressive Erkrankungen 7 krankheitsbedingte Berufsunfähigkeit, Scheidung, Tod eines nahen Angehörigen, Wohnungslosigkeit oder drohender Verlust der Wohnung, häusliche Gewalt, kranke Angehörige, die Pflege kranker oder behinderter Angehöriger, Stress und Burn-out, Beziehungsprobleme, Probleme im Arbeits- und Gesellschaftsleben, erlebte oder mit angesehene Traumata (Missbrauch, Überfall, Autounfall, Naturkatastrophe etc.) oder alkoholabhängige/drogenabhängige Angehörige (vgl. DGPPN et al. 2009). Die Ursache, warum psychosoziale Faktoren eine depressive Erkrankung auslösen, bedingen oder verstärken können, ist genauso multifaktoriell, wie es die psychosozialen Faktoren selbst sind. Einerseits wirken sich psychosoziale Faktoren auf die biologischen und neuronalen Prozesse im Körper aus, wodurch sie über eine Veränderung der Hirnstruktur und -funktion eine depressive Erkrankung verursachen oder begünstigen können, andererseits lässt sich mithilfe lerntheoretischer und kognitiver Ansätze die Entstehung depressiver Erkrankungen durch das Auftreten psychosozialer Faktoren erklären (vgl. Lewinsohn et al. 1979; Beck 1974). Diese Modelle wurden bereits in den 70er-Jahren konzipiert. Das Auftreten einer depressiven Erkrankung im Rahmen des lerntheoretischen Modells wurde damals auf einen Mangel an Belohnung zurückgeführt (vgl. Lewinsohn et al. 1979). Auf dem Boden des kognitiven Modells nach Beck (1974) werden depressive Erkrankungen durch eine Interaktion von dysfunktionalen Kognitionen hervorgerufen. Man spricht bei den psychosozialen Faktoren auch von sogenannten Negativverstärkern (vgl. Wittchen et al. 2010). Diese Erkenntnis bildet die Grundlage der Theorie der erlernten Hilflosigkeit als Ursache depressiver Erkrankungen (vgl. Abramson et al. 1978; 1989). Hinzu kommt der Einfluss der Persönlichkeitsstruktur auf die Ausbildung depressiver Erkrankungen Depressive Erkrankungen 8 (vgl. Kronmüller et al. 2002). Vor allem die als Melancholiker bezeichneten Persönlichkeitstypen haben eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Ausprägung einer depressiven Erkrankung (vgl. Zerssen 1991). Genetische (biologische) Faktoren Die genetische Komponente der depressiven Erkrankungen ist unumstritten (vgl. Lieb et al. 2002; Mattejat et al. 2008). Dabei spielen verschiedene Gene und Genloci eine Rolle in der Entstehung depressiver Erkrankungen. Belegt wird diese Tatsache durch die nachweislich familiäre Häufung von depressiven Erkrankungen (vgl. Berger et al. 1999). Das Risiko von Kindern depressiver Eltern, an einer depressiven Erkrankung zu leiden, ist um fast 14-16 % höher als bei Kindern, deren Eltern keine depressiven Erkrankungen zeigen (vgl. Wittchen et al. 2010; Mattejat et al. 2008). Ebenso sind die Dysthymie und die bipolaren Störungen mit depressiver Komponente bei Kindern depressiver Eltern gegenüber Kindern von gesunden Eltern um 4-5 % bei der Dysthymie und um 2-4 % bei der bipolaren Störung erhöht (vgl. Mattejat et al. 2008). Gleiche Ergebnisse wurden in Zwillingsstudien belegt. So beträgt die Konkordanz depressiver Erkrankungen bei eineiigen Zwillingen 44 % und bei zweieiigen Zwillingen 20 % (vgl. Mattejat et al. 2008). Die sich dadurch bedingende Heritabilität, die Erblichkeit depressiver Erkrankungen liegt zwischen 40-71 % (vgl. McGuffin et al. 2003). Sowohl McGuffin et al. als auch Mattejat et al. konnten gewisse Gesetzmäßigkeiten innerhalb der familiären Prädisposition ausmachen (vgl. Mattejat et al. 2008; McGuffin et al. 2003). So besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Erstmanifestation einer depressiven Erkrankung innerhalb der Familie und der familiären Prädisposition. Je früher eine depressive Erkrankung sich in einer Familie manifestiert, desto höher ist die genetische Belastung für die übrigen Familienmitglieder. Zudem kommt es innerhalb der Generationen einer Familie zu einer Verjüngung des Erstmanifestationsalters in jeder neuen Generation. Letztlich besteht keine Geschlechtsdivergenz in der Stärke der genetischen Prädisposition. Forciert werden die genetischen Faktoren durch ihre nachgewiesene Beeinflussbarkeit durch Umweltfaktoren und soziale Faktoren (vgl. Maier 2004). Auch hier liegen die Daten von Zwillingsstudien vor, die sich mit der Wechselbeziehung von genetischer Disposition und psychosozialem Kontext befasst haben (vgl. Wittchen et al. 2010; Kendler et al. 1999). Somit kann eine Reihe psychosozialer Faktoren, wie frühe Kindheitstraumata, kritische Lebenser- Depressive Erkrankungen 9 eignisse, ein mangelnder sozialer Bezugsrahmen und der sog. Neurotizismus eines Menschen, die genetische Prädisposition einer depressiven Erkrankung erhöhen (vgl. Kendler et al. 1999; Brakemeier et al. 2008). Eines der Gene, die die Prädisposition einer depressiven Erkrankung erhöhen, ist das Gen 5HTTLPR (vgl. Risch et al. 2009). Dieses Gen, welches zum Chromosom 17 gehört, bewirkt einerseits eine Störung in der Interaktion von Amygdala und subgenualem Gyrus cinguli, was zu einer gestörten Emotionsverarbeitung und -ausprägung führt, andererseits ist das kurze Allel dieses Chromosoms mit einem bis zu 50 % höheren Erkrankungsrisiko einer depressiven Erkrankung assoziiert (vgl. Risch et al. 2009). Außerdem zeigen Träger des kurzen Allels eine Dysfunktion des Gyrus cinguli bezüglich negativ affektiver Emotionen, was zum Auftreten einer depressiven Erkrankung bei fehlender Pufferung von Negativgefühlen zur Folge hat (vgl. Risch et al. 2009). Inwieweit diese Untersuchungen Allgemeingültigkeit besitzen, bleibt zu hinterfragen, da es auch Studiendaten gibt, die diese Erkenntnisse bzgl. des 5-HTTLPRGens und der erhöhten Inzidenz und Prävalenz von depressiven Erkrankungen widerlegen. Neben dem 5-HTTLPR-Gen nehmen Gene Einfluss auf die Inzidenz und Prävalenz der depressiven Erkrankungen, die weitere Rezeptoren und Transporter im Serotoninstoffwechsel codieren (vgl. Mandelli et al. 2007). Neurobiologische Faktoren Die Gruppe der neurobiologischen Faktoren, die eine depressive Erkrankung bedingen oder forcieren können, wird geprägt durch unspezifische strukturelle und funktionelle Hirnveränderungen (vgl. Eberhard-Metzger 2006). Daneben führen hormonelle Veränderungen auch extrakranial durch die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse zu biologischen Veränderungen, die depressive Erkrankungen bedingen können. Hierin wird u. a. die Ursache postpartaler und prämenstrueller depressiver Erkrankungen gesehen (vgl. Yonkers & McCunn 2007; Wittchen et al. 2010). Pharmakologische Faktoren und Drogen Auch Medikamente und Drogen können eine depressive Episode bedingen oder eine bestehende depressive Episode beeinflussen. Vor allem von Drogen wie Cannabis, Ecstasy und Depressive Erkrankungen 10 Crystal Meth gehen depressive Episoden aus. Unter den Medikamenten bedingen insbesondere Antibiotika depressive Episoden. Mehrere Studien haben den direkten Zusammenhang zwischen depressiven Störungen und Substanzmissbrauch nachgewiesen (vgl. Ihle et al. 2012). Die Prävalenz depressiver Störungen bei Alkoholabhängigen lag in der Studie von Soyka und Kollegen bei 30-60 % (vgl. Soyka et al. 1996). Dieser Zusammenhang wurde von Swendsen und Kollegen im Jahr 2000 bestätigt und um den Zusammenhang zwischen depressiven Störungen und Substanzmissbrauch ohne Alkohol (Drogen, Medikamente) erweitert (vgl. Swendsen & Merikangas 2000). Sie kamen außerdem zu dem Schluss, dass es keinen ausschließlich unidirektionalen Zusammenhang zwischen depressiven Störungen und den einzelnen Arten des Substanzmissbrauchs gibt, sondern dass beide Störungen einander bedingen und zur jeweils anderen Störung führen können (vgl. Swendsen & Merikangas 2000). Trauma als Ursache der Depression Aufgrund der starken Entwicklung in der Traumaforschung bestehen mittlerweile auch ausreichende Studiendaten, die den Zusammenhang zwischen Depressionen und Traumata erklären. Dabei können Traumata gleich welchen Ausmaßes und welcher Art und vor allem unabhängig ihres zeitlichen Auftretens in der Biographie eines Menschen zum Auslöser von Depressionen werden (vgl. Wingenfeld et al. 2011). Vor allem der Major-Depression liegt häufig eine Traumagenese zugrunde (vgl. Fernando et al. 2012). Während sich die Ausbildung einer Depression aufgrund eines Traumas aus psychologischer Sicht als Verarbeitungsprozess beschreiben lässt, lassen sich die Zusammenhänge auch neurobiologisch nachweisen (vgl. Fernando et al. 2012). In ihrer Studie aus dem Jahr 2012 konnten Fernando und Kollegen nachweisen, dass sowohl Traumapatienten als auch Patienten mit einer Depression Verschiebungen in der Aktivität der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse (HHP-Achse) und einen signifikant höheren Kortisolspiegel aufweisen als gesunde Personen (vgl. Fernando et al. 2012). Damit scheinen beide Prozesse nicht nur durch dieselben Hormone generiert zu werden, sondern auch über ähnliche hormonelle Aktivierungsprozesse ausgelöst zu werden (vgl. Fernando et al. 2012). Wang und Kollegen gehen davon aus, dass die Stressoren, die zur Aktivierung der HHP-Achse führen, ebenso die neuronalen Rezeptoren beeinflussen (vgl. Wang et al. 2013; Kapfhammer 2014). Die Studienlage, die diese Effekte mittels des Neuroimaging abbildet ist allerdings gering (vgl. Wang et al. 2013). Daneben führen Traumata in der frühen Lebensphase eines Individuums zu einer erhöhten Vulnerabilität, die das Auftreten Depressive Erkrankungen 11 einer Depression im Erwachsenenalter begünstigt (vgl. Wang et al. 2013; Kleim et al. 2012). Auch hier liegt die Ursache in einer Veränderung der neuronalen Rezeptoraktivitäten und damit der neuronalen Informationsweiterleitung (vgl. Wang et al. 2013). Frühe interpersonelle Traumatisierung (FIT) als Ursache der Depression Neben den oben beschriebenen Ursachen der Depression kann im Rahmen der verschiedenen Traumatisierungen auch die frühe interpersonelle Traumatisierung (FIT) als Ursache der Depression angesehen werden (vgl. Kolk 2009; Wiersma et al. 2009; Park et al. 2016). Hierzu gehören alle Formen von Traumata, welche der Säugling bzw. das Kleinkind durch seine Bezugspersonen erlebt. Neben den verschiedenen Arten des Missbrauchs sind dies u.a. körperliche und seelische Misshandlungen, emotionale Vernachlässigung oder wiederholt medizinische Eingriffe. Die frühe interpersonelle Traumatisierung geht mit einer erhöhten Lebenszeitprävalenz spezifischer psychiatrischer Erkrankungen einher (vgl. Tagay et al. 2013; Fricke et al. 2007). So ist sie in 54% mit einer Depression, in 84% mit einer BorderlinePersönlichkeitsstörung und in 32,4% mit einer Angststörung im Erwachsenenalter vergesellschaftet (vgl. Herpertz 2014; Teicher & Samson 2013). Für depressive Patienten bedeutet das zudem, dass Patienten mit früher interpersoneller Traumatisierung einen früheren Beginn der Depression, eine größere Symptomvielfalt, eine höhere Rate an Komorbiditäten und ein deutlich höheres Suizidrisiko gegenüber depressiven Patienten ohne frühe interpersonelle Traumatisierung aufweisen (vgl. Teicher & Samson 2013; Herbst et al. 2009). Dabei müssen sich nach Streeck-Fischer (2014) frühe interpersonelle Traumatisierungen nicht zwangsläufig in spezifischen Störungsbildern manifestieren. Jedoch gehen sie zumeist mit einer gestörten Objektbeziehung und damit mit einer gestörten Beziehungserfahrung einher, die im Erwachsenenalter zu zahlreichen Folgeerscheinungen und Erkrankungen führen (vgl. Streeck-Fischer 2014; Pérez et al. 2011). Die Ursache der komplexen Auswirkungen früher interpersoneller Traumatisierungen liegt in deren neurobiologischen Auswirkungen, die zur Entwicklung sog. ecophenotypischer Varianten führen (vgl. Herpertz 2014). Hier sind insbesondere Veränderungen im Bereich des Hippocampus (Volumenreduktion), der Amygdala (Hyperaktivität) und des präfrontalen Kortex mit rechtshemisphärischer Fokussierung zu verzeichnen (vgl. Teicher & Samson 2013; Naumann-Lenzen 2003). Beeinflusst werden die Entwicklung und Ausprägung der frühen interpersonellen Traumatisierung durch genetische Faktoren in Form von genetischen Modifikationen und genetischen Polymorphismen, intrapersonelle Faktoren in Form der Resilienz Depressive Erkrankungen 12 und Resistenz sowie Umweltfaktoren (vgl. Naumann-Lenzen 2003). In ihrer Studie aus dem Jahr 2013 konnten Apter-Levy und Kollegen den genetischen Zusammenhang zwischen den Allelvariationen des Oxytocin-Rezeptor-Gens (OXTR) und den Auswirkungen einer frühen interpersonellen Traumatisierung nachweisen. Kinder mit dem rs225298-G-Allel im OXTR wiesen dabei eine genetische Prädisposition einer sozialen Hypersensitivität auf, die beim Auftreten früher interpersoneller Traumatisierungen beispielweise in Form mäßiger Vernachlässigung zu ausgeprägten Störungen im Erwachsenenalter führt (vgl. Apter-Levy et al. 2013). Demgegenüber waren Kinder mit dem rs-2254298-A-Allel im OXTR resistenter gegenüber der frühen interpersonellen Traumatisierung, so dass diese weder einen desorganisierten Bindungstyp noch eine Emotionsregulationsstörung zeigten. Patienten, die eine frühe interpersonelle Traumatisierung erfahren haben, zeigen unabhängig der Kriterien einer spezifischen psychiatrischen Erkrankung wie der Depression u.a. eine hohe Bedrohungssensitivität, eine schlechte Emotionsregulation, einen unsicheren Bindungsstil, ein schlechtes Selbstkonzept und eine Mentalisierungsschwäche (vgl. Herpertz 2014; Naumann-Lenzen 2003; Wiltgen et al. 2015). In der Behandlung von Patienten, deren psychiatrische Erkrankung auf eine frühe interpersonelle Traumatisierung zurückzuführen bzw. durch eine solche forciert wurde, müssen die Störungen aus der frühen interpersonellen Traumatisierung berücksichtigt werden. Dabei bieten vor allem psychotherapeutische Verfahren aus der Verhaltenstherapie und der Psychoanalyse die Möglichkeit zum interpersonellen Lernen und damit zum neurobiologischen und kognitiven Nachreifen (vgl. Herpertz 2014). Insbesondere, da die aufgrund der frühen interpersonellen Traumatisierung entstandenen Bindungsprobleme und Bindungsstörungen einbezogen werden können (vgl. Kolk 2009). Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass Patienten mit Depression und früher interpersoneller Traumatisierung ein signifikant schlechteres Ansprechen auf eine antidepressive Pharmakotherapie zeigen als depressive Patienten ohne frühe interpersonelle Traumatisierung (vgl. Nemeroff et al. 2003). Komorbiditäten Vor allem psychiatrische Erkrankungen erhöhen das Risiko, eine depressive Erkrankung zu entwickeln. Nachgewiesen wurde das beispielsweise für die Angststörungen in der EDSPStudie (vgl. Bittner et al. 2004; Wittchen et al. 2000). Angststörungen gehen im Durchschnitt mit einer 2-3-fach höheren Inzidenz depressiver Erkrankungen einher (vgl. Bittner et al. 2004). Begründet wird die Komorbidität von depressiven Erkrankungen mit anderen psychiat- Depressive Erkrankungen 13 rischen Erkrankungen über gemeinsame Vulnerabilitätsfaktoren sowie über die wechselseitige Beeinflussung ihrer prädisponierenden Faktoren (vgl. Wittchen et al. 2000). Alle diese Faktoren dienen als Stressoren, die durch ihr Zusammenspiel untereinander und mit der Grundstimmung des Patienten im Sinn seiner Vulnerabilität und Resilienz die Entwicklung einer depressiven Erkrankung bedingen können. Inwieweit es zur Ausbildung einer depressiven Erkrankung bei Vorliegen verschiedener Stressoren kommt, wird mithilfe der Vulnerabiltäts-Stress-Modelle erklärt (vgl. Wittchen et al. 2010; Wittchen et al. 2006b), die nachfolgend, wie auch die Resilienz, näher erklärt werden sollen. Zimmermann und Kollegen konnten 2002 in einer Studie an 479 Patienten zeigen, dass die Depression mit anderen Achse-I-Störungen assoziiert ist. So wiesen 64 % der Patienten dieser Studie eine zusätzliche Achse-I-Störung und 37 % mindestens zwei weitere Achse-IStörungen auf (vgl. Zimmermann et al. 2002). Mit 57 % bildeten Angststörungen die häufigste Komorbidität der depressiven Störung. Der prozentuale Anteil der Achse-I-Komorbiditäten stieg auf 73 %, wenn auch sog. subsyndromale Störungen eingeschlossen wurden (vgl. Zimmermann et al. 2002). Den engen Zusammenhang von depressiven Störungen und Angststörungen wiesen Johnson und Lydiard bereits 1998 nach (vgl. Johnson & Lydiard 1998). Katon beschrieb 1991 die Komorbidität der depressiven Störung mit Panikstörungen in bidirektionaler Richtung. Hierbei zeigten 25 % der Patienten mit einer depressiven Störung eine Panikstörung, während 40-80 % der Patienten mit Panikstörungen eine zusätzliche depressive Störung aufwiesen (vgl. Katon 1991). Vulnerabilitäts-Stress-Modelle Den einzelnen Modellen ist gemeinsam, dass der Auslöser (Stressor) auf die Vulnerabilität (Veranlagung) und Resilienz des Patienten trifft, woraus es je nach Vorbedingungen zu einem depressiven Zustand kommen kann, der einer Therapie bedarf (vgl. Wittchen & Jacobi 2010; Wittchen et al. 2006b). Dabei kommt es zu einem Zusammenspiel der Hauptfaktoren (vgl. Wittchen et al. 2010): Belastung (akut und/oder chronisch), neurobiologische und psychische Veränderung und modifizierende Variablen. Depressive Erkrankungen 14 Die Unterscheidung der einzelnen Modelle beruht auf deren unterschiedliche Klassifizierung und Bewertung der einzelnen biopsychosozialen Faktoren und der Bewertung der Notwendigkeit einer Therapie (vgl. Wittchen et al. 2010; 2006b). Die Anzahl bestehender Modelle zeigt, wie komplex das Zusammenspiel der einzelnen Faktoren ist und wie schwierig es ist, daraus Kernfaktoren zu eliminieren, vor allem vor dem Hintergrund einer zusätzlich einfließenden hohen Anzahl von Vulnerabilitätsfaktoren. Einer dieser Vulnerabilitätsfaktoren ist ein genetischer Vulnerabilitätsfaktor, der sich auf einer Variation der Promotorregion des Serotonintransportergens begründet (vgl. Risch et al. 2009). Resilienz Als Resilienz wird die Widerstandsfähigkeit der Seele beschrieben, die auf Forschungen von Werner und Smith an hawaiianischen Einwohnern der Insel Kauai im Rahmen der KauaiStudie zurückzuführen ist (vgl. Sit 2012). Aufgrund der 40-jährigen Nachbeobachtung von im Jahr 1955 geborenen Kindern konnten anhand der Kauai-Studie psychisch-seelische Schutzfaktoren evaluiert werden, die dafür verantwortlich sind, inwieweit traumatische Kindheitserlebnisse und schwierige frühe Lebensphasen verarbeitet werden und eine störungsfreie seelische Entwicklung möglich ist (vgl. Sit 2012). Auf dem Boden dieser Grundlagenstudie und ergänzt durch nachfolgende Studien wurden drei spezifische Merkmale der Resilienz festgelegt. Demnach ist Resilienz kein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal, sondern ein sich im Zuge der Entwicklung ausbildendes und von der Kind-Umwelt-Interaktion bestimmtes Merkmal (vgl. Sit 2012). Daneben kann Resilienz nicht als statisches Merkmal gewertet werden. Die Resilienz eines Menschen ist variabel und abhängig von der aktuellen Lebenssituation, weswegen sich Resilienz zu unterschiedlichen Zeiten und bei verschiedenen Umständen unterschiedlich äußern kann (vgl. Sit 2012). Ein weiteres Merkmal der Resilienz ist ihre Verwurzelung in der von der individuellen Persönlichkeit und der Lebenssituation bestimmten Individualentwicklung. Vor allem Phasen, die Entwicklungsschritte oder Entwicklungsübergänge beinhalten, zeichnen sich durch eine geringere Resilienz aus. Zu solchen Phasen gehört beispielsweise der Übergang ins Grundschulalter oder in die Pubertät. Dabei ist das Individuum bzw. das Kind in Phasen geringerer Widerstandskraft einerseits anfälliger, andererseits offener für äußere Fak- Depressive Erkrankungen 15 toren, die sich aus der Umwelt ergeben, und „Risikobedingungen können stärker auf das psychosoziale Funktionsniveau des einzelnen Kindes einwirken“ (Sit 2012, S. 13). Die Komplexität der seelischen Widerstandskraft als Interaktion von innerpersonalen und interpersonalen Verhältnissen bedingt, dass nur eine sichere innere und auch äußere Umgebung zur Ausbildung der Resilienz führt (vgl. WHO 2014b). Damit bilden sogenannte innere und äußere Schutzfaktoren die Grundlage der Resilienz. Diese Schutzfaktoren werden in Schutzfaktoren innerhalb und außerhalb der Familie unterteilt. Zu den innerfamiliären Schutzfaktoren gehören hierbei: „eine verlässliche primäre Bezugsperson, ein Erziehungsstil, der Risikoübernahme und Unabhängigkeit möglich macht bzw. zum Ziel hat und die Ermutigung, Gefühle auszudrücken, verbunden mit einer positiven Identifikationsfigur“ (Sit 2012, S. 16). Außerfamiliäre Schutzfaktoren beinhalten (vgl. Sit 2012): konstante stabile und verlässliche Freundschaften, eine Sensibilität der Umwelt, unterstützende Erwachsene, die nicht zur Familie gehören, wie beispielsweise LehrerInnen und ErzieherInnen, ein entwicklungsförderndes und unterstützend sowie schützend wirkendes Umfeld in Kindergarten und Schule, klare und artikulierte Regeln und die positive Verstärkung des Verhaltens und der Leistung des Kindes. Kinder bzw. Menschen, die über eine gute Resilienz verfügen, können auf gesunde Ressourcen zurückgreifen, die sich aus folgenden Faktoren zusammensetzen und gleichzeitig die Merkmale resilienter Kinder und Erwachsener darstellen (vgl. Sit 2012, S. 13): ein sicheres Bindungsverhalten, eine aktive Problembewältigung, eine internale Überzeugung vom Handlungserfolg, Depressive Erkrankungen 16 Optimismus, Zuversichtlichkeit, eine effektive Nutzung vorhandener Ressourcen, ein Glauben an eigene Kontrollmöglichkeiten, Realismus mit realistischer Reflexion und Interpretation der aktuellen Situation, die Fähigkeit zur Selbstmotivation, eine hohe Sozialkompetenz, eine hohe Fähigkeit zur Empathie, eine hohe Kooperationsfähigkeit sowie die Übernahme von Verantwortung. Eine Störung der Resilienzentwicklung führt zu Fehladaptationen und psychischen Störungen. Außerdem werden zahlreiche psychische Störungen, wie u. a. die Depression davon bestimmt, wie das Individuum mit seiner Umwelt interagieren und insbesondere schwierige Lebensphasen und Situationen meistern kann. Vor allem die aufgrund akuter negativer Lebensereignisse eintretenden depressiven Episoden werden durch die seelische Widerstandskraft beeinflusst. Zum einen wirkt sich eine hohe Resilienz im Individuum protektiv hinsichtlich der Entwicklung einer depressiven Episode aus, zum anderen nimmt die Resilienz Einfluss auf den Progress einer depressiven Episode. So sind depressive Episoden kürzer und weniger schwerwiegend bei Patienten mit einer guten bzw. hohen Resilienz (vgl. Sit 2012). Wichtig bei der Betrachtung der Resilienz ist die Tatsache, dass – obwohl die Resilienz ein sich in der frühen Entwicklung ausprägendes Merkmal ist – Resilienz in begrenztem Umfang auch von Erwachsenen erlernt und entwickelt werden kann. Dazu gibt es, analog zur Förderung im Kindesalter, auch für Erwachsene Trainingskonzepte zur Entwicklung und zum Ausbau der eigenen Resilienz. Es zeigt sich, dass die Verbesserung der Resilienz auch eine Verbesserung der depressiven Symptomatik nach sich ziehen kann. Hierbei setzt die Resilienzförderung an den pathologischen Bindungsmustern an und führt nach Korrektur im Rahmen einer Psychotherapie zur Verbesserung der Selbstwirksamkeit, des Selbstwertgefühles, der sozialen Kompetenz, des Umganges mit Gefühlen, des Umganges mit Stress und der Verbesserung der Konfliktfähigkeit sowie der Fähigkeit der Problemlösung (vgl. Sit 2012). Damit Depressive Erkrankungen 17 werden alle depressionsbedingenden und depressionsfördernden Faktoren aus bindungstheoretischer Sicht aufgegriffen und positiv verändert, was Einfluss auf die depressive Episode nimmt. Gerade Patienten mit einer verminderten oder rudimentären Resilienz auf dem Boden frühkindlicher Bindungsstörungen und Traumata neigen zu ausgeprägten Defiziten, wie sie im Kapitel der bindungstheoretischen Grundlagen bereits erläutert wurden, die die Ausbildung und die Ausprägung einer Depression forcieren. 2.5 Klinik Patienten, die an einer depressiven Episode leiden, kommen zumeist mit unspezifischen und dennoch wegweisenden Symptomen in die Klinik bzw. die Praxis. Sie berichten über allgemeine körperliche Beschwerden (allgemeine körperliche Abgeschlagenheit, Mattigkeit, Schlafstörungen (Ein- und Durchschlafstörungen, Appetitstörungen), gastrointestinale Probleme (Magendruck, Gewichtsverlust, Obstipation, Diarrhoe), neurologische Probleme (diffuser Kopfschmerz, Globusgefühl im Hals, Schwindel, Flimmerskotome, Sehstörungen, Muskelverspannungen, neuralgiforme Beschwerden, Gedächtnisstörungen), kardiologische Probleme (Herzrhythmusstörungen, Synkopen, Herz- und Kreislaufstörungen) und gynäkologische Beschwerden (Libidoverlust, Menstruationsstörungen, Impotenz, sexuelle Funktionsstörungen). Bestehen diese Symptome, so sollte eine weitere diagnostische Abklärung unter dem Verdacht einer depressiven Episode gestellt werden. Diese erfolgt aufgrund der Evaluierung der Haupt- und Zusatzsymptome sowie der psychotischen und somatischen Syndrome, die eine Einteilung der depressiven Episode sowie die Abschätzung deren Schweregrades zulassen (vgl. Härter et al. 2007). Zu den Hauptsymptomen gehören (vgl. Härter et al. 2007): die gedrückte Grundstimmung (tiefe Traurigkeit), der Interessenverlust (Anhedonie) und die Antriebsminderung (Energielosigkeit). Daneben setzen sich die Zusatzsymptome zusammen aus (vgl. Härter et al. 2007; DGPPN et al. 2009): Negativismus, Depressive Erkrankungen Pessimismus, Konzentrationsstörungen, mangelndem Selbstwertgefühl, mangelndem Selbstvertrauen, einem Aufmerksamkeitsdefizit, dem Gefühl der Wertlosigkeit, Schuldgefühlen, vermindertem Appetit, Schlafstörungen und Suizidgedanken bzw. Suizidhandlungen. 18 2.6 Diagnose Die Diagnostik der depressiven Störung ist ein multimodales Verfahren, das sich auf verschiedene Säulen stützt. An erster Stelle steht hierbei die psychiatrische bzw. psychologische Exploration des Patienten anhand der diagnostischen Kriterien nach ICD-10 und DSM-V. Entsprechend den Ausführungen des Robert Koch Instituts (RKI) im Heft 51 der Gesundheitsberichterstattung des Bundes gliedert sich die psychologisch-psychiatrische Exploration in die Bereiche (vgl. Wittchen et al. 2010): Diagnostische Verfahren, Depressionsskalen und Screeningverfahren. Diagnostische Verfahren In den Bereich der diagnostischen Verfahren fallen entsprechend dem RKI sowohl die standardisierten diagnostischen Interviews als auch sogenannte Checklistenverfahren. Allen diagnostischen Interviews ist gemeinsam, dass sie sowohl die Symptomerfassung als auch die Beurteilung und die differenzialdiagnostische Bewertung umfassend abdecken. Depressive Erkrankungen 19 Demgegenüber unterscheiden sie sich von den Checklistenverfahren. Diese erfassen zwar ebenfalls die Symptome, geben „jedoch keine expliziten Anleitungen zur Erfassung und klinischen Beurteilung“ (Wittchen et al. 2010, S. 13). Zu den diagnostischen Interviews gehören unter anderem: das strukturierte Interview für DSM-V und das Composite International Diagnostic Interview (CIDI) nach WHO (1990). Beide, das strukturierte Interview für DSM-V und der CIDI, zählen zum diagnostischen Goldstandard in der Diagnostik der depressiven Erkrankungen (vgl. Wittchen et al. 2010). Depressionsskalen Depressionsskalen umfassen eine Reihe von Fragebögen, die vom Patienten (sog. Selbstbeurteilungsverfahren) oder vom Untersucher (klinisches Beurteilungsverfahren) ausgefüllt werden. Ziel dieser Skalen ist die Beschreibung und Erfassung depressiver Symptome und deren Schweregrad, sofern welche vorliegen bzw. der Verdacht einer depressiven Erkrankung besteht. In die Gruppe der Selbstbeurteilungsverfahren gehören Depressionsskalen wie z. B.: die Center of Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D), der Beck Depression Inventory (BDI) und der WHO-5 Well Being Index. Daneben gibt es eine Reihe von klinischen Beurteilungsverfahren wie die Hamilton Depression Scale (HAMD). Während mit der HAMD die Schwere der depressiven Episode umfassend eingeschätzt werden kann, ist sie zur klinischen Diagnostik der depressiven Erkrankung entsprechend Wittchen nicht geeignet (vgl. Wittchen et al. 2010). Screeningverfahren Screeningverfahren dienen der Aufdeckung beginnender depressiver Erkrankungen und des Risikos, dass eine depressive Erkrankung auftritt. Vor allem Patienten, die einer Hochrisikogruppe angehören und in der Eigenanamnese depressive Episoden oder somatische Erkrankungen aufweisen, profitieren von der Früherken- Depressive Erkrankungen 20 nung (vgl. DGPPN et al. 2009). Ergeben die Screeningverfahren erhöhte Depressionswerte, so schließt sich an das Screening die genaue Diagnostik zur Abklärung einer depressiven Episode an. Screeninginstrumente sind dabei u. a. der Gesundheitsfragebogen für Patienten (PHQ-D), der WHO-5-Fragebogen zum Wohlbefinden, die Allgemeine Depressionsskala (ADS) und der sogenannte Zwei-Fragen-Test. Innerhalb des Screeningverfahrens werden auch auf dem Hintergrund von Differenzialdiagnosen die Bereiche Panikstörungen, Angststörungen, Zwangsstörungen, bipolare Störungen, posttraumatische Belastungsreaktionen, Essstörungen und Substanzmissbrauch (Alkohol, Drogen, Medikamente) abgefragt. Letztendlich entscheiden die Ergebnisse der verschiedenen Diagnostikinstrumente in ihrer Gesamtheit, ob bei einem Patienten eine depressive Erkrankung vorliegt oder nicht. Weder die psychologisch-psychiatrische Diagnostik noch die rein internistische Diagnostik sind in der Lage, eine depressive Erkrankung exakt zu bestimmen, vor allem vor dem Hintergrund, dass sich hinter einer depressiven Erkrankung oft ein multimodales Geschehen verbirgt und auch rein internistische Erkrankungen das klinische Bild einer depressiven Erkrankung bedingen können, ohne dass diese tatsächlich vorliegt (vgl. Wittchen et al. 2010). Nach Wittchen und Kollegen unterliegt die psychologisch-psychiatrische Diagnostik einer Überschätzung, vor allem bezüglich der Prävalenz depressiver Erkrankungen, während die klinische Diagnostik sowohl zu einer Über- als auch zu einer Unterschätzung der Prävalenz führt (vgl. Wittchen et al. 2010). Ursächlich hierfür ist, bezogen auf die psychologisch-psychiatrische Diagnostik, die Unspezifität der in den Fragebögen und Skalen erfassten Daten, die deutlich von der aktuellen Befindlichkeit des Patienten beeinflusst werden. Hinzu kommen die mitunter uneinheitlichen Definitionen der depressiven Erkrankungen, die zu einer Verschiebung der Prävalenzdaten führen (vgl. Wittchen et al. 2010). Entsprechend den Ausführungen von Wittchen aus dem Jahr 2006 liegt so beispielsweise der Anteil der über die Fragebögen erfassten depressiven Symptome 26 % höher als der Anteil der nach strikten Definitionskriterien gestellten Diagnose einer depressiven Erkrankung (vgl. Wittchen & Jacobi 2006a). Das RKI stellte aufgrund dieser Daten eine Pyramide auf, welche die Wertigkeit der Diagnosen staffelt. Dabei wurden die allein durch eine psychologisch-psychiatrische bzw. eine klinische Diagnostik erhobenen Befunde als depressive Symptome bezeichnet. Diese bilden die Depressive Erkrankungen 21 Basis der Pyramide und machen einen Anteil von 26 % aus. Von diesen 26 % werden durch eine fortgeführte gezielte Diagnostik 12 % als depressive Syndrome bezeichnet. Unter Anlegung der strikten Definitionskriterien der depressiven Erkrankungen nach DSM-V haben von diesen 12 % lediglich 8 % der Patienten eine klassisch depressive Erkrankung (vgl. Wittchen et al. 2010). Neben der Fehlbeurteilung der Beschwerden sowohl durch die psychologisch-psychiatrische als auch durch die klinische Diagnostik bei bestehenden Beschwerden bzw. dem Verdacht einer vorliegenden depressiven Erkrankung wird die Diagnostik der depressiven Erkrankungen dadurch erschwert, dass Patienten mit unspezifischen Symptomen im hausärztlichen Sektor vorstellig werden, ohne dass der Verdacht einer depressiven Erkrankung gestellt wird (vgl. Wittchen et al. 2010). Vor allem psychosomatische Beschwerden kaschieren die Symptome der depressiven Erkrankung. Letztlich „boykottieren“ einige Patienten selbst die Diagnostik, wenn die Diagnose einer depressiven Erkrankung als Stigma erlebt wird. Diese Faktoren bedingen in ihrer Gesamtheit, dass eine Vielzahl von Patienten mit depressiven Erkrankungen nicht oder erst zeitverzögert diagnostiziert wird (vgl. Wittchen et al. 2010). Durch die Implementierung geeigneter Diagnostikinstrumente für den ambulanten und hausärztlichen Sektor soll dieser falschnegativen Diagnostik entgegengewirkt werden. Federführend sind hierfür unter anderem die Gremien des Kompetenznetzes Depression. 2.7 Therapie Die Therapie der depressiven Störung ist ebenso komplex wie die Störung selbst. Neben der pharmakologischen Therapie stellt die Psychotherapie den Goldstandard in der Behandlung depressiver Störungen dar. Sie setzt sich zusammen aus der Akuttherapie, der Erhaltungstherapie und der Rezidivprophylaxe. In der Akuttherapie geht es vor allem um das Erreichen einer Vollremission bei Vorliegen einer akuten depressiven Episode. Die Behandlungsdauer der Akuttherapie umfasst einen Zeitraum von mindestens vier bis sechs Wochen (vgl. Kempermann et al. 2008). Die Erhaltungstherapie folgt an die Akuttherapie und soll durch den Erhalt der Remission ein Rezidiv verhindern. Die Mindestdauer der Erhaltungstherapie liegt bei sechs Monaten und ist abhängig von den Risikofaktoren (vgl. Kempermann et al. 2008). Depressive Erkrankungen 22 Mit der sich anschließenden Rezidivprophylaxe soll das Auftreten neuer depressiver Episoden vermieden werden. Bei einer einmaligen und erstmaligen depressiven Episode erstreckt sich die Rezidivprophylaxe über sechs Monate, während sie bei Rezidiven eine Mindestdauer von drei Jahren nicht unterschreiten sollte (vgl. Kempermann et al. 2008). Pharmakotherapie Die Pharmakotherapie der depressiven Störung besteht aus Antidepressiva und je nach Ansprechen und Risikofaktoren in der Gabe von Lithium, Carbamazepin und Phasenprophylaktika (vgl. Kempermann et al. 2008). Goldstandard in der Pharmakotherapie sind dabei die Antidepressiva, von denen es zahlreiche Gruppe wie z. B. die trizyklischen Antidepressiva, die tetrazyklischen Antidepressiva, die Reuptake-Hemmer und die MAO-Hemmer gibt. Alle Antidepressiva haben in Studien zu einer Remission und Reduktion des Rezidivrisikos um bis zu 50 % geführt (vgl. Geddes et al. 2003). Zu beachten ist, dass es unter der Therapie mit trizyklischen Antidepressiva zur Ausbildung einer Manie und damit zur Entstehung einer bipolaren Störung kommen kann (vgl. Kempermann et al. 2008). Kommt es zu diesem Wechsel der klinischen Symptomatik, wird nachfolgend die Manie bzw. die bipolare Störung behandelt, wozu Antimanika und Phasenprophylaktika zum Einsatz kommen. Demgegenüber wird die bipolare Depression in der Rezidivprophylaxe, anders als die normale depressive Episode, statt mit Antidepressiva mit Lithium, Carbamazepin, Valproat, Lithium oder atypischen Neuroleptika behandelt (vgl. DGPP 2009). Nicht pharmakologische Therapien Neben der Pharmakotherapie gibt es eine Reihe weiterer Therapieoptionen in der Behandlung der depressiven Episode, von denen die Psychotherapie die wichtigste darstellt (vgl. Blanz et al. 2007). Welches psychotherapeutische Setting gewählt wird, sollte individuell entschieden werden. Als geeignet haben sich die kognitive Verhaltenstherapie (vgl. Blanz et al. 2007) und die interpersonelle Therapie (IPT) erwiesen. Die schweren depressiven Störungen profitieren zudem von psychoanalytischen Therapiekonzepten, die jedoch nicht flächendeckend angewandt und auf spezielle Kliniken, wie die hier vorgestellte Tagesklinik, beschränkt sind (vgl. Matakas & Rohrbach 2005). Unter der Annahme sich verschiebender Über-Ich-Anteile entsprechend den Freudschen Grundlagen Depressive Erkrankungen 23 „braucht die Depression, um bestehen zu können, einen Interaktionspartner“ (vgl. Matakas & Rohrbach 2005, S. 3). Daraus geht hervor, dass die passagere Unterbindung von Beziehungen zu Angehörigen und Bekannten zu einer Besserung der depressiven Beschwerden führt. Aus psychotherapeutisch-psychoanalytischer Sicht verbirgt sich eine Abwehr hinter der Depression, die einen Beziehungskonflikt zum Auslöser hat. Damit greift diese Form des therapeutischen Settings auf den ätiopathogenetischen Faktor der Bindungs- und Beziehungsstörung, die Grundlage der depressiven Störungen bildet bzw. bilden kann, zurück. Hemmung, Regression und Aggression ergänzen diesen Faktor und können in der Psychoanalyse aufgegriffen und gedeutet werden, was dem Patienten zugutekommt (vgl. Matakas & Rohrbach 2005). Hinsichtlich der Pharmakotherapie profitieren manche therapieresistente Patienten, entsprechend der aktuellen Datenlage, von der elektrokonvulsiven Therapie (EKT) zur Remissionserhaltung und Rezidivvermeidung (vgl. Kempermann et al. 2008). Hinzu kommen ergänzende und unterstützende Behandlungen, die sich aus ergotherapeutischen, soziotherapeutischen und gestaltungstherapeutischen Elementen zusammensetzen. Daneben wird der Patient im Rahmen der Psychoedukation über seine Erkrankung sowie über die Perspektiven aufgeklärt und es werden ihm Helfersysteme u. a. aus Sozialarbeitern und Betreuern zur Seite gestellt, die ihm helfen, seinen Alltag zu bewältigen, ihn neu zu strukturieren und ggf. in das Arbeitsleben zurückzukehren. Hierfür stehen den depressiven Patienten, wie allen psychisch kranken Patienten, verschiedene, auf Staats- und Bundesebene implementierte Versorgungseinrichtungen zur Verfügung. Die Therapie der Patienten erfolgt entweder vollstationär, teilstationär, in einer Tagesklinik oder in einer ambulanten Psychotherapie. Vor allem Tageskliniken haben sich in der Therapie depressiver Patienten bewährt. Einerseits wird durch die Anwesenheit in der Tagesklinik der Teufelskreis durchbrochen, der es den Patienten unmöglich macht, beispielsweise im eigenen Haushalt aktiv zu werden, andererseits wirken sich die Einbettung in die dortige Struktur und die Interaktion mit anderen Menschen (Personal, Therapeuten, Betroffene) positiv auf den Krankheitsverlauf aus (vgl. DGPP 2009). Zu den wichtigen soziotherapeutischen Zielen der Behandlung gehört es, depressive Patienten wieder in eine sozial integrierte Situation zu begleiten. Haben die depressiven Patienten eine Behinderung lt. § 109 SGB IX oder § 33 Abs. 6 SGB IX, so kann der Integrationsfachdienst (IFD) die Aufgabe der Vermittlung dieser Patienten in geeignete Fördermaßnahmen übernehmen. Der IFD berät arbeits- und berufsbegleitend, auch nach voll- und teilstationären Klinikaufenthalten. Depressive Erkrankungen 24 Wenn Patienten länger als 6 Monate erkrankt sind, kann eine berufliche Rehabilitation zur Stärkung der beruflichen Kompetenzen im Anschluss an die Behandlung zum Beispiel in den Berufsförderungswerken oder den Berufsbildungswerken notwendig sein. Im Einzelfall kann es sinnvoll sein, nach der Entlassung aus der Klinik ein ambulant betreutes Wohnen zu empfehlen. Hier besprechen die Patienten soziale Probleme und erarbeiten individuelle Lösungen. In der Entwicklung der depressiven Störungen hat, wie die vorangegangenen Kapitel zeigten, die seelische Widerstandskraft (Resilienz) eine entscheidende Bedeutung. Obwohl sie ihre Grundlage in der Entwicklung des Individuums hat, kann sie auch im Erwachsenenalter erlernt werden. Hier gibt es analog zur Förderung im Kindesalter auch für Erwachsene Trainingskonzepte zur Entwicklung und zum Ausbau der eigenen Resilienz. Es zeigt sich, dass die Verbesserung der Resilienz auch eine Verbesserung der depressiven Symptomatik nach sich ziehen kann. Hierbei setzt die Resilienzförderung an den pathologischen Bindungsmustern an und führt nach Korrektur im Rahmen einer Psychotherapie zur Verbesserung der Selbstwirksamkeit, des Selbstwertgefühles, der sozialen Kompetenz, des Umgangs mit Gefühlen, des Umgangs mit Stress und der Konfliktfähigkeit sowie der Fähigkeit der Problemlösung (vgl. Sit 2012). Damit werden alle depressionsbedingenden und depressionsfördernden Faktoren aus bindungstheoretischer Sicht aufgegriffen und positiv verändert, was Einfluss auf die depressive Episode nimmt. Hauptfaktor für das Gelingen der Therapie ist die Bereitschaft des Patienten, aktiv an dieser mitzuwirken. Abgesehen von akuten Phasen, in denen der Patient in geschütztem Rahmen abgeschirmt und mitunter passiv stabilisiert wird, sind alle anderen Therapieschritte von der Bereitschaft (der Compliance) des Patienten abhängig. 2.8 Prognose Die Prognose der depressiven Störungen ist nicht immer günstig. Einerseits nehmen die Rezidive mit zunehmendem Lebensalter zu, andererseits haben 20-30 % der Patienten persistierende Residualsymptome (vgl. Kempermann et al. 2008). Die Chronizität der depressiven Störungen liegt bei 10 %, die Wahrscheinlichkeit des Suizids bei 15 % (vgl. Kempermann et al. 2008). Hinzu kommt, dass es bei 10-20 % der depressiv Erkrankten zur Ausbildung einer bipolaren Störung kommt. Prognosebestimmende Faktoren ergeben sich aus der Ätiopathogenese. Daraus lassen sich nach Kempermann folgende Risikofaktoren für ein Rezidiv einer depressiven Episode ableiten (vgl. Kempermann et al. 2008): Depressive Erkrankungen 25 die Entwicklung eines bipolaren Verlaufes, ein frühes Erkrankungsalter, die Dysthymie, mindestens drei Episoden einer Majordepression, mindestens zwei depressive Episoden innerhalb von fünf Jahren, das Vorliegen von psychiatrischen Komorbiditäten, das Vorliegen somatischer Komorbiditäten, ausgeprägte Defizite im psychosozialen Funktionsniveau, das Auftreten von Episoden mit psychotischen, somatischen und katatonen Symptomen, eine unvollständige Remission, das Auftreten eines Rezidivs nach Beendigung der Pharmakotherapie, das Vorliegen einer genetischen Prädisposition, das Vorhandensein chronischer psychosozialer Belastungen und das Vorhandensein von Suizidversuchen in der Anamnese. Handelt es sich um eine rezidivierend depressive Störung, so wird sie unterteilt in Patienten mit einer therapeutischen Ansprechbarkeit, einer partiellen Remission, einer Vollremission, einem Rückfall in der Remissionsphase, Patienten mit einer Genesung und Patienten mit einem erneuten Rezidiv. Tritt das Rezidiv mit dem Vollbild einer depressiven Episode nach Beendigung der Remissionsphase auf, so spricht man von einer eigenständigen erneuten depressiven Episode (vgl. DGPP 2009). Der therapeutische Outcome richtet sich auch nach den vorliegenden Komorbiditäten. Dabei konnten Berger und Kollegen 2003 nachweisen, dass die Prognose bei Vorliegen einer depressiven Störung und einer Angststörung signifikant schlechter ist als beim alleinigen Vorliegen einer depressiven Störung. Patienten, die diese Komorbidität aufwiesen, hatten ein höheres Suizidrisiko, eine schlechtere Langzeitprognose und einen schlechteren Outcome bezüglich der pharmakologischen Therapie (vgl. Berger et al. 2003; Ihle et al. 2012). Depressive Erkrankungen 26 Liegt die depressive Störung gemeinsam mit einem Substanzmissbrauch vor, so entscheiden die Arten beider Störungen (primär, sekundär) über die Prognose (vgl. Brown et al. 1995). Patienten mit einer depressiven Störung und einer Alkoholabstinenz oder einer nicht vorliegenden Alkoholabhängigkeit (kein Vorliegen als Lebenszeitdiagnose) haben „doppelt so hohe Heilungsraten wie Patienten mit aktueller Alkoholabhängigkeit“ (vgl. Ihle et al. 2012, S. 13). Liegt der schweren depressiven Störung ein Beziehungskonflikt zugrunde, der nicht aufgelöst wird, und kann der Patient nicht angehalten werden, sich entsprechend seinem Maß in die Gesellschaft und folglich ins Leben zu integrieren, entwickelt sich eine anhaltende depressive Regression, die eine Betreuung oder Heimunterbringung des Patienten erforderlich macht (vgl. Matakas et al. 2005). 2.9 Lebensqualität depressiver Patienten Die depressiven Störungen gehen mit einer deutlichen Reduktion der Lebensqualität einher (vgl. Kempermann et al. 2008). Hieraus ergibt sich ein Circulus vitiosus, da die reduzierte Lebensqualität wiederum die Depression verstärkt. Hinzu kommt, dass viele Erkrankungen als Komorbiditäten mit der depressiven Störung auftreten und sowohl allein als auch durch die Interaktion mit der depressiven Störung die Lebensqualität reduzieren. 2.10 Komplikationen der Depression Neben der Chronizität stellt vor allem die Suizidalität eine Komplikation der depressiven Episode dar. Entsprechend der Statistik versterben 4 % aller hospitalisierten Patienten mit einer depressiven Störung durch Suizid (vgl. DGPPN et al. 2009). Demgegenüber treten bei 6070 % dieser Patienten Suizidgedanken auf, die nicht zum Vollzug des Suizids führen. Wichtig dabei ist, dass die Suizidalität in jeder Phase der depressiven Episode auftreten kann und nicht nur bei der schweren Form der depressiven Störung zu finden ist. Neben der Eruierung der Suizidalität in der Akutsituation muss die Suizidalität auch im Verlauf evaluiert und therapeutisch behandelt werden. Diese Exploration erfolgt über gezielte Fragen, die Risikomerkmale der Suizidalität abfragen. Die Behandlung der Suizidalität richtet sich danach, ob der Patient absprachefähig ist, ob es Suizidversuche und parasuizidales Verhalten in der Anamnese gab und danach, wie stark die Einengung durch die Suizidgedanken vorliegt (vgl. DGPPN et al. 2009). Depressive Erkrankungen 27 Außerdem gibt es zahlreiche psychiatrische Erkrankungen, die als Komorbidität mit der depressiven Störung assoziiert sind. Hierzu gehört auch der Substanzmissbrauch (vgl. DGPPN et al. 2009), der aufgrund seiner körperlichen und psychiatrischen Auswirkungen die Therapie der depressiven Störung behindert. Des Weiteren spielen die Rezidive in der Behandlung depressiver Episoden eine große Rolle und zählen mit zu den Komplikationen. Rezidive treten mit einer Inzidenz von 85 % bei der unipolaren Depression auf, wobei die Rezidivhäufigkeit pharmakologisch behandelter Patienten bei 5-10 % liegt (vgl. Kempermann et al. 2009). 2.11 Bindungsmuster und Depression Die Bindungstheorie geht zurück auf den britischen Psychiater Bowlby, der Bindung als „stammesgeschichtlich vorgegebene Bereitschaft, eine starke emotionale Bindung zu einer oder mehreren bevorzugten Bezugspersonen zu entwickeln“ (Sit 2012, S. 23) definiert. Diese Bereitschaft zur Bindung und die Etablierung der Bindung sichern dem Kind Schutz und Beruhigung beim Auftreten bedrohlicher Situationen, bei Angst, Schmerz, Unwohlsein und bei der Entfernung einer anderen Bezugsperson. Dieser Zusammenhang zwischen der Bindungssuche des Kindes durch angeborene kommunikative Fähigkeiten und der Fähigkeit der Eltern, adäquat darauf zu reagieren, lässt sich als Bindungsverhalten beschreiben, das sich ontogenetisch entwickelt hat und zur Ausbildung einer sozial-emotionalen Beziehung führt, die für die gesunde Entwicklung und Reifung des Kindes notwendig ist (vgl. Sit 2012). Störungen in diesem Zusammenspiel führen zu sogenannten Bindungsstörungen, die sich als pathologische Bindungsstile sowohl beim Kind als auch beim späteren Erwachsenen darstellen. Während die gesunde sozial-emotionale Bindung zum sicher gebundenen Bindungsstil bei Kindern und Erwachsenen führt, führen Störungen zu Bindungsstilen, die als unsichervermeidend, unsicher-ambivalent und unsicher-desorganisiert beschrieben werden (vgl. Brisch 2013; Sit 2012). Die empathische Bindung an die Mutter als primäre Bezugsperson bzw. an andere primäre Bezugspersonen ist notwendig, um sowohl eine gesunde Affektivität als auch eine gesunde Kognition entwickeln zu können (vgl. Matakas 2006). Die primären Bezugspersonen werden damit zum Vorbild einerseits und zum Steuerungsobjekt andererseits. Diese Steuerung und Abhängigkeit von einem Nichtselbst gehört zum Menschen, weil – wie Matakas es beschreibt – kein Mensch in der Lage ist, „die Regulation seines seelischen Funktionierens ganz allein Depressive Erkrankungen 28 bewerkstelligen“ (vgl. Matakas 2006, S. 6) zu können. Diese Abhängigkeiten, die eine Person durch den gesellschaftlichen Kontext zeitlebens begleiten, bewirken ihre soziale Identität, die nach Matakas die Schnittstelle der gesellschaftlichen Gruppenzugehörigkeiten darstellt und entscheidenden Einfluss auf die Ausprägung einer depressiven Störung sowie später auf den Verlauf des therapeutischen Settings nimmt (vgl. Matakas 2006; King 2015). Die gestörte Sozialisation, die sich aus den einzelnen Bindungsmustern ergibt, wirkt als Faktor in der Entstehung depressiver Erkrankungen und muss in die Behandlung der Patienten einbezogen werden, um nicht nur die äußeren Symptome der depressiven Störung zu minimieren, sondern es dem Patienten auch zu ermöglichen, sich eine neue soziale Integration zu erobern, pathologische Bindungsmuster aufzulösen und auf diesem Boden gesunde Beziehungen und ein gesundes soziales Umfeld zu schaffen, was sowohl für seine Genesung als auch für die Rezidivprophylaxe der depressiven Störung eminent ist (vgl. Matakas 2006). „Depression entsteht, wie es scheint, wenn das Kind in seinen Lebensäußerungen keine angemessene Aufmerksamkeit und Anteilnahme erfährt“ (Matakas 2006, S. 7). Bewiesen wurde das vor allem durch die Cambrigde-Studie, die den Einfluss einer gestörten frühkindlichen Bindung aufgrund einer depressiven Erkrankung der primären Bezugsperson auf die spätere Entwicklung des Kindes und des Erwachsenen untersuchte (vgl. Brisch 2011; Murray & Trevarthen. 1996). Neben der Bindungsstörung, die sich beim Kind entwickelt, hat sich allerdings auch gezeigt, dass umgekehrt das Verhalten des Kindes zu einer depressiven Episode der Mutter führen kann, wenn diese nicht fähig ist, sich den Anforderungen des Kindes und des an sie gerichteten Beziehungsangebotes zu stellen (vgl. Brisch 2011; Murray & Trevarthen 1986). Aus bindungstheoretischer Sicht haben Kinder mit einem ambivalenten oder vermeidenden Bindungsverhalten ein signifikant erhöhtes Depressionsrisiko (vgl. Brisch 2011), während das ängstlich-ambivalente Bindungsmuster vor allem mit dem späteren Auftreten einer Angststörung assoziiert ist (vgl. Brisch 2011; Warren et al. 1997). Chemisch sind es vor allem die Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysen- Nebennierenachse, die Ausschüttung des Oxytocins und die damit verbundene Höhe des Kortisolspiegels im Blut, die sich auf das Bindungsverhalten und das erlernte Bindungsmuster auswirken und im günstigsten Fall zu einer sicheren Bindung führen (vgl. Brisch 2011; Mehta und Binder 2012). Entsprechend dem psychoanalytischen Modell der Depression verstärken die Bindungsstörung und die erlernte Hilflosigkeit des Patienten die Depression und begünstigen das Auftreten depressiver Regression (vgl. Matakas et al. 2005; Seligmann 1974). Depressive Erkrankungen 29 Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie hat die familiären Faktoren, die entsprechend dem Bindungskonzept von Bowlby und Brisch das Bindungsverhalten des Kindes beeinträchtigen und zur Entstehung späterer psychiatrischer Erkrankungen führen (vgl. Brisch 2011), als störungsrelevante Rahmenbedingungen in die Leitlinie der schweren depressiven Störungen im Kindes- und Jugendalter aufgenommen, was deren Relevanz für die Entwicklung einer Psychopathologie sowohl im Erwachsenen- als auch im Kindesalter unterstreicht. Zu diesen Faktoren zählen (vgl. Blanz et al. 2007): das Auftreten depressiver und bipolar affektiver Störungen in der Familie, das Auftreten anderer Psychopathologien (Angststörungen, Psychosen, Persönlichkeitsstörungen, Substanzmissbrauch) in der Familie, das Vorliegen psychosozialer Stressoren in der Familie (Flucht, Migration, chronische Erkrankungen, Arbeitslosigkeit, Armut), divergente Therapieerwartungen und Störungskonzepte innerhalb der Bezugspersonen und das Vorkommen von Interaktions- und Beziehungsstörungen in der Familie (emotionale Deprivation, inkonsistenter abwertender Erziehungsstil, Schuldzuweisungen gegenüber dem Kind, inkonstantes Bezugsklima mit häufigem Wechsel der Bezugsperson, psychische seelische und physische Traumata). Die bindungstheoretischen Grundlagen nehmen des Weiteren auch Einfluss auf die später geschilderte Resilienz. Insbesondere die Qualität der Bezugspersonen im Kindesalter hat Einfluss auf die späteren Bindungsmuster und die damit verbundenen Störungen des Erwachsenen. Anhand dieser sowohl primären als auch sekundären frühen Bindungspersonen entwickelt das Individuum eine innere Leitlinie, die ihm hilft, sich in aktuellen Situationen zurechtzufinden und Lösungskonzepte entwickeln zu können. Dabei muss die Bindung im Kindesalter folgende Aspekte beinhalten, damit die Kinder als Erwachsene ein gesundes Bindungsmuster internalisiert haben (vgl. Sit 2012): das Kind benötigt eine stabile, emotional-positive Beziehung zu mindestens einer Bezugsperson, es bedarf eines von Wertschätzung und Akzeptanz geprägten Erziehungsstils, der unterstützend und strukturierend wirkt, Depressive Erkrankungen 30 neben der primären Bezugsperson braucht das Kind kompetente und fürsorgliche außerfamiliäre sekundäre Bezugspersonen im Sinn positiver Rollenmodelle, es muss sekundäre außerfamiliäre Bezugspersonen geben, die das Kind ermutigen und ihm helfen, Krisen zu meistern, das Kind braucht positive Kontakte zu Gleichaltrigen im Sinne von Freundschaften und es bedarf eines wertschätzenden Klimas in der jeweiligen Bildungseinrichtung (Schule, Kindergarten etc.). Mit der Resilienz des Kindes ist dessen Vulnerabilität verbunden, welche den Ausgangspunkt der oben beschriebenen Entwicklungen darstellt und von King (2015) sowohl als „grundlegende Dimension (als auch als) Folge der leiblichen und psychischen Bedrüftigkeit“ (King 2015, S. 25) des Kindes ab dem Zeitpunkt seiner Geburt bezeichnet wird. Aufgrund dieser Vulnerablität können zahlreiche Ereignisse zu Störungen in der Persönlichkeitsentwicklung und zur Ausbildung von psychischen Erkrankungen im Erwachsenenalter führen. Dabei handelt es sich nicht nur um Traumata auf dem Boden von Misshandlungen und der verschiedenen Missbrauchsformen. Vielmehr sind es auch defizitäre Bindungsmuster zu den primären Bezugspersonen oder Lebensereignisse wie die Trennung der Eltern oder der Tod eines Elternteils, die zu Entwicklungsstörungen führen (Schore zitiert in Sachsse 2003; StreeckFischer 2010). Vor diesem Hintergrund kam es zur Etablierung der Terminologie des Mikrotraumas, dessen epigenetische Veränderungen zum einen Erkrankungen wie die traumatogene Depression begünstigen und hervorrufen können und sich zum anderen von Generation zu Generation im Sinn einer genetischen transgenerationalen Weitergabe fortsetzen (Böker et al. 2015; Binder und Holsboer 2012). Nach Binder und Holsboer (2012) sind hier vor allem Schäden der Methylinisierung der DNA und der Azetylierung der Histone ausschlaggbend, die sowohl die Expression als auch die phänotypische Funktion einzelner Gene behindern (Zannas et al. 2015). Dies wird umso bedeutungsamer als dass die mikrotraumabedingten neuronalen Veränderungen zu direkten Veränderungen der Hirnegionen führen, die u.a. für die Stressbewältigung verantwortlich sind (Sachsse 2003; Binder und Holsboer 2012). So führen Bindungs- und Beziehungstraumata beim Säugling zu einer unzureichenden Entwicklung des corticolimbischen Systems, die zudem durch eine zu hohe und damit neurotoxische Konzentration von Neurotransmittern wie Glutamat und Cortisol forciert wird (Sachsse 2003). Diese mikrotraumaassoziierte Störung der Hirnbiochemie führt wiederum zu einer Depressive Erkrankungen 31 Synapsenelimination, welche die Vernetzungsdichte im Gehirn reduziert und Entwicklungsstörungen verursacht (Sachsse 2003). Je früher die Bindungstrauma bzw. Bindungsstörungen beim Säugling und Kleinkind auftreten, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit sich auf genetischer Ebene ausbildender Mikrotraumata, was nach Zannas und Kollegen (2015) auf die hohe Sensitivität dieser biografischen Entwicklungsphase bzgl. der Entwicklung von Genen und Hirnstrukturen, welche bei Störungen Erkrankungen wie PTBS oder Depression hervorrufen können. Zu diesen Ergebnissen kamen auch Provencal und Binder (2015a) in ihrer Metaanalyse aus dem Jahr 2015, in welcher sie die Rolle des Stresses in der frühen und frühesten Lebensphase in der späteren Ausbildung psychiatrischer Erkrankungen aufgrund von Veränderungen im Epigenom untersuchten. Dabei unterteilen Provencal und Binder (2015b) die Auswirkungen der Stressoren in der frühkindlichen Phase in globale und spezifische Veränderungen. Während sich die globalen Veränderungen auf makroanatomischer Ebene in den Hirnstrukturen zeigen, verdeutlichen die spezifischen Veränderungen die oben beschriebenen epigenetischen Veränderungen (Provencal und Binder 2015b). Aufgrund der Wechselwirkungen von Genen und Umwelt, können Mikrotraumata bereits beim Foetus entstehen (Provencal und Binder 2015b; Klengel und Binder 2015). Neben den oben bereits beschriebenen epigenetischen Veränderungen wurden zudem genetische Polymorphismen (single nucleotid polymorphism, kurz SNP) identifiziert, welche den depressiogenen und anxiogenen Effekt von Traumata im frühen und frühesten Kindesalter modifizieren (Nemeroff und Binder 2014; Arloth et al. 2015). Zu diesen Polymorphismen gehört u.a. der Polymorphismus des CRF R1Rezeptors, der angestossen durch ein frühkindliches Bindungstrauma die Inzidenz für Depressionen und Suizide im Erwachsenenalter signifikant erhöht (Nemeroff und Binder 2014). Darüber hinaus können epigenetische Veränderungen aufgrund eines frühkindlichen Traumas gleich welchen Ausmaßes die Expression und Funktion von Genen beeinflussen ohne dass es dazu zu Veränderungen der DNA-Sequenz kommen muss. Folglich stellen sich die frühkindlichen Bindungsstörungen als hochkomplexe Mikrotraumata dar, welche nachweislich neben traumaassoziierten Störungen auch zu Erkrankungen wie Depressionen und Persönlichkeitsstörungen im Erwachsenenalter führen können (Nemeroff und Binder 2014; Arloth et al. 2015; Klengel und Binder 2015). Diese Abhängigkeit der Persönlichkeit von den Beziehungen und Bindungsmustern in der frühkindlichen und kindlichen Lebensphase fließt in die psychodynamische und psychoanalytische Psychiatrie ein (Böker et al. 2015). Zumal sich beide eignen, um die unverarbeiteten Depressive Erkrankungen 32 und unbewältigten frühkindlichen Bindungstrama bei Depressionspatienten zu eruieren und therapieren zu können (Subic-Wrana et al. 2011). Patientenparameter 33 3 Patientenparameter Das subjektive Erleben der Behandlung durch den einzelnen Patienten hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Vornehmlich hat dies zwei Gründe: Zum einen wird durch die Notwendigkeit von qualitätssichernden Maßnahmen in Krankenhäusern die Forderung nach objektivierbaren Daten, die den Nutzen der jeweiligen Einrichtung belegen, lauter, zum anderen befindet sich auch das Arzt-Patienten-Verhältnis im Wandel hin zu einem deutlich partnerschaftlicheren Verhältnis. Dies bedeutet, dass die subjektive Auffassung des Patienten eine immer größere Rolle spielt, da er als Partner in einem Wechselspiel, nicht mehr bloß als passives Behandlungsobjekt gesehen wird. 3.1 Alltagskompetenz Alltagskompetenz beschreibt die Fähigkeit des Erwachsenen, alle an ihn gestellten und sich aus seinem soziokulturellen Umfeld ergebenden Aufgaben selbstständig, eigenverantwortlich und unabhängig zu erledigen (vgl. MDK 2014). Sie ist ein wichtiger Patientenparameter, der bestimmt, inwieweit sowohl der Patient als auch der Gesunde seinen Alltag selbstständig managen kann. Auf dem Hintergrund der depressiven Störungen umfassen die Alltagskompetenzen neben der Erfüllung der häuslichen Aufgaben auch die Erfüllung der beruflichen Aufgaben sowie der Aufgaben, die sich aus der gesellschaftlichen Stellung des Patienten ergeben. Je nach Schweregrad der Depression ist die Alltagskompetenz mehr oder minder stark reduziert. Die Betroffenen sind in der Regel nicht in der Lage, ihrem Beruf nachzugehen und den Haushaltspflichten nachzukommen. Dazu haben sie mitunter ausgeprägte Schwierigkeiten in der Selbstfürsorge, was die Körperhygiene und die Nahrungszufuhr angeht. Bei lang anhaltenden schweren depressiven Episoden ist die Tendenz zur Verwahrlosung gegeben. 3.2 Patientenzufriedenheit In seiner Theorie des sozialen Vergleiches beschrieb Festinger bereits 1954 (vgl. Festinger 1954) das Bedürfnis von Menschen, im Zusammenleben sich selbst im Vergleich zu anderen zu bewerten. Sie sind zufrieden, wenn ihre Leistung ihr Anspruchsniveau erreicht hat und unzufrieden, wenn ihre Leistungen darunter liegen. Patientenparameter 34 Linde postuliert, dass die Zufriedenheit von der „Setzung eines positionsspezifischen Maßstabs der Lebensbedürfnisse determiniert ist“ (Linde 1967, S. 43). Dieser ist kein objektives Kriterium, sondern abhängig von den Erwartungen und der sozialen Position des Individuums. Hierbei können Probleme auftreten, da es außer den objektiven Qualitäten noch andere Einflussfaktoren auf das Konstrukt Zufriedenheit gibt. So ist bekannt, dass das individuelle Anspruchsniveau von Faktoren wie Alter, sozialer Status und Bildungsstand abhängt (vgl. Dreier 1999; Wütherich-Schneider 1998). Auch hat der Bildungsabschluss einen großen Einfluss auf das Anspruchsniveau der Patienten. Patienten mit höherem Bildungsabschluss sind eher geneigt, sich kritisch zu äußern. Der Abstand des sozialen Status zwischen Arzt und Patient spielt hier ebenfalls eine Rolle. Je größer der Statusunterschied zwischen Arzt und Patient ist, desto höher die Zufriedenheit des Patienten. Dieses Phänomen wird mit den höheren Erwartungen oberer sozialer Schichten an die Standards sozialer Dienstleistungen begründet. Auch haben Angehörige oberer Schichten eher das Gefühl, mit dem Äußern von Kritik einen unangenehmen Zustand ändern zu können, während Angehörige unterer Schichten sich mit dem Status quo eher zufriedengeben. In einer weiteren Studie untersuchte Wütherich-Schneider die Abhängigkeit von Alter und Geschlecht des behandelnden Arztes. Hier wurde deutlich, dass Ärztinnen mit niedrigeren Zufriedenheitswerten beurteilt wurden als ihre männlichen Kollegen und jüngere Ärzte weniger zufriedene Patienten hatten als ältere (vgl. Wütherich-Schneider 1998). Auch das Anspruchsniveau, auf dessen Erfüllung sich die Zufriedenheit abbildet, unterscheidet sich. Schon im Jahr 1976 entwickelte Campbell die Theorie von angepassten Anspruchsniveaus. Laut Campbell spiegelt sich die subjektive Zufriedenheit einer Person in der Differenz zwischen ihrem Anspruchsniveau und ihrer wahrgenommenen Situation wider. Das Anspruchsniveau wiederum passt sich immer den objektiven Gegebenheiten an. So passen sich die subjektiven Ansprüche immer auch langfristig an die objektiven Gegebenheiten des Systems an, und zwar so lange, bis sich beide wieder im Gleichgewicht befinden (vgl. Campbel 1976). Ein weiteres Modell von Zufriedenheit wurde im Rahmen der Arbeitszufriedenheitsforschung von Bruggemann (1974) entwickelt. Das Modell setzt voraus, dass vielfältige Formen von Zufriedenheit existieren, die aus verschiedenen psychischen Verarbeitungsmechanismen resultieren, welchen Soll-Ist-Differenzen zugrunde liegen. Entsprechend des von Bruggemann (1974) entwickelten Modells können die progressive, stabilisierte Arbeitszufriedenheit (tat- Patientenparameter 35 sächlich zufriedene Personen), die resignative Arbeitszufriedenheit (Unzufriedene, die entgegen ihrem tatsächlichen Empfinden angeben, dass sie zufrieden seien) und die fixierte Unzufriedenheit (die wirklich Unzufriedenen, die die auch auf Nachfrage artikulieren) voneinander unterschieden werden. Dabei stellt die Gruppe der resigniert Zufriedenen immer eine große Gruppe dar, da sie ihr Anspruchniveau mit der Zeit erheblich reduzieren. Es ist auch diskutiert worden, ob die Lebenszufriedenheit mit der Patientenzufriedenheit korreliert. Eine hohe Patientenzufriedenheit kann zu einer Verbesserung der Lebensumstände beitragen und so eine Lebenszufriedenheit erhöhen. Aber auch eine hohe Lebenszufriedenheit kann optimale therapeutische Rahmenbedingungen schaffen, in denen eine bessere Behandlungsqualität erreicht wird (vgl. Tomozei 2006). Im Jahr 2000 führte Fahrenberg eine Studie zur Lebenszufriedenheit in der Bevölkerung durch, in der die Einflüsse soziodemografischer Faktoren auf die Lebenszufriedenheit gemessen wurden. Tendenziell ergab sich hier, dass ältere Menschen etwas zufriedener waren als jüngere und Menschen in festen Partnerschaften ein höheres Maß an Zufriedenheit angaben als Alleinstehende. Weitere Korrelate der Lebenszufriedenheit sind Neurotizismus und Depressivität (vgl. Fahrenberg et al. 1989). Ob die Lebenszufriedenheit und die Patientenzufriedenheit tatsächlich korreliert sind, bleibt fraglich, die Studien kommen hier zu widersprüchlichen Ergebnissen. In den älteren Studien (vgl. Berger 1983; Le Vois et al. 1981; Roberts & Fitzpatrick 1994) fand sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen Lebenszufriedenheit und Patientenzufriedenheit. Neuere Studien berichten von einer schwachen Korrelation beider Werte (vgl. Holloway & Carson 1999). Psychiatrische Patienten im Allgemeinen und darunter depressiv erkrankte Patienten im Besonderen leiden unter einer besonders niedrigen Lebenszufriedenheit, doch weisen sie in Studien eine hohe Patientenzufriedenheit auf (vgl. Koivumaa-Honkanan et al. 1996). Auch Kelstrup et al. (1993), Barker et al. (1996) und Hoff et al. (1999) sahen einen signifikanten Zusammenhang zwischen Diagnose und Patientenzufriedenheit. Die Patienten mit den Diagnosen aus dem depressiven Formenkreis wiesen eine durchschnittlich höhere Patientenzufriedenheit auf als Patienten mit nicht affektiven Psychosen. Die weitgehende Kritiklosigkeit könnte ein Hinweis auf mangelnde Missstände sein, dann wäre jedoch nicht zu erklären, warum Patienten gleicher Institutionen mit anderen Diagnosen unzufriedener sind. Viel wahrscheinlicher ist die besondere Situation depressiv Erkrankter, die sich gegenüber Ärzten unterlegen und abhängig fühlen und sich gegenüber diesen als übermächtig erlebten Personen nicht kritisch zeigen wollen. Patientenparameter 36 Neugebauer und Porst (2001) weisen darauf hin, dass es für den Patienten um eine KostenNutzen-Analyse geht, in der Unannehmlichkeiten zur Erreichung eines Behandlungszieles akzeptabel sind. Die Gefahr sehen sie darin, dass der Patient unter sonst gleichen Bedingungen mit der Leistungserbringung umso zufriedener wird, je mehr er das eigene Anspruchsniveau relativiert und je mehr er zu sozial erwünschtem Verhalten tendiert. Auch dies ist eine mögliche Erklärung für das unterschiedliche Antwortverhalten von depressiven Patienten bei Patientenzufriedenheitserhebungen. Heutzutage geht der größte Anreiz zur Erforschung von Patientenzufriedenheit sicherlich von der Verpflichtung der Leistungserbringer zur Qualitätssicherung im Gesundheitswesen aus. Der Gesetzgeber fordert im SGB V § 135-139 die Leistungserbringer auf, sich der „Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der von ihnen erbrachten Leistungen zu verpflichten.“ In den ausführenden Regelungen heißt es weiter, dass sich alle Leistungsanbieter an Maßnahmen zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität beteiligen müssen. So finden in den meisten Krankenhäusern Methoden des Qualitätsmanagements (QM) Anwendung. Dem Patienten soll aus der Behandlung ein größtmöglicher Nutzen erwachsen. Zu diesen Nutzenserwägungen gehört als einer der wichtigsten Parameter die Zufriedenheit der Patienten mit der Einrichtung. Donabedian, dem Begründer der Qualitätsforschung im Gesundheitswesen, ist es zu verdanken, dass die Qualitätsdimension um zwischenmenschliche Beziehungen und Beziehungskontinuität erweitert wurde. Donabedian (1980) unterscheidet drei Dimensionen der Qualität: Strukturqualität, Prozessqualität und Ergebnisqualität. Als Strukturqualität bezeichnet er die Behandlungsbedingungen, die ein Patient vorfindet (d. h. die räumliche Ausstattung, aber auch die Ausstattung mit Personal sowie deren Qualifikation). Die Prozessqualität umfasst die Qualität der diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen (so z. B. die Einhaltung von Behandlungsleitlinien). Die Ergebnisqualität wiederum erfasst die erreichten Behandlungsergebnisse, die Besserung der Symptomatik und das subjektive Wohlbefinden. Es gibt noch eine weitere Entwicklung, die mit der Veränderung der Rollenvorstellungen des Arztberufes zu tun haben: „Die Patienten sind erwachsen geworden, es gibt keinen Weg zurück. (…) Paternalismus ist endemisch (...) und auch wenn er gut gemeint sein mag, schafft und erhält er doch eine ungesunde Abhängigkeit, die mit anderen Strömungen in der Gesellschaft nicht mehr im Einklang steht.“ (Coulter et al. 1999, S. 719) So hat das subjektive Erleben der Behandlung durch den einzelnen Patienten in den letzten Jahren an Bedeutung hinzugewonnen. Nicht nur im Rahmen des Qualitätsmanagements, son- Patientenparameter 37 dern auch in der Diskussion um Freiheits- bzw. Selbstbestimmungsrechte rückt der Patient mit seinen Erwartungen und Bedürfnissen in den Vordergrund. Dies ist auch vor dem Hintergrund des Paradigmenwechsels von einer institutionenzentrierten hin zu einer personenzentrierten Behandlung zu sehen (vgl. Kunze 2007). So hat sich auch die Rolle des Patienten, insbesondere in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung gewandelt. Immer mehr Ärzte verlassen ihren angestammten Platz als allwissende Instanz und ziehen vermehrt eine Rolle als Partner im Arzt-Patienten-Verhältnis vor. So wird wechselseitiges Vertrauen ein wichtiger Parameter im Arzt-Patienten-Verhältnis (vgl. Hall 2002). Aus diesem Grund wurden in dieser Arbeit sowohl die nur 18 Items umfassenden Fragebögen zur Patientenzufriedenheit (MFPB-18) mit ihren beiden objektiven Faktoren „Gesamtzufriedenheit mit der Therapie“ und „Persönlicher Nutzen“ eingesetzt als auch detaillierte Fragen zu einzelnen Behandlungseinheiten zusammengestellt. Auch die detaillierte Aufklärung der Patienten mit dem Überreichen eines verschlossenen Umschlages mit einer für den Therapeuten nicht ersichtlichen Nummernzuweisung soll hier Verzerrungen in Richtung sozialer Erwünschtheit der Antworten minimieren. Die Katamneseerhebung mit der dann messbaren Veränderung des Grades der depressiven Verstimmung und der sozialen Integration gibt Aufschlüsse über die dauerhafte Änderung der objektiven Lebensumstände der Patienten. Eine Änderung der täglichen Lebenswelt in den Bereichen Arbeit, Freizeit, Verwandte, Partnerschaft, Eltern, Familienzusammenhalt und Finanzen bedeutet den objektiven Niederschlag des Behandlungserfolges. Es ist keineswegs einfach, die Patientenzufriedenheit als gegebene Größe in einer „Zufriedenheitsskala“ abzubilden. Bei Befragungen von Personen zur Patientenzufriedenheit werden zwei Annahmen vorausgesetzt, um die Antworten sinnvoll im Rahmen des Qualitätsmanagements zu berücksichtigen und um die Patientenzufriedenheit für einen reliablen Qualitätsindikator halten zu können (vgl. Tomozei 2006): 1. Es muss angenommen werden, dass eine nach objektiven Maßstäben gute Realität auch so empfunden wird und dementsprechend bei Patienten Zufriedenheit produziert. 2. Zum anderen muss angenommen werden, dass die Zufriedenheitsangaben tatsächlich auf die subjektive Zufriedenheit der Patienten schließen lassen. Patientenparameter 38 3.3 Lebensqualität Lebensqualität wird in der Psychiatrie unterschiedlich definiert, je nachdem, welches Konzept ihr zugrunde gelegt wird. Mattejat und Kollegen unterteilen sie beispielsweise in die Lebensqualität im engeren Sinn und die Lebensqualität im weiteren Sinn (vgl. Mattejat & Remschmidt 1998). Hierbei beschreibt die Lebensqualität im engeren Sinn die objektive Handlungs- und Funktionsfähigkeit und das subjektive Wohlbefinden bzw. die subjektive Zufriedenheit (vgl. Mattejat & Remschmidt 1998). Bestimmt wird die Handlungs- und Funktionsfähigkeit durch das Funktionsniveau und die objektive Leistungsfähigkeit (vgl. Mattejat & Remschmidt 1998). Die subjektive Zufriedenheit umfasst im Konzept von Mattejat die Zufriedenheit mit der eigenen körperlichen Verfassung, der seelischen Verfassung, der Lebensführung und der Lebenssituation (vgl. Mattejat & Remschmidt 1998). Daraus ergibt sich, dass sich die Lebensqualität im engeren Sinn in eine objektive (Handlungs- und Funktionsfähigkeit) und eine subjektive Lebensqualität (Wohlbefinden und Zufriedenheit) unterscheidet. Die Lebensqualität im weiteren Sinn enthält anschließend die Voraussetzungen und Bedingungen, welche die eigentliche Lebensqualität beeinflussen. Zu diesen Faktoren gehören der sozioökonomische Status, das psychosoziale Umfeld, Erkrankungen und Behinderungen sowie medizinische Behandlungen (vgl. Mattejat & Remschmidt 1998). Damit zeigt sich die Komplexität hinter dem Begriff der Lebensqualität, die in entsprechenden Testverfahren erfasst und abgebildet werden muss. Dabei wird das objektive Funktionsniveau am besten durch einen außenstehenden Beobachter evaluiert, während Wohlbefinden und Zufriedenheit am besten durch Reflexion des Patienten selbst evaluiert werden können. Daneben gibt es Konzepte, die die Lebensqualität bestimmter Patientenkollektive beschreiben. So entwickelten Lawton und Kollegen ein vierdimensionales Modell zur Erfassung der Lebensqualität bei Demenzkranken, das sich aus den Dimensionen subjektives Wohlbefinden, objektive Umwelt, Verhaltenskompetenz und erlebte Lebensqualität zusammensetzt (vgl. Lawton et al. 1996). 3.4 Symptomveränderung Symptomveränderung bedeutet, dass im Verlauf einer depressiven Störung die Symptome des Patienten variieren. Diese Veränderung kann sich auch unabhängig davon, ob eine Therapie durchgeführt wird oder nicht ereignen. So kann sich das Symptombild eines Patienten von einer depressiven Störung über die Manie zu einer bipolaren Störung entwickeln. Patientenparameter 39 Wird der Patient behandelt, so dient die Symptomveränderung als Kriterium der Beurteilung der Therapie und des Behandlungserfolges. Mithilfe einer Korrelationsanalyse kann ein möglicher Zusammenhang zwischen dem Behandlungserfolg und der Symptomveränderung untersucht werden. Diagnostische Messinstrumente in der Psychiatrie 40 4 Diagnostische Messinstrumente in der Psychiatrie Im folgenden Kapitel sollen die einzelnen diagnostischen Messinstrumente in der Psychiatrie näher erläutert werden. 4.1 Variablen in der operationalen Diagnostik Die operationale Diagnostik wird durch die zwei Faktoren Reliabilität und Konsistenz determiniert. 4.1.1 Reliabilität Im Rahmen der Messinstrumente stellt die Reliabilität ein Gütekriterium dar, welches angibt, „inwieweit Messergebnisse, die unter gleichen Bedingungen mit identischen Messverfahren erzielt werden (z. B. bei Wiederholungsmessungen), übereinstimmen“ (Wübbenhorst 2014, Onlinequelle). 4.1.2 Konsistenz Die Konsistenz eines Verfahrens beschreibt seine Widerspruchsfreiheit. Das bedeutet, dass sich aus einem konsistenten Verfahren kein Widerspruch aus den Ergebnissen ableiten lässt (vgl. Lehmann 2014). Die Grundlage der Konsistenz bildet die Logik einer Aussage bzw. eines Messverfahrens. Dabei kann die Logik, die auch als Aussagelogik bezeichnet wird, in verschiedenen Argumentationsmodi auftreten. 4.2 Messinstrumente zur Erfassung der Lebensqualität Bei Kindern und Jugendlichen wird das Inventar zur Erfassung der Lebensqualität, kurz ILK, herangezogen (vgl. Mattejat & Remschmidt 1998). Grundlage dieses Messinstrumentes bildete die Notwendigkeit, die Lebensqualität von der eigentlichen psychischen Störung getrennt erfassen zu wollen (vgl. Mattejat & Remschmidt 1998). Ähnliches wird mit dem Global Assessment of Functioning und der Achse IV des multiaxialen Klassifikationsschemas für psychiatrische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter erreicht (vgl. Remschmidt & Schmidt 1994). In allen drei Testverfahren wird das Funktionsniveau, welches als Maßstab der Lebensqualität erfasst wird, unabhängig der psychischen Störung erfasst. Diagnostische Messinstrumente in der Psychiatrie 41 In Analogie zur Erfassung der Lebensqualität bei Kindern gibt es spezifische Erfassungsbögen auch für andere Erkrankungen, wie beispielsweise für die Erfassung der Lebensqualität bei Demenzerkrankten, mithilfe des Heidelberger Instrumentes zur Erfassung von Lebensqualität bei Demenz (vgl. Becker et al. 2005). 4.3 Messinstrument zur Erfassung der sozialen Integration Messinstrumente zur Erfassung der sozialen Integration unterliegen zumeist der individuellen Konzeption, die auf der Fragestellung basiert, welche Individuen im Hinblick auf welchen Integrationsbereich untersucht werden sollen. Für die Erfassung der sozialen Integration von Schülern steht beispielsweise der FEESS 3-4 als Messinstrument zur Verfügung. Der SASSR-Fragebogen dient der Feststellung der sozialen Integration. Erfasst wird damit die Fähigkeit eines Individuums zur Übernahme instrumenteller und expressiver Rollen nach Parsons und Bales (1955). Daneben dient die Erfassung der Akkulturationsorientierung als Skala Akkulturationseinstellung u. a. dazu, die kulturelle Identität in Verbindung mit intergruppalen Kontakten zu erfassen (vgl. Babioch 2007). Eine ähnliche Erhebung kann mittels der Cultural Orientation Scale (COS) erfolgen (vgl. Babioch 2007). Ergänzt wird dies durch eine Vielzahl deskriptiver Erfassungen, die, ebenfalls individuell konzipiert, gesellschaftliche Werte, die Einstellung des Patienten zu diesen verbunden mit der Einbettung des Patienten in den gesellschaftlichen Kontext bzw. in sein gesellschaftliches Umfeld evaluieren (vgl. Babioch 2007). Zusätzlich können Messinstrumente, die die Zufriedenheit und die instrumentellen Werte des Patienten erfassen, Rückschlüsse auf seine soziale Integration bzw. auf mögliche Ursachen einer sozialen Desintegration aufzeigen. Zieht man die soziale Isolation als Faktor einer misslungenen sozialen Integration heran, so kann zur Erfassung der sozialen Integration im weitesten Sinn auch der BDI herangezogen werden, der die soziale Isolation als Item abfragt (vgl. Beck et al. 1987). Diagnostische Messinstrumente in der Psychiatrie 42 4.4 Messinstrumente zur Erfassung der Depression Die Messinstrumente zur Erfassung der Depression erfassen sowohl Fremd- als auch Selbsteinschätzungsinstrumente. Ihre Anwendung richtet sich nach der Präferenz des Untersuchers und den individuellen Bedürfnissen des Patienten (vgl. Ihle et al. 2012). Das „Strukturierte Klinische Interview für DSM-IV Achse I“, kurz SKID-I, gilt als Basisinstrument, mit dem alle Achse-I-Störungen und damit die Komorbiditäten und Differenzialdiagnosen der depressiven Störungen evaluiert werden können (vgl. Ihle et al. 2012). Es basiert auf einer zweistufigen sich aus 12 Screeningfragen und spezifischen Items zusammensetzenden Methode. Der Nachteil dieses Verfahrens liegt in seinem zeitlichen Umfang. Ähnlich funktioniert der IDCL (Internationale Diagnosen Checklisten für ICD-10 und DSM-IV) als Basisinstrument ohne Depressionsspezifität (vgl. Ihle et al. 2012). Depressionsspezifisch ist die Hamilton-Depressionsskala (HAMD) aus dem Jahr 1986 als Fremdbeurteilungsinstrument, dem ein halbstrukturiertes Interview zugrunde liegt (vgl. Ihle et al. 2012). Ähnlich, jedoch mit weniger Fragen zeitökonomischer, funktioniert die Montgomery-Asberg-Depressionsskala (MADRS). Als Selbsteinschätzungsinstrument hat sich der Beck-Depressionsinventar (BDI) bewährt (vgl. Beck et al. 1987). Daneben existiert die Allgemeine Depressionsskala (ADS), die die Beeinträchtigung durch spezifische depressive Symptome wie depressive Affekte, körperliche Beschwerden, motorische Hemmung und negative Denkmuster evaluiert (vgl. Ihle et al. 2012). Als Kurz- oder Langversion widmet sie sich insbesondere den Symptomen Verunsicherung, Erschöpfung, Rückzug, Angst, Antriebslosigkeit, Einsamkeit, Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, Selbstabwertung und Niedergeschlagenheit bezogen auf die zurückliegenden sieben Tage und erhebt deren Häufigkeit (vgl. Ihle et al. 2012). Damit unterscheidet sich die ADS vom BDI, das die Beschwerdeintensität untersucht. Weitere etablierte Messinstrumente zur Erfassung und Beurteilung der Depression sind das DSI (Depressionsstatusinventar), BRMS (Bech-Rafaelsen-Melancholie-Skala), die BRMAS, die GDS (Geriatrische Depressionsskala nach Yesavage et al.), die SDS (SelbstbeurteilungsDepressionsskala), die DSN (Diagnostische Depressionsskala Newcastle) und die HADS-D (Hospital Anxiety and Depression Scale – Deutsche Version). Zur Diagnostik der depressiven Störung im Kindes-und Jugendalter stehen zudem auf das entsprechende Alter des Kindes adaptierte Testverfahren zur Verfügung. Hierzu gehören u. a. der „Thematische Gestaltungs-Test-Salzbuger (TGT), der Children’s Apperzeptionstest Diagnostische Messinstrumente in der Psychiatrie 43 (CAT), der Schwarzfuß-Test, das Depressions-Inventar für Kinder- und Jugendliche (DIKJ), der Depressions-Test für Kinder (DTK), der Attributionsstil-Fragebogen (ASF) und zur Verlaufskontrolle die Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRS)“ (Blanz et al. 2007, S. 4). Daneben sollten die Achsen II bis VI in die Diagnostik einbezogen werden (vgl. Blanz et al. 2007). 4.5 Messinstrumente im Vergleich Nachfolgend sind die in der vorliegenden Studie verwendeten Messinstrumente dargestellt. 4.5.1 BDI-II Der BDI dient der Erfassung des Vorhandenseins sowie der Schwere depressiver Symptome innerhalb der zurückliegenden sieben Tage (vgl. Ihle et al. 2012). Dafür wurden die Hauptsymptome der Depression in 21 Items zusammengefasst, die u. a. die Frage nach Pessimismus, trauriger Verstimmtheit, Weinen, Reizbarkeit und sozialem Rückzug beinhalten. Der sich aus der Beantwortung der Items ergebende Score ermöglicht die Einteilung des Patienten anhand von Cut-off- und Normwerten (vgl. Ihle et al. 2012). Die Vorteile des BDI-II gegenüber anderen Testverfahren liegen in seiner raschen Durchführbarkeit (Zeitökonomie), seiner schnellen Auswertung, seiner hohen Reliabilität und dem hohen Forschungsstand zu diesem Testverfahren. Die Reliabilität des BDI-II wird in Form interner Konsistenzen (Cronbachs Alpha) berichtet und liegt je nach Stichprobe zwischen 0,89 und 0,93. Die auf Basis des Partial-Credit-Modells berechnete Reliabilität in der Stichprobe depressiver Patienten wird mit 0,92 angegeben. Für die Gesunden liegen die Reliabilitäten bei 0,80 bzw. 0,82. Für die IRT-Analysen fehlt die Angabe des Standardmessfehlers. Die Retestreliabilität beträgt für Gesunde sowohl über drei Wochen als auch über fünf Monate 0,78 und ist damit als hinreichend stabil anzusehen. Erwartungsgemäß liegt die Retestreliabilität für behandelte Patienten niedriger (0,46) (vgl. Herzberg et al. 2008). 4.5.2 SASSR Der SASSR-Fragebogen dient der Feststellung der sozialen Integration. Erfasst wird damit die Fähigkeit eines Individuums zur Übernahme instrumenteller und expressiver Rollen nach Par- Diagnostische Messinstrumente in der Psychiatrie 44 sons und Bales (1955). Eine Person, die als sozial integriert gilt, erfüllt folgende Voraussetzungen: Sie erfüllt die an sie gestellten, instrumentellen Aufgaben (Erfüllung der Arbeitsaufgaben, aktive Teilnahme am Sozial- und Familienleben) mit selbst produziertem Wohlbefinden und bewältigt den gefühlsmäßigem Austausch mit den Mitmenschen in sozial angemessener Weise. Soziale Integration kann in verschiedenen Lebensbereichen unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Aus diesem Grund sollte sie daher getrennt für jeden Lebensbereich erhoben werden. Im Verfahren werden die Bereiche Arbeit (unterteilt in Berufstätige, Hausfrauen und -männer, Schüler und Studenten), Freizeit und Soziales, Verwandte, Partnerschaft, Eltern, familiärer Zusammenhalt sowie Finanzen erfasst. Dabei können die Items in die Kategorien Ausführung des Verhaltens, zwischenmenschliche Beziehungen, Spannungen sowie Gefühle und Befriedigung unterteilt werden. 4.5.3 MFPB-18 Die Patientenzufriedenheit wird mit dem Fragebogen MFPB-18 erhoben. Dieser Fragebogen wurde 2010 von Fr. P. Decker in München entwickelt. In besonderem Maß berücksichtigt der MFPB-18 die Wichtigkeit, mit der die Zielbestimmung in der psychotherapeutischen Behandlung in Abstimmung mit den Zielen des Patienten und nicht nur des Therapeuten erfolgt (vgl. Decker 2010). 4.5.4 Sonstige Messinstrumente Andere Fragebögen wie der ZUF 8, die deutsche Adaptation des Client Satisfaction Questionnaire (CSQ) von Attkinson und Zwick (1982), der KAPP – Karolinska Psychodynamic Profile – von Weinryb und Rössel (1991) oder der HAQ (Penn Helping Alliance Questionnaire) nach Alexander und Luborsky (1986) umfassen nur Teilaspekte der Psychotherapie. So ist der ZUF-8 mit seinen globalen Beurteilungen wenig trennscharf. Demgegenüber misst der KAPP-8 den Zusammenhang zwischen mentalen Funktionen und Charaktereigenschaften, die die Erfolgszufriedenheit des Patienten bestimmen. Situation der Tageskliniken in Deutschland 45 5 Situation der Tageskliniken in Deutschland Nachfolgend soll die Situation der Tageskliniken in Deutschland beschrieben werden. 5.1 Verteilung der Tageskliniken in Deutschland Das Statistische Bundesamt gibt in einer Übersicht die Anzahl der Tageskliniken wieder, die Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen betreuen (vgl. Statistisches Bundesamt 2011). In dieser Statistik muss jedoch berücksichtigt werden, dass hier die Anzahl der Tages- und Nachtkliniken zusammengefasst und die Tageskliniken nicht nochmals gesondert aufgeführt werden. Dabei wird unterschieden nach Tageskliniken, die als reine Tages- bzw- Nachtkliniken fungieren, was nicht an Krankenhäusern angegliederten Tageskliniken entspricht, und Krankenhäusern (psychiatrisch, psychotherapeutisch und/oder neurologisch) mit Tageskliniken (vgl. Statistisches Bundesamt 2011). Demnach gibt es insgesamt 157 Krankenhäuser mit Tageskliniken, die eine Bettenzahl von 6.535 vorweisen, und 59 reine Tageskliniken, die insgesamt eine Bettenanzahl von 1.263 vorweisen (vgl. Statistisches Bundesamt 2011). Dabei zeigt die Aufschlüsselung der Kliniken mit Tagesklinikanschluss, dass Kliniken mit mehr als 500 Betten am wenigsten über eine Tagesklinik verfügen. Bei diesen Kliniken bestehen lediglich 4 Tageskliniken, die allerdings 380 Betten ausmachen. Krankenhäuser mit 200 bis 499 Betten haben in 66 Fällen eine Tagesklinik mit einer Gesamtbettenanzahl von 3.890. Unter den Krankenhäusern mit 100-199 Betten haben 50 Kliniken eine Tagesklinik, was 1.530 tagesklinische Plätze ausmacht. Von den Krankenhäusern mit maximal 99 Betten haben 37 Kliniken eine Tagesklinik und machen 735 Tagesklinikplätze aus (vgl. Statistisches Bundesamt 2011). 5.2 Aufenthaltsdauer in den Tageskliniken Die Aufenthaltsdauer in Tageskliniken variiert je nach individuellem Patienten. In der Regel sind die Patienten mindestens sechs Wochen in ein tagesklinisches Setting eingebunden (vgl. Seidler et al. 2005). 5.3 Tagesklinik mit psychotherapeutischem Setting Tageskliniken mit psychotherapeutischem Setting sind in Deutschland die Minderzahl. In der Regel verfahren die Tageskliniken nach psychiatrischem Setting. Die in dieser Arbeit vorge- Situation der Tageskliniken in Deutschland stellte Tagesklinik Alteburger Straße 46 (Köln) verfolgt einen psychiatrisch- psychotherapeutischen Ansatz. Insgesamt ist die Evidenzlage zur tagesklinisches Betreuung sowohl in der Psychiatrie allgemein als auch im Hinblick auf verschiedene spezifische Krankheitsbilder gering, obwohl sie in Deutschland eine starke Entwicklung zeigten und zeigen (vgl. Lang et al. 2015; Eikelmann 2010). Dabei stellen Tageskliniken „als Bindeglied zwischen stationärer und ambulanter Behandlung (...) ein wichtiges Element der gemeindepsychiatrischen Versorgung dar“ (Lang et al. 2015, S. 616). Um diesen Status beibehalten zu können bedarf es neuer transparenter Strukturen und definierter Aufgabenstellungen in den tagesklinischen Einrichtungen (vgl. Kallert et al. 2003). Die Strukturen der Tageskliniken in Deutschland variieren. So gibt es Tageskliniken als Station innerhalb eines Krankenhauses, Tageskliniken mit eigener Gebäudeeinheit aber einer Klinik angehörend, Tageskliniken unabhängig eines Krankenhauses oder Rehabilitationstageskliniken (vgl. Eikelmann 2010; Dohren & Münzer 2012). 5.3.1 Behandlungsansatz Während sich die Psychiatrie darauf beschränkt, Symptome eines Patienten zu minimieren, ohne zu evaluieren, welchen Nutzen diese für seine aktuelle Lebenssituation haben, bezieht der psychotherapeutische Ansatz der Tagesklinik die Symptome als Adaptation an die aktuelle Situation aus Krankheit und sozialem Umfeld ein (vgl. Matakas & Rohrbach 2006). Gerade bei Erkrankungen, denen eine Beziehungsstörung zugrunde liegt, wie es auch bei einem Teil der depressiven Patienten der Fall ist, sind die augenscheinlichen Symptome Ausdruck dieser Beziehungsproblematik, die sich nicht verändert, indem die Symptome minimiert werden. Darüber hinaus führt die Einbindung in die Gruppe zu einer Konfrontation des Patienten mit seinen pathogenen Beziehungsstrukturen, die in der tagesklinischen Behandlung dann bearbeitet werden können. Die Behandlungsansätze in der Tagesklinik richten sich nach der Indikationsstellung, die gleichzeitig darüber entscheidet, ob für einen Patienten eher ein stationäres oder ein tagesklinisches Setting sinnvoll ist (vgl. Zeeck 2008; Seidler et al. 2005). Sie orientieren sich an den aktuellen Leitlinien wie denen der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Allen Behandlungsansätzen gemeinsam ist die Einbettung in ein multiprofessionelles Team und ein komplexes Angebot an Behandlungen und Therapieformen (vgl. Eikelmann 2010). Davon ausgehend können sowohl die Behandlungsintensität als auch die Zielsetzung (z.B. Fokussierung auf soziale Inklusion oder Akutbehandlung) an den jeweiligen Patienten angepasst werden (vgl. Eikelmann 2010). Situation der Tageskliniken in Deutschland 47 5.3.2 Vorteile Hieraus ergeben sich die Vorteile des tagesklinischen Settings. Der Patient bleibt in seinem sozialen Umfeld und kann die im tagesklinischen Setting erlernten Fähigkeiten nicht nur im geschützten Raum der Tagesklinik, sondern auch im privaten Umfeld erproben, in welches er abends zurückkehrt. Außerdem ist die unbewusste Abhängigkeit vom Therapeuten, wie sie beispielsweise oft in der ambulanten Psychotherapie anzutreffen ist, in der Tagesklinik weniger stark ausgeprägt (vgl. Matakas 2006). Sie ist damit das zu bevorzugende Setting, wenn es darum geht, Patienten (auch mit schweren Verläufen) langfristig zu begleiten und ihr sog. psychisches Niveau zu erhöhen (vgl. Matakas 2006), während gleichzeitig ihre Autonomie gefördert wird (vgl. Rohrbach 2002). Die sich durch die verändernden Patienten in der Tagesklinik und der Patientengruppe immer wieder ergebenden Trennungs- und Neukontakterfahrungen können und werden im tagesklinischen Setting wiederholt mit dem Patienten bearbeitet (vgl. Rohrbach 2002), was neben der Beziehungskompetenz auch den Selbstwert des Patienten fördert und vorhandene pathologische Bindungsmuster aufzeigt, welche dann therapeutisch bearbeitet werden können. Darüber hinaus hat die Tagesklinik einen wichtigen Stellenwert, in der Debatte um Verweildauerverkürzungen und den Betteneinsparungen in der vollstationären Behandlung, die den Bedürfnissen der Patienten in der Psychiatrie nicht gerecht wird (vgl. Dohren & Münzer 2012). 5.3.3 Nachteile Durch die Einbindung des Patienten in die jeweilige Patientengruppe der Tagesklinik und das sich daraus ableitende therapeutische Setting ergibt sich der Nachteil der Tagesklinik, dass diese für kurze Kriseninterventionen ungeeignet sind (vgl. Matakas 2006). 5.4 Tagesklinik Alteburger Straße gGmbH Die Tagesklinik „Alteburger Straße“, die in der vorliegenden Studie untersucht wird, ist eine Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie verfügt über vier tagesklinische Stationen mit einer Gesamtanzahl an Therapieplätzen von 56 sowie über drei Vollstationen mit insgesamt 40 Behandlungsbetten. Das Einzugsgebiet der Tagesklinik „Alteburger Straße“ besteht aus den Stadtteilen Zollstock, Raderberg, Raderthal, Marienburg, Bayenthal, Altstadt-Süd und Neustadt-Süd. Daraus leitet sich der Versorgungsauftrag als Sektorversorgung ab. Situation der Tageskliniken in Deutschland 48 Die ärztliche Personaldecke der Tageseinheit wird durch zwei Ärzte (einem Mann und einer Frau) bestimmt, die insgesamt 1,5 Stellen besetzen. Dazu gibt es zwei Krankenpflegekräfte (einen Mann und eine Frau) mit insgesamt 1,85 Stellen, eine Sozialarbeiterin mit einer halben Stelle und einen stundenweise arbeitenden Bewegungs- und Kunsttherapeuten. Die tagesklinische psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung findet wochentags 8.3017.00 Uhr statt. Samstags besteht für die Patienten die Möglichkeit, von 10 bis 12 Uhr in die Klinik zu kommen. Die Tageseinheiten haben dabei unterschiedliche Behandlungsschwerpunkte. Demnach werden auf den einzelnen tagesklinischen Stationen schwerpunktmäßig Patienten mit Borderline-Störungen (Tageseinheit A), Psychosen (Tageseinheit B), Depressionen (Tageseinheit C), Zwängen und akuten psychiatrischen Störungen (Tageseinheit D) behandelt. Die Tagesklinik als Behandlungsoption enthält Elemente der ambulanten sowie der vollstationären Behandlung. Dabei bleibt der Patient überwiegend in seinem gewohnten sozialen Rahmen und seinen vertrauten Lebensbezügen. Während der therapeutischen Behandlungswoche befindet er sich für 8 Stunden in einer intensiven psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung. Es besteht für den Patienten so die Möglichkeit, im ständigen Austausch zwischen intensiver Therapie und seiner sozialen Realität seine Beziehungsfähigkeit im außerklinischen Alltag immer wieder zu überprüfen und gegebenenfalls zu revidieren. Im Rahmen der tagesklinischen Behandlung besteht die Möglichkeit, durch multimodale Therapieansätze der Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse, den Fähigkeiten und den individuellen Problemstellungen der einzelnen Patienten besser gerecht zu werden. Hier zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zwischen ambulanter Psychotherapie und Tagesklinik. Während in der ambulanten Psychotherapie in der Regel ein einziges Verfahren zur Anwendung kommt, gelingt es in der Tagesklinik, über die Unterschiedlichkeit der Therapien (Soziotherapie, Kunsttherapie, Bewegungstherapie, Yoga, Gruppen- und Einzelpsychotherapie) einen größeren therapeutischen Spielraum bereitzustellen. Zudem ist auch die Intensität der psychotherapeutischen Behandlung durch die höhere Behandlungsdichte größer als im ambulanten Setting. Im Alltag und im therapeutischen Setting der Tagesklinik „Alteburger Straße“ finden die Konzepte und zentralen Elemente der therapeutischen Gemeinschaft Anwendung. Zu diesen zentralen Elementen der therapeutischen Gemeinschaft zählen: die tägliche Gemeinschaftssitzung, in der das therapeutische Alltagsleben thematisiert wird, Situation der Tageskliniken in Deutschland 49 die anschließende Team-Sitzung, in der die vorangegangene Gemeinschaftssitzung reflektiert wird, die Gruppentherapie (eine Kerngruppe mit bis zu sechzehn Patienten), die Morgenrunden, die auf den Klinik- und Therapiealltag bezogen sind, die Verteilung gemeinschaftlicher Aufgaben und Verantwortungsbereiche, das Patensystem zur Orientierungshilfe, die Gespräche zu Grundfragen der Gesundheit und Krankheit, Behandlungskonzepte, Übertragung der Klinikerfahrung auf den Alltag, gesunden Ernährungsweise etc. und die Beteiligung der Patienten am Verbesserungs- und Beschwerdemanagement (vgl. Winkler et al. 2013). 5.4.1 Hintergrund der Behandlung von depressiven Patienten in der Tagesklinik Alteburger Straße gGmbH Gerade für depressive Patienten bietet die tagesklinische Struktur einen optimalen Rahmen. Ohne vollständig aus der Häuslichkeit und dem sozialen Umfeld herausgenommen zu werden, wirkt die Tagesklinik durch ihre Teilhabeverpflichtung dem sozialen Rückzug, der Antriebsarmut und der daraus entstehenden Vereinsamung der Patienten entgegen. Gefördert wird diese Durchbrechung des Teufelskreises dadurch, dass der Patient in eine interaktionelle Beziehung zu anderen Menschen in Form der Therapeuten, der Mitpatienten und der Mitarbeiter treten kann, ohne dabei eine gesellschaftskonforme Rolle erfüllen zu müssen. Vielmehr können gerade durch den psychoanalytischen Ansatz der Tagesklinik Alteburger Straße gGmbH pathologische Bindungs- und Beziehungsmuster externalisiert und bearbeitet werden, die im außerklinischen gesellschaftlichen Kontext in aller Regel kupiert werden. Dabei führt die Bearbeitung intrapsychischer Prozesse, die zumeist in negativen Übertragungsphänomenen bestehen, zu einer Stärkung der Sozialkompetenz des Patienten. Es sind vor allem die depressionsassoziierten bindungstheoretischen Faktoren, die im Rahmen des psychoanalytischen Ansatzes der Tagesklinik Alteburger Straße GmbH positive verändert werden können. Zudem kommt es zu einer Verbesserung der Resilienz der Patienten, wie es allein im ambulanten Setting mit wöchentlichen Einzelstunden nicht umgesetzt werden kann. Damit verbunden ist eine Zunahme der Affektstabilität, der Frustrationstoleranz und der Stressresistenz. Gleichzeitig kommt es durch die intrapsychisch angestoßenen Veränderungsprozesse zu einer Situation der Tageskliniken in Deutschland 50 Verbesserung der Selbstwirksamkeit und des Selbstwertgefühles, was den Therapie- und den Krankheitsverlauf positiv beeinflusst. 5.4.2 Behandlungsablauf auf der Tageseinheit C der Tagesklinik Alteburger Straße gGmbH Nachfolgend soll das Konzept der Tageseinheit C, deren Klientel das Studienkollektiv der vorliegenden Studie darstellt, im Besonderen dargestellt werden. Das therapeutische Team der Tageseinheit C verfolgt neben einem psychiatrischen auch einen psychoanalytischen Behandlungsansatz. Das bedeutet, die Konzepte von Übertragung, Gegenübertragung, Abwehr, freier Assoziation und Widerstand spielen im therapeutischen Setting eine große Rolle. Ziel ist es, dadurch das Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeit der Patienten zu stärken, ihnen pathologische Beziehungs- und Bindungsmuster bewusst zu machen, welche die Depression forcieren oder initiieren, krankheitsfördernde Denkmuster der Patienten zu durchbrechen und bei den Patienten eine Haltung der Achtsamkeit zu fördern. Bedingt durch das gruppenanalytisch geprägte Arbeiten nehmen alle Patienten am gleichen Wochenprogramm des multimodalen Therapiesettings teil. Hierdurch wird eine große Gruppenkohärenz, also eine enge soziale Bezogenheit der Patienten untereinander, erzielt. Vinogradov und Kollegen (1996) sprechen von „der Anziehungskraft, durch die sich einzelne Mitglieder in einer Gruppe eingebunden fühlen und die sie mit anderen Mitgliedern verbindet“ (Vinogradov et al. 1996, S. 1449). Da viele Patienten an Störungen ihrer sozialen Beziehungsfähigkeiten leiden, ergeben sich im Miteinander Konfliktfelder, die im Rahmen des therapeutischen Settings genutzt werden können. Dabei kommt es zur Ausbildung von Übertragungskonstellationen sowohl zwischen Therapeuten und Patienten als auch multipersonal und häufig innerhalb der Patientengruppe. Somit werden die Patienten Regisseure ihrer eigenen inneren Konflikte, die sie in dem „sozialen Mikrokosmos“ der Station reinszenieren. Gleichzeitig dient die Patientengruppe als soziales Korrektiv, in dessen Spiegel die Verzerrung der Realität, die der einzelne Patient mitbringt, nicht durchzuhalten ist. Folglich kann der Patient auf diesem Weg lernen, besser mit sich selbst und anderen umzugehen sowie tragfähigere Bindungen zu gestalten. Matakas geht davon aus, dass das therapeutische Milieu dem Patienten eine Möglichkeit gibt, in einer durch Vernunft, Achtung und Wertschätzung geprägten Atmosphäre seinen Wahnsinn und seine Triebe besser beherrschen zu lernen, um den Preis der partiellen Aufgabe der Mög- Situation der Tageskliniken in Deutschland 51 lichkeit und der Freiheit seiner Pathologie durchzuarbeiten (vgl. Matakas 1992). Zusätzlich können intakte soziale Systeme Ich-Funktionen verstärken und die Ängste der Individuen vermindern, was sich ebenfalls positiv auf die Entzerrung und die Schaffung eines neuen Realitätsbezuges für den Patienten auswirkt (vgl. Matakas 1992). Die vorliegende Studie bezieht sich auf die tagesklinische Behandlung von Patienten mit schweren Depressionen, deren Wochenprogramm in der Tagesklinikeinheit C folgende Punkte beinhaltet: 3 Stunden analytische Gruppenpsychotherapie, ½ Stunde Einzelpsychotherapie (1 Stunde alle 14 Tage), 1 ½ Stunden Soziogruppe, 1 ½ Stunden Bewegungstherapie, 1 ½ Stunden Yoga/Achtsamkeitstraining, 4 Stunden Kunsttherapie, 1 Stunde Therapiezielbesprechung, tägliche ärztliche Visiten, 1 Stunde ärztliche Gruppenvisite, bedarfsabhängige Einzelgespräche mit dem Pflegeteam, dem Therapeuten oder der Sozialarbeiterin, 3 Stunden milieutherapeutische Gruppen, 2 Stunden Freizeitgruppe und Familiengespräche nach Absprache. In der ärztlichen Gruppenvisite werden u. a. Fragen zur Medikation, Mitbehandlung durch andere Fachrichtungen oder körperliche Beschwerden des Patienten besprochen. Die Milieutherapie wird vom Pflegeteam durchgeführt und besteht in der Begleitung des Patienten bei allen Aktivitäten im Milieu (Einkaufen, Frühstück, Bereitung von Mittagessen, Esskultur und Ernährungsfragen, achtsamer Umgang mit eigenen Bedürfnissen und denen Anderer, Putzaktivitäten etc.). Hierbei handelt es sich um bedarfsabhängige Therapie, die bis zu 1 h./Tag in Anspruch genommen werden kann. Daneben gibt es Einzelgespräche mit dem Pflegeteam, in welchen zumeist Themen der konkreten Lebensgestaltung (siehe Milieutherapie) besprochen Situation der Tageskliniken in Deutschland 52 werden. Zudem bespricht das fachlich hochkompetente Pflegeteam mit den Patienten Übungen zur Stressbewältigung wie z. B. Atemübungen und Achtsamkeitsübungen, Gedankenstopptechniken z. B. bei Ängsten, Dissoziationsstopptechniken bei traumatisierten Patienten sowie Techniken zur Affektwahrnehmung und Affektsteuerung bei psychosomatischen Patienten bzw. Borderline-Patienten. Im Rahmen der Kunsttherapie, die 4 h./Woche umfasst, wird mit unterschiedlichen Materialien wie Farbe, Stoffe, Stein, Ton oder Holz gearbeitet, über deren Gestaltung sich der Patient ausdrücken kann. Hierbei geht es vor allem um die Darstellung innerer Erlebniswelten und innerer Bilder, obgleich sich auch Möglichkeiten der Handlungsdurchführung (z. B. Wie nähere ich mich einer neuen Aufgabe, einem neuen Material?) anbieten. So kann der Patient neue Fähigkeiten und Ressourcen entwickeln und neue Lösungsmöglichkeiten entdecken. Die Soziogruppe dient der Bearbeitung von Fragen rund um die Themen Arbeit, Freizeit und soziale Aktivitäten. Des Weiteren werden hier konkrete Handlungs- und Planungsziele erarbeitet. Während die Patienten ihre Situation in der Gruppe der Mitpatienten darstellen, können sich die Mitpatienten im innerpersonellen Beziehungskontext mit ihren Ressourcen und ihren Lebenserfahrungen einbringen und so ihr eigenes Gefühl von Selbstwirksamkeit verbessern. In der Gruppe, gegebenenfalls auch im Einzelgespräch, stellt die Sozialarbeiterin die notwendigen Fachkenntnisse zu Möglichkeiten der Weiterbildung, Umschulung oder begleitenden ambulanten Hilfen (betreutes Wohnen, Soziotherapie, Schuldnerberatung etc.) her. Bedarfsgerichtete Einzelgespräche mit der Sozialarbeiterin dienen der Besprechung und Bearbeitung konkrete Probleme wie z. B. der Sortierung aufgelaufener Rechnungen, der Planung der weiteren Lebenssituation oder dem Ausfüllen von Anträgen z. B. auf Umschulung. Die Freizeitgruppe bietet die Möglichkeit, in kleinen Gruppen eine Freizeitaktivität z. B. Kinobesuch, Museumsbesuch, Kegeln oder Minigolf zu planen und umzusetzen. Dies erfordert eine umsichtige Planung (Planung der Fahrt, Öffnungszeiten, Kosten etc.), die einigen Patienten zunächst schwerfällt, weswegen mitunter unterstützende Gespräche mit dem Pflegeteam notwendig werden. Positive Effekte kommen hier auch dadurch zustande, dass es mit den Mitpatienten zusammen für viele Patienten zunächst einfacher ist, etwas Neues und Ungewohntes auszuprobieren. Auch können sich in ihren Bereichen kompetente Patienten mit ihren Hobbys und Fähigkeiten einbringen (z. B. Fotografie, Stadtführung, Pilzsammler etc.), was wiederum das Gefühl der Selbstwirksamkeit und das Selbstwertgefühl der Patienten stärkt. Beim wöchentlichen Yoga erleben sich die Patienten im Zusammenspiel von Körper und Geist und lernen durch Übungen zur Achtsamkeit und anhand spezieller Atemtechniken Situation der Tageskliniken in Deutschland 53 Stress besser zu bewältigen. Auf der körperlichen Ebene fördert das Yoga Gleichgewicht, Kraft und Beweglichkeit, was durch die Bewegungstherapie ergänzt wird. Einmal wöchentlich erfolgt die Therapiezielbesprechung. Die Patienten stellen ihre Therapieziele zu Beginn der Therapie, in der 3., 6. und 9. Behandlungswoche vor. Die Therapiezielbesprechung findet in einer Gruppe statt, damit auch die Mitpatienten die Fortschritte oder auch die Probleme ihrer Mitpatienten verstehen und begleiten können. So wächst das Potenzial, sich gegenseitig zu helfen und die Patienten können sich gegenseitig Mut zusprechen und sich motivieren. Die Aufgabe des behandelnden Arztes ist es, im Gespräch mit dem Patienten nach Vorbesprechung im therapeutischen Team diesem Denk- und Handlungsansätze für seine persönliche Weiterentwicklung zu geben, damit er seine Therapieziele erreichen kann. Aufgrund des besonderen psychoanalytischen Ansatzes zur Depressionsbehandlung auf der Tagesklinikeinheit C der Tagesklinik Alteburger Straße gGmbH und den damit verbundenen Kernelementen dieses Patientenkollektivs soll die Einzel- und Gruppentherapie in der Tagesklinikeinheit C nachfolgend gesondert dargestellt werden. Einzel- und Gruppenpsychotherapie in der Tagesklinikeinheit C Wie bereits oben für das gesamtherapeutische Setting in der Tagesklinik Alteburger Straße gGmbH beschrieben, hat die Psychotherapie die Stärkung des Selbstwertgefühls und der Selbstwirksamkeit, die Bewusstmachung pathogener Beziehungsmuster und deren Veränderung, die Einübung einer Haltung der Achtsamkeit und die Veränderung krankheitsfördernder Denkmuster zum Ziel. Erfahrungsgemäß gibt es bei depressiven Patienten bestimmte Themenbereiche, die in der einen oder anderen Form auftauchen. Ein depressiver Grundkonflikt ist eng mit dem Selbstwertgefühl verbunden. Viele depressive Patienten fühlen sich nicht liebenswert und nicht leistungsfähig. Dies hat häufig mit Situationen im Elternhaus und der Eigenschaft der primären Bezugspersonen zu tun, wodurch die Patienten als Kinder nicht gefördert, entwertet oder körperlich und/oder sexuell missbraucht wurden. Neben der Vernachlässigung und der Entwertung in der Erziehung finden sich auch häufig Patienten, die durch Verwöhnung kein stabiles Selbstwertgefühl entwickeln konnten. Sie verlieren das Gefühl der Selbstwirksamkeit und damit eine grundlegende Stütze des Selbstwertgefühls. Patienten mit instabilem Selbstwertgefühl bemühen sich häufig im Streben nach Perfektionismus um Fehlerlosigkeit und sind bemüht, Andere zu beeindrucken. Trotzdem können sie über Situation der Tageskliniken in Deutschland 54 sich selbst kaum etwas Gutes sagen. In der Einzeltherapie gilt es, diese Patienten dazu zu befähigen, die Verknüpfungen von Leistungsansprüchen und Selbstwertgefühl zu verstehen und zu entflechten. Auch der Zusammenhang zwischen Katastrophisierungsgedanken und Rückzugshandlungen mit der Konsequenz sozialer Isolation kann im Einzelsetting bearbeitet werden. Die negativen Gedanken der Patienten – oft Abkömmlinge der internalisierten elterlichen Entwertungen („Du kannst nichts“, „Du bist nichts wert“) – können von den Patienten erkannt und verändert werden. Bewährt haben sich hier die zur Anwendung kommenden Methoden der Impact-Technik, die den internalisierten Überzeugungen der Patienten ihren Realitätscharakter und damit ihre Glaubwürdigkeit nehmen (Sprechenlassen in Micky-Maus-Stimme, Benennung der Gedanken mit lustigen Namen “Blasius Theophil“ oder Visualisierung eines Papageis, der nur einen Satz sprechen kann). Das den depressiven Patienten oft fehlende Gefühl von Selbstwirksamkeit wird insbesondere durch die therapeutischen Gruppen verbessert. Jeder Patient kann sich hier in vielen Situationen als hilfreich, stützend und kompetent erleben. Auch können z. B. in Milieudiensten, bei der Kunsttherapie und beim gemeinsamen Kochen eigene Handlungskompetenzen entwickelt und gefördert werden. Da die Atmosphäre auf der Station sehr wertschätzend und freundlich ist, können Patienten lernen, diese Haltung nicht nur anderen gegenüber, sondern auch sich selbst gegenüber einzunehmen. Dies ist eine grundlegende Änderung des Umgangs mit sich selbst. Oftmals entsteht die verminderte Frustrationstoleranz der Patienten aus strengen ÜberIch-Forderungen, die niemals realistisch erfüllt werden können. Hier erweist sich eine tagesklinische Behandlung als besonders hilfreich, da sie durch Deutung und Spiegelung nicht nur in psychotherapeutischen Einzelsitzungen, sondern durch den gesamten Tagesablauf immer wieder Anregungen gibt, anders zu handeln und zu denken. Ein weiterer häufiges Problemfeld ist die Vorstellung der depressiven Patienten, sie könnten in ihrem Erwachsenenleben durch besonders viel Fürsorge und Liebe durch ein anderes Objekt zu der Stabilität und dem Selbstwertgefühl gelangen, das sie als Kind hätten entwickeln können. Dies ist ein Trugschluss, der häufig zu asymmetrischen Bindungsmustern und einem Aufschaukeln von Versorgungswunsch und sich verstärkender Inkompetenz im Alltagsleben führt. Die daraus resultierenden häufig destruktiven Muster in Partnerschaften können in begleitenden Paargesprächen bearbeitet werden. Für den Patienten besteht die schmerzliche Entwicklungsaufgabe oft darin, sich von der Illusion zu lösen, ein Anderer könne ihn „satt“ machen und seine Versorgungswünsche minimieren. Dieser Prozess ist für viele Patienten schwer, insbesondere wenn sie verstehen, dass Situation der Tageskliniken in Deutschland 55 sie als Erwachsene selbst für ihre gute seelische Versorgung verantwortlich sind. Aus diesem Grund ist die Selbstfürsorge, die bei depressiven Patienten häufig sehr schlecht ist, ein Grundpfeiler der tagesklinischen Behandlung. Die Selbstfürsorge reicht von der körperlichen Versorgung (“Was esse ich, wann esse ich?”) über die Strukturierung des Tages (“Tut es mir gut bis morgens aufzubleiben und fern zu sehen?”) bis zu Fragen der Abgrenzung von den Wünschen Anderer (“Wann ist es für mich besser, nicht zu helfen?”) und der Erlaubnis, sich gut zu fühlen (“Darf es einem Menschen wie mir überhaupt gut gehen?”). In der multimodalen Behandlung greifen hier die pflegerischen, ärztlichen, sozialarbeiterischen und kunsttherapeutischen Einflussmöglichkeiten ineinander. Hier erweisen sich die tagesklinische Behandlung und die enge Verzahnung der einzelnen Bereiche des therapeutischen Prozesses als besonders hilfreich. Zu den pathogenen Beziehungsmustern von depressiven Patienten gehört neben der Abhängigkeit auch die leichte Kränkbarkeit, die einen Auslöser für depressive Rückzugstendenzen bildet. Der depressive Patient erlebt sich selbst als weniger kompetent und weniger erfolgreich als seine Mitmenschen. Um dieser Kränkung zu entgehen, zieht er sich zurück. Bei männlichen Patienten wird das unangenehme Gefühl der Unterlegenheit und der Scham oft durch Aggressivität überdeckt. Sie erscheinen dann zunächst dauerhaft gespannt und wütend und geraten viel in Streit. In der Behandlung besteht das Ziel darin, den Patienten in mühevoller Kleinarbeit den ursprünglichen Gedanken („Ich fühle mich unterlegen und beschämt“) wieder bewusst zu machen, damit es möglich wird, diesen zu arbeiten. Erst wenn die Ursache der scheinbar ursachenlosen Wut und Angespanntheit deutlich wird, kann es hier zu einem Transformationsprozess kommen. Es liegt in der besonderen Kompetenz des therapeutischen Teams, hier mit den Patienten nicht in eine erzieherische Auseinandersetzung zu geraten („Sie müssen ruhiger werden!“), sondern sensibel und einfühlend die Ursachen der Gespanntheit zu ergründen. Dabei hat sich in der Tagesklinikeinheit C als gut erwiesen, den vorhandenen Leidensdruck der Patienten zum Verbündeten zu nehmen. Zu den weiteren pathogenen Bindungsmustern, die im Einzel- und Gruppensetting behandelt werden, gehören die negativen Übertragungen internalisierter Objekte (z. B. prügelnde Eltern, vernachlässigende Verwandte etc.), wobei durch die Gruppengröße (12-14 Mitpatienten) ein breites Spektrum an Übertragungsobjekten und dem externalisierten Ausagieren der initial internalisierten Objekte möglich wird. Die sich aus diesen Übertragungen ableitenden Konflikte sind grade in der Gruppenpsychotherapie immer wieder Thema. Hier ist es für die Patienten möglich, die Realität ihrer Wahrnehmung – auch durch die Beobachtung der Konflikte Situation der Tageskliniken in Deutschland 56 von außen – zu überprüfen. So gelingt es häufig festzustellen, dass die erfahrene Rollenverteilung (z. B. „entwertender Vater“) in der Schaffung eines Übertragungsobjekt aufrechterhalten wird. Es ist erstaunlich, wie schnell die unversöhnlich erscheinenden Konfliktparteien so zu Erkenntnissen gelangen, die sie beruhigen und den Konflikt entschärfen. Im Verlauf der Behandlung ist es so viel besser möglich, sich der gegebenen Realität anzupassen und diese immer wieder – schließlich auch eigenständig – auf ihren Übertragungsanteil hin zu überprüfen. So wird es den Patienten möglich, stabilere Bindungen einzugehen. Ein weiteres Problem, das in der Einzel- und Gruppentherapie aufgegriffen wird, besteht darin, dass es depressiven Patienten häufig nicht möglich ist, etwas zu genießen. Dies hat mit einem Mangel an Achtsamkeit und Konzentration auf die Gegenwart zu tun. Die Gedanken scheinen den Patienten häufig realer als die gegebene Erfahrung. In der Behandlung depressiver Patienten hat es sich deswegen bewährt, diese Achtsamkeit im Augenblick zu fördern. In der tagesklinischen Behandlung wird immer wieder eingeübt, wie eine Fokussierung auf Körpersensationen (z. B. Geschmack, Geruch, Atmung) das wache Erleben fördern und den Stress abbauen kann. Explizit geschieht dies natürlich im Yoga, aber auch in der Milieutherapie. Zu der Haltung der Achtsamkeit gehört es auch, die Patienten darin zu begleiten, sich und andere weniger zu bewerten. Dadurch werden die Selbstakzeptanz und die soziale Kompetenz gefördert. Zudem sinkt das Stresslevel deutlich. Für Patienten mit dissoziativen Störungen hat sich der Einsatz von extremen körperlichen Wahrnehmungen zur Unterbrechung der Dissoziation bewährt (z. B. Eiskubus in die Hand nehmen, Chilischote kauen). Hier werden auch die Übungen zur Etablierung eines sicheren Ortes angewandt. Letztlich hat es sich bei depressive Patienten als hilfreich erwiesen, ihre Denkmuster auf prinzipiell hilfreiche und prinzipiell nicht hilfreiche Gedanken hin zu untersuchen. Die Gedanken, die nicht hilfreich sind (z. B. „Warum passiert immer mir das?“, „Wie blöd bin ich, das mir so etwas passiert?”), sollen mittels Stopptechnik nicht weiter verfolgt werden, diejenigen, die hilfreich sind („Wie kann ich jetzt weitermachen?“ „Was kann ich tun, damit es gelingt?“), sollen stattdessen fokussiert werden. So gewinnt der Patient langsam eine Hoheit über sein Denken und kann auch in frustrierenden Situationen negative Gedankenspiralen verlassen. Mitpatienten bilden hierbei oft ein wichtiges Korrektiv. Daneben gelingt es in der Gruppenpsychotherapie häufig, die eingefahrenen Selbstauffassungen der Patienten zu verändern, indem sie von Mitpatienten Rückmeldungen über eigenes Verhalten erhalten und dies so zu reflektieren lernen. Die Gruppenmitglieder gehen dabei, wie Situation der Tageskliniken in Deutschland 57 es auch der Grundhaltung auf des Station entspricht, sehr wohlwollend und einfühlsam mit ihren Mitpatienten um. Unserer Erfahrung nach agieren die Mitpatienten die aus dem Kontakt erwachsenden Schwierigkeiten aus, wodurch es ihnen häufig gelingt, die negativen Auswirkungen depressiver Kommunikation zu verstehen und zu verändern. Forciert wird dieser Prozess durch das Bedürfnis vieler Patienten, von Anderen gemocht und respektiert zu werden, wodurch viele depressive Patienten dazu neigen, in der Kommunikation nicht offen ihre Haltungen und Wünsche zu formulieren. Diese werden sehr indirekt und für Andere oft nicht verständlich kommuniziert. Solche Strategien führen immer wieder zu Missverständnissen im Stationsalltag, können aber im Gruppenkontext gespiegelt und verändert werden. Ein immenser Vorteil der tagesklinischen Behandlung ist es, die theoretischen, psychodynamischen und analytischen Veränderungen im Alltag begleiten und spiegeln zu können. Oft wird jedoch erst in der Entlassungsphase deutlich, welche konkreten Änderungen der Lebensumstände notwendig sein müssen, um dauerhaft zu mehr Lebenszufriedenheit zu gelangen. Dies können Veränderungen in der Beziehungsgestaltung (z. B. Paarbeziehung, Beziehung zu Eltern), in der berufliche Perspektiven (Veränderung der Arbeitsstelle, Umschulung) oder auch in der Freizeit (Kontaktgestaltung mit Anderen) sein. In der Auffassung der Tagesklinik gibt es keinen Unterschied zwischen der Reifung des Innenlebens und der Spürbarkeit im Alltag, da diese beiden Prozesse komplex miteinander verzahnt sind und demnach auch in ihrer Komplexität im Gruppen- und Einzelsetting erkannt, aufgegriffen und bearbeitet werden müssen. 5.5 Die Tagesklinik in der Behandlung depressiver Patienten Eine der führenden Studien, welche die tagesklinische Behandlung der Depression mit der stationären Behandlung verglich war die Studie von Dinger und Kollegen aus dem Jahr 2014. In die Studie wurden insgesamt 44 Patienten aufgenommen. Zu den Einschlusskriterien gehörte neben einem Alter zwischen 18 und 60 Jahren eine mindestens mittelgradige depressive Episode oder Dysthymie. Das durchschnittliche Patientenalter lag bei 35.1 Jahren. Mit 50% weiblicher Patienten war es ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis (vgl. Dinger et al. 2014). Sowohl die stationären als auch die tagesklinisch behandelten Patienten wurden über einen Zeitraum von acht Wochen behandelt. Die Erhebung der Katamnese erfolgte zu Beginn und am Ende der Therapie sowie einen und sechs Monate nach dem Therapieende. Als Assessments wurden der BDI-II und der Globale Schwere Index (GSI) herangezogen. Es zeigte sich, dass die Werte im BDI und im GSI in beiden Gruppen nach sechs Monaten nach einem initialen Abfall wieder angestiegen waren, obgleich die symptomatischen Beschwerden und Situation der Tageskliniken in Deutschland 58 die interpersonellen Probleme weiterhin rückläufig waren (vgl. Bateman & Fonagy 2003). Eine signifikante Überlegenheit einer der beiden Gruppen konnte aufgrund des kleinen Studienkollektivs nicht nachgewiesen werden. Die Forscher gingen aber davon aus, dass es signifikante Unterschiede zwischen beiden Therapieformen bei spezifischen Krankheitsbildern gab (vgl. Bateman & Fonagy 2003). 5.6 Zukunftstrend Zukünftig werden die Säulen aus ambulanter, stationärer, teilstationärer und tagesklinischer Behandlung bestehen bleiben und sich je nach Patientenaufkommen ausgleichen. Da die depressiven Störungen wie auch eine Reihe anderer psychiatrischer Erkrankungen an Inzidenz zunehmen und ein sozioökonomisches Problem darstellen, werden in Zukunft Therapieansätze, die nicht nur die Behandlung der Grunderkrankung, sondern auch die Rückführung des Patienten ins Arbeitsleben fördern, eine besondere Stellung einnehmen. Hierzu leisten die Tageskliniken einen wesentlichen Beitrag, was die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen. Material und Methoden 59 6 Material und Methoden Im nachfolgenden Abschnitt wird das methodische Vorgehen vorgestellt, welches zur Erstellung der hier vorliegenden Arbeit und der dazugehörigen Untersuchung herangezogen wurde. 6.1 Studiendesign In der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um eine prospektive klinische Untersuchung im Zeitraum 2/2013 bis 6/2014 in der Tagesklinik Alteburger Straße. 6.2 Forschungsgegenstand Ausgehend von der Frage nach der Patientenzufriedenheit und der Symptomveränderung im Rahmen einer tagesklinischen Behandlung von Patienten mit depressiven Erkrankungen wurde entsprechend den Operationalisierungsschritten zur Problem- und Gegenstandsbenennung nach Atteslander der Forschungsgegenstand benannt (vgl. Atteslander 2010). Problembenennung Gegenstandsbenennung Patienten mt psychiatrischen Erkrankungen depressive Störungen, Angststörungen, Traumafolgestörungen, bipolaren Störungen Patienten mit depressiver Störung stationäre Behandlung ambulante Behandlung tagesklinische Behandlung tagesklinische Behandlung psychoanalytischer Ansatz psychotherapeutischer Ansatz Abbildung 1. Problem- und Gegenstandsbenennung in Anlehnung an Atteslander (2010, S. 39) Material und Methoden 60 6.3 Studienkollektiv Das Studienkollektiv umfasste alle in der Tagesklinik Alteburger Straße behandelten Patienten, die nach Beginn der Untersuchung dort eine 12-wöchige psychoanalytische Depressionsbehandlung erhielten. Anhand definierter Ein- und Ausschlusskriterien wurde über die Aufnahme der Patienten in die Studie entschieden. Die entsprechenden Kriterien sind in Tabelle 2 dargestellt. Tabelle 2 Ein- und Ausschlusskriterien zur Aufnahme der Patienten in die Studie (eigene Daten) Einschlusskriterien Ausschlusskriterien Patientenalter > 18 Jahre Patientenalter < 18 Jahre Einwilligung in die Studie Fehlende Einwilligung zur Studie Kognitive Fähigkeit zur Beantwor- Unzureichende kognitive Fähigkeiten tung der Fragebögen Patienten mit der Diagnose F32.2, zur Beantwortung der Fragebögen F32.1 und F33.2 Abgeschlossene 12-wöchige Behand- Patienten mit anderen Diagnosen als F32.2, F32.1 und F33.2 Behandlungsabbrecher lung 6.4 Datenerhebung Die Erhebung der Daten gliederte sich in die Erfassung der Literaturdatenbanken und die Erfassung der Patientendaten. Die Vorstellung der Tagesklinik Alteburger Strasse gGmbH erfolgte unter Nutzung des eigenen Wissens der Autorin, die in dieser Einrichtung tätig ist. 6.4.1 Ablauf der Literaturrecherche Die Literaturrecherche zur Sammlung der Daten für den wissenschaftstheoretischen Hintergrund sowie zur Sammlung empirischer Daten erfolgte anhand einer Stichwortsuche in den Material und Methoden 61 Fachdatenbanken pubMed, Science Direct, der Fachdatenbank des Springer Verlages, den Suchmaschinen Google und Google Scholar sowie dem Katalog der Universitätsbibliothek. Die verwendeten Stichworte waren Depression, Tagesklinik, psychoanalytische Therapie der Depression, psychotherapeutische Therapie der Depression, Patientenzufriedenheit, soziale Integration, Symptomveränderung und Depression, Trauma und Depression, Bindungsstörung, multipersonelle Übertragung, BDI II und SASSR. Um den aktuellen Bezug insbesondere in den empirischen Daten zu wahren, wurden hier vor allem Daten aus den Jahren 2010-2014 herangezogen. Bezüglich der Daten für den wissenschaftstheoretischen Teil wurde das Publikationsdatum der Daten auf die Jahre 2000-2014 ausgeweitet. Ferner gab es keine spezifischen Ein- und Ausschlusskriterien in der Auswahl der empirischen Daten. Grund dafür war die allgemein geringe empirische Datenlage zum tagesklinischen und zum psychoanalytischen Setting bei Patienten mit depressiven Störungen. Die Trefferquoten in den einzelnen Datenbanken und Suchmaschinen sind in den Tabellen 3 und 4 dargestellt. Tabelle 3 Ergebnisse der Stichwortsuche in den Datenbanken pubMed, Science Direct und der Springer Fachdatenbank Stichwort Treffer in Treffer in Science Treffer pubMed Direct Scholar depression 340.255 665.667 3.030.000 day-unit 211 1.567.238 6.270 336 27.200 36.521 54.200 35.579 1.990 psychoanalytic therapy 36 AND depression psychotherapy AND 21.890 depression patient satisfaction 3791 AND depression Google Material und Methoden 62 social integration AND 549 27.983 35.700 47.210 326 70.737 1.410.000 729 2.600 3 191 depression symptom modification 95 AND depression trauma AND depressi- 11.656 on attachement disorder multipersonal 12.101 trans- 0 ference BDI II 1341 12.404 89.100 SASSR 29.910 251 303 Tabelle 4 Ergebnisse der Stichwortsuche in den Suchmaschinen Google und Google Scholar Stichwort Treffer in der Springer Fachdaten- Treffer in Google bank Depression 450.097 208.000.000 Tagesklinik 1.939 651.000 psychoanalytische The- 4.013 233.000 rapie UND Depression psychotherapeutische 13.212 416.000 423 38.700 Therapie UND Depression Patientenzufriedenheit UND Depression Material und Methoden soziale 63 Integration 6.791 143.000 UND Depression Symptomveränderung 30 1.040 UND Depression Trauma UND Depres- 12.628 65.000.000 sion 224 Bindungsstörung multipersonelle Über- 26 34.100 307 tragung BDI II 11.598 854.000 SASSR 26 28.500 6.4.2 Ablauf der Patientenbefragung Die Erhebung der Patientendaten erfolgte im Rahmen eines Fragebogeninterviews, bei dem der Untersuchungsleiter anwesend war. Die verwendeten Fragebögen waren der Fragebogen Beck (BDI II), die Social Adjustment Scale (SASSR) und der PHY-Fragebogen, welche bereits im theoretischen Teil dieser Arbeit beschrieben wurden, weswegen auf eine erneute Darstellung in diesem Kapitel verzichtet wird. Alle Fragebögen gelten als validierte Instrumente in der Psychologie und Psychiatrie. Bedingt durch den Aufbau der verwendeten Fragebögen handelt es sich bei den hier durchgeführten Interviews um standardisierte Interviews mit geschlossenen Fragen. Die Messung erfolgte vor Therapiebeginn, am Therapieende sowie 6 Monate nach Therapieende. 6.5 Datenanalyse Die Analyse der Literaturdaten unterlag keinen spezifischen Kriterien. Material und Methoden 64 Die Daten der Patientenbefragung wurden codiert und mittels des Statistikprogramms SPSS® 22.0 ausgewertet. Die Daten wurden auf Normalverteilung und Varianzgleichheit getestet. Das Signifikanzniveau wurde auf p < 0.05 gesetzt. Zur Stichprobenbeschreibung kamen deskriptive Verfahren zur Anwendung. Zusammenhänge wurden mit interferenzstatistischen Verfahren durchgeführt. Hierbei kamen der t-Test und die Pearson-Korrelation zur Anwendung. Die statistischen Berechnungen erfolgten mit IBM® PASW 18® Statistics und dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel 2010 von Microsoft Office Standards. Ergebnisse 65 7 Ergebnisse 7.1 Beschreibung der Stichprobe Erfasst wurden alle depressiven Patienten, die die Diagnosen F33.1 und F33.2 sowie F32.1 und F32.2 aufwiesen. Ein Ausschlusskriterium war die psychiatrische Komorbidität mit Nebendiagnosen aus dem Bereich der Persönlichkeitsstörungen, Angststörungen oder Suchterkrankungen sowie schizoaffektive und bipolare Störungen. Der Einschluss der Patienten erfolgte zwischen Februar 2013 und Juni 2014. Die letzten Katamneseuntersuchungen fanden im Februar 2015 statt. Durch die Selektion rein depressiv erkrankter Patienten ohne Nebendiagnosen ergab sich eine geringe Größe der untersuchten Stichprobe, jedoch konnten die untersuchten Ergebnisse durch die relative Homogenität der depressiven Pathologie und eine 100 % Follow-up-Quote ein aussagekräftiges Ergebnis erzielen. Die Stichprobe umfasst insgesamt 26 Patienten, von denen 42,3 % männlichen Geschlechts (n = 11) und 57,7 % weiblichen Geschlechts sind (n = 15). Über zwei Drittel des Samples waren zum Zeitpunkt der Aufnahme in die teilstationäre Behandlung über 1 Jahr erkrankt. Weitere Charakteristika des Studiensamples sind in Tabelle 5 dargestellt. Tabelle 5 Charakteristika des Studiensamples (eigene Daten) Anzahl % Soziodemografische Angaben männlich 11 42,3 Geschlecht weiblich 15 57,7 Beruf keine Berufsausbildung 4 15,4 17 65,4 abgeschlossenes Studium 5 19,2 alleinlebend 9 34,6 Lebenspartner 8 30,8 Lebenspartner und Kinder 5 19,2 Kinder ohne Lebenspartner 3 11,5 anderes 1 3,8 abgeschlossene Lehre Wohnumfeld Ergebnisse 66 Erkrankungsspezifika zum Aufnahmezeitpunkt 1-3 Monate krank 1 3,8 Dauer der 3-6 Monate krank 5 19,2 Erkrankung über 1 Jahr krank 20 76,9 keine 11 42,3 1 6 23,1 Anzahl stationärer 2 2 7,7 Vorbehandlungen ≥4 1 3,8 fehlende Angabe 6 23,1 nicht arbeitsunfähig 4 15,4 Dauer der 2-4 Wochen 9 34,6 Arbeitsunfähigkeit 1-3 Monate 4 15,4 3-6 Monate 5 19,2 6-12 Monate 2 7,7 > 1 Jahr 2 7,7 9 34,6 keine ambulante Psychotherapie Dauer der 1-3 Monate 3 11,5 ambulanten 3-6 Monate 6 23,1 psychotherapeuti- 6-12 Monate 1 3,8 7 26,9 schen Vorbehandlung > 1 Jahr 7.2 Soziale Integration, depressive Symptomatik und Patientenzufriedenheit 7.2.1 Übersicht Im Beobachtungszeitraum wurden drei verschiedene Fragebögen eingesetzt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme wurden die soziale Integration mittels des SASSR und der Schweregrad der depressiven Symptomatik mittels des Beck-Depressionsinventars (BDI) erhoben. Zum Entlassungszeitpunkt nach 12-wöchiger teilstationärer Behandlung in der Tagesklinik wurden Ergebnisse 67 erneut die depressive Symptomatik mittels BDI sowie die Patientenzufriedenheit mit dem Münchner Fragebogen zur Behandlungszufriedenheit MFBP erfasst. Zum Zeitpunkt der Katamnese, 6 Monate nach Entlassung aus der teilstationären tagesklinischen Behandlung, wurden erneut der Grad der depressiven Symptomatik mittels BDI sowie die soziale Integration mittels SASSR erfasst. Tabelle 6 gibt einen Überblick über die im Mittel erzielten Scores in den Fragebögen bezogen auf die verschiedenen Erfassungspunkte. Tabelle 6 Kennwerte der eingesetzten Fragebögen (eigene Daten) MW ± SD BDI SASSR MFBP t0 t1 t2 11,33 ± 29,63 ± 12,11 ± 7,38 7,10 8,88 Arbeit 1,55 ± 1,28 ± 1,72 1,15 Freizeit + Soziales 2,99 ± 2,68 ± 0.72 0,68 Verwandte 2,46 ± 2,14 ± 0,88 0,83 Partnerschaft 1,32 ± 1,04 ± 1,38 1,26 Eltern 0,69 ± 0,52 ± 0,89 0,87 Familienzusammenhalt 1,85 ± 1,06 ± 1,41 1,09 Finanzen 2,26 ± 2,52 ± 1,38 1,74 SASSR-Gesamtwert 2,66 ± 2,32 ± 0,61 0,50 Skala 1 20,37 ± 3,26 Skala 2 17,93 ± 5,09 Gesamtwert 38,30 ± 7,17 Signifikanz (t0 vs. t2) < 0.001** 0,48 0,11 0,18 0,09 0,18 < 0,001** 0,53 0,04* ** signifikant p < 0,001; * signifikant p < 0,05 t0 = Aufnahme, t1 = Entlassung, t2 = Katamnese (6 Monate nach Entlassung) MW = Mittelwert, SD = Standardabweichung 7.2.2 Soziale Integration Die soziale Integration wurde mittels des Fragebogens SASSR erhoben, wobei der Fragebogen zwischen den Bereichen Arbeit, Freizeit und Soziales, Verwandte, Partnerschaft, Ergebnisse 68 Eltern, Familienzusammenhalt und Finanzen unterscheidet. Zusätzlich wird ein Gesamtwert dargestellt. Die soziale Integration wurde zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Tagesklinik sowie zum Zeitpunkt der Katamnese 6 Monate nach der Entlassung aus der teilstationären Behandlung erhoben. Die im Mittel erzielten Punktwerte zum Zeitpunkt der Aufnahme weichen in den Bereichen Freizeit und Soziales, Verwandte und im Gesamtwert von dem durchschnittlichen Bereich der Normstichprobe ab und weisen auf eine geringere soziale Integration als bei der Normstichprobe in diesen Domänen hin (T < 40). Zum Zeitpunkt der Katamnese nähert sich der Gesamtwert der sozialen Integration der Norm an, verbleibt jedoch unterdurchschnittlich. In den Bereichen Arbeit und Partnerschaft weisen die Studienteilnehmer zum Zeitpunkt der Katamnese überdurchschnittliche Werte der sozialen Integration auf, sind in diesen Domänen demnach stärker integriert als die Normstichprobe (T > 60). Der Punktwert in der Domäne Familienzusammenhalt reduziert sich signifikant zwischen dem Zeitpunkt der Aufnahme und der Katamnese von im Mittel 1,85 (SD +/-1,41) auf 1,06 (SD +/-1,09). Auch der Gesamtwert der sozialen Integration verringert sich signifikant von im Mittel 2,66 (SD +/-0,61) auf 2,32 (SD +/-0,50) Punkten. In den anderen Bereichen der sozialen Integration kann ebenfalls eine Reduktion der mittleren Werte beobachtet werden, diese fallen jedoch nicht signifikant aus. Eine Ausnahme bildet hierbei lediglich der mittlere Punktwert im Bereich Finanzen. 7.2.3 Depressive Symptomatik Der Schweregrad der depressiven Symptomatik der Patienten wurde anhand des BeckDepressionsinventars zu drei Zeitpunkten erhoben: bei der Aufnahme (t0), zum Zeitpunkt der Entlassung (t1) sowie nach 6 Monaten (t2). Der mittlere BDI reduzierte sich dabei signifikant vom Beginn der Behandlung mit 29,6 Punkten auf 11,3 Punkte zum Zeitpunkt der Entlassung (p < 0.05). Zum Zeitpunkt der Katamnese stieg der mittlere BDI auf einen Wert von 12,1 Punkten an (nicht signifikant). 7.2.4 Patientenzufriedenheit Der Fragebogen zur Patientenzufriedenheit (MFBP) wurde zum Entlassungszeitpunkt von den Studienteilnehmern ausgefüllt. Der MFBP misst die Patientenzufriedenheit in zwei Skalen, Ergebnisse 69 wobei Skala 1 Auskunft über die Gesamtzufriedenheit der Therapie gibt, Skala 2 dagegen den persönlichen Nutzen erfasst. Die Verteilung der Antworthäufigkeiten ist in Tabelle 7 dargestellt. Dabei entsprechen die grau unterlegten Items der Skala 1 = Gesamtzufriedenheit und die nicht unterlegten Items der Skala 2 = Persönlicher Nutzen. Tabelle 7 Antworthäufigkeiten im MFBP-18 (eigene Daten) voll überwiegend unentschieden eher nicht gar nicht N % N % N % N % N % Sollte ich nochmals erkranken, würde ich mich gern wieder in dieser Klinik behandeln lassen. 19 73.1 6 23.1 0 0 0 0 1 3.8 Ich habe in der Therapie gelernt, mit anderen Menschen besser zurechtzukommen. 8 30.8 14 53.8 4 15.4 0 0 0 0 Insgesamt bin ich mit der Art der Therapie, die ich hier erhalten habe, zufrieden. 14 53.8 11 42.3 0 0 0 0 1 3.8 Ich habe in der Therapie mehr Selbstvertrauen gewonnen. 8 30.8 12 46.2 4 15.4 1 3.8 1 3.8 Eigentlich hätte ich mir mehr von diesem Klinikaufenthalt versprochen. Ich weiß jetzt, welche Ziele mir wichtig sind. Ich habe die für mich richtige therapeutische Betreuung erhalten. Ich glaube, dass ich die hier eingeübten Problemlösungen auch im wirklichen Leben eigenständig einsetzen kann. 1 3.8 2 7.7 4 15.4 9 34.6 10 38.5 11 42.3 12 46.2 1 3.8 0 0 2 7.7 13 50.0 8 30.8 5 19.2 0 0 0 0 8 30.8 12 46.2 5 19.2 1 3.8 0 0 Insgesamt bin ich mit dem Therapieergebnis zufrieden. 12 46.2 11 42.3 2 7.7 0 0 1 3.8 Ich habe im Laufe der Therapiezeit Freude an Freizeitaktivitäten und ein positives Körperbewusstsein entwickelt. 8 30.8 13 50.0 4 15.4 1 3.8 0 0 Meine Zufriedenheit mit den therapeutischen Maßnahmen ist im Verlauf der Behandlung gesunken. 0 0 4 15.4 2 7.7 7 26.9 13 50.0 Ich habe in der Therapie gelernt, positiver zu denken. 8 30.8 11 42.3 6 23.1 1 3.8 0 0 Ergebnisse 70 Ich habe genügend Einfluss auf die Behandlung gehabt. 6 23.1 15 57.7 2 7.7 3 11.5 0 0 Ich habe in der Therapie eine Hilfestellung erhalten, um in meinem Leben etwas Grundsätzliches zu verändern, das ich bisher nicht ändern konnte. 10 38.5 10 38.5 5 19.2 1 3.8 0 0 In der Therapie wurden genau die Problembereiche bearbeitet, die mir wichtig waren. 6 23.1 11 42.3 8 30.8 0 0 1 3.8 In der Therapie sind alle meine Möglichkeiten, klarer zu sehen und Probleme besser lösen zu können, erkannt und ausgeschöpft worden. 1 3.8 16 61.5 8 30.8 0 0 1 3.8 Meine Zufriedenheit mit den therapeutischen Maßnahmen ist im Verlauf der Behandlung gestiegen. 7 26.9 13 50.0 6 23.1 0 0 0 0 Ich weiß jetzt, wie ich meine Ziele erreichen kann. 7 26.9 15 57.7 2 7.7 1 3.8 1 3.8 Die im Fragebogen eingesetzte Likert-Skala beschreibt die Zustimmung von 1 = „gar nicht“ bis 5 = „voll“. Je höher der Punktwert, umso zufriedener waren die Patienten mit der Behandlung. Auf den beiden Skalen können jeweils minimal 9 Punkte und maximal 45 Punkte erreicht werden, auf der Gesamtskala minimal 18 und maximal 90 Punkte. Der Median für den Gesamtwert liegt bei 37, für die Skala Gesamtzufriedenheit (Skala 1) bei 20 und für die Skala Persönlicher Nutzen (Skala 2) bei 17. Die statistischen Kennwerte sind in Tabelle 8 dargestellt. Tabelle 8 Statistische Kennwerte des MFBP-18 (eigene Daten) Deskriptive Statistik MFBP-18 Skala 1 Skala 2 Gesamt Mittelwert 20.37 17.93 38.30 SD 3.26 5.09 7.17 Median 20 17 37 Schiefe 1.73 0.90 1.49 Kurtosis 5.27 0.34 2.70 Ergebnisse 71 Minimum 16.00 10.00 28.00 Maximum 32.00 30.00 60.00 Range 16.00 20.00 32.00 7.3 Korrelation der Patientenzufriedenheit mit Outcomes 7.3.1 Assoziation zwischen der Zufriedenheit und der Alltagskompetenz Bei der Berechnung des Pearsonschen Korrelationskoeffizienten zeigte sich zwischen der Patientenzufriedenheit und der sozialen Integration in zwei Bereichen eine signifikante Assoziation. Die Patientenzufriedenheit korrelierte moderat mit dem Bereich Freizeit + Soziales zum Zeitpunkt der Katamnese (r = 0,407; p = 0,039) sowie mit dem Bereich Finanzen zum Zeitpunkt der Katamnese (r = 0,407; p = 0,015). Keine statistisch signifikante Assoziation konnte mit der Skala Zufriedenheit mit der Therapie und den Domänen der sozialen Integration nach 6 Monaten gefunden werden. 7.3.2 Assoziationen zwischen Patientenzufriedenheit und Depressivität Zum Zeitpunkt der Entlassung zeigten nur noch 6 Patienten (23,1 %) eine klinisch relevante depressive Symptomatik (zum Vergleich: bei Aufnahme 26 Patienten, 100 %), 7 Patienten konnten als „mild“ eingestuft werden (26,9 %) und 12 Patienten (50,0 %) zeigten einen klinisch unauffälligen BDI-Wert. Zwischen der Patientenzufriedenheit und dem Schweregrad der depressiven Symptomatik zum Zeitpunkt der Entlassung zeigen sich statistisch signifikante Korrelationen zwischen der Skala 2 (Persönlicher Nutzen) und dem BDI (r = 0,529, p = 0,005) sowie der Gesamtzufriedenheit mit dem BDI-Wert (r = 0,518, p = 0,007). Nach 6 Monaten zeigt sich ein geringerer Korrelationsgrad zwischen dem Persönlichen Nutzen und dem BDI-Wert, bleibt aber statistisch signifikant (r = 0,425, p = 0,03). Die Gesamtzufriedenheit korreliert zum Zeitpunkt der Katamnese nicht mehr mit dem BDI. Tabelle 9 Korrelation zwischen MFBP und BDI bei Entlassung und nach 6 Monaten (eigene Daten) Ergebnisse Skala 1 Skala 2 Gesamt 72 BDI bei Entlassung BDI nach 6 Monaten Korrelationskoeffizient nach Pearson 0,312 0,171 Signifikanz (2-seitig) 0,120 0,403 N 26 26 Korrelationskoeffizient nach Pearson 0,529** 0,425* Signifikanz (2-seitig) 0,005 0,030 N 26 26 Korrelationskoeffizient nach Pearson 0,518** 0,380 Signifikanz (2-seitig) 0,007 0,056 N 26 26 ** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. * Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. Ergebnisse 73 Tabelle 10 Korrelation des MFBP-18 mit den Domänen der Social Adjustment Scale (eigene Daten) MFBP18 Arbeit Freizeit und Soziales Verwandtschaft Partnerschaft Elternschaft Familienzusammenhalt Finanzen Gesamtwert N r p r p r p r p r p r p r p r p Skala 1 26 0.141 0.494 0.071 0.731 -0.286 0.156 0.073 0.724 0.247 0.225 -0.330 0.100 0.043 0.835 0.089 0.665 Skala 2 26 0.112 0.585 ,407* 0.039 0.035 0.866 0.071 0.732 0.156 0.445 -0.066 0.747 ,470* 0.015 0.305 0.130 Gesamt 26 0.144 0.484 0.256 0.206 -0.105 0.608 0.017 0.934 0.223 0.273 -0.197 0.335 0.353 0.077 0.176 0.390 *. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. Skala 1 = Gesamtzufriedenheit mit Therapie, Skala 2 = Persönlicher Nutzen Diskussion 74 8 Diskussion Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Untersuchung im Kontext der Forschungsfragen diskutiert und bewertet werden. 8.1 Hypothesenbildung Ausgehend von der oben beschriebenen Problematik widmet sich die vorliegende Studie der Untersuchung dieser Parameter in einer tagesklinischen Einrichtung, die depressiv Erkrankte nach psychotherapeutischen Konzepten behandelt. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt hierbei in der Analyse der Patientenzufriedenheit und der Symptomveränderung, nicht nur im Rahmen des tagesklinischen Settings, sondern vor allem in einer Katamneseerhebung. Zu den untersuchten Patienten gehörten Patienten, die tagesklinisch in der Tagesklinik Alteburger Straße auf der Tageseinheit C für 12 Wochen behandelt wurden. Zur Evaluierung und empirischen Erfassung der Zielstellung wurden entsprechende Forschungsfragen und Forschungshypothesen formuliert, die unten ersichtlich sind. In der Nullhypothese wird angenommen, dass der Grad der Patientenzufriedenheit mit der psychiatrisch-psychotherapeutischen Tagesklinik keinen Prädiktor für eine objektive Symptomveränderung und einen messbaren Grad sozialer Integration 6 Monate nach Therapieende, gemessen an der Veränderung des BDI und des SASSR, darstellt. Aufgrund der spezifischen Arbeitsweise der psychiatrisch-psychotherapeutischen Tagesklinik am Beispiel der Tagesklinik Alteburger Straße werden jedoch sowohl eine symptomatische Besserung anhand der Ausprägung depressiven Erlebens als auch eine Veränderung in der sozialen Integration der Patienten erwartet. Die Fragestellung dieser Arbeit ist, ob es einen Zusammenhang zwischen der subjektiven Patientenzufriedenheit und der Veränderung der Alltagskompetenzen des Patienten gibt. Eine Verbesserung der Alltagskompetenz wird in einer Verbesserung in den wichtigen Bereichen sozialen Lebens, wie Arbeit, Familie und Beziehungsgestaltung, ihren Niederschlag finden, und sollte auch ein halbes Jahr nach der Entlassung messbar sein. Forschungsfrage 1: Gibt es eine Veränderung der depressiven Symptomatik über die drei Untersuchungszeitpunkte hinweg? Diskussion 75 Forschungsfrage 2: Stellt der Grad der Patientenzufriedenheit im psychotherapeutischpsychiatrischen Setting einer Tagesklinik gemessen an den Veränderungen im BDI und dem SASSR einen Prädiktor für eine objektive Symptomveränderung dar? Forschungsfrage 3: Inwieweit kann die Patientenzufriedenheit sechs Monate nach Beendigung einer 12-wöchigen psychiatrisch-psychotherapeutischen tagesklinischen Behandlung gemessen an den Veränderungen im BDI und dem SASSR als Prädiktor sozialer Integration bewertet werden? Forschungsfrage 4: Besteht ein Zusammenhang zwischen der sozialen Integration, der Arbeit, der Partnerschaft und dem Familienzusammenhalt nach Abschluss einer 12-wöchigen psychiatrisch-psychotherapeutischen tagesklinischen Behandlung zum Zeitpunkt der Entlassung und sechs Monate nach Entlassung gemessen an den Werten des SASSR? Forschungsfrage 5: Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Schwere der Depression und den Werten des BDI zum Entlassungszeitpunkt sowie sechs Monate später nach Abschluss einer 12-wöchigen psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung? Forschungsfrage 6: Wie stark ist die Korrelation zwischen dem persönlichen Nutzen und den Werten des BDI zum Entlasszeitpunkt sowie sechs Monate später nach Abschluss einer 12wöchigen psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung? Forschungsfrage 7: Hat der psychoanalytische Ansatz in der tagesklinischen Behandlung von Depressionspatienten einen besseren Outcome als der klassische psychotherapeutische Ansatz? Hypothese 1.1: Eine 12-wöchige tagesklinische Behandlung von Patienten mit Depressionen wirkt sich positiv auf die Patientenzufriedenheit aus. Hypothese 1.2: Die Patientenzufriedenheit ist auch sechs Monate nach Beendigung einer 12wöchigen psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung im Rahmen eines tagesklinischen Settings hoch. Hypothese 2.1: Der Grad der Patientenzufriedenheit gemessen an den Veränderungen im BDI und SASSR stellt einen Prädiktor für eine objektive Symptomveränderung dar. Hypothese 2.2: Der Grad der Patientenzufriedenheit gemessen an den Veränderungen im BDI und SASSR stellt nach Beendigung einer 12-wöchigen tagesklinischen Depressionsbehandlung einen Prädiktor für eine objektive Symptomveränderung dar. Diskussion 76 Hypothese 2.3: Der Grad der Patientenzufriedenheit gemessen an den Veränderungen im BDI und SASSR stellt auch sechs Monate nach Beendigung einer 12-wöchigen tagesklinischen Depressionsbehandlung einen Prädiktor für eine objektive Symptomveränderung dar. Hypothese 3.1: Die Patientenzufriedenheit kann nach Beendigung einer 12-wöchigen tagesklinischen Depressionsbehandlung gemessen an den Veränderungen im BDI und SASSR als Prädiktor sozialer Integration gewertet werden. Hypothese 3.2: Die Patientenzufriedenheit kann auch sechs Monate nach Beendigung einer 12-wöchigen tagesklinischen Depressionsbehandlung gemessen an den Veränderungen im BDI und SASSR als Prädiktor sozialer Integration gewertet werden. Hypothese 4.1: Es besteht ein Zusammenhang zwischen der sozialen Integration, der Arbeit, der Partnerschaft und dem Familienzusammenhalt als Ausdruck einer Veränderung der Alltagskompetenz des Patienten und den Werten des SASSR nach Abschluss einer 12-wöchigen psychiatrisch-psychotherapeutischen tagesklinischen Behandlung. Hypothese 4.1: Es besteht ein Zusammenhang zwischen der sozialen Integration, der Arbeit, der Partnerschaft und dem Familienzusammenhalt als Ausdruck einer Veränderung der Alltagskompetenz des Patienten und den Werten des SASSR auch sechs Monate nach Abschluss einer 12-wöchigen psychiatrisch-psychotherapeutischen tagesklinischen Behandlung. Hypothese 5.1: Der psychoanalytische Ansatz in der tagesklinischen Behandlung von Depressionspatienten hat einen signifikant besseren Outcome als der psychotherapeutische Ansatz in der tagesklinischen Behandlung von Depressionspatienten. Hypothese 5.2: Der psychoanalytische Ansatz in der Behandlung von Depressionspatienten hat sowohl im tagesklinischen als auch im stationären Setting einen besseren Outcome als der psychiatrisch-psychotherapeutische Ansatz. 8.2 Der Stellenwert der Tageskliniken in der Depressionsbehandlung Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die in der Studie erfassten Patienten von der tagesklinischen Behandlung in mehreren Bereichen profitiert haben. Der Grad der depressiven Verstimmung reduzierte sich signifikant, sodass zum Zeitpunkt der Entlassung nur noch 6 Patienten (23,1 %) eine klinisch relevante depressive Symptomatik (zum Vergleich: bei Aufnahme 26 Patienten, 100 %) zeigten. Immerhin 12 Patienten (50,0 %) zeigten zu diesem Diskussion 77 Zeitpunkt einen klinisch unauffälligen BDI-Wert. Zum Zeitpunkt der Katamnese stieg der mittlere BDI auch nicht mehr signifikant an (12,1 Punkte). Auch der Grad der sozialen Integration verbesserte sich erheblich. Der Gesamtwert der sozialen Integration verringert sich signifikant von im Mittel 2,66 (SD +/-0,61) auf 2,32 (SD +/-0,50) Punkten. Damit näherte sich die im SASSR-Test gemessene soziale Integration dem Wert der Normstichprobe an. Es ist auffällig, das sich besonders der Familienzusammenhalt verbesserte. Die Veränderung des mittleren Punktwerts des Items „Finanzen“ weicht von den anderen gemessenen Werten im SASSR deutlich ab und erhöht sich zwischen dem Zeitpunkt der Anamnese und Katamnese signifikant. Im SASSR wird zum Thema Finanzen die Situation der Patienten nur mit einer Frage abgebildet: „Hatten Sie in den letzten zwei Wochen genug Geld, um ihre eigenen Bedürfnisse und die ihrer Familie erfüllen zu können?“ Schwer depressive Patienten weisen ein niedrigeres Aktivitätsniveau auf als die Normalbevölkerung und haben so auch weniger das subjektive Gefühl, dass ihre Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Steigt das Leistungs- und Funktionsniveau an, so wird den Patienten deutlich, dass ihr finanzieller Rahmen einige Aktivitäten einschränken kann und so wächst die Unzufriedenheit mit der Situation. Dies kann erklären, warum im Gegensatz zu den anderen Parametern des SASSR das Item „Finanzen“ in der Katamnese einen höheren Wert aufweist. Diskussion 78 3.5 Arbeit Freizeit+Soziales 3 Verwandte 2.5 Partnerschaft 2 Eltern 1.5 Familienzusammen halt Finanzen 1 0.5 Gesamtwert 0 SASSR T0 SASSR T2 Abbildung 2. Veränderungen der Einzelitems des SASSR (eigene Daten) Die depressiven Patienten, die in der Studie untersucht wurden, waren durchschnittlich sehr zufrieden mit der Therapie. 34 % der Patienten waren voll zufrieden, immerhin 41 % überwiegend zufrieden. Die Patientenzufriedenheit korrelierte moderat mit dem Bereich „Freizeit und Soziales“ im SASSR zum Zeitpunkt der Katamnese sowie invers mit dem Bereich „Finanzen“ zum Zeitpunkt der Katamnese. Keine statistisch signifikante Assoziation konnte mit der Skala Zufriedenheit mit der Therapie und den anderen Domänen der sozialen Integration nach sechs Monaten gefunden werden. Durch das Konzept der tagesklinischen Behandlung als eine Gruppenbehandlung gilt ein besonderes Augenmerk der Interaktion zwischen den Patienten. Diese Ausrichtung kann die soziale Interaktionsfähigkeit der Patienten positiv beeinflussen. Laut Grawe (1995) gibt es in der Psychotherapie folgende Wirkfaktoren: Diskussion 1. Therapeutische 79 Beziehung: „Die Qualität der Beziehung zwischen dem Psychotherapeuten und dem Patienten/Klienten trägt signifikant zu einem besseren oder schlechteren Therapieergebnis bei.“ (Grawe 1995, S. 130 ff.) 2. Ressourcenaktivierung: „Die Eigenarten, die die Patienten in die Therapie mitbringen, werden als positive Ressource für das therapeutische Vorgehen genutzt. Das betrifft vorhandene motivationale Bereitschaften, Fähigkeiten und Interessen der Patienten.“ (Grawe 1995, S. 130 ff.) 3. Problemaktualisierung: „Die Probleme, die in der Therapie verändert werden sollen, werden unmittelbar erfahrbar. Das kann z. B. dadurch geschehen, dass Therapeut und Klient reale Situationen aufsuchen, in denen die Probleme auftreten, oder dass sie durch besondere therapeutische Techniken wie intensives Erzählen, Imaginationsübungen, Rollenspiele die Probleme erlebnismäßig aktualisieren.“ (Grawe 1995, S. 130 ff.) 4. Motivationale Klärung: „Die Therapie fördert mit geeigneten Maßnahmen, dass der Patient ein klareres Bewusstsein der Determinanten (Ursprünge, Hintergründe, aufrechterhaltende Faktoren) seines problematischen Erlebens und Verhaltens gewinnt.“ (Grawe 1995, S. 130 ff.) 5. Problembewältigung: „Die Behandlung unterstützt den Patienten mit bewährten problemspezifischen Maßnahmen (direkt oder indirekt) darin, positive Bewältigungserfahrungen im Umgang mit seinen Problemen zu machen.“ (Grawe 1995, S. 130 ff.) 8.3 Die Tagesklinik Alteburger Straße und ihr psychoanalytischen Therapieansatz Während der tagesklinischen Behandlung wird im Behandlungssetting der Tageseinheit C besonderer Wert auf die Umsetzung und Alltagstauglichkeit der Veränderungen in den Interaktionen der Patienten gelegt. Hier kann in den analytischen Psychotherapiegruppen die motivationale Klärung erfolgen, d. h., der Patient versteht, auf welcher Grundlage er in Handlungs- und Denkmuster, welche die Depression fördern, verwoben ist. Gleichzeitig wird im Alltag auf der Station das aktuell auftretende Problem – häufig mit Mitpatienten oder Teammitgliedern – gespiegelt und im Konkreten verändert. Dies erfolgt auch in der Soziogruppe mithilfe von Rollenspielen, sodass der Patient alternative Handlungsmöglichkeiten erproben kann. Es wird dem Patienten so möglich, positive Erfahrungen mit der Umsetzung neuer, realitätsangepasster Verhaltensweisen zu gewinnen und ein besseres Gefühl seiner Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Diskussion 80 Zwischen der Patientenzufriedenheit und dem Schweregrad der depressiven Symptomatik zum Zeitpunkt der Entlassung zeigen sich statistisch signifikante Korrelationen zwischen der Skala 2 (persönlicher Nutzen) und dem BDI (r = 0,529, p = 0,005) sowie der Gesamtzufriedenheit mit dem BDI-Wert (r = 0,518, p = 0,007). Nach 6 Monaten zeigt sich ein geringerer Korrelationsgrad zwischen dem persönlichen Nutzen und dem BDI-Wert, bleibt aber statistisch signifikant (r = 0,425, p = 0,03). Die Gesamtzufriedenheit korreliert zum Zeitpunkt der Katamnese nicht mehr mit dem BDI. Während die Skala 1 nicht mit der Reduktion des BDI korreliert, ist dies bei der Skala 2 (persönlicher Nutzen) anders. Wie eingangs erwähnt, bildet die Patientenzufriedenheit mit der Therapie nicht unbedingt die objektiv erhaltene Leistung ab, da hier die Erwartungshaltung des Patienten eine große Rolle spielt. Die Korrelation zwischen dem subjektiv empfundenen persönlichen Nutzen und der Verringerung der depressiven Symptome spricht allerdings dafür, dass die Patienten sehr wohl ihren persönlichen Nutzen aus der Behandlung beurteilen können. Die Verbesserung der Beziehungen zu anderen (Frage 2) oder die Veränderung von Freizeitgewohnheiten (Frage 10) sowie die Vergrößerung des Selbstvertrauens (Frage 4) sind Parameter, die in diese Skala einfließen. Wenn sich der konkret erlebbare Alltag der Patienten ändern kann, dann ist eine Veränderung der Depression fördernden und Depression aufrechterhaltenden Denk- und Handlungsmuster möglich. Welche einzelnen Maßnahmen während der komplexen und multimodalen Behandlung in der Tagesklinik eine besonders intensive Rolle bei der Bewältigung der Depression spielen, sollte sicherlich an anderer Stelle noch intensiver erforscht werden. 8.4 Der Stellenwert der Tagesklinik in der Behandlung traumabedingter Depressionen und Depressionen im Kontext von Traumafolgestörungen In ihrer Meta-Analyse aus dem Jahr 2015 untersuchte Leuzinger-Bohleber die Auswirkungen der psychoanalytischen Therapie nicht nur bei Depressionen, sondern auch bei traumabedingter Depression (vgl. Leuzinger-Bohleber 2015). Hierbei wurden die Ergebnisse der OutcomeStudie der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft und der Comparative outcome study on chronic depression (LAC Study) vorgestellt. Im Rahmen der Outcome-Studie der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft wurden 400 Patienten untersucht, die zwischen 1990 und 1993 eine psychoanalytische Therapie erhalten haben (vgl. Leuzinger-Bohleber 2015). Das Studienkollektiv der LAC-Study umfasste ebenfalls rund 400 chronisch depressive Pati- Diskussion 81 enten. Dabei konnte sie nachweisen, dass die traumabedingte Depression eine Art Schutzmechanismus des Patienten darstellt, mit deren Hilfe er versucht, mit dem Traumaschmerz umzugehen (vgl. Leuzinger-Bohleber 2015). Die inneren Prozesse und dissoziativen Strukturen bei Traumapatienten bergen zudem in einer Psychoanalyse die Gefahr der Retraumatisierung, da das Trauma geleugnet wird (vgl. Leuzinger-Bohleber 2015). Obgleich die Psychoanalyse über eine laut Leutzinger-Bohleber hoch differenzierte Konzeptualisierung für diese Patientenklientel verfügt, wird sie aufgrund der defizitären Studienlage in der Fachwelt nicht ausreichend beachtet und wahrgenommen (vgl. Leuzinger-Bohleber 2015). 8.5 Vergleich der Effizienz des psychotherapeutischen und psychoanalytischen Ansatzes in der tagesklinischen Behandlung von Depressionspatienten Insgesamt ist die empirische Datenlage zur Anwendung des psychoanalytischen Therapieansatzes in Tageskliniken zur Behandlung von Depressionen und dessen Vergleich mit dem klassischen psychotherapeutischen Therapieansatz gering. Hieraus ergeben sich inhomogene Ansichten über den Vorteil eines der beiden Verfahren (vgl. Brown und Tracy 2014). Dabei umfasst der psychoanalytische Ansatz weit mehr als die klassische von Freud beschriebene Psychoanalyse und wird durch verschiedene Elemente der psychodynamischen Psychotherapie, die sich dem Konzept der multipersonellen Übertragung der Psychoanalyse bedient, ergänzt (vgl. Brown und Tracy 2014). Der Vorteil des psychoanalytischen Ansatzes liegt dabei in seiner direkten Fokussierung auf die inneren Prozesslandschaften des Patienten, die in der klassischen Psychotherapie oft erst im Verlauf erfasst werden, da manche psychotherapeutischen Ansätze derart auf praktische Handlungsanweisungen fokussiert sind, dass auf die intrapsychischen Prozesse des Patienten nicht eingegangen wird. In ihrer Meta-Analyse aus dem Jahr 2014 haben Brown und Tracy die Wirksamkeit der psychoanalytischen Therapie genau vor diesem Hintergrund untersucht. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass in der Kurzzeittherapie der psychoanalytische Ansatz dem der klassischen Verhaltenstherapie signifikant überlegen ist. Die untersuchten Studien machten jedoch keine Differenzierung beider Ansätze nach einzelnen Krankheiten wie Depression möglich (vgl. Brown und Tracy 2014). Anders sah es in den von beiden Forschern analysierten Studien zum Vergleich der Langzeittherapie aus, zu denen auch die Travistock Adult Depression Study gehörte. Hier lagen Daten zur Differenzierung beider Therapieansätze bezüglich verschiedener spe- Diskussion 82 zifischer psychiatrischer Erkrankungen vor, welche einen Vorteil des psychoanalytischen Ansatzes unterstellten, jedoch zu inkonsistent waren. Die Problematik begründete sich vor allem in den zu allgemein gehaltenen Endzielen. Darüber hinaus beschrieben Brown und Tracy (2014) den sog. Sleeper-Effect, der sich unter der psychoanalytischen Therapie einstellt und eine intrapsychische Transformation beschreibt, die sich jedoch erst lange nach Therapieende in Verhaltensänderungen oder Beziehungsstrukturen der Patienten zeigt (vgl. Brown und Tracy 2014). Diese Späteffekte, die unter psychoanalytischer Therapie signifikant häufiger anzutreffen sind als unter klassischer Psychotherapie, machen die Erfassung der Effizienz in Studien schwierig, da es eines hinreichend langen Follow-ups bedürfte, um wirklich alle therapieassoziierten Veränderungen messen und evaluieren zu können (vgl. Brown und Tracy 2014; Leuzinger-Bohleber 2013). Die bereits von Brown und Tracy (2014) erwähnte groß angelegte randomisiert-kontrollierte Studie zur Effizienz der psychoanalytischen Therapie als Langzeittherapie bei therapieresistenter Depression konnte die Effizienz dieses Therapieansatzes im Langzeit-Outcome nachweisen (vgl. Fonagy et al. 2015). Hier wurden Zwischen 2002 und 2009 insgesamt 129 Patienten in die Studie aufgenommen, in eine Interventionsgruppe (Anwendung von Psychoanalyse) und eine Kontrollgruppe unterteilt und einem Langzeit-Follow-up von zwei Jahren unterzogen. Das Durchschnittsalter der Patienten betrug 42.7 Jahre bei einem Frauenanteil von 66.7% (vgl. Fonagy et al. 2015). Alle Patienten litten an einer mindestens zweijährigen nachgewiesenen Major-Depression. Obgleich die Psychoanalyse mit einem besseren Outcome assoziiert war, gab es keine signifikante Überlegenheit der Psychoanalyse bezüglich der Vollremission (vgl. Fonagy et al. 2015). Daneben konnten Fonagy und Kollegen die Überlegenheit der Psychoanalyse im Langzeitverlauf nachweisen und untermauerten damit die Ergebnisse der Finnischen Longitudinalstudie aus dem Jahr 2008 (vgl. Fonagy et al. 2015; Knekt et al. 2008). Knekt und Kollegen (2008) untersuchten die Psychoanalyse als solche im Kurz- und Langzeit-Setting. Näher erklärt wurden diese Phänomene von Leuzinger-Bohleber (2013). Sie beschrieb die Abhängigkeit der Psychoanalyse bei depressiven Patienten von intrapsychischen Prozessen des Patienten, die in einem individuellen nicht zu beschleunigenden Rhythmus ablaufen (vgl. Leuzinger-Bohleber 2013). Aufgrund ihrer unbeeinflussbaren Individualität im Ablauf werden diese Prozesse in der Psychoanalyse auch als urzeitgemäß bezeichnet. Durch diesen werden die Erfassung und Evaluierung des Therapieerfolges schwieriger im Vergleich zur Psychotherapie, was insbesondere die Diskussion 83 Darlegung des Therapieerfolges und Therapiefortschrittes gegenüber den Leistungsträgern erschwert, zumal es kein Assessment gibt, was die intrapsychisch ablaufenden Transformationsprozesse abbilden könnte, die nach Leuzinger-Bohleber (2013) in der Psychoanalyse von Depressionspatienten ein Indikator für eine psychische Veränderung und damit einen Therapiefortschritt darstellen. Diese als Cracking-ups bezeichneten Transformationsprozesse spiegeln die Veränderung der intrapsychischen, von Traumata geprägten Objektwelt der Patienten wider (vgl. Leuzinger-Bohleber 2013). Angestoßen werden diese Prozesse durch die intensiven Interaktionen zwischen Patient und Therapeut in einem geschützten Rahmen. Hier zeigen sich deutliche Parallelen zur nicht psychoanalytischen Traumatherapie. Insgesamt sind diese intrapsychischen Prozesse unabdingbar, um sowohl die Weitergabe der Depression als auch die des Traumas in Form einer transgenerationalen Weitergabe unterbrechen zu können (vgl. Leuzinger-Bohleber 2013). Untersucht wurden diese Prozesse in der LAC-Depressionsstudie, in der u. a. die psychoanalytischen und psychotherapeutischen Therapieansätze bei Patienten mit chronischen Depressionen analysiert wurden. Hier zeigte sich, dass die Indikationsstellung zum jeweiligen Therapieansatz individuellen Faktoren unterworfen ist, die z. B. darin bestehen, welche Problemlösungsstrategien der Patient bisher angewandt hat und welche Ursache der Depression zugrunde liegt (vgl. Leuzinger-Bohleber 2013). Je nachdem, ob die Problemlösungsstrategien der Patienten eher erkenntnis- oder verhaltenstheoretischen Charakter haben, kommt die entsprechende Therapie zum Einsatz. Wird der Versuch unternommen, chronisch depressive Patienten mit einem Therapieansatz zu behandeln, der ihrer individuellen und intrapsychischen Problemlösungsstrategie entgegenwirkt, bleiben die Therapieerfolge trotz Bemühung der Patienten oftmals aus (vgl. Leuzinger-Bohleber 2013). Umso wichtiger ist es, klare Indikationen für oder gegen die Psychoanalyse zu stellen. Letztlich kann man feststellen, dass sich bei Patienten, bei denen die Indikation zur Psychoanalyse als Behandlungsform der Depression besteht, der psychoanalytische Therapieansatz im tagesklinischen Setting aufgrund der oben vorgestellten Studienergebnisse als effektiver darstellt als die klassische Psychotherapie z. B. in Form der Verhaltenstherapie. 8.6 Vergleich Bearbeitung pathologischer Bindungsmuster im tagesklinischen und stationären Setting Pathologische Bindungs- und Beziehungsmuster finden sich bei Patienten mit Traumafolgestörungen und traumaassoziierten Störungen wie der Depression in hohem Maß. Vor allem Diskussion 84 frühkindliche Traumatisierungen gehen mit pathologischen Bindungsmustern einher, die sich im Erwachsenenleben der Patienten als pathologische Beziehungsmuster darstellen. Sowohl im stationären als auch im tagesklinischen Setting können diese Bindungsmuster evaluiert und bearbeitet werden. Ob sich für den jeweiligen Patienten hierzu ein tagesklinisches Setting mehr eignet als ein vollstationäres Setting, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Vor allem bei Traumapatienten und bei Patienten mit traumabedingten Depressionen kann die Bearbeitung der pathologischen Bindungsmuster ein stationäres Setting unabdingbar machen. Dieser Fall liegt in der Regel dann vor, wenn es sich um komplexe Traumafolgestörungen handelt und die Täter, die zur Ausbildung dieser Störung führten, im sozialen und familiären Umfeld der Patienten zu finden sind und dort weiterhin einen Kontakt zum Patienten unterhalten. Hier kann die tagesklinische Struktur, bei welcher der Patient am Nachmittag in die Häuslichkeit zurückkehrt, zu einer Retraumatisierung oder einer ausgeprägten Dissoziation führen, wenn der Patient in der Erkenntnis des Bindungsmusters und des Gewahrwerdens der Täter sich diesen im häuslichen Bereich wieder gegenübergestellt sieht. Bei diesen Patienten setzt die intensive Bearbeitung der pathologischen Bindungsmuster und ihrer Ursachen in der Tagesklinik die vorherige Trennung aus dem Täterumfeld voraus. Sofern dies nicht möglich ist, weil es sich bei den Tätern z. B. um nahe Verwandte handelt, ist für die Bearbeitung der Bindungsproblematik ein vollstationäres Setting zu empfehlen, zumal mit der Bearbeitung der Bindungsproblematik bei komplex traumatisierten Patienten mit und ohne Depression meistens eine Erinnerung an die zugrunde liegenden Traumata stattfindet. Kann ein Täterkontakt ausgeschlossen werden, so kann die Bearbeitung der pathologischen Bindungsmuster und ihrer Ursachen auch im tagesklinischen Setting erfolgen. Hierfür bieten sich sowohl klassische psychotherapeutische Tageskliniken als auch psychoanalytische Tageskliniken an. In allen tagesklinischen Konzepten bieten Therapeuten, Mitarbeiter und Mitpatienten eine ausreichende Plattform, um derartige Bindungsproblematiken erkennen und beheben zu können. Dennoch scheint der psychoanalytische Ansatz der Tagesklinik, wie er sich in der Tagesklinik Alteburger Straße gGmbH findet, für die Bearbeitung von Bindungsproblematiken insgesamt besser geeignet zu sein, vorausgesetzt der Patient bringt die entsprechende Indikation mit und der psychoanalytische Ansatz entspricht den Lösungsstrategien des Patienten (vgl. Leuzinger-Bohleber 2013). Unbewusst überwiegt bei den meisten Patienten ein Lösungsstil, der entweder auf die Erkennung und Analyse der Probleme im Sinn der Psychoanalyse oder auf die rasche Lösungsorientierung durch Erlernen und Anwenden praktischer Handlungsempfehlungen im Sinn der Diskussion 85 Verhaltenstherapie ausgerichtet ist. Hier hat die LAC-Depressionsstudie eindeutig nachgewiesen, dass Patienten im verhaltenstherapeutischen Lösungsstil nicht vom psychoanalytischen Therapieansatz profitieren (vgl. Leuzinger-Bohleber 2013). Bei Patienten, bei denen eine Indikation zur Psychoanalyse besteht, kann der tagesklinisch psychoanalytische Ansatz durch die Ermöglichung der Externalisierung intrapsychischer Prozesse und Ich-Strukturen dazu beitragen, dass Bindungsproblematiken sowohl für den Therapeuten als auch für den Patienten ersichtlich werden, wobei der Patient diese vor allem in der Gruppentherapie oder in Gruppenunternehmungen wie der gemeinsamen Freizeitgestaltung erkennt. Sind die Bindungsprobleme des einzelnen Patienten erkannt, bietet ihm der tagesklinisch- psychoanalytische Ansatz die Möglichkeit, die erfahrenden defizitären Beziehungen und frühkindlichen Bindungen zu externalisieren und im Kontext der Übertragung mit dem Therapeuten und den Mitpatienten ein gesundes Beziehungsmuster zu entwickeln. Dabei wirken sowohl der Therapeut als auch Mitpatienten, wie im nachfolgenden Kapitel beschrieben, als Spiegel der inneren Landschaft des Patienten und der verschieden ausgeprägten IchStrukturen, was sich durch das Konzept der multipersonellen Übertragung erklären lässt. 8.7 Die multipersonelle Übertragung im tagesklinischen Setting Die multipersonelle Übertragung, auch multipersonale Übertragung genannt, gehört zu den Übertragungs-Gegenübertragungsphänomenen in der Psychotherapie und Psychoanalyse (vgl. Dinger 2012). Neben ihren nachteiligen Auswirkungen auf den Therapieverlauf macht man sich die multipersonelle Übertragung sowohl im psychotherapeutischen als auch im psychoanalytischen Setting zunutze. Schon in den 1980er-Jahren wurden in deutschen Kliniken psychoanalytische Therapiekonzepte entwickelt, die sich der multipersonellen Übertragung bedienten und sich an die psychoanalytische Kreativitätsforschung anlehnten (vgl. Scheytt und Janssen 2013). Eines dieser Modelle was das „Essener integrative analytisch- psychotherapeutische Behandlungsmodell“, das den Patienten erlauben sollte, „ihre inneren Probleme im multipersonalen Beziehungsfeld zu reinszenieren, damit sie im Hier und Jetzt mit Hilfe der Therapeuten Einblick in die infantile Welt der Objektbeziehungen erhalten und über neue Einsichten und Erfahrungen in den therapeutischen Beziehungen eine innere Veränderung ableiten können“ (Scheytt und Janssen 2013, S. 203). Derartige Konzepte können in verschiedenen Therapieformen eingesetzt werden und in gruppentherapeutischen Interventionen ebenso gute Ergebnisse erzielen wie in der Einzel- oder der Musiktherapie (vgl. Scheytt und Janssen 2013). Diskussion 86 Die damit für den Patienten einhergehende sog. subjektive Objektivierung schafft einen Raum, in dem der Patient sich weniger angstbesetzt seinem Erleben und seinen Erfahrungen widmen und dem der Grundstörung zugehörenden defizitären Bereich nacheifern kann. Letzteres ist beispielsweise im Bereich Beziehung und Kreativität möglich. Vor diesem Hintergrund sind Konzepte, die ihren Schwerpunkt auf die multipersonelle Übertragung legen, insbesondere für Patienten mit Traumafolgestörungen und traumaassoziierten Störungen wie Depression geeignet und sie eignen sich ebenfalls im tagesklinischen Ansatz. Foulkes sieht die Wirkung der multipersonellen Übertragung in der sozialen Determiniertheit des Bewusstseins, die dazu führt, dass das Ich des Patienten einen Gegenpart benötigt, in dem er sich spiegeln kann, um zu Erkenntnissen zu gelangen (vgl. Foulkes zit. in Dinger 2012). Dieser Spiegel wird in der multipersonellen Übertragung durch den Therapiepartner in dem jeweiligen therapeutischen Setting dargestellt. Die sich so gestaltende Erlebniswelt kann für die Patienten im Hier und Jetzt nach Foulkes zur Schnittstelle zwischen früheren Erlebnissen und Erfahrungen und aktuellen Erlebnissen und Erfahrungen werden (vgl. Dinger 2012). Unabhängig davon, ob man die multipersonelle Übertragung im Einzelsetting zwischen Patient und Therapeut bewertet oder im Gruppensetting zwischen mehreren Patienten, die Interaktionen, die von Foulkes als Netzwerk beschrieben werden, werden von einer gemeinsamen Basis aller Beteiligten bestimmt, die wiederum Ausgangspunkt der gemeinsamen Kommunikation ist (vgl. Dinger 2012). Innerhalb dieses interpersonalen Netzwerkes kommt es zur Ausbildung von intrapsychischen, transpersonalen und interpersonalen Beziehungen, die eine Externalisierung der intrapsychischen Prozesse des einzelnen Patienten gestatten (vgl. Dinger 2012). Mittels dieser Externalisierung können die Abwehrmechanismen und intrapsychischen Auswirkungen des einzelnen Patienten erkannt werden, da sie spiegelbildlich in der Reaktion des Gegenübers abgelesen werden können (vgl. Dinger 2012). Zusammenfassung und Ausblick 87 9 Zusammenfassung und Ausblick 9.1 Zusammenfassung der forschungsfragenspezifischen Ergebnisse Im folgenden sollen die eingangs definierten Forschungsfragen unter Berücksichtigung der empirischen Studienergebnisse, der aktuellen Datenlage und der Ergebnisse der Diskussion zusammenfassend beantwortet werden. Forschungsfrage 1: Gibt es eine Veränderung der depressiven Symptomatik über die drei Untersuchungszeitpunkte hinweg? Der mittlere BDI reduzierte sich über die Zeit hinweg signifikant vom Beginn der Behandlung mit 29,6 (t0) Punkten auf 11,3 Punkte zum Zeitpunkt der Entlassung (t1) (p < 0.05). Zum Zeitpunkt der Katamnese (t2) stieg der mittlere BDI auf einen Wert von 12,1 Punkten an (nicht signifikant). Forschungsfrage 2: Stellt der Grad der Patientenzufriedenheit im psychotherapeutischpsychiatrischen Setting einer Tagesklinik gemessen an den Veränderungen im BDI und dem SASSR einen Prädiktor für eine objektive Symptomveränderung dar? Der Grad der Patientenzufriedenheit kann als Prädiktor einer objektiven Symptomveränderung angesehen werden, wenn man dem die Erfassung der depressiven Symptomatik zugrunde legt, da eine statistisch signifikante Korrelation zwischen der Patientenzufriedenheit und dem Schweregrad der Depression (BDI) besteht. Dies trifft jedoch nicht mehr für den Zeitpunkt der Katamnese zu, weswegen sich der Grad der Patientenzufriedenheit im Langzeitverlauf nicht als Prädiktor einer objektivem Symptomveränderungen anwenden lässt. Hier muss wie unter forschungsfrage 1 bereits beschrieben die Anwendung des MFBP kritisch bewertet werden und die Korrelation in der Katamnese mit Hilfe anderer Assessments zur Erfassung der Patientenzufriedenheit überprüft werden. Forschungsfrage 3: Inwieweit kann die Patientenzufriedenheit sechs Monate nach Beendigung einer 12-wöchigen psychiatrisch-psychotherapeutischen tagesklinischen Behandlung gemessen an den Veränderungen im BDI und dem SASSR als Prädiktor sozialer Integration bewertet werden? Aufgrund eines sich in den Forschungsergebnissen darstellenden signifikanten Zusammenhangs zwischen der Patientenzufriedenheit und der sozialen Integration in den Bereichen Freizeit und Soziales sowie Finanzen kann die Patientenzufriedenheit als Prädiktor der sozialen Integration in den eben genannten Teilbereichen angesehen werden. Eine signifikante Zusammenfassung und Ausblick 88 Korrelation zwischen Patientenzufriedenheit und depressiver Symptomatik, gemessen mit dem BDI, zeigt sich sowohl nach Abschluss der 12-wöchigen Behandlung als auch sechs Monate nach Therapieende. Obgleich der Korrelationsgrad in der Katamnese geringer ist, bleibt die Korrelation signifikant, weswegen die Patientenzufriedenheit auch als Prädiktor der depressiven Symptomatik und folglich der sozialen Integration bewertet werden. Zumal die Schwere der Depression mit dem Grad der sozialen Interaktion korreliert ist. Forschungsfrage 4: Besteht ein Zusammenhang zwischen der sozialen Integration, der Arbeit, der Partnerschaft und dem Familienzusammenhalt nach Abschluss einer 12-wöchigen psychiatrisch-psychotherapeutischen tagesklinischen Behandlung zum Zeitpunkt der Entlassung und sechs Monate nach Entlassung gemessen an den Werten des SASSR? In den o.g. Bereichen konnte ein direkter Zusammenhang nachgewiesen werden. Während sich zu Beginn eine geringe soziale Integration bei den Probanden zeigt, nähert sich diese in der Katamnese an die Normalbevölkerung an, auch wenn sie in den Bereichen Eltern, Finannzen, Freizeit, Soziales, Verwandte und Familienzusammenhalt unterdurchschnittlich bleibt und sich partiell zwischen Anamnese und Katamnese reduziert. Zudem zeigten die Probanden der hier vorgestellten Untersuchung überdurchschnittliche Werte der sozialen Integration bezogen auf Arbeit und Partnerschaft gegenüber der Normstichprobe. Folglich bestehen Zusammenhänge, die jedoch zwischen den einzelnen Teilbereichen Arbeit, Partnerschaft und Familienzusammenhalt unterscheiden, weswegen diese Teilbereiche im Follow-up getrennt bewertet werden sollten. Forschungsfrage 5: Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Schwere der Depression und den Werten des BDI zum Entlassungszeitpunkt sowie sechs Monate später nach Abschluss einer 12-wöchigen psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung? Ja dieser Zusammenhang ließ sich nachweisen. Somit spiegelt der BDI die Schwere der Depression auch im Verlauf nach Abschluss einer 12-wöchigen Behandlung wieder Er zeigt sowohl den signifikanten Rückgang der depressiven Symptomatik im Therapieverlauf durch eine Reduktion des Punktwertes von 29,6 auf 11,3 als auch die Dynamik depressiver Symptome, indem sich der Wert de BDI, wenngleich nicht signifikant, in der Katamnese wieder erhöht. Forschungsfrage 6: Wie stark ist die Korrelation zwischen dem persönlichen Nutzen und den Werten des BDI zum Entlasszeitpunkt sowie sechs Monate später nach Abschluss einer 12wöchigen psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung? Zusammenfassung und Ausblick 89 Der persönliche Nutzen korreliert sowohl direkt nach Therapieende als auch im Follow-up von sechs Monaten signifikant mit den Werten im BDI, womit sich die Korrelation zwischen persönlichem Nutzen und BDI von der Korrelation zwischen der Gesamtzufriedenheit und dem BDI unterscheidet. Forschungsfrage 7: Hat der psychoanalytische Ansatz in der tagesklinischen Behandlung von Depressionspatienten einen besseren Outcome als der klassische psychotherapeutische Ansatz? Davon ausgehend, dass sich die Schwere der depressiven Symptome und die sozialen Beeinträchtigungen gemessen am BDI und SASSR nach Abschluss der tagesklinischen Behandlung mit psychoanalytischem Ansatz signifikant und deutlich verbessert haben, kann dieser Ansatz in der Behandlung von Patienten mit Depressionen als optimal angesehen werden. Inwieweit der psychoanalytische Ansatz im tagesklinischen Setting mit einem besseren Outcome assoziiert ist als ein psychotherapeutischer Ansatz kann aus den statistischen Ergebnissen dieser Studie nicht geklärt werden. Zieht man die aktuelle Datenlage zu beiden Therapieansätzen in der Behandlung der Depression hinzu, so haben beide Ansätze ihre Berechtigung und ihren Stellenwert und es ist letztlich von der klaren Indikation abhängig in welchem Umfang der Patient von dem jeweiligen Setting profitiert. 9.2 Fazit Unter Berücksichtigung der empirischen Datenlage und der aktuellen Literatur kann der tagesklinische Ansatz in der Behandlung der Depression als effizient bewertet werden. Dem kann auch zugestimmt werden, obwohl eine alleinige Erfassung der Patientenzufriedenheit mittels des MFPB-18-Fragebogens nicht ausreicht, um eine statistisch belastbare Aussage über die Reduktion des Ausmaßes der depressiven Verstimmung und der sozialen Integration nach sechs Monaten zu gewinnen. Dennoch gibt es Hinweise darauf, dass der von den Patienten erlebte persönliche Nutzen aus der Therapie einen positiven Einfluss auf die Verringerung der Symptomatik hat. Dies wird auch von der allgemeinen Studienlage untermauert, in welcher ebenfalls eine Verbesserung der sozialen Interaktionen und der depressiven Symptomatik nach Ende einer tagesklinischen Therapie nachzuweisen waren (vgl. Dinger et al. 2014). Selbst wenn die Probleme in der sozialen Interaktion sechs Monate nach einem tagesklinischen Setting leicht ansteigen, erreichen sie im weiteren Verlauf einen stabilen Zustand, der es dem Patienten ermöglicht, Zusammenfassung und Ausblick 90 sein Alltagsleben zu gestalten und ggf. einer Beschäftigung nachzugehen (vgl. Dinger et al. 2014). Darüber hinaus kann der psychoanalytische Therapieansatz vor allem in der Behandlung von Patienten mit chronischen Depressionen gute Ergebnisse nachweisen. Obgleich es natürlich von der Genese der Depression abhängt, ob die Psychoanalyse sich als angebracht erweist, bieten die multipersonellen Übertragungen und die damit verbundene direkte und bewusste Auseinandersetzung mit der inneren Erlebniswelt des Patienten gerade bei Depressionen einen guten Therapieansatz. Bei traumabedingten Depressionen kommt hinzu, dass durch die Externalisierung des traumatischen Erlebens, welches unbewusst im Patienten abläuft, dieses bewusst gemacht und anschließend bearbeitet werden kann. Zudem können neu erprobte Handlungsstrategien, die den traumatisch erlernten und internailiserten Handlungsstrategien des Individuums entgegenstehen, direkt ausprobiert werden. Den Bezugsrahmen dafür bietet sowohl das multiprofessionelle Team als auch die Mitpatienten. Gerade Depressions- oder Traumapatienten mit Bindungsstörungen profitieren vom interpersonellen Interaktionsrahmen einer Tagesklinik, die eine familiärere Struktur aufweist als eine stationäre Station. Für die Bindungsproblematik gilt dabei dasselbe Prinzip er Externalisierung im tagesklinischen Setting. So bewusst gewordene Bindungsproblematiken können be- und verarbeitet werden. Wie eingangs beschrieben, bedarf es jedoch auch im tagesklinischen Setting der individuellen Indikationsstellung, welche die bisherigen Bewältigungsstrategien des Patienten und die Ursachen seiner Depression berücksichtigt. Daraus lässt sich auch ableiten, welcher Patient eher für eine psychoanalytische und welcher Patient eher für eine verhaltenstherapeutische Behandlung in Frage kommt. Insgesamt bedarf es jedoch eines weiteren Ausbaus der tagesklinischen Strukturen, um die hohe Nachfrage an psychotherapeutischer Behandlung langfristig decken zu können. Außerdem kann die tagesklinische Struktur ein effizientes Behandlungselements für Patienten darstellen, die an chronisch persistierenden psychiatrischen Erkrankungen wie z.B. Persönlichkeitsstörungen oder der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Diese Patienten benötigen sowohl komplexe in sich abgeschlossene Behandlungseinheiten als auch Akutbehandlungen in instabilen Phasen. Gerade bei diesen Patienten wird die Schnittstellenfunktion der Tagesklinik deutlich. Zum einen können die Patienten in der Tagesklinik Alltagskompetenzen entwickeln, die sofort in der Praxis und im oft spannungsreichen Umfeld erprobt werden können. Zum anderen können Tageskliniken, sofern sie auch bestimmte Akutpatienten aufnehmen, die Hospitalisierung dieser Patienten Zusammenfassung und Ausblick 91 minimieren. Dadurch würden zum einen sozioökonomische Kosten gesenkt werden. Zum anderen würden die Patienten in instabilen Phasen, die einer Akutsituation entsprechen, in ihrem sozialen Umfeld verbleiben können und somit Problemlösungsstragien entwickeln können, die alltagstauglich sind. Die räumliche Trennung der stationären Behandlung von der Häuslichkeit der Patienten führt immer wieder dazu, dass es nach einem stationären Aufenthalt bei der Rückkehr in die Häuslichkeit zu einer erneuten Krise kommt. Verantwortlich davor ist de schützende Rahmen des stationären Aufenthaltes, welcher den Patienten vollständig aus seiner sozialen Umgebung herausnimmt und mit welcher er bei seiner Rückkehr konfrontiert wird. Hier bieten Tageskliniken bessere Möglichkeiten, diese posttherapeutische Krise eingrenzen zu können. Quellen 92 Literaturverzeichnis Abramson L., Seligman M., Teasdale J. (1978): Learned helplessness in humans: critique and reformulation. J Abnorm Psychol. 87: 49-74. Abramson L., Metalsky G., Alloy L. (1989): Hopelessness depression: A theory-based subtype of depression. Psychological Review. 96: 358-372. Apter-Levy, Y., Feldman, M., Vakart, A., Ebstein, R. & Feldman, R. (2013): Impact of Maternal Depression Across the First 6 Years of Life on the Child’s Mental Health, Social Engagement and Emapthy: The Moderating Role of Oxytocin. Am J Psychiatry. 170: 11611168. Arloth, J., Bogdan, R., Hariri, R., Binder, E.B. (2015): Genetic Differences in the Immediate Transcriptome Response to Stress Predict Risk-Related Brain Function and Psychiatric Disorders. Neuron. 86: 1189-1202. Atteslander, P. (2010). Methoden der empirischen Sozialforschung. Berlin: Erich Schmidt Verlag. Attkinson, C.C., Zwick, R.J. (1982): The client satisfaction questionnaire. Psychometric properties and correlations with service utilization and psychotherapy outcome. Eval Pogram Plann. 5: 233-237. Babioch A. (2007): Integration aus sozialwissenschaftlicher und alltagspsychologischer Sicht. Eine empirische Studie mit Aussiedlern aus Schlesien, einheimischen Deutschen und Schlesiern in Polen. Dissertation im Lehrgebiet Soziologie an der Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften der FernUniversität Hagen. Barker D. A., Sukhwinder S. S., Higginson, Orrell M. W. (1996): Patient´s views towards care received from psychiatrics. British Journal Psychiatry 168: 641-646. Bateman, A., Fonagy, P. (2003): Health Service Utilization Costs for Borderline Personality Disorder Patients Treated With Psychoanalytically Oriented Partial Hospitalization Versus General Psychiatric Care. Am J Psychiatry. 160: 169-171. Quellen 93 Beck A. (1974): Depression. Cases and treatment. University of Pennsylvania Press, Philadelphia. Beck A. T., Brown G., Steer R. A., Eidelson J. I., Riskind J. H. (1987): Differentiating anxiety and depression: a test of the cognitive content-specificity hypothesis. J Abnorm Psychol. 96(3):179-83. Becker S., Kruse A., Schröder J., Seidl U. (2005): Das Heidelberger Instrument zur Erfassung von Lebensqualität bei Demenz (H.I.L.D.). Z Gerontol Geriat 38: 108-121. Berger M., van Calker D., Riemann D. (2003): Sleep and manipulations of the sleep-wake rhythm in depression. Acta Psychiatr Scand Suppl. 418:83-91. Berger M. (1999): Affektive Erkrankungen. In: Berger M. (Hrsg.): Psychiatrie und Psychotherapie. Verlag Urban und Schwarzenberg, München, S. 483-566. Berger M. (1983): Toward maximizing the utility of consumer satisfaction as an outcome. In: Lamber M. J., Christensen E. R., De Julio S. S. (Hrsg): The assessment of psychotherapy outcome. John Wiley & Sons. New York. Binder, E.B., Holsboer, F. (2012): Low Cortisol and risk and Resilience to Stress-Related Psychiatric Disorders. Biological Psychiatry. 71. 282-283. Bittner A., Goodwin R., Wittchen H. U. (2004): What characteristics of primary anxiety disorders predict subsequent major depressive disorders? Journal of Clinical Psychiatry. 65: 618-626. Blanz B., Gerhard U. J., Huss M., Lehmkuhl U., Schönberg A., Englert E., Oehler K. U., Dt. Ges. f. Kinder-und Jugendpsychiatrie u.a. (Hrsg.) (2007): Leitlinien zur Diagnostik und Therapie von psychischen Störungen im Säuglings-, Kinder- und Jugendalter. Deutscher Ärzte Verlag. Berlin, 3. überarbeitete Auflage. Quellen 94 Böker, H., Hartwich, P., Piegler, T. (2016): Bedeutung entwicklungspsychologischer Prozesse in der Biografie. In Böker, H., Hartwich, P., Northoff, G. (Hrsg.): Wiesbaden: Springer. S. 96-105. Brakemeier E. L., Normann C., Berger M. (2008): Ätiopathogenese der unipolaren Depression: neurobiologische und psychosoziale Faktoren. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 51: 379-391. Brisch K. H. (2013): Bindungsstörungen. Von der Bindungsstörung zur Therapie. Verlag Klett-Cotta. Stuttgart, 12. Auflage. Brisch K. H. (2011): Bindung und frühe Störungen der Entwicklung. Verlag Klett-Cotta. Stuttgart. Brown K., Tracy D. K. (2014): Psychoanalytic psychotherapy in contemporary mental health services: current evidence, future role and challenges. British Journal of Psychotherapy, 20(2), S. 229-242. Brown S. A., Inaba R. K., Gillin J. C., Schuckit M. A., Stewart M. A., Irwin M. R. (1995): Alcoholism and affective disorder: clinical course of depressive symptoms. Am J Psychiatry. 152(1):45-52. Bruggemann A. (1974): Zur Unterscheidung verschiedener Formen von “Arbeitszufriedenheit“. Arbeit Leistung. 28: 281-284. Campbell A., Converse P. E., Rodgers W. L. (1976): The quality of life. Sage. New York. Coulter A., Entwistle V., Gilbert D. (1999): Sharing decisions with patients: is the information good enough? British Medical Journal. 318: 719. DGPPN, BÄK, KBV, AWMF, AKdÄ, BPtK, BApK, DAGSHG, DEGAM, DGPM, DGPs, DGRW (Hrsg.) (2009): für die Leitliniengruppe Unipolare Depression*. S3-Leitlinie / Nationale Versorgungsleitlinie Unipolare Depression-Kurzfassung. 1. Auflage 2009. DGPPN, ÄZQ, AWMF – Berlin, Düsseldorf. URL: Quellen 95 http://www.versorgungsleitlinien.de/themen/depression/pdf/s3_nvl_depression_kurz.pdf (Zugriffsdatum: 25.07.2014). Decker, P. (2010): Entwicklung und Validierung eines Fragebogens zur Patientenzufriedenheit in der stationären Psychotherapie/Psychosomatik. Dissertation. München: Ludwig- Maximilian-Universität. Dinger, U., Köhling, J., Klipsch, O., Ehrenthal, J.C., Nikendei, C., Herzog, W., Schauenburg, H. (2014): Tagesklinische und stationäre Psychotherapie der Depression (DIP-D) – Sekundäre Erfolgsmaße und Katamneseergebnis einer randomisiert-kontrollierten Pilotstudie. Psychother Psych Med. 65: 261-267. Dinger W. (2012): Paradigmen gruppenanalytischer Arbeit. In. Dinger W (Hrsg.): Gruppenanalytisch denken –supervisorisch handeln: Gruppenkompetenz in Supervision und Arbeitswelt. Kassel: University Press, S. 146-149. Dohren, J., Münzer, R. (2012): Entwicklung eines integrierten tagesklinischen Behandlungspfades. PID. 13(4). Donabedian A. (1980): The definition of quality and approaches to its assessment. Explorations in uality assessment and monitoring. Health Administration: Ann Arbor. Michigan. Dreier J. (1999): „Bei Entlassung zufriedener? Zur Patientenzufriedenheit in einer psychiatrischen Klinik.“ Dissertation. TU-München. Eberhard-Metzger C. (2006): Es ist, als ob die Seele unwohl wäre. ... Depression – Wege aus der Schwermut. Forscher bringen Licht in die Lebensfinsternis. Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.). Berlin. Eikelmann, B. (2010): Tagesklinische Behandlung in der Psychiatrie. Nervenarzt. 81: 355365. Quellen 96 Fahrenberg J., Hampel R., Selg H. (1989): Das Freiburger Persönlichkeitsinventar: FPI. Verlag Hogrefe. Göttingen. Fernando, S.C., Beblo, T., Schlosser, N., Terfehr, K., Otte, C., Löwe, B., Wolf, O.T., Spitzer, C., Driessen, M., Wingenfeld, K. (2012): Association of childhood trauma with hypothalamic-pituary-adrenals function in borderline personality disorder and major depression. Psychoneuroendocrinology. 37: 1659-1668. Festinger L. (1954): A Theory of Social Comparison Processes. Human Relations. 7: 117140. Fonagy P., Rost F., Carlyle J. et al. (2015): Pragmatic randomized controled trial of longterm psychoanalytic psychotherapy for treatment-resistant depression: the Tavistock Adult Depression Study (TADS). World Psychiatry, 14(3), S. 312-321. Fricke, S., Köhler, S., Moritz, S. & Schäfer, I. (2007): Frühe interpersonale Traumatisierungen bei Zwangserkrankungen: Eine Pilotstudie. Verhaltenstherapie. 17: 243-250. Geddes J. R., Carney S. M., Davies C., Furukawa T. A., Kupfer D. J., Frank E., Goodwin G. M. (2003): Relapse prevention with antidepressant drug treatment in depressive disorders: a systemic review. Lancet. 361(9358): 653-661. Grawe, K. (1995): Grundriss einer Allgemeinen Psychotherapie. Psychotherapeut, 40, S. 130-145. Hall M. A. (2002): Trust in the medical profession: conceptual and measurement Issues. URL: http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m4149/is_5_37/a9_95105516/print (Zu- griffsdatum: 01.08.2014). Härter M. (2014): Depressionsleitlinien. Kompetenznetz Depression. Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie und Zentrum für Psychosoziale Medizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. URL: http://www.depression-leitlinien.de/depression/7761.php (Zugriffsdatum 10.06.2014). Quellen 97 Härter M., Bermejo, I., Niebling, W. (2009): Praxismanual Depression. Deutscher Ärzteverlag. Berlin. 2. Auflage. Härter M., Bermejo, I., Niebling, W. (2007): Praxismanual Depression. Deutscher Ärzteverlag. Berlin. Hegerl M., Althaus D., Reiners H. (2005): Das Rätsel depression: Eine Krankheit wird entschlüsselt. Verlag Beck. München. Herbst, G., Jaeger, U., Leichsenring, F., Streeck-Fischer, A. (2009): Folgen von Gewalterfahrungen. Praxis für Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie. 58: 610-634. Herpertz, S.C. (2014): Frühes interpersonelles Trauma und affektive Erkrankungen. Heidelberger Symposium am 04.04.2014. Psychosoziale Medizin in der Gegenwart und Zukunft. Heidelberg: Universitätsklinikum Heidelberg. Herzberg P. Y., Goldschmidt S., Testkuratorium der Föderation deutscher Psychologenvereinigungen (2008): Testbeurteilungssystem. Medizinische Psychologie der Universität Leipzig N. Heinrichs, psychologisches Institut der Universität Bielefeld. Reportpsychologie. 33. Hoff R. A., Rosenheck R. A., Meterko M., Wilson N. J. (1999): Mental illness as a predictor of satisfaction with inpatient care at veterans affairs hospital. Psychiatric Services 50: 680685. Holloway F., Carson J. (1999): Subjective quality of life, psychopathology, satisfaction with care and insight: an exploratory study. International Journal of Social Psychiatry, 45(4): 259267. Ihle W., Groen G., Walter D., Esser G., Petermann F. (2012): Depression. Verlag Hogrefe. Göttingen. Johnson, M.R., Lydiard, R.B. (1998): Comorbidity of major depression and panic disorder. J Clin Psychol. 54(2):201-210. Quellen 98 Kallert, T.W., Schützwohl, M., Matthes, C. (2003): Aktuelle Struktur- und Leistungsmerkmale allgemeinpsychiatrischer Tageskliniken in der Bundesrepublik Deutschland. Psychiatr Prax. 30: 72-82. Kapfhammer, H.P. (2014): Trauma- und stressorbezogene Störungen. Nervenarzt. 85: 553563. Katon, R.-B. (1991): Mixed anxiety and depression. J Abnorm Psychol. 100(3):337-345. Kelstrup A., Lund K., Lauritzen B., Bech P. (1993): Satisfaction with care reported by psychiatric inpatients. Acta Psychiatr Scand 87: 374-379. Kempermann U., Henke M., Sasse J., Bauer M. (2008): Rückfallprophylaxe bei Depression. up2date. 2:73-78. Kendler K. S., Karkowski L. M., Prescott C. A. (1999): Causal relationship between stressful life events and the onset of major depression. Am J Psychiatry. 156: 837-841. Kind, V. (2015): Kindliche Angewiesenheit und elterliche Generativität. In Andresen, S., Koch, C., König, J. (Hrsg.): Vulnerable Kinder. Wiesbaden: Springer VS. S. 23-43. Kleim, B., Ehlers, A., Glucksman, E. (2012): Investigating Cognitive Pathways to Psychopathology: Predicting Depression and Posttraumatic Stress Disorder From Early Responses After Assault. Psychological Trauma, Theory, Research, Practice and Policy. 4: 527-537. Klengel, T., Binder, E.B. (2015): Epigenetics of Stress-Related Psychiatric Disorders and Gene x Environment Interactions. Neuron. 86: 1343-1352. Knekt P., Lindfors O., Härkänen T., vällikoski, M., Virtala, E., Laakson, M.A., Marttunen, M., Kaipainen, M., Renlund, C., Helsinki Psychotherapy Study Group (2008): Randomized trial on the effectiveness of long- and short-term psychodynamic psychotherapy solution-focused therapy on psychiatric syndroms during a 3-year follow-up. Helsinki Psychotherapy Study group. Psychol Med 38, S. 689-703. Quellen 99 Koivumaa-Honkanen H. T., Viinamäki H., Honkanen R., Tanskanen A., Antikainen R., Niskanen L., Jääskeläinen J., Lehtonen J. (1996): Correlates of life satisfaction among psychiatric patients. Acta Psychiatr Scand 94: 372-378. Kolk van der, B.A. (2009): Entwicklungstrauma-Störung: Auf dem Weg zu einer sinnvollen Diagnostik für chronisch traumatisierte Kinder. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie. 58(8): 572-586. Krollner B., Krollner D.M. (2014): ICD-10-GM-2014. ICD-Code online. URL: http://www.icd code.de (Zugriffsdatum 10.06.2014). Kronmüller K. T., Backenstrass M., Reck C. (2002): Einfluss von Persönlichkeitsfaktoren und -struktur auf den Verlauf der Major-Depression. Nervenarzt. 73: 255-261. Kunze H. (2007): Personenbezogene Behandlung in psychiatrischen Kliniken und darüber hinaus – Gute Praxis und Ökonomie verbinden. Psychiat Prax. 34: 150-153. Lang, F.U., Becker, T., Kösters, M. (2015): Psychiatrische Tageskliniken – Evidenzlage und Stellenwert im Versorgungssystem. Fortschr Neurol Psychiatr. 83: 616-620. Lawton M. P., van Haitsma K., Klapper J. (1996): Observed affect in nursing home residents with Alzheimer’s disease. J gerontol 51B: 3-14. Lehmann C. (2014): Konsistenz. URL: http://www.christianlehmann.eu/ling/epistemology/techniques/redaction/index.html?http://w ww.christianlehmann.eu/ling/epistemology/techniques/redaction/Kohaerenz.html (Zugriffsdatum 07.08.2014). Leuzinger-Bohleber M. (2013): Chronische Depression und Trauma. In. LeuzingerBohleber M., Bahrke U., Negele A. (Hrsg.): Chronische Depression verstehen behandeln erforschen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 56-80. Quellen 100 Leuzinger-Bohleber M. (2015): Working with severly traumatized, chronically depressed analysands. Int J Psychoanal, 96, S. 611-636. Le Vois M., Nguyen T. D., Attkisson C. C. (1981): Artefact in client satisfaction assessment. Evaluation and Program Planning 4: 139-150. Lewinsohn P. M., Youngren M., Grossup S. (1979): Reinforcement and depression. In: Depue R. (Hrsg.) The psychobiology of depressive disorders. Academic Press, New York, S. 291-319. Lieb R., Isensee B., Hofler M. (2002): Parental major depression and the risk of depression and other mental disorders in offspring: a prospective-longitudinal community study. Arch Gen Psychiatry. 59: 365-374. Linde H. (1967): Jahrbuch für Sozialwissenschaft, Bd. 18, H.1/2 Entzifferung. Göttingen: Verlag Vaderhoek und Ruprecht. S. 43. Luborsky, L., Barber, J.P., Siqueland, L. et al. (1996): The Revised Helping Alliance Questionnaire (HAq-II) - Psychometric Properties. J Psychother pract res. 5: 260-271. Maier W. (2004): Genetik der Depression. Gegenwärtiger Erkenntnisstand und Perspektiven. Bundesgesundheitsbl – Gesundheitsforsch – Gesundheitsschutz. 51: 379-391. Mandelli L., Serreti A., Marino E. (2007): Interaction between serotonin transporter gene, catechol-Omethyltransferase gene and stressful life events in mood disorders. Int J Neuropsychopharmacol. 10: 437-447. Matakas F. (1992): Neue Psychiatrie. Verlag Vandenhoek und Ruprecht. Göttingen. S. 21 ff. Matakas F. (2006): Wozu Tageskliniken?. Vortrag anlässlich des 10jährigen Bestehens der Tagesklinik in Lünen. URL: http://www.matakas.de/publikationen/wozu-tageskliniken.pdf (Zugriffsdatum: 08.08.2014). Quellen 101 Matakas F., Rohrbach E. (2005): Zur Psychodynamik der schweren Depression und die therapeutischen Konsequenzen. Psyche – Z Psychoanal. 59:892-917. Mattejat F., Remschmidt H. (2008): Kinder psychisch kranker Eltern. Deutsches Ärzteblatt. 105: 413-418. Mattejat F., Remschmidt H. (1998): Zur Erfassung der Erfassung der Lebensqualität bei psychisch gestörten Kindern und Jugendlichen. Eine Übersicht. McGuffin P., Rijsdijk F., Andrew M. (2003): The heritability of bipolar affective disorder and the genetic relationship to unipolar depression. Arch Genl Psychiatry. 60: 497-502. MDK (2014): Alltagskompetenz. URL: http://www.mdk.de/817.htm (Zugriffsdatum: 07.08.2014). Mehta, D., Binder, E.B. (2012): Gene x environment vulnerbaility factors for PTSD: The HPA-axis. Neuropharmacology. 62: 654-662. Murray L., Stanley C., Hooper R., King F., Fiori-Cowley A. (1996): The role of infant factors in postnatal depression and mother-infant intercations. Developmental Medicine & Child Neurology. 38:109-119. Murray L., Trevarthen, C. (1986): The infant’s role in mother-infant communication. Journal of Child Language. 13.15-29. Naumann-Lenzen, M. (2003): Frühe, wiederholte Traumatisierungen, Bindungsdesorganisation und Entwicklungspsychologie – Ausgewählte Befunde und klinische Optionen. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie. 52(8): 595-619. Nemeroff, C.B., Heim, C.M., Thase, M.E., Klein, D.N., Rush, A.J., Schatzberg, A.F., Ninan, P.T., McCollough, J.P., Weiss, P.M., Dunner, D.L., Rothbaum, B.O., Kornstein, S., Keitner, G. & Keller, M.B. (2003): Differential responses to psychotherapy versus pharmacotherapy in patients with chronic forms of major depression and childhood trauma. PNAS. 100(24): 14293-14296. Quellen 102 Nemeroff, C.B., Binder, E.B. (2014): The Preeminent Role of Childhood Abuse and Neglect in Vulnerability to Major Psychiatric Disorders: Toward Elucidating the Underlying Neurobiological Mechanism. Journal of the American academy of child & Adolescent Psychiatry. 53: 395-397. Neugebauer B., Porst R. (2001): ZUMA-Methodenbericht Nr. 7/2001, S. 21-23. Park, S.C., Kim, D. & Jang, E.Y. (2016): Prevalence and symptomatic correlates of interpersonal trauma in South Korean outpatients with major depressive disorder. Comprehensive Psychiatry. 66: 46-52. Parsons, T., Bales, R.F. (1955): Family, socialization and interaction process. Michigan: Free Press. Penot, B. (2005): Psychoanalytical teamwork in a day hospital: Revisiting some preconditions for patients’ subjective appropriation. Int J Psychoanal. 86: 503-515. Pérez, T., Di Gallo, A., Schmeck, K. & Schmid, M. (2011): Zusammenhang zwischen interpersoneller Traumatisierung, auffälligem Bindungsverhalten und psychischer Belastung bei Pflegekindern. Kindheit und Entwicklung. 20(2): 72-82. Provencal, N., Binder, E.B. (2015a): The effects of early life stress on the epigenome: From the womb to adulthod and even before. Experimental Neurology. 268: 10-10. Provencal, N., Binder, E.B. (2015b): The neurobiological efects of stress as contributors to psychiatric disorders: focus on epigenetics. Current Opinion in Neurobiology. 30: 31-37. Remschmidt H., Schmidt M.-H. (1994): Multiaxiales Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters nach ICd-10 der WHO. Huber. Bern Göttingen Toronto Seattle. Risch N., Herrell R., Lehner T. (2009): Interaction between the serotonin transporter gene (5-HTTLPR), stressful life events and risk if depression: a meta-analysis. JAMA. 301: 24622471. Quellen 103 Roberts B. L., Fitzpatrick J. J. (1994): Margin in life among hospitalised and nonhospitalised elderly persons. International Journal of Nursing Studies. 31(6): 573-582. Roesler, C. (2013): Evidence for the Effectiveness of Jungian Psychotherapy: A Review of Empirical Studies. Behav Sci. 3: 562-575. Rohrbach E. (2002): Gruppenpsychotherapie im tagesklinischen Setting. In: Lehmkuhl G. (Hrsg.): Theorie und Praxis individualpsychologischer Gruppenpsychotherapie. Verlag Vadenhoeck & Ruprecht. Göttingen, S. 287-301. Sachsse, U. (2003): Man kann bei der Wahl seiner Eltern gar nicht vorsichtig genug sein – Zur biopsychosozialen Entwicklung der Bewältigungssysteme für Distress beim Homo sapiens. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie. 52: 578-594. Scheytt N., Janssen PL (2013): Kommunikative Musiktherapie in der stationären analytischen Psychotherapie. In. Lamprecht F (Hrsg.): Spezialisierung und Integration in Psychosomatik und Psychotherapie. Wiesbaden: Springer Verlag, S. 203-206. Seidler, K.P., Garlipp, P., Machleidt, W., Haltenhof, H. (2005): Treatment concepts of day hospitals for general psychiatric patients. Findings from a national survey in Germany. European Psychiatry. 21: 110-117. Seligman M. (1974): Depression and learned helplessness. In: Friedman R, Katz M (Hrsg) The psychology of depression: Contemporary theory and research. Winston-Wiley. New York. Sit M. (2012): Sicher, stark und mutig: Kinder lernen Resilienz. Verlag Kreuz. Freiburg i.B. Soyka M., Hollweg M., Naber D. (1996): [Alcohol dependence and depression. Classification, comorbidity, genetic and neurobiological aspects]. Nervenarzt. 67(11):896-904. Statistisches Bundesamt (2011): Gesundheit. Grunddaten der Krankenhäuser. Statistisches Bundesamt. Wiesbaden. Quellen 104 Streeck-Fischer, A. (2010): Angriffe auf Körper und Seele. Psychotherapeut. 55: 98-105. Streeck-Fischer, A. (2014): Traum und Entwicklung: Adoleszenz – frühe Traumatisierung und ihre Folgen. 2. überarb. Auflage. Stuttgart: Schattauer. Subic-Wrana, C., Beetz, A., Wiltink, J., Beutel, M.E. (2011): Aktuelles Bindungstrauma und retrospektiv erinnerte Kindheitsttraumatisierung bei Patienten in psychosomatischer Akutbehandlung. Z psychosom Med Psychother. 57: 325-342. Swendsen, J.D., Merikangas, K.R. (2000): The comorbidity of depression and substance use disorders. Clin Psychol Rev. 20(2):173-189. Tagay, S., Repic, N., Düllmann, S., Schlottbohm, E., Hermans, E., Hiller, R., Holtmann, M., Frosch, D. & Senf, W. (2013): Traumatische Ereignisse, psychische Belastung und Prädiktoren der PTBS-Symptomatik bei Kindern und Jugendlichen. Kindheit und Entwicklung. 22(2): 70-79. Teicher, M.H. & Samson, J.A. (2013): Childhood Maltreatment and Psychopathology: A Case for Ecophenotypic Variants as Clinically and Neurobiologically Distinct Subtypes. Am J Psychiatry. 179(10): 1114-1133. Tomozei A. V. (2006): Qualität von Gesundheitsdienstleistungen und Patientenzufriedenheit als Qualitätskriterium. München. Vinogradov, S., Yalom, I.D., Hales, R.E. (1996): Group therapy. he American Psychiatric Press synopsis of psychiatry., S.1063-1095. Wang, L., Paul, N., Stanton, S.J., Greeson, J.M., Smoski, M.J. (2013): Loss of sustained activity in the ventromedial prefrontal cortex in response to repeat stress in individuals with early-life emotional abuse: implications for depression vulnerability. Frontiers in Psychology. 4: 1-9. Quellen 105 Warren s., Huston M., Egeland B., Sroufe A (1997): Child and adolescent anxiety disorders and early attachment. Journal of Academic Child and Adolescent Psychiatry. 36:637644. Weinryb, R.M., Rössel, R.J. (1991): Karolinska Psychodynamic Profile. KAPP. Acta Psychiatr Scand Suppl. 1991;363:1-23. Review. WHO (2014a): Definition einer Depression. URL: http://www.euro.who.int/de/healthtopics/noncommunicable-diseases/pages/news/news/2012/10/depression-ineurope/depression-definition (Zugriffsdatum 08.08.2014). WHO (2014b): New global report: depression predominant cause of illness and disability among adolescents. URL: http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable- diseases/mental-health/news/news/2014/05/new-global-report-depression-predominant-causeof-illness-and-disability-among-adolescents (Zugriffsdatum 08.08.2014). WHO (2014c): Data and statistics: Prevalence of mental disorders. URL: http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/data-andstatistics (Zugriffsdatum 08.08.2014). Wiersma, J.E., Hovens, J., Oppen van, P., Giltay, E., Schaik van, A., Beekman, A.T.F. & Penninx, B.W.J.H. (2009): Childhood trauma as a risk factor for chronicity of depression. Journal of Clinical Psychiatry. 7: 983-989. Winkler, W.T., Beese, F., de Lambert, L., Main, T.F., Morrice, J.K. W., Ploye, P. & Whiteley, J.S. (2013): Psychotherapie in der Klinik: Von der therapeutischen Gemeinschaft zur stationären Psychotherapie. Verlag Axel Springer. Heidelberg. Wiltgen, A., Arbona, C., Frankel, L., Frueh, C. (2015): Interpersonal trauma, attachment insecurity and anxiety in an inpatient psychiatric population. Journal of Anxiety Disorders. 35: 82-87. Wingenfeld, K., Schaffrath, C., Rullkoetter, N., Mensebach, C., Schlosser, N., Beblo, T., Driessen, M., Meyer, B. (2011): Association of childhood trauma, trauma in adulthood and Quellen 106 previous-year stress with psychopathology in patients with major depression and borderline personality disorder. Child Abuse & Neglect. 35: 647-654. Wittchen H. U., Jacobi F., Klose M., Ryl L. (2010): Depressive Erkrankungen. Gesundheitsberichterstattung des Bundes. 51: 1-47. Wittchen H. U., Jacobi F. (2006a): Epidemiologie. In: Stoppe G, Bramesfeld A, Schwartz FW (Hrsg.) Volkskrankheit Depression? Bestandsaufnahme und Perspektive. Verlag Axel Springer. Heidelberg, S. 15-37. Wittchen H. U., Hoyer J. (2006b): Klinische Psychologie und Psychotherapie. Verlag Axel Springer. Heidelberg. Wittchen H. U., Kessler R. C., Pfister H. (2000): Why do people with anxiety disorders become depressed? A prospective-longitudinal community study. Acta psychiatrica Scandinawica. 102: 14-23. Wübbenhorst K. (2014): Reliabilität. Gabler Wirtschaftslexikon. http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/57492/reliabilitaet-v6.html URL: (Zugriffsdatum 07.08.2014). Wütherich-Schneider E. (1998): Qualitätsmanagement in Spitälern: Ein Modell zur Evaluation der Patientenzufriedenheit. Diss. Universität St. Gallen. Yonkers K., McCunn K. (2007): comorbidity of premenstruel syndrome and premenstruel dysphoric disorder with other psychiatric conditions. In: O’brian P, Rapkin A., Schmidt J. (Hrsg.) The premenstruel syndromes: PMS and PMDD. Informa Healthcare, London, S. 4954. Zannas, A.S., Provencal, N., Binder, E.B. (2015): Epigenetic of Posttraumatic Stress Disorder: Current Evidence, Challenges, and future Directions. Biological Psychiatry. 78: 327-335. Zeeck, A.; Hartmann, A., Küchenhoff, J., Weiss, H., sammet, I.,Gaus, E., Semm, E., Harms, D., Eisenberg, A., Rahm, R., von Wietersheim, J. (2008): Differenzielle Indikati- Quellen 107 onsstellung stationärer und tagesklinischer Psychotherapie: die DINSTAP-Studie. Psychother Psych Med. 59: 354-363. Zerssen D. (1991): Zur prämorbiden Persönlichkeit des Melancholikers. In: Mundt C., Fiedler P., Lang H. (Hrsg) Depressionskonzepte heute: Psychopathologie oder Pathopsychologie? Verlag Axel Springer. Berlin, S. 76-94. Zimmermann, M., Chelminski, I., McDermut, W. (2002): Major depressive disorder and axis I diagnostic comorbidity. J Clin Psychiatry. 63(3):187-93. Quellen 108 11. Anhang 11.1 Tabellenverzeichnis Tabelle 1 Gruppierung der ätiopathogenetischen Faktoren nach Hegerl. In Anlehnung an Wittchen et al. (2010, S. 14) und Hegerl et al.(2005) ................................................ 6 Tabelle 2 Ein- und Ausschlusskriterien zur Aufnahme der Patienten in die Studie (eigene Daten) ........................................................................................................................ 60 Tabelle 3 Ergebnisse der Stichwortsuche in den Datenbanken pubMed, Science Direct und der Springer Fachdatenbank ..................................................................................... 61 Tabelle 4 Ergebnisse der Stichwortsuche in den Suchmaschinen Google und Google Scholar ...................................................................................................................... 62 Tabelle 5 Charakteristika des Studiensamples (eigene Daten) ................................................ 65 Tabelle 6 Kennwerte der eingesetzten Fragebögen (eigene Daten) ........................................ 67 Tabelle 7 Antworthäufigkeiten im MFBP-18 (eigene Daten) .................................................. 69 Tabelle 8 Statistische Kennwerte des MFBP-18 (eigene Daten) ............................................. 70 Tabelle 9 Korrelation zwischen MFBP und BDI bei Entlassung und nach 6 Monaten (eigene Daten) ........................................................................................................... 71 Tabelle 10 Korrelation des MFBP-18 mit den Domänen der Social Adjustment Scale (eigene Daten) ......................................................................................................... 73 Quellen 109 11.2 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1. Problem- und Gegenstandsbenennung in Anlehnung an Atteslander (2010, S. 39)....................................................................................................................... 59 Abbildung 2. Veränderungen der Einzelitems des SASSR (eigene Daten) ............................. 78 Quellen 110 11.3 SASSR-Fragebogen Urheberrechtlich geschütztes Material – Copyright Firma Schuhried, GmbH, Hyrtlstraße 45, 2340 Mödling , Austria Social Adjustment Scale – Self Report, deutsche Übersetzung mit modifizierten Skalenwerten. Anleitung: Wir möchten gerne wissen, was Sie in den letzten beiden Wochen gemacht haben und bitten Sie, einige Fragen über Ihre Arbeit, Freizeit und Familie zu beantworten. Bitte lesen Sie jede einzelne Frage in Ruhe durch. Auf diese Fragen gibt es weder richtige noch falsche Antworten. Geben Sie bitte jeweils die Antwort ein, die am besten beschreibt, wie es Ihnen in den letzten beiden Wochen gegangen ist. Ich bin überwiegend Berufstätig Hausfrau/Hausmann Schüler/Student Berentet Pensioniert Arbeitslos Sonstiges Wie viele Tage haben Sie in den letzten zwei Wochen an Ihrem Arbeitsplatz gefehlt? Ich habe keinen Tag gefehlt. Ich habe ein oder zwei Tage gefehlt. Ich habe etwa die Hälfte der Zeit gefehlt. Ich habe mehr als die Hälfte der Zeit gefehlt. Ich habe überhaupt nicht gearbeitet. Ich hatte in den letzten beiden Wochen Urlaub. Wie gut haben Sie ihre Arbeit in den letzten beiden Wochen geschafft? Ich habe meine Arbeit sehr gut geschafft. Ich habe meine Arbeit gut geschafft. Ich habe meine Arbeit mittelmäßig geschafft. Quellen 111 Ich habe meine Arbeit schlecht geschafft. Ich habe meine Arbeit sehr schlecht geschafft. Haben Sie sich wegen Ihrer Leistungen am Arbeitsplatz in den letzten beiden Wochen geschämt? Ich habe mich nie geschämt. Ich habe mich selten geschämt. Ich habe mich manchmal geschämt. Ich habe mich oft geschämt. Ich habe mich immer geschämt. Hatten Sie in der letzten Zeit Auseinandersetzungen oder Streitigkeiten mit Ihren Kollegen oder Vorgesetzten? Ich hatte keine Auseinandersetzungen. Ich hatte wenige Auseinandersetzungen. Ich hatte einige Auseinandersetzungen. Ich hatte viele Auseinandersetzungen. Ich hatte sehr viele Auseinandersetzungen. Haben Sie sich in den letzten beiden Wochen bei Ihrer Arbeit geärgert? Ich habe mich nie geärgert. Ich habe mich nie geärgert. Ich habe mich nie geärgert. Ich habe mich nie geärgert. Ich habe mich nie geärgert. Fanden Sie Ihre Arbeit in den letzten beiden Wochen interessant? Ich fand meine Arbeit immer interessant. Quellen 112 Ich fand meine Arbeit oft interessant. Ich fand meine Arbeit manchmal interessant. Ich fand meine Arbeit selten interessant. Ich fand meine Arbeit nie interessant. Wie viele Freunde und Bekannte haben Sie in den letzten beiden Wochen getroffen oder am Telefon gesprochen? Neun oder mehr. Fünf bis acht. Zwei bis vier. Einen. Keinen. Konnten Sie in den letzten beiden Wochen mit wenigsten einem Freund oder Bekannten über Ihre Gefühle oder Probleme reden? Ich konnte sehr gut darüber reden. Ich konnte gut darüber reden. Ich konnte einigermaßen darüber reden. Ich konnte schlecht darüber reden. Ich konnte sehr schlecht darüber reden. Nicht zutreffend, ich habe keine Freunde oder Bekannte. Wie oft haben Sie in den letzten zwei Wochen etwas mit anderen Menschen unternommen (z. B. Freunde besucht oder eingeladen, mit Anderen ins Kino, Theater oder Konzerte gegangen, Kneipen, Restaurants besucht?) Mehr als dreimal. Dreimal. Zweimal. Einmal. Überhaupt nicht. Können Sie Ihre Freizeit mit Hobbys (z. B. Sport, Lesen, Handarbeiten, Gartenarbeit usw.) ausfüllen? Quellen 113 Ich kann meine Freizeit sehr gut ausfüllen. Ich kann meine Freizeit gut ausfüllen. Ich kann meine Freizeit einigermaßen ausfüllen. Ich kann meine Freizeit schlecht ausfüllen. Ich kann meine Freizeit überhaupt nicht ausfüllen. Hatten Sie in den letzten beiden Wochen Auseinandersetzungen oder Streitigkeiten mit Freunden oder Bekannten? Ich hatte keine Auseinandersetzungen. Ich hatte wenige Auseinandersetzungen. Ich hatte einige Auseinandersetzungen. Ich hatte viele Auseinandersetzungen. Ich hatte sehr viele Auseinandersetzungen. Nicht zutreffend, ich habe keine Freunde oder Bekannte. Wie schwer hat es Sie getroffen, wenn Sie in den letzten beiden Wochen von einem Freund oder Bekannten in Ihren Gefühlen verletzt wurden? Ich bin sehr gut darüber hinweggekommen. Ich bin gut darüber hinweggekommen. Ich bin einigermaßen darüber hinweggekommen. Ich bin schlecht darüber hinweggekommen. Ich bin nicht darüber hinweggekommen. Nicht zutreffend, ich habe keine Freunde oder Bekannte. Haben Sie sich in den letzten beiden Wochen im Zusammensein mit anderen unwohl gefühlt? Quellen 114 Ich habe mich nie unwohl gefühlt. Ich habe mich selten unwohl gefühlt. Ich habe mich manchmal unwohl gefühlt. Ich habe mich oft unwohl gefühlt. Ich habe mich immer unwohl gefühlt. Nicht zutreffend, ich war in den letzten beiden Wochen mit niemand zusammen. Haben Sie sich in den letzten beiden Wochen einsam gefühlt und sich mehr Freunde und Bekannte gewünscht? Ich habe mich nie einsam gefühlt. Ich habe mich selten einsam gefühlt. Ich habe mich manchmal einsam gefühlt. Ich habe mich oft einsam gefühlt. Ich habe mich immer einsam gefühlt. Haben Sie sich in der letzten Zeit in Ihrer Freizeit gelangweilt? Ich habe mich nie gelangweilt. Ich habe mich selten gelangweilt. Ich habe mich manchmal gelangweilt. Ich habe mich oft gelangweilt. Ich habe mich immer gelangweilt. Leben Sie ohne Partner (Single, getrennt, geschieden)? Ja Nein Quellen 115 Hatten Sie in den letzten beiden Wochen mit einem der folgenden Verwandten Kontakt: Eltern, Geschwistern, Schwager, Schwägerinnen und Kinder, soweit diese nicht mit Ihnen zusammenleben? (Diese Frage bezieht sich auch auf Briefe und Telefonate). Ja Nein Hatten Sie in den letzten beiden Wochen Auseinandersetzungen oder Streitigkeiten mit diesen Familienmitgliedern? Ich hatte keine Auseinandersetzungen. Ich hatte wenige Auseinandersetzungen. Ich hatte einige Auseinandersetzungen. Ich hatte viele Auseinandersetzungen. Ich hatte sehr viele Auseinandersetzungen. Konnten Sie in den letzten beiden Wochen mit wenigsten einem Verwandten über Ihre Gefühle oder Probleme reden? Ich konnte sehr gut über meine Gefühle und Probleme reden. Ich konnte gut über meine Gefühle und Probleme reden. Ich konnte einigermaßen über meine Gefühle und Probleme reden. Ich konnte schlecht über meine Gefühle und Probleme reden. Ich konnte sehr schlecht über meine Gefühle und Probleme reden. Ich konnte überhaupt nicht über meine Gefühle und Probleme reden. Haben Sie den Kontakt mit Ihrer Familie in den letzten zwei Wochen vermieden? Ich habe den Kontakt mit ihnen nie vermieden. Ich habe den Kontakt mit ihnen selten vermieden. Quellen 116 Ich habe den Kontakt mit ihnen manchmal vermieden. Ich habe den Kontakt mit ihnen oft vermieden. Ich habe den Kontakt mit ihnen immer vermieden. Waren Sie in den letzten beiden Wochen auf Hilfe, Ratschläge, Geld oder seelische Unterstützung von Ihrer Familie angewiesen? Ich war nie darauf angewiesen. Ich war selten darauf angewiesen. Ich war manchmal darauf angewiesen. Ich war oft darauf angewiesen. Ich war immer darauf angewiesen. Wollten Sie in den letzten beiden Wochen genau das Gegenteil davon tun, was Ihre Familienmitglieder wollten, um sie zu ärgern? Ich wollte nie das Gegenteil tun, um sie zu ärgern. Ich wollte selten das Gegenteil tun, um sie zu ärgern. Ich wollte manchmal das Gegenteil tun, um sie zu ärgern. Ich wollte oft das Gegenteil tun, um sie zu ärgern. Ich wollte immer das Gegenteil tun, um sie zu ärgern. Haben Sie sich in den letzten zwei Wochen ohne richtigen Grund Sorgen gemacht, dass Ihren Familienmitglieder etwas passieren könnte? Ich habe mir nie grundlos Sorgen gemacht. Ich habe mir selten grundlos Sorgen gemacht. Ich habe mir manchmal grundlos Sorgen gemacht. Ich habe mir oft grundlos Quellen 117 Sorgen gemacht. Ich habe mir immer grundlos Sorgen gemacht. Hatten Sie in den letzten beiden Wochen das Gefühl, das Sie eines Ihrer Familienmitglieder im Stich gelassen oder schlecht behandelt hätten? Ich hatte nie solch ein Gefühl. Ich hatte selten solch ein Gefühl. Ich hatte manchmal solch ein Gefühl. Ich hatte oft solch ein Gefühl. Ich hatte immer solch ein Gefühl. Hatten Sie in den letzten beiden Wochen das Gefühl, das eines Ihrer Familienmitglieder Sie im Stich gelassen oder schlecht behandelt hätte? Ich hatte nie solch ein Gefühl. Ich hatte selten solch ein Gefühl. Ich hatte manchmal solch ein Gefühl. Ich hatte oft solch ein Gefühl. Ich hatte immer solch ein Gefühl. Leben Sie mit einem Partner zusammen? Ja Nein Hatten Sie in den letzten beiden Wochen Auseinandersetzungen oder Streitigkeiten mit Ihrem Partner? Ich hatte keine Auseinandersetzungen. Ich hatte wenige Auseinandersetzungen. Ich hatte einige Auseinandersetzungen. Ich hatte viele Auseinandersetzungen. Quellen 118 Ich hatte sehr viele Auseinandersetzungen. Nicht zutreffend, ich habe keine Freunde oder Bekannte. Konnten Sie in den letzten beiden Wochen mit Ihrem Partner über Ihre Gefühle oder Probleme reden? Ich konnte sehr gut über meine Gefühle und Probleme reden. Ich konnte gut über meine Gefühle und Probleme reden. Ich konnte einigermaßen über meine Gefühle und Probleme reden. Ich konnte schlecht über meine Gefühle und Probleme reden. Ich konnte sehr schlecht über meine Gefühle und Probleme reden. Ich konnte überhaupt nicht über meine Gefühle und Probleme reden. Haben Sie in den letzten beiden Wochen darauf bestanden, Ihrem Partner gegenüber Ihren Willen durchzusetzen? Ich habe nicht darauf bestanden. Ich habe selten darauf bestanden. Ich habe manchmal darauf bestanden. Ich habe oft darauf bestanden. Ich habe immer darauf bestanden. Haben Sie sich in den letzen beiden Wochen von Ihrem Partner herumkommandieren lassen? Ich habe mich nicht herumkommandieren lassen. Ich habe mich selten herumkommandieren lassen. Ich habe mich manchmal Quellen 119 herumkommandieren lassen. Ich habe mich oft herumkommandieren lassen. Ich habe mich immer herumkommandieren lassen. Haben Sie sich in den letzten beiden Wochen von Ihrem Partner abhängig gefühlt? Ich habe mich unabhängig gefühlt. Ich habe ziemlich unabhängig gefühlt. Ich habe mich teils unabhängig teils abhängig gefühlt. Ich habe mich ziemlich abhängig gefühlt. Ich habe mich völlig abhängig gefühlt. Welche Gefühle hatten Sie die letzten beiden Wochen zu Ihrem Partner? Ich habe mich immer zu ihm hingezogen gefühlt. Ich habe mich oft zu ihm hingezogen gefühlt. Ich habe mich manchmal zu ihm hingezogen gefühlt. Ich habe mich selten zu ihm hingezogen gefühlt. Ich habe mich nie zu ihm hingezogen gefühlt. Wie oft hatten Sie im letzten Monat Geschlechtsverkehr mit Ihrem Partner? Mehr als zweimal in der Woche. Ein- bis zweimal in der Woche. Einmal in zwei Wochen. Etwa einmal im Monat. Im letzten Monat überhaupt nicht. Hatten Sie in den letzten beiden Wochen Probleme, zum Beispiel Schmerzen beim Geschlechtsverkehr? Nie Quellen 120 Selten Manchmal Oft Immer Ich hatte keinen Geschlechtsverkehr. Haben Sie den Geschlechtsverkehr in den letzten beiden Wochen als angenehm empfunden? Nie Selten Manchmal Oft Immer Ich hatte keinen Geschlechtsverkehr. Haben Sie Kinder (auch Stief- oder Pflegekinder), mit denen Sie in den letzten beiden Wochen zusammengelebt haben? Ja Nein Haben Sie sich dafür interessiert, was Ihre Kinder in den letzten beiden Wochen getan haben (z. B. Schule, Sport, Hobbys)? Ich habe mich immer dafür interessiert. Ich habe mich oft dafür interessiert. Ich habe mich manchmal dafür interessiert. Ich habe mich selten dafür interessiert. Ich habe mich nie dafür interessiert. Konnten Sie in den letzten beiden Wochen mit Ihren Kindern (sofern sie älter sind als zwei Jahre) sprechen und Ihnen zuhören? Ich konnte immer mit ihnen sprechen und ihnen zuhören. Ich konnte oft mit ihnen sprechen und ihnen zuhören. Ich konnte manchmal mit ihnen sprechen und ihnen zuhören. Ich konnte selten mit ihnen Quellen 121 sprechen und ihnen zuhören. Ich konnte nie mit ihnen sprechen und ihnen zuhören. Hatten Sie die letzten beiden Wochen Auseinandersetzungen oder Schwierigkeiten mit Ihren Kindern? Ich hatte keine Auseinandersetzungen oder Schwierigkeiten. Ich hatte wenige Auseinandersetzungen oder Schwierigkeiten. Ich hatte einige Auseinandersetzungen oder Schwierigkeiten. Ich hatte viele Auseinandersetzungen oder Schwierigkeiten. Ich hatte sehr viele Auseinandersetzungen oder Schwierigkeiten. Welche Gefühle hatten Sie die letzten zwei Wochen Ihren Kindern gegenüber? Ich fühlte immer Zuneigung zu meinen Kindern. Ich fühlte oft Zuneigung zu meinen Kindern. Ich fühlte manchmal Zuneigung zu meinen Kindern. Ich fühlte selten Zuneigung zu meinen Kindern. Ich fühlte nie Zuneigung zu meinen Kindern. Waren Sie jemals verheiratet bzw. haben Sie einmal mit einem Partner zusammengelebt oder haben Sie Kinder? Ja Nein Haben Sie sich in den letzen beiden Wochen grundlos Sorgen um Ihren Partner oder eines Ihrer Kinder gemacht, auch wenn Sie nicht mit Ihnen zusammenleben? Ich habe mir nie grundlos Sorgen gemacht. Ich habe mir selten grundlos Sorgen gemacht. Ich habe mir manchmal grundlos Sorgen gemacht. Ich habe mir oft grundlos Sorgen gemacht. Quellen 122 Ich habe mir immer grundlos Sorgen gemacht. Hatten Sie in den letzten beiden Wochen das Gefühl, dass Sie Ihren Partner oder eines Ihrer Kinder im Stich gelassen hätten? Ich hatte nie solch ein Gefühl. Ich hatte selten solch ein Gefühl. Ich hatte manchmal solch ein Gefühl. Ich hatte oft solch ein Gefühl. Ich hatte immer solch ein Gefühl. Hatten Sie in den letzten beiden Wochen das Gefühl, dass Ihr Partner oder eines Ihrer Kinder Sie im Stich gelassen hätte? Ich hatte nie solch ein Gefühl. Ich hatte selten solch ein Gefühl. Ich hatte manchmal solch ein Gefühl. Ich hatte oft solch ein Gefühl. Ich hatte immer solch ein Gefühl. Hatten Sie in den letzten zwei Wochen genug Geld, um Ihre eigenen Bedürfnisse und die Ihrer Familie zu erfüllen? Ich hatte nie finanzielle Schwierigkeiten. Ich hatte selten finanzielle Schwierigkeiten. Ich hatte manchmal finanzielle Schwierigkeiten. Ich hatte oft finanzielle Schwierigkeiten. Ich hatte immer finanzielle Schwierigkeiten. Quellen 123 Quellen 124 11.4 Beck-Depressions-Inventar – BDI II Fragebogen Beck-Depressions-Inventar - BDI II Fragebogen Urheberrechtlich geschütztes Material Anleitung: Dieser Fragebogen enthält 21 Gruppen von Aussagen. Bitte lesen Sie jede dieser Gruppen von Aussagen sorgfältig durch und suchen Sie dann in jeder Gruppe eine Aussage heraus, die am besten beschreibt, wie Sie sich in den letzten zwei Wochen, einschließlich heute, gefühlt haben. Kreuzen Sie die Zahl neben der Aussage an, die Sie sich herausgesucht haben (0,1,2 oder3). Falls in einer Gruppe mehrere Aussagen gleichermassen auf Sie zutreffen, kreuzen Sie die Aussage mit der höheren Zahl an. Achten Sie bitte darauf, dass Sie in jeder Gruppe nicht mehr als eine Aussage ankreuzen, das gilt auch für Gruppe 16 (Veränderungen der Schlafgewohnheiten) oder Gruppe 18 (Veränderungen des Appetits). 1. Traurigkeit Ich bin nicht traurig. Ich bin oft traurig. Ich bin ständig traurig. Ich bin so traurig oder ünglücklich, dass ich es nicht aushalte 0 1 2 3 2. Pessimismus Ich sehe nicht mutlos in die Zukunft Ich sehe mutloser in die Zukunft als sonst. Ich bin mutlos und erwarte nicht, dass meine Situation besser wird. Ich glaube dass meine Situation hoffnungslos ist und nur noch schlechter wird. 0 1 2 3 3. Versagensgefühle Ich fühle mich nicht als 0 Versager Ich habe häufiger Versa- 1 Quellen gensgefühle. Wenn ich zurückblicke, sehe ich eine Menge Fehlschläge. Ich habe das Gefühl als Mensch ein völliger Versager zu sein. 125 2 3 4. Verlust von Freude Ich kann Dinge genau so genießen wie früher. Ich kann die Dinge nicht mehr so genießen wie früher. Dinge, die mir früher Freude gemacht haben, kann ich kaum mehr genießen. Dinge, die mir früher Freude gemacht haben, kann ich überhaupt nicht mehr genießen. 0 1 2 3 5. Schuldgefühle Ich habe keine besonderen Schuldgefühle Ich habe oft Schuldgefühle wegen Dingen, die ich getan oder die ich hätte tun sollen. Ich habe die meiste Zeit Schuldgefühle. Ich habe ständig Schuldgefühle. 0 1 2 3 6. Bestrafungsgefühle Ich habe nicht das Gefühl, für etwas bestraft zu sein. Ich habe das Gefühl, vielleicht bestraft zu sein. Ich erwarte bestraft zu werden. Ich habe das gefühl, bestraft zu sein. 7. Selbstablehnung 0 1 2 3 Quellen Ich halte von mir genau so viel wie immer. Ich habe das Vertrauen in mich verloren. Ich bin von mir völlig enttäuscht. Ich lehne mich völlig ab. 126 0 1 2 3 8. Selbstvorwürfe Ich kritisiere oder tadle mich häufiger als sonst. Ich bin mir gegenüber kritischer als sonst. Ich kritisiere mich für all meine Mängel. Ich gebe mir die Schuld für alles Schlimme, was passiert. 0 1 2 3 9. Suizidgedanken Ich denke nicht daran, mir etwas anzutun. Ich denke manchmal an Selbstmord, aber ich würde es nicht tun. Ich möchte mich am liebsten umbringen. Ich würde mich umbringen, wenn ich die Gelegenheit dazu hätte. 0 1 2 3 10. Weinen Ich weine nicht öfter als früher. Ich weine jetzt mehr als früher. Ich weine beim geringsten Anlass. Ich möchte gerne weinen, kann aber nicht. 0 1 2 3 11. Unruhe Ich bin nicht unruhiger als sonst. 0 Quellen 127 Ich bin unruhiger als 1 sonst. Ich bin so unruhig, dass es 2 mir schwer fällt still zu sitzen. Ich bin so unruhig, dass 3 ich mich ständig bewegen und etwas tun muss. 12. Interessensverlust Ich habe das Interesse an anderen Menschen oder Tätigkeiten nicht verloren. Ich habe weniger Interesse an anderen Menschen oder Dingen als sonst. Ich habe das Interesse an Menschen oder Dingen größtenteils verloren. Es fällt mit schwer, mich überhaupt für etwas zu interessieren. 0 1 2 3 13. Entschlusslosigkeit Ich bin so entschlussfreudig wie immer. Es fällt mir schwerer als sonst, Entscheidungen zu treffen. Es fällt mir sehr viel schwerer als sonst, Entscheidungen zu treffen. Ich habe Mühe, überhaupt Entscheidungen zu treffen. 0 1 2 3 14. Wertlosigkeit Ich fühle mich nicht wertlos. Ich halte mich für weniger wertvoll und nützlich als sonst. Verglichen mit anderen Menschen fühle ich mich weniger wert. Ich fühle mich völlig wertlos. 0 1 2 3 Quellen 128 15. Energieverlust Ich habe so viel Energie wie immer. Ich habe weniger Energie als sonst. Ich habe so wenig Enegie, dass ich kaum noch etwas schaffe. Ich habe keine Energie mehr, um überhaupt noch etwas zu tun. 0 1 2 3 16. Schlafgewohnheiten Meine Schlafgewohnheiten haben sich nicht verändert. Ich schlafe etwas mehr als sonst.. Ich schlafe etwas weniger als sonst Ich schlafe viel mehr als sonst Ich schlafe viel weniger als sonst Ich schlafe fast den ganzen tag. Ich wache 1-2 Stunden früher auf als gewöhnlich und kann nicht mehr einschlafen. 0 1a 1b 2a 2b 3a 3b 17. Reizbarkeit Ich bin nicht reizbarer als sonst. Ich bin reizbarer als sonst Ich bin viel reizbarer als sonst. Ich fühle mich dauernd gereizt. 0 1 2 3 18. Veränderungen des Appetits Mein Appetit hat sich 0 Quellen nicht verändert. Mein Appetit ist etwas schlechter als sonst. Mein Appetit ist etwas größer als sonst. Mein Appetit ist viel schlechter als sonst. Mein Appetit ist viel größer als sonst. Ich habe überhaupt keinen Appetit. Ich habe ständig Heißhunger. 129 1a 1b 2a 2b 3a 3b 19. Konzentrationsschwierigkeiten Ich kann mich so gut konzentrieren, wie immer. Ich kann mich nicht so gut konzentrieren, wie sonst. Es fällt mir schwer, mich längere Zeit auf irgend etwas zu konzentrieren. Ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. 0 1 2 3 20. Ermüdung oder Erschöpfung Ich fühle mich nicht müder oder erschöpfter als sonst. Ich werde schneller müde und erschöpft als sonst. Für viele Dinge, die ich üblicherweise tue, bin ich zu müde und erschöpft. Ich bin so müde und erschöpft, dass ich fast nichts mehr tun kann. 0 1 2 3 21. Verlust an sexuellem Interesse Mein Interesse an Sexuali- 0 tät hat sich in letzter Zeit nicht verändert. Ich interessiere mich we1 niger für Sexualität als früher. Quellen Ich interessiere mich viel weniger für Sexualität als früher. Ich habe das Interesse an Sxualität völlig verloren. 130 2 3 Quellen 131 Quellen 132 11.5. MFPB 18 Urheberrechtlich geschütztes Material Münchner Fragebogen zur Behandlungsbewertung von Patienten in der stationären Psychotherapie/Psychosomatik (Decker, Möller-Leimkühler, Zaudig 2010) , Copyright Dr. phil. Petra Decker, Ohmstraße 1, 80802 München Bitte geben Sie an, wie Sie den folgenen Aussagen zustimmen : 1. Sollte ich nochmals erkranken, würde ich mich gerne wieder in dieser Klinik behandeln lassen. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 2. Ich habe in der Therapie gelernt, mit anderen Menschen besser zurechtzukommen. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 3. Insgesamt bin ich mit der Therapie, die ich erhalten habe, zufrieden. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 4. Ich habe in der Therapie mehr Selbstvertrauen gewonnen. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 5. Eigentlich hätte ich mir von diesem Klinikaufenthalt mehr versprochen. Voll Überwiegend Quellen 133 Unentschieden Eher nicht Gar nicht 6. Ich weiß jetzt, welche Ziele mir wichtig sind. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 7. Ich habe für mich die richtige therapeutische Betreuung erhalten. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 8. Ich glaube, dass ich die hier eingeübten Problemlösungen auch im wirklichen Leben eigenständig anwenden kann. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 9. Insgesamt bin ich mit dem Therapieergebnis zufrieden. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 10. Ich habe im Laufe der Therapie wieder Freude an Freizeitaktivitäten und einem positiven Körperbewusstsein entwickelt. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 11. Meine Zufriedenheit mit den therapeutischen Maßnahmen ist im Verlauf der Behandlung gesunken. Quellen 134 Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 12. Ich habe im Verlauf der Behandlung gelernt, positiver zu denken. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 13. Ich habe genug Einfluss auf die Behandlung gehabt. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 14. Ich habe in der Therapie eine Hilfestellung erhalten, in meinem Leben etwas Grundsätzliches zu verändern, das ich bisher nicht ändern konnte. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 15. In der Therapie wurden genau die richtigen Problembereiche bearbeitet, die mir wichtig waren. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 16. In der Therapie sind alle meine Möglichkeiten, klarer zu sehen und Probleme besser lösen zu können, erkannt und ausgeschöpft worden. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht Quellen 135 17. Meine Zufriedenheit mit den therapeutischen Maßnahmen ist im Verlauf der Behandlung gestiegen. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 18. Ich weiß jetzt, wie ich meine Ziele erreichen kann. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht Quellen 136 Sehr geehrter Patient, sehr geehrte Patientin, in diesem Fragebogen geht es um Ihre persönlichen Erfahrungen mit der teilstationären Behandlung in unserer Klinik. Wir würden gerne wissen, wie Sie Ihre Behandlung erlebt haben und Kritikpunkte zum Anlass für Verbesserungen nehmen. Es gibt keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten. Wie Sie Ihren teilstationären Aufenthalt erlebt haben, können nur Sie selbst beurteilen. Bitte kreuzen Sie daher im Folgenden jeweils die Antwortmöglichkeit an, der Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen am ehesten zustimmen können. Wir bedanken uns für Ihre Mühe und wünschen Ihnen alles Gute! Quellen 137 Quellen 138 Bitte geben Sie an, wie Sie den folgenen Aussagen zustimmen : 19. Sollte ich nochmals erkranken, würde ich mich gerne wieder in dieser Klinik behandeln lassen. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 20. Ich habe in der Therapie gelernt, mit anderen Menschen besser zurechtzukommen. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 21. Insgesamt bin ich mit der Therapie, die ich erhalten habe, zufrieden. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 22. Ich habe in der Therapie mehr Selbstvertrauen gewonnen. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 23. Eigentlich hätte ich mir von diesem Klinikaufenthalt mehr versprochen. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 24. Ich weiß jetzt, welche Ziele mir wichtig sind. Voll Überwiegend Unentschieden Quellen 139 Eher nicht Gar nicht 25. Ich habe für mich die richtige therapeutische Betreuung erhalten. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 26. Ich glaube, dass ich die hier eingeübten Problemlösungen auch im wirklichen Leben eigenständig anwenden kann. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 27. Insgesamt bin ich mit dem Therapieergebnis zufrieden. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 28. Ich habe im Laufe der Therapie wieder Freude an Freizeitaktivitäten und einem positiven Körperbewusstsein entwickelt. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 29. Meine Zufriedenheit mit den therapeutischen Maßnahmen ist im Verlauf der Behandlung gesunken. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 30. Ich habe im Verlauf der Behandlung gelernt, positiver zu denken. Quellen 140 Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 31. Ich habe genug Einfluss auf die Behandlung gehabt. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 32. Ich habe in der Therapie eine Hilfestellung erhalten, in meinem Leben etwas Grundsätzliches zu verändern, das ich bisher nicht ändern konnte. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 33. In der Therapie wurden genau die richtigen Problembereiche bearbeitet, die mir wichtig waren. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 34. In der Therapie sind alle meine Möglichkeiten, klarer zu sehen und Probleme besser lösen zu können, erkannt und ausgeschöpft worden. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht 35. Meine Zufriedenheit mit den therapeutischen Maßnahmen ist im Verlauf der Behandlung gestiegen. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Quellen 141 Gar nicht 36. Ich weiß jetzt, wie ich meine Ziele erreichen kann. Voll Überwiegend Unentschieden Eher nicht Gar nicht Quellen 142 Quellen 12. Lebenslauf Bussardweg 4, 50858 Köln Tel: 0221 486837 Email: [email protected] Schulische und Universitäre Ausbildung 1971 - 1984 Gymnasium Weiden, Ostlandstraße , 50859 Köln Abschluss: Abitur 1986 - 1988 Studium der Humanmedizin, Semmelweis-Universität Budapest Abschluss: Physikum 1988 - 1993 Studium der Humanmedizin, Rheinische Friedrich-Wilhelm-Universität, Bonn Abschluss: Staatsexamen Approbation als Ärztin i.P. 1993 - 1994 Ärztin im Praktikum, Tagesklinik Alteburger Straße Abschluss: Approbation als Ärztin 143 Quellen 144 Beruflicher Werdegang 1994 - 2005 Assistenzärztin 2005 - jetzt Oberärztin Tagesklinik Alteburger Straße, Köln Tagesklinik Alteburger Straße, Köln Weiterbildung 1998 Fachärztin für Psychiatrie 2004 Weiterbildung Gruppenanalyse 2005 Zusatzbezeichnung: Psychotherapie 2011 Weiterbildung EMDR-Therapeutin , Quellen 145