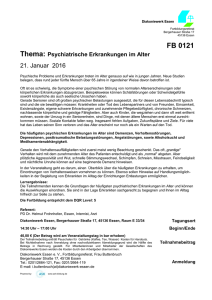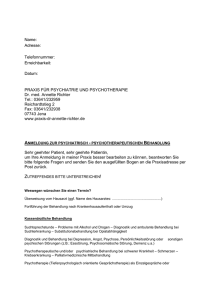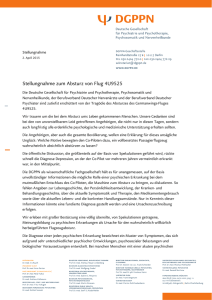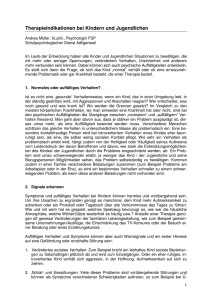Wenig Zeit und dominantes Arztverhalten können zu Fehldiagnose
Werbung
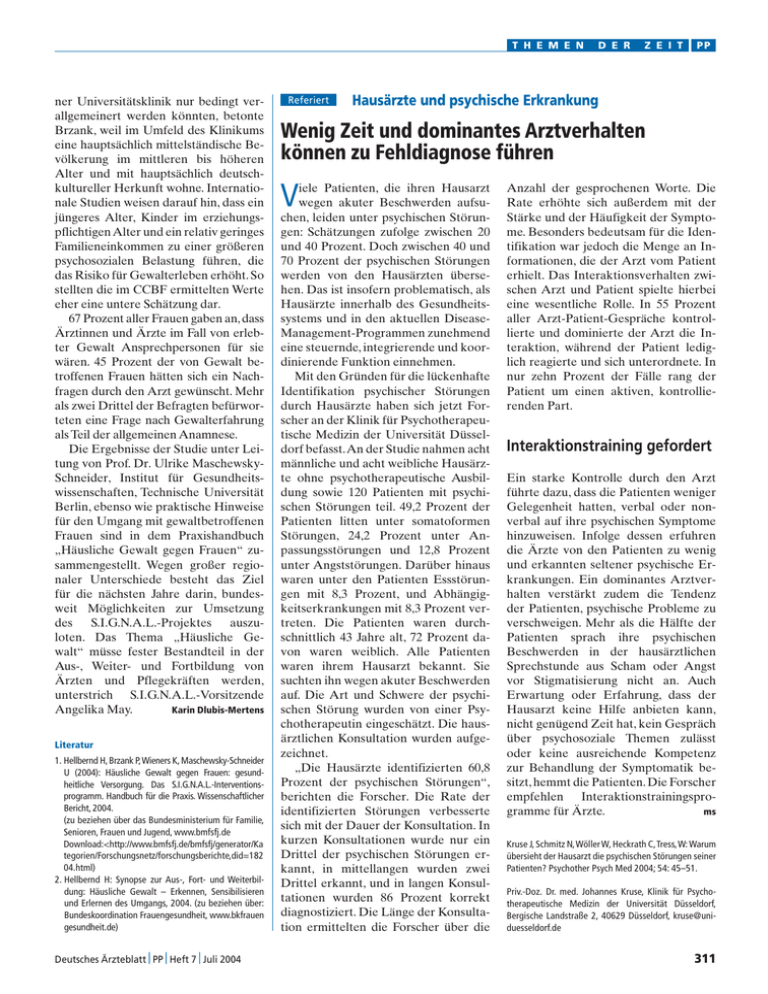
T H E M E N ner Universitätsklinik nur bedingt verallgemeinert werden könnten, betonte Brzank, weil im Umfeld des Klinikums eine hauptsächlich mittelständische Bevölkerung im mittleren bis höheren Alter und mit hauptsächlich deutschkultureller Herkunft wohne. Internationale Studien weisen darauf hin, dass ein jüngeres Alter, Kinder im erziehungspflichtigen Alter und ein relativ geringes Familieneinkommen zu einer größeren psychosozialen Belastung führen, die das Risiko für Gewalterleben erhöht. So stellten die im CCBF ermittelten Werte eher eine untere Schätzung dar. 67 Prozent aller Frauen gaben an, dass Ärztinnen und Ärzte im Fall von erlebter Gewalt Ansprechpersonen für sie wären. 45 Prozent der von Gewalt betroffenen Frauen hätten sich ein Nachfragen durch den Arzt gewünscht. Mehr als zwei Drittel der Befragten befürworteten eine Frage nach Gewalterfahrung als Teil der allgemeinen Anamnese. Die Ergebnisse der Studie unter Leitung von Prof. Dr. Ulrike MaschewskySchneider, Institut für Gesundheitswissenschaften, Technische Universität Berlin, ebenso wie praktische Hinweise für den Umgang mit gewaltbetroffenen Frauen sind in dem Praxishandbuch „Häusliche Gewalt gegen Frauen“ zusammengestellt. Wegen großer regionaler Unterschiede besteht das Ziel für die nächsten Jahre darin, bundesweit Möglichkeiten zur Umsetzung des S.I.G.N.A.L.-Projektes auszuloten. Das Thema „Häusliche Gewalt“ müsse fester Bestandteil in der Aus-, Weiter- und Fortbildung von Ärzten und Pflegekräften werden, unterstrich S.I.G.N.A.L.-Vorsitzende Karin Dlubis-Mertens Angelika May. Literatur 1. Hellbernd H, Brzank P,Wieners K, Maschewsky-Schneider U (2004): Häusliche Gewalt gegen Frauen: gesundheitliche Versorgung. Das S.I.G.N.A.L.-Interventionsprogramm. Handbuch für die Praxis. Wissenschaftlicher Bericht, 2004. (zu beziehen über das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, www.bmfsfj.de Download:<http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Ka tegorien/Forschungsnetz/forschungsberichte,did=182 04.html) 2. Hellbernd H: Synopse zur Aus-, Fort- und Weiterbildung: Häusliche Gewalt – Erkennen, Sensibilisieren und Erlernen des Umgangs, 2004. (zu beziehen über: Bundeskoordination Frauengesundheit, www.bkfrauen gesundheit.de) PP Heft 7 Juli 2004 Deutsches Ärzteblatt Referiert D E R Z E I T PP Hausärzte und psychische Erkrankung Wenig Zeit und dominantes Arztverhalten können zu Fehldiagnose führen V iele Patienten, die ihren Hausarzt wegen akuter Beschwerden aufsuchen, leiden unter psychischen Störungen: Schätzungen zufolge zwischen 20 und 40 Prozent. Doch zwischen 40 und 70 Prozent der psychischen Störungen werden von den Hausärzten übersehen. Das ist insofern problematisch, als Hausärzte innerhalb des Gesundheitssystems und in den aktuellen DiseaseManagement-Programmen zunehmend eine steuernde, integrierende und koordinierende Funktion einnehmen. Mit den Gründen für die lückenhafte Identifikation psychischer Störungen durch Hausärzte haben sich jetzt Forscher an der Klinik für Psychotherapeutische Medizin der Universität Düsseldorf befasst.An der Studie nahmen acht männliche und acht weibliche Hausärzte ohne psychotherapeutische Ausbildung sowie 120 Patienten mit psychischen Störungen teil. 49,2 Prozent der Patienten litten unter somatoformen Störungen, 24,2 Prozent unter Anpassungsstörungen und 12,8 Prozent unter Angststörungen. Darüber hinaus waren unter den Patienten Essstörungen mit 8,3 Prozent, und Abhängigkeitserkrankungen mit 8,3 Prozent vertreten. Die Patienten waren durchschnittlich 43 Jahre alt, 72 Prozent davon waren weiblich. Alle Patienten waren ihrem Hausarzt bekannt. Sie suchten ihn wegen akuter Beschwerden auf. Die Art und Schwere der psychischen Störung wurden von einer Psychotherapeutin eingeschätzt. Die hausärztlichen Konsultation wurden aufgezeichnet. „Die Hausärzte identifizierten 60,8 Prozent der psychischen Störungen“, berichten die Forscher. Die Rate der identifizierten Störungen verbesserte sich mit der Dauer der Konsultation. In kurzen Konsultationen wurde nur ein Drittel der psychischen Störungen erkannt, in mittellangen wurden zwei Drittel erkannt, und in langen Konsultationen wurden 86 Prozent korrekt diagnostiziert. Die Länge der Konsultation ermittelten die Forscher über die Anzahl der gesprochenen Worte. Die Rate erhöhte sich außerdem mit der Stärke und der Häufigkeit der Symptome. Besonders bedeutsam für die Identifikation war jedoch die Menge an Informationen, die der Arzt vom Patient erhielt. Das Interaktionsverhalten zwischen Arzt und Patient spielte hierbei eine wesentliche Rolle. In 55 Prozent aller Arzt-Patient-Gespräche kontrollierte und dominierte der Arzt die Interaktion, während der Patient lediglich reagierte und sich unterordnete. In nur zehn Prozent der Fälle rang der Patient um einen aktiven, kontrollierenden Part. Interaktionstraining gefordert Ein starke Kontrolle durch den Arzt führte dazu, dass die Patienten weniger Gelegenheit hatten, verbal oder nonverbal auf ihre psychischen Symptome hinzuweisen. Infolge dessen erfuhren die Ärzte von den Patienten zu wenig und erkannten seltener psychische Erkrankungen. Ein dominantes Arztverhalten verstärkt zudem die Tendenz der Patienten, psychische Probleme zu verschweigen. Mehr als die Hälfte der Patienten sprach ihre psychischen Beschwerden in der hausärztlichen Sprechstunde aus Scham oder Angst vor Stigmatisierung nicht an. Auch Erwartung oder Erfahrung, dass der Hausarzt keine Hilfe anbieten kann, nicht genügend Zeit hat, kein Gespräch über psychosoziale Themen zulässt oder keine ausreichende Kompetenz zur Behandlung der Symptomatik besitzt, hemmt die Patienten. Die Forscher empfehlen Interaktionstrainingsproms gramme für Ärzte. Kruse J, Schmitz N,Wöller W, Heckrath C,Tress,W: Warum übersieht der Hausarzt die psychischen Störungen seiner Patienten? Psychother Psych Med 2004; 54: 45–51. Priv.-Doz. Dr. med. Johannes Kruse, Klinik für Psychotherapeutische Medizin der Universität Düsseldorf, Bergische Landstraße 2, 40629 Düsseldorf, [email protected] 311