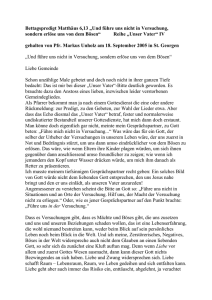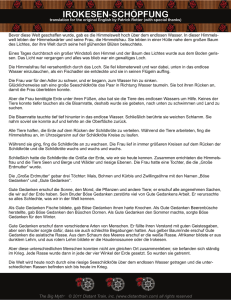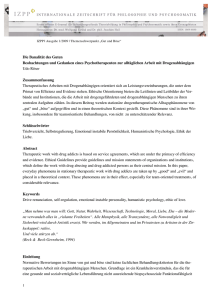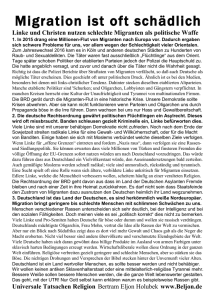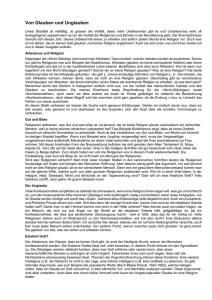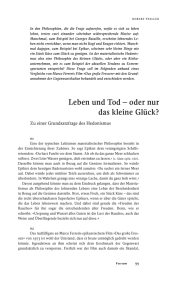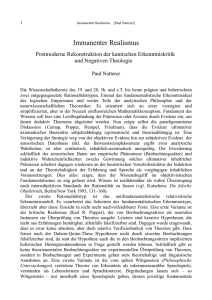1 Freiheit in Kants Die Religion innerhalb der Grenzen der bloβen
Werbung

Das Böse: Fluch oder Segen? Kant und Schelling über das Böse und die Freiheit des Menschen Masterarbeit Studiengang Philosophie (Research Master) Universität Amsterdam Betreuer: Victor Kal Amsterdam, den 19. August 2010 Matthé Scholten (0272825) Groen van Prinstererstraat 13-hs 1051 ED Amsterdam [email protected] 06 17 308 772 Inhaltsaufgabe Abkürzungen 3 Einleitung 4 1 Die Verwirklichung der Freiheit 9 1.1 Der systematische Kontext der Religionsschrift 9 1.2 Die Idee des höchsten Guts in der Welt 11 2 Kant: Die menschliche Freiheit al Grund des Bösen 16 2.1 Der Hang zum Bösen 16 2.2 Der Beweis des Hanges zum Bösen 18 2.3 Die intelligible Tat 26 3 Freiheit und System 29 3.1 „Als ob“ und System 34 3.2 Der Systemansatz der Freiheitsschrift 4 Von Kant Schelling: Die intelligible Tat als Mittelpunkt des Systems 36 4.1 Die Freiheitsschrift: Eine Übersicht der wissenschaftlichen Diskussion 36 4.2 Nochmals die intelligible Tat 38 4.3 Das Wesen des Böse 41 4.4 Die Umkehr zum Guten 46 4.5 Moralische und ontologische Freiheit 49 Schluss 51 Literaturliste 53 2 Abkürzungen GMS Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Seitenangaben nach Band IV der Akademienausgabe. KdrV Kritik der reinen Vernunft. Seitenangaben nach der Originalausgaben A und B. KpV Kritik der praktischen Vernunft. Seitenangaben nach der Originalausgabe. KU Kritik der Urteilskraft. Seitenangaben nach der zweiten Originalausgabe B. MS Metaphysik der Sitten. Seitenangaben nach Band VI der Akademienausgabe. RGV Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Seitenangaben nach der zweiten Originalausgabe B. WF Über das Wesen der menschlichen Freiheit. Seitenangaben nach Band VII der Sämtlichen Werke. WA Die Weltalter. Seitenangaben nach der Paginierung der Originaldrucke. 3 Einleitung Das Böse ist ein Thema, zu dem man vielleicht lieber keine Masterarbeit schreiben möchte. Warum würde einer das Böse in den Vordergrund stellen wollen? Wenn es darauf ankommt, das Böse anzuerkennen, ziehen wir es vielmals vor, es heimlich verschwinden zu lassen. Das zeigt sich schon am Sprachgebrauch: Während wir das Wort „gut“ sehr häufig, mit großer Selbstverständlichkeit und spielender Leichtigkeit benutzen, zögern wir offenbar so sehr mit dem Wort „böse“, dass wir es nur selten in den Mund nehmen. Das Böse hat etwas Bedenkliches, etwas Abschreckendes sogar, jedenfalls etwas, mit dem wir lieber nicht konfrontiert werden wollen. Das Böse fängt an, wo unser Verständnis aufhört. Wenn uns „böse“ Taten vor die Augen geführt werden, fragen wir uns: „Wie könnte man so etwas machen?“ Unser Unvermögen, böse Taten verstehen zu können, führt uns oftmals dazu, dem Täter eine psychische Krankheit zuzuschreiben. Wir sind uns dabei gleichwohl nicht bewusst, dass wir damit die böse Tat zu einem bloßen Naturvorgang herabsetzen. „Böse“ ist eine moralische Qualifikation und setzt als solche Freiheit voraus. Indem wir den Täter unzurechnungsfähig erklären, ist das Böse annulliert. Hier zeigt sich das Paradox des Bösen: Es scheint gerade nur da zu sein, wo es nicht ist. Gerade weil das Böse eine marginale Erscheinung ist, vermag es auch zu faszinieren. Wenn das Böse ästhetisiert wird – und damit auch gewissermaßen unschädlich gemacht –, kann eine außerordentliche Anziehungskraft davon ausgehen. Die Figur des großen Verbrechers aus der modernen Literatur zeigt uns mit seinem unangepassten und gesetzesüberschreitenden Benehmen, dass er den Gepflogenheiten der bürgerlichen Moral nicht unterworfen ist. Seine bösen Taten erbringen uns den Beweis seiner radikalen Individualität. Indem wir uns mit dem Verbrecher identifizieren, sind wir imstande, freilich ohne dazu böse Taten begehen zu müssen, die Vorurteile, in denen wir befangen waren, abzulegen und wie unser Held eine absolute Einzigartigkeit zu beanspruchen. Die bösen Handlungen, mit denen der Verbrecher seine Eigenheit bezeugt, stellen zugleich die bürgerlichen Sitten in den Verdacht, trotz ihrem Anspruch auf Vollkommenheit, nur „Scheingutes“ zu repräsentieren, denn wenn die bösen Handlungen auf absoluter Individualität beruhen müssen, so auch die guten; und wie können die „gewissenhaften“ Menschen, die alles „nach Sitten und Gebrauch“ tun, d. h. lediglich pflichtmäßig handeln, behaupten, ein solches Individuum zu sein? Diesbezüglich ist es nicht erstaunlich, dass vor allem in der Jugendkultur eine 4 „sympathy for the devil“ auftaucht. Die Faszination, die das Böse auszulösen vermag, darf uns jedoch nicht dazu verführen, uns an den Teufel auszuliefern, denn der Preis, den wir dafür zu zahlen hätten, wäre nicht weniger als unsere Freiheit. Kehren wir zum Paradox des Bösen zurück: Das Böse ist gerade da, wo es nicht ist. Dieser Paradox hat Metaphysiker veranlasst, die Frage nach dem Seinscharakter des Bösen zu stellen: Auf welcher Weise „ist“ das Böse? „Ist“ das Böse überhaupt? Eine Metaphysik des Bösen versucht solche Fragen zu beantworten. Die Versuche, die es in der Geschichte der Metaphysik gegeben hat, sind, wenn es erlaubt ist sehr grob zu vereinfachen, auf zwei Modelle zurückzubringen: Ein monistisches und ein dualistisches Modell. Das monistische Modell findet seinen exemplarischen Ausdruck in der Emanationslehre Plotins. Nach der Emanationslehre kann alles, was ist, auf das Eine, aus dem es im Prozess der Emanation hervor gequellt ist, zurückgeführt werden; alles Seiende verdankt dem Einen sein Sein. Indem das Eine zugleich das Gute ist, ist alles, was ist, insofern es ist, gut. Im Prozess der Emanation gibt es gleichwohl verschiedene Abstufungen: Im Ablauf vom völlig Geistigen zu immer mehr Materiellen gibt es eine graduelle Abnahme an Sein. Das Böse entsteht nun, indem die nicht-erleuchtete Materie sich vom Einen löst, d. h. wenn sie als nicht seiend – denn nicht mehr in Kontakt mit dem Einen – dennoch wirklich ist: Das Böse ist eine Privation oder Abwesenheit des Guten. Der Unterschied zwischen guten und schlechten Handlungen ist, wie Schelling sich ausdrückt, ein „bloßes Plus und Minus der Vollkommenheit“. (WF, S. 353) Im eigentlichen Sinne „ist“ das Böse nicht. Anhand des monistischen Modells können wir die Existenz des Bösen nur erklären, indem wir gerade leugnen, dass das Böse ist. Das monistische Modell vermag das Paradox des Bösen nicht zu lösen. Auch die Versuche, das Böse anhand des dualistischen Modells zu erklären, laufen letztlich schief. Mani – dessen Lehre uns vor allem über Augustin bekannt ist – nahm zur Erklärung des Bösen in der Welt zwei positive, substantivierte Mächte an: Ein guter Gott und ein böser Gott. Der Streit zwischen Gut und Böse, den wir in dieser Welt wahrnehmen können, spielt sich eigentlich zwischen den zwei himmlischen Feinden ab. Mit diesem Kunstgriff wird jedoch der Mensch zum Spielball des guten und schlechten Gottes gemacht: Die Manichäische Lehre bedeutet für den Menschen gerade so viel Gewissensruhe als Freiheitsverlust. Mani bringt es nicht fertig, das moralische Böse zu begründen, denn wenn die menschliche Freiheit ausgelöscht wird, so auch das moralische Böse. 5 Auf Basis dessen, was bis jetzt erörtert worden ist, kann die Theodizee-Frage, die aus theologischer Hinsicht gestellt wird, einsichtig gemacht werden. Wie kann Gott angesichts des Bösen in der Welt gerechtfertigt werden? Oder: Wie ist die Allmacht und Allgütigkeit Gottes mit der Existenz des Bösen in Übereinstimmung zu bringen? Wenn das Böse als eine Gott gegenüberstehende, eigenständige Macht sein soll, so wäre dies im Widerstreit mit der Allmacht Gottes. Soll das Böse dagegen ein Geschöpf Gottes sein, so würde dies der Allgütigkeit Gottes widersprechen. Obwohl die Problematik natürlich erheblich komplizierter ist, als ich sie dargestellt habe, scheint der Theodizee darauf hinauszulaufen, dass Gott nur gerettet werden kann, indem das Böse geleugnet wird. Es führt im Rahmen dieser Arbeit zu weit, hier die von Leibniz vorgeschlagene Lösung zum Theodizee-Problem zu besprechen, zumal diese Arbeit sich keiner theologischen Fragestellung annimmt. Diese Arbeit fokussiert sich auf den moralischen Deutungsversuch des Bösen. Ein moralischer Deutungsansatz stellt sich primär die Frage, wie der Mensch für das Böse zur Rechenschaft gezogen werden kann. Zugegeben, auch bei metaphysischen und theologischen Deutungsversuchen kommt die menschliche Verantwortung für das Böse in den Betracht. Die menschliche Verantwortung für das Böse ist in diesen Kontexten jedoch zunächst Antwort auf die Frage, die gestellt wird – sie bildet nicht die Problemstellung. Zwischen metaphysischen, theologischen und moralischen Deutungsversuchen gibt es somit keine – oder jedenfalls nicht unbedingt – Konkurrenz: Der Unterschied liegt vielmehr in der Fragerichtung. Kants Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft und Schellings Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und damit zusammenhängenden Gegenstände sind klassische moralische Deutungsversuche des Bösen. Die Problemstellung ergibt sich aus der praktischen Philosophie Kants, die er in der Kritik der praktischen Vernunft und der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten dargelegt hat. 1 Kant unterscheidet in seiner praktischen Philosophie zwischen verschiedenen Arten von Handlungen. Das moralische Gesetz funktioniert als das Kriterium für die Unterscheidungen. Da es für Handlungen jeweils nur einen ausschlaggebenden Grund geben kann, muss eine Handlung entweder aus Pflicht, 1 Ich beziehe mich im Folgenden auf Prauss (1983, v. a. S. 70 - 83). Prauss hält jedoch Kants „Theorie der radikalen Bösen“ für einen „scheiternde[n] Lösungsversuch“. (Ebd. S. 83) Ich werde in dieser Arbeit dagegen versuchen aufzuweisen, dass Kants Deutungsansatz in der Religionsschrift erfolgreich gewesen ist. Prauss schließt auf das Scheitern, weil er unvermögend ist, den rekonstruktiven Charakter der kantischen Untersuchung einzusehen. (Vgl. dazu § 2.2 und § 3.2 dieser Arbeit) 6 genauer gesagt um der Moralität der Handlung selbst willen, oder nicht aus Pflicht bzw. aus Neigung, nämlich um willen der Befriedigung einer Neigung, geschehen. Obwohl man weiter nuancieren könnte, kann man das menschliche Handeln in drei Kategorien einordnen: 1.) moralische Handlungen, d. h. Handlungen aus Pflicht, 2.) bloß pflichtmäßige Handlungen, d. h. dem Gesetz angemessenen Handlungen aus Neigung und 3.) moralisch böse Handlungen, d. h. gesetzwidrige Handlungen aus Neigung. Das Moralgesetz dient indessen nicht nur zur moralischen Qualifikation der Handlungen, sondern wird von Kant auch als Prinzip zur Deduktion der Freiheit eingesetzt. Kant leitet nicht das Moralgesetz aus der Wirklichkeit der Freiheit, sondern umgekehrt die Wirklichkeit der Freiheit aus dem Moralgesetz als „Faktum der Vernunft“ ab. Dementsprechend ist das Verhältnis des moralischen Gesetzes zur Freiheit analytisch: „[…] ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen [ist] einerlei.“ (GMS, S. 447)2 Wenn freies Handeln mit moralischem Handeln identisch ist, bleibt jedoch keine Freiheit für das nicht-moralische Handeln übrig: Das bloß legale und das moralisch-böse Handeln wird zur reinen Heteronomie bzw. Fremdbestimmung herabgesetzt. Handlungen, die nicht aus Pflicht und demzufolge nicht aus Freiheit geschehen, kommen nicht für eine moralische Beurteilung in Betracht. Indem das Sittengesetz sowohl das Kriterium zur Unterscheidung guter und böser Handlungen als auch das Prinzip zur Deduktion der Freiheit ist, meint die Beurteilung einer bestimmten Handlung als böse zugleich auch deren Aufhebung als Handlung. Aufs Neue scheint das Böse sich nur dort aufhalten zu können, wo es gerade nicht sein kann. Diese Arbeit stellt sich die Frage, wie der Mensch für das Böse zur Rechenschaft gezogen werden kann. Sie hat sich damit zur Aufgabe gestellt, ein fundamentales Problem der Autonomiephilosophie zu lösen. Das Böse stellt jedoch nicht nur ein philosophisches Problem dar; es wird sich nämlich erweisen, dass gerade die Reflexion auf das moralische Böse dem Philosophen Wege zu öffnen vermag, die ihm sonst verschlossen bleiben müssten. Die Untersuchung wird erstens zur Einsicht gelangen, dass das Böse ein gewisses Erklärungspotenzial hat: Das Böse vermag zu erklären, warum die Freiheit, obzwar sie wirklich sein muss, dies in vielen Fällen nicht ist. Die Untersuchung wird zweitens ein kritisches Potenzial des Bösen bloßlegen. Die Anerkennung des Bösen vermag nämlich die Gewissensruhe des Menschen als Selbstbetrug zu entlarven. Die Arbeit stellt sich gleichwohl noch eine kühnere Frage, 2 Vgl. auch KpV, S. 4 f., 52, 56, 59, 72, 79 f., 128. 7 nämlich: Was hat das moralische Böse positiv über das Wesen der menschlichen Freiheit zu sagen? Es wird sich ergeben, dass mittels einer Analyse des moralischen Bösen eine für die Moderne maßgebende Freiheit bloßgelegt werden kann, und zwar: eine Freiheit als Selbstbestimmung. Ich werde die gestellten Fragen im zweiten Kapitel, anhand Kants Religionsschrift, zu beantworten versuchen. Das erste Kapitel dient vorerst dazu, den systematischen Kontext der Frage nach dem moralischen Bösen darzulegen: Die Frage nach dem Bösen wird gestellt vor dem Hintergrund der Problematik einer Verwirklichung der Freiheit. Das erste Kapitel unterstützt zudem die Vorbereitung auf die Frage, die ich erst im dritten und vierten Kapitel zu beantworten versuchen werde: Wie ist das moralische Böse mit einem Systemansatz in Übereinstimmung zu bringen? Oder positiv formuliert: Welche Möglichkeiten eröffnet die Reflexion auf das moralische Böse der Idealistischen Philosophie? Diese Fragen stehen im Kontext der Frage, welche Konsequenzen die Anerkennung des Bösen für die Methode der Philosophie hat. Ich werde behaupten, dass die Philosophie, wenn sie dem moralischen Bösen gerecht werden soll, eine doppelte Methode, in der Deduktion und Rekonstruktion sich gegenseitig ergänzen, in Anspruch nehmen muss. Das dritte Kapitel dient dazu, der Systemansatz der Freiheitsschrift von anderen Systemansätze im Deutschen Idealismus unterscheiden zu können. Das vierte Kapitel wird inhaltlich näher auf die Freiheitsschrift eingehen. Schellings Freiheitsschrift ist ein sehr komplizierter Text. Deshalb werde ich erst eine Interpretation der Religionsschrift Kants herausarbeiten und diese dann als heuristisches Instrument zur Interpretation der Freiheitsschrift heranziehen. Aus diesem Grund habe ich entschieden, Kants Deutung des Wesens des Bösen und der Umkehr zum Guten erst im vierten Kapitel, die eigentlich Schellings Freiheitsschrift gewidmet ist, zu erörtern. (§ 4.3 und § 4.4) Ich beschränke mich in dieser Arbeit auf die folgenden primären Texten: Kants Kritik der praktischen Vernunft und Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft und Schellings Abhandlung über das Wesen der menschlichen Freiheit. In Einzelfällen erlaube ich es mir, aus anderen primären Texten zu zitieren. Die Arbeit hat sich nicht zum Ziel gesetzt, die Grundbegriffe der praktischen Philosophie Kants zu erläutern. Eine Bekanntschaft mit Begriffen wie Sittengesetz, Pflicht, Imperativ und Autonomie – und mit deren ungeläufigen Bedeutung – wird vorausgesetzt. 8 1 Die Verwirklichung der Freiheit Bevor auf das Thema des Bösen eingegangen werden kann, soll erst der systematische Kontext der Frage nach dem Bösen geklärt werden. Die Frage nach dem Bösen wird gestellt im Rahmen der Problematik der Verwirklichung der Freiheit. (§ 1.1) Eine Analyse von Kants Idee des höchsten Guts in der Welt befähigt uns, diese Problematik detailliert darzustellen. (§ 1.2) 1.1 Der systematische Kontext der Religionsschrift Um den systematischen Kontext der Religionsschrift klären zu können, ist es hilfreich, mit den drei Fragen anzufangen, welche sich die Vernunft, Kant zufolge, stellt: (KdrV, S. A 805, B 833) 1. Was kann ich kennen? 2. Was soll ich tun? 3. Was darf ich hoffen? In diesem Buch über die Religion – als dem Teil des Lebens, worin Glaube und Hoffnung einen Platz haben – wird offenbar der Versuch geleistet, die dritte Frage zu beantworten. Die erste und zweite Frage sind der theoretischen beziehungsweise der praktischen Philosophie Kants zuzuordnen. In der Kritik der reinen Vernunft wird die erste Frage mittels einer Eingrenzung – und das bedeutet zugleich die Freilegung – des Möglichkeitsraums des Erkennens beantwortet. Die Erkenntnis von Gegenständen ist uns, der theoretischen Philosophie Kants zufolge, nur möglich, sofern diese als Erscheinungen betrachtet werden, nicht aber als Dinge an sich.3 Wenn die Dinge als Erscheinungen betrachtet werden, erfüllen sie die notwendigen subjektiven Bedingungen für die Möglichkeit objektiver Erkenntnis. Sowohl unsere Anschauungsformen – Raum und Zeit – als auch die Kategorien des Verstandes sind dadurch empirisch real. Eine dieser Kategorien des Verstandes ist die 3 Ich bin der Meinung, dass die kantische Unterscheidung zwischen Erscheinung und Ding an sich von methodologischer bzw. epistemologischer Art ist. Ich benutze die Formulierung „sofern sie betrachtet werden als“, um mich von einer ontologischen Interpretation der Unterscheidung zu distanzieren. Es spricht für sich, dass „betrachten“ nicht im Sinn der sinnlichen Erfahrung verstanden werden muss. Auch Kant benutzt hier das Verb „betrachten“. (Vgl. KdrV, S. B XIX, GMS, 451 ff.). 9 Kategorie der Kausalität. Die Dinge, vorausgesetzt sie sind Gegenstände des Erkennens, sind also immer in kausalen Beziehungen eingebunden. Dies hat zur Folge, dass auch der Mensch, sofern er Gegenstand des Erkennens ist, immer in kausale Zusammenhänge eingebunden, d. h. völlig determiniert ist. Die Kritik der praktischen Vernunft versucht die zweite Frage zu beantworten: Was muss ich tun? Um diese Frage beantworten zu können, muss aber der Mensch als frei gedacht werden; denn wie könnte einem unfreien Wesen etwas moralisch befohlen sein? Kant konzipiert die Freiheit des Menschen als Autonomie, d. h. als das Vermögen, sich selbst das Gesetz geben zu können. Das Handeln des Menschen kann also nur durch den Menschen selbst und nicht durch anderes bestimmt werden. Die Konzeption des Menschen, einerseits als determiniertes, andererseits als freies Wesen, erscheint widersprüchlich: Wie kann ein Mensch zugleich frei und determiniert sein? Er ist doch entweder frei oder determiniert? Die theoretische Lösung dieses Widerspruchs leistet Kant in der Kritik der reinen Vernunft. (KdrV, A 444 ff., B 472 ff.) Seine Lösung läuft darauf hinaus, dass es nur einen scheinbaren Widerspruch zwischen den beiden Aussagen – der Mensch ist frei, der Mensch ist determiniert – gibt. In den Aussagen wird nämlich der Mensch in verschiedener Perspektive betrachtet: einmal als Ding an sich und einmal als Erscheinung. Der Mensch ist nur in dem Sinne, dass er auf zwei verschiedenen Weisen betrachtet werden kann, „Bürger zweier Welten“. Der Widerspruch ist in theoretischer Hinsicht gelöst. Für die praktische Vernunft gibt es aber dennoch ein Problem. Das Sittengesetz ist ein „Faktum der Vernunft“, d. h. der Mensch lebt in der unmittelbaren Sicherheit, dass ihm etwas moralisch befohlen ist. Da die Idee einer prinzipiell unrealisierbaren Pflicht widersinnig ist, kann aus dem Faktum, dass dem Menschen etwas zur Pflicht gestellt ist, geschlossen werden, dass er diese Pflicht realisieren kann: „Du kannst, denn du sollst.“ Aus dem Sittengesetz, als formaler Bedingung des Gebrauches der Freiheit, kann mithin die Wirklichkeit der Freiheit gefolgert werden: Meine Freiheit muss in der Sinnenwelt realisiert werden können. Vom Standpunkt des Sittengesetzes aus gesehen bedeutet dies, dass die Verbindlichkeit des Sittengesetzes seine „objektive Realität“, d. h. die Möglichkeit der Realisierung dessen Endzwecks in der Sinnenwelt, impliziert. Soll die objektive Realität der Freiheit und des Sittengesetzes garantiert werden, so muss das Sollen mit der Wirklichkeit, die Kausalität aus Freiheit mit der Kausalität der Natur verbunden werden. Keine Erfahrung kann mir indessen davon versichern, 10 dass meine Freiheit wirklich ist bzw. das Sittengesetz objektive Realität hat, denn wenn wir von Erfahrung sprechen, sind wir wieder im Bereich der theoretischen Vernunft. Da es in der Erfahrung nur Raum für die Kausalität der Natur gibt, kann die moralische Qualität der Auswirkungen meines moralischen Handelns nie ihr Gegenstand werden. Wenn der Mensch nicht in einen unmöglichen Spagat zwischen zwei „Welten“ geraten soll, muss die „Kluft“ zwischen den ersten beiden Kritiken überbrückt werden. 1.2 Die Idee des höchsten Guts in der Welt Traditionell wird – übrigens ganz zu Recht – zur Lösung des Problems einer Vermittlung von Freiheit und Natur auf die dritte Kritik, die Kritik der Urteilskraft, hingewiesen. Auch in Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft versucht Kant dieses Problem zu lösen. In dem Text versucht er das Sollen mit dem Wirklichen, oder in der Terminologie der Religionsschrift: die „Pflicht“ mit der angemessenen „Glückseligkeit“ zu verbinden. Gleich am Anfang des Buches macht Kant deutlich, dass die Moral sich selbst genügt, und das heißt hier insbesondere, dass die Moral der Religion nicht bedarf. Das moralische Gesetz an sich reicht als Bestimmungsgrund des Willens schon aus. Dennoch schließt die Moral die Idee eines Endzweckes des moralischen Handelns ein, dessen Realisierung, wie wir gesehen haben, außerhalb der Grenzen der bloßen praktischen Vernunft liegt. Kant nennt diesen Endzweck, der die Pflicht und die Glückseligkeit „zusammen vereinigt in sich hält“, „die Idee eines höchsten Guts in der Welt“. (RGV, S. VII) Allein mit dieser Idee kann „der Verbindung der Zweckmäßigkeit aus Freiheit mit Zweckmäßigkeit der Natur, deren wir gar nicht entbehren können, objektiv praktische Realität verschafft werden […]“. (RGV, S. VIII) Die Idee des höchsten Guts enthält die Vorstellung eines weltlichen Zustands, in dem jeder auf vollkommene Weise sittlich und in präziser Proportion dazu glückselig ist. Kant wird nicht müde zu betonen, dass die Idee des höchsten Guts, als Endzweck des moralischen Handelns, kein Grund, sondern nur eine notwendige Folge des Gebrauches der Freiheit ist. Da die Idee eines höchsten Guts in der Welt die Pflicht mit der angemessenen Glückseligkeit verbindet bzw. die „Kluft“ zwischen der praktischen und der theoretischen Vernunft, zwischen Freiheit und Natur, überbrückt, müssen wir zu deren Möglichkeit „ein höheres, moralisches, heiligstes und allvermögendes Wesen annehmen […] das allein beide Elemente desselben [Pflicht und Glückseligkeit] vereinigen kann“. (RGV, S. VII) Nur bei der praktischen Annahme eines Gottes, der 11 zugleich moralischer Gesetzgeber und Urheber der Welt ist, kann die Wirklichkeit der Freiheit und die objektive Realität des Sittengesetzes gesichert werden. Zwar bedarf die Moral um ihrer selbst willen der Religion nicht, aber sie „führt unumgänglich zur Religion“. (RGV, S. IX) Wenn wir auch zur Realisierung des Endzwecks des moralischen Handelns auf Hoffnung angewiesen sind, so werden wir nicht von unserer moralischen Pflicht entlassen. Nur unter der Bedingung, dass wir im moralischen Handeln den Beistand Gottes würdig werden, dürfen wir hoffen, dass Gott unsere Anstrengungen vollendet: Er [der Mensch] muß [...] so verfahren, als ob alles auf ihn ankomme, und nur unter dieser Bedingung darf er hoffen, daß höhere Weisheit seiner wohlgemeinten Bemühung die Vollendung werde angedeihen lassen. (RGV, S. 141) Die Idee des höchsten Guts – und damit die ganze Religionsphilosophie Kants – ist ein großer Diskussionspunkt in der Kant-Forschung. Caswell (2006) verschafft uns eine Übersicht der Diskussion. Auf der einen Seite gibt es die „Überflüssigkeitsthese“. Wie oben schon erwähnt, ist die Idee des höchsten Guts immer nur Folge, nie aber Grund des moralischen Handelns. Das einzige, was wir tun können, um unsere Glückseligkeit zu fördern, ist versuchen, ihr würdig zu werden, d. h. unsere Pflicht ausführen. Dazu reicht aber das Sittengesetz an sich schon aus, ergo: Die Idee des höchsten Guts ist überflüssig. Was Caswell nicht herauszustreichen weiß, ist die Voraussetzung dieser Interpretation, nämlich dass die Geltung des moralischen Gesetzes von der Möglichkeit des höchsten Guts völlig unabhängig ist. Wie sich später zeigen wird, ist diese Voraussetzung nicht legitim. Auf der anderen Seite gibt es die „Revisionisten“. Kant zufolge sind wir zur Realisierung des höchsten Guts in der Welt, d. h. des Endzwecks des moralischen Handelns, auf Hoffnung angewiesen. Die Revisionisten folgern hieraus, dass der Mensch sich der Realisierung des Sittengesetzes nicht ganz zum Verdienst anrechnen darf. Aus dem Sollen folgt nicht notwendig das Können des Menschen. Die Idee des höchsten Guts untergrabe dementsprechend die kantische Autonomiekonzeption oder nötige Kant wenigstens, sein Konzept der Autonomie zu revidieren. Die Revisionisten müssen sich gewissermaßen über die Passagen der Religionsschrift hinwegsetzen, in denen Kant betont, dass die Möglichkeit des höchsten Guts das Moralgesetz nicht bedingt, sondern nur eine notwendige Folge desselben ist. 12 Wie Caswell werde ich aufzuweisen versuchen, dass die Idee des Guten eine Erweiterung der praktischen Vernunft, mithin nicht überflüssig ist, zugleich aber kompatibel ist mit dem Autonomieansatz in der Kritik der praktischen Vernunft und in der Grundlegung. Caswell entwickelt die Idee des höchsten Guts indessen als eine Alternative für die Selbstliebe. Ihm zufolge kann die Stelle der Selbstliebe nach der Umkehr zum Guten nicht leer bleiben, denn weil der Mensch sich nach der kantischen Lehre des radikalen Bösen in der menschlichen Natur (vgl. Kapitel 2) immer schon auf Selbstliebe als Endzweck seines Handelns ausgerichtet habe, würde eine Leerstelle einen Rückfall in die Selbstliebe enthalten. (Cawell 2006, S. 204) Die Idee des höchsten Guts dient folglich der Selbstliebe zum Ersatz. Caswells Argument fußt auf der anthropologischen Beobachtung Kants, dass wir ein natürliches Bedürfnis haben, „zu allem unseren Tun und Lassen im ganzen genommen irgend einen Endzweck […] zu denken“. (RGV, S. VIII) Ich halte dieses Argument für unzureichend. Kant insistiert darauf, dass der Satz „Es ist ein Gott, mithin es ist ein höchstes Gut in der Welt“ ein synthetischer Satz a priori ist. (RGV, S. IX f.) Obzwar die Glückseligkeit nicht schon in der Pflicht enthalten oder mit ihr identisch ist, geht sie doch notwendigerweise aus der Pflicht hervor. Wenn auch das höchste Gut in der Welt eine Erweiterung der praktischen Vernunft ist, so ist sie doch „praktisch notwendig“ und muss die „Deduktion“ dessen Möglichkeit „lediglich auf Erkenntnisgründen a priori beruhen“. (KpV, S. 203) In Hinsicht auf einen Beweis für die Notwendigkeit der Idee des höchsten Guts ist eine anthropologische Beobachtung somit von Anfang an disqualifiziert. Obwohl Kant eine Verbindung zwischen seiner anthropologischen Beobachtung und der Notwendigkeit des höchsten Guts vermuten lässt, wird die Idee des Guten nicht wegen den „unvermeidlichen Einschränkungen des Menschen“ (vgl. RGV, S. XII), sondern wegen dem Sittengesetz selbst eingeführt. Um anzeigen zu können, was bei der Einführung der Idee des höchsten Guts in der Welt auf dem Spiel steht, sei folgendes Zitat angeführt: Ist also das höchste Gut nach praktischen Regeln unmöglich, so muß auch das moralische Gesetz […] an sich falsch sein. (KpV, S. 205) Während die Interpreten, die der Meinung sind, die Idee des höchsten Guts sei überflüssig, unterstellen müssen, dass das Sittengesetz auch ohne das höchste Gut seine Validität behält, macht Kant deutlich, dass die Geltung des Sittengesetzes mit der Möglichkeit des höchsten Guts zusammenfällt. Die Verbindlichkeit des Sittengesetzes 13 konvergiert indessen nicht mit der Möglichkeit des höchsten Guts, sofern letzteres die Möglichkeitsbedingung des ersten wäre, sondern nur weil die Möglichkeit des höchsten Guts eine notwendige Folge des Sittengesetz ist: Vorausgesetzt das Sittengesetz ist gültig, dann ist das höchste Gut in der Welt möglich. Da das Sittengesetz ein „Faktum der Vernunft“, die Bedingung der Möglichkeit des höchsten Guts in der Welt mithin immer schon erfüllt ist, muss das höchste Gut in der Welt notwendigerweise möglich sein; das höchste Gut muss, wie Kant sich ausdrückt, objektiv praktische Realität haben. Wenn wir auch den logischen Zusammenhang zwischen dem moralischen Gesetz und dem höchsten Gut verstehen, so bleibt noch die Frage, was wir uns hierbei vorstellen können. In seiner Religionsschrift gibt Kant uns eine Anzeige. Zwar bedürfen wir zum Rechthandeln keiner Vorstellung eines Zwecks: Aber aus der Moral geht doch ein Zweck hervor; denn es kann der Vernunft doch unmöglich gleichgültig sein, wie die Beantwortung der Frage ausfallen möge: was dann aus diesem unserem Rechthandeln herauskomme […]. (RGV, S. VII) Es scheint zunächst so, dass, wie Kierkegaard sich ausdrückt, Arbeit und Lohn nur in der „Welt des Geistes“ in proportioniertem Verhältnis zueinander stehen, in der „äußeren Welt“ dagegen „auch derjenige, der nicht arbeitet, sein Brot bekommt, derjenige, der schläft, es reichlicher bekommt als derjenige, der arbeitet“. (Kierkegaard 2005, S. 201) Obzwar wir nie mit Sicherheit wissen können, ob derjenige, der gut handelt, in diesem Leben auch glücklich zu werden vermag, muss Kant zufolge unterstellt werden, dass er darauf wenigstens eine größere Chance hat als der Verbrecher. Gott, der die „wohlgemeinten Bemühungen“ des Menschen zu vollenden hat, muss mithin wenigstens so zuverlässig sein, dass er dem moralisch Enthaltsamen oder sogar dem Verbrecher in diesem Leben nicht eher belohnen würde als dem Tugendhaften. Die Idee des höchsten Guts in der Welt stellt sicher, dass das Handeln im Einklang mit dem moralischen Gesetz keine Ergebnisse in der Sinnenwelt hervorbringt, die in Bezug auf den Endzweck des moralischen Handelns indifferent, oder sogar diesem Endzweck entgegengesetzt sind. Die notwendige Verbindung zwischen Pflicht und Glückseligkeit garantiert, dass moralisches Handeln für dieses Leben weder sinnlos noch kontraproduktiv ist. Oder positiv formuliert: Moralisches Handeln ist nur möglich, wenn es auch sinnvoll ist, moralisch zu handeln. Wäre es für dieses Leben nicht sinnvoll, 14 moralisch zu handeln, so wäre das moralische Gesetz „an sich falsch“. Die Idee des höchsten Guts ist folglich weder überflüssig noch nötigt sie uns, das kantische Autonomiekonzept neu zu erwägen; vielmehr ist sie eine unerlässliche Idee, um die Autonomie des Menschen bis zum Ende durchdenken zu können. 15 2 Kant: Die menschliche Freiheit als der Grund des Bösen Nachdem der systematische Kontext der Frage nach dem Bösen aufgeklärt worden ist, kann die Frage nach dem Grund des Bösen gestellt werden. Kant weist zuerst einen universell menschlichen Hang zum Bösen als Grund des Bösen in der Welt an. Es gilt zu erleuchten, was Kant unter einem Hang zum Bösen versteht. (§ 2.1) Ist es legitim, über einen universell menschlichen Hang zum Bösen zu reden? Warum hat der Mensch nicht einen Hang zum Guten? (§ 2.2) Wenn das Böse moralisch gedeutet werden soll, muss der Hang zum Bösen noch auf eine Freiheitstat zurückgeführt werden können. Diese Tat muss als letzten Grund des Bösen angewiesen werden. (§ 2.3) 2.1 Der Hang zum Bösen Es mag verwunderlich erscheinen, dass Kant ein Buch, das von der Realisierung der Freiheit handelt, mit einer Abhandlung über das anfängt, was er „das radikale Böse in der menschlichen Natur“ nennt. Welche Notwendigkeit gibt es, hier auf das Böse einzugehen? Das Böse hat ein Erklärungspotential. Aufgrund unserer Freiheit haben wir die Aussicht auf die Realisierung des höchsten Guts in der Welt. Die Idee des höchsten Guts ist, wie oben schon erwähnt worden ist, die Vorstellung eines Zustandes, in dem jeder sowohl vollkommen sittlich als auch komplett glückselig ist. Das radikale Böse in der menschlichen Natur vermag nun zu erklären, warum das höchste Gut, obzwar es notwendig und im Prinzip möglich ist, de facto noch nicht verwirklicht worden ist. Die Zuschreibung des Bösen am Menschen soll indessen nicht ohne Weiteres als eine Erniedrigung des Menschen interpretiert werden. Die Verwirklichung des höchsten Guts in der Welt darf man Kant zufolge mit der Gründung des Reichs Gottes auf Erden gleichsetzen. Da es dem Menschen zur Pflicht gestellt ist, das Kommen dieses Reichs zu befördern, muss er dazu auch imstande sein. Wenn auch das Böse uns zunächst nur den Blick zum verzehrenden Feuer der Hölle zu eröffnen scheint, so offenbart es uns zugleich die Größe des Projekts, dessen Realisierung dem Menschen abverlangt wird. Das radikale Böse in der menschlichen Natur zeigt dann nicht primär die Verdorbenheit des Menschen, sondern vielmehr die Größe des Maßstabes, an dem er gemessen wird. Von dem Menschen wird nämlich gefordert, sich für die Verwirklichung des höchsten Guts in der Welt bzw. die Gründung des Reichs Gottes auf Erden verdienstlich zu machen. Dass dem Menschen das Böse zugeschrieben wird, offenbart mithin nicht seine 16 Nichtigkeit, sondern vielmehr seine Größe. Die Bosheit des Menschen wird damit gleichwohl nicht unschädlich gemacht, denn sie bleibt wesentlich ambivalent; sie birgt einerseits die Versprechung in sich, dass der Mensch sich für die Gründung des Reichs Gottes auf Erden verdienstlich machen kann, anderseits die Möglichkeit, dass der Mensch nicht nur bei dieser Forderung in Verzug bleibt, sondern sich vielmehr zum großen Widersacher des Guten machen kann. Das radikale Böse in der menschlichen Natur weist darauf hin, dass der Mensch, um mit Schelling und von Baader zu sprechen, nur unter oder über dem Tier stehen kann. Kant zufolge ist ein „Hang zum Bösen“ in der menschlichen Natur verwurzelt. Unter einem Hang versteht Kant „den subjektiven Grund der Möglichkeit einer Neigung“. (RGV, S. 20) Unter einer Neigung versteht Kant wiederum eine „habituelle Begierde“. (Ebd.) Der Hang zum Bösen des Menschen besagt somit weder, dass seine Handlungen immer böse seien, noch dass er eine Neigung oder habituelle Begierde zum Bösen habe, sondern nur, dass er für eine Neigung zu bösen Handlungen zugänglich ist. Der Hang zum Bösen zeigt sich beim Menschen vor allem daran, dass er bei sich selbst eine Verführung des Bösen spüren kann. Dies kann anhand eines nicht-moralischen Beispiels erläutert werden. Ich trinke etwa ein- oder zweimal die Woche ein Bier. Ich habe somit keine Neigung oder habituelle Begierde, Bier zu trinken. An den meisten Tagen, vor allem am day after, habe ich überhaupt keine Lust auf Bier. Nun, ich trinke Bier, weil ich es lecker finde und es sozial ist; man philosophiert jedoch, wie Aristoteles zu verstehen gegeben hat, um des Philosophierens selbst willen. Wenn ich am nächsten Tag meine Magisterarbeit schreiben, d. h. philosophieren muss, scheint es mir darum besser, kein Bier zu trinken. Das Bierchen, das mir auf der Feier angeboten wird, ist gleichwohl sehr verführerisch. Diese Verführung offenbart mir, dass ich zwar keine habituelle Neigung zum Biertrinken habe, wohl aber für diese Neigung zugänglich bin: Ich habe einen Hang zum Biertrinken. Mein Hang zum Biertrinken schließt jedoch nicht aus, dass ich aus Pflicht das Bierchen stehen lasse. Wenn wir dies auf eine moralische Ebene hinüberführen, kann gefolgert werden, dass der Hang zum Bösen mit dem Handeln aus Pflicht, d. h. mit dem moralischen Handeln, kompatibel ist: Der Hang zum Bösen kann „mit einem in allgemeinen guten Willen zusammenbestehen“. (RGV, S. 36) Die Behauptung, dass der Mensch mit einem Hang zum Bösen behaftet ist, impliziert folglich nicht, dass seinen Handlungen höchstens Legalität zukomme; vielmehr kann ihnen auch Moralität zugeschrieben werden. Der menschliche Hang zum Bösen drückt nicht aus, dass der 17 Mensch notwendig nach bösen Maximen handelt, sondern nur, dass das Handeln nach bösen Maximen ihm möglich ist: Der Hang zum Bösen besteht in „dem subjektiven Grunde der Möglichkeit der Abweichung der Maximen vom moralischen Gesetze“. (RGV, S. 21) 2.2 Der Beweis des Hanges zum Bösen Die große Frage ist nun, warum der Mensch einen Hang zum Bösen, nicht aber einen Hang zum Guten hat. Wie rechtfertigt Kant seine Lehre vom radikalen Bösen in der menschlichen Natur? In der Sekundärliteratur stellt sich diese Frage folgendermaßen: Kann der Hang zum Bösen a priori aus dem moralischen Gesetz deduziert werden oder brauchen wir empirisches Material, um die Existenz des Hanges beweisen zu können? Ich werde nun versuchen zu zeigen, dass der universelle Hang zum Bösen weder eine empirische Verallgemeinerung ist, noch rein formal aus dem moralischen Gesetz abgeleitet werden kann. Oder positiv formuliert: Ich werde vorweisen, dass der Beweis des menschlichen Hanges zum Bösen auf einer systematischen Rekonstruktion beruht. Nach meiner Interpretation braucht Kant einen minimalen Verweis auf die Empirie, aufgrund dessen er dann a priori auf den Hang zum Bösen schließen kann. In seiner Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft sagt Kant Folgendes über den Beweisgang: Daß nun ein solcher verderbter Hang im Menschen gewurzelt sein müsse, darüber können wir uns, bei der Menge schreiender Beispiele, welche uns die Erfahrung an den Taten der Menschen vor Augen stellt, den förmlichen Beweis ersparen. (RGV, S. 27 f.) Allison (1990, 2002) weist darauf hin, dass Kant, obzwar er in seiner Religionsschrift den formalen Beweis nicht liefert, die Möglichkeit eines solchen Beweises nicht verkennt. Die Bemerkung Kants veranlasst Allison zu untersuchen, ob der Hang zum Bösen a priori aus dem Pflichtcharakter des Sittengesetzes deduziert werden kann. Er beantwortet diese Frage positiv. Allisons Argument fußt auf Kants „Rigorismus“. Der enthält, dass die Gesinnung des Menschen entweder gut oder böse sein muss. Der Rigorismus folgt aus Kants Annahme, dass unter den verschiedenen Triebfedern einzig das moralische Gesetz an sich zur Bestimmung der Willkür ausreicht. Wenn das moralische Gesetz ein Faktum der Vernunft, zugleich aber für sich schon ausreichend 18 zur Bestimmung der Willkür ist, so ist der Mangel der Übereinstimmung mit dem moralischen Gesetz im Handeln nur als Folge einer dem Sittengesetz widerstrebenden Gesinnung möglich. (Vgl. RGV, S. 9 f.) Der Rigorismus ermöglicht Allison, den Hang zum Bösen mittels der Elimination der gegensätzlichen Möglichkeit, nämlich die eines „Hanges zum Guten“, beweisen zu können. Allison ist der Meinung, dass die Möglichkeit eines „Hanges zum Guten“ tatsächlich eliminiert werden kann: Einem gut gesinnten Subjekt würde das Sittengesetz nicht als Imperativ und die Forderungen dessen nicht als Pflicht vorkommen. (Allison 1990, S. 154 ff.; 2002, S. 342) Da der Hang entweder gut oder böse sein muss, die Möglichkeit eines „Hanges zum Guten“ sich aber nicht mit dem Pflichtcharakter des Sittengesetzes verträgt, könne die Notwendigkeit eines Hangs zum Bösen a priori aus dem Sittengesetz deduziert werden. Ich habe zwei Bedenken gegen Allisons Interpretation. Erstens, die Möglichkeit eines „Hanges zum Guten“ ist nicht nur kompatibel mit dem Pflichtcharakter des Sittengesetzes, sondern fördert diesen sogar. Das Sittengesetz reicht nämlich nur darum als Bestimmungsgrund des Willens hin, weil es dem Menschen als Imperativ gestellt ist. Hätte das moralische Gesetz nicht den Charakter der Pflicht, wäre es eine Triebfeder unter vielen. Ein gut gesinnter Mensch, der sich zum moralischen Gesetz wie zu einer Triebfeder unter vielen verhalten würde, würde nur zufällig und demzufolge gar nicht moralisch handeln. Die Möglichkeit eines „Hanges zum Guten“ kann mithin nicht hinsichtlich des Pflichtcharakters des moralischen Gesetzes eliminiert werden.4 Es gibt aber noch ein wichtiges Argument, warum die Möglichkeit eines „Hanges zum Guten“ nicht ausgeschlossen werden kann. Die Elimination der Möglichkeit eines „Hanges zum Guten“ würde nämlich die „Revolution der Gesinnung“ (vgl. § 4.4), d. h. die Umkehr vom Bösen zum Guten, unmöglich machen. Kant macht deutlich, dass gerade die Möglichkeit einer Revolution der Gesinnung, d. h. die Umkehr vom Hang zum Bösen zum „Hang zum Guten“, gemäß der Formel des „du kannst, denn du sollst“ a priori aus dem Sittengesetz deduziert werden kann; der Pflichtcharakter des Sittengesetzes („du sollst“) schreibt gerade die Möglichkeit einer guten Gesinnung bzw. eines „Hanges zum Guten“ vor. Die Existenz eines Hanges zum Bösen kann 4 Allison rechtfertigt die Elimination eines Hanges zum Guten auch aufgrund der Beobachtung, dass ein Subjekt mit einem Hang zum Guten für Verführung nicht zugänglich wäre. (Allison 1990 S. 155, 2002 S. 342) Das ist zwar richtig, aber um wissen zu können, dass es für den Menschen jederzeit die Möglichkeit der Verführung gibt, braucht man jedoch einen Verweis auf die moralische Erfahrung. Die prinzipielle Möglichkeit der Verführung kann jedenfalls nicht a priori aus dem Sittengesetz abgeleitet werden. 19 infolgedessen nicht durch Ausscheidung der gegenteiligen Möglichkeit bewiesen und mithin nicht a priori aus dem moralischen Gesetz abgeleitet werden. Kant betont in seiner Religionsschrift mehrere Male, dass er die Empirie braucht, um den menschlichen Hang zum Bösen beweisen zu können. (Vgl. RGV, S. 6, 15, 27, 32) Dass der Beweis des Hanges zum Bösen nicht a priori geliefert werden kann und empirisches Material erfordert, bedeutet jedoch nicht, dass das Böse zu einem empirisch-anthropologischen Problem herabgesetzt wird. Ich werde im Folgenden versuchen zu zeigen, dass Kant einen minimalen Verweis auf die Erfahrung braucht, auf Basis dessen er die Notwendigkeit eines Hanges zum Bösen formal ableiten kann. Präziser gesagt: Ich werde versuchen aufzuweisen, dass wir eine einzige böse Handlung brauchen, um auf einen universellen Hang zum Bösen schließen zu können. Das Problem, mit dem der Versuch zu einem empirischen Beweis der Notwendigkeit eines Hanges zum Bösen sofort konfrontiert wird, ist folgendermaßen: Während wir, um die Notwendigkeit eines Hanges zum Bösen beweisen zu können, nachweisen sollen, dass nicht nur die Handlungen, sondern vielmehr die moralische Gesinnung des Menschen böse ist, lässt die moralische Gesinnung sich nicht zum Gegenstand der Erfahrung machen. Die moralische Gesinnung ist der dem Subjekt zurechenbare, allgemeine Grund zur Annahme aller besonderen Maximen. Eine Maxime ist wiederum eine Regel, nach der das Subjekt handeln will. Die moralische Gesinnung kann folglich mit dem moralischen Charakter, d. h. mit dem, was sich im zeitlichen Nacheinander der Handlungen durchhält und sich als solche gleichsam in dieses reflektiert, gleichgesetzt werden. Durch Erfahrung kann man nun feststellen, ob eine Handlung dem Gesetz angemessen oder unangemessen ist. Die Erfahrung an sich gibt jedoch keinen Aufschluss über die Maxime, auf deren Basis der Handelnde gehandelt hat: Durch Erfahrung können wir uns vergewissern, dass die Person so oder so gehandelt hat, gleichwohl nicht warum er so oder so gehandelt hat. Wenn die Maximen nicht zum Gegenstand der Erfahrung gemacht werden können, so noch weniger deren allgemeiner, subjektiver Grund, d. h. die moralische Gesinnung. Die Beschaffenheit der moralischen Gesinnung ist selber nicht Inhalt der Erfahrung. (Vgl. RGV, S. 5 f.) Es kann somit keinen rein empirischen Beweis der Notwendigkeit des Hanges zum Bösen geben. Neben einer „empirischen Beurteilung“ ist aber auch eine „intellektuelle Beurteilung“ der Handlung möglich. (Vgl. RGV, S. 40) Zwischen diesen zwei Beurteilungstypen gibt es einen qualitativen Unterschied. Während man gemäß der 20 empirischen Beurteilung nur feststellen kann, ob eine Handlung mit dem Gesetz in Übereinstimmung oder dagegen gesetzwidrig ist, so kann man erst gemäß der intellektuellen Beurteilung eine Aussage über moralisch gut und böse machen. Es ist die fundamentale Voraussetzung der menschlichen Freiheit und Zurechnungsfähigkeit – Allison nennt sie Kants „Inkorporationsthese“ –, die uns auf die Ebene der intellektuellen Beurteilung hinüberführt. Wie sich zeigen wird, kann dieser Übergang zur intellektuellen Beurteilung nur im Falle von gesetzwidrigen Handlungen ein eindeutiges Ergebnis haben. Da die Notwendigkeit eines Hanges zum Bösen nicht auf einem rein empirischen Beweis fußen kann, gilt es, mittels der Voraussetzung der unumgänglichen Verantwortlichkeit des Menschen, den Sprung von der Gegebenheit der Handlung in die formale Analyse zu machen. Im Falle einer aus Freiheit begangenen bösen Handlung gibt es Kant zufolge die Möglichkeit, die Beschaffenheit der moralischen Gesinnung aus der Erfahrung abzuleiten: Also müßte sich aus einigen, ja aus einer einzigen mit Bewußtsein bösen Handlung, a priori auf eine böse zum Grunde liegende Maxime, und aus dieser auf einen in dem Subjekt allgemein liegenden Grund aller besonderen moralisch-bösen Maximen, der selbst wiederum Maxime ist, schließen lassen […]. (RGV, S. 6) Diese Passage ist meines Erachtens der Schlüssel zur Beantwortung der Frage, wie die Notwendigkeit eines Hanges zum Bösen bewiesen werden kann. Die Passage kann indessen nur angemessen verstanden werden, wenn in Rechnung gezogen wird, dass es, wie noch zu zeigen ist, eine fundamentale Asymmetrie in der Ableitung der Beschaffenheit der Gesinnung gibt: Während die Notwendigkeit einer bösen Gesinnung aus der Gegebenheit einer aus Freiheit begangenen gesetzwidrigen Handlung abgeleitet werden kann, ist die Gegebenheit einer bewusst guten Handlung nicht zureichend, um die Notwendigkeit einer guten Gesinnung beweisen zu können. Diese Asymmetrie gründet, wie im Folgenden gezeigt werden soll, in der fundamentalen Ungleichwertigkeit der Triebfeder. Im Gegensatz zu Allison versucht Wood aufzuweisen, dass der Hang zum Bösen nicht a priori, sondern nur aufgrund der Erfahrung bewiesen werden kann. (Wood 1970, S. 219 ff.) Er kommentiert die von Kant quotierte Passage folgendermaßen: 21 Now from this passage, and other like it, we might be tempted to think that Kant means to infer that because a person sometimes knowingly commits evil actions, the highest maxim of such a person is necessary evil, and therefore the person himself is essentially evil. But surely this cannot be what Kant means. For in this case it would also seem proper to infer that because a person had in some case performed a morally good action, his highest maxim must be morally good; but in this case, it would be proper to infer that because a person performs both good actions and evil actions […] the highest maxim of such a person is good and evil, which is a contradiction. (Ebd. S. 222) Ich bin mit Wood einverstanden, dass nicht die höchste Maxime, sondern vielmehr der subjektive Grund zur Annahme aller besonderen Maximen böse genannt werden soll. (Vgl. ebd. S. 223) Es heißt im Zitat zwar, dass dieser Grund „selbst wiederum Maxime ist“, aber dies bedeutet so viel wie: Der Mensch kann für diese Disposition zur Rechenschaft gezogen werden, und nicht: Diese Disposition ist keine Disposition, sondern eine Maxime. Wichtiger aber ist, dass Wood eine Unempfindlichkeit für die oben erwähnte Asymmetrie in der Ableitung der Gesinnung erkennen lässt. Für Wood könnte auch die Notwendigkeit einer bösen Gesinnung nicht mit der von Kant vorgeschlagenen Methode bewiesen werden, denn wäre das möglich, könnten wir ebenso gut die gegensätzliche Möglichkeit – die Notwendigkeit einer guten Gesinnung – beweisen. Das ist aber im Streit mit dem kantischen Rigorismus. Wood schiebt darum die quotierte Passage zur Seite und optiert für eine Interpretation, die er später als „naiv“ bezeichnen wird (vgl. Wood 1999, S. 287): Kants Lehre vom radikalen Bösen in der menschlichen Natur sei eine empirische Verallgemeinerung. Warum er diese Interpretation später naiv nennt, mag deutlich sein, denn eine empirische Induktion vermag ja höchstens zu beweisen, dass das Böse weitverbreitet ist, nicht aber die Notwendigkeit eines universellen Hanges zum Bösen. (Vgl. Allison 1990, S. 154) Woods Versuch wird also entweder der kantischen Philosophie nicht gerecht – denn der Hang zum Bösen ist laut Kant universell-menschlich – oder er stößt auf das klassische Induktionsproblem. Wir sollen jetzt zum Zitat Kants zurückkehren. Wood kann sich über den von Kant vorgeschlagenen Beweisgang hinwegsetzen, indem er unterstellt, dass die Notwendigkeit einer guten Gesinnung aus der Gegebenheit einer guten Handlung abgeleitet werden könne. Das ist jedoch nicht der Fall. Erstens, streng genommen können wir aufgrund der Erfahrung nur feststellen, dass die gegebene Handlung dem Gesetz entsprechend ist. Feststellen, dass sie die Handlung aus Pflicht geschieht, d. h. moralisch gut ist, können wir nicht, denn sie könnte ebenso gut nur zufälligerweise dem 22 Gesetz gemäß sein. Wenn wir aber eine gute Handlung als gegeben unterstellen, so ist es, zweitens, immer noch nicht gerechtfertigt, aus der gegebenen guten Handlung auf die Notwendigkeit einer guten Gesinnung zu schließen. Das ergibt sich aus folgender Überlegung: Eine gute Gesinnung wäre eine Prädisposition zur Achtung des Sittengesetzes. Da das moralische Gesetz, das als „Faktum der Vernunft“ unumgänglich ist, als einzige unter der Triebfeder zur Bestimmung der Willkür hinreicht, zugleich aber in der guten Gesinnung keine sich widerstrebende, sondern sogar eine sich befördernde Prädisposition hat, würde ein gut gesinnter Mensch lauter gute Handlungen hervorbringen. Wenn man somit die Notwendigkeit einer guten Gesinnung beweisen möchte, so reicht eine einzelne gute Handlung, sogar eine Menge guter Handlungen, nicht aus, denn dazu ist erforderlich, dass alle Handlungen dieses Menschen gut sind. Das Argument, mit dem Wood den von Kant vorgeschlagenen Beweisgang zur Seite schiebt, ist somit nicht gültig. Wir dürfen nicht, wie Wood, über das angeführte Zitat hinwegsehen. Wenn man aber die Notwendigkeit einer guten Gesinnung nicht aus einer einzelnen guten Handlung ableiten kann, warum sei die Notwendigkeit einer bösen Gesinnung wohl aus einer bösen Handlung abzuleiten? Während man aus einer dem Gesetz entsprechende Handlung nicht ableiten kann, ob ihr eine gute Maxime zugrunde liegt und sie mithin moralisch gut ist, muss die gesetzwidrige Handlung, wenn wir wenigstens den Handelnden dafür zur Verantwortung ziehen, notwendigerweise auf einer moralisch bösen Maxime beruhen. (Vgl. RGV, S. 11 f., 48) Die Plausibilität dieser „Inkorporationsthese“ ergibt sich aus folgender Erwägung: Eine gute Maxime ist nur mit Handlungen kompatibel, die dem Gesetz angemessen sind. Derjenige, der sich auf der Schwachheit seines Willens beruft – „Ich will, aber kann es nicht!“ –, um die moralische Verantwortung für eine gesetzwidrige Handlung aus dem Wege zu gehen und sich von seiner Gutheit zu vergewissern, täuscht sich selbst, denn wenn er ein freier Mensch ist, müssen wir vielmehr unterstellen, dass seine Handlung einer bösen Maxime entspringt. Aus einer bösen Maxime können sich dagegen sowohl Handlungen, die (zufälligerweise) dem Gesetz gemäß sind, als auch gesetzwidrige Handlungen entwickeln. Eine gesetzwidrige Handlung verträgt sich also nur mit einer bösen, nicht aber mit einer guten ihr zugrunde liegenden Maxime. Während aus der dem Gesetz konforme Handlung nicht eindeutig auf eine ihr zugrunde liegende, gute Maxime geschlossen werden kann – denn sie ist auch mit einer bösen Maxime kompatibel –, so kann andererseits, unter Voraussetzung der Zurechnungsfähigkeit des Menschen, aus 23 einer einzelnen gesetzwidrigen Handlung a priori auf eine böse, ihr zugrunde liegende Maxime geschlossen werden. Wie können wir aber aus einer einzigen bösen Maxime die Notwendigkeit einer bösen Gesinnung bzw. eines bösen subjektiven Grundes zur Annahme aller Maximen ableiten? Wie kann aus der Gegebenheit einer bösen Handlung die Notwendigkeit eines Hanges zum Bösen folgen? Wie schon gezeigt worden ist, würden die Handlungen eines gut gesinnten Menschen alle insgesamt gut sein. Eine Böse Gesinnung ist gleichwohl kompatibel mit sowohl bösen als auch guten Handlungen: Das moralische Gesetz, das zur Bestimmung der Willkür nichts außer sich bedarf, hat in der bösen Gesinnung ein sich widerstrebendes Prinzip, so dass das moralische Handeln, je nachdem, ob der dem Subjekt imputierbare Hang zum Bösen oder die praktische Vernunft überwiegt, böse oder gut ausfallen kann. Da eine gute Gesinnung überhaupt keine bösen Handlungen, eine böse Gesinnung sowohl böse als gute Handlungen zulässt, die Gesinnung aber hinsichtlich des Rigorismus entweder gut oder böse sein muss, reicht die Gegebenheit einer bösen Handlung aus, um die Notwendigkeit eines Hanges zum Bösen zu konkludieren. Bis jetzt konnte gezeigt werden, dass die Gegebenheit einer gesetzwidrigen Handlung eines verantwortlichen Menschen uns dazu berechtigt, ihm einen Hang zum Bösen zuzuschreiben. Wie kann Kant aber behaupten, dass es einen universellmenschlichen Hang zum Bösen gibt? Zeigt die Erfahrung nicht vielmehr, dass manche gut, manche böse sind? Das Argument, dass uns die Begründung dieser kontraintuitiven Behauptung liefert, ist nur zu verstehen, wenn man darauf achtet, welche Frage sich Kant stellt. Er fragt sich primär, ob der Mensch gut oder böse sei. Wie gesagt, die Erfahrung lehrt uns, dass vielmehr manche gut, manche böse sind. Wir müssen gleichwohl einen Unterschied zwischen „empirischem“ und „intelligiblem“ Charakter (RGV, S. 35), zwischen „virtus phenomenom“ und „virtus noumenon“ (RGV, S. XXV f.) machen. Der empirische Charakter ist „die Fertigkeit in pflichtmäßigen Handlungen (ihrer Legalität nach)“, der intelligible aber „die standhafte Gesinnung solcher Handlungen aus Pflicht (ihrer Moralität wegen). (RGV, S. XXV) Warum nennen wir manche Menschen gut und manche Menschen böse? Weil wir von den guten lauter pflichtgemäße, oder jedenfalls keine gesetzwidrigen Handlungen, und von den bösen freilich eine Menge gesetzwidrige Handlungen wahrgenommen haben. Wenn wir manche gut nennen, so nennen wir sie gut qua empirischen Charakter. Das berechtigt 24 uns, wie schon nachgewiesen worden ist, jedoch nicht, zu folgern, dass ihr intelligibler Charakter gut sei. Ein faktisch gegebener Zustand, in dem manche Menschen gut und manche böse sind, ist nur mit der Behauptung, der Mensch ist böse, in Übereinstimmung zu bringen. Wäre nämlich der intelligible Charakter des Menschen gut, so müssten alle menschlichen Handlungen dem Gesetz entsprechend, mithin alle Menschen qua empirischen Charakter gut sein. Das ist jedoch nicht der Fall. Nennen wir den Menschen qua intelligiblen Charakter böse, so können menschliche Handlungen sowohl gute als auch böse, der empirische Charakter mancher Menschen gut und mancher Menschen böse sein. Da wir uns durch Erfahrung davon vergewissern können, dass es qua empirischen Charakter sowohl gute als auch böse Menschen gibt, müssen wir den Schluss ziehen, dass der Mensch qua intelligiblen Charakter böse ist. Wenn der Mensch qua intelligiblen Charakter böse ist, ist der Hang zum Bösen universell menschlich. Man könnte gleichwohl einen Einwand gegen diese Argumentation vorbringen und sich demzufolge fragen, ob das Konzept „der Mensch“ nicht unsinnig ist. Können freie, individuell verantwortliche Personen so einfach auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden? Ist die Frage, ob der Mensch gut oder böse sei, nicht eine PseudoFrage? Aus theoretischer Sicht sind diese Bedenken völlig berechtigt. Die Frage, ob der Mensch gut oder böse sei, und ihre Antwort kommen jedoch einem praktischen Interesse entgegen. Die „Lehre“ vom radikalen Bösen in der menschlichen Natur hat eine kritische Funktion, indem es ein kritisches Gegengewicht zur Gefahr menschlichen Selbstbetrugs bildet; ohne sie könnte dieser Selbstbetrug nicht als Selbstbetrug entlarvt werden. Der Selbstbetrug ist ein Zustand, in dem der Mensch meint, sich von seiner eigenen moralischen Vollkommenheit versichern zu können, nur darum, weil er unter seinen Handlungen keine Verstöße gegen das Gesetz antrifft – Verstöße, die er andere fortdauernd begehen sieht. (Vgl. RGV, S. 37 f.) Der Mensch betrügt sich wegen seiner Gesinnung, indem er sich einen guten Menschen wähnt, weil er nichts falsch gemacht hat. Der Selbstbetrug äußert sich in der Gewissensruhe derjenigen, die das Gesetz zwar nie verletzen, zugleich aber nicht aus Pflicht oder der Moralität wegen handeln. Sie vergessen jedoch, dass sie ganz zufällig und dementsprechend gar nicht moralisch gehandelt haben: Wären sie nur in heikle Umstände geraten, hätten sie ebenso gut gegen das Gesetz verstoßen können. 25 Aufgrund des Selbstbetrugs des Menschen droht die Moralität zur Legalität herabgesetzt zu werden. Wenn die Frage, ob der Mensch gut oder böse sei, unbeantwortet bleibt, gäbe es keinen kritischen Ansatzpunkt, um den Selbstbetrug als Selbstbetrug aufdecken zu können. Bliebe nämlich die Beschaffenheit der menschlichen Gesinnung in Schwebe, hätte man nichts in den Händen, mit dem man die in ihren Augen gewissenhaften Menschen, die sich auf Basis der Legalität ihrer Handlungen für die Gutheit selbst halten, erwidern könnte. Kants Lehre vom radikalen Bösen in der menschlichen Natur tritt so dem Prozess einer „Legalisierung der Moral“ entgegen, oder paradoxal formuliert: Das radikale Böse eröffnet dem sich betrügenden Menschen den Weg zum Guten. Das Böse ist folglich nicht nur ein Begründungsproblem der Autonomiephilosophie, sondern auch eine ihrer unerlässlichen Voraussetzungen. Ob das praktisch-kritische Potenzial der kantischen Lehre des radikalen Bösen in der menschlichen Natur die oben erwähnten theoretischen Beschwerden zu suspendieren vermag, darf jeder für sich entscheiden. Die Irritation, welche Kants Behauptung, dass der Mensch böse sei, bei uns erweckt – nein, ich werde für mich sprechen: Die Irritation, die sie bei mir erweckt, gründet vielleicht nicht allein in theoretischen Beschwerden, sondern vielmehr in Selbstbetrug. 2.3 Die intelligible Tat Der Mensch ist von Natur böse. Ich habe diese Redewendung Kants bisher auf unproblematischer Weise benutzt. Wir müssen jedoch die Frage stellen, wie das Böse in der menschlichen Natur verwurzelt sein kann. Macht das nicht gerade die menschliche Verantwortung für das Böse unmöglich? Wir dürfen hier den Begriff Natur nicht im Sinne der physischen Natur auffassen. Unter der Natur des Menschen wird in diesem Kontext „nur der subjektive Grund des Gebrauchs der Freiheit überhaupt (unter objektiven moralischen Gesetzen)“ verstanden, „der vor aller in die Sinne fallenden Tat vorhergeht“. (RGV, S. 6) Der subjektive Grund ist in der Tiefenstruktur des zeitlichen moralischen Handelns enthalten. Weil die Handlungsfreiheit von Kant als Autonomie konzipiert wird und dadurch immer unter der Bedingung des moralischen Gesetzes steht, müssen böse Handlungen, wie im vorigen Paragrafen nachgewiesen worden ist, auf den Verderb des subjektiven Grundes – oder der menschlichen „Natur“ – zurückgeführt werden. Da der Mensch sowohl für gute als auch für böse Handlungen verantwortlich gemacht werden muss, böse 26 Handlungen aber auf dem Verderb des subjektiven Grundes beruhen, muss der subjektive Grund „immer wiederum selbst ein Aktus der Freiheit sein“. (RGV, S. 6) Kant nennt diesen Aktus der Freiheit eine „intelligible Tat“. (RGV, S. 26) Die intelligible Tat geht, da sie der Handlungsfreiheit zugrunde liegen muss, den empirisch wahrnehmbaren und in der Zeit vollzogenen Handlungen voran und ist als solche „bloß durch Vernunft ohne alle Zeitbedingungen erkennbar“. (RGV, S. 26) Kant weiß mittels einer Reflexion auf konkrete böse Handlungen eine freie Tat zu rekonstruieren, die der Handlungsfreiheit zugrunde liegen muss. Stärker noch: Es ist gerade und nur die Reflexion auf das Böse, die es Kant ermöglicht, diese Freiheit bloßzulegen. Der Mensch kann nur dann für böse Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden, wenn er für seine moralische Gesinnung bzw. seinen moralischen Charakter verantwortlich gemacht wird: Um den Menschen für das, was er tut, zur Verantwortung ziehen zu können, muss er verantwortlich gemacht werden für das, was er ist. Auf Basis von konkreten moralischen Urteilen kann eine Freiheit als Selbstbestimmung rekonstruiert werden: Was der Mensch im moralischen Sinne ist, oder werden soll, gut oder böse, dazu muss er sich selbst machen, oder gemacht haben. (RGV, 48) Ich möchte zunächst anhand eines Beispiels zeigen, warum der subjektive Grund selbst wieder ein Aktus der Freiheit sein muss: Jemand führt eine moralisch verwerfliche Handlung aus. Wenn wir versuchen zu erklären, wie die Handlung zustande gekommen ist, kann dies auf zwei verschiedene Weisen geschehen. Wir können entweder nach dem „Zeitursprung“ oder nach dem „Vernunftursprung“ der Handlung suchen. (RGV, S. 40) Suchen nach dem Zeitursprung der Handlung bedeutet zu versuchen, die Handlung aus den vorhergehenden Zuständen abzuleiten. Wenn aber die Handlung aus den vorhergehenden Zuständen abgeleitet wird, ist die Handlung Resultat eines Geschehens in der Zeit, d. h., sie ist keine freie Handlung und somit überhaupt keine Handlung, sondern ein Naturvorgang. „Von den freien Handlungen, als solchen, den Zeitursprung (gleich als von Naturwirkungen) zu suchen, ist also ein Widerspruch.“ (RGV, S. 40) Suchen nach dem Zeitursprung der Handlung bedeutet nach Ausreden zu suchen und das bedeutet wiederum nichts anderes, als zu versuchen, der Verantwortung für das Handeln aus dem Weg zu gehen. Nur wenn, in Abstraktion aller Geschehnisse in der Zeit, nach dem Vernunftursprung der Handlung gesucht wird, nur wenn die Handlung 27 als das Resultat eines freien Entschlusses betrachtet wird, kann eine Person für ihre Tat verantwortlich gemacht werden. Es ist oft derjenige, der moralisch verwerflich gehandelt hat, der, um seine Tat zu entschuldigen, nach dem Zeitursprung der Handlung sucht. Er kann dies auf zwei verschiedene Weisen tun. Erstens kann er sagen: „Die Umstände waren so, dass ich nicht anders handeln konnte.“ Zweitens kann er sagen: „So bin ich nun einmal, ich konnte nicht anders handeln.“ Es ist hier vor allem die zweite Art von Ausrede, die uns interessiert. Hier versucht die Person nämlich, der Verantwortung für die moralisch verwerfliche Handlung aus dem Weg zu gehen, indem er auf seinen Charakter verweist. Dadurch, dass er den subjektiven Grund des Gebrauchs der Freiheit in eine Gegebenheit uminterpretiert, wird es ihm möglich, die Unmöglichkeit des freien Handelns zu behaupten. Die Handlungsfreiheit kann also nur gesichert werden, wenn der subjektive Grund, der die Handlungsfreiheit erst möglich macht, keine Gegebenheit, sondern Resultat einer intelligiblen Tat sei. Kant würde darum die Ausreden anhören und erwidern: „Mag sein, aber dennoch bist du verantwortlich.“ Dies macht er in Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft auf wunderschöne Weise deutlich: Eine jede böse Handlung muß, wenn man den Vernunftursprung derselben sucht, so betrachtet werden, als ob der Mensch unmittelbar aus dem Stande der Unschuld in sie geraten wäre. Denn: wie auch sein voriges Verhalten gewesen sein mag, und welcherlei auch die auf ihn einfließenden Naturursachen sein mögen, imgleichen ob sie in oder außer ihm anzutreffen seien, so ist seine Handlung doch frei, und durch keine dieser Ursachen bestimmt, kann also und muß immer als ein ursprünglicher Gebrauch seiner Willkür beurteilt werden. Er sollte sie unterlassen haben, in welchen Zeitumständen und Verbindungen er auch immer gewesen sein mag; denn durch keine Ursache in der Welt kann er aufhören, ein frei handelndes Wesen zu sein. (RGV, S. 42) 28 3 Freiheit und System Was bedeutet die Anerkennung des Bösen für die „Systemphilosophie“ des Deutschen Idealismus? Die Bedeutung des Systems im Deutschen Idealismus kann im Ausgang der kantischen Philosophie erläutert werden. (§ 3.1) Danach gilt es, den Systemansatz der Freiheitsschrift von den anderen Systemansätzen des Deutschen Idealismus zu unterscheiden. (§ 3.2) 3.1 „Als ob“ und System Schelling wird im Allgemeinen zum Deutschen Idealismus gerechnet. „System“ ist eines der wichtigsten Stichwörter – wenn nicht das wichtigste –, mit dem man die Philosophie des Deutschen Idealismus bezeichnen kann. Das Wort „System“ wird bei jedem modernen Leser Argwohn erregen oder ihm sogar Abscheu einflößen, denn das System markiert zugleich den Punkt, an dem Philosophen wie Kierkegaard, Schopenhauer und Nietzsche ihre vehemente Kritik an die Adresse des Deutschen Idealismus angesetzt haben. Die Kritik könnte folgendermaßen zusammengefasst werden: Der Systemansatz des Deutschen Idealismus sei Ausschließung der Existenz, d. h. Formalismus, Leugnung des Anderen, d. h. Absolutismus, Ausscheidung des Neuen, d. h. Konservatismus und zuletzt auch Beseitigung der menschlichen Freiheit, d. h. Fatalismus. Kurz: Es ist euphemistisch zu sagen, es sei keine leichte Aufgabe, heutzutage das System zu verteidigen. Die Kritik des Systems geht jedoch einher mit dem Unvermögen, den Systembegriff des Deutschen Idealismus angemessen verstehen zu können. Man hat erstens die Neigung, das System mit dem persönlichen Begriffsinstrumentarium eines Philosophen oder etwa mit der Inhaltsaufgabe eines Buches gleichzusetzen. Diese Neigung äußert sich in Aussagen wie: „Er musste das so interpretieren, denn sonst passte es ja nicht in sein System.“ Das System sei eine nur subjektive Logik und als solches nicht imstande, dem Phänomen gerecht zu werden. Zweitens hat man die Neigung, das System als etwas Dinghaftes aufzufassen. Wenn das System ein Kompositum ist, so sei das Prinzip dieser Zusammenfügung ein objektivierendes. Die Unterordnung der Dingen unter dem Systemprinzip sei äquivalent mit ihrer Festlegung auf ihre Funktion im System; die Dinge seien verurteilt zu ihren Platz im System wie 29 Kleider zu ihrer gehörigen Schublade im Schrank. Wenn das System als ein solches aufgefasst wird, impliziert es einen totalen Zustand der Verdinglichung. Im Folgenden werde ich versuchen zu zeigen, dass das Prinzip des Systems die Freiheit ist. Wenn die Freiheit das Prinzip des Systems ist, geht die oben skizzierte, pauschale Kritik des Systems nicht auf, denn den Dingen im Allgemeinen Freiheit zuzuschreiben, heißt nicht sie einer objektivierenden Logik zu unterwerfen, sondern sie vielmehr von einer solchen Logik zu entlassen und sie zu sich selbst zu befreien. Wenn wir verstehen möchten, warum gerade die Freiheit das Prinzip des Systems sein muss und warum gerade sie zum Prinzip des Systems gemacht werden kann, gilt es zum Problem der Verwirklichung der Freiheit (§ 1.1) und zu Kants Begriff des höchsten Guts (§ 1.2) zurückzukehren. Jedes vernünftige Wesen ist sich auf einer unmittelbaren Weise bewusst, dass ihm etwas moralisch geboten ist. Da zur Gültigkeit des Sittengesetzes gefordert ist, dass die Bestimmung des Willens durch das Gesetz nicht ohne Erfolg bleibt, schließt das Sittengesetz die Idee des höchsten Guts in der Welt als dessen Endzweck ein. Weil die Glückseligkeit nicht schon in der Pflicht und die Pflicht nicht schon in der Glückseligkeit enthalten ist, ist deren Verknüpfung im höchsten Gut synthetisch. Die synthetische a priori Verbindung von Pflicht und Glückseligkeit muss Kant zufolge „als Verknüpfung der Ursache mit der Wirkung gedacht werden“. (KpV, S. 204) Die Verbindung von Ursache und Wirkung kennen wir aus theoretischer Hinsicht als die Naturkausalität. Aus praktischer Hinsicht ist die Notwendigkeit der Natur jedoch bloß Zufälligkeit und Kontingenz. Wenn die Idee des höchsten Guts in der Welt die praktisch-notwendige Verbindung von Pflicht und Glückseligkeit als Ursache und Wirkung enthält, diese Verbindung sich in der Welt gleichwohl nur zufälligerweise gestalten kann, scheint die Realisierung des höchsten Guts in der Welt unmöglich. Ist aber das höchste Gut unmöglich, so ist, wie schon angedeutet wurde, das moralische Gesetz „an sich falsch“. Kant bezeichnet diesen Widerspruch als „die Antinomie der praktischen Vernunft“. (KpV, S. 204 ff.) Wie bei der dritten Antinomie der reinen Vernunft ist der Widerspruch laut Kant nur scheinbar. Wir haben nämlich das Verhältnis zwischen Pflicht und Glückseligkeit als „Verhältnis zwischen Erscheinungen“ aufgefasst und demzufolge sowohl die Ursache als auch die Wirkung als Erscheinung betrachtet. (KpV, S. 207) Wie wir gesehen haben, kann die Beschaffenheit der Maximen weder zum Gegenstand der Erfahrung gemacht werden, noch kann sie im Falle moralisch guter 30 Handlungen aus der Gegebenheit der Handlungen abgeleitet werden. Die Pflicht, als Ursache der Glückseligkeit, kann nur durch Vernunft eingesehen werden und muss als solche einer intelligiblen „Welt“, oder besser, dem intelligiblen Standpunkt zugeordnet werden. Die Glückseligkeit, als (mittelbare) Wirkung der Pflicht, kann indessen zum Objekt der Wahrnehmung gemacht werden. Das Verhältnis zwischen Pflicht und Glückseligkeit ist somit ein „Verhältnis der Dinge an sich selbst zu [den] Erscheinungen“. (KpV, S. 207) Mittels des moralischen Handelns können wir unsere eigene Glückseligkeit nicht bewirken – wir können ihr nur würdig werden. Nicht der Mensch, sondern Gott muss folglich als die wirkende Ursache der Glückseligkeit vorgestellt werden. Wiewohl Kant in seiner Religionsschrift die Hilfe Gottes „übernatürlich“ (RGV, S. 296) und „transzendent“ (RGV, S. 297) nennt, wirkt sie gerade auf die Natur bzw. auf die Sinnenwelt. In einer sehr komplizierten, aber ebenso einleuchtenden Passage der Kritik der praktischen Vernunft fasst Kant das oben Dargestellte zusammen: Da ich […] nicht allein befugt bin, mein Dasein auch als Noumenon in einer Verstandeswelt zu denken, sondern sogar am moralischen Gesetze einen rein intellektuellen Bestimmungsgrund meiner Kausalität (in der Sinnenwelt) habe, so ist es nicht unmöglich, daß die Sittlichkeit der Gesinnung einen, wo nicht unmittelbaren, doch mittelbaren (vermittelst einer intelligiblen Urhebers der Natur) und zwar notwendigen Zusammenhang, als Ursache, mit der Glückseligkeit, als Wirkung in der Sinnenwelt habe, welche Verbindung in einer Natur, die bloß Objekt der Sinne ist, niemals anders als zufällig stattfinden, und zum höchsten Gute nicht zulangen kann. (KpV, S. 206 f.) Obwohl die Freiheit, d. h. die Annahme der dem Gesetz gemäßen Maximen, auf einer noumenalen Ebene gedacht werden muss, findet ihre Verwirklichung „in der Sinnenwelt“ statt. Die Idee des höchsten Guts beseitigt so den möglichen Vorwurf, dass freies Handeln sich nur in einer „noumenalen Welt“ vollziehen werde. Wo aus theoretischer Hinsicht die noumenale und phänomenale Perspektive indifferent nebeneinander stehen, nötigt die Freiheit uns, die noumenale mit der phänomenalen Perspektive zu vermitteln. Da das höchste Gut die Pflicht, d. h. die Freiheit, mit der Glückseligkeit verbindet, muss zu dessen Möglichkeit die „Harmonie der Naturgesetze mit denen der Freiheit“ (KpV, S. 261) oder „die genaue Zusammenstimmung des Reichs der Natur mit dem Reiche der Sitten“ (KpV, S. 262) unterstellt werden. Aus dem Bewusstsein der Freiheit kann gefolgert werden, dass die Natur nicht „bloß Objekt der 31 Sinne ist“; aus praktischer Perspektive muss vielmehr angenommen werden, dass die Natur der Freiheit entgegenkommt. Die Frage ist nun, ob es irgendeine Erfahrung gibt, die diese Vermittlung von Natur und Freiheit bestätigen kann. Denn ohne eine solche Bestätigung, droht die Deduktion der Glückseligkeit aus der Freiheit zu leerem Formalismus herabgesetzt zu werden. Die Feststellung einer Übereinstimmung von Natur und Freiheit kann indessen keine Sache der Erkenntnis sein, denn die Freiheit ist der theoretischen Sichtweise fremd; aus theoretischer Sicht kann nur festgestellt werden, dass die Dinge die Gesetze der Natur folgen. Es gibt aber neben Urteilen der Erkenntnis noch ästhetische Urteile. Die dritte Kritik, die Kritik der Urteilskraft, ist eine Reflexion auf das ästhetische Urteil. Da „der Freiheitsbegriff […] den durch seine Gesetze aufgegebenen Zweck in der Sinnenwelt wirklich machen [soll]“, soll die dritte Kritik zugleich die „unübersehbare Kluft“ zwischen Natur und Freiheit überbrücken. (KU, S. XIX) Das ästhetische Urteil, das über einen Gegenstand gefällt wird, ist laut Kant zwar subjektiv, aber zugleich auch allgemeingültig: Über den Geschmack lässt sich streiten. Um meine Absicht explizit zu machen, werde ich die Behauptung Kants jedoch umkehren: Ästhetische Urteile sind zwar allgemeingültig, aber zugleich auch subjektiv. Daraus erhellt sich, dass ästhetische Urteile im strengen Sinne nicht über einen Gegenstand, sondern nur anlässlich eines Gegenstandes gefällt werden. Die Zweckmäßigkeit ohne allen Zweck, die sich im freien, doch nicht willkürlichen Spiel unserer Erkenntnisvermögen offenbart, darf das Objekt nur wie ein „als ob“ beigelegt werden. Die „Kluft“ zwischen Freiheit und Natur, zwischen praktischer und theoretischer Vernunft wird demnach letztendlich nur durch ein „als ob“ überbrückt: Wenn der Endzweck des moralischen Handelns realisiert worden ist, verhalten wir uns „nach Maximen der Freiheit, als ob sie Gesetze der Natur wären“. (GMS, 462 f.) Obzwar Kant deutlich macht, dass die Antinomie der praktischen Vernunft auf dialektischem Schein beruht, vermag er keine Erfahrung vorzuweisen, die uns auf eine entschiedene Weise von der Möglichkeit des höchsten Guts versichern kann. Das moralische Gesetz erklärt uns für frei, aber wenn das höchste Gut unmöglich ist, ist jenes „an sich falsch“. Kurz: Die Freiheit bleibt eine unsichere Angelegenheit. Man braucht nur Bonaventuras Nachtwachen – deren Autorschaft lange Zeit an Schelling zugeschrieben worden ist – zu lesen, um erfahren zu können, zu welchen existentiellen Problemen diese Unsicherheit führen kann. Das Buch stellt die zerreißende Verzweiflung der Menschen dar, indem es freie Menschen plötzlich in Marionetten und 32 Marionetten plötzlich in freie Menschen verwandeln lässt. Während Bonaventura das Lachen als einziges Remedium gegen die existentielle Krise des Menschen vorschrieb, fassten die Deutschen Idealisten den wackeren Plan, die Freiheit der äußerlichen Welt nicht nur wie ein „als ob“ beizulegen, sondern sie vielmehr zum Prinzip des Wirklichen selbst zu erklären. Wo ein Kantianer Sätze, in denen er den Dingen Freiheit zuzuschreiben versucht, immer wieder im Konjunktiv schreiben muss, trauten sich die Deutschen Idealisten den Indikativ zu benutzen. Die Legitimität ihrer Methode gründet in der Möglichkeit, die Glückseligkeit a priori aus der Pflicht ableiten zu können. Wenn das möglich ist, kann die praktische Vernunft über ihre eigene Grenze erweitert werden, so dass aus ihr synthetisch a priori Sätze deduziert werden können. Die Deutschen Idealisten fanden so in der Freiheit das Prinzip, anhand dessen die Wirklichkeit verständlich gemacht werden kann. Schon im Ältesten Systemprogramm des Deutschen Idealismus ist diese Einsicht angelegt. Dort heißt es, dass „die ganze Metaphysik künftig in die Moral fällt“. (Hegel 1979 I, S. 234) Die Frage nach der Natur soll dann folgendermaßen lauten: „Wie muß eine Welt für ein moralisches Wesen beschaffen sein?“ (Ebd.) Die Idealisten glaubten auf dieser Weise mit dem von Kant behaupteten „Primat der praktischen Vernunft“ Ernst zu machen. (Vgl. KpV, S. 215 ff.) Kant erläutert dieses auf folgende Weise: In der Verbindung […] der reinen spekulativen mit der reinen praktischen Vernunft zu einem Erkenntnisse führt letztere das Primat […]. Denn es würde ohne diese Unterordnung ein Widerstreit der Vernunft mit ihr selbst entstehen. (KpV, S. 218 f.) Nun gibt es laut Kant, wie gesagt, im Sache der Antinomie der praktischen Vernunft nur einen scheinbaren Widerspruch: In Wirklichkeit widersprechen sich die kausale Verknüpfung von Pflicht und Glückseligkeit einerseits und die Kausalität der Natur andererseits nicht. Dennoch gibt es jetzt zwei mögliche Erklärungen der Natur: Einmal erscheint sie als „bloßes Objekt der Sinne“, ein andermal als durch Freiheit begründet. Während Kant konsequent seine Zwei-Perspektiven-Lehre hantiert, fühlten sich die Idealisten hinsichtlich der oben dargestellten existenziellen Krise des Menschen genötigt, die Frage nach der Natur und dem Wirklichen völlig in die Moral zu integrieren. 33 3.2 Der Systemansatz der Freiheitsschrift In der Einleitung der 1809 publizierten Abhandlung über das Wesen der menschlichen Freiheit stellt sich Schelling die Frage, ob die Freiheit mit dem System zu vereinbaren sei. In Hinblick auf das, was ich im vorigen Paragrafen erörtert habe, scheint diese Frage leicht zu beantworten, denn obzwar einige Kritiker das System für etwas anderes halten und es mit dem Fatalismus gleichsetzen wollen, ist die Freiheit gerade das Prinzip des Systems. Schelling scheint dies andeuten zu wollen, wenn er gegen die „verklungene Sage“, nach welcher „der Begriff der Freiheit mit dem System überhaupt unverträglich sein [soll]“, einwendet, dass, wenn die Freiheit überhaupt etwas vorstellen soll, sie „einer der herrschenden Mittelpunkte des Systems sein muß“. (WF, S. 336) Die entscheidende Einsicht des Deutschen Idealismus, die darin besteht, dass die Freiheit den Dingen nicht nur wie ein „als ob“ beigelegt werden darf, sondern vielmehr das Prinzip des Seins selbst sein muss, ist von Schelling auf die Formel gebracht worden: „Wollen ist Ursein.“ (WF, S. 350) Wenn die Freiheit das Prinzip des Wirklichen ist, scheint die Aufgabe eines Systems der Freiheit gelöst: Schelling brauchte eigentlich nur der Einleitung seiner Abhandlung zu verfassen. Der Punkt, zu dem der Idealismus die Philosophie gehoben hat, ist für Schelling jedoch nicht schon der Endpunkt, sondern vielmehr erst der Anfangspunkt. Wenn wir nämlich das Spezifische der menschlichen Freiheit zeigen wollen, „reicht der bloße Idealismus nicht hin“: Der Idealismus gibt nämlich einerseits nur den allgemeinsten, andrerseits nur den bloß formellen Begriff der Freiheit. Der reale und lebendige Begriff aber ist, daß sie ein Vermögen des Guten und des Bösen sei. (WF, S. 352) Um verstehen zu können, wie Schelling hier zwischen einem „bloß formellen“ und einem „realen und lebendigen“ Freiheitsbegriff differenzieren kann, muss kurz zu Kant zurückgekehrt werden. Wenn Kant 1797, also vier Jahre nach der Publikation seiner Religionsschrift, Reinhold erwidert – der den Einwand erhoben hat, Kant sei unfähig, eine Begründung der menschlichen Verantwortung für das Böse zu liefern –, schreibt er, wir können nur einsehen: […] daß, obgleich der Mensch als Sinnenwesen der Erfahrung nach ein Vermögen zeigt dem Gesetze nicht allein gemäß, sondern auch zuwider zu 34 wählen, dadurch doch nicht seine Freiheit als intelligiblen Wesens definirt werden könne […]. (MS, S. 226) An diesem Zitat ist deutlich wahrzunehmen, dass Kant seine Erörterung in der Religionsschrift nicht als eine Änderung des Standpunkts der Kritik der praktischen Vernunft und der Grundlegung sieht. Der Unterschied liegt in der Vorgehensweise: Während Kant in seinen frühen Werken die Freiheit aus dem Sittengesetz deduziert, versucht er sie in der Religionsschrift auf Basis gegebener Handlungen zu rekonstruieren. Der „formelle“ Begriff der Freiheit umfasst den Gebrauch der Willkür unter objektiven moralischen Gesetzen und unterstellt folglich die analytische Einheit von Freiheit und Moralität, infolgedessen er der Zurechenbarkeit des Bösen nicht zu begründen vermag. Der „reale und lebendige“ Begriff der Freiheit ist in der Tiefenstruktur von konkreten legalen und illegalen Handlungen eingefasst und kann, auf Basis dieser konkreten Handlungen, als intelligible Tat rekonstruiert werden. Schelling fragt sich in der Freiheitsschrift nicht nur, ob das System mit diesem „realen und lebendigen“ Freiheitsbegriff vereinigt werden kann, sondern vielmehr, ob sich das System am Leitfaden dieses Freiheitsbegriffs gestalten kann. Er hat sich zur Aufgabe gestellt, nicht nur das menschliche Handeln, sondern vielmehr das Wirkliche insgesamt auf die Freiheit der intelligiblen Tat zurückzuführen. Der Schritt, den Schelling hier zu machen weiß, ist imposant, denn dieser neue Systemansatz fordert eine radikal neue Herangehensweise: Während die Methode des Idealismus darin bestand, das Wirkliche aus der Freiheit zu deduzieren, muss die jetzt darin bestehen, aufgrund des Wirklichen die Freiheit zu rekonstruieren. Es reicht also nicht aus, „zu behaupten, [wie Fichte] ‚dass Tätigkeit, Leben und Freiheit allein das wahrhaft Wirkliche seien‘ […]; es wird vielmehr gefordert, auch umgekehrt zu zeigen, daß alles Wirkliche (die Natur, die Welt der Dinge) Tätigkeit, Leben und Freiheit zum Grunde habe […]“. (WF, S. 351) Der Idealismus soll Schelling zufolge zum „RealIdealismus“ ergänzt werden. (Vgl. WF, S. 356) Dessen System kann sich, als systematische Rekonstruktion, jedoch erst nach den Fakten gestalten. 35 4 Von Kant nach Schelling: Die intelligible Tat als Mittelpunkt des Systems Es gilt jetzt den Systemansatz Schellings auszuarbeiten und inhaltlich näher auf die Freiheitsschrift einzugehen. Um die Interpretationsperspektive dieser Arbeit verschärfen zu können, werde ich sie gegen andere Positionen in der wissenschaftlichen Debatte abgrenzen. (§ 4.1) Indem ich das Konzept der intelligiblen Tat in das Zentrum der Erörterung stelle, gilt es nochmals zu der Thematik zurückzukehren. (§ 4.2) Ich werde die Systematik der Religionsschrift Kants als heuristisches Instrument zur Interpretation der Freiheitsschrift heranziehen. Ich werde herausarbeiten, wie Kant und Schelling das Wesen des Bösen (§ 4.3) und die Umkehr zum Guten (§ 4.4) bestimmen. Aufgrund dieses Vergleichs ist es möglich, den Unterschied zwischen ihren Freiheitsbegriffen herauszustreichen. (§ 4.5) 4.1 Die Freiheitsschrift: Eine Übersicht der wissenschaftlichen Diskussion Nachdem der Systemansatz Schellings in der Freiheitsschrift erläutert worden ist, kann die folgende Hypothese aufgestellt werden: Die intelligible Tat bildet den Kerngedanken der Freiheitsschrift, d. h. die Freiheitsschrift folgt der Methode einer systematischen Rekonstruktion, anhand deren Schelling nicht nur die Handlungen des Menschen, sondern vielmehr das Wirkliche im Allgemeinen auf die Struktur der intelligiblen Tat zurückzuführen versucht. Diese Rekonstruktion ist nicht als eine bloße Kritik des Idealismus, sondern vielmehr als dessen Ergänzung gemeint; obzwar die Behauptung, etwas soll ergänzt werden, natürlich auch eine Kritik enthält, dient die Rekonstruktion dem Idealismus jedenfalls nicht zum Ersatz. Hinsichtlich dessen, was im letzten Paragrafen erörtert worden ist, scheint die aufgestellte Hypothese trivial. Man braucht sich jedoch nur einmal die zur Verfügung stehende Sekundärliteratur anzuschauen, um sich vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Erstens gibt es einen Interpretationsstrang, in der die durch die Freiheitsschrift inaugurierte Spätphilosophie Schellings im Lichte der theosophischen und schöpfungstheologischen Tradition verstanden wird. Dieser Interpretation zufolge sei Schelling ein Quasi-Mystiker, der die Rätsel der Welt zu entwirren versucht. So lässt SchmidtBiggemann, in seinem 78 Seiten zählenden Vorwort zur Ausgabe der Weltalterfragmenten aus dem Berliner Nachlass, die ganze schöpfungs-theologische Tradition, von Proklos bis Böhme, Revue passieren, während er die Philosophie Kants 36 mit keinem Wort erwähnt. (Schmidt-Biggemann 2002) Geijssen (2009) geht in seiner neulich veröffentlichten Arbeit – mit dem er mehr als 700 Seiten aufzufüllen weiß, ohne freilich etwas zu behaupten – davon aus, dass in Schellings Freiheitsschrift eine „Weisheitslehre“ verborgen liegt, während Brown (1977) behauptet, dass Schellings Freiheitsschrift nur aus seiner Beschäftigung mit Böhme zu verstehen sei. Obzwar diese Art Interpretationen hinsichtlich der Biografie Schellings eine gewisse Plausibilität haben – denn Schelling hat sich eingehend mit Figuren als Böhme und von Baader beschäftigt und zum Teil sogar ihr Vokabular übernommen –, sind sie meiner Meinung nach philosophisch nicht so interessant. Die Systematik des Textes droht nämlich hinter Wörtern und historischen Verweisen zu verschwinden. Zweitens trifft man in der Literatur eine Sichtweise an, nach der Schelling sich 1809 zur positiven Religion hingewendet habe. Der wichtigste Repräsentant dieser Sichtweise ist Horst Fuhrmans. Er sieht Schelling gegen 1806 eine „Rückwende ins Christliche“ vollziehen. (Fuhrmans 1954, S. 163) Während bezüglich der Philosophie der Offenbarung etwas für diese Interpretation zu sagen wäre, läuft sie schief, wenn sie auf die Freiheitsschrift angewendet wird. Man stößt in der Freiheitsschrift auf so gut wie keine Bibelzitate. Was man dagegen sehr einfach antreffen kann, ist eine aus dogmatischer Sicht häretische Gottesvorstellung. Wenn die Freiheitsschrift somit eine „Wendung ins Christliche“ darstellen soll, so wäre diese eine Wendung in ein sektiererisches Christentum. Drittens, im Anschluss an einem wichtigen Artikel von Theunissen (1965), gibt es eine Reihe von Interpretationen, nach der die Freiheitsschrift, trotz Schellings „anthropologischen Ansatzes“, letztlich doch einen „Rückfall in die Transzendentalphilosophie“ bedeute. (Vgl. Hühn 1998, Iber 2004) Die Anthropologie, die Schelling philosophisch zu begründen beabsichtigt habe, sei eine schöpfungstheologische, somit eine solche, die in der Anerkennung des Geschaffen-seins gründet. Anhand dieser Anthropologie habe Schelling dann beabsichtigt, die idealistischen Figuren der Selbstbestimmung und Autonomie zu kritisieren. Effektiv habe er darin jedoch keinen Erfolg gehabt, denn sein Konzept der intelligiblen Tat bleibe einer Figur der absoluten Selbstsetzung verhaftet und bedeute somit einen Rückfall in die idealistische Transzendentalphilosophie, d. h. in die Philosophie Fichtes. Bevor ich auf diese Interpretation eingehe, soll noch ein vierter Interpretationsstrang angedeutet werden. Wo Theunissen und seine Nachfolger der Meinung sind, dass Schellings Konzept der intelligiblen Tat einen Rückfall in eine 37 Figur der absoluten Autonomie bedeute, behaupten Interpreten wie Schulte (1988) und Hermanni (1994) paradoxaler Weise, dass dieses Konzept einen Fatalismus impliziere: Mit der intelligiblen Tat geht gerade die Freiheit des innerweltlichen Handelns zugrunde. Dass Iber nun sowohl bei Theunissen als auch bei Hermanni anknüpft, d. h. sowohl die absolute Autonomie als auch den Fatalismus, als Implikationen von Schellings Auffassung der intelligiblen Tat, behaupten kann, offenbart uns, dass beide Schlüsse auf einer gemeinsamen Voraussetzung beruhen. (Vgl. Iber 2004, S. 132 f.) Ich werde versuchen, die gemeinsame Voraussetzung dieser gegensätzlichen Interpretationen mittels einer Reflexion auf Schellings Konzept der intelligiblen Tat herauszustellen. (§ 4.2) Um die ersten zwei Interpretationen zurückweisen zu können, genügt es, glaubhaft zu machen, dass die zwei Seinsprinzipien, von den Schelling in seiner Freiheitsschrift redet, nur im Lichte der kantischen Ideen des Sittengesetzes und der Selbstliebe verstanden werden können. (§ 4.3) 4.2 Nochmals die intelligible Tat Die Hypothese, dass Schellings Systemansatz der Freiheitsschrift eine systematische Rekonstruktion des Wirklichen am Leitfaden der intelligiblen Tat ist, hat Beleg in den Schriften Schellings. Nicht nur ein großer Teil der Freiheitsschrift (WF, S. 381 - 390), sondern auch ein wichtiger Abschnitt der Weltalter ist der Problematik der intelligiblen Tat gewidmet. (WA, S. 177 - 186) In diesem Abschnitt der Weltalter übersetzt Schelling das, was in der wissenschaftlichen Diskussion üblicherweise für seine „Theogonie“ und „Kosmogonie“ durchgeht, völlig in die Begrifflichkeit der intelligiblen Tat. Im Hintergrund steht hier noch eine aus dieser Sicht merkwürdige Passage der Kritik der praktischen Vernunft, in der Kant bemerkt, dass die „oberste Ursache der Natur“ – die er danach mit Gott identifiziert – „eine der moralischen Gesinnung gemäße Kausalität hat“. (KpV, S. 225) Da die Philosophie der Weltalter außerhalb des Rahmens dieser Arbeit fällt, kann dies jedoch nur als Hinweis gelten. Um erläutern zu können, wie Schelling die intelligible Tat erfasst, soll kurz zu Kant zurückgekehrt werden. Aus dem Sittengesetz kann nicht abgeleitet werden, dass es Böses gibt. Aber gesetzt den Fall, dass es Böses gibt, kann dieses am Leitfaden des formellen Freiheitsbegriffs auf eine intelligible Tat des Menschen zurückgeführt werden. Kants „Lehre“ der intelligiblen Tat ist folglich kein metaphysischer Lehrsatz, sondern vielmehr das Ergebnis einer systematischen Rekonstruktion auf Basis gegebener 38 Handlungen: Wenn wir jemanden für eine gesetzwidrige Handlung zur Verantwortung ziehen wollen, müssen wir unterstellen, dass diese auf einer bösen Maxime, diese böse Maxime aber wiederum auf einem dem Menschen zurechenbaren subjektiven Grund zur Annahme böser Maximen überhaupt beruht. Die Außerzeitlichkeit der intelligiblen Tat ist demnach kein Indiz dafür, dass sie quasi in einem metaphysischen Jenseits vollzogen worden sei; vielmehr meint diese Außerzeitlichkeit, dass die intelligible Tat allein unabhängig von aller Zeitbedingungen, d. h. mit Verzicht auf alle mögliche Ausreden, erkannt werden kann. Bei der Erörterung von Schellings Konzept der intelligiblen Tat kann uns einige Mühe erspart bleiben, denn Schelling macht selber schon explizit klar, wie wir sie zu verstehen haben: […] bemerkenswert ist, wie Kant, der sich zu einer transzendentalen alles menschliche Sein bestimmenden Tat in der Theorie nicht erhoben hatte, durch treue Beobachtung der Phänomene des sittlichen Urteils in späteren Untersuchungen auf die Anerkennung eines, wie er sich ausdrückt, subjektiven, aller in die Sinne fallenden Tat vorangehenden Grundes der menschlichen Handlungen, der doch selbst wiederum ein Aktus der Freiheit sein müsse, geleitet wurde. (WF, S. 388) Schelling übernimmt Kants „Lehre“ der intelligiblen Tat. Am Zitat ist deutlich wahrzunehmen, dass Schelling sich den rekonstruktiven Charakter der Ableitung der intelligiblen Tat durchaus bewusst ist: Kant wurde nicht durch Deduktion, sondern „durch treue Beobachtung der Phänomene des sittlichen Urteils“ zu ihr „geleitet“. Schelling weiß sogar ein einleuchtendes Beispiel eines solchen sittlichen Urteils zu geben: […] indem derjenige, welcher etwa, um eine unrechte Handlung zu entschuldigen, sagt: So bin ich nun einmal, doch sich wohl bewußt ist, daß er durch seine Schuld so ist, so sehr er auch recht hat, daß es ihm unmöglich gewesen, anders zu handeln. (WF, S. 386) Hinsichtlich dieser Beobachtungen ist es bemerkenswert, dass Schellings Konzept der intelligiblen Tat auf so viel Kritik gestoßen ist. Es ist in der wissenschaftlichen Diskussion fast unbestritten, dass Schellings Philosophie der Freiheit an seinem Konzept der intelligiblen Tat „gescheitert“ sei. (Vgl. u. a. Theunissen 1965, Schulte 1988, Hermanni 1994, Peetz 1995, Hennigfeld 2001, Iber 2004) Die Autoren schließen, wie schon erwähnt worden ist, aus verschiedenen Gründen auf das Scheitern der 39 Schellingschen Freiheitsphilosophie: Einige behaupten, die intelligible Tat impliziere die absolute Selbstsetzung des Subjekts und somit einen Rückfall in die Transzendentalphilosophie; andere behaupten, sie impliziere Fatalismus. Es gilt jetzt, die von diesen Autoren geteilte Voraussetzung bloßzulegen. Wenn es möglich ist, Schelling in einem Text zwei gegensätzliche Vorwürfe zu machen, müssen diese Vorwürfe auf einer gemeinsamen Voraussetzung fußen. Was könnte diese Voraussetzung sein? Ich lasse kurz Iber zu Wort kommen: Wirklich frei ist nur die transzendentale Selbstbestimmung des Charakters, während die je konkreten Handlungen mit determinierender Notwendigkeit aus diesem folgen. (Iber 2004, S. 133) Diese Argumentationsstruktur ist auch in den Texten Schultes und Hermannis erkennbar. Laut Schulte verlegt Schelling „mit seinem Konzept der intelligiblen Tat den Ursprung des radikalen Bösen in die Ewigkeit außerhalb des irdischen Lebens hinaus […]. Handelt ein Mensch in dieser Welt böse, ist dies die – zudem unumkehrbare – Folge der intelligiblen Tat“. (Schulte 1988, S. 227) Hermanni zufolge entscheidet die intelligible Tat „ein für allemal“ über das Wesen des Menschen. (Hermanni 1994, S. 147) Konkrete Handlungen sind nicht mehr als „die notwendigen Folgen des durch die intelligible Tat stets schon entschiedenen menschlichen Wesens“. (Ebd. S. 149) Kurz zusammengefasst: Der Mensch verfüge bezüglich der intelligiblen Tat über eine absolute Autonomie. Wenn er sich einmal bestimmt habe – und er habe sich nicht einfach, sondern zum Bösen bestimmt –, so gehen seine konkreten Handlungen mit absoluter Notwendigkeit aus dieser Tat hervor. Der Widerspruch zwischen den beiden Vorwürfen ist nur scheinbar, denn die absolute Autonomie in Hinsicht auf die Selbstbestimmung entspricht dem Fatalismus bezüglich einzelner Handlungen. Ich möchte die Aufmerksamkeit auf die Argumentationsrichtung der Autoren richten: Sie fangen bei der intelligiblen Tat an und gehen dann zu den einzelnen Handlungen über. Egal ob man, wie Schulte, über ein überirdisches Jenseits reden möchte – was wirklich daneben ist – oder nicht, wenn man sich für diese Interpretationsrichtung entscheidet, hat man Schelling zwei Vorwürfe zu machen. Schelling argumentiert gerade in die umgekehrte Richtung: Er beginnt bei einem konkreten sittlichen Urteil über eine konkrete Handlung und schließt letztlich auf die intelligible Tat als eine notwendige Voraussetzung. Er führt die intelligible Tat gerade ein, um die Zurechenbarkeit einzelner Taten zu retten. Die genannten Autoren legen ihr 40 Unvermögen an den Tag, den rekonstruktiven Charakter der Schellingschen Argumentation einsehen zu können. Sie verwechseln das Ergebnis einer systematischen Rekonstruktion auf Basis konkreter Handlungen mit einem metaphysischen Lehrsatz. Auch die Analysen von Theunissen und Hühn zeugen von dieser Verwirrung, indem sie die intelligible Tat mit der Fichteschen Tathandlung gleichsetzen wollen. (Theunissen 1965, S. 186, Hühn 1998, S. 62) Schelling macht dagegen explizit klar, dass die intelligible Tat unter keinen Umständen mit der Tathandlung gleichgesetzt werden darf, denn dieses sei „nur idealisch“ (WF, S. 386), jenes hingegen „reales Selbstsetzen“. (WF, S. 385) Wenn nicht auf noch schönere Weise als Kant spricht auch Schelling dem Menschen eine radikale Freiheit zu: Der Mensch ist auf jenen Gipfel gestellt, wo er die Selbstbewegungsquelle zum Guten und zum Bösen gleicherweise in sich hat: das Band ist ihm kein notwendiges, sondern ein freies. Er steht am Scheidepunkt; was er auch wähle, es wird seine Tat sein, aber er kann nicht in der Unentschiedenheit bleiben […]. (WF, S. 374) Da sowohl Kant als auch Schelling dem Menschen eine radikale und heroische Freiheit zusprechen, aufgrund dessen der Mensch nicht nur für gute Handlungen verantwortlich ist, sondern auch für böse Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden kann, muss, um den Unterschied zwischen dem kantischen und dem Schellingschen Freiheitsbegriff explizieren zu können, bestimmt werden, worin bei Kant und Schelling das Böse besteht. Es wird sich erweisen, dass Kant und Schelling verschiedene Konzeptionen des Bösen vertreten. (§ 4.3) Wenn das Böse von beiden Verfassern unterschiedlich aufgefasst wird, müssten sie auch die Umwendung zum Guten auf verschiedene Weise interpretieren. (§ 4.4) Anhand der Differenz in den Interpretationen des Bösen und der Umkehr zum Guten kann der Unterschied zwischen Kants und Schellings Freiheitsbegriff explizit gemacht werden. (§ 4.5) 4.3 Das Wesen des Bösen Im zweiten Kapitel habe ich die Frage, warum der Mensch böse genannt werden muss, beantwortet. Ich habe dort, mit Kant, den zwar natürlichen und universellen, jedoch zurechenbaren Hang zum Bösen als Grund der Möglichkeit böser Handlungen angewiesen. Die Idee einer intelligiblen Tat stellt sicher, dass der Hang dem Menschen 41 imputierbar ist. Die Beantwortung der Frage, worin das Böse besteht, habe ich im zweiten Kapitel unterlassen, indem ich Kants Analyse als heuristisches Instrument zur Interpretation der Freiheitsschrift einsetzen wollte. Jetzt kann jedoch die Frage nach dem Wesen des Bösen gestellt werden. Während Kant die Empirie braucht, um ableiten zu können, dass der Mensch böse ist, braucht er sie nicht, um sagen zu können, was das Böse ist: Wenn nun aber gleich das Dasein dieses Hanges zum Bösen in der menschlichen Natur, durch Erfahrungsbeweise des in der Zeit wirklichen Widerstreits der menschlichen Willkür gegen das Gesetz, dargetan werden kann, so lehren uns diese doch nicht die eigentliche Beschaffenheit desselben […]; diese […] muß aus dem Begriffe des Bösen, sofern es nach Gesetzen der Freiheit möglich ist, a priori erkannt werden. (RGV, S. 32 f.) Kant erfasst das Böse weder als eine selbstständige, positive Macht, noch als eine Privation des Guten, sondern als ein durch Freiheit gesetztes moralisches Böses. Das Böse als solches kommt durch den Menschen in die Welt. Kant distanziert sich von einer angeblich mit Plato beginnenden Tradition, welche die Neigung als solche oder sogar die Endlichkeit an sich als Ursache des Bösen anführt. Die Neigungen können nicht an sich bereits böse sein, denn sie müssen eine Maxime – eine Regel, nach welcher ich handeln will – aufgenommen werden, ehe sie für eine moralische Beurteilung in Betracht kommen. Dennoch sind die Neigungen „gut“ zu nennen, solange das moralische Gesetz nur zu ihrer Bedingung gemacht wird; die Triebfeder der Sinnlichkeit ist gut, unter der Bedingung, dass sie „im Grunde“ bleibt. Erst wenn jemand die Triebfeder der Sinnlichkeit „als für sich hinreichend zur Bestimmung der Willkür“ (RGV, S. 33) – was in Wahrheit nur das moralische Gesetz sein kann – in seine Maxime aufnehmen würde, die Triebfeder der Sinnlichkeit also zur Bedingung der Befolgung des moralischen Gesetzes macht, würde er moralisch böse sein. Das Böse besteht für Kant demnach in einer Verkehrung der Triebfeder in einer Maxime: Also muß der Unterschied, ob der Mensch gut oder böse sei, nicht in dem Unterschiede der Triebfedern, die er in seine Maxime aufnimmt (nicht in dieser ihrer Materie), sondern in der Unterordnung (der Form derselben) liegen: welche von beiden er zur Bedingung der anderen macht. (RGV, S. 34) Damit wir verstehen können, worin das Böse für Schelling besteht, soll zuerst kurz dargestellt werden, wie Schelling in der Freiheitsschrift die Schöpfung – oder was für ihn dasselbe ist: die Geschichte – als das Ineinander-Wirken von zwei Seinsprinzipien 42 begreift: das „dunkle“ und das „lichte“ Prinzip. Das hört sich freilich sehr mystisch an, aber wir sollen nicht zu früh urteilen. Die Mühe lohnt sich, sich eine Übersicht des Schellingschen Vokabulars zu schaffen. Schelling benutzt einerseits „dunkles Prinzip“, „Selbstheit“, „Eigenwille“, „Partikularwille“ und „besonderen Wille“, andererseits „Lichtprinzip“, „ideales Prinzip“, „Universalwille“ und „allgemeinen Wille“ als äquivalente Begriffe. Im Hinblick auf diese Ordnung der Begriffe scheint es sehr plausibel anzunehmen, dass die beiden Seinsprinzipien nur im Lichte des kantischen Unterschieds zwischen der Triebfeder des Sittengesetzes und der Triebfeder der Selbstliebe verständlich werden. Wenngleich das „lichte“ Prinzip, d. h. der „Universalwille“ oder der „allgemeine Wille“, nicht einfach mit der Triebfeder des Sittengesetzes und das „dunkle“ Prinzip, d. h. der „Partikularwille“ oder der „besondere Wille“, nicht einfach mit der Triebfeder der Selbstliebe gleichgesetzt werden darf, so ist es sehr plausibel, eine Sinnkontinuität zwischen diesen anzunehmen. Es ist möglich, die folgende Hypothese aufzustellen: Schellings Seinsprinzipien bekommen nur einen Sinn vor dem Hintergrund der kantischen Unterscheidung zwischen der Triebfeder des Moralgesetzes und der Triebfeder der Selbstliebe. Wer jedoch in der heutigen wissenschaftlichen Debatte eine solche Sinnkontinuität behaupten würde, steht ganz allein. Esoteriker behaupten, die Seinsprinzipien seien mit der Systole und Diastole, also mit der Kontraktion und Expansion des Herzens, zu vergleichen. (Vgl. z. B. Schmidt-Biggemann 2002) Obzwar auch Schelling diese Metapher in seinen Weltaltern benutzt, erklärt sie nur wenig. Hühn ist der Meinung angetan, dass das „dunkle“ Prinzip bzw. der „Eigenwille“ mit dem „neuzeitlichen Autonomiebegriff“ gleichzusetzen sei. (Hühn 1998, S. 92, vgl. auch S. 67 f., 82 f.) Die Folgen sind desaströs: Schellings Freiheitsschrift wäre eine Kritik des neuzeitlichen Autonomiegedankens, nach welcher die Autonomie einem göttlichen Gebot untergeordnet werden sollte. Der Unterschied mit dem Interpretationsansatz dieser Arbeit mag deutlich sein: Während Hühn den Partikularwillen mit dem neuzeitlichen Autonomiegedanken identifiziert, soll er nach meines Erachtens in Sinnkontinuität mit der Triebfeder der Selbstliebe begriffen werden. Hinsichtlich der aufgestellten Hypothese muss Autonomie vielmehr in der Unterordnung des Partikularwillens unter dem Universalwillen bestehen. Die aufgestellte Hypothese wird bewahrt, wenn sie uns befähigt, Schellings Begriff des Bösen auf einer kohärenten Weise darzustellen. Das werde ich im Folgenden versuchen zu tun. 43 Der Partikularwille wird von Schelling als ein kontrahierendes und verschließendes Prinzip konzipiert, der Universalwille als ein extrahierendes und offenbarendes Prinzip. Der Unterschied zwischen, und das Ineinander-Wirken von diesen Prinzipien geht zurück auf den durch Schelling gemachten Unterschied zwischen der Existenz und dem Grund von Existenz – der Unterschied zwischen „dem Wesen, sofern es existiert, und dem Wesen, sofern es bloß Grund von Existenz ist“. (WF, S. 357) Im Rahmen dieser Arbeit kann der Unterschied zwischen Grund und Existenz leider nicht erörtert werden. Es gilt jetzt nur festzuhalten, dass die Existenz und der Grund von Existenz nicht vereinzelt, sondern nur in ihrer Wechselwirkung denkbar sind. Da der Gegensatz zwischen dem Partikular- und Universalwillen seinen Ursprung in der Differenz von Grund und Existenz hat, gibt es im Prinzip eine Reziprozität, oder eine harmonische Wechselwirkung zwischen beiden: Jede Geburt ist eine „Geburt aus [dem] Dunkel ans Licht“. (WF, S. 360) Es kann nicht die Absicht der Schöpfung sein, eines der beiden Prinzipien aufzuheben, denn das wäre zugleich die Aufhebung der Wechselwirkung, d. h. der Schöpfung als solcher. Vielmehr ist es die Absicht der Schöpfung, das richtige Verhältnis zwischen beiden Prinzipien herzustellen. Das Gute – das richtige Verhältnis zwischen dem Partikular- und Universalwillen – drückt Schelling mithilfe der Analogie der Liebe aus. Die Liebe verbindet solche, „deren jedes für sich sein könnte und doch nicht ist, und nicht sein kann ohne das andre“. (WF, S. 408) Das Gute besteht in der Affirmation einer harmonischen Einheit zwischen den beiden Seinsprinzipien, ohne dass dies bedeuten würde, dass die Differenz zwischen den Prinzipien völlig gelöscht wäre. Wenn das Gute in der harmonischen Einheit zwischen beiden Seinsprinzipien besteht, so liegt die Annahme nahe, dass das Böse in der Abwesenheit dieser Einheit liegt. Aber wäre das so, wäre das Böse nur eine Privation des Guten und die menschliche Freiheit nicht ein Vermögen zum Guten und zum Bösen, sondern ein Vermögen nur zum Guten. Schelling will darum deutlich machen, dass das Böse etwas Positives ist, ohne dass es bedeuten würde, dass es eine von der menschlichen Freiheit unabhängige Macht ist. Schelling leugnet, dass eines der beiden Prinzipien für sich schon für böse erklärt werden könne; denn, wäre das so, wäre das Böse kein moralisches Böses und damit die menschliche Freiheit kein Vermögen zum Guten und zum Bösen. Zudem, solang die Prinzipien in einer harmonischen Einheit aufgenommen 44 sind, sind sie gut. Wenn das Böse nicht im Materiellen, aber auch nicht in der Abwesenheit der formalen Einheit besteht, worin besteht es dann? Schelling zufolge besteht das Böse weder in der Abwesenheit der formalen Einheit, noch in der Materialität der Seinsprinzipien, sondern in der „falschen Einheit“ (WF, S. 371) der Prinzipien oder im „zertrennten Ganzen“. (WF, S. 370) Kurz: Das Böse ist das „Scheingute“. Die Bestimmung des Bösen ist also zugleich positiv – das Böse besteht in einer Einheit, nicht in deren Abwesenheit – und formal – das Böse besteht in dem formalen Zusammenhang der Prinzipien, nicht in einem Prinzip für sich. Schelling untermauert diese Behauptung anhand zweier Analogien: die der Temperatur und die der Harmonie. Wie die Distemperatur nicht in der Abwesenheit der Temperatur, sondern in einer falschen Temperatur besteht, so besteht das Böse nicht in einer Abwesenheit der Einheit – nicht in einer Privation des Guten –, sondern in einer falschen Einheit. Wie die Disharmonie nicht in einem einzelnen Ton besteht, sondern in einem falschen Zusammenhang der Töne, so besteht das Böse nicht in einem einzelnen Prinzip, sondern im falschen Zusammenhang der Seinsprinzipien. Der Partikularwille hat seinen Ursprung im Grunde der Existenz und ist demnach ein Prinzip, das seinem Wesen nach immer im Grunde bleiben soll. Der Partikularwille ist seinem Wesen nach nur Potenz und kann nie zur Aktualität gelangen. Wenn der Partikularwille, im Einklang mit seinem Wesen, Basis bleibt, ist es die notwendige Bedingung der harmonischen Einheit der Seinsprinzipien; insofern ist der Partikularwille gut. Nun verdeutlicht anhand der Analogie der Gesundheit: Solange der Partikularwille nichts mehr – aber auch nicht weniger – als Organ ist, trägt es zur Gesundheit bei, d. h. zur harmonischen Einheit des Organismus. In der Natur ist aber die Möglichkeit gegeben, dass das Organ eine Autarkie beansprucht und sich wider den Organismus kehrt. Diese Möglichkeit ist die Möglichkeit der Krankheit. Das Phänomen der Krankheit macht deutlich, dass in der Natur eine relative Freiheit angelegt ist, aufgrund welcher ein Teil der Natur es vermag, sich wider die natürliche Ordnung zu wenden. Wenn das Organ aber, durch eine Affirmation seiner Selbstheit, anfängt ein eigenes Leben zu leben, findet am Ende nicht nur der Organismus den Tod, sondern auch das Organ selbst wird zerstört. Das Böse besteht nun in dieser Affirmation des Partikularwillens als „für sich selbst hinreichend“ – also als etwas, das es seinem Wesen nach nicht sein kann. Wenn der Partikularwille als für sich selbst hinreichend affirmiert wird, wird prätendiert, dass es, statt nur im Grunde, für sich selbst seiend sei bzw. statt 45 nur Potenz, Aktualität sei. Das Böse besteht in der Verabsolutierung dessen, was seinem Wesen nach nur relativ ist. Oder anders: Das Böse besteht in der Affirmation des Partikularwillens – das seinem Wesen gemäß nur Potenz, d. h. (noch) nicht „ist“ – als für sich seiend. Es ist wichtig einzusehen, dass das Böse seiner Möglichkeit nach zwar in der Natur angelegt ist, das Böse als solches aber erst durch eine Affirmation von der Seite des Menschen her in die Welt kommt. Das Böse besteht seiner Möglichkeit nach in der „Zertrennlichkeit der Prinzipien“. (WF, S. 364) Wir haben aber gesehen, dass das Böse seiner Möglichkeit nach die notwendige Bedingung des Guten und insofern gut ist. Da der Partikularwille seinem Wesen gemäß nicht von der Potenz zur Aktualität und nicht vom Nichtsein zum Sein gelangen kann, kann es erst „durch falsche Imagination“ von der Seite des Menschen her „als wirklich erfaßt (aktualisiert) werden“. (WF, S. 390) Erst wenn der Partikularwille durch einen Akt der menschlichen Freiheit affirmiert wird, als wäre es alles, können wir vom Bösen als solchen sprechen. Das Böse entsteht gerade dort, wo der Mensch sich selbst betrügt und aufgrund der Pflichtmäßigkeit seiner Handlungen folgert: „Mein Handeln lässt nichts zu wünschen übrig.“ Bei Schelling ist das Böse, wie bei Kant, notwendigerweise moralisches Böses, in dem Sinne, dass es als solches erst durch die Freiheit des Menschen in die Welt kommt. Das Böse besteht bei Schelling aber nicht ausschließlich, wie bei Kant, in der Verkehrung der Triebfeder in einer Maxime. Das Böse besteht in der Affirmation des Partikularwillens als seiend – eine Qualifizierung, die eigentlich nur dem Universalwillen angehört. Kurz gesagt: Das Böse besteht bei Schelling nicht in einer affirmierten Verkehrung der Triebfeder, wie bei Kant, sondern in einer affirmierten Verkehrung der Seinsprinzipien. Der „allein richtige Begriff des Bösen“ ist Schelling zufolge der, „nach welchem es auf einer positiven Verkehrtheit oder Umkehrung der Prinzipien beruht“. (WF, S. 366) Das Böse ist für Schelling immer moralisches Böses, aber es hat zugleich auch einen Seinscharakter. Bevor wir weiterreichende Schlüsse hieraus ziehen, werden wir unsere Befunde an den Konzeptionen der Umkehr zum Guten prüfen. 4.4 Die Umkehr zum Guten Für Kant besteht das Böse im Verderben des subjektiven Grundes zur Annahme der Maximen. Wenn dieser subjektive Grund, als Resultat einer Tat „außerhalb“ aller Zeit, 46 verdorben ist, wie kann der Mensch sich dann in der Zeit wieder zum Guten wenden? Diese Frage scheint Kant fast zur Verzweiflung gebracht zu haben: Wie es nun möglich sei, daß ein natürlicherweise böser Mensch sich selbst zum guten Mensch mache, das übersteigt alle unsere Begriffe; denn wie kann ein böser Baum gute Früchte bringen? (RGV, S. 49 f.) Dennoch: Der kantische Schlachtruf „Du kannst, denn du sollst!“ gilt auch hier. Wenn es unsere Pflicht ist, uns zum Guten zu wenden, muss es uns auch möglich sein; denn die Idee, dass uns eine prinzipiell unausführbare Pflicht auferlegt wäre, ist widersinnig. Der Schlachtruf gilt aber nur dann, wenn auch in der bösesten Person noch ein Keim des Guten – in der Form des sittlichen Gesetzes – aufbewahrt geblieben ist. Diese Bedingung ist garantiert, denn das moralische Gesetz „dringt sich“, als Faktum der Vernunft, auch dem ärgsten Menschen „unwiderstehlich auf“. (RGV, S. 33) Das Böse besteht darum laut Kant, wie wir wissen, nicht in der Abwesenheit des moralischen Gesetzes, sondern in der Affirmation der Triebfeder der Sinnlichkeit als Bedingung der Befolgung des moralischen Gesetzes. Vermöge des Schlachtrufs des „Du kannst, denn du sollst!“ ist es Kant möglich, die Umkehr zum Guten als Entschluss des Menschen – und zwar als einen moralischen – zu fassen: [...] wenn er den obersten Grund seiner Maximen, wodurch er ein böser Mensch war, durch eine einzige unwandelbare Entschließung umkehrt (und hiermit einen neuen Menschen anzieht): so ist er sofern, dem Prinzip und Denkungsart nach, eine fürs Gute empfängliches Subjekt; aber nur in kontinuierlichem Wirken und Werden ein Guter Mensch. (RGV, S. 54 f.) Wir sehen hier schon den Unterschied zwischen der Revolution des moralischen Prinzips, die der Mensch „durch eigene Kräfte [...] zu Stande bring[t]“ (RGV, S. 54) und der Reform der „Faktizität“, für die der Mensch auf Hoffnung angewiesen ist. Es genügt jedoch, wenn wir einsehen, dass Kant die Umkehr zum Guten als moralischen Entschluss des Menschen begreift. Da die Umkehr zum Guten eine Umkehrung des obersten subjektiven Grundes enthält, geht es hier, Kant zufolge, um nichts weniger als „eine Art von Wiedergeburt, gleich als [...] eine neue Schöpfung“. (RGV, S. 99) Der Mensch wird jedoch nur „moralisch ein anderer“. (RGV, S. 99) Die Art von Wiedergeburt, um die es hier geht, ist also eine moralische. Die ontologische Kategorie der Schöpfung wird hier nur als Gleichnis – „gleich als“ – angeführt. Zusammenfassend 47 können wir sagen, dass Kant die Umkehr zum Guten in einem moralischen Kontext als Entschluss des Menschen fasst. Für Schelling besteht das Böse in der Verabsolutierung des Partikularwillens. Die Umkehr zum Guten ist dem Menschen laut Schelling nicht aufgrund eines autonomen Entschlusses, sondern nur mit „menschliche[r] oder göttliche[r] Hilfe“ (WF, S. 389) möglich. Dies scheint gerade die Verantwortung des Menschen für die Umkehr zum Guten unmöglich zu machen; der Mensch bewirkt diese Wende nicht ganz selber. Die menschliche Verantwortlichkeit für die Umkehr zum Guten wird jedoch nicht aufgehoben, denn „eben das In-sich-handeln-Lassen des Guten Prinzips ist die Folge der intelligiblen Tat“. (WF, S. 389) Es geht darum, sich dem guten Prinzip zu öffnen. Die intelligible Tat wird von Schelling nicht, wie bei Kant, als ein aktiver und selbstischer Entschluss des Menschen, sondern exzentrisch, d. h. als ein „In-sich-handelnLassen“ des Universalwillens verstanden. Dieses Lassen ist zwar im Vollzug der Wende passiv, aber in deren Vorbereitung aktiv. Die Verantwortung des Menschen liegt dann auch nicht im Vollzug, sondern in der Vorbereitung der Umkehr. Dies bedeutet jedoch keinen Schritt jenseits des Autonomiegedankens. Der Mensch muss sich nämlich nicht einer fremden Macht, sondern vielmehr der „innere[n] Stimme seines eignen, in Bezug auf ihn, wie er jetzt ist, besseren Wesens“ eröffnen. (Ebd.) Schelling verlässt den Rahmen des modernen Autonomiegedankens nicht, sondern dezentralisiert diesen vielmehr. Da auch laut Schelling im bösen Menschen das gute Prinzip nicht „völlig erstorben“ ist (ebd.), ist es eine nicht umgehbare Aufgabe für den Menschen, sich seinem eigentlichen Selbst zu öffnen.5 Wir haben schon gesehen, dass die Krankheit eine „Krankheit zum Tode“ ist, demzufolge der zum Allwillen erhobene Wille des Organs letztendlich nicht nur den Organismus, sondern auch sich selbst vernichtet. Das Böse fällt also der Logik der hybris (des Übermuts) anheim, durch die er mit seinem Streben „alles zu sein, ins Nichtsein fällt“. (WF, S. 391) Erst dann entsteht die Möglichkeit einer Umkehr zum Guten. Worin besteht aber diese Umkehr? Ich lasse kurz Schelling zu Wort kommen: 5 Wenn man Schelling eine fatalistische Position zuschreibt, muss man auch die Möglichkeit einer Umkehr zum Guten leugnen. Hermanni konkludiert, dass Schelling die Umkehr zum Guten zuletzt unmöglich macht, weil er die Selbstbesserung in die intelligible Tat zurückverlegt. (Hermanni 1994, S. 154 f.) Das ist jedoch nur problematisch, wenn man die intelligible Tat als eine Entscheidung zum Bösen, die „ein für allemal“ vollzogen worden ist, interpretiert. (Ebd. S. 147) Schulte (1988) ist so sehr von der Wahrheit seiner fatalistischen Interpretation überzeugt, dass er völlig die Tatsache vernachlässigt, dass Schelling die Umkehr zum Guten zur Sprache bringt. 48 [...] das wahre Gute [kann] nur durch eine göttliche Magie bewirkt werden [...], nämlich durch die unmittelbare Gegenwart des Seienden im Bewußtsein und der Erkenntnis. (WF, S. 391) Es ist offensichtlich eine göttliche Hilfe, welcher der Mensch zur Umkehr zum Guten bedarf. Worin besteht aber diese Hilfe? Warum spricht Schelling hier von einer „unmittelbaren Gegenwart des Seienden im Bewußtsein“? Zuerst soll bemerkt werden, dass diese „unmittelbare Gegenwart des Seienden im Bewußtsein“ nicht als die absolute Alleinherrschaft des Universalwillens, sondern als das richtige Verhältnis zwischen dem Universal- und dem Partikularwillen verstanden werden muss. Die Terminologie Schellings ist hier offensichtlich vom Deutschen Idealismus geprägt. Versuchen wir es in einer Terminologie auszudrücken, die dem Deutschen Idealismus zunächst fremd ist. Zuerst eine kleine Vorbereitung: Das Böse ist die auf falsche Imagination gründende Affirmation des dunklen Prinzips – das seinem Wesen nach Potenz oder (noch) nicht „ist“ – als seiend. Das Böse ist die Affirmation des Nichts als das All. Nachdem das Böse der Logik der hybris anheimgefallen ist, gibt es die Möglichkeit eines Geschehens, worin das eigentlich Seiende zu einer unmittelbaren Gegenwart im Bewusstsein gelangt. Von der Seite des Menschen gesehen führt dieses Geschehen zu der unmittelbaren Erfahrung, dass überhaupt Seiendes ist und nicht vielmehr nichts. Anders gesagt, die Umkehr zum Guten ist bei Schelling eine durch die exzentrische Tat des Menschen ermöglichte Seinserfahrung, in welcher die Welt sich dem Menschen als verwirklichte Freiheit öffnet. Die Umkehr zum Guten wird von Schelling nicht – wie bei Kant – in einem moralischen Kontext, sondern in einem ontologischen Kontext aufgefasst. 4.5 Handeln und sein: Moralität und Ontologie Welche Schlüsse können wir aus unserer Darstellung der Konzeptionen des Bösen und der Umkehr zum Guten ziehen? Welche Konzeptionen der Freiheit folgen daraus? Sowohl Kant als auch Schelling erkennen eine Freiheit als Selbstbestimmung an, welche der Handlungsfreiheit zugrunde liegen muss. Kant zufolge muss die intelligible Tat ausschließlich nach moralischen Maßstäben beurteilt werden; er fasst sie in einem moralischen Kontext auf. Kraft dieser intelligiblen Tat hat der Mensch nicht nur die Freiheit zu tun, sondern auch die Freiheit zu „sein“, d. h. nicht nur die Verantwortung für das, was er tut, sondern auch für das, was er „ist“. Das Verb „sein“ darf hier aber nur im abgeleiteten Sinne verstanden werden; denn dass der Mensch die Verantwortung hat 49 für das, was er ist, heißt, dass es ihm immer möglich und damit auch als Pflicht auferlegt ist, selbst seine moralische Gesinnung zu bestimmen. Erst bei Schelling ist in der Behauptung, dass der Mensch nicht nur verantwortlich ist für das, was er tut, sondern auch für das, was er ist, das Verb „sein“ in seinem eigentlichen Sinne angesprochen. Die Freiheit als Selbstbestimmung wird von Schelling nicht nur im Rahmen der Moralität, sondern zugleich auch im Rahmen der Ontologie begriffen. Demnach können wir diese Art von Freiheit eine ontologische Freiheit nennen. Diese Verantwortlichkeit für das Sein ist nicht auf das Sein des Individuums beschränkt, sondern umfasst auch das Sein im Allgemeinen, denn die beiden Seinsprinzipien, deren harmonische Einheit bzw. Verkehrung in den Händen des Menschen liegt, gehen über das individuelle Dasein des einzelnen Menschen hinaus. Es ist bei Schelling also der Mensch, der verantwortlich für die Schöpfung ist. Diese Freiheit zur Bestimmung des Seins darf aber nicht als „Herrschaft über das Seiende“ verstanden werden, denn die ontologische Freiheit des Menschen ist exzentrisch: Es ist ein Vermögen das Seiende oder die Freiheit sein zu lassen. Es mag nun scheinen, als würde Schelling die Freiheit als Selbstbestimmung, indem er sie in einem ontologischen Kontext versteht, zu einer Kategorie des Handelns herabsetzen, die nicht für eine moralische Beurteilung in den Betracht kommt. Wenn wir aber den Schluss ziehen, dass Schelling die freie Selbstbestimmung a-moralisch begreift, vergessen wir, was Schelling unter „Sein“ versteht. Das Sein ist laut Schelling nämlich nicht die beharrende und unveränderliche Substanz; vielmehr ist die Freiheit das Prinzip des Seins: „Wollen ist Ursein“. Schelling beurteilt die intelligible Tat demnach weder nach bloß ontologischen, noch nach bloß moralischen Maßstäben; vielmehr geht sie für ihn dem Unterschied zwischen Ontologie und Moralität in engerem Sinne voran. 50 Schluss Die Frage nach dem Bösen ist anhand zwei moralischer Deutungsansätze beantwortet worden. Ein moralischer Deutungsversuch des Bösen stellt sich zuerst die Frage, wie der Mensch für das Böse verantwortlich gehalten werden kann. Die Frage nach dem Bösen wird im Kontext der Problematik der Verwirklichung der Freiheit, d. h. der Verknüpfung vom „an sich“ der Freiheit mit der phänomenalen Welt, angesetzt. Als solche bildet sie nicht bloß ein Teilproblem der kantischen Philosophie; vielmehr liegt sie in deren Herzen. Das Böse vermag zu erklären, warum die Freiheit, wenn sie wirklich sein muss, dies in vielen Fällen nicht ist. Als Grund des Bösen ist vorerst der universell menschliche Hang zum Bösen in der menschlichen Natur angewiesen. Dieser Hang kann nicht a priori aus dem Sittengesetz deduziert werden. Um beweisen zu können, dass der Mensch von Natur aus böse ist, braucht man einen minimalen Verweis auf die Empirie. Der Beweis des Hanges zum Bösen hat die Form einer systematischen Rekonstruktion auf Basis konkreter Handlungen. Die These der bösen Beschaffenheit der menschlichen Natur hat eine kritische Funktion, denn nur kraft ihr ist es möglich, den Selbstbetrug des Menschen zu entlarven. Als solche tritt sie dem Prozess einer „Legalisierung der Moral“ entgegen. Das Böse muss, wenn es moralisch böse sein soll, letztlich auf die menschliche Freiheit zurückgeführt werden können. Die systematische Rekonstruktion führt dementsprechend zu einer intelligiblen Tat des Menschen als letztem Grund des Bösen. Nach der intelligiblen Tat trägt der Mensch nicht nur die Verantwortung für das, was er tut, sondern auch für das, was er ist. Es ist gerade die Reflexion auf das Böse, die uns befähigt, diese Freiheit als Selbstbestimmung herauszugreifen. Dieser reelle Freiheitsbegriff – d. h. Selbstbestimmung des Wesens – dient jedoch dem formellen – d. h. der Autonomie des Handelns – nicht zum Ersatz; vielmehr muss angenommen werden, dass sie einander gegenseitig ergänzen. Der Systemansatz des Deutschen Idealismus knüpft an der Problematik der Verwirklichung der Freiheit an. Schelling hat sich in der Freiheitsschrift zum Ziel gesetzt, das „formelle“ System des Idealismus zu einem „real-idealistischen“ System zu komplettieren. Um sein „Real-Idealismus“ artikulieren zu können, greift er die kantische Analyse des Bösen aus der Religionsschrift auf. Schellings Untersuchung hat die Einsicht zum Ergebnis, dass ein genuiner Systemansatz es nicht bei der formellen 51 Deduktion der Wirklichkeit der Freiheit bewenden lassen darf, sondern auch umgekehrt die Freiheit auf Basis der Wirklichkeit zu rekonstruieren versuchen muss. Die Freiheitsschrift Schellings kann nur vor dem Hintergrund der Religionsschrift Kants verständlich gemacht werden. Die Vorwürfe, die Schelling in der Sekundärliteratur gemacht werden, fußen auf dem Unvermögen der Autoren, um den rekonstruktiven Charakter des Arguments Schellings einsehen zu können. Schellings „Lehre“ von der intelligiblen Tat ist kein metaphysischer Lehrsatz, sondern das Ergebnis einer systematischen Rekonstruktion. Die Annahme einer Sinnkontinuität zwischen den von Kant unterschiedenen Triebfedern des Sittengesetzes und der Selbstliebe einerseits und den von Schelling unterschiedenen Universal- und Partikularwillen andererseits, ermöglicht es, nicht nur den Schellingschen Begriff des Bösen, sondern auch seine Idee einer Umkehr zum Guten auf kohärenter Weise darzustellen. Mittels der Darstellung ihren unterschiedlichen Auffassungen des Bösen und der Umkehr zum Guten ist es möglich, die Differenz der Freiheitsbegriffe Kants und Schellings herauszustreichen. Während Kant konsequent seine „Zwei-PerspektivenLehre“ hantiert und der Freiheit als Selbstbestimmung nur eine moralische Relevanz zuspricht, gewinnt dieser Freiheitsbegriff bei Schelling zugleich eine ontologische Bedeutung. Kant und Schelling konfrontieren uns mit einem unbequemen Satz: Der Mensch ist böse. Sprechen sie damit einen Fluch über den Menschen aus? Diese Arbeit hat sich auf die positiven Möglichkeiten, die ein solcher Satz eröffnet, konzentriert. Dies jedoch nicht mit der Absicht, die Schrecklichkeit des Bösen zu leugnen: Das Böse ist kein Segen. Nur ein Ding ist sicher: Der Weg zum Guten öffnet sich nur demjenigen, der die Bereitschaft hat, seine eigene Bosheit anzuerkennen. 52 Literaturliste ALLISON, H. (1990) Kant's Theory of Freedom, Cambridge, Cambridge University Press. ALLISON, H. (2002) On the Very Idea of a Propensity to Evil. The Journal of Value Inquiry, 36, 337 - 348. BROWN (1977) The later Philosophy of Schelling, Lewisburg, Bucknell University Press. CASWELL, M. (2006) Kant's Conception of the Highest Good, the Gesinnung, and the Theory of Radical Evil. Kant-Studien, 97, 184 - 209. FUHRMANS, H. (1954) Die Philosophie der Weltalter. Studia Philosophica, 14, 162 178. GEIJSEN, L. (2009) "Mitt-Wissenschaft", Freiburg, Alber. HENNIGFELD, J. (2001) F.W.J. Schellings "Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit”, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft. HERMANNI, F. (1994) Die letzte Entlastung, Wien, Passagen Verlag. HÜHN, L. (1998) Die intelligible Tat. IN IBER, C. (Hrsg.) Selbstbesinnung der philosophischen Moderne. Cuxhaven, Junghans. IBER, C. (2004) Prinzipien von Personalität in Schellings "Freiheitsschrift". IN BUCHHEIM, T. (Ed.) "Alle Persönlichkeit ruht auf einem dunklen Grunde". Berlin, Akademie Verlag. KANT, I. (1907) Metaphysik der Sitten. Kants Werke VI. Berlin, Reiner. KANT, I. (1998) Kritik der reinen Vernunft, Hamburg, Meiner. KANT, I. (1999) Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Hamburg, Meiner. KANT, I. (2003) Kritik der praktischen Vernunft, Hamburg, Meiner. KANT, I. (2003) Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, Hamburg, Meiner. KIERKEGAARD, S. (2005) Furcht und Zittern, München, Deutscher Taschenbuch Verlag. PEETZ, S. (1995) Die Freiheit im Wissen, Frankfurt am Main, Klostermann. PRAUSS, G. (1982) Kant über Freiheit und Autonomie, Frankfurt am Main, Klostermann. SCHELLING, F. (1993) Die Weltalter. Schellings Werke VIII. München, Beck. SCHELLING, F. (2008) Über das Wesen der menschlichen Freiheit, Stuttgart, Reclam. SCHMIDT-BIGGEMANN, W. (2002) Schelling "Weltalter" in der Tradition abendländischer Spiritualität. IN GROTSCH, K. (Hrsg.) Weltalter-Fragmente. Stuttgart, Frommann. SCHULTE, C. (1988) Radikal Böse, München, Fink. 53 THEUNISSEN, M. (1965) Schellings anthropologischer Ansatz. Archiv für Geschichte der Philosophie, 47, 174 - 189. WOOD, A. (1970) Kant's Moral Religion, Ithaca, Cornell University Press. WOOD, A. (1999) Kant's Ethical Thought, Cambridge, Cambridge University Press. 54