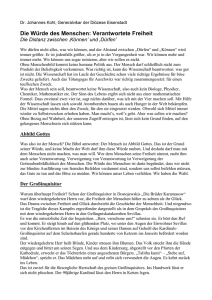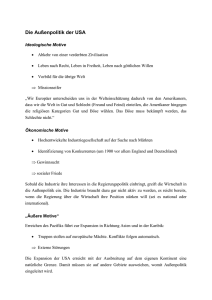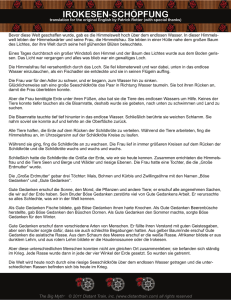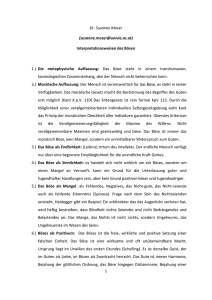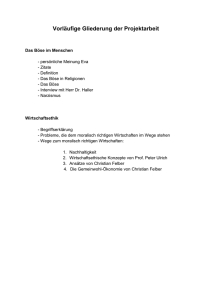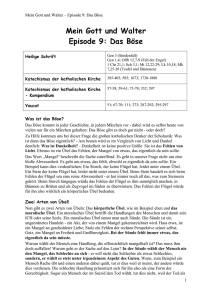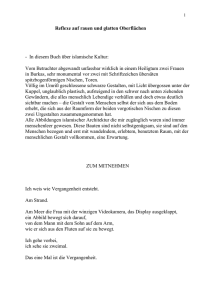Die Banalität des Guten Beobachtungen und Gedanken eines
Werbung

IZPP. Ausgabe 1/2009. Themenschwerpunkt „Gut und Böse“. Udo Röser, Die Banalität des Guten ISSN: 1869-6880 IZPP | Ausgabe 1/2009 | Themenschwerpunkt „Gut und Böse“ Die Banalität des Guten Beobachtungen und Gedanken eines Psychotherapeuten zur alltäglichen Arbeit mit Drogenabhängigen Udo Röser Zusammenfassung Therapeutisches Arbeiten mit Drogenabhängigen orientiert sich an Leistungsvereinbarungen, die unter dem Primat von Effizienz und Evidenz stehen. Ethische Orientierung bieten die Leitlinien und Leitbilder der Verbände und Institutionen, die die Arbeit mit drogengefährdeten und drogenabhängigen Menschen zu ihren zentralen Aufgaben zählen. In diesem Beitrag werden stationäre drogentherapeutische Alltagsphänomene von „gut“ und „böse“ aufgegriffen und in einen theoretischen Kontext gestellt. Diese Phänomene sind in ihrer Wirkung, insbesondere für teamorientierte Behandlungen, von nicht zu unterschätzender Relevanz. Schlüsselwörter Triebverzicht, Selbstregulierung, Emotional instabile Persönlichkeit, Humanistische Psychologie, Ethik der Liebe. Abstract Therapeutic work with drug addicts is based on service agreements, which are under the primacy of efficiency and evidence. Ethical Guidelines provide guidelines and mission statements of organizations and institutions, which define the work with drug abusing and drug addicted persons as their central mission. In this paper, everyday phenomena in stationary therapeutic work with drug addicts are taken up by „good“ and „evil“ and placed in a theoretical context. These phenomena are in their effect, especially for team-oriented treatments, of considerable relevance. Keywords Drive renunciation, self-regulation, emotional instable personality, humanistic psychology, ethic of love. „Man nehme was man will: Gott, Natur, Wahrheit, Wissenschaft, Technologie, Moral, Liebe, Ehe – die Moderne verwandelt alles in „riskante Freiheiten“. Alle Metaphysik, alle Transzendenz, alle Notwendigkeit und Sicherheit wird durch Artistik ersetzt. Wir werden, im Allgemeinsten und im Privatesten zu Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos. Und viele stürzen ab.“ (Beck & Beck-Gernsheim, 1994) Einleitung Normative Bewertungen im Sinne von gut und böse sind keine fachlichen Behandlungskriterien für die therapeutischen Arbeit mit drogenabhängigen Menschen. Grundlage ist ein Krankheitsverständnis, das die für eine gesunde und sozialverträgliche Lebensführung nicht ausreichende biopsychosoziale Funktionsfähigkeit 1 IZPP. Ausgabe 1/2009. Themenschwerpunkt „Gut und Böse“. Udo Röser, Die Banalität des Guten in den Blick nimmt. Trotzdem bestimmen alltags- und umgangssprachliche Selbst- oder Fremdzuweisungen von gut und böse den Verlauf und damit auch den Erfolg therapeutischen Handelns. Anliegen dieses Beitrages ist es Alltagsphänomene, die jedem klinisch praktizierenden Therapeuten aus der Arbeit mit drogenabhängigen Patientinnen und Patienten vertraut sein dürften, in den Blick zu nehmen und unter dem Gesichtspunkt des „Guten“ und „Bösen“ zu beleuchten. Die Auswahl ist subjektiv und bezieht sich auf Phänomene, die den Autor immer wieder gedanklich und auch emotional beschäftigen. Diese Beschäftigung geht über die in wissenschaftliche Begrifflichkeit gegossene wertfreie ICD Nomenklatur hinaus, ebenso wie über die behandlungstauglichen standardisierten und evidenzbasierten Therapiemanuale. Es sind Phänomene, die etwas mit „gut“ und „richtig“ und mit „falsch“ und „böse“ zu tun haben. Natürlich bin auch ich, neben aller fachlicher Haltung und Orientierung, ein innerer Bewerter. Treffe Entscheidungen, die für Patienten weitreichende lebensbestimmende und auch lebenseinschränkende Konsequenzen haben. Sehe mich täglich mit einer Welt konfrontiert, die mir selbst innerlich fremd ist. Ich habe nie Heroin, Kokain, Amphetamine usw. konsumiert, führe somit ein „cleanes“ Leben. Oft habe ich durchgespielt, was wäre eigentlich meine Droge? Welche dieser verheißungsvollen Verlockungen würde mich inspirieren, beflügeln, meinen Geist erweitern, mir Erfahrungen, Erkenntnisse, Ekstase, Lust und Freuden verschaffen, die sich aus dem und im „normalen“ Leben nicht erschließen? So sei mir erlaubt für einen Moment über all die mit der Drogensucht einhergehenden malignen Folgeerscheinungen hinwegzusehen und eine Gegenüberstellung einer drogenfreien mit einer drogenbezogenen Welt zu wagen. Hannah Arendt hat in der Beobachtung des Eichmann Prozesses in Jerusalem das berühmte Diktum der Banalität der Bösen geprägt, da ihr in Adolf Eichmann nicht eine Fratze des Bösen begegnete, sondern ein Mann, der sich durch seine scheinbare Gedankenlosigkeit auszeichnete. Blickt man mit den Augen eines Drogensüchtigen auf ein Leben ohne Drogen, so taucht eine Welt ohne besondere Anreize und Verlockungen auf. Es dominiert die Banalität des Guten. Klinische Phänomene I Eine der Standardfragen im Rahmen einer Informationsgruppe für Patientinnen und Patienten einer Facheinrichtung zur Behandlung drogenabhängiger Menschen ist die nach dem Eigenerleben des „Cleanseins“. Die Frage wird, auch im Angesicht der Autorität des Fragestellers, in der Regel mit „ganz gut“ beantwortet. Als Begründung wird zumeist angeführt, dass der permanente Druck sich Geld und Drogen beschaffen zu müssen nun aufgehört habe und dass es Zeit sei, seinem Leben eine andere Richtung zu geben. Letztgenannte Antwort kommt häufig von den Personen, die schon auf eine lange Lebenszeit mit Drogen und den damit verbundenen multiplen Folgeerscheinungen zurückblicken. Stellt man die Frage in die Runde, was denn eigentlich das Besondere und „Gute“ an Drogen und einem Leben in einem doch meist kriminellen Umfeld sei, ist gruppendynamisch ein interessantes Phänomen zu beobachten. In die Gruppe kommt sofort mehr Bewegung, sie wird lebhafter, manche richten sich im Stuhl auf, die Augen beginnen zu blitzen. „Der Reiz, der Kitzel, das Kribbeln, der Kick“, all dies sei etwas besonderes, einmaliges, mit nichts anderem zu vergleichen. Die daran anschließende Frage, und was sei denn nun das „Gute“ an einem Leben ohne Drogen, verändert die wahrnehmbare Stimmung wiederum. Die Energie sackt ab, Schweigen breitet sich aus. „Tja, das sei schon auch ganz gut, man könne sein Leben wieder ordnen, spüre sich wieder mehr mit klarem Kopf, könne etwas für die Wiederherstellung seiner Gesundheit tun, die Beziehung zu Eltern oder Kindern wieder neu beleben“. Die Fragezeichen hinter diesen Antworten schwingen unausgesprochen mit. Sehr überzeugend und „reizvoll“ klingen diese Antworten nicht. Ist ein „normales“ Leben wirklich so banal? Die Lust auf ein Leben ohne Drogen gilt es erst zu wecken. 2 IZPP. Ausgabe 1/2009. Themenschwerpunkt „Gut und Böse“. Udo Röser, Die Banalität des Guten Theoretischer Exkurs I Jede Gesellschaft ist aufgefordert sich zu den jeweiligen von ihr wahrgenommenen „Übeln“ zu verhalten. So auch die westlichen Gesellschaften gegenüber dem epidemiologischen Problem der Sucht. Eine Schwierigkeit dieser gesellschaftlichen Standortbestimmung besteht darin, dass sich die den westlichen Lebensstil bestimmenden „Güter“ fast alle zum Suchtmittel eignen. Die Schattenseite der Wohlstandsgesellschaft zeigt sich u.a. in der hohen Anzahl Alkohol-, Medikamenten- und Drogenabhängiger Menschen1, die ergänzt werden um den Anteil der Personen, die nicht-substanzbezogenen Süchten verfallen sind. Das triebhafte und bedürfnisorientierte Streben nach Genuss, Lust und Befriedigung findet seine Grenze in einer allmählich beginnenden Abhängigkeit, die in einen selbst- und fremdzerstörerischen Prozess übergeht (Abhängigkeitssyndrom, ICD 10, F10.2 – F19.2). Die jedem Menschen vorgegebene Aufgabe, einen gesunden Umgang mit Genussmitteln zu erlernen, beruht auf einer gesellschaftlich-kulturellen Übereinkunft: und der impliziten definitorischen Macht Erlaubtes und nicht Erlaubtes festzulegen. Dieser „Kulturvertrag“ basiert auf dem Wissen und der Erfahrung des Menschen als eines triebhaften Wesens, dessen Begehren nach Lust, Genuss und Sinnenfreude in einem „guten“, Selbstund Fremdschaden vermeidenden Sinne geformt und gebildet werden muss. Die Triebhaftigkeit des Menschen, sein Streben nach Selbst- und Arterhaltung, führt zu der immer wieder aufkehrenden Frage, ob der Mensch nun per se „gut“ oder „böse“ sei. Die Antworten sind vielfältig und sollen hier nicht nacherzählt und eingeordnet werden. Bis auf eine, da diese das neuzeitliche Denken nachhaltig geprägt hat. Es geht um die anthropologische Perspektive Freuds, der ausgehend von der Energie trieborientierter Anschubkräfte die regulative Aufgabe des Menschen darin sieht, individuelles und soziales Miteinander in Einklang zu bringen. Die Freudsche Genese der Menschheitsgeschichte beginnt wie in der Bibel mit einem Sündenfall. In grauen Vorzeiten sieht Freud eine Urhorde am Werk, die ihre Aggressionen nicht regulieren, kontrollieren und unterdrücken konnte, sondern auslebte. Es regiert ein Urpatriarch, der seinen Herrschaftsanspruch aus einem sexuellen Ausschließlichkeitsmonopol ableitet. Die Söhne töten den Urvater, um Zugang zu den Frauen zu erhalten und die Macht, um die sie ihn beneiden, selbst ausüben zu können: Eines Tages taten sich die ausgetriebenen Brüder zusammen, erschlugen und verzehrten den Vater und machten so der Vaterhorde ein Ende. Vereint wagten sie und brachten zustande, was dem einzelnen unmöglich geblieben wäre. (Freud, 1956, 158f, zit. n. Pieper, 2008, 34) Freud benutzt diesen „Sündenfall“, um neben dem Ödipuskomplex eine weitere Genese des „Über-Ichs“ einzuführen. Das triebhafte Geschehen bedarf einer regulierenden Instanz, das dem Treiben der dem „Es“ verhafteten Urhorde Einhalt gebietet. Freud erzählt die Geschichte so weiter, dass die Söhne ihre Tat bereuen und sich schuldig bekennen. ...nachdem der Haß durch die Aggression befriedigt war, kam in der Reue über die Tat die Liebe zum Vorschein, richtete durch Identifizierung mit dem Vater das Über-Ich auf, gab ihm die Macht des Vaters wie zur Bestrafung für die gegen ihn verübte Tat der Aggression, schuf die Einschränkungen, die eine Wiederholung der Tat verhüten sollten. (Freud, 1956, 174, zit. n. Pieper, 2008, 35) 3 IZPP. Ausgabe 1/2009. Themenschwerpunkt „Gut und Böse“. Udo Röser, Die Banalität des Guten So geht aus einer Horde narzisstischer Wesen eine soziale Gemeinschaft hervor, „die ihre Interaktionen einvernehmlich nach für alle in gleicher Weise gültigen Prinzipien regelt, um zu verhindern, dass das Verbrechen, mit dem das Böse in die Welt kam, sich wiederholt“ (Pieper, 2008, 35). Lust, Sexualität, Neid, Aggression, Scham, Schuld, all diese trieb- , impuls- und sozialorientierten Grundbefindlichkeiten menschlichen Seins bedürfen einer regulierenden Instanz, die, so Freud, den Menschen vor sich selbst schützen. Für den Einzelnen bedeutet dies (Trieb-)Verzicht zu lernen und sich in Gemeinschaft einzubinden. Das primärnarzisstische Begehren, jegliche Lust voll und ganz und um jeden Preis befriedigen zu wollen, stößt auf die natürliche Grenze des Miteinander. Wollte jeder das Gleiche, ewiger Krieg wäre die Folge. So geht es um ein Lernen von Einschränkung und Regulation. Für sich selbst und für das soziale Miteinander. Primäres Anliegen ist es, den Patienten für innerseelische Vorgänge zu sensibilisieren, das Wahrnehmen von Triebbedürfnissen zu thematisieren sowie daraus sich ergebende dys­funktionale Selbststeuerungsvorgänge zu reflektieren und adäquates Selbstregulierungsver­halten zu erproben. Umfassendes Ziel ist es, Zusammenhänge zu selbstschädigendem suchtbezogenen Erleben und Verhalten aufzuzeigen. (Textbaustein eines Therapieberichtes über einen drogenabhängigen Patienten) Klinische Phänomene II „Du bist böse“! So eine Mutter zu ihrem dreijährigen Kind, mit dem sie sich zur Behandlung ihrer Drogenabhängigkeit und weiterer psychischer Probleme in einer stationären Einrichtung befindet. Und noch einmal, mit erregter lauter Stimme auf das Kind einredend: „Du bist böse“. „Das machst Du alles mit Absicht“. Das Kind schaut mit großen, weit geöffneten Augen zu seiner Mutter empor, die sich nicht beruhigen kann. Erst das massive Eintreten einer Mitarbeiterin, die Mutter und Kind trennt, kann diese unheilvolle Situation auflösen. Nach einer Weile hat sich die Mutter beruhigt. Die Einstellung bleibt. Das Kind sei böse, das mache es mit Absicht, um sie zu ärgern, sie zu reizen, sie zu treffen. Hintergrund des Geschehens war, dass das Kind nicht in seinem Zimmer bleiben wollte, sondern die Nähe der Mutter suchte. Es war Mittagszeit, Zeit für den Mittagsschlaf. Die Mutter brachte das Kind in sein Zimmer und forderte es auf zu schlafen. Dieses stand aber immer wieder auf, verliess das Zimmer und suchte die Mutter. Die Mutter wollte in Ruhe eine Zigarette rauchen. Das Kind ließ das nicht zu. Dies hatte die Explosion zur Folge. Theoretischer Exkurs II Ist diese Mutter „böse“? Diese so banal und unsinnig klingende Frage soll unter drei Gesichtspunkten diskutiert werden: Zunächst aus der Perspektive der Patientin, dann aus fachlicher Perspektive und abschließend aus dem Blickwinkel des Beziehungsgeschehens. 1. Einer Patientengruppe drogenabhängiger Eltern und Nicht-Eltern wird dieses Beispiel im Rahmen eines Elterntrainings vorgestellt und die oben benannte Frage gestellt. Die Antwort ist eindeutig. Mehrheitlich werden sowohl Mutter als auch Kind als „böse“ gesehen und bewertet. Warum? „Weil das Kind nicht hört und 4 IZPP. Ausgabe 1/2009. Themenschwerpunkt „Gut und Böse“. Udo Röser, Die Banalität des Guten folgt“ und weil die Mutter so etwas nicht sagen darf. „Das sei genauso schlimm wie Schlagen“. „Das macht man nicht“. Von den Gruppenteilnehmern nicht ausgesprochen wird, dass das geschilderte Beispiel Angst macht. Die Mitglieder dieser Patientengruppe wissen, dass ihnen ähnliches widerfahren kann. Dass sie ihre Impulse nicht immer kontrollieren und in einem gesunden Sinne regulieren können. Daraus resultieren Rückfälle, Aggressionen, Selbst- und Fremdverletzungen, Resignation, Suizidgedanken. Eine normative Orientierung kann von den Teilnehmern dieser Gruppe benannt werden. Das Sollen, das ge- und erwünschte Verhalten ist bekannt. Das Problem besteht im Umgang mit dem Erleben, mit Stimmungen, Gefühlen, Affekten. Diese werden wie eine Bedrohung wahrgenommen, abgelehnt, abgespalten, bewertet. Die Bewertung erfolgt infantil simplifizierend. Da dieses Eigenerleben so schwer zu kontrollieren ist und die gesamte Persönlichkeit beeinflusst, wird es dem numinos Dunklen, Unbeeinflussbaren zugerechnet: dem Bösen. Die Schwierigkeit seelisches und körperliches differenziert wahrzunehmen führt zu einer Gleichsetzung von Seele und Körper. Der Körper ist sinnlich wahrnehmbar, begreifbar, sichtbar. So führt die erlebte affektive Überflutung zu einer Störung des Körperbildes. Der Körper wird als bedrohlich und fremd wahrgenommen. Bis hin zu einer Ablehnung jeglicher körperlichen Wahrnehmung, die sich „krank“,“ schmutzig“, „lästig“, „störend“ anfühlt. Die dysfunktionale Reaktion auf dieses Körpererleben ist ein pathogener Kampf: Hungern, Zerstörung, Prostitution, anabolides Aufputschen. 2. Für Fachleute stellt sich die oben benannte Frage, ob diese Mutter „böse“ sei, nicht. Fachlich wird das geschilderte Verhalten einem Störungsbild zugeordnet. „Eine Persönlichkeitsstörung mit deutlicher Tendenz, Impulse ohne Berücksichtigung von Konsequenzen auszudrücken,.....Es besteht eine Neigung zu emotionalen Ausbrüchen und eine Unfähigkeit impulshaftes Verhalten zu kontrollieren“ (Emotional instabile Persönlichkeit, F.60.3, ICD 10). Als weitere Merkmale werden dieser klinischen Klassifizierung Störungen des Selbstbildes, intensive, aber unbeständige Beziehungen und eine Neigung zu selbstdestruktivem Verhalten mit parasuizidalen Handlungen und Suizidversuchen zugeschrieben. Der Mutter, die sich mit ihrem Kind zu Behandlung in der Suchtklinik aufhält, wird neben der Drogenabhängigkeit dieses Störungsbild einer „emotional instabilien Persönlichkeit“ zugeordnet. Sogenannte „Doppeldiagnosen“ sind in der Population Drogenabhängiger ein lange bekanntes Phänomen. Allerdings wurden erst in den letzten Jahren vermehrt Fachkonzepte entwickelt, die kombiniert ambulant-stationäre Konzepte für eine Patientengruppe mit komorbiden Störungen anbieten. Dazu war es notwendig integrierte Therapiekonzepte zu entwickeln, die Ansätze der Suchthilfe mit Angeboten für psychisch Kranke zusammenfügen (Eirund, 2006). Die Behandlung wird neben der psychotherapeutisch-beziehungsorientierten Therapie medikamentös unterstützt, beinhaltet die Teilnahme an Psychoedukations- und Skillsgruppen und beauftragt die Patientin mit Hilfe eines Tages- und Wochenplanes, Krisenverläufe sowie Wahrnehmungen von Krisenbewältigung im Sinne der Schulung selbstregulatorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten tabellarisch zu bewerten. Die Zuweisung des „Bösen“ sowie die situative Fixierung der Mutter auf ihr „böses“ Kind werden im Rahmen therapeutischer Einzelgespräche thematisiert. Die Patientin erkennt, dass dieses Erleben eng mit ihren inneren 5 IZPP. Ausgabe 1/2009. Themenschwerpunkt „Gut und Böse“. Udo Röser, Die Banalität des Guten Spannungszuständen und Stresserleben zusammenhängt. Steigt das innere Erleben von Spannung und Druck, verengt sich der Blick nach „außen“. Alles wird bedrohlich, gefährdend. Das „Sich nicht wohl fühlen“ in der eigenen Haut steigert sich zur Projektion der Verachtung und des Hasses auf alles. Auf sich selbst (ihren Körper), auf ihr Kind sowie die nächste Umgebung (Therapeuten, Einrichtung). Diese Krise wird zur existentiellen Lebens-Not. Der Druck muss sich lösen. Die bisher erlernten dysregulatorischen Lösungen sind: Drogen, Selbstverletzungen durch „Schneiden mit dem Messer“, Suizidversuche. Therapie bedeutet in diesen Fällen auch klare Grenzen sowie die damit verbundenen Konsequenzen bei Selbst- und Fremdschädigung festzulegen. Ziel dieser Vereinbarungen ist die Orientierung an Maßnahmen, die salutogene Perspektiven aufzeigen. Greifen diese nicht, können Eingriffe wie Zwangseinweisung oder Inobhutnahme der Kinder erforderlich werden. 3. Rückt man das intersubjektive Beziehungsgeschehen in den Fokus der Betrachtung, so erweitert sich die Diskussion um einen weiteren interessanten Aspekt. Dabei geht es um die Einordnung und Bewertung des Beziehungsgeschehens aus der Sicht der Beobachter. Das in diesem Falle triadische Beziehungsgeschehen umfasst die Akteure Mutter, Kind und (fachlicher) Beobachter. Betrachtet man das Geschehen aus der Perspektive des Kindes so hat der Beobachter zu entscheiden und zu bewerten, inwieweit dieses Geschehen einen nachhaltig schädlichen und schädigenden Einfluss für die kindliche Entwicklung hat.2 Und, daraus folgernd, in welchem Maße das Kind vor der Mutter zu schützen ist. Mit zu berücksichtigen ist, dass die Mutter diesen Vorfall harmlos bewertet. Sie sieht dies als nicht so schlimm an, denn grundsätzlich liebe sie ihr Kind und das sei das wichtigste. So liegt hier ein intersubjektives Geschehen vor, das dem Kind als auch der Mutter, aus Sicht der Beobachter, eine eingeschränkte Handlungsfreiheit unterstellt. Mutter und Kind werden als nicht frei handelnde Subjekte gesehen. Rationale Autonomie, Selbstreflexität und Selbstverantwortung als Grundlage für einen gleichwertigen Diskurs werden in diesem Fall in Frage gestellt. Die Mutter wird als ein handelndes Subjekt gesehen, die zwar ihr Tun zu verantworten hat , aber andererseits in ihrer Verantwortlichkeit, bedingt durch die akute Symptomatik der psychischen Erkrankung, als „eingeschränkt“ Handelnde betrachtet wird. Unabhängig von der juristischen Bewertung eines solchen Vorganges, durchleben Beobachter dieses exemplarischen oder vergleichbarer Geschehen einen inneren Kampf der Prüfung und Bewertung. Die Beobachter, eingebunden in ein therapeutisches Behandlungsteam, ringen jenseits aller fachlichen Standards um eine verantwortliche ethische Positionierung. „Die Verantwortungsethik zielt auf die Verantwortbarkeit der Folgen des Handelns bzw. der Ergebnisse ab.“ (Wikipedia August 2008). Das Kind gilt es zu schützen, der Mutter gilt es zu helfen. Wie lange können Beobachtungen wie die oben geschilderte in einen therapeutischen Behandlungsprozess eingebunden werden, der sowohl Kind als auch Mutter zu „Gute“ kommen. Wann ist der Punkt erreicht, das Kind vor der Mutter zu schützen und es in andere Obhut zu geben? „Diese im engeren Sinn moralische Qualität ist das Ergebnis einer Beurteilung dessen, was der Fall ist, von einem distanznehmenden Standpunkt aus, der es erlaubt, eine schlechthin geglückte Lebensform zu entwerfen, die im Hinblick auf die faktisch bestehenden Verhältnisse als Maßstab fungiert, dem sie entsprechen sollen.“ (Pieper, 2008, 39) 6 IZPP. Ausgabe 1/2009. Themenschwerpunkt „Gut und Böse“. Udo Röser, Die Banalität des Guten Die moralische Qualität, die sich aus der Orientierung an einem „Sollen“ ableitet, führt in dem geschilderten Fall zu einem „Gewissenskonflikt“, dem ich mich ebenso wenig wie die Teamkolleginnen und Teamkollegen entziehen kann. Wann ist der „richtige“ Zeitpunkt gekommen? War es „gut“ zu warten, auf die regulierende Kraft des therapeutischen Prozesses und die Förderung der Selbstheilungskräfte zu vertrauen oder hätten wir alle zum Schutz des Kindes und dessen Wohl schon früher reagieren müssen? Die Antwort auf diese moralischen Implikationen findet sich in Abwägungsprozessen, an dessen Ende immer eine Entscheidung steht. Ob diese „richtig“ und „gut“ oder „falsch“ und „schädigend“ war, dies gilt es vor sich, dem erwachsen gewordenen Kind, der Mutter, den Eltern oder eventuell vor dem Richtertisch zu verantworten. Klinische Phänomene III Ein Patient sucht das Gespräch mit mir: „Herr R., ich muss mit Ihnen reden.“ „Ja?“ „Ich verstehe mich gut mit der Mitpatientin Y.“ „Schön.“ „Ich meine, ich verstehe mich sehr gut mit der Mitpatientin Y.“ „?“ „Wir haben uns näher kennen gelernt.“ „Was verstehen Sie denn unter näher kennen lernen?“ „Tja, wenn Sie es so genau wissen wollen, wir haben miteinander Sex gehabt. Aber mehr ist nicht. Wir lassen es ganz langsam angehen.“ Eine Patientin über ihren ebenfalls drogenabhängigen Ehemann: „Dieser Mann hat mir eine Fahrt in einem Riesenrad geschenkt. Noch nie hat mir, mir ganz allein, jemand etwas geschenkt. Und dann hat er dafür gesorgt, dass das Riesenrad nur für mich gefahren ist, alle anderen mussten aussteigen. Dieser Mann liebt mich und ich liebe ihn. Und jetzt sagen Sie mir, dass das weitere Zusammensein mit diesem Mann für mich gefährdend sei!“ Theoretischer Exkurs III Die geschilderten Beispiele stehen in engem Zusammenhang mit den bisherigen Ausführungen. Zum einen geht es wiederum um ein Triebgeschehen, in diesem Fall die sexuelle Lust. Andererseits um normative Konflikte, die sich aus dem Spannungsbogen subjektiver Bewertungen auf Seiten der Behandler ableiten. Das normative Spektrum triebbezogener Behandlungsregularien reicht vom Verbot intimer und sexueller Beziehungen für den Zeitraum der Behandlung bis hin zu begleitenden therapeutischen Angeboten. Sowohl Exklusion als auch Akzeptanz sehen sich damit allerdings einem lustreglementierenden Kontrollauftrag konfrontiert, der die Grenzen des Zulässigen und die Konsequenzen bei Überschreitung festlegen muss. Den theoretischen Exkurs dieses Abschnittes möchte ich jedoch nicht den therapeutischen Konsequenzen trieborientierten Handelns und der moralischen Qualität Sexualität normierender Maßstäbe widmen, sondern einem Phänomen das neben jeglicher Destruktivität die Möglichkeit der Veränderung zum „Guten“ in sich trägt: Der Liebe. Patienten, die sich verlieben, glauben in einem romantischen Sinne an diese Kraft der Liebe. Es geht ihnen gut, sie fühlen sich wohl, bekommen Aufmerksamkeit, Zuwendung, Zärtlichkeit, Berührungen 7 IZPP. Ausgabe 1/2009. Themenschwerpunkt „Gut und Böse“. Udo Röser, Die Banalität des Guten geschenkt. Das Sehnen und die Sehnsucht anzukommen, angenommen zu werden, erkannt und beantwortet zu werden, zu lieben und geliebt zu werden spielt dabei eine wesentliche Rolle. Die biologischen, psychischen und sozialen Erosionen, die all die mehr oder weniger traumatisierenden Erfahrungen bei frühkindlicher Missachtung dieser menschlichen Ursehnsucht hinterlassen haben, sollen nicht weiter vertieft werden. Darum geht es mir nicht. Ich möchte mit wenigen Sätzen auf einige interessanten Ansätze hinweisen, die der Liebe eine Bedeutung zuweisen, die sowohl ethische als auch therapeutische Konsequenzen hat. Die Verfahren der humanistischen Psychologie haben im Spagat zwischen Freuds Kulturpessimismus und der Fixierung auf Mechanismen operanter Konditionierung behavioristischer Verfahren eine Position eingenommen, die den Menschen in seiner Ganzheit in den Blick nehmen (Röser, 2008), einschließlich seiner Fähigkeit zu „Gutem“ und „Bösem“ als polaren Potenzialen menschlichen Seins. Das menschliche Eingebundensein in ein historisch-kulturelles Kontinuum sowie die Fähigkeit eines Lernens von Körper, Geist und Seele führen bei den Vertretern der humanistischen Psychologie zu einem anthropologischen Grundverständnis, das die Entwicklungsfähigkeit und –möglichkeit zum „Guten“ für realisierbar hält. Voraussetzung für diese Potenzialentfaltung ist die Arbeit an einer Welt, die das Ganze in den Blick nimmt: individuelles, soziales, gesellschaftliches, kulturelles, ökologisches. „Hominität bezeichnet die Menschennatur auf der individuellen und kollektiven Ebene in ihrer biopsychosozialen Verfasstheit und ihrer ökologischen, aber auch kulturellen Eingebundenheit mit ihrer Potenzialität zur Destruktivität/Inhumanität und zur Dignität/Humanität. Das Hominitätskonzept sieht den Menschen als Natur- und Kulturwesen in permanenter Entwicklung durch Selbstüberschreitung, so daß Hominität eine Aufgabe ist und bleibt, eine permanente Realisierung mit offenem Ende – ein WEG, der nur über die Kultivierung und Durchsetzung von Humanität führen kann. Petzold (2008) Einer der theoretischen Gründerväter der humanistischen Psychologie ist Erich Fromm. Dieser hat mit seinem 1956 erstmals erschienen populärwissenschaftlichen Buch der „Kunst des Liebens“ eine Position aufgezeigt, die neben aller Gesellschaftskritik deutlich machte: alles Streben, aller Ehrgeiz, jegliche Anstrengung, die ausschließlich danach trachtet geliebt zu werden, lenkt von der eigentlichen Voraussetzung ab, nämlich von der Fähigkeit zu lieben. Die Fähigkeit zu lieben ist zwar jedem Menschen gegeben, aber sie stellt sich nicht von alleine ein, sondern verlangt ein Wissen um diese Fähigkeit und ein aktives Bemühen diese zu erreichen. Fromm geht von einer grundwirkenden lebensfördernden Energie aus, die allerdings durch innere und äußere Bedingungen blockiert wird. „Die individuellen und gesellschaftlichen Bedingungen .... bringen den Destruktionstrieb hervor, der seinerseits zur Quelle der verschiedenen Manifestationen des Bösen wird......Wir haben dargelegt, dass der Mensch nicht zwangsläufig böse ist, sondern nur dann böse wird, wenn die für sein Wachstum geeigneten Bedingungen fehlen. Das Böse führt kein unabhängiges Eigenleben; es ist das Nichtvorhandensein des Guten, das Scheitern eines Verwirklichungsversuchs.“ (Fromm, 1978, 234 – 236, zit. n. Pieper, 2008, 41) Wie sieht denn heute, 50 Jahre nach Fromms Eintreten für eine Kunst des Liebens, 40 Jahre nach dem Aufbruch der „68er“ und der heutigen Deutungshoheit neurobiologischer Erklärungsmodelle ein theoriegeleitetes und praxisorientiertes Eintreten für die Liebe als Wegweiser menschlicher Entwicklungsmöglichkeiten aus? Wie werden heute die von Fromm als erforderlich gesehenen Verwirklichungsversuche beschrieben? Und wie kann heute eine Ethik, die sich auf Bedingungen der Liebe bezieht, formuliert werden? 8 IZPP. Ausgabe 1/2009. Themenschwerpunkt „Gut und Böse“. Udo Röser, Die Banalität des Guten Exemplarisch3 sei der Ansatz von Michael Cöllen vorgestellt, der in der Tradition der Humanistischen Psychologie steht. Cöllen bündelt in seinem Ansatz philosophisches, sozialwissenschaftliches und psychologisches Wissen. Er transformiert dies in ein therapeutisches Verfahren4, das ausgehend von einer dyadischen Grundbestimmung menschlichen Seins, einen Entwicklungsweg zur Entfaltung der Fähigkeit zu lieben aufzeigt. So betrachtet er die Liebe als Lernmodell, die eine Ethik aus dem Dialog begründet. „Eine Ethik, die aus der Liebe erwächst, ist, im Unterschied zu vielen ethischen Begründungen, ihrem Wesen nach nicht monologisch, das heißt aus dem Impuls eines singulären Denkens entsprungen, sondern sie ist dialogisch wie das Paar in seinen Nöten und Sehnsüchten, seinen Widersprüchen und Synthesen selbst.“ (Cöllen, ebd. 46) Zwei wesentliche Grundannahmen stützen dieses Modell: 1. Dem Gefühl wird ebenso eine Erkenntnisfunktion zugewiesen wie dem kognitiven Verstand. Cöllen beruft sich in dieser Aufwertung des Gefühls auf die Philosophin und Psychologin Carola Meier-Seethaler mit ihrem Plädoyer für die emotionale Vernunft. „Emotionsloses Denken führt immer zu partieller Wertblindheit“. (Meier-Seethaler (1998), zit. nach Cöllen, ebd. 45). So liegt hier eine Chance, in einer universell gerichteten Beziehungsethik Verstand und Gefühl zu verschmelzen und als Ressourcen für den sozialen und politischen Frieden zu nutzen. Dieser epistemologische Ansatz orientiert sich an einem ganzheitlich verstandenen Menschenbild. Das Zusammenwirken von Körper, Geist und Seele ist das, was den Menschen ausmacht. Das Verhältnis dieser anthropologischen Essenzen ist ein gleichwertiges. In der Begegnung zweier Menschen, im „Zwischenmenschlichen“ (Buber), wirkt ein Beziehungsgeschehen, das diese Ganzheitlichkeit umfasst. Beidseitig. Interdependent. Eine Ethik, die sich dieser Gleichwertigkeit von Körper, Geist und Seele im interdependenten Beziehungsgeschehen, im diaolgischen Miteinander öffnet, ver-rückt den Blick auf unser Da-sein. 2. Die Ethik der Liebenden enthält als Grundlage die implizite Übereinkunft, dass jeder das Beste für den Anderen will. Beide wissen durch Erfahrung und Kenntnis, dass die Liebe nicht von allein gedeiht. Licht und Schatten finden sich bei beiden Partnern. In der Liebe erfolgt auf jede Handlung ein Feedback, ob gut oder schlecht. Im dialogischen Miteinander wird ein gemeinsamer Weg gesucht. Dieser umfasst eine Fehlerkultur, die Fehler nicht als das zu bekämpfende Böse des Anderen betrachtet. Im Bewusstsein der eigenen Fehlerhaftigkeit, des „Nichtfertiggestelltseins“ (Gehlen), wird nach gemeinsamen Wegen gesucht aus diesen Fehlern zu lernen und diese zu überwinden. Dazu gehört sich gegenseitig Fehler einzugestehen, Verzeihung zu erbitten und zu verzeihen (Cöllen, 2009). Das „Gute“ und das „Böse“ sind somit impliziter Bestandteil jeglichen Beziehungsgeschehen. Selbstverantwortung meint hier aber gleichzeitig Fremdverantwortung. Die Wirkung meiner Fehlerhaftigkeit hinterlässt Spuren in mir und bei meinem Gegenüber. Verantwortung zu übernehmen und dafür einzustehen bedeutet diese Auswirkung bei mir und beim Anderen zu sehen, zu spüren, anzuerkennen und dafür einzustehen. Liebe als Kraftquelle, als anthropologisches Sehnen zu lieben und geliebt zu werden, fordert eine Beziehungsethik, die das „Böse“ in der zwischenmenschlichen Auseinandersetzung als menschliches Defizit benennt und hinterfragt. Dies kann Grundlage für einen Wachstumsprozess werden, der Entwicklung ermöglicht. Die Partner werden sich in diesem dialogischen Miteinander gegenseitig Entwicklungshelfer. Wie ist jetzt der Bogen zurück zu finden zur Arbeit mit drogenabhängigen Patienten? Hat all das, was zuletzt beschrieben wurde, eine Relevanz für die konkrete therapeutische Arbeit mit Drogenabhängigen? Was würden 9 IZPP. Ausgabe 1/2009. Themenschwerpunkt „Gut und Böse“. Udo Röser, Die Banalität des Guten diese z.B. sagen, wenn ich ihnen diesen Beitrag zu lesen gebe? Gut und Böse? Liebe? „Tja, Herr R., schön geschrieben, aber könnten sie mir mal nicht 10 Euro vorstrecken“? Die Fähigkeit zu lieben als transzendierende Kraft, die die Polarität von Gut und Böse zu überwinden hilft? Ein schöner Gedanke, auf den ich vertraue. Literatur Beck, Ulrich & Beck-Gernsheim, Elisabeth (1994), Riskante Freiheiten, Suhrkamp Frankfurt. Cöllen, Michael & Jung, Mathias (2002), Liebe in Zeiten der Unverbindlichkeit. Eros und Éthos, Kreuz Stuttgart. Cöllen, Michael (2009), Das Verzeihen in der Liebe, Kreuz Verlag Freiburg. Eirund, W. (2006), Doppelte Krankheit – Doppelte Heilung – Doppelte Gesundheit? Medizinische Diagnosen und ganzeitliches Menschenbild, in: Röder, Hannsknut & Eirund, Wolfgang (Hrsg) (2006), Der aufgeteilte Geist, Glaukos Limburg. Freud, Sigmund (1956), Totem und Tabu, Suhrkamp Frankfurt. Fromm, Erich (1979), Die Kunst des Liebens, Ullstein Berlin. Fromm, Erich (1982), Psychoanalyse und Ethik, DVA Stuttgart. ICD-10-GM. Version 2009. Klein, Michael (2006), Kinder drogenabhängiger Eltern, Roderer Regensburg. Meier-Seethaler, Carola (1998), Gefühl und Urteilskraft. Ein Plädoyer für die emotionale Vernunft. Beck München. Petzold, Hilarion (2008), Wille, Wollen, Willensfreiheit, Willenstherapie in: Petzold, Hilarion & Sieper, Johanna, Der Wille, die Neurobiologie und die Psychotherapie, Band II, Sirius, Bielefeld und Locarno. Pieper, Annemarie (2008), Gut und Böse, Beck München. Röser, Udo (2008), Der Begriff der Freiheit in humanistischen Therapieansätzen, in: Röder, Hannsknut. & Eirund, Wolfgang (2008), Freiheit in der Psychotherapie, BoD Norderstedt. Suchtbericht 2009 der Deutschen Bundesregierung. Willi, Jürg & Limacher, Bernhard (Hrsg.) (2005), Wenn die Liebe schwindet, Klett-Cotta Stuttgart. 1 Der Suchtbericht 2009 der Deutschen Bundesregierung geht von 1,3 Millionen Alkoholabhängigen, 1,4 – 1,9 Millionen Medikamentenabhängigen und ca. 200.000 Drogenabhängigen aus. 2 Kinder drogenabhängiger Eltern werden ebenso wie Kinder psychisch kranker Eltern einer Hochrisikogruppe zuge- ordnet (Klein, 2006). Das Risiko der Kinder bezieht sich auf die Einschränkung einer gesunden, Leib und Leben gefährdenden Entwicklung. Die Novellierung des Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) hat die juristische Voraussetzung geschaffen Kindeswohl und Kinderschutz zu sichern. 3 Paartherapeuten, die sich per se mit Phänomen der Liebe auseinandersetzen, haben in den letzten Jahren vermehrt den Fokus auf eine Psychologie der Liebe gelegt und dazu publiziert. Neben Michael Cöllen Autoren wie Jürg Willi (Psychologie der Liebe, 2002), Guy Bodenmann (Liebe in der Verhaltenstherapie mit Paaren, 2005), David Schnarch (Die leidenschaftliche Ehe. Die Rolle der Liebe in der Paartherapie, 2005), Astrid Riehl-Emde, Liebe im Fokus der Paartherapie, 2005). Die Beiträge von Bodenmann, Schnarch und Riehl-Emde sind in dem Buch: Willi, Jürg & Limacher, Bernhard (Hrsg.) (2005), Wenn die Liebe schwindet, Klett-Cotta Stuttgart erschienen. 4 Das therapeutische Verfahren der Paarsynthese beschreibt die Psychodynamik des Paares auf einem tiefenpsychologischen, dialogischen und spirituellen Hintergrund. Aus diesen drei Ansätzen leitet sich die therapeutische Methodik ab. Zum Autor: Udo Röser M.A., Studium der Soziologie, Geschichte, Philosophie, Diplom-Sozialpädagoge (FH), approbierter Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, Lehrtherapeut für Gestalt- und Paartherapie, Fachlicher Gesamtleiter Therapiedorf Villa Lilly, Adolphus Busch Allee, 65307 Bad Schwalbach Kontakt: [email protected] 10