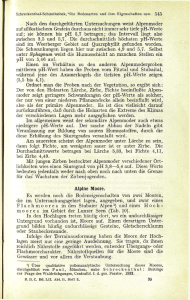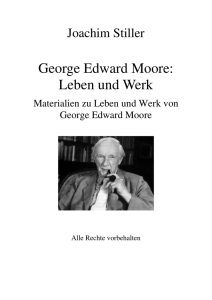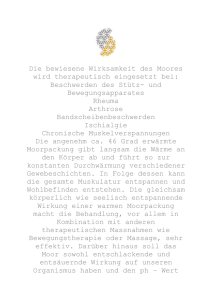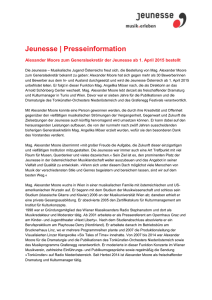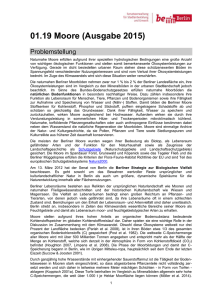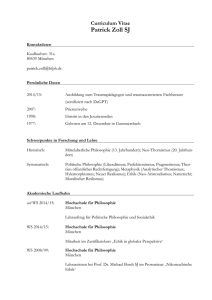C. LITERATURBERICHTE GEORGE EDWARD MOORES
Werbung

C. LITERATURBERICHTE GEORGE EDWARD MOORES PHILOSOPHIE UND IHRE GEGENWÄRTIGE REZEPTION Wulf Kellerwessel, Aachen George Edward Moore (1873–1958) gilt zusammen mit B. Russell und G. Frege als Begründer der Analytischen Philosophie, und ohne Zweifel hatte er und hat er aktuell wieder großen Einfluß auf diese philosophische Strömung. Dies gilt insbesondere für den englischsprachigen Raum, in dem seine Beiträge zur theoretischen und praktischen Philosophie intensive Resonanz fanden und nach wie vor finden. Im deutschsprachigen Raum wurde vor allem seine Ethik breiter rezipiert, was wohl durch die Übersetzung seiner beiden Monographien zur Moralphilosophie – Prinicipa Ethica (im Original 1903 veröffentlicht) und Grundprobleme der Ethik (zuerst 1912 erschienen) – unterstützt wurde. Seine theoretische Philosophie stand in Deutschland weniger im Blickpunkt, auch wenn immerhin fünf der Aufsätze von Moore in einem Sammelband erschienen (Eine Verteidigung des Common Sense, 1969). Die Editionslage für deutsche Übersetzungen der Werke von ­Moore hat sich sehr deutlich verbessert, weil einige bislang nicht übersetzte Werke Moores nun erstmals auch auf Deutsch vorliegen. Dabei handelt es sich um „Ausgewählte Werke“, die in drei Bänden erschienen sind. George Edward Moore: Grundprobleme der Philosophie, Ausgewählte Werke, Band 1. 419 S., Ontos Verlag, Heusenstamm 2007; ISBN 978-3938793-53-4, EUR 98,– Die „Grundprobleme der Philosophie“ gehen auf zwanzig Vorlesungen Moores aus den Jahren 1910/11 zurück, erschienen auf Englisch aber erstmals 1953. In ihnen versucht Moore einleitend zu klären, was Philosophie ist, und analysiert dann zahlreiche für seine Philosophie wichtige Begriffe und Positionen der theoretischen Philosophie. Es geht um die Bereiche Ontologie, Metaphysik, Erkenntnistheorie sowie Sprachphilosophie mitsamt ihren Hauptbegriffen, aber immer wieder auch um Philosophischer Literaturanzeiger 64 / 2 / 2011 Literaturberichte 199 die kritische Auseinandersetzung mit Positionen des Empirismus (vor allem der Erkenntnistheorie von David Hume) und um (ontologische, metaphysische) Auffassungen, die im britischen Neo-Heglianismus vertreten wurden. Dabei verwendet Moore seine kritischen Analysen, um seine eigenen Positionen zu entwickeln. Moore zufolge ist es die Aufgabe der Philosophie, „eine allgemeine Beschreibung des gesamten Universums zu erstellen“ (6), wobei viele Philosophen, die dies versucht hätten, mit dem gesunden Menschenverstand resp. dem für Moores Philosophie bedeutsamen Common Sense in Konflikt geraten seien. Letzterer nimmt an, daß es materielle Gegenstände gebe, aber auch mentale Akte bzw. Bewußtseinsakte (vgl. 8), von denen die materiellen Gegenstände unabhängig wären. Zudem gehe er vom Vorhandensein von Raum und Zeit aus (vgl. 9), in denen die anderen genannten Entitäten vorhanden wären. Philosophen hätten dem entweder – zweifelhafte – weitere Entitäten hinzugefügt wie z. B. Gott (vgl. 22 f.), oder sie hätten – skeptischer Weise – die Existenz von einigen dieser Typen von Entitäten bestritten (vgl. 24): Sie zweifelten dann entweder an der Existenz materieller Gegenstände oder an diesen und dem Vorhandensein anderer Menschen mit Bewußtsein, also auch an psychischen Akten anderer Personen (vgl. 24 f.). Und schließlich gebe es Philosophen, die die Existenz von Raum und Zeit (zusätzlich) bestritten (vgl. 25). Daher stellt sich für Moore die entscheidende Frage, was eine Beschreibung des Universums begründetermaßen enthalten muß (vgl. 29). Es geht damit um das Vorhandensein der genannten Entitäten – und um die Frage, ob resp. wie man sie erkennen kann (vgl. 31), und damit um die Möglichkeit, zu wahren Erkenntnissen von ihnen zu gelangen. Die Erkenntnis beginnt, so Moore, mit „Sinnesdaten“ (Dinge, Farben, Größen, Formen, vgl. 37), die in Bewußtseinsakten direkt erfahren würden. Doch würde man, hat man solche Sinnesdaten präsent, auch gewahr sein, daß „etwas existiert, das sich von jedem Sinnesdatum […] unterscheidet“ (59) – etwa die den Sinnesdaten zugrundeliegenden materiellen Gegenstände (vgl. 60). Über diese lassen sich laut Moore – wahre oder falsche – Propositionen bilden, die als weitere Bestandteile des Universums anzusehen seien, und mit deren Hilfe ein indirektes Erfassen von etwas möglich ist (vgl. 79). Erkenntnisse kann man demnach, so Moore, durch wahre Propositionen erhalten. Dies leitet zu der Frage Philosophischer Literaturanzeiger 64 / 2 / 2011 200 Literaturberichte über, welche Arten von Propositionen als wahr gewußt werden können, was Moore in Auseinandersetzung mit Humes Ansichten zu diesem Thema entwickelt. Die Auseinandersetzung nutzt Moore zudem, um eine prägnante skeptische (Gegen‑)Position zu formulieren. Sie besagt: „Die einzigen Dinge, von deren Existenz ich wissen kann über das hinaus, was ich selbst erfasst habe, sind: (1) die vergangenen und zukünftigen Inhalte meines Verstandes, meine Bewußtseinsakte und alle Dinge eingeschlossen, die ich direkt erfasse, und (2) die Inhalte im Verstand anderer Menschen im gleichen Sinn“ (119). Demnach wüsste man also nicht um die Existenz von materiellen Dingen. Dieser skeptischen Gegenposition steht aber, so Moore, entgegen, daß Sinnesdaten Zeichen von etwas in Raum und Zeit sind (vgl. 129 f.), und Zeichen von etwas, an dessen Existenz man glaube bzw. von dem man tatsächlich weiß resp. von etwas, dessen Existenz gewiß sei (vgl. 132 ff.). Dies sei als reductio ad absurdum der skeptischen Gegenposition zu verstehen. Zudem gebe es keine Möglichkeit, etwas Nachvollziehbares zu formulieren, indem man sagt: „Kein Mensch weiß von der Existenz eines materiellen Objekts“ (156). Denn wer dergleichen formuliert, unterstellt die Existenz von Menschen mitsamt ihren Körpern, also materiellen Objekten. Im weiteren diskutiert Moore eine Reihe von Positionen und Argumenten, denen zufolge materielle Gegenstände gar nicht existieren können – und weist diese zurück. Ferner versucht er in Diskussionen resp. durch Analysen von Positionen von Descartes, Berkeley, Hume, Kant und Bradley nachzuweisen, daß es gute Gründe für die Annahme von (der Realität von) Raum und Zeit gibt. Dabei analysiert Moore sorgfältig die Bedeutungen von „real“ und sinnverwandten Termini wie „existieren“ sowie von diversen Oppositionsbegriffen. Weitere Themen bilden diverse für die Mooresche Erkenntnistheorie bedeutsame Begriffe wie „Vorstellung“, „Erinnerung“ und „Annahme“. Vor allem die Beziehungen von Vorstellungen, Erinnerungen und Annahmen zu Tatsachen werden untersucht. Insbesondere widmet sich Moore der Klärung dessen, was es heißt, angenommene Propositionen seien wahr. Moore erwägt, Wahrheit Annahmen zuzuschreiben, die sich auf eine Tatsache beziehen, die „Sein hat“ oder „ist“ (vgl. 292) – wobei die Schwierigkeit dieser Auffassung Moore zufolge darin besteht, diese Beziehung genauer zu erfassen, obschon wir in der Praxis mit ihr Philosophischer Literaturanzeiger 64 / 2 / 2011 Literaturberichte 201 vertraut sind (vgl. 305). Zumindest für etliche Verwendungsweisen von „wahr“ plädiert Moore daher für eine Korrespondenztheorie der Wahrheit (vgl. 307 ff.). Kritisiert werden dagegen die pragmatische Wahrheitsauffassung1 und die Position von Bradley, nach der alle Annahmen „zugleich teilweise wahr und auch falsch“ (313) wären. Ein weiterer wichtiger Punkt für Moore ist die Klärung der Frage, ob es allgemeine Ideen bzw. Universalien im Universum gibt. Im Kontext dieser Fragestellung intendiert Moore nachzuweisen, daß es sich hierbei nicht um Fiktionen handelt (vgl. 333). Dies gelte beispielsweise für räumliche Relationen (vgl. 336). Weitere Universalien neben Beziehungen wären Eigenschaften, die „eine Beziehung zu etwas haben“ (353). Darüber hinaus erwägt Moore noch eine dritte Art von Universalien anzunehmen, zu der insbesondere Zahlen gehören sollen (vgl. 403 ff.). Insgesamt gebe es, so Moores abschließende Beschreibung des Universums, „drei verschiedene Arten von Bestandteilen des Universums […], nämlich (1) partikulare Dinge, (2) Wahrheiten oder Tatsachen und (3) Universalien“ (409). Letztgenannte seien zwar aus Abstraktionen hervorgegangen, aber von „fiktionalen Gegenständen“ klar unterschieden. George Edward Moore: Philosophische Studien, Ausgewählte Werke, Band 2. 283 S., Ontos Verlag, Heusenstamm 2007; ISBN 978-3-93879354-1, EUR 79,– Die Philosophischen Studien, die erstmals bereits 1922 erschienen sind, enthalten zehn Aufsätze, die in sich abgeschlossene Themen behandeln. Überwiegend sind sie mit Themenstellungen aus der theoretischen Philosophie befaßt, aber es gibt auch zwei Beiträge, bei denen moralphilosophische Thematiken im Mittelpunkt stehen. Eingeleitet wird der Band mit dem berühmten Aufsatz „Die Widerlegung des Idealismus“. In ihm kritisiert Moore den Idealismus, dem zufolge das Universum „geistig“ sei. Dies führt, so Moore, dazu, daß das Universum anders sein müsse als es zu sein scheint, und „eine hohe Anzahl von Eigenschaften aufweist, die es scheinbar nicht hat“ (1), z. B. 1 Vgl. dazu auch die nachfolgende Besprechung zu Band 2 der ausgewählten Werke Moores (Philosophische Studien). Philosophischer Literaturanzeiger 64 / 2 / 2011 202 Literaturberichte würde es dann Zwecke verfolgen oder wäre gar intelligent, und nicht nur mechanisch. Allerdings ist die dem Idealismus zugrundeliegende These des esse est percipi laut Moore „in allen Lesarten […] falsch“ (2). Sie setze – fälschlich – „das Erfahrene mit der Erfahrung von ihm in eins“ (15). In „Wesen und Wirklichkeit“ analysiert Moore die Annahme, andere Menschen hätten Wahrnehmungen, die den je eigenen Wahrnehmungen ähneln, und geht der Frage nach, ob es einen guten Grund für die Annahme der Existenz anderer Menschen gebe (was zu einer Klärung der Bedeutung des Begriffs „guter Grund“ führt). Dabei diskutiert Moore unter anderem die Bedeutung von Wahrnehmungen resp. Erkenntnissen und die Frage, welche Verallgemeinerungen zulässig sind resp. das Induktionsproblem. Kritisch analysiert wird die pragmatische Wahrheitstheorie von W. James. Zielscheibe der detaillierten, sorgfältigen Analysen Moores sind insbesondere die Identifikation von Wahrheit mit Nützlichkeit, die James vornimmt, aber auch dessen Annahme, alle wahren Auffassungen ließen sich verifizieren (was unter anderem problematisch hinsichtlich Äußerungen über Vergangenes und hinsichtlich von allgemeinen Aussagen sei). Darüber hinaus stellt Moore heraus, daß es dauerhaft oder temporär unnütze Wahrheiten geben kann, daß die Frage des „Nutzens für wen?“ genauer zu klären ist, und daß es nützliche, aber (mutmaßlich) falsche Auffassungen gibt. Abgesehen davon kann der Nutzen einer Annahme sich im Zeitverlauf ändern. Doch die Wahrheit entsprechend gebildeter (nicht-indexikalischer) Aussagen bzw. von in ihren Bedeutungen stabilen Aussagen (vgl. 113) dürfte sich, so Moore, nicht verändern. Und viele vielleicht nützliche Auffassungen sind mit Blick auf ihren Wahrheitswert schwer zu bestimmen, wie Moore z. B. hinsichtlich religiöser Annahmen herausstellt. Daher sprächen gravierende Gründe gegen die pragmatische Wahrheitstheorie von James. In „Humes Philosophie“ geht es um die Möglichkeit des Wissens wahrer Sätze. Moore zufolge kann man Sätze, die wahr sein können, in drei Gruppen einteilen. Gemäß der Interpretation von Moore geht Hume allerdings davon aus, daß nur Sätze aus den ersten beiden Gruppen als wahr gewußt werden können. Diese drei Gruppen umfassen: 1) Aussagen, die gewisse Beziehungen zwischen Vorstellungen betrefPhilosophischer Literaturanzeiger 64 / 2 / 2011 Literaturberichte 203 fen, 2) Aussagen über direkt beobachtete oder erinnerte Tatsachen, und 3) Aussagen, für die keine solchen Belege durch unmittelbar beobachtete oder erinnerte Tatsachen vorhanden sind und die nicht Beziehungen zwischen Vorstellungen betreffen (vgl. 124). Zu letztgenannter Gruppe zählen unter anderem „die meisten religiösen und ein Großteil der philosophischen Aussagen“ (126), aber auch etliche Aussagen über „äußere Tatsachen“ (vgl. 128) bzw. Auffassungen über die Außenwelt oder andere Menschen: Bezüglich dieser scheine es absurd, sie von den Sätzen, die wahr sein können, auszuschließen (vgl. 131 f.). Und: „Jeder Philosoph, der positiv behauptet, dass andere Menschen, die ihm gleichen, nicht fähig sind, irgendwelche externe Tatsachen zu wissen, widerspricht sich mit eben dieser Aussage, da er mit einschließt, dass er sehr wohl einiges über das Wissen anderer zu sagen weiß“ (132). Unser Wissen von der Außenwelt (und über Kausalitäten) werde letztlich auch von Hume nicht mit überzeugenden Gründen angezweifelt (vgl. 136). In „Über den Status von Sinnesdaten“ geht es um das direkte Erfassen von Sinnesdingen, und um die Frage, ob Sinnesdinge physikalische Dinge sind. Der Text „Der Begriff der Realität“ kritisiert ausführlich Bradleys These von der Unwirklichkeit von Raum und Zeit. Denn, so Moore, wenn die Zeit nicht wirklich sei, „passiert offenkundig nichts weder vor noch nach irgendwas; ja, noch nicht mal gleichzeitig mit irgendwas anderem, es ist niemals wahr, dass irgendwas vergangen ist“ (175) – Aussagen, die die Falschheit der Bradleyschen These anzeigen, da sie selbst falsch sind und aus den Annahmen von Bradley folgen (vgl. 175). Weitere Ausführungen betreffen Wahrnehmungsurteile und die Frage, ob alle Beziehungen intern seien. Um Überlegungen zur praktischen Philosophie geht es zunächst in „Der Begriff des intrinsischen Werts“. Hier erörtert Moore, ob es intrinsisch Wertvolles gibt, und wie die Beantwortung dieser Frage mit der Frage einer objektiven Ethik zusammenhängt. Intrinsische Werte werden dabei wie folgt charakterisiert: „Zu sagen, eine Art von Wert sei ‚intrinsisch‘ meint lediglich, dass die Frage, ob und zu welchem Grad er einem Ding zukommt, einzig von der intrinsischen Natur des jeweiligen Dinges abhängt“ (214). Damit wären intrinsische Werte, die bekanntlich auch in der Moralphilosophie, die Moore in der „Principia Ethica“ entwickelt, eine grundlegende Rolle spielen, nicht von subjekPhilosophischer Literaturanzeiger 64 / 2 / 2011 204 Literaturberichte tiven Zuschreibungen abhängig (vgl. 222). In „Vom Wesen der Moralphilosophie“ erläutert Moore sein Verständnis von Pflicht und dem, was „moralisch richtig“ oder „moralisch falsch“ bedeutet. Insbesondere moralische Regeln erscheinen ihm von Relevanz. Diese betreffen entweder Handlungen bzw. Unterlassungen oder Einstellungen, Gefühle o. dgl. Nur bezüglich handlungsbezogener Regeln der Moral gilt dabei nach Moore, daß das „Sollen“ das „Können“ impliziere (vgl. 262). Solch handlungsbezogene Regeln stellen Pflichten dar. Regeln, die hingegen einstellungsbezogen sind, scheinen dagegen auf Ideale ausgerichtet (vgl. 263). Die Begriffe „Pflicht“ oder „moralisch gut“ seien nicht bloß auf psychologische Vorstellungen zu beziehen. Entsprechende Analysen moralischer Urteile, denen zufolge Moralurteile letztlich Gefühle der Mißbilligung zum Ausdruck bringen könnten, lehnt Moore ab. Solche emotivistischen Vorstellungen (wie die von E. Westermarck) können nicht erklären, wieso es in der Moral tatsächliche Meinungsverschiedenheiten gibt (vgl. 274) und weshalb Menschen ihre jeweils eigene Moral als vorzugswürdig ansehen (vgl. 275). George Edward Moore: Die frühen Essays. Ausgewählte Werke, Band 3. 209 S., Ontos Verlag, Heusenstamm 2008; ISBN 978-3-93879355-8, EUR 89,–2 sind eine Übersetzung der Ausgabe der Early Essays von Moore, die 1986 erstmals erschienen sind. Sie fassen 10 Texte Moores aus den Jahren 1897 bis 1903/04 zusammen, die in renommierten Philosophiezeitschriften erstveröffentlicht wurden. Bei vielen dieser Texte handelt es sich um Vorträge, einige sind eher kritische Besprechungen. Abgehandelt werden einerseits diverse zentrale Begriffe der abendländischen Philosophie, die Moore – wie so oft in Auseinandersetzung mit klassischen philosophischen Bestimmungen dieser Begriffe – analysiert, anderseits werden Positionen aus dem Umkreis des Neo-Heglianismus einer sorgsam abwägenden Analyse und oft einer gravierenden 2 Die drei Bände George Edward Moore: Ausgewählte Werke kosten zusammen EUR 199,–. Philosophischer Literaturanzeiger 64 / 2 / 2011 Literaturberichte 205 Kritik unterzogen. So geht Moore in seinem Beitrag zu einem entsprechend betitelten Symposium (mit B. Bosanquet und S. H. Hodgson) der Frage nach der möglichen Existenz von Vergangenheit und Zukunft nach und untersucht die Begriffe „Freiheit“ (vor allem bei Kant), „Notwendigkeit“ und „Identität“. Erörtert werden ferner „Das Wesen des Urteils“ (unter Einbeziehung von Überlegungen F. H. Bradleys und Kants), der Zusammenhang von „Erfahrung und Empirismus“, aber auch „Kants Idealismus“. Vor allem aber ist auch der Neo-Heglianismus von J. McTaggert Thema Moores und Zielscheibe seiner oft ebenso fundamentalen wie genauen Kritik. Und nicht zuletzt findet sich ein längerer Aufsatz mit dem Titel „Der Wert der Religion“, der Moores Agnostizismus deutlich werden läßt. In dem eben genannten Aufsatz zur Religionsphilosophie geht es um die Frage „Sollen wir an Gott glauben?“ (77). Nach Moores Auffassung sind diverse Argumentation zu dem damit benannten Thema zu kritisieren, und er hofft durch das Aufklären von Argumentationsfehlern Meinungsunterschiede zum Verschwinden zu bringen (vgl. 78). Dabei erörtert Moore zunächst, welche personalen Eigenschaften jener Gott (des Monotheismus) haben soll, an den geglaubt oder eben nicht geglaubt wird: Er wird als „personal“ verstanden und soll einen Geist oder Vernunft haben (nicht „Verstand“, wie die Übersetzung es besagt), und zwar einen ihm eigenen Geist, der sich von anderen unterscheide (vgl. 79). Zudem wird Gott als mächtig, weise und gut in besonderem Maße vorgestellt. Sollte so ein Gott existieren, wäre es gut, an seine Existenz zu glauben – aber die entscheidende Frage ist: Können wir wissen, ob er existiert? Laut Moore gibt es „nicht eine Spur eines Beweises“ (81) dafür – aber auch keinen Beweis für eine gegenteilige Auffassung. Eine Argumentation zugunsten der Annahme der Existenz Gottes mit Hilfe moralischer Argumentation, etwa durch Verweis auf „gute“ Folgen eines entsprechenden Glaubens, kritisiert Moore: Auch Illusionen können gute Folgen haben, beweisen aber nicht, daß das, woran in einer Illusion geglaubt werde, tatsächlich existiere. Auch den kosmologischen und den teleologischen Gottesbeweis lehnt Moore ab. Nimmt man auch gemäß dem kosmologischen Beweis an, es gebe eine erste Ursache des Universums, so impliziert dies keine der angenommen göttlichen Eigenschaften der ersten Ursache. Sollte man der Annahme folgen, Gott sei Philosophischer Literaturanzeiger 64 / 2 / 2011 206 Literaturberichte eine Ursache ganz anderer Art als z. B. der Mensch Ursache einer Wirkung ist, „dann können wir auf seine Existenz schließen, aber nicht auf seine Wesensart: Wir können schließen, dass die betroffenen Ereignisse eine Ursache hatten, aber nicht dass ihre Ursache Gott war“ (87). Und nicht zuletzt kann auch der Hinweis darauf, daß viele Menschen an die Existenz Gottes glauben, diese Existenz nicht beweisen – denn vieles, was früher von vielen Menschen als wahr angenommen wurde, sehen viele Menschen heutzutage als falsch an. Die temporäre, große Verbreitung einer Überzeugung ist demnach kein überzeugender Grund dafür, diese Überzeugung für wahr zu halten (vgl. 89). Historische Belege sind für Moore ebenfalls nicht überzeugend (vgl. 89 f.). Daher rät Moore am Ende des Textes zu einer praktischen Konsequenz aus der theoretisch nicht lösbaren bzw. entscheidbaren Frage nach der Existenz Gottes: „Wir könnten vielleicht zum Vorteil die reale Kreatur ein wenig mehr verehren und ihren hypothetischen Schöpfer um ein Vieles weniger“ (94). Einen Schwerpunkt der beginnenden britischen Analytischen Philosophie stellt bekanntermaßen die kritische Auseinandersetzung mit dem englischen Neo-Heglianismus dar, wie er beispielsweise prominent von McTaggert vertreten wurde. Zwei kritische Analysen in Form von zwei Beiträgen Moores finden sich in den Frühen Essays, die ausführlich auf Überlegungen von McTaggert eingehen. Der eine Beitrag befaßt sich zunächst mit McTaggerts Idee, der zufolge die „Realität sich ausschließlich aus einer Pluralität endlicher Personen, uns selbst eingeschlossen, zusammensetzt“ (120), und das „Universum ein Ganzes ist, das nicht nur in jedem seiner Teile, sondern auch für jedes seiner Teile ist“ (122). Moore untersucht die verschiedene Begründungsversuche für diese idealistische Position und verortet ein höchst bedeutendes Problem in der fehlerhaften Annahme über dasjenige, was im Bewußtsein ist (vgl. 127) – die Objekte, die „im“ Bewußtsein vorhanden seien, sind nämlich nicht zwangsläufig nur im Bewußtsein. Demgemäß formuliert Moore: „Die Geschichte der Philosophie weist ein gleichbleibendes Unvermögen auf, zwischen dem, dessen ich mir bewußt bin, und meinem Bewußtsein von ihm zu unterscheiden – ein Unvermögen, das ein Denkmal in dem Wort ‚Idee‘ gefunden hat, das regelmäßig für beides steht“ (128). Im weiteren geht es dann um McTaggerts Beweisversuch für die These, Philosophischer Literaturanzeiger 64 / 2 / 2011 Literaturberichte 207 daß der Mensch unsterblich sei, was unter anderem zu einer massiven Kritik an McTaggerts Personenbegriff führt. Denn nach dessen Begriff von Person wäre ein jetzt erzeugter perfekter Doppelgänger von Moore mit Moore identisch bzw. dieselbe Person, was aufgrund der mangelnden kausalen Verbindungen zum früheren Moore wohl kaum zutreffen dürfte. McTaggert verkennt, so Moore, die Bedeutsamkeit der Verbindung mit einem gegenwärtigen Selbst (vgl. 144). Letztlich führte ein von McTaggert behauptetes zukünftiges Leben, welches auf Substanzgleichheit basiert, nicht aber auf Erinnerungen rekurriert, dazu, daß es nach Moore „kaum von der zukünftigen Existenz einer anderen Person unterscheidbar ist“ (149), womit die Position McTaggerts drastisch an Bedeutung verliere. Auch McTaggerts Ethik, wie sie im Kapitel „Das höchste Gut und das moralische Kriterium“ seiner Schrift Studies in Hegelian Cosmology vorliegt, ist Gegenstand der subtilen Mooreschen Kritik. Unter anderem konstatiert er Sein-Sollen-Fehlschlüsse; vor allem moniert er jedoch, daß „Freude“ als alleiniges Kriterium moralischen Handelns betrachtet wird. Die Übersetzungen von Texten aus der Feder von Moore dürften aufgrund der Art und Weise, wie Moore Texte verfaßt hat, alles andere als einfach zu verfassen sein. Denn die Sätze von Moore sind außerordentlich komplex; er differenziert ausgesprochen sorgfältig, ja skrupulös, und ist in seinen Urteilen zumeist sehr vorsichtig und wägt das Für und Wider ab – oft innerhalb eines komplex strukturierten Satzes. Trotz dieser Erschwernis wären doch einige Verbesserungen der Übersetzung möglich, die unter anderem terminologischer Natur sind („Verstand“ als Oppositionsbegriff zu „Gehirn“ und „Körper“ ist beispielsweise nicht sehr überzeugend). Abgesehen davon ist es aber sehr zu begrüßen, daß die genannten Werke von Moore nun in deutscher Sprache vorliegen. Denn Moores Analysen beeindrucken auch heute noch durch ihre Genauigkeit und ihre Subtilität. Insbesondere Moores Vermögen, in den von ihm untersuchten Texten und Ausführungen Interpretationsvarianten aufzufinden und kritisch zu analysieren, ist immens – was natürlich nicht bedeutet, seinen Analysen wäre durchweg zu folgen. Sowohl als kritischer Exeget klassischer Positionen als auch als Philosoph, der systematisch Begriffsanalysen betreibt, hat Moore Philosophischer Literaturanzeiger 64 / 2 / 2011 208 Literaturberichte nichts an Aktualität verloren – auch wenn vielleicht einige der von ihm (immer wieder) erörterten Positionen (wie z. B. der britische Neo-Heglianismus) und Annahmen (wie beispielsweise seine Sinnesdatentheorie) nicht im Fokus gegenwärtiger Interessen sind und vielleicht zurecht an Bedeutung überhaupt verloren haben, weil Moore sie für viele überzeugend kritisiert hat. Daß nun etliche seiner Schriften, die zuvor nicht in deutscher Sprache verfügbar waren, auf Deutsch erschienen sind, ist aufgrund der Bedeutung von Moore nicht nur für die Analytische Philosophie in hohem Maße zu begrüßen. Die Diskussion der Mooreschen Philosophie im englischen Sprachraum ist nach wie vor intensiv, und dies betrifft sowohl die theoretische wie die praktische Philosophie. Dies belegen unter anderem ein Sammelband, der sich sowohl mit der Moralphilosophie als auch der Erkenntnistheorie Moores befaßt, eine neue Monographie zur Ethik Moores und ein Sammelband spezieller zu Moores Metaethik und ihren Folgen. Susana Nuccetelli, Gary Seay (Eds.): Themes from G.E. Moore. New Essays in Epistemology and Ethics. 368 S., Oxford University Press, Oxford u.a. 2007; ISBN 978-0-19-928172-5, £ 57,50 Neben der sehr instruktiven Einleitung, die einen hervorragenden Überblick über die Beiträge des Bandes sowie die erörterten Themen und Problemstellungen enthält, finden sich in diesem thematisch breit angelegten Band sechzehn Beiträge, davon je acht zu Moores Erkenntnistheorie und zu seiner Ethik. Zu den epistemologischen Themen gehören „Moores Beweis einer Außenwelt“, „anti-skeptische Argumente“, „die Rolle des Common-Sense“, aber auch „Sinnesdaten“ und „paradoxe Sätze bzw. Äußerungen“. Die moralphilosophischen Themen umfassen „intrinsische Werte“, „Fragen einer angemessenen moralischen Phänomenologie“, das berühmte „Argument der offenen Frage“, „Wünsche zweiter Ordnung“, den „Non-Naturalismus“, „Moores Konsequentialismus bzw. Utilitarismus“ und den „Zusammenhang von organischen Werteinheiten und rachsüchtiger Strafe“. Im ersten Beitrag von Crispin Wright, „The Perils of Dogmatism“, geht es um Moores viel diskutierten Versuch, die Außenwelt als existent zu beweisen, indem er – bei hochgehaltener eigener Hand – von der PräPhilosophischer Literaturanzeiger 64 / 2 / 2011 Literaturberichte 209 misse „Hier ist eine Hand“ auf „Es gibt externe materielle Dinge“ zu schließen versucht. Inzwischen besteht wohl ein breiter Konsens darüber, daß das Argument in dieser knappen Form zumindest nicht erfolgreich ist; es fehlt (mindestens) eine im Beweis(versuch) der Außenwelt von Moore nicht artikulierte Prämisse (vgl. 26), die implizit unterstellt werde. Ihre explizite Einführung mache aber, so Wright, das Argument zirkelhaft bzw. bewirke, dass die Rollen von Prämissen und Konklusion vertauscht werden (vgl. 27). Daher bedürfe es anderer Bedingungen, die einen Glauben an die Existenz der Welt bzw. allgemein einen „Glauben, daß p“ rechtfertigen. Fünf Vorschläge werden von Wright (anhand von fünf heterogenen Beispielen) diskutiert. Sie sollen für einen geeigneten „warrant“ aufkommen, der es angemessen erscheinen läßt, p zu glauben (vgl. 30 ff.). Moores Beweis der Außenwelt ist auch Thema des Aufsatzes von Ernest Sosa, „Moore’s Proof“, der Moores Ansprüche an (s)einen Beweis für ungeeignet hält (vgl. 50). Sosa unterscheidet zwei Beweisarten: „A persuasive proof is a valid argument that can be used to rationally persuade one to believe its conclusion, if one has put the conclusion in doubt“ (51). Anders stellt sich der zweite Typ eines Beweises dar: „A display proof is a valid argument that displays premises on which one can rationally base belief in the conclusion, without vicious circularity“ (52). Moores Beweis sei ein solcher Beweis des zweiten Typs, der erfolgreich gegen den Idealismus formuliert werden könne (vgl. 52), und den Idealismus zu widerlegen sei auch Moores Ziel gewesen – und nicht die Überwindung des Skeptizismus. Ram Neta untersucht in „Fixing the Transmission: The New Mooreans“ Überlegungen von Martin Davies und James Pryor, die Moores Beweis einer Außenwelt für erfolgreich halten (vgl. 63). Auch Neta kommt dabei zu dem Ergebnis, daß Moores „Beweis“ uns kein Wissen zukommen läßt, über das wir nicht schon zuvor verfügten, sondern unser schon vorhandenes Wissen anzeigt („display“), was uns unsere Zweifel aufzulösen hilft (vgl. 83). „Moore’s Anti-Skeptical Strategies“ sind Thema von William G. Lycan. Er untersucht die verschiedenen gegen den Skeptizismus gerichteten Strategien, die sich in diversen Publikationen Moores finden lassen, von seinen frühen Texten zu Hume (aus dem Jahr 1910), über Eine Verteidigung des Common Sense (von 1925), Beweis einer Außenwelt (von 1939) bis zu Gewissheit (aus dem Jahr 1941) und schließlich Vier Philosophischer Literaturanzeiger 64 / 2 / 2011 210 Literaturberichte Formen des Skeptizismus (von 1959). Generell verfolge Moore eine Strategie, Plausibilitäten zu vergleichen, und zwar von philosophischen, skeptischen Argumentationen resp. Thesen und von Annahmen des täglichen Lebens. Dieses Verfahren zeige zwar keinen Widerspruch in der These des Außenweltskeptikers auf, verweise aber zu Recht auf die Relevanz der Lebenspraxis. Moores Außenweltbeweis bleibe, theoretisch betrachtet, „question-begging“ – gleichwohl ließe sich argumentativ auch nicht nachweisen, es gebe keine Außenwelt (vgl. 95). Auf teilweise ähnliche Weise deutet C. A. J. Coady Moores anti-skeptische Position, die dem Common-Sense mit der Annahme, es gebe eine Außenwelt, größere Sicherheit als der skeptischen Position zuspricht. Untersucht wird ferner Moores Sinnesdaten- und Wahrnehmungstheorie (von Paul Snowdon) und Moores Paradox (von Michael Huemer), das sich in Form des Beispielsatzes „Es regnet, aber ich glaube es nicht“ exemplifizieren läßt, aber auch in zahlreichen anderen Formulierungen vorliegen kann, wie Huemer verdeutlicht. Moore erkläre das Paradox mithilfe von Implikationen (wer behaupte, es regnet, impliziere, er glaube auch, es regne), aber es gebe auch andere Vorschläge, das Paradoxale solcher Aussagen zu erklären. Huemer zufolge sind „all purely linguistic solutions […] incomplete“ (144). Zentral für seine eigene Erklärung ist, daß solche Äußerungen gegen eine „knowledge norm“ verstießen, der zu folge jemand, der p glaubt, verpflichtet bzw. festgelegt („commited“) ist, sein Überzeugtsein auch als Wissen zu verstehen („one is […] rationally commited to taking one’s belief to be knowledge“, 145). Abweichende Äußerungen, die in Zusammenhang mit Moores Paradox stehen, erörtert schließlich Roy Sorensen in „Can the Dead Speak?“, und zwar in großer Zahl und Bandbreite. Er bestreitet, daß postmortale Artikulationen, die als Aufzeichnungen vorliegen, als Behauptungen von Toten zu analysieren wären. Im Kontext der Auseinandersetzung mit der Ethik von Moore setzt sich Stephen Darwall (in „How is Moorean Value Related to Reasons for Attitudes?“) mit der Frage auseinander, welcher Begriff grundlegend für die Moralphilosophie ist. In der Kontroverse zwischen Moore, der den „intrinsischen Wert“ als basal ansieht, und Sidgwick, der das „Sollen“ für fundamental hält, argumentiert Darwall zugunsten Sidgwicks (vgl. 188-194). Gegenüber Letztgenanntem wird aber auf einem anderen Philosophischer Literaturanzeiger 64 / 2 / 2011 Literaturberichte 211 Verständnis von Normativität insistiert (vgl. 188).3 Terry Horgans und Mark Timmons’ Thema ist eine adäquate Moralphänomenologie, die sie für eine jede Moralphilosophie für unverzichtbar halten. Sie führen in „Moorean Moral Phenomenology“ aus, daß Moores Argument der offenen Frage vor allem die Irreduzibilität des Normativen offen lege (vgl. 204). Eine Moralphänomenologie, die dies berücksichtige, vermeide den traditionellen Non-Kognitivismus (vgl. 210) und lasse objektiv wahrnehmbare Pflichten zu (vgl. 211). Moralische Urteile brächten, wie Moore behauptet, Überzeugungen zum Ausdruck (vgl. 213) und daher seien sie kognitiv. Aber contra Moore würden in moralischen Urteilen keine Aussagen über „objective moral properties being instantiated in the world“ (221) gemacht. Im Weiteren setzt sich Richard Fumerton in „Open Questions and the Nature of Philosophical Analysis“ kritisch mit dem Mooreschen Argument der offenen Frage auseinander – ein Argument, das auch in Charles R. Pigdens Text „Desiring to Desire: Russell, Lewis, and G. E. Moore“ eine wichtige Rolle spielt. Gleiches gilt für den Beitrag der Herausgeber, der den Titel „What’s Right with the Open Question Argument“ trägt. Die beiden Herausgeber konzipieren verschiedene Varianten des ursprünglich auf Moore zurückgehenden Arguments, um einen semantischen naturalistischen Reduktionismus zu widerlegen. Mit der Gegenposition, dem Non-Naturalismus, ist Robert Shaver in gleichnamigen Text befaßt. Dieser Non-Naturalismus ist insbesondere mit zwei Einwänden konfrontiert, meint Shaver: Er habe zum einen eine extravagante Ontologie und Epistemologie als Voraussetzungen, und zum anderen beantworte er keinerlei philosophische Fragen (vgl. 284). Vor allem die erste These versucht Shaver zurückzuweisen. Etliche weitere Aspekte der Mooreschen Ethik spricht Joshua Gert in „Beyond Moore’s Utilitarianism“ an. Wie Moore geht Gert davon aus, daß „gut“ nicht analysierbar und einfach ist. Anders als Moore nimmt Gert aber an, daß nicht Moores Gedankenexperiment der Isolation entscheidend für die Frage ist, ob etwas (und wenn ja, welchen) Wert hat. Moore zufolge muß man sich, fragt man nach dem intrinsischen Wert von etwas, bekanntlich vorstellen, ob dieses etwas geschätzt werde, wenn es völlig 3 Zu Darwalls Auseinandersetzung mit der Praktischen Philosophie von Moore siehe auch die folgende Besprechung. Philosophischer Literaturanzeiger 64 / 2 / 2011 212 Literaturberichte isoliert vorhanden wäre. Dieses Werthaben ergibt sich laut Gert vielmehr aus der von den Menschen geteilten Rationalität. Gegen Moore ist Gert zudem der Meinung, aus der Rationalität ergebe sich keine moralische Verpflichtung, Gutes zu maximieren; und Moore habe für jenes Maximierungsgebot keine überzeugende Argumentation vorgelegt. Abschließend erörtert Jonathan Dancy eine selten behandelte Frage. Ihm geht es um Moores Idee vom Wert organischer Einheiten im Kontext von Strafen. Geht man davon aus, daß Verbrechen einen Unwert darstellen, und daß strafende Handlungen für sich, also gänzlich separat betrachtet, ebenfalls einen Unwert repräsentieren, so bleibt zu klären, wieso „the disvalue of the crime is reduced by something which is still a disvalue, a way that leaves the combination still bad, but less bad than the crime would have been alone“ (341) – eine Frage, die sich offenbar aufgrund von Moores Moralontologie sinnvoll stellen läßt. Dieser Sammelband, der sich sowohl der theoretischen wie der praktischen Philosophie von Moore zuwendet, verdeutlicht das immense Potential der Mooreschen Philosophie: Positionen oder Themenstellungen resp. Argumente von Moore sind heutzutage in sehr beachtlicher Anzahl in teilweise verzweigten und ausdifferenzierten Diskussionen zu finden. Die verschiedenen Beiträge dieser Textsammlung, deren Themen und Positionen im Einzelnen weiter zu diskutieren wären (wie z. B. die oben erwähnte These, nach der man verpflichtet sei, seinen Glauben, dass p, als Wissen zu verstehen), nehmen auf sehr hohem Niveau die zum Teil komplexen Argumente Moores bzw. die durch die bisherige Moore-Rezeption komplex gewordenen Thematiken auf und führen sie (kontrovers) weiter. Darüber hinaus betten sie die Überlegungen (Moores) zum Teil in größere Kontexte ein. Daher ist der Band für jede und jeden, die bzw. der an Moore resp. seiner Philosophie oder den von ihm aufgeworfenen Problemen interessiert sind, in hohem Maße lesenswert. Terry Horgan, Mark Timmons (Eds.): Metaethics after Moore. 416 S., Oxford University Press, Oxford u. a. 2006; ISBN 978-0-19-926991-4, £ 30,– Dieser Sammelband enthält, von der Einleitung abgesehen, wie der zuvor besprochene 16 Beiträge. Diese Beiträge fallen aber im Gegensatz Philosophischer Literaturanzeiger 64 / 2 / 2011 Literaturberichte 213 zum vorher vorgestellten Band allesamt in den Bereich der praktischen Philosophie. Sie verteilen sich auf vier Sektionen. Die ersten sechs Aufsätze gehören zur allgemeinen Ethik und untersuchen zentrale Annahmen Moores, die folgenden drei zur „moral semantics“. Es folgen fünf Beiträge zur „moral metaphysics“. Zwei Aufsätze zur „moral epistemology“ schließen den Band ab. Gemäß dem Titel des Bandes geht es um „Metaethics after Moore“, also nicht ausschließlich um die Philosophie von Moore. Moore wird eher als ein Philosoph betrachtet, der die englischsprachige Moralphilosophie in ihrer Entwicklung im 20. Jahrhundert insgesamt maßgeblich angeregt und beeinflusst hat – und nicht nur den Intuitionismus. Und dies berücksichtigt der Band. Der erste Teil setzt mit Stephen Darwalls Text „How Should Ethics Relate to (the Rest of) Philosophy? Moore’s Legacy“ ein, der zunächst Moores Beitrag zur Analytischen Philosophie und zur Metaethik würdigt. Insbesondere ist es Darwall zufolge seit Moore möglich, Fragen der Metaethik und der normativen Ethik getrennt voneinander zu erörtern (vgl. 19 und 22 f.). Mit Moore ist Darwall der Auffassung, „that ethical concepts have an irreducible core“ (26), aber der bestehe – contra Moore – nicht in intrinsischem Wert, sondern im Begriff der Normativität bzw. dem der normativen Gründe (vgl. 26 und 32). Was einen intrinsischen Wert habe, müsse etwas sein, was wertgeschätzt werden solle (vgl. 28). Weitere Aufsätze dieses ersten Teils behandeln Fragen nach Gründen (Jonathan Dancy: „What Do Reasons Do?“), rationalen Wertungen (Sigrún Svavarsdóttir: „Evaluations of Rationality“) und dem Zusammenhang von intrinsischem Wert und Handlungsgründen (im Beitrag Robert Audi); ferner geht es um den Begriff des „personal good“ (in einem Aufsatz von Connie S. Rosato). Abgeschlossen wird dieser Teil von einem Beitrag von Michael Smith mit dem Titel „Moore on the Right, the Good, and Uncertainty.“ Er erörtert, was es angesichts der notorischen Unsicherheiten über die Folgen einer jeden Handlung besagen kann, daß moralisch richtige Handlungen positive Werte maximieren sollen (vgl. 133). Schließlich könne man nur mutmaßliche Handlungsfolgen einbeziehen. In diesem Kontext wird Frank Jacksons Kritik an Moores Konsequentialismus diskutiert, der (mit Hilfe suggestiver Beispiele) darauf hingewiesen hat, daß es auch eine Rolle spiele, Philosophischer Literaturanzeiger 64 / 2 / 2011 214 Literaturberichte wessen Einschätzung mutmaßlicher Handlungsfolgen herangezogen werden (z. B. wenn eine Handlung ein hohes Risiko für eine andere Person als die handelnde darstellen kann, macht es einen Unterschied, ob der Akteur oder der Betroffene sich zugunsten der risikoreichen Handlung ausspricht). Zudem sei aber zu berücksichtigen, so Smith, welche Wertvorstellungen die jeweils an der Handlung beteiligten Personen haben (vgl. 141). Dann aber gehe es letztlich um die Maximierung nicht nur eines erwartbaren Nutzens oder erwartbarer Werte, sondern aus der Perspektive des Akteurs um das Maximieren erwarteter „valuesas-I-see-things“ (147) – eine deutlich komplexere Analyse des richtigen Handelns als die von Moore, die nahe liegend erscheint, sofern man die Vorgaben aus der Mooreschen Philosophie der Moral akzeptiert. Im Teil über „moral semantics“ geht es um Zusammenhänge des Mooreschen Arguments der offenen Frage mit moraltheoretischen Einsichten von Thomas Scanlon („Scanlon versus Moore on Goodness“ von Philip Stratton-Lake und Brad Hooker) und um den Zusammenhang von Moores Open-Question-Argument und dem Regelfolgen als prominentem Thema der Wittgensteinschen späten Sprachphilosophie (in einem Beitrag von Paul Bloomfield). Bloomfield intendiert nachzuweisen „that there is no peculiar or queer sui generis form of normativity which infects the meaning of the word ‚good‘; whatever it is that keeps the definition of other words […] open“ (171). Im dritten Beitrag dieser Sektion wirft Jamie Dreier die interessante, zunächst paradox scheinende Frage „Was Moore a Moorean?“ auf. „Moorean“ sei man in der Metaethik, wenn man „gut“ für nicht analysierbar halte und man zugleich annehme, daß der Terminus eine nicht-natürliche Eigenschaft bezeichne. Die Frage, inwieweit Moore die zweite Position tatsächlich vertreten habe, ist Dreiers Untersuchungsgegenstand. Sie meint, „that there is no coherent conception of ‚non-natural‘ properties“ (193) in der „Principia Ethica“. Schwierigkeiten bereiteten jedenfalls Explikationen (Moores), nach denen man sich solche Eigenschaften vorstellen solle „existing by itself in time and not merely as a property of some object“ (194). Auch die weiteren Erläuterungen Moores in diesem Kontext bleiben Dreier zufolge problematisch. Die Sektion „moral metaphysics“ wird von Russ Shafer-Landaus Aufsatz „Ethics as Philosophy. A Defense of Ethical Nonnaturalism“ Philosophischer Literaturanzeiger 64 / 2 / 2011 Literaturberichte 215 eröffnet. In ihm wird die von Moore geteilte Auffassung verteidigt, daß es moralische Eigenschaften gebe, die nicht-natürlich sind. Entsprechend verfahre die Ethik wie die Philosophie insgesamt nicht wie eine empirische Wissenschaft: Die Moralphilosophie greife nicht auf empirisch-wissenschaftliche Methoden zurück wie z. B. die induktive Verallgemeinerung, die Philosophie resp. die Ethik mache keine Kausalitätsannahmen und sie gebe auch keine Beschreibungen historischer Sachverhalte (vgl. 211). Dennoch ließe sich, so Shafer-Landau, ein moralischer Realismus bzw. ein „nonnaturalistic moral realism“ als plausibel ausweisen (vgl. 230). Im Anschluß daran untersucht Judith Jarvis Thomson Moores Argument der offenen Frage genauer. Sie hält das Resultat des Arguments, nach dem gut eine nichtnatürliche Eigenschaft sei, für „suspect“ (233). Wichtig sei es, einzusehen, daß nichts einfach nur „gut“ sei; „all goodness is goodness in a way“ (247); ähnliches gelte für „right“. Insofern sei Moores Prämisse des Arguments, nach der es eine Eigenschaft (bloßer) Gutheit gebe, nicht unqualifiziert zu übernehmen. Einen weiteren Beitrag zur „moral metaphysics“ stellt der Beitrag „Cognitivist Expressivism“ dar, der von den beiden Herausgebern gemeinsam verfaßt ist. Sie plädieren für eine Kombination von „nondescriptivism and cognitivism“ (257), was sie vom non-kognitiven Emotivismus abgrenzt (und Simon Blackburns Position, dem Quasi-Realismus, annähert). Sie behalten Moores Auffassung von der Irreduzibilität moralischer Termini bei (vgl. 259), gehen aber keineswegs davon aus, daß die Sprache der Moral deswegen ihren kognitiven Gehalt verlöre. Moralische Äußerungen könnten – wie eine (moral‑)phänomenologische Untersuchung zeige – wahr oder falsch sein (vgl. 265) und Teil von komplexen logischen Zusammenhängen und Inferenzen sein (vgl. 269). Weitere Beiträge thematisieren den Expressivismus, so Stephen Baker in „Truth and the Expressing in Expressivism“ und Alan Gibbard in „Normative Properties“, der sich von der Auffassung früher Emotivisten bzw. Nonkognitivisten wie Alfred J. Ayer und Charles Stevenson bezüglich normativer Eigenschaften absetzt. Unter der Rubrik „moral epistemology“ finden sich schließlich zwei Beiträge: Von Walter Sinnott-Armstrong der Aufsatz „Moral Intuitionism Meets Empirical Psychology“ und von Panayot Butchvarov „Ethics Dehumanized“. Sinnott-Armstrong befaßt sich damit, den Philosophischer Literaturanzeiger 64 / 2 / 2011 216 Literaturberichte Intuitionismus als Erkenntnismethode der Mooreschen Moralphilosophie in den Kontext empirischer Humanwissenschaften zu stellen und mögliche psychologische Einflüsse auf moralische Intuitionen aufzuzeigen. Sein zentrales Anliegen besteht in folgendem: „In particular, I will argue that some recent research in psychology and brain science undermine moral intuitionism“ (340). Dabei wird unter „Intuitionismus“ die Annahme verstanden, daß eine Person moralische Überzeugungen haben könne, auch ohne über Gründe für diese moralischen Annahmen zu verfügen. Dennoch, so diese Begriffsbestimmung weiter, könne die genannte Person bzw. könnten ihre Intuitionen angemessen gerechtfertigt sein (vgl. 341 f.). Begründungen resp. „confirmations“ (Bestätigung, Stützungen) für Überzeugungen sind nach Sinnott-Armstrong allerdings generell erforderlich, wenn die überzeugte Person zugleich Partei sei, bei Uneinigkeiten, beim Vorliegen von emotionalen Einflüssen, wenn Illusionen im Spiel seien oder sofern Quellen der Überzeugungen zweifelhaft wären (vgl. 343–346). Moralische Überzeugungen sind aber Überzeugungen, bei denen die genannten Kriterien erfüllt sind, meint Sinnott-Armstrong (vgl. 358), daher brauchten sie „confirmations“. Ein bloßer Intuitionismus resp. ein sich Berufen auf Intuitionen wäre daher nicht ausreichend. Der Sammelband vereinigt nicht nur eine Vielzahl namhafter Autoren und gegenwärtig führender (Meta-)Ethiker, sondern dokumentiert vor allem auch, wie viele bedeutsame Anregungen auf die Mooreschen Erörterungen in der Moralphilosophie zurückgehen. Auch wenn die zahlreichen Thesen der Autoren eigene weiterführende Diskussionen und Kritiken verlangten, kann pauschal festgehalten werden, daß dieser Sammelband ausgesprochen anregend ist. Dies gilt sowohl für die unmittelbaren Auseinandersetzungen mit Moores Überlegungen, die zahlreiche interessante Kritiken artikulieren und Weiterführungen Moorescher Gedanken enthalten, als auch für die Erörterungen, die sozusagen als „nach Moore“ zu charakterisieren sind und Probleme bearbeiten, die sich aus der von Moore entscheidend mit angeregten metaethischen Debatte ergeben (haben). Philosophischer Literaturanzeiger 64 / 2 / 2011 Literaturberichte 217 Brian Hutchinson: G. E. Moore’s Ethical Theory. Resistance and Reconciliation. 219 S., Cambridge University Press, Cambridge u. a. 2007; ISBN 978-0-521-03782-2, £ 28,99 Hutchinsons Monographie beansprucht, eine umfassende Darstellung der Moralphilosophie von G. E. Moore zu präsentieren. Sie bezieht sich aber in weiten Teilen auf Moores Principia Ethica, und auch wenn sie auf diverse Aufsätze Moores ebenfalls eingeht, so spielt Moores zweites Buch zur Philosophie der Moral, Ethics, eine nur sehr untergeordnete Rolle. Insofern stellt der Text eher eine kommentierende Gesamtdarstellung der berühmten Principia Ethica dar, die auch Teile der bisherigen Rezeption dieses Werkes einbezieht. Hutchinsons sorgfältig rekonstruierender und interpretierender Text enthält neben der Einleitung, in der auf einige Ähnlichkeiten von Moores Philosophie und der des jungen Wittgenstein hingewiesen wird, insgesamt zehn Hauptkapitel, die ihrerseits weiter untergliedert sind. Nach Hutchinson teilt Moore manche Auffassung mit dem Verfasser des Tractatus logico-philosophicus: So sei es auch für Moores Philosophie zentral, das Philosophieren zu beenden bzw. beenden zu können (vgl. 13). Nach Moore hätten alle Philosophen einige Tatsachen des Lebens schlicht zu akzeptieren (vgl. 13). „Moore’s great aim in ethics is to expose and expunge philosophy’s revisionary impulse in order to defend the things we know to be irreplaceble in any sane way of life“ (13). Daher habe die Philosophie „reactionary“ (14) zu sein; „the sole job of philosophy is to resist philosophy“ (14). Kapitel 1 erörtert Moores Vorstellungen von „Einfachheit“, „Undefinierbarkeit“ und „Nichtnatürlichkeit“. Nach Moore ist der zentrale Terminus der Ethik, „gut“, bekanntlich einfach und undefinierbar. Er bezeichnet, so Moore weiter, eine nichtnatürliche Eigenschaft. Dies trennt Moore von den Empiristen, die das bestreiten, und von den Metaphysikern, die diese These fehlinterpretierten (vgl. 27). Die Undefinierbarkeit von „gut“ suchte Moore durch das „Argument der offenen Frage“ („open question argument“) herauszustellen, dessen Bedeutung und Stellenwert festzustellen aber Probleme bereitet (vgl. 28 ff.). Kapitel 2 geht dann der These nach, die mit „gut“ bezeichnete Eigenschaft sei nichtnatürlich, da natürliche Eigenschaften in der Zeit existierten, und Philosophischer Literaturanzeiger 64 / 2 / 2011 218 Literaturberichte nichtnatürliche – wie gut – dies gerade nicht täten (vgl. 39). Gleichwohl verbleiben auch hier Probleme der genauen Bestimmungen (vgl. 47). Vor allem sei aber bedeutsam, wie man lerne, daß einige Entitäten im Gegensatz zu anderen gut sind. Hutchinson geht davon aus, daß man es seit der Kindheit durch die Erwachsenen und ihre Urteile erlerne. Dies geschehe so, daß man es später als völlig selbstverständlich erachte, dieses oder jenes als gut zu bewerten. Zudem würden die so erworbenen Wertschätzungen bzw. Wertungen in hohem Maße verinnerlicht (vgl. 49 f.). Dieses Wissen von den Werten, so Kapitel 3, gehe auch später nie gänzlich verloren, bereite aber für das philosophische Verstehen Probleme (vgl. 61). Vor allem sorge es (über das Argument der offenen Frage) dafür, daß die Eigenschaft gut nicht mit einer anderen (natürlichen) Eigenschaft identifiziert werden kann. Gutes löse zwar angenehme Gefühle aus, gut sein sei aber nicht mit diesen Gefühlen oder dem Auslösen dieser Gefühle identisch, was die Hedonisten verkennten. „Gut“ bezeichne eine einfache, unanalysierbare Eigenschaft, vergleichbar mit „gelb“. (Dieser Vergleich ist jedoch, wie Hutchinson zeigt, keineswegs unproblematisch; vgl. 72 ff.). Gleichwohl sei unsere Kenntnis der Eigenschaft gut zu verbessern – darin bestehe die (zukünftige) Aufgabe der Moralphilosophie, die in der Vergangenheit nicht gelöst worden sei (vgl. Kapitel 4). Was die Eigenschaft gut habe, liege (so Kapitel 5) im Common Sense unpräzise, ungeordnet und unreflektiert vor. Die Philosophie der Moral solle diese Inhalte nicht grundsätzlich verändern, „the general picture in ethics is one of refinement not revolt“ (93); zuviele Änderungen führten zu einem veränderten bzw. anderen Untersuchungsgegenstand. Breiten Raum (Kapitel 6 und 7) nimmt die Rekonstruktion von Moores Kritik am Egoismus ein, genauer: Moores Kritik an einer besonderen Version des Egoismus, die Moore für selbstwidersprüchlich hält. Gemeint ist ein universeller Egoismus, für dessen Position zu argumentieren versucht wird und der eines jeden Einzelnen Glück zum alleinigen Guten erklärt („each person’s good […] is the sole good“, 121). Argumentierten mehrere Personen auf diese Weise, „many different things become the sole good“ (122) – und dies sei kontradiktorisch. 4 Allerdings ist der von 4 Vgl. zum Thema auch: Wulf Kellerwessel: Normenbegründung in der Analytischen Ethik, Würzburg 2003, 130 ff. Philosophischer Literaturanzeiger 64 / 2 / 2011 Literaturberichte 219 Moore konzipierte Egoismus nicht die einzig denkbare Version eines Egoismus, wie auch Hutchinson zurecht herausstellt, und zunächst plausibler erscheinende Varianten werden von Moores Argumentation nicht betroffen. Kapitel 8 wendet sich Moores Auffassungen von moralischen resp. gesellschaftlichen Regeln zu. Moore klassifiziert solche Normen erstens in solche, die für stabile Gesellschaften notwendig erscheinen (wie z. B. das Mordverbot), zweitens in nicht notwendige, aber verbreitete Regeln, und drittens in von Philosophen zur allgemeinen Befolgung konzipierte Regeln (vgl. 146). Moore verteidigt als Common-Sense-Philosoph die erstgenannten Regeln und weist die zuletzt angeführten zurück. In Auseinandersetzung mit Tom Regans Deutungen, der in Moore einen Verteidiger des Individuums gegen einen „,moral imperalism‘ of rule makers“ (147) sieht, geht Hutchinson davon aus, daß Moore auch mit Blick auf die zweite Klasse der Regeln dem Common-Sense großes Gewicht beimißt. Regeln helfen, das Gute zu maximieren, motivieren und unterstützten die Unparteilichkeit (vgl. 165 f.) – und dies spreche im Rahmen der Mooreschen Moralphilosophie zu ihren Gunsten. Dies passe auch zu Moores (moralischem) Konservatismus, der in den Schlußkapiteln 9 und 10 weiter erläutert wird, unter anderem im Zusammenhang mit Moores Religionskritik resp. seinem Agnostizismus bzw. Atheismus sowie mit den Mooreschen Auffassungen über den Wert der Kunst. Hutchinsons Studie stellt nicht nur die wesentlichen Aspekte der Mooreschen Ethik, wie sie in der Principia Ethica entwickelt sind, in ihrem Zusammenhang und in ihren ontologischen Kontexten dar, sondern zeigt auch an vielen Stellen Interpretationsprobleme und interne Spannungen in Moores Moralphilosophie auf. Obwohl die Studie offenbar in vielen Punkten mit den Analysen Moores konform geht, übt sie an etlichen Details Kritik. Zudem nimmt sie zu der einen oder anderen Interpretation (z. B. von Tom Regan) oder Kritik (etwa von Alasdair MacIntyre) kritisch Stellung. Im Rahmen der insgesamt positiven Einstellungen unterbleiben jedoch ausführliche kritische Diskussion zentraler Voraussetzungen von Moores Moralkonzeption resp. seinem Intuitionismus und seinem Konsequentialismus. Nicht abschließend erörtert wird z. B. das Problem unterschiedlicher und inhaltlich unvereinbarer Behauptungen über den moralischen Gehalt des ComPhilosophischer Literaturanzeiger 64 / 2 / 2011 220 Literaturberichte mon Sense resp. mehrerer Common Sense (falls es solche gibt) und die Schwierigkeit, überzeugend den Konsequentialismus als Teil des Common Sense auszuweisen. Zudem bliebe die normative Verbindlichkeit des Common Sense weiter zu erörtern. Und auch zum Thema von Normen bzw. Regeln und (universalisierten) Pflichten wäre noch weiteres zu sagen. Gleichwohl hat Hutchinson eine sehr lesenswerte Studie zur Moralkonzeption in Moores Principia Ethica vorgelegt. Alles in allem zeigen die Sammelbände und die Diskussionen zu Moores Philosophie, daß Moores Philosophie keineswegs ihre Aktualität eingebüßt hat. Gleichwohl verdeutlichen die Debatten auch, daß einhellige Einschätzungen darüber, was Moores eigentliches Verdienst über das Anregen von Kontroversen und vielleicht das Anregen zu besonders sorgfältiger Analyse hinaus ist, derzeit nicht vorliegen. Philosophischer Literaturanzeiger 64 / 2 / 2011