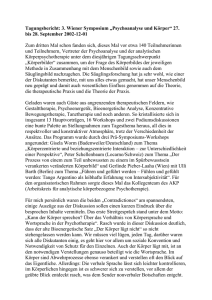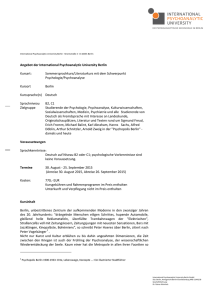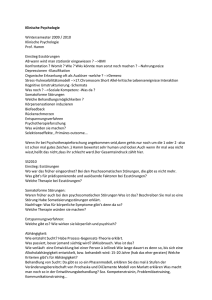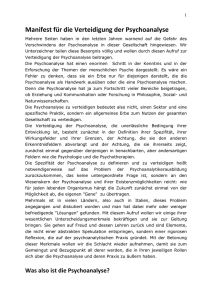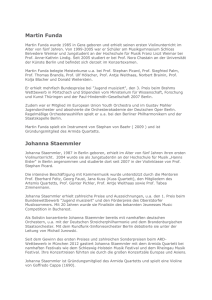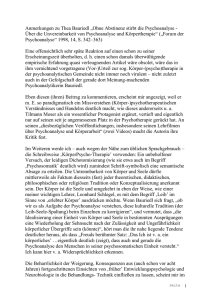Die relationale Psychoanalyse
Werbung
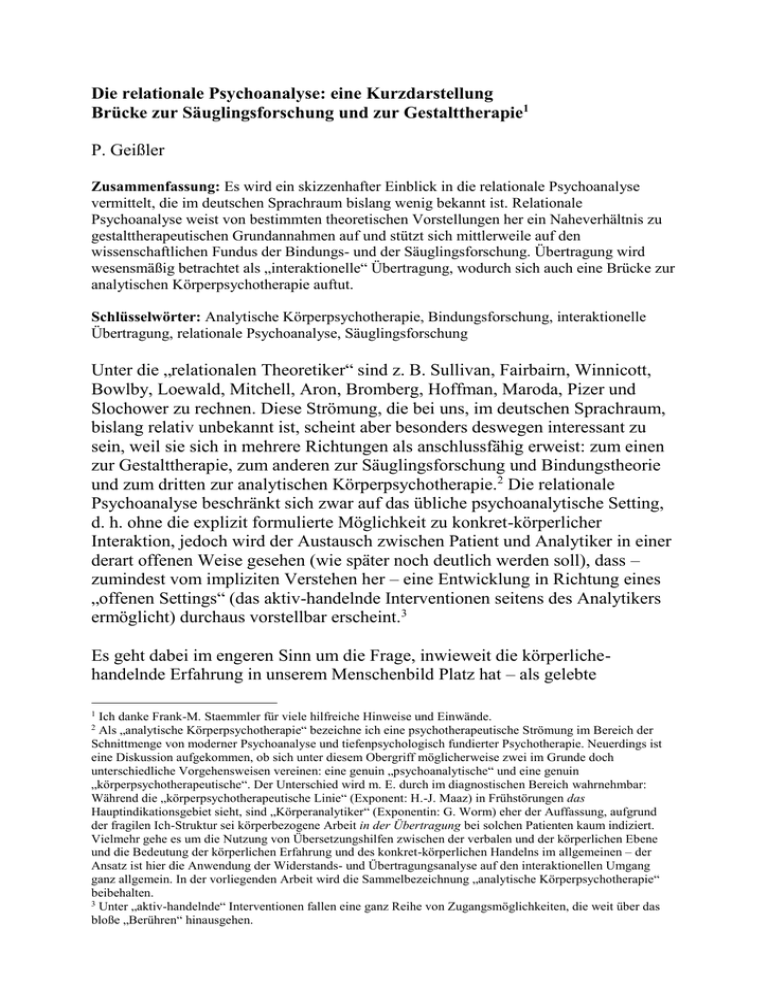
Die relationale Psychoanalyse: eine Kurzdarstellung Brücke zur Säuglingsforschung und zur Gestalttherapie1 P. Geißler Zusammenfassung: Es wird ein skizzenhafter Einblick in die relationale Psychoanalyse vermittelt, die im deutschen Sprachraum bislang wenig bekannt ist. Relationale Psychoanalyse weist von bestimmten theoretischen Vorstellungen her ein Naheverhältnis zu gestalttherapeutischen Grundannahmen auf und stützt sich mittlerweile auf den wissenschaftlichen Fundus der Bindungs- und der Säuglingsforschung. Übertragung wird wesensmäßig betrachtet als „interaktionelle“ Übertragung, wodurch sich auch eine Brücke zur analytischen Körperpsychotherapie auftut. Schlüsselwörter: Analytische Körperpsychotherapie, Bindungsforschung, interaktionelle Übertragung, relationale Psychoanalyse, Säuglingsforschung Unter die „relationalen Theoretiker“ sind z. B. Sullivan, Fairbairn, Winnicott, Bowlby, Loewald, Mitchell, Aron, Bromberg, Hoffman, Maroda, Pizer und Slochower zu rechnen. Diese Strömung, die bei uns, im deutschen Sprachraum, bislang relativ unbekannt ist, scheint aber besonders deswegen interessant zu sein, weil sie sich in mehrere Richtungen als anschlussfähig erweist: zum einen zur Gestalttherapie, zum anderen zur Säuglingsforschung und Bindungstheorie und zum dritten zur analytischen Körperpsychotherapie.2 Die relationale Psychoanalyse beschränkt sich zwar auf das übliche psychoanalytische Setting, d. h. ohne die explizit formulierte Möglichkeit zu konkret-körperlicher Interaktion, jedoch wird der Austausch zwischen Patient und Analytiker in einer derart offenen Weise gesehen (wie später noch deutlich werden soll), dass – zumindest vom impliziten Verstehen her – eine Entwicklung in Richtung eines „offenen Settings“ (das aktiv-handelnde Interventionen seitens des Analytikers ermöglicht) durchaus vorstellbar erscheint.3 Es geht dabei im engeren Sinn um die Frage, inwieweit die körperlichehandelnde Erfahrung in unserem Menschenbild Platz hat – als gelebte 1 Ich danke Frank-M. Staemmler für viele hilfreiche Hinweise und Einwände. Als „analytische Körperpsychotherapie“ bezeichne ich eine psychotherapeutische Strömung im Bereich der Schnittmenge von moderner Psychoanalyse und tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie. Neuerdings ist eine Diskussion aufgekommen, ob sich unter diesem Obergriff möglicherweise zwei im Grunde doch unterschiedliche Vorgehensweisen vereinen: eine genuin „psychoanalytische“ und eine genuin „körperpsychotherapeutische“. Der Unterschied wird m. E. durch im diagnostischen Bereich wahrnehmbar: Während die „körperpsychotherapeutische Linie“ (Exponent: H.-J. Maaz) in Frühstörungen das Hauptindikationsgebiet sieht, sind „Körperanalytiker“ (Exponentin: G. Worm) eher der Auffassung, aufgrund der fragilen Ich-Struktur sei körperbezogene Arbeit in der Übertragung bei solchen Patienten kaum indiziert. Vielmehr gehe es um die Nutzung von Übersetzungshilfen zwischen der verbalen und der körperlichen Ebene und die Bedeutung der körperlichen Erfahrung und des konkret-körperlichen Handelns im allgemeinen – der Ansatz ist hier die Anwendung der Widerstands- und Übertragungsanalyse auf den interaktionellen Umgang ganz allgemein. In der vorliegenden Arbeit wird die Sammelbezeichnung „analytische Körperpsychotherapie“ beibehalten. 3 Unter „aktiv-handelnde“ Interventionen fallen eine ganz Reihe von Zugangsmöglichkeiten, die weit über das bloße „Berühren“ hinausgehen. 2 Erfahrung, nicht nur als kognitiv-reflektierte; inwieweit also ein Körperbewusstsein einen gleichrangigen Platz neben dem kognitiven Bewusstsein haben kann. Insofern versteht sich analytische Körperpsychotherapie, wie andere Körperpsychotherapien auch, als kritisches Gegengewicht gegenüber ein rational überbetonten und körperlichen Prozessen entfremdeten westlichen Lebenskultur. So weist der bekannte Gestalttherapeut Gary Yontef (Quellenangabe: Homepage, siehe Lit. Verzeichnis) zurecht auf bestimmte implizite, triebtheoretisch geprägte Vorstellungen hin, die zwar heute – im Zuge der neuen Objektbeziehungstheorien und der psychoanalytischen Selbstpsychologie – nicht mehr die Bedeutung haben wie in der Ära der klassischen Triebtheorie. Sie spielen aber da und dort – in bestimmten kleinianischen Richtungen beispielsweise – noch immer eine Rolle. Nach der alten Auffassung ist der Mensch ein instinkthaftes, in seinem Kern gleichermaßen tierhaftes Wesen, dessen Denken ein Abkömmling, eine Umwandlung tierischer Energien ist. Das Instinkthafte wird – in einer mehr oder weniger wertenden Form – mit dem Infantilen gleichgesetzt. Der menschliche Geist bestehe auf vielschichtigen Kompromissen zwischen dem Ausleben von Impulsen und deren Abwehrkräften, die sie hemmen und umlenken wollen. Auch die Fantasiewelt sei von diesen in instinkthaften Kräften (z. B. von primären aggressiven Fantasien) beherrscht. Die klassische psychoanalytische Arbeit bestand daher im Aufdecken dieser instinkthaften Energien und wenn möglich im Verzicht auf kindliche, instinkthafte Impulse. Die stärkste Kraft in der Persönlichkeitsentwicklung ist aus dieser Sicht das Schuldgefühl. Eine reife Form der Selbstzufriedenheit komme durch die Sublimierung dieser tierischinfantilen Energien zustande, weshalb – und hier steckt wieder eine implizite Wertung drin – bedürftige und psychisch abhängige Menschen als schwach, krank, unreif, regrediert oder schlecht, gefährlich, agierend angesehen wurden.4 Als vorrangiges Entwicklungsziel galt, speziell in der Ära von Margret Mahler, das Erreichen von Autonomie und Unabhängigkeit. Interessant wäre zu diskutieren, ob die seinerzeitige Ächtung von Bowlbys Bindungstheorie seitens der Psychoanalyse hier einen Hintergrund hatte. Bedürftigkeit war im damaligen psychoanalytischen Modell eine Schwäche und etwas Beschämendes – die wichtige Rolle des Schamgefühls wurde damals missverstanden.5 Die Gestalttherapie hat hingegen mit ihrem Feldmodell den Organismus als grundlegend eingebettet und in wechselseitiger Bezogenheit mit der Umwelt verstanden und geht hier Hand in Hand mit modernen Diese Wertigkeit war interessanterweise auch im bioenergetischen charakteranalytischen Modell spürbar – zumindest in meiner Lehrzeit von 20 Jahren. „Orale“ Charaktere als Prototyen schwacher und abhängiger Menschen rangierten in der „Beliebtheits“-Hierarchie der Charaktertypen an letzter Stelle. 5 Diese impliziten Wertungen veranlassten mich seinerzeit, den aktuellen Stellenwert und die Bedeutung des Regressionsbegriffs neu zu überdenken. Vgl. Geißler, P. (2001). 4 Objektbeziehungstheoretikern und Selbstpsychologien. Einer der konsequentesten von psychoanalytischer Seite ist der „relationale Ansatz“. Dabei gibt es auch innerhalb der relationalen Autoren nicht zu allen Fragen Einigkeit. So steht Sullivan (1950), der auf sprachliche Genauigkeit größten Wert legt, mit seiner Ansicht, die Sprache sei gleichzusetzen mit dem Beginn der Menschwerdung, der Meinung Mitchells (2003, S. 41) und der Gestalttherapie (vgl. Staemmler 2003a) gegenüber, die – sich auf Stern berufend – in der Sprache ein zweischneidiges Schwert sehen. Sullivan glaubt, Wörter verkörpern die Besonderheiten eines ursprünglichen Zusammenhanges, weshalb alle Eltern so aufgeregt seien, wenn ihr Kind zum ersten Mal „Mama“ oder etwas Ähnliches sagt. Aber es habe seinen Sinn, wenn die „parataktischen“ Eigenschaften verloren gehen, denn erst dann könne Sprache wirklich benutzt werden, so dass andere Kommunikationsteilnehmer sie genau verstehen. Überreste des ursprünglichen „parataktischen“ Kontextes bleiben nach Sullivan nur als eine Art Privatsprache erhalten – eine Art „autistische Residuen“ im Sinne nichtsprachlicher Reste, welche die Möglichkeiten der Sprache grundsätzlich aber schmälern. Mitchell sieht das mit Stern entschieden anders. Denn „es gibt auch Bereiche unseres Erlebens, die wir mit anderen Menschen weniger leicht teilen können und die uns selbst nicht unmittelbar zugänglich sind, weil die Sprache sich dem entgegenstellt. Sie treibt einen Keil zwischen zwei simultane Formen interpersonalen Erlebens: die Form, wie Interpersonalität gelebt, und die Form, wie sie verbal dargestellt wird. Das Erleben in den Bereichen der auftauchenden, der Kern- und der intersubjektiven Bezogenheit, die ungeachtet der Sprache weiterhin erhalten bleiben, kann der Bereich der verbalen Bezogenheit nur sehr partiell mit einschließen. Und in dem Maße, in dem das Geschehen im verbalen Bereich als wirkliches Geschehen betrachtet wird, unterliegt das Erleben in den anderen Bereichen einer Entfremdung. (Sie können zu „niederen“ Erlebnisbereichen herabsinken.) Die Sprache bewirkt also eine Spaltung im Selbsterleben. Überdies verlagert sie die Bezogenheit von der persönlichen, unmittelbaren Ebene dieser Bereiche auf die ihr selbst inhärente, unpersönliche, abstrakte Ebene (Stern 1992, S. 231f.). Mit anderen Worten: Die reichsten Formen des Erlebens entstammen der präverbalen Entwicklungsphase mit ihren dichten kreuzmodalen Sinneserfahrungen – man kann das Erleben des Säuglings und kleiner Kinder durchaus als zutiefst sinnlich bezeichnen. Andacht fühlen, Ergriffensein, still staunendes Wahrnehmen – diese Affektbereiche bilden sich in der Persönlichkeitsentwicklung früh heraus und sind bei Kindern als Erlebnisbereiche nachfühlbar (vgl. dazu auch Hoffmann-Axthelm 2003). Die sinnliche Intensität geht mit dem Aufkommen der Sprache verloren. Es ist ein Verdienst all jener psychotherapeutischen Ansätze, die explizit an und mit dem Körper arbeiten, auf den emotionalen Reichtum dieser vorsprachlichen „Domäne“ aufmerksam zu machen. Dieser Auffassung schließt sich auch der in der psychotherapeutischen Literatur zu wenig beachtete Analytiker Loewald, ein Analysand und Schüler von Sullivan und zugleich Student bei Heidegger an. Während Freud der Ansicht war, es geben ein klar definierbare Kluft zwischen vorsprachlichem und sprachlichem Bereich, zwischen Primär- und Sekundärprozess, die auch das Traumerleben prägt (damit die unbewusste infantile Triebstrebung im Traummotiv das Bewusstsein erreichen kann, muss sie sich an Worte heften, die aus den Tagesresten stammen), bezweifelt Loewald (1977) genau diese Trennung. Für ihn sind vielmehr die Arbeitsweisen der Sprache auf allen Entwicklungsebenen der seelischen Struktur bedeutsam. Schon wenn die Mutter zum Säugling spricht, ist ihre Sprache ein wesentliches Transportmittel ihrer Person – durch ihren Sprachfluss, den Klang der Stimme, den Rhythmus der gesprochenen Worte – und dies sogar schon vorgeburtlich. Loewald muss daher auch als Wegbereiter einer seriösen pränatalen Psychologie betrachtet werden. Für ihn ist weniger die Unterscheidung zwischen „verbal“ und „präverbal“ von Bedeutung, sondern zwischen einer Entwicklungsphase, bei der Wort und Klang in der Dichte eine ganzheitlichen Erlebens aufgehen, und einer späteren Phase, wo die semantischen gegenüber den sinnlich-affektiven Eigenschaften der Sprache Vorrang erhalten. Mitchell (2003 53f.), der sich in wesentlichen Aspekten auf Loewald beruft, liest sich beinahe schon körperpsychotherapeutisch, wenn er über die affektivsinnliche Wirkung von Worten Gedanken macht. Er ist an Klängen von Worten interessiert, genauso wie Loewald, und an der physikalischen Erfahrung bei Aussprechen von Worten – z. B. am Wort „dig“ (dt.: schürfen): „Dabei ist mir aufgefallen, wie sehr der aggressiv-durchdringende Klang des Wortes... zu seiner Bedeutung passt... Um das Wort auszusprechen, muss man die Zungenspitze gegen den Daumen drücken und die Lippen leicht von den Zähnen zurückziehen. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr schien mir, dass die Bedeutung, der Klang und die physische Aktivität, die man brauchte, um das Wort zu formen, dass alle diese Komponenten zusammen daran beteiligt waren, einen seelischen Zustand zu erzeugen und eine besondere Form der Bezogenheit... herzustellen.“ Mitchell kommt etwas später zu dem Schluss (und schließt hier wiederum an Loewald an), dass ein wesentliches Element dieser frühen und sinnlichen Entwicklungsphase der Affekt Freude / Spaß ist. Eine Sprache ist für ihn eine „verbundene Sprache“, wenn ihr affektive Qualitäten in breiten Variationen und insbesondere die affektive Qualität der Freude im Gesprochenen mitschwingen kann. Damit befindet sich Mitchell sowohl im Einklang mit der Gestalttherapie, die eine lebendige „Kontaktsprache“ an die Stelle reinen „Verbalisierens“ setzen will (vgl. Perls et al. 1979; Staemmler 2003a), als auch mit analytischen Körperpsychotherapeuten, die sowohl auf die Wichtigkeit sprachlicher Verbundenheit mit basalen Erlebensmodi (Berliner 1994) als auch auf die Bedeutung der Freude explizit aufmerksam machen (Heisterkamp 2000). Mitchell (2003 S. 54) betont, dass es ihm wesentlich um die „Tiefendimensionen“ des Erlebens geht – um einen ganzheitlichen Erfahrungsmodus, gekennzeichnet durch ein Verschwimmen der Unterscheidung von Selbst und Anderem, von Innen und Außen, von Fantasie und Wahrnehmung – einem Erlebensmodus, der in unserer vorsprachlichen Entwicklungsperiode seine Blüte erlebt - aber das ganze Leben lang bestehen bleibt, wenn auch im Hintergrund! Wichtig: Dieses Erleben sei aber vom Wesen her nicht illusorisch, sondern ganz wirklich, ganz real! Hier spürt man Mitchell die Kritik an einem grundlegenden Freud´schen Paradigma, das im frühen kindlichen Erleben halluzinativ-illusorische Momente betont. Auch aus der Sicht der modernen Säuglingsforschung besteht an der realen Erfahrung des Säuglings im Grunde kein Zweifel. Mitchell geht damit genauso wie Loewald sogar über Winnicott einen entscheidenden Schritt hinaus, denn für Winnicott hatten die Fantasien einen sehr wichtigen Platz - aber eben als illusionärer Übergangsraum. Beide befassen sich auch mit Körpererinnerungen, mit Kinogrammen (Downing 1996) – beide unterstreichen, dass nicht immer Erinnerungen als Bild abgespeichert werden, sondern als kinästhetische Erinnerungen. Diese Ansicht steht ganz im Einklang mit der modernen Traumaforschung. Beide stellen Überlegungen zur grundlegenden These der Kleinianer über frühe introjektive und projektive Mechanismen an, in denen Substanzen und Körperteile gleichsam über die Grenze zwischen innen und außen hin- und herbewegt werden. Beispiel: „Wenn ich mich also dabei ertappe, im Ärger über meine Tochter genau die gleichen Ausdrücke zu verwenden, die mein Vater mir gegenüber verwendet hat, dann bin ich mit einem väterlichen Introjekt identifiziert, das zum Zwecke einer omnipotenten Kontrolle in mir aufgerichtet worden ist“ (Mitchell 2003, S. 61). Sie kommen zu einer von den Kleinianern abgrenzbaren, anderen Hypothese: „Die Worte meines Vaters (sind) nicht in mich hinein gebracht worden, sie sind ich“ (ebend.). Es aktualisiert sich eine frühe Erfahrung, für die kennzeichnend ist, dass der Unterschied zwischen „innen und außen“ noch keine wesentliche Rolle spielt. Diese Erfahrung tritt im genannten Moment in den Vordergrund. Domänen des Erlebens Dabei gibt es durchaus wichtige Parallelen zwischen Kleinianern und Säuglingsforschern. Eine der wichtigsten liegt für mich darin, dass beide von unterschiedlichen Modi des Erlebens ausgehen, die in einer Art Vorder/Hintergrundbeziehung zueinander stehen, in Anlehnung an eine gestaltpsychologische Sichtweise des Erlebens. D. h. die Psyche organisiert Erfahrung nach unterschiedlichen Prinzipien und in verschiedenen Strukturen, wobei dieselben parallel zu einander bestehen – jedoch ist jeweils eine gegenwärtig im Vordergrund. Bei den Kleinianern ist es die Unterscheidung der paranoid-schizoiden und der depressiven „Position“, in der diese Modi dargestellt werden. Die beiden Modi variieren danach, wie die räumlichen Grenzen um das Selbst und zwischen Selbst und Anderem verlaufen, und danach, ob Objektbeziehungen aufgespalten werden oder ganzheitlich sind, ob Realitätsprüfung stattfindet und ob schon Bewusstsein und Unumkehrbarkeit der Zeit existiert (vgl. Mitchell 2003, S. 100ff.). Ogden (1989) hat diese Zweiteilung des Erlebens um einen weiteren Modus erweitert - den autistisch-berührenden Modus. In ähnlicher Weise spricht auch Frischenschlager (2003) von unterschiedlichen „Organisationsformen“ des Erlebens bzw. der Regulation psychischen Geschehens (ebend. S. 87ff.). Bei Stern (1992) sind es die Modi „auftauchende Bezogenheit“, „Kernbezogenheit“, „intersubjektive Bezogenheit“, „verbale Bezogenheit“ und „narrative Bezogenheit“, also fünf Erlebensbereiche, die zwar – historisch betrachtet – hintereinander auftauchen, dann aber allesamt weiterhin bestehen bleiben. In einer späteren Einteilung fasst Stern die beiden ersten Bereiche im Oberbegriff „interaktive Bezogenheit“ zusammen. Auf die fundamentale Bedeutung dieser Sichtweise, in der es also nicht um eine Aufeinanderfolge von Phasen mit einem umschriebenen Beginn und Ende geht, sondern um Erlebnisbereiche, die zwar einen Beginn haben, aber kein Ende, hat u. a. der Gestalttherapeut Staemmler (2000) ausdrücklich hingewiesen. Er macht darüber hinaus auf eine wichtige Parallele zwischen gestalttherapeutischen Vorgehen, der Stern´schen Forschungsmethodik und der modernen Psychotherapieforschung aufmerksam (ebend. S. 137): es geht bei allen dreien um „von Moment zu Moment wahrnehmbare bzw. beobachtbare Prozesse (vgl. dazu auch die Technik der Videomikroanalyse), um eine Fokussierung der Aufmerksamkeit insbesondere auf körperlich vermittelte Mini-Handlungen bzw. Mini-Enactments sowie um die Vergegenwärtigung dieses „Mittendrinseins“ im Erleben – in der Gestalttherapie durch die gezielte Förderung des Erlebens im „Hier und Jetzt“. Auch die Psychotherapieforschung (z. B. Grawe 1998) sieht mittlerweile in der unmittelbaren Erlebensförderung einen wichtigen Wirkfaktor. Dass das Begreifen des psychischen Erlebens im Sinne von Domänen auch eine Auswirkung auf unser Verständnis von Regression haben muss, wurde an anderer Stelle ausführlich erörtert (Geißler 2001; Staemmler 2000). Auch Mitchell entschließt sich für eine solche Sichtweise, wenn auch in ein gegenüber Stern etwas veränderten Einteilung und Nomenklatur (ebend. S. 100ff.): Modus 1 : Nicht-reflexives Verhalten Es ist dies der gesamte interaktive Erlebnisbereich, den die videomikroanalytisch gestützte Säuglingsforschung erhellt hat – der Bereich der wechselseitigen Regulierung des Verhaltens auf einer Ebene der Interaktion, die so subtil ist und sich so rasch vollzieht, dass sie unserem bewussten Erkennen kaum zugänglich ist. Mit ausreichender Übung kann man lernen, davon ein wenig zu spüren, mehr als zu erkennen – spüren z. B., ob der interaktive Austausch angenehm oder unangenehm ist, und auch, wie sich seine „Vitalitätskontur“ (Stern 1998) anfühlt. Die Frage, wer die Interaktion angefangen hat ist auf dieser Ebene ein ähnlich unlösbares Unterfangen wie die Frage, was zuerst war: die Henne oder das Ei. Einzig interessant ist die Wechselseitigkeit der Regulationsvorgänge. Therapeutisch gehören in diesen Bereich jene Interaktionen, die zu Verwandlungserfahrungen in Sinne von „Now-moments“ (Stern 1998) führen, im zwischenmenschlichen Bereich eine Vertiefung des gegenseitigen Interesses aneinander, und – im erotischen Bereich – das Erleben von Anziehung und erste Vorstufen des Verhaltens, das wir „Flirt“ nennen. Modus 2: Affektive Durchlässigkeit Auch hier ist die Frage wer angefangen hat bedeutungslos, der Fokus liegt aber mehr auf dem Affekt als im Verhalten. Es geht besonders um Zustände hoher emotionaler Erregung, die ansteckend sind, und damit zusammenhängende Resonanzphänomene. Therapeutisch relevant sind Erlebnisweisen in diesem Modus als Übertragungs-Gegenübertragungs-Gefühle, deren wechselseitige Durchlässigkeit dem Therapeuten die Chance eröffnet, „die eigenen Gefühle als ein Fenster zum tiefsten, oft abgespaltenen Affekterleben des Patienten zu nutzen“ (Mitchell 2003, S. 196). Hierher gehören auch Phänomene, die unter dem Stichwort „projektive Identifizierung“ laufen. Wenn ein Therapeut in seiner Gegenübertragung beispielsweise tiefe Trauer erlebt, befindet sich der Modus 2 im Vordergrund. Kennzeichnend ist also intensive Gefühlsempfindungen, Erregung und Affektempfänglichkeit, die sich aber nicht genau zuordnen lassen und in das Erleben all jener Teilnehmer einfließen, die an der Interaktion beteiligt sind (dazu gehören auch intensive Formen von Gruppenerleben, sei es in Selbsterfahrungsgruppen oder im Bereich von Großgruppenphänomenen wie z. B. in einem Fußballstadion). Intensives Affekterleben kann unter bestimmten (pathologischen) Zuständen den Charakter einer Ersatzbefriedigung annehmen und zu suchtartigen Phänomenen führen – im therapeutischen Feld bekannt als maligne Regression. Im zwischenmenschlichen Feld wäre ein Beispiel ein fortschreitendes Flirtverhalten, bei dem sich bereits ein intensives emotionales Feld aufgebaut hat. Modus 3: Konfigurationen des Selbst-mit-dem-Anderen In diesen Bereich gehören die Selbst- und Objektrepräsentanzen im Sinne von Erwartungen und Vorstellungen, die wir in Bezug auf andere Menschen haben und die unser Handeln anleiten. Kernberg (1997) spricht in diesem Zusammenhang von Selbst-Objekt-Affekt-Konfigurationen. Der Andere ist in diesem noch bildhaft strukturierten Modus des Erlebens als gänzlich eigenständige Subjektrepräsentanz noch nicht vorhanden: „Er hat zwar eine eigenständige symbolische Repräsentanz, aber bloß unter dem Aspekt bestimmter Funktionen, wie der des Spiegelns, der Erinnerung, der Befriedigung usw.“ (Mitchell 2003, S. 107). Es werden, je nachdem wer an der Interaktion beteiligt ist, gemeinsame Interaktionskonstruktionen herausgefiltert und markiert. Im therapeutischen Bereich geht es dann nicht mehr nur um affektive Offenheit und Nähe, sondern um damit verbundene Vorstellungen, die z. B. ein emotionales Klima von Kameradschaftlichkeit entstehen lassen können (ev. im Sinne einer Übertragung vom Typ der Alter-Ego-Übertragung). Es wird in diesem Modus bereits sorgfältiger differenziert und sortiert, wer gegenüber wem was tut – allerdings noch ohne die Möglichkeit, von einem einzigartigen anderen als einzigartiges Subjekt anerkannt zu werden, den man umgekehrt auch als solches anerkennt. Modus 4: Intersubjektivität Im ersten Modus teilen Menschen das, was sie miteinander tun. Man tut etwas miteinander, das Teilen der Gefühle ist aber nicht so wichtig, weil der Schwerpunkt regulatorischer Vorgängen in der Person selbst liegt. Im zweiten Modus teilen Menschen miteinander mehr oder weniger intensive Affekte, wie z. B. im Spiel. Es gibt aber hier keine Repräsentanzen, die ineinander „einhaken“ und für gemeinsame Inszenierungen sorgen. Im dritten Modus teilen Menschen miteinander bestimmte Vorstellungen aufgrund unbewusster Rollenzuschreibungen, wie z. B. „Opfer“ und „Täter“. In der gemeinsamen Inszenierungen wird der Andere aber immer noch als Teilobjekt erlebt. Erst im vierten Modus geht es um ein Teilen und auch Mit-Teilen von subjektiver Einzigartigkeit. Erst nun wird der Andere wirklich als Anderer wahrgenommen, und diese Wahrnehmungen können reflektiert und kommuniziert werden. Der Andere ist nun als eigenständiges Subjekt in der seelischen Struktur repräsentiert. Denn „zum vollwertigen Menschsein gehört (in der westlichen Kultur), von anderen menschlichen Subjekten als Subjekt anerkannt zu werden. Zwischen dem Bemühen, unseren eigenen Weg zu gehen, in dem sich die eigene Subjektivität ausdrückt, und unserer Abhängigkeit vom Anderen, der selber Subjekt ist und von dem wir Anerkennung fordern, herrscht eine tiefe und anhaltende Spannung... Im vierten Modus (sind) die Menschen... zu komplexen Wesen geworden..., die bereits über die Fähigkeit verfügen, selbstreflexiv und intentional zu handeln (d. h. über Dinge nachzudenken und zu versuchen, Dinge zu tun), sowie Abhängigkeit (von anderen handlungsfähigen Personen zur eigenen Vervollständigung) zu ertragen“ (ebend. S. 108).6 Während beispielsweise im Bereich sexueller Intimität die ersten beiden Modi in der Vordergrund des Erlebens rücken, ist ein – wenn auch unbewusstes – Verständnis füreinander bereits Ausdruck des dritten Modus, wogegen der bewusst und in verbundener Weise gesprochene Satz „Ich liebe dich!“ ein selbstreflexives Sich-aufeinander-Beziehen spiegelt, weil darin nicht nur eine Zustandsbeschreibung enthalten ist, sondern auch eine Mitteilung darüber, wie tief man sich auf die Beziehung einlässt (ebend. S. 114). Fantasie und Erleben und andere Aspekte des Menschenbildes Fantasie und Realität sollten gar nicht zu weit voneinander entfernt sein, wenn das Leben Sinn, Vitalität und Kraft behalten soll (Mitchell 2003, S. 68). Eine objektive Realität ist, wie sie durch die Höherbewertung von Denken und Sprechen implizit unterstellt wird, aus dieser Sicht etwas Verarmtes, der sinnlichen Urkraft Beraubtes. Wir sollten zu unseren Träumen und Visionen stehen dürfen. Auf diese Weise entpuppen sich Mitchell und Loewald insbesondere als Gegenspieler gegenüber der Hartmann´schen Ich-Psychologie. Aus ihr kommt auch der Begriff der „Triebneutralisierung“. Eine von der Realität angeschnittene Fantasie verliert ihre Bedeutung und wird bedrohlich, eine von der Fantasie abgeschnittene Realität wird schal und leer. „Für das menschliche Erleben kommt Sinn erst durch eine dialektische Spannung zwischen Phantasie und Wirklichkeit zustande, die sich wechselseitig bereichern und einander brauchen, um lebendig zu bleiben“ (ebend. S. 68). Loewald schien zu spüren, dass an Freuds Triebtheorie etwas unstimmig war. Freud sah in den Trieben zwar sehr wohl das Lebendige, und er sah in ihnen 6 Jüngere Arbeiten aus der Säuglingsforschung (Fivaz-Depeursinge 2003, Meltzoff und Moore 1999) weisen darauf hin, dass bereits frühes Imitationsverhalten als wegbereitend für Vorformen von Intersubjektivität zu betrachten, und dass überhaupt „Intersubjektivität“ der Stellenwert eines evolutionär bedeutsamen Motivationssystems zukommen könnte. Aus der Sicht der Biologie ist es nämlich so, dass Intersubjektivität zum Überleben wichtig ist, insbesondere im Kampf um die Ressourcen. In der biologischen Perspektive ist dabei die Fähigkeit, Konkurrenten zu täuschen, maßgeblich. Schimpansen beispielsweise erreichen dabei ein erstaunliches Maß an Intersubjektivität und Empathie, das in etwa dem eines vierjährigen Kindes entspricht. Interessant ist, dass es den Anschein hat, die emotionale und kognitive Welt des Anderen wird nicht über eine metakognitive Ebene explizit erschlossen, sondern durch Mitfühlen implizit verstanden – Schimpansen scheinen also, auf der Basis des unbewussten Wissens um körpersprachliche Signale, genau zu spüren, was sie tun müssen, um Artgenossen erfolgreich zu täuschen, was mittlerweile auf Basis sog. Spiegelneuronen plausibel erscheint (vgl. dazu Funke 2003, Robert u. Worden 1996, Wuketits 2000). Ein „Spür-Bewusstsein“ (Schellenbaum 2000) scheint also evolutionär-biologisch von Vorteil zu sein. Gegenwärtige neurowissenschaftliche Befunde scheinen dies zu bestätigen (vgl. Damasio 2002). etwas, das im Körper entsteht; insofern war er in seinem Denken recht körpernah. Er betonte allerdings die vorsoziale bis asoziale Natur der Triebe. Wenn Freud meinte, aller Anfang sei durch den Trieb bestimmt, so stellt Loewald, im Einklang mit der modernen Bindungs- und Säuglingsforschung, dem entgegen: Das Lebendige entsteht in der Beziehung. Am Anfang steht nicht der Trieb, sondern ein Feld, das alle Individuen umfasst (ebend., S.76). Noch deutlicher wird die Unterschiedlichkeit im Menschenbild, wenn Loewald (1986, S. 183) feststellt, dass „der Sekundärprozess nicht nur aus Vorgängen der Aufspaltung, Trennung und Unterscheidung besteht..., sondern dass im gleichen Akt die ursprüngliche Ganzheit durch eine klar erkennbare Form der Integration lebendig bleibt, die aus einer vorher ganzheitlichen Totalität nun eine Totalität mit einer differenzierten Textur macht“. Somit steht im Zentrum des Interesses nicht die Besetzung des Objekts mit einer Energieladung (wie im klassischen Triebmodell), sondern die Besetzung selbst „ist ein organisierender psychischer Akt (triebhaften Ursprungs), der vorhandenes Material zum Objekt strukturiert, das heißt zu einer differenzierten, von der organisierenden Instanz relativ entfernten Wesenheit. Eine solche Besetzung schafft das Objekt qua Objekt, und in nachfolgenden sekundären Aktivitäten schafft und organisiert sie es neu. Es ist eine objektivierende Besetzung“ (ebend., S. 182). Objekte existieren somit nie unabhängig vom Subjekt – sie werden aus der ursprünglichen Dichte des Primärprozesses neu geschaffen, indem sie durch strukturierende Aktivität mit Bedeutung versehen werden – ein deutlich anderes Menschenbild als bei Freud, viel näher an gestaltpsychologischen Sichtweisen! Die Objektbesetzung kann man sich gleichsam als eine Einkreisung eines Stücks Erleben vorstellen, die irgendwann in der Aussage mündet: „Das bist Du!“ – oder, bei der narzisstischen Besetzung: „Das bin ich!“ Die Bedeutung des Begriffs Trieb ändert sich dadurch radikal. Das Es ist nun nicht mehr länger ein von der Außenwelt abgeschnittenes Triebreservoir. Das Es ist kein Hort gegen die Anpassung von gesellschaftlichen Kräften, sondern wird in interaktiven wechselseitigen Prozessen erst geschaffen. Es-Fragmente stammen wie der gesamte Primärprozess aus dem Niederschlag sozialer Interaktion (Mitchell 2003, S. 80). Die zentrale Frage der Psychoanalyse, warum wir nach Objekten suchen, macht nun gar keinen Sinn mehr, denn eine solche Frage setzt voraus, dass „ich“ und die „Objekte“ getrennte Wesenheiten sind. Anders die relationale Sichtweise: Im Laufe des Entwicklungsprozesses wird die Realität – zunächst ohne Abgrenzung gegen ein Ich, später in magischer Kommunikation mit ihm – schließlich objektiv. Wir sind unsere Objekte und unsere Objekte sind wir. Die Unterscheidung zwischen Trieb und Objekt ist ein sekundärprozesshafter Vorgang.7 Noch eine andere Metapher (Mitchell 2003, S. 152): die Atmung. Wir werden nicht getrieben, Sauerstoff zu suchen – wir atmen, aber nicht intentional (außer unter traumatischen Bedingungen). Genauso verhält es sich mit der Objektsuche: Sie ist kein Trieb. Sie ist in uns Menschen, als Herden- bzw. Hordenwesen, evolutionär angelegt. Vertreter dieser Richtung berufen sich dabei auf den gegenwärtig wahrscheinlich bedeutsamsten Bewusstseinsforscher, auf Edelman und seinen neuronalen Darwinismus. Demnach soll es sogar schon im menschlichen Fötus eine sehr frühe und einfache Neigung zu „Bewertungen“ geben, die sich unter den Bedingungen einer durchschnittlich erwartbaren Umwelt in ein intersubjektives Motivationssystem, dem Bedürfnis nach Objektbindung, umwandeln. Therapeutischer Ausblick Aus der Sicht der relationalen Psychoanalyse sind gesunde Objektbeziehungen nicht so sehr durch ein klares Unterscheiden-Können zwischen dem Selbst und dem Anderen definiert, sondern durch die Fähigkeit, verschiedene Formen der Bezogenheit zu integrieren, die in einer dialektischen Spannung zueinander stehen (Mitchell 2003, S. 152). Zwischen diesen Formen der Bezogenheit bzw. Erlebensmodi, die in einer Vordergrund-/Hintergrundrelation zueinander stehen, sollte man optimalerweise bewusst oszillieren können, je nach Erfordernis der realen Situation. Ziel der Therapie ist somit die Erleichterung des bislang erschwerten Zugangs zwischen Fantasie und Wirklichkeit (Mitchell, 2003, S. 185). In diesem Punkt befindet sich die relationale Psychoanalyse ganz im Einklang mit der Gestalttherapie (vgl. dazu Staemmler 2000). Wichtig ist dabei auch, sich bewusst zu machen, dass unsere Vorstellungen davon, was an Erleben und Verhalten „erwachsen“ ist, natürlich Kinder unserer Zeit und Kultur sind. D. h. was als „kindlich“ gilt, ist nicht per se kindlich (wie z. B. die Neigung, impulsiv zu weinen), sondern eine Frage kultureller Sichtweisen. Gleiches gilt natürlich auch für erwachsenes Verhalten. Auch hier sind es immer unsere Vorstellungen, die darüber entscheiden, was wir erwachsen nennen (vgl. dazu Geißler 2001, S. 290). Darauf weist die Gestalttherapie ausdrücklich hin (Staemmler 2000, S. 164), und ebenso die Säuglingsforschung (Stern 1992, S. 53f.): „Tatsächlich ist ein Großteil der als „sozialisierend“ bezeichneten Erfahrungen darauf abgestellt, die Aufmerksamkeit auf einen einzigen Bereich, meist den verbalen, zu lenken 7 Mitchell vergisst in seinen Arbeiten nicht den Punkt zu diskutieren, inwieweit Säuglinge in der Lage sind, zwischen „Innen“ und „Außen“ zu unterscheiden. Auf der Ebene körperlicher Wahrnehmung scheinen sie dazu sehr wohl in der Lage zu sein, was Stern (1992,k S. 116f.) plausibel begründet. Aber gilt dieses Vermögen gleichzeitig für die affektive Ebene? Hier ist die Diskussion noch in Fluss. und das Erleben in diesem Bereich zur offiziellen Version zu erklären, während das Erleben in anderen Bereichen (die „inoffiziellen“ Versionen) verleugnet wird.“ Mit anderen Worten, unsere (westliche) Sozialisation bewirkt eine Einengung, eine Fixierung auf die verbal-abstrahierende Erlebensdomäne. Ohne die Verbindung zu den anderen Erlebensdomänen, jenem basalen Urgestein unserer Erfahrung (Stern 1992), die eine zutiefst sinnliche ist, wird „das Menschenleben unfruchtbar und zu einer leeren Hülse“ (Loewald 1986, S. 241).8 Aber nicht nur die Gestalttherapie hat sich immer schon diesem Menschenbild verschrieben. Es gibt durchaus psychoanalytische Strömungen, die hier zu nennen sind. Neben der relationalen Psychoanalyse ist es v. a. die psychoanalytischen Selbstpsychologie und ebenso der individualpsychologische Ansatz, der mit dem relationalen Ansatz eine große gemeinsame Schnittmenge teilt. Therapeutische Konsequenzen entstehen dort, wo es um im allgemeinen schwer behandelbare Persönlichkeitsbilder geht – wie z. B. bei BorderlinePersönlichkeiten. Vertreter dieses Ansatz bekennen sich im Gegensatz zu einer eher objektivierenden Grundhaltung wie bei Kernberg ausdrücklich zu einer „personalen Haltung“ (Reinert 2004). Auf dem Boden einer solchen Haltung werden Patienten dieser Art relativ gut behandelbar, weil ihnen eine Menge Kränkungen erspart bleibt, die im Zuge eines wissenschaftlich-objektivierenden Herangehens an sie unvermeidlich sind. Allerdings brauchen sie Zeit, um sich entwickeln zu können. Und entwicklungsorientierte Langzeittherapien haben in unserer Gesellschaft mit ihrem Zeitdruck und Effektivitätswahn, von dem auch so manche neuere psychotherapeutischen Richtungen infiziert zu sein scheinen, nicht gerade Hochkonjunktur. Mutig sind daher jene, die sich klar dafür aussprechen, dass Entwicklung eben Zeit braucht, aber dass sich eine solche, auf lange Zeit angelegte Psychotherapie (unter 300 Stunden chancenlos!) letztlich auch rechnerisch lohnt: „Borderline-Patienten sind teure Patienten! Das auch ohne jede Therapie. Und, rechnet man die Kosten selbst einer sehr langen Analyse auf gegen diese krankheitsbedingten und immer wiederkehrenden Kosten, dann werden meine Patienten hinterher ihre Therapiekosten immer wieder „hereinholen“. Insofern vertrete ich offensiv die Meinung, dass (selbstverständlich bei entsprechendem Verlauf!) die Behandlungskosten auch für so große wie die genannten Stundenkontingente übernommen werden sollten... Was aber aus den geschilderten Behandlungen m. E. erkennbar wird, ist, dass therapeutischer Pessimismus nicht angebracht ist!“ (Reinert 2004, S. 257). 8 Leicht kann hier der Vorwurf erhoben werden, ein solches Menschenbild sei ein romantisierendes. Kürzlich habe ich eine sehr differenzierte Analyse des Silberling-Films „Stadt der Engel“ in die Hand bekommen, in der von psychoanalytischer Seite die in diesem Film angespielten sinnlich-affektiv-körperlichen Szenen auf gekonnte Weise pathologisiert werden (Weilnböck 2003). Die Kritik läuft darauf hinaus, dass existenzielle Gefühle immer dort herausbeschworen werden, wo es eigentlich um tiefe unbewusste Konfliktdynamiken geht. So bestehe das Prinzip, das all diesen Romantisierungen zugrunde liegt, in einer „abwehrstrategischen Verschwörung der filmischen Bilder gegen die in ihnen dargestellten Körper“ (ebend. S. 245). An anderer Stelle habe ich den Versuch einer Gegenkritik gegen eine Überbetonung psychodynamischen Denkens unternommen (Geißler, 2004). Eine „personale“ Haltung, die sich heute auf Befunde der Bindungs- und Säuglingsforschung gut stützen kann, führt auch zu einer Neubewertung der Realbeziehung in der Therapie im Verhältnis zur Übertragungsbeziehung. Ich stimme hier mit Frischenschlager über, wenn er meint, dass uns eben die Bindungsforschung lehrt, „den Aspekten der Realbeziehung sowohl in der Entwicklung als auch im psychotherapeutischen Prozess größere Bedeutung einzuräumen. Die alte psychoanalytische Terminologie, die von Objekten und Objektbeziehungen spricht, berücksichtigt den Austausch zu wenig und fokussiert zu ausschließlich das intrapsychische Geschehen“ (Frischenschlager 2003, S. 85). Liebe und Hass beim Patienten sind somit nicht immer nur als Übertragungsgeschehen zu verstehen, sie sind zugleich reale Reaktionen auf den realen zwischenmenschlichen Austausch mit dem Analytiker und unvermeidlich, weil beide, unabhängig vom Reifegrad, in eine tiefe emotionale Verwicklung geraten (Mitchell, 2003, S. 187). Solche intensiven Gefühle tauchen aber nicht einfach unaufgefordert auf, sondern formen sich in Kontexten, die über einen langen Prozess hergestellt werden (ebend. S. 188). Auch Bettighofer (2001, S. 112) als Befürworter eines neuen Übertragungsverständnisses – Übertragung als „interaktionelle Übertragung“ – spricht sich für eine Neubewertung der „Übertragungsliebe“ aus: Es handelt sich dabei um eine „ganz normale Liebe... Natürlich beinhaltet sie auch neurotische Anteile wie jede Liebesbeziehung im Alltag auch. Es gibt (aber) keinen (grundsätzlichen) Unterschied zwischen Übertragungsliebe und Alltagsliebe... Wenn eine Patientin sich verliebt, verliebt sie sich nicht in eine Fantasiefigur. Sondern sie verliebt sich, weil sie Verständnis erfährt, wie ihr zugehört wird, sie verliebt sich in die Stimme des Therapeuten, in sein Aussehen, in die Art wie er sie anschaut usw. Das sind alles ganz reale Aspekte des Therapeuten. Irreal wird es nur dann, wenn sie glaubt, das mache die ganze Person des Therapeuten aus. Aber auch das passiert in jeder Alltagsbeziehung, die ja schließlich auch mit einer Idealisierung beginnt.“ Mit anderen Worten: Die analytische Beziehung unterscheidet sich gar nicht so sehr von anderen Beziehungen – das intersubjektive Engagement ist wie auch in alltäglichen Beziehungen der eigentliche Hebel (Mitchell 2003, S. 183); aus gestalttherapeutischer Perspektive haben Jacobs (1990; 1998), Staemmler (1993) und Yontef (1999; 2002) Ähnliches betont. Folgt man einer intersubjektiven bzw. personalen Haltung konsequent, dann muss man auch die zunächst auf negativen Prinzipien beruhenden psychoanalytischen „Essentials“ Neutralität, Anonymität und Abstinenz neu bewerten. Und dies öffnet die Türen für einen interaktionellen Zugang (der auch körperliche Interaktion grundsätzlich ermöglicht), denn „Neutralität und Abstinenz bedeutet dann nicht mehr, dass ich z. B. nicht berühren darf, sondern dass ich mir über mein Motiv zu berühren bewusst bin und im Auge behalte, was das szenisch bedeuten könnte. Vor diesem Hintergrund ist der Einsatz verschiedenster Methoden durchaus denkbar“ (Bettighofer 2001, S. 112). Noch mehr: Der Psychotherapeut darf, er soll sogar leidenschaftlich sein.9 Er darf und soll sein Engagement zeigen, zumindest in seinem intersubjektiven Verhalten. Über die Frage, ob „Gegenübertragungsmitteilungen“ im Sinne von möglichst großer Authentizität auf Seiten des Therapeuten möglich oder sogar wichtig sind, gehen die Meinungen aber noch erheblich auseinander (Mitchell 2003, S. 185 ff., Renik 1996). Hier ist weitere Diskussion noch erforderlich. Keinesfalls darf die relationale Analyse mit einer „wilden Analyse“ gleichgesetzt werden, mit einem „anything goes“ – im Gegenteil: Auch sie unterwerfen sich – wie alle Psychoanalytiker – einer sehr disziplinierten Selbstreflexion. Und sie denken über ihre Leidenschaften sehr konsequent nach. Man kann sich davon ein gutes Bild machen, wenn man die bei Mitchell (2003) ausführlich vorhandenen Fallberichte studiert. Interessant fand ich seine Aussage zum Thema Sexualität: „Heutzutage... wird eine Regel beschworen, welche die Grenze zu dem markiert, was man nicht tun darf, und das Schibboleht lautet: Kein Sex mit dem Patienten. Die Begründung liegt in den anerkannten, kulturellen Normen und Standards unserer Profession, die dadurch verletzt würden... Ich denke, das ist wahr, aber es gibt noch etwas anderes darüber hinaus... Sex haben und Psychoanalyse betreiben – das lässt sich emotional nicht miteinander vereinbaren. Der Kernproblem liegt in der Verantwortlichkeit des Analytikers. Die Empfindungen beim Sex sind zu intensiv, als dass man sich darin – auf Kosten der Reflektion über die Folgen für die Analyse – nicht verlieren würde. Jemand, der dazu wirklich in der Lage wäre, wäre ohnehin zu sehr ein Zombie, um ein guter Analytiker zu sein“ (ebend. S. 194). Also – statt professioneller ethischer und genormter Standards spricht dies hier für ein gesundes Spüren – für eine reife psychotherapeutische Haltung jenseits durch Gebote und Verbote gekennzeichneter Abstinenz (vgl. dazu auch Geißler P, Geißler C und Hofer-Moser O 2000). Sich therapeutisch „richtig“ zu verhalten gründet allem Anschein nach auf einer inneren Haltung, die wesensmäßig auf einer Integration aller Modi der Erfahrung beruht – auch der basalen Spürebene. Man kann als Therapeut somit spüren, was „stimmig“ ist. Auch Empathie wird aus dieser Perspektive weniger als technisches Instrument wahrgenommen, wie es bei Kohut noch eher den Anschein erweckt, sondern sie erwächst aus einem gefühlsmäßigen Prozess, in den beide Interaktionspartner involviert sind. Fazit 9 Innerhalb der gestalttherapeutischen Diskussion ist die Bedeutung der Leidenschaftlichkeit von jeher stark betont worden und hat auch in neuester Zeit Beachtung gefunden (vgl. Cornell 2003; Miller 2003). Weil er so schön formuliert hat, möchte ich abschließend Mitchell (2003, S. 209) sprechen lassen: „Liebe und Hass innerhalb der analytischen Beziehung sind sehr real, aber auch vom jeweiligen Kontext abhängig. Die asymmetrische Struktur der analytischen Situation ist eine mächtige Gestalterin von Gefühlen, die darin entstehen, und sie macht einige davon möglich, während sie andere versperrt. Und genau weil diese Gefühle, so real sie sind, dermaßen stark vom analytischen Kontext abhängen, lassen sie sich nicht einfach in eine Beziehung außerhalb oder nach der Analyse überführen. Eine generelle Regel, sie entweder zurückzuhalten oder ihnen Ausdruck zu verleihen, macht als Richtlinie für den Umgang des Analytikers mit seinen Gefühlen keinen Sinn. Beides, Zurückhaltung und Spontaneität, kann durchdacht und gedankenlos sein. Es gehört zum Kern des psychoanalytischen Handwerks, mit solchen Gefühlsdimensionen zu ringen, daraus etwas zu machen, was als die beste Entscheidung zur gegebenen Zeit erscheint, und immer wieder frühere Entscheidungen zu hinterfragen (Hervorhebung SM), um somit den Kontext, innerhalb dessen laufende Wahlen getroffen werden, zu erweitern und zu bereichern.“ Literatur Berliner J (1994) Psychoanalyse, Bioenergetische Analyse, analytische körpervermittelte Psychotherapie: Konzepte und Praxis. Ähnlichkeiten, Unterschiede und Besonderheiten. In: Geißler P (Hg) Psychoanalyse und Bioenergetische Analyse. Im Spannungsfeld zwischen Abgrenzung und Integration. Peter Lang, Frankfurt, S 53-147 Bettighofer S (2001) Sexualität zwischen Verdrängen und Agieren. In: Geißler P (Hg) Körperbilder. Sammelband zum 3. Wiener Symposium „Psychoanalyse und Körper“. Psychosozial, Gießen, S 95-117 Cornell, W F (2003) The impassioned body: Erotic vitality and disturbance in psychotherapy. British Gestalt Journal 12/2, S 97-104 Damasio A R (2002) Ich fühle, also bin ich. Die Entschlüsselung des Bewusstseins. List, München Downing G (1996) Körper und Wort in der Psychotherapie. Leitlinien für die Praxis. Kösel, München Fivaz-Depeursinge E (2003) Körper und Intersubjektivität: In: Psychoanalyse und Körper Nr. 3, Heft 2, S 7-21 Frischenschlager O (2003) Die Relevanz der Bindungstheorie für die Psychoanalyse. In: Poscheschnik G, Ernst R (Hg) Psychoanalyse im Spannungsfeld von Humanwissenschaft, Therapie und Kulturtheorie. Brandes & Apsel, Frankfurt/M, S. 71-85 Funke J (2003) Theory of Mind: http://www.psychologie.uniheidelberg.de/ae/allg/lehre/030707_ToM.pdf Geißler P (2001) Mythos Regression. Psychosozial, Gießen Geißler P (2004) Stadt der Engel. Komplementäre Assoziationen zu einer psychoanalytischen Interpretation H. Weilnböcks aus dem Blickwinkel des affektiv-körperlichen Erlebens. In: Selbstregulation. Eine Standortbestimmung. Psychosozial, Gießen, im Druck Geißler P. Geißler C, Hofer-Moser O (2000) Überlegungen zum Abstinenzbegriff. http://meineseite.one.at/glang/Texte/Texte_ieS/abstinenz.rtf Grawe K (1998) Psychologische Therapie. Hogrefe, Göttingen Heisterkamp, G (2000) Ist die Psychoanalyse ein freudloser Beruf? In: Schlösser, A-M u Höhfeld, K (Hg.): Psychoanalyse als Beruf. PsychosozialVerlag, Gießen, Psychosozial Hoffmann-Axthelm D (2003) Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an – und umgekehrt. Einige Überlegungen zum Dreieck Musik – Emotionen – frühkindliches Erleben. In Geißler P (Hg) Körperbilder. Sammelband zum 3. Wiener Symposium „Psychoanalyse und Körper“. Psychosozial, Gießen, S. 189199 Jacobs, L (1990) Ich und Du, Hier und Jetzt — Zu Theorie und Praxis des Dialogs in der Gestalttherapie. Gestalt-Publikationen 12. Zentrum für Gestalttherapie, Würzburg Jacobs, L (1998) Optimal responsiveness and subject-subject relating. In H A Bacal (Ed) Optimal responsiveness: How therapists heal their patients (pp 191212). Aronson, Northvale, NJ & London Kernberg O (1997) Innere Welt und äußere Realität. Anwendungen der Objektbeziehungstheorie. Verlag Internationale Psychoanalyse, Stuttgart Loewald H (1977) Primary process, seconfary process and language. In: Papers on Psychoanalysis. New Haven CT (Yale University Press) 1980, S 178-206. Dt.: Primärprozess, Sekundärprozess und Sprache: In: Psychoanalyse: Aufsätze aus den Jahren 1951-1979. Klett-Cotta, Stuttgart 1986 Meltzoff A, Moore A (1999) Persons and representations. Why infant imitation is important for theories of human development. In: Nadel J, Butterwroth G (Ed) Imitation in infancy. Cambridge University Press, Cambridge, S 7-35 Miller, M V (2003) Reflection on Cornell: The aesthetics of sexual love. British Gestalt Journal 12/2, S 111-114 Mitchell, S A (2003) Bindung und Beziehung. Auf dem Weg zu einer relationalen Psychoanalyse. Psychosozial, Gießen Ogden T (1989) Frühe Formen des Erlebens. Springer, Wien 1995 Perls, F S, Hefferline, R, & Goodman, P (1979) Gestalt-Therapie — Lebensfreude und Persönlichkeitsentfaltung. Klett-Cotta, Stuttgart Reinert T (2004) Therapie an der Grenze: die Borderline-Persönlichkeit. Modifiziert-analytische Langzeitbehandlungen. Pfeiffer bei Klett-Cotta, „Leben lernen“ 172, Stuttgart Renik O (1996) The perils of neutrality. Psychoanal. Quart. 65, 495-517 Robert W, Worden R E (1996) Primate and Theory of Mind. In: Cognitive Science Vol 20, Iss 4, S 579-616 Schellenbaum P (2000) Befreiung des sexuellen Empfindens durch Spürbewusstsein. In: Geißler P (Hg) Über den Körper zur Sexualität finden. Psychosozial, Gießen, S 231-244 Staemmler, F.-M. (1993). Therapeutische Beziehung und Diagnose — Gestalttherapeutische Antworten. Pfeiffer bei Klett-Cotta, München Staemmler, F-M (2000) Regressive Prozesse in der Gestalttherapie. In: B Bocian & F-M Staemmler (Hg) Gestalttherapie und Psychoanalyse – Berührungspunkte, Grenzen, Verknüpfungen (S. 142-202). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen Staemmler, F-M (2003a) Ganzheitliches 'Gespräch', sprechender Leib, lebendige Sprache. Bergisch Gladbach: Edition Humanistische Psychologie Staemmler F-M (2003b). Körperliche Mikroprozesse im Hier und Jetzt – gestalttherapeutische Zugänge zur prozessualen Aktivierung. In: Geißler P (Hg) Körperbilder. Sammelband zum 3. Wiener Symposium „Psychoanalyse und Körper“. Psychosozial, Gießen, S 127-139 Stern D N (1992) Die Lebenserfahrung des Säuglings. Klett-Cotta, Stuttgart Stern D N (1998a) "Now-moments", implizites Wissen und Vitalitätskonturen als neue Basis für psychotherapeutische Modellbildungen. In: Trautmann-Voigt S, Voigt B (Hg) Bewegung ins Unbewusste. Beiträge zur Säuglingsforschung und analytischen Körperpsychotherapie. Brandes & Apsel, Frankfurt/M, S 82-96 Sullivan H S (1950) The illusion of personal identity. In: The Fusion of Psychiatry and Social Science. Norton, New York 1964, S. 198-226 Weilnböck H (2003) Das Körperbeziehungs-Bild einer Hollywood-Produktion. Zur Ästhetisierung von Unterstimulanz, Suchtbeziehung und Suizidalität in Silberlings Film „City of Angels“. In: Geißler P (Hg) Körperbilder. Sammelband zum 3. Wiener Symposium „Psychoanalyse und Körper“. Psychosozial, Gießen, S. 211-247 Wuketits F M (2000) Der wahre Egoist ist immer hilfsbereit. Zu den stammesgeschichtlichen Wurzeln von Konflikt und Kooperation. In: Geißler P (Hg) Mediation – die neue Streitkultur. Kooperatives Konfliktmanagment in der Praxis. Psychosozial, Gießen, S 189-204 Yontef, G M (1999) Awareness, Dialog, Prozess — Wege zu einer relationalen Gestalttherapie. Edition Humanistische Psychologie, Köln Yontef, G. M. (2002). The relational attitude in gestalt therapy theory and practice. International Gestalt Journal 25/1, S 15-35 Yontef G: Beziehungen und Selbstwertgefühl in der gestalttherapeutischen Ausbildung. www.gestaltkritik.de/yontef_beziehungen.html