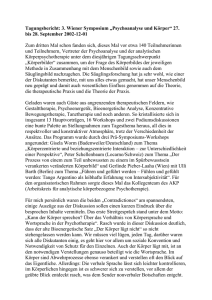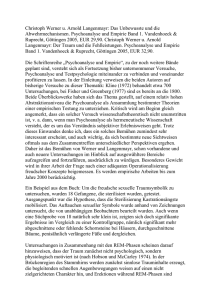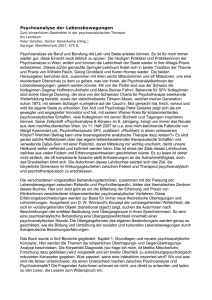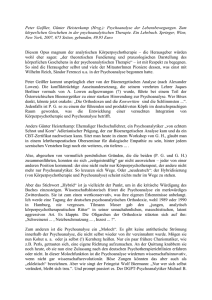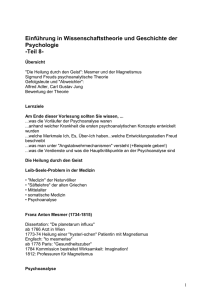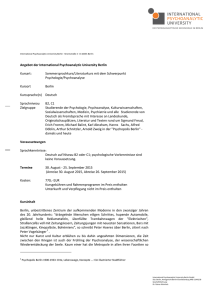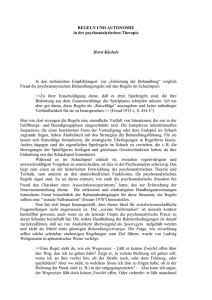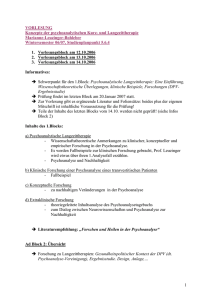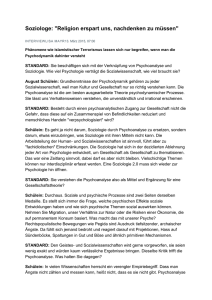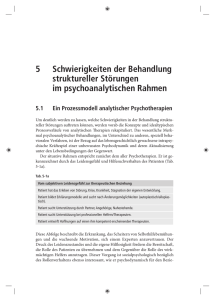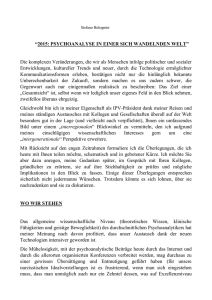Ohne Abstinenz stirbt die Psychoanalyse
Werbung
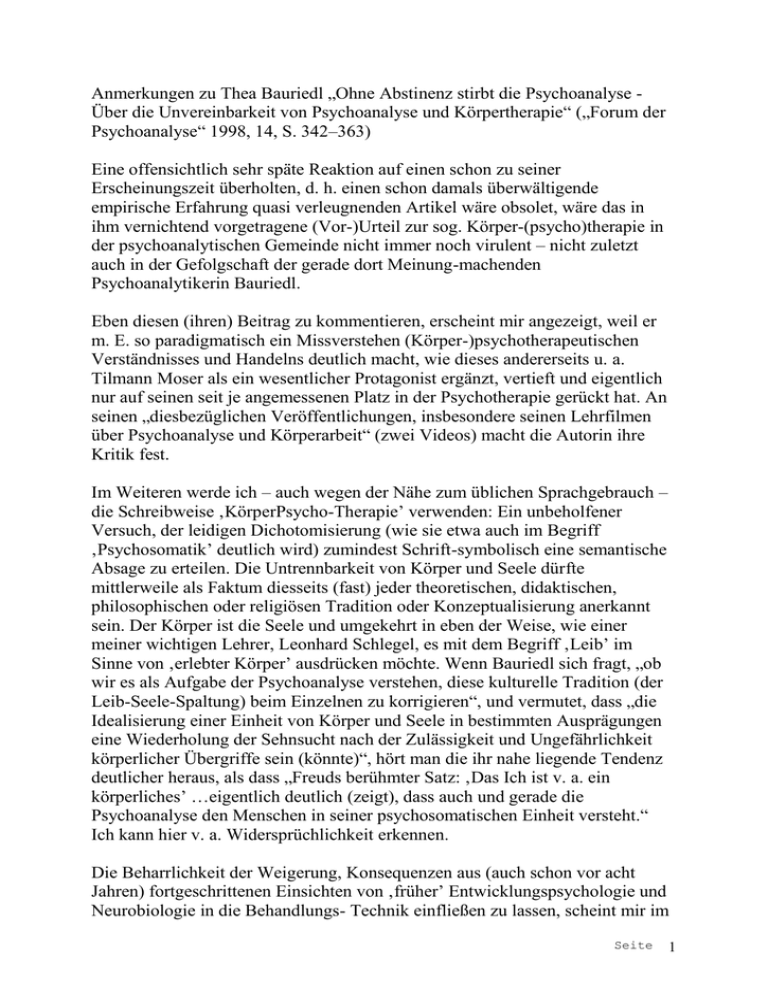
Anmerkungen zu Thea Bauriedl „Ohne Abstinenz stirbt die Psychoanalyse Über die Unvereinbarkeit von Psychoanalyse und Körpertherapie“ („Forum der Psychoanalyse“ 1998, 14, S. 342–363) Eine offensichtlich sehr späte Reaktion auf einen schon zu seiner Erscheinungszeit überholten, d. h. einen schon damals überwältigende empirische Erfahrung quasi verleugnenden Artikel wäre obsolet, wäre das in ihm vernichtend vorgetragene (Vor-)Urteil zur sog. Körper-(psycho)therapie in der psychoanalytischen Gemeinde nicht immer noch virulent – nicht zuletzt auch in der Gefolgschaft der gerade dort Meinung-machenden Psychoanalytikerin Bauriedl. Eben diesen (ihren) Beitrag zu kommentieren, erscheint mir angezeigt, weil er m. E. so paradigmatisch ein Missverstehen (Körper-)psychotherapeutischen Verständnisses und Handelns deutlich macht, wie dieses andererseits u. a. Tilmann Moser als ein wesentlicher Protagonist ergänzt, vertieft und eigentlich nur auf seinen seit je angemessenen Platz in der Psychotherapie gerückt hat. An seinen „diesbezüglichen Veröffentlichungen, insbesondere seinen Lehrfilmen über Psychoanalyse und Körperarbeit“ (zwei Videos) macht die Autorin ihre Kritik fest. Im Weiteren werde ich – auch wegen der Nähe zum üblichen Sprachgebrauch – die Schreibweise ‚KörperPsycho-Therapie’ verwenden: Ein unbeholfener Versuch, der leidigen Dichotomisierung (wie sie etwa auch im Begriff ‚Psychosomatik’ deutlich wird) zumindest Schrift-symbolisch eine semantische Absage zu erteilen. Die Untrennbarkeit von Körper und Seele dürfte mittlerweile als Faktum diesseits (fast) jeder theoretischen, didaktischen, philosophischen oder religiösen Tradition oder Konzeptualisierung anerkannt sein. Der Körper ist die Seele und umgekehrt in eben der Weise, wie einer meiner wichtigen Lehrer, Leonhard Schlegel, es mit dem Begriff ‚Leib’ im Sinne von ‚erlebter Körper’ ausdrücken möchte. Wenn Bauriedl sich fragt, „ob wir es als Aufgabe der Psychoanalyse verstehen, diese kulturelle Tradition (der Leib-Seele-Spaltung) beim Einzelnen zu korrigieren“, und vermutet, dass „die Idealisierung einer Einheit von Körper und Seele in bestimmten Ausprägungen eine Wiederholung der Sehnsucht nach der Zulässigkeit und Ungefährlichkeit körperlicher Übergriffe sein (könnte)“, hört man die ihr nahe liegende Tendenz deutlicher heraus, als dass „Freuds berühmter Satz: ‚Das Ich ist v. a. ein körperliches’ …eigentlich deutlich (zeigt), dass auch und gerade die Psychoanalyse den Menschen in seiner psychosomatischen Einheit versteht.“ Ich kann hier v. a. Widersprüchlichkeit erkennen. Die Beharrlichkeit der Weigerung, Konsequenzen aus (auch schon vor acht Jahren) fortgeschrittenen Einsichten von ‚früher’ Entwicklungspsychologie und Neurobiologie in die Behandlungs- Technik einfließen zu lassen, scheint mir im Seite 1 Grunde nur als Widerstands-Phänomen deutbar. Es wird besonders deutlich am Festhalten (ja, geradezu Festklammern) an einem erstarrten Abstinenz-Begriff. Dessen historisch gewachsene Bedeutung als Angst-Abwehr v. a. des genialen Gründervaters der Psychoanalyse selbst hat nicht nur Sandor Ferenczi in die (zumindest innere) Emigration getrieben bzw. bezüglich der Zugehörigkeit zur orthodoxen ‚community’ sozusagen den Kopf gekostet. Es geht der Autorin m. E. wesentlich um dies: Wer hat die Definitionshoheit über den Gehalt des psychoanalytischen Abstinenz-Begriffs? Und wer den ihren nicht teilt, muss fürchten, als un-abstinent, was bedeutet als sexuell übergriffig, also Patienten (und –innen selbstverständlich) missbrauchend, disqualifiziert zu sein – mindestens hinsichtlich einer psychoanalytischen Identität. Fast verführerisch irreführend eröffnet die Autorin ihren Gedankengang mit dem Hinweis auf „sexuellen Missbrauch“ als „wichtiges Thema in der Öffentlichkeit“ und die damit verbundene Aufforderung zu einer „eindeutigen Definition der therapeutischen Beziehung in der Psychoanalyse“. Die damit insinuierte Implikation im Zusammenhang mit der These von „Unvereinbarkeit von Psychoanalyse und Körpertherapie“ wird unmittelbar peinlich klar und noch verschärft durch die mir unzulässig erscheinende Behauptung von „Gegensätzlichkeit psychotherapeutischen Selbstverständnisses, derzufolge „Stellung dazu (zu) nehmen (sei), ob wir Grenzen zwischen den Menschen als Schutz oder als Hindernis verstehen, ob wir meinen, dass Psychoanalyse grundsätzlich von neurotischen Selbsteinschränkungen befreien soll, oder ob wir Psychoanalyse so verstehen, dass sie einen Verständigungsprozess fördert, in dem die Verantwortlichkeiten klar verteilt sind und der Analysand die Verantwortung für sein Wohlergehen in seinen Beziehungen zunehmend selbst übernehmen kann, weil der Analytiker seine eigene Verantwortung für seine Beziehung zum Analysanden selbst trägt“. Ja, wer denn sonst?! Ich dachte, das sei selbstverständlich für jedes psychotherapeutische Arbeitsbündnis. Oder will Bauriedl solches speziell den KörperPsycho-Therapeuten ins Stammbuch schreiben? Z. B. auch, wenn sie schreibt: „Die Definition körperlicher Berührungen in einer ‚psychoanalytisch’ genannten Therapie als ‚therapeutisch nötig’ erinnert allzu sehr an Begründungen, die missbrauchende Erwachsene ihren kindlichen Opfern gegenüber anführen.“ Oder wenn sie „Kollegen und Kolleginnen, die körperliche Berührungen oder gar sexuelle Beziehungen mit ihren Patienten für die Methode der Wahl ansehen“, in einen Topf wirft und sie meint aufklären zu müssen, „dass sie standesrechtliche und eventuell (wie bitte? D.A.) strafrechtliche Konsequenzen zu befürchten haben“. Und ich dachte, zumindest ersteres sei seit Hippokrates’ Zeiten klar! Angesichts solcher Gegensatz-Konstruktionen, die Bauriedl als „eindeutige Stellung“-nahme erklärt, geht sie eigener Einschätzung zufolge in der Tat „ein nicht geringes Risiko ein, in Konflikte zu geraten, angegriffen und entwertet zu werden“. Soweit meine Einlassungen diese Einschätzung bestätigen sollten, Seite 2 setzte ich mich dem gleichen Risiko aus. Und das umso mehr, als ich als namensloser Kollege einer namhaften Expertin widerspreche, (offener) polemisch, assoziativ ungeordnet, noch dazu ohne ‚wissenschaftliche’ Untermauerung durch bibliographische Hilfstruppen, gewissermaßen‚ aus dem Bauch heraus’ (hoffend, dass das in professionellem Kontext nicht schlechter ist als ‚Deutung’). Fast wehleidig klingt die Autorin, wenn sie beklagt, dass es „zum unausweichlichen Schicksal der ‚alten Tante Psychoanalyse’ zu gehören scheint, dass sie zunehmend zerfleddert, ausgeraubt und gleichzeitig mit scheinbar neuen Methoden ‚angereichert’ wird“, statt sich zu fragen, wie es möglich werden konnte, dass „immer mehr Patienten in Vorgespräche (kommen) mit in der Öffentlichkeit weitgehend unwidersprochenen Meinung, sie könnten besser geheilt werden, wenn der Psychoanalytiker oder die Psychoanalytikerin auch andere Verfahren beherrsche, oder nicht ganz so streng ‚orthodox’ sei“. Wenn sie dann fragt, „ob wir uns dieser ‚Leichenfledderei’ resigniert überlassen, oder ob wir uns selbstkritisch mit den neuen Formen der Psychotherapie auseinander setzen (wollen)“ klingt diese Frage rhetorisch, denn im weiteren geht es weit weniger um selbstkritische Auseinandersetzung mit einer immerhin möglichen Bereicherung und Verjüngung der „alten Tante“ als um Kritik an der KörperPsycho-Therapie im allgemeinen und T. Moser und einem seiner Pilotprojekte im besonderen. Wer, nebenbei, ist die „Öffentlichkeit“? Wahrscheinlich ja wohl Menschen, die gute Erfahrungen mit um KörperPsycho-therapeutische Methoden „angereicherte“ Psychotherapie oder gar –analyse gemacht haben (vielleicht hinsichtlich „neurotischer Selbsteinschränkungen“ und Förderung von „Verantwortung für sein Wohlergehen“. Und wer sind „wir“? Die (strenggläubigen?) Psychoanalytiker (und –innen selbstverständlich)? Moser jedenfalls erkennbar nicht, sonst würde ihm, der sich auch laut Bauriedl wiederholt „explizit von sexuellen Beziehungen in der Therapie …distanziert“ hat, nicht eine gegenteilige Haltung unterstellt – kontextuell hintergründig, wenn sie ihn zitiert, „seit er diese Form der Therapie ausübe, sei er selbst nach den Therapiestunden zufriedener“, ganz offen, wenn sie anschließt: „Auffällig ist, dass sich in beiden Filmen für meine Wahrnehmung eindeutig sexuelle Szenen abspielen, die aber von Moser auch den Patienten gegenüber systematisch als frühkindliche Szenen umgedeutet werden.“ Immerhin attestiert sie sich im ersten Halbsatz fairerweise noch Subjektivität, währen der zweite bereits eine eigene Deutung als Realität behauptet. (Also auch Deutungs-Hoheit!) Der nächste Satz schwächt diese Haltung nur wenig ab: „Dies ermöglicht es ihm wahrscheinlich, den Missbrauch der Patienten vor sich selbst und vor diesen zu verbergen.“ Zwar anerkennt sie noch, dass nur „nach meiner (also ihrer) Interpretation eine ‚Verabredung’ zwischen beiden, dass die Bedürfnisse der Patienten als präverbal oder zumindest präödipal – jedenfalls nicht sexuell – zu interpretieren sind“, um Seite 3 dann aber, ihrer selbst wieder allzu sicher, zu behaupten: „So werden die erwachsenen Patienten ständig auf ihren Kindheitszustand verwiesen, und zwar genauso, wie Moser sich diesen Zustand vorstellt, nämlich durchwegs defizitär.“ Während ich von dieser Vorstellung bei Moser und in seinen Videos nichts beobachten kann, scheint Bauriedl eher ihre eigene Bewertung von Regression in frühstkindliche Zustände offenzulegen (die sie als vermutlich „orthodox“ arbeitende Analytikerin gar nicht zu Gesicht bekommt). In der Tat, sie sieht, was sie verallgemeinernd sehen zu können behauptet: „Sobald man… als Zuschauer sieht und erlebt, dass hier zwei erwachsene Menschen miteinander umgehen, werden die körperlichen Berührungen in ihrer sexuellen Bedeutung erkennbar.“ Statt wirklich das Gesehene „erleben“ zu können, dürfte sich hinter dieser Sehweise die Abwehr verbergen, die sie im tendenziösen Fortfahren Moser unterstellt: „Ich frage mich, welch ungeheuren Abwehraufwand Moser aufbringen muss, um dies nicht selbst zu bemerken und seine Patienten davon abzuhalten, dass sie es bemerken.“ Die eigentlich fällige Frage lautet: Warum muss die herkömmliche ‚Schul-Psychoanalyse’ einen so ungeheuren Abwehraufwand, betreiben, um ‚den Körper’ und sein präkognitiv und präverbal (vielleicht sogar intrauterin) gesammeltes ‚Wissen’, an das die ‚Rede-Kur’ – wenn überhaupt – nur schwer herankommt, zumindest links liegen lassen zu wollen, oder gar diejenigen, die diese unüberschätzbare Ressource in der ‚Archäologie’ des (viel größeren) unbewussten Anteils an und in der Geschichte der individuellen Mensch-Werdung nutzen wollen, zumindest als nicht analytisch, oder gar – wie hier – als sexuell übergriffig zu diffamieren? Der mit entscheidend erscheinende Einwand gegen die Definitionshoheit Frau Bauriedl’s in Sachen Abstinenz muss schon hier eingeschoben werden, weil er das Kriterium ist, das an ihre Einlassungen durchgängig anzulegen ist: Hier spricht eine sprichwörtlich Blinde von der Farbe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie eine körperpsycho-therapeuthische Selbsterfahrung durchlaufen hat, da ihr sonst weder dieser Artikel als ganzer, noch seine Tendenz im Einzelnen möglich geworden wäre. (Hätte ich nicht selbst nach sechsjähriger Psychoanalyse eine komplette körperpsycho-therapeutische Ausbildung durchlaufen, deren Potenz nicht buchstäblich am eigenen Leib erlebt und in mittlerweile 15-jähriger Erfahrungssammlung mit gerade der Vereinbarkeit von Psychoanalyse und KörperPsycho-Therapie und der nur so erreichbaren tiefen Regression mit unvergleichlich heilsamer Wirkung gerade für wenig ‚reife’ Neurotiker bestätigt gefunden - ich stünde vermutlich in gleicher Abwehrfront wie Frau Bauriedl, die natürlich nur sehen kann, was sie kennt.) Wie anders ist zu erklären, dass sie „eine Szene, die ähnlich auch im Film dargestellt ist“ und in der „Moser (1992, S. 19) in schriftlicher Form“ beschreibt, wie ähnlich die körperlichen (Gegenübertragungs-)Empfindungen des Therapeuten anlässlich tiefster Regression einer Patientin in die orale Gier Seite 4 des Säuglings denen „stillender Mütter“ in ihrem „unerwarteten Erschrecken über ihre genitale Erregung“ sein können, und dass er „stolz (war) über die immer klarer werdende Unterscheidung zwischen erotischem und erotisiertem Begehren“, nur zu kommentieren weiß mit: „Hier wird Sexualität gespielt mit der Vereinbarung, nicht zu merken, was es ist.“ Indem sie das mögliche Ausmaß der Wucht frühster Affekte, denen auch noch der Erwachsene (!) quälend unterliegen und die er befreiend (wieder-)erleben kann, wenn ihnen nur in Angst-Freiheit des Therapeuten (= Begleiter) Platz und Raum für ihren AusDruck gegeben wird, verleugnet, wird sie just zu einer jener „psychoanalytischen Altvorderen“, deren Moser nach eigener Aussage anlässlich dieser wahrlich leibhaftigen Wahrnehmung „mit geradezu gönnerhaftem Wohlwollen“ gedachte: Schließlich handelt es sich um eindrucksvolles Erleben und Er-kennen von auf der klassischen Couch natürlich nie beobachtbarem Material frühester „in Fleisch und Blut“ übergegangener konflikthafter Erfahrung von Bedürftigkeit, Gier, Sehnsucht, Enttäuschung, Wut, Verzweiflung usw.: Potenzial für den therapeutischen Prozess, wie es den „Altvorderen“ tatsächlich noch nicht zur Verfügung stand/steht. Fraglos ist T. Moser nicht nur in der gerade zitierten Wortwahl angreifbar und mag auch manche Intervention in den Videos, v. a. aber an seinen eigenen lehrhaften Kommentaren darin (auch bei einschlägig erfahrenen Kollegen) umstreibar sein. Zu seiner vielleicht auch als „narzisstisch“ deutbaren Eigen-Art, die man gewiss nicht mögen muss, gehört aber vornehmlich auch ein unerhörter Mut, sich mit seinen KörperPsycho-therapeutischen (Nach-) Entdeckungen zu exponieren. Vielleicht ist es gerade das, was den kühlen ‚Chirurgen’ hinter der Couch fehlt und dessen Mangel sie hinter möglichst unbewegter Miene, berührungsfreiem Begegnungsritual und/also einer restriktiven AbstinenzDefinition zu verstecken versuchen: Mut. Solchen nämlich braucht es, um sich – wenn nötig und sinnvoll – auf intensive, ‚hautnahe’ Begegnung mit dem Leidenden einzulassen und gleichzeitig Zeuge zu bleiben und ihm/ihr zur Zeugenschaft der aktuellen/alten Erfahrungen und ihrer Neubewertung zu verhelfen. Dabei ist dem psychoanalytischen KörperPsycho-Therapeuten selbstverständlich, dass mit bestimmten Patienten und zumindest phasen-weise in Therapieverläufen ‚Berührungs-frei’ zu arbeiten ist, ja sogar (sonst auch Körperarbeit vorbereitende) verbal induzierte Körper-Erfahrungen zu unterbleiben haben – ganz abgesehen davon, dass es natürlich Therapieverläufe gibt, in denen es keine Körperarbeit (im engeren sinne) braucht. Hilfreich ist aber auch dort und dann, wenn der Patient spürt, dass sein Therapeut keine Angst vor physischem Ausdruck und (auch körperlicher) Nähe hat. (Dies ist – zumindest teilweise – sogar lernbar: Leider pflanzt sich gerade in psychoanalytischen Instituten die ‚Leibfeindlichkeit’, paradoxerweise neben dem Freiheits-Anspruch für die Seele, von Generation zu Generation fort. Aber auch ‚Ex-kommunikation’ für Andersdenkende kommt nicht nur in dieser ‚community’ vor.) Seite 5 Bauriedl wirft Moser „Verfälschung“ der „Realität der therapeutischen Beziehung“ und „seiner eignen Reaktionen“ durch „ständige Uminterpretation“ derselben vor, was sie als „Wiederholung der Szenen, in denen viele Patienten (oder Moser selbst?) geschädigt wurden“ deutet, und postuliert schlussfolgernd: „Das Erwachsen-Sein der Patienten und ihrer Sexualität werden verleugnet.“ Sie scheint dabei ihre allzeit bereite eigene Uminterpretations-Neigung auf dem Boden mangelnder Erfahrung beim Betrachten des unbekannten Terrains von außen nachhaltig (verständlicherweise) nicht zu bemerken. Dass Moser mit „erfahrenen Patienten“ Therapieszenen quasi nachstellt, mag deren Authentizität angreifbar machen, und auch auf mich wirkte manches Detail ‚gestellt’, aber dem erfahrenen Betrachter sind die tief regressiven Elemente soweit nachvollziehbar, dass er sie mit Moser „durchaus als echte therapeutische Szenen begreift“. (Wer vor Jahren seine Live-Demonstrationen an freiwilligen Kollegen im Lindauer Stadttheater miterlebt hat, weiß, wie schnell sogar auf einer künstlichen Plattform ein echter, elementar regressiver Prozess in Gang kommen kann.) Ich habe mich bisher v. a. den ersten vier Seiten von Bauriedl’s Argumentation zugewandt und will diese Ausführlichkeit nicht fortsetzen: Der Grundtenor möge paradigmatisch deutlich geworden sein, demzufolge die Autorin ihrer Vorstellungswelt entsprechende „Körperphantasien“ bzw. Phantasien über das, was körperpsycho-therapeutische Interventionen bedeuten und auslösen könnten, entwickelt und diese Vor-Stellungen als Realität behauptet. Dabei basieren sie auf einem Psychoanalyse-Konzept, in dem eine Hereinnahme des realen Körpers als therapeutisch hoch effizient nicht sein kann, weil nicht sein darf: Eine Heerschar von schizoiden Psychoanalytikern würde arbeitsunfähig. Die wortreiche Argumentation bleibt System-immanent (was sich auch darin widerspiegelt, dass sie in 20 % ihrer Literaturverweise sich selbst zitiert). Das führt v. a. zu einer bemerkenswerten Undifferenziertheit bzw. Eingleisigkeit in der Auseinandersetzung mit dem Abstinenz-Begriff. Unfähigkeit und Unwillen, den Körper adäquat in die therapeutische Arbeit mit einzubeziehen, werden rationalisiert, indem sie sogar – schwammig und selbstreferenziell – idealisiert werden: „Die psychoanalytischen Abstinenzregeln sind wohlbegründet. Jeder Analytiker, der ein Gefühl für die Unterschiedlichkeit der Beziehungen hat, der zwischen analytischer Beziehung und konventioneller Beziehung zu unterscheiden gelernt hat, spürt sofort eine innere Vorsichtshaltung, wenn es darum geht, seinem Analysanden im ‚normalen Leben’ zu begegnen oder ‚normal’ mit ihnen umzugehen. Diese Vorsichtshaltung hat nichts mit neurotischer Angst (sic!) zu tun, sie entsteht als Warnsignal (wovor?) und wird immer deutlicher im Lauf einer guten analytischen Ausbildung (quod erat demonstrandum; s. o.), wenn man spürt, dass man die besondere Art der analytischen Beziehung schützen will und muss (wovor?), um in seiner Arbeit Seite 6 effektiv zu bleiben und den Patienten nicht zu schädigen (womit?)“. (Die Einwürfe in Klammern in diesem Zitat stammen natürlich von mir.) Ist das die Begründung? (Auch für seminaristische Behandlung etwa der Fragen, ob einem(r) Patienten(in) aus oder in den Mantel geholfen werden darf, oder mit welchem Wortlaut Kunst-gerecht eine Sitzung zu beenden sei, wie sie mir in anderem Zusammenhang psychoanalytischer Fachkunde begegnet sind? Zum Glück war es für meinen verehrten Lehranalytiker sogar schon vor 25 Jahren kein ernstliches Problem, dass ich anlässlich eines zufälligen Zusammentreffens beim Abschlussball der jeweiligen Kinder auch mit seiner Frau ein Tänzchen wagte. Welche Freiheit meiner Seele verdanke ich ihm, der sich sogar erlaubte – präzise gezielt - eigene Lebenserfahrungs-Aspekte als tröstendes Solidaritätsoder auch (Gegen-)Modell-Angebot ins Spiel zu bringen! Und noch meine Patienten bzw. deren ‚outcome’ danken es ihm indirekt! Und ich verbitte mir dringend, ihn oder mich als ‚un-abstinent’ disqualifizieren zu wollen! Fast tragisch ist es, wenn sie ein- und weitsichtige „Altvordere“(?) wie Alexander und French, die schon 1946 „das ‚intellektualisierte’ psychoanalytische Verfahren kritisierten“ und die „korrigierende emotionale Erfahrung“ für möglich und wünschenswert hielten, in die Schranken weist: „Schon Ferenzci (1930, S. 263) hatte Freuds ‚Prinzip der Versagung’ sein ‚Prinzip der Gewährung’ entgegengestellt. Er wollte den psychoanalytischen Prozess beschleunigen, indem er durch Gewährung die Widerstände lockerte, um so, wie er glaubte, den Wiederholungszwang aufzuheben. Der Misserfolg dieser ‚aktiven Technik’ und Freuds Kritik an ihr ließ diese Ideen für einige Zeit aus den Veröffentlichungen der Psychoanalytiker verschwinden.“ Tragisch für die Psychoanalyse, peinlich dazu wegen der zutage getretenen Inquisition und schade für die Patienten, dass bahnbrechende Überlegungen zu Abstinenz, (Gegen-)Übertragung, und Arzt-Patient-Beziehung (nicht umsonst war der ‚praktische Arzt’ M. Balint sein Schüler) in seinem ‚Klinischen Tagebuch von 1932’ erst 1985 erscheinen durften (unter dem Titel ‚Ohne Sympathie keine Heilung’. Das wusste übrigens schon Paracelsus!): Nibelungentreue Epigonen des aus tatsächlichem sexuellen Fehlverhaltens von Analytikern (über)vorsichtig gewordenen Gründervaters meinten, die reine Lehre durch Selbstzensur über ein halbes Jahrhundert vor dem revolutionären Gedankengut eines vermeintlichen Dissidenten schützen zu müssen. Höchst fraglich, ob dies letztlich zu Freud’s Wissenschafts-Verständnis gepasst hätte. (Um es mit Ludwig Marcuse zu sagen: „Freud war kein Freudianer; sie waren, von ehrenvollen Ausnahmen abgesehen, nur das unvermeidliche Nebenprodukt.“) Auch die Darstellung, dass „die Trias der psychoanalytischen Behandlung: Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten verlassen“ und „die spontane Wiederholung und darin die negative Übertragung vermieden“ würden, weil „der Therapeut ja jetzt ‚besser’ als die früheren Bezugspersonen“ sei, ist eine Seite 7 Denunziation der Intentionen Mosers, o. g. Autoren und ernsthafter KörperPsycho-Therapeuten. Für ausgeschlossen hält Bauriedl offenbar eine Verkennung des (Re-)Traumatisierungspotentials in einer zu artifiziellen Begegnungsweise. Den „Veränderungswunsch“ entwickelt der Patient in der Tat „nur im Erleben des Leidens“: Dem realen Leid, das auch in der KörperPsycho-Therapie und in der auch hier allfälligen Übertragung nicht vermieden werden kann und soll, braucht nicht das der vergeblichen Anstrengung, eine unerreichbare (Kunst-) Figur (wieder) nicht zu erreichen, hinzugefügt werden. Und keinesfalls geht es mir in meinem Therapie-Verständnis um die unterstellte „rückwirkende Veränderung der Vergangenheit in der Gegenwart“ oder um Neigung zur Verwechslung der „Rolle des Analytikers… mit der eines Ersatzpartners“. Und ob der therapeutische Prozess nur die „Illusion einer Begegnung“ ist, dürfte eher von der Persönlichkeit des Therapeuten und einem differentialdiagnostisch sauber erarbeiteten Setting-Angebot als davon abhängen, ob dies ‚reine’ oder „angereicherte“ Psychoanalyse repräsentiert. Und natürlich bedeutet, den Körper in die Arbeit mit einzubeziehen, eine nicht minder große „Verantwortlichkeit des Therapeuten“ für das, was im Prozess geschieht, sicher keinesfalls deren „Vertuschen“ oder gar Überwälzen auf den Patienten. Gänzlich unverständlich bleibt mir, wie Bauriedl meinen kann, „die Analyse dieser Szenen (Kindheitsszenen) wird unmöglich, wenn sie agiert werden“, als sei das (in analytischen Kreisen meist pejorativ konnotierte) Agieren nicht die ‚natürlichste’ und vielleicht dem Patienten einzig mögliche Weise, seine konflikthafte Geschichte darzustellen. Und als sei es nicht möglich und vielleicht sogar wesentlichster Bestandteil analytischer Arbeit, diese Wiederholungen durch Agieren gerade im geschützten Rahmen der therapeutischen Begegnung zu analysieren. „Die Moral der Psychoanalyse besteht nicht darin, dass man bestimmte Handlungen oder Interpretationen vermeidet, sondern darin, dass man jeweils genau hinsieht und hinfühlt, um die psychische Realität und auch die äußere Realität der therapeutischen Beziehung nicht aus dem Auge zu verlieren.“ Stimmt genau, Frau Bauriedl! Es kommt eben einzig auf die ethisch klare innere Haltung an! Und ich füge hinzu: Auch darauf ist zu achten, dass aus einer möglichst natürlichen menschlichen Begegnung durch iatrogene Künstlichkeit nicht eine verfälschte (Beziehungs-)Realität gemacht und dann ‚behandelt’ wird. Das wäre ein Kunst-Fehler, der, so fürchte ich, noch allzu häufig in der ‚therapeutischen’ Realität vorkommt. M. E. schädigt den Patienten nichts mehr als ‚unnormal’ mit ihm umzugehen, anders scheinen zu wollen als man ist, z. B. unbewegt, wenn man bewegt ist, unberührt, wenn traurig, gelassen, wenn ärgerlich, und auf eine normale Frage Seite 8 eines Menschen an den anderen – auch wenn der eine ‚Patient’ und der andere ‚Analytiker’ ist – unbegründet keine normale Antwort zu geben. (Es soll vorkommen, dass der Patient der untrüglichere Analytiker ist, als sein Gegenüber in dieser vereinbarten Rolle.) Eine zentrale Not vieler Patienten ist gerade die fundamentale Unsicherheit hinsichtlich des affektiven bzw. emotionalen Gehalts (eigener und anderer) Aktionen und Reaktionen, weil es ihnen an ebenso wohlmeinendem wie aufrichtigem und verlässlich authentischem Gegenüber gefehlt hat. (Und hier rede ich natürlich nicht unkontrolliertem ‚Agieren’ des Analytikers das Wort.) „Die Einsamkeit der abstinenten Haltung ist oft schwer auszuhalten. Aber wenn ich mir vorstelle, wie sehr ich meiner Patientin oder meinem Patienten schade und wie ich meine eigene Arbeit zerstöre, wenn ich die abstinente Haltung verlasse, fällt es mir wieder leichter, an ihr festzuhalten. Vielleicht ist das in manchen Situation auch für eine Frau leichter als für einen Mann.“ (Wer sexualisiert hier? Oder wie ist das gemeint? Der/die sich seines/ihres Tuns bewusste KörperPsycho-Therapeut/in fühlt sich hier jedenfalls nicht angesprochen, versteht allenfalls erneut die ebenso fatale wie reduktionistische Gleichsetzung von Abstinenz mit sexueller Abstinenz.) Vielleicht sollte einmal erwogen werden, wie die eben beschriebene Schädigung ihrer affektiven/emotionalen Eichkurve, mit der Menschen zu uns kommen, sich vergrößern könnte, wenn die Chance einer „korrigierenden Erfahrung“ sogar anlässlich einer selbstverständlich geschützten und ritualisierten ,Selbsterfahrung in der Begegnung’ mit einem Poker-gesichtigen Gegenüber vertan wird. Hier, und nicht durch KörperPsycho-Therapie ist die Gefahr groß, „Patienten Gefühle (zu) ‚machen’“. Gerade im Standardsetting kommen Patienten leicht zu kurz, „die oft ihre Gefühle bis zur Unkenntlichkeit zurückgenommen haben“. Immerhin anerkennt Bauriedl zumindest hier die Möglichkeit, dies könne „auf (früh-?)kindliche Situationen zurückzuführen sein, „in denen die Bezugspersonen die Gefühle des Kindes und deren Ausdruck nicht haben ertragen können“. Ob allerdings „das Kind (versuchte) …, v. a. keine sexuelle Erregung bei Erwachsenen auszulösen“, ist ebenso bezweifelbar, wie die Hoffnung, eine gelingendere Erfahrung machen zu können mit einem „schafsgesichtigen Blechaffen“. Ansonsten hält die Autorin „den Begriff ‚Frühstörung’ grundsätzlich für problematisch, geht er doch von der Vorstellung aus, dass dieser Patient schon sehr ‚früh’ in seiner Entwicklung gestört wurde, während andere Patienten erst ‚später’ in traumatische Beziehungssituationen gerieten“. Es mag mit der weit zurückliegenden analytischen Sozialisation Bauriedls zusammenhängen, dass Sexualität überall gewittert, mittlerweile bestens fundierte Daten von Säuglings- und Bindungsforschung aber scheinbar nicht zur Kenntnis genommen werden. Seite 9 Wie sehr bei ihr die Furcht vor Sexualisierung Ausdruck einer (latenten) Sexualisierung des althergebrachten Metiers ist, die projektiv abgewehrt wird, zeigt sich nicht nur besonders deutlich, wenn die Autorin das ihr Ferne bzw. Unbekannte u. a. explizit sogar mit dem Begriff „Vergewaltigung“ benennt, sondern allein schon in der Selbstverständlichkeit, mit der sie „körperliche Berührungen zwischen Analytiker und Analysand, die über die konventionelle Begrüßung und Verabschiedung hinausgehen, mit einer psychoanalytischen Haltung grundsätzlich unvereinbar“ findet , damit – wegen der „Bedeutung von körperlichen Berührungen (in der spezifischen Situation der analytischen Beziehung)“ – „der Analytiker… nicht zum Verführer wird, oder sich selbst dazu verführen lässt, die Situation in grenzverletzender Weise auszunützen“. Aber: „Bei Kindern sind solche Berührungen üblich und selbstverständlich. Deshalb kann es ja auch so leicht geschehen, dass Kinder sich nicht mehr auskennen, wenn die Berührungen plötzlich missbräuchlichen Charakter annehmen. Dies geschieht, sobald der Erwachsene dabei die Phantasie hat, nicht ein zu schützendes Kind zu berühren, sondern einen Sexualpartner… Zwischen Fremden haben sie (die Berührungen) im Allgemeinen die Bedeutung der sexuellen Annäherung.“ Ja, wo kommen wir denn da hin?! So klein ist in Bauriedls Phantasie (und Realität?) das Spektrum von Berührungen zwischen Erwachsenen? Immerhin beschreibt sie genau die ‚Phantasie’ von KörperPsycho-Therapeuten, die hinsichtlich Erfahrung tiefer Regression eben doch weiter sind, als offenbar mancher herkömmlicher Analytiker: Sie wissen, wann sie im erwachsenen Patienten ein „zu schützendes Kind“ berühren. Wenn das Ungeheuerliche wirklich stimmt, dass etwa 10 % der Psychotherapeuten ihre Schutzbefohlenen sexuell missbrauchen, behaupte ich, dass der kleinere Teil von ihnen aus dem Lager der ‚angereichert’ ausgebildeten und ‚anreichernd’ Arbeitenden kommt: Sie haben nämlich besser gelernt, wie „man jeweils genau hinsieht und hinfühlt“, schon ‚Setting-bedingt’, - neben aller Denk-Arbeit. Ich beklage hier gerade, dass erst „seit einiger Zeit in der psychoanalytischen Literatur die Gegenseitigkeit der analytischen Beziehung deutlicher“ wird, und fordere damit, „dass die analytische Beziehung als ein Ineinandergreifen von Übertragung und Gegenübertragung von beiden Beteiligten zu verstehen ist“. V. a. aber beklage ich, dass aus dieser Erkenntnis – auch der Autorin – ausreichende Konsequenzen zu ziehen als so mühsam erscheint. Stattdessen werden Gegenpositionen aufgebaut, die den ‚gegnerischen’ Positionen gar nicht entsprechen. Besonders unglücklich geschieht dies, wenn sie Tilman Moser und Günther Bittner in den gleichen Zusammenhang stellt, weil sie „trotz ihres langjährigen Konflikts fast unisono die ’Versteinerung des Abstinenzkonzeptes’ verurteilen“, nachdem sie allen Ernstes zuvor die „Frage“ (aus dem gleichen Forum-Heft) aufgreift, „ob Liebe in der Analyse ein Fall für den Staatsanwalt ist“. Nicht nur wird damit zumindest fahrlässig „Liebe“ mit “Sexualität in der analytischen Beziehung (Bittner 1998)“ gleichgesetzt, sondern (auch hier) die üble Unterstellung eingebracht, der analytische KörperPsycho-Therapeut Moser Seite 10 und der kriminelle Psychoanalytiker Bittner könnten von gleichem Schlag sein. Auch, dass „die Entscheidung für eine therapeutische Beziehung bedeutet, dass sie keine ‚normale’ Beziehung ist, aus der eventuell eine Liebesbeziehung entstehen könnte“, bedeutet nicht, dass eine körperpsycho-therapeutische Beziehung ‚nicht normal’, oder eine sexuelle Beziehung in einer Analyse „normal“ sei. (Warum nebenbei, fällt in einem Artikel zur Abstinenz in der Psychoanalyse – auch wenn sexuelle Abstinenz offensichtlich den Hauptakzent erhält – kein Wort etwa zum Macht-Missbrauch, in dem der Analytiker narzisstisch ein ohnehin unvermeidliches Machtgefälle aus Angst vor eigener Angreifbarkeit und Verletzlichkeit zum Eigenschutz noch ausbaut?) Das Konzept der „korrigierenden Erfahrung“ ist nicht deshalb falsch, weil es auch im falschen Kontext eingesetzt (bzw. zitiert) werden kann, etwa in dem des Mythos vom „Gegengift“ der Berührung des Körpers, der sich ‚unberührt’ und missachtet fühlt“: Als sei dies Sinn und Zweck von Berührung in der Körperarbeit, oder als ginge es ernstlich darum, „zuviel oder zu wenig Berührung durch quantitativen Ausgleich korrigieren zu wollen“. Es gibt, wie gesagt, auch Körperarbeit ohne Berührung, aber ebenso kann ihr Ausbleiben grobe Unterlassung sein, ihr indizierter Einsatz viele Rede-Stunden einsparen. Und vielleicht fühlt der Patient so sogar besser, dass er nicht „grenzenlos“ ist, und fühlt sich der Therapeut dann (gerade als solcher) nicht nur „besser“ (weil erkennbar hilfreicher und damit tatsächlich zufriedener), sondern ist es sogar – wenn auch nicht im Sinne des „idealen Vaters“. Eine selbstverständliche Implementierung von Körperarbeit in den analytischen Prozess nimmt unmittelbar Druck aus der Beziehung, den ängstliche Verkrampfung des Therapeuten m.E. – wie sinngemäß auch schon gesagt – als Artefakt überhaupt erst in den Prozess hineinträgt. (Dabei sei auch noch einmal gefragt, ob diese Ängstlichkeit nicht selbst ein Artefakt traditioneller Instituts-abhängiger Ausbildung – mit übrigens allzu oft entsprechend ‚inzestuöser’ Lehrer-SchülerBeziehung, die gelegentlich auch sogar (leider erst nach ihrer ,Emeritierung’) von prominenten Institutsvorständen beklagt wird - sein könnte, oder ob vielleicht die einschlägige Tradition entsprechende Kandidaten mit ‚gehaltener’ Konstitution und Begabung zu aseptischer intellektueller Logelei besonders anzieht.) Während Bauriedl den Vorwurf von „Funktionalisierung“, „Instrumentalisierung“ und „Manipulation“ des Patienten durch KörperPsychoTherapeuten (und umgekehrt) gegen letztere erhebt, wäre er also im Rahmen des artefiziell ‚abstinenten’ Settings herkömmlicher Psychoanalyse wahrscheinlich eher angebracht – nur wird dies und seine Auswirkungen verständlicherweise von seinen Vertretern nicht so kritisch hinterfragt. (Besser denn je wissen wir, dass Freud ursprünglich selbst eine weit natürlichere Begegnungsweise mit seinen Patienten gepflegt hat: Ich sähe ihn im Umfeld seiner jüngsten Geburtstags-Gedenkfeiern gerne geehrt, indem man dem großen Pionier die Erweiterung seines therapeutischen Repertoires um die Körper-Dimension (im engeren Sinn) zutraute, hätte er die in den letzten Jahrzehnten glücklich Seite 11 geminderte Befangenheit des 19. Jahrhunderts hinsichtlich der Leiblichkeit und die Erkenntnis der von ihm so hochgeschätzten wissenschaftlichen Forschung im gleichen Zeitraum noch erlebt.) Natürlich können meine Einwände gegen den herkömmlichen Abstinenzbegriff abgetan werden mit dem Hinweis, ich arbeitete schlicht psychotherapeutisch, hätte längst die Psychoanalyse verlassen. Gerade, weil ich deren tiefenpsychologische Modellbildung unübertroffen finde, will ich mich nicht so leicht ‚ausbürgern’ (lassen), sondern versuche unbeirrt, die mir an ihr entscheidenden Ideen im Diskurs mit ‚modernen’ Therapie-Richtungen und ihren oft allzu zeit,geistigen’ Instant-Heilsversprechen zu vertreten. (Auch deshalb dies Verlassen meiner sonstigen Schreib-Abstinenz, ehrlicher gesagt Schreib-Faulheit.) Entscheidend für Freud war u.a., wie gesagt, der Wissenschafts-Anspruch. Und die Mindestvoraussetzung für einen solchen ist der einer Weiterentwicklung von Erfahrung, Erkenntnis und Einsicht. Der Anspruch, eine hilfreiche ‚Kur’ anzubieten, ist mir noch wichtiger, weil ärztliche Verpflichtung. In meiner zwanzigjährigen Praxis ist noch kein Patient zu mir gekommen mit dem Wunsch, eine Psychoanalyse ‚an sich’ zu machen, sondern jeder hatte ein explizites Hilfeersuchen. Der Anspruch auf Linderung von Not und möglichst weitreichende ‚Heilung’ steht nach meinem Verständnis gleichberechtigt neben dem auf ‚nil nocere’, und ärztliche Ethik verlangt beider Einlösung nach allen Regeln der Kunst. Gestritten werden darf und muss um die Frage, was zu diesen gehört und was nicht. Bornierte Abschottung gegen nutzbringende Ausweitung derselben jedenfalls ist nicht kunstgerecht. Die Aufforderung Bauriedls in ihrer „Schlussbemerkung“, „jetzt die öffentliche Diskussion zum Anlass (zu) nehmen, um uns über die ethischen Prinzipien und Grenzen klar zu werden“, klingt rhetorisch, um nicht zu sagen unredlich, wenn sie schon (längst) weiß, wie „die psychoanalytische Abstinenz immer wieder neu und eindeutig zu definieren“ sei. (Und bezüglich der Definition der „ethischen Prinzipien und Grenzen unserer Arbeit“ weiß sie das sicher auch schon vor jeder Diskussion. Die hat man mit der ‚psychoanalytischen Gesellschafts-Muttermilch’ eingesogen. Siehe Definitionshoheit). Auch die Psychoanalyse steht nicht außerhalb des (v.a. ideellen) Wettbewerbs der HeilMethoden, und innerhalb dessen gilt auch für sie: Wer heilt, hat recht. Sie schadet sich, wenn das Rechtbehalten in der Auslegung eines zu eng gefassten Abstinenz-Begriffes zur Ausgrenzung derer führt, die in der kunstgerechten Einbeziehung der psychoanalytisch fundierten Körperarbeit eine wertvolle Erweiterung des therapeutischen Repertoires befürworten – zum Wohle der Patienten. Die gehen dorthin, wo sie am ehesten effektive Hilfe erwarten dürfen. Wo das ist, spricht sich herum (s.o.). Nur, wenn sich die Psychoanalyse aus akademischer (?) Tradition und institutionalisierter Angst einer angemessenen Aufgeschlossenheit (und „öffentlichen Diskussion“) verweigert, wird sie – jedenfalls als anerkannte Heilmethode – tatsächlich sterben. Seite 12 Aber selbst dann muss die ‚Leiche’ der „alten Tante Psychoanalyse“ ja nicht ‚gefleddert’ werden: Die Nachkommen erben dankbar die besten Stücke! Seite 13