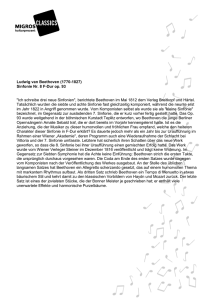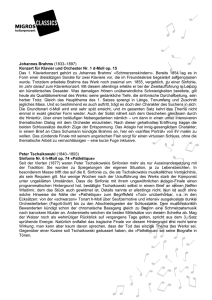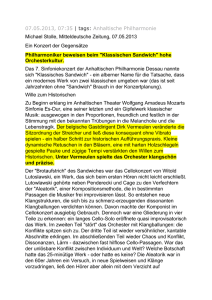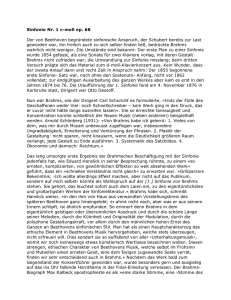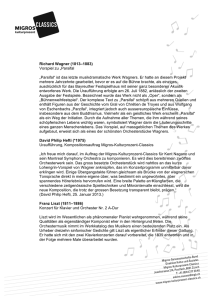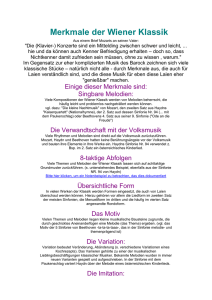Am heutigen Abend erklingen Werke von 4 Komponisten, deren
Werbung

Mittwoch, 6. Februar 2013 20 Uhr, Volkshaus 6. Philharmonisches Konzert Reihe A Letzte Worte. Legenden. Hector Berlioz (1803-1869) Ouvertüre »König Lear« (Le Roi Lear) op. 4 Béla Bartók (1881-1945) Konzert für Viola und Orchester op. posth. (Version Serly) Allegro moderato Lento Allegretto Pause Johannes Brahms (1833-1897) Sinfonie Nr. 3 F-Dur op. 90 Allegro con brio Andante Poco allegretto Allegro Dirigent: GMD Marc Tardue Viola: Christian Götz 1 Der Dirigent Marc Tardue wurde als Sohn franko-italienischer Eltern in Amerika geboren. Er absolvierte das Peabody Conservatory in Baltimore und studierte anschließend Klavier und Dirigieren, darüber hinaus ist er ausgebildeter Gesangslehrer und Klavierbegleiter. Schon kurz nach Beendigung seiner Studien erhielt er von amerikanischen Choral-, Sinfonie- und Opernensembles Engagements als musikalischer Leiter und Chefdirigent. Von 1982 bis 1984 war Marc Tardue Chefdirigent der National Opera von Reykjavik, 1984 gewann er den internationalen Dirigentenwettbewerb »Concours International d’Execution Musicale Ernest Ansermet« (CIEM). 1985 übernahm er kurzfristig beim »Ensemble Instrumentale de Grenoble« Aufführungen der 9. Sinfonie von Beethoven und wurde sowohl vom Publikum wie auch den Musikern dermaßen umjubelt, dass das Orchester ihn umgehend zum Musikdirektor wählte. Unter seiner Leitung wurde das Repertoire des Klangkörpers um große Sinfonien sowie Chor- und Opernwerke erweitert. Zwischen 1991 bis 2002 war Marc Tardue Chefdirigent des Sinfonieorchesters des Theaters Biel (Schweiz), von 1999 bis 2009 des Orquestra Nacional do Porto (Portugal). Seit 2010 ist er künstlerischer Leiter und Musikdirektor der »Oper Schenkenberg« (Schweiz). Als gern gesehener Gastdirigent arbeitet er mit renommierten Orchestern im In- und Ausland zusammen. Für seine künstlerischen Leistungen wurde Marc Tardue mit vielen Preisen und Auszeichnungen geehrt, u.a. erhielt er 1989 den französischen Kulturorden »Chevalier des Arts et des Lettres« und 2004 die »Medalha de Mérito Cultural«, eine der höchsten Ehrungen Portugals. Der Solist Christian Götz, 1984 in Halle/Saale geboren, hatte ab dem 6. Lebensjahr Violinunterricht an der Musikschule Leipzig. Nach dem Abitur studierte er an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig, später an der Universität der Künste Berlin bei Professor Hartmut Rohde, an der er 2009 sein Diplomexamen absolvierte. Bereits seit 2007 war er Mitglied der Orchesterakademie des Rundfunksinfonieorchesters Berlin. Eine regelmäßige Zusammenarbeit verband ihn überdies mit dem Bachorchester des Gewandhauses zu Leipzig. In der Saison 2009/2010 hatte er einen Zeitvertrag bei der Dresdner Philharmonie. Seit 1. Januar 2011 ist Christian Götz Solo-Bratscher der Jenaer Philharmonie. Avantgarde gegen Konservative Beim Verfassen eines Programmführers gehen mir immer drei Aspekte der Werkbesprechung durch den Kopf: Die Werkanalyse, das Hörerlebnis – denn dem Konzertpublikum steht zumeist keine Partitur zur Verfügung – und der Inhalt (biografische und programmatische Einflüsse). Werfen wir einen Blick auf vergangene Epochen, insbesondere das 19. Jahrhundert, indem Musikkritik, Musikjournalismus und Musikwissenschaft ihren größten Einfluss auf Komponisten und Gesellschaft hatten. Die Musik wurde als höchste Vereinigung aller Künste angesehen und dem mündigen Publikum ein enormes Musikverständnis zugesprochen. Dann wird deutlich, wie wichtig vor allem die Frage nach dem äußeren Einfluss auf die Komposition sowie die Werkinterpretation und -beschreibung ist. Dies führt uns auf direktem Weg zum »Musikstreit« zwischen Avantgardisten und vermeintlichen Konservativen: Programmmusik gegen absolute Musik – Berlioz, Liszt und Wagner gegen Schubert, Schumann und Brahms. Zwei Lager, die aus derselben Tradition hervorgingen und sich alle auf den Vollender der Klassik und großen Visionär Ludwig van Beethoven beziehen. Sie alle meinten, dass es nach Beethoven schwierig wäre, Musik zu komponieren und suchten deshalb nach eigenen Wegen und Innovationen. Für den Außenstehenden schlagen alle Komponisten eine ähnliche Richtung ein: Der Musik wurden nun Programme, Ideen und Vorbilder aus anderen Künsten wie Literatur oder Malerei zu Grunde gelegt. 2 Doch die beiden Lager führten einen erbitterten Kampf gegeneinander. Für die Programmmusiker wie Berlioz und Liszt war die Musik die höchste Vereinigung aller Künste. Sie konnte Geschichten formulieren, Charaktere erschaffen, mit Klangfarben Bilder malen und Gefühle ausdrücken. Sie war eine erzählende Kunst. Dem gegenüber standen die Verfechter der absoluten Musik. Auch sie setzten manchmal ihren Werken klare Überschriften voran. Doch strebten sie nach dem romantischen Ideal, das die Vollendung des Kunstwerkes von der Phantasie des Rezipienten abhängig macht und dieser nicht durch konkrete Programminhalte davon abgelenkt oder im schlimmsten Fall fehlgeleitet werden sollte. Wir erkennen nun die unterschiedlichen Sichten der Komponisten auf die Herangehensweisen an ihre Schöpfungen. Doch wie liegen diese Dinge heute? Wie erhalten wir Informationen über das Werk? Ist es für unser Verständnis und Hörvergnügen wichtig, den biografischen Hintergrund und die Intentionen des Künstlers zu kennen, wenn wir diese Musik hören? Das heutige Konzert wird von zwei Vertretern eben dieser beiden Oppositionen umrahmt. Zum einen die Ouvertüre zu König Lear von Hector Berlioz, in welcher die Geschichte des Königs Lear nach Shakespeare erzählt wird, und die berühmte 3. Sinfonie des Romantikers Johannes Brahms. Dazwischen spielt das Orchester das von Béla Bartók vor seinem Tod begonnene und von seinem Schüler Tibor Serly vollendete Bratschen-Konzert. Auch hier stellt sich die Frage nach dem Programm, da der Lebenslauf eines Künstlers ebenfalls programmatischen Einfluss auf sein Werk nehmen kann. Doch lassen Sie sich selbst von der Musik Geschichten und Legenden erzählen oder machen Sie – nach dem romantischen Ideal – mit ihrer eigenen Phantasie erst die Brahms’sche Sinfonie zu einem Kunstwerk. Die Komponisten und Ihre Werke Wir beginnen mit der Ouvertüre »König Lear« (Le Roi Lear) op. 4 von Hector Berlioz. Ein Stück, welches sich sowohl eines inhaltlichen Programms bedient, als auch von prägenden biografischen Ereignissen beeinflusst wurde. Die Entstehungsgeschichte jedenfalls liest sich wie ein Abenteuerroman. 1827 kam Berlioz, als eine Schauspielergruppe aus England in Paris gastierte, erstmals mit dem Oeuvre Shakespeares in Kontakt. Er verdiente sein Studiengeld damals selbst als Varietésänger, besuchte eine solche Aufführung mit der Schauspielerin Harriett Smithson und verfiel ihr. Sicher trug dies dazu bei, die Vorstellungen der Theatertruppe, welche vorzugsweise Shakespeare aufführte, häufiger zu besuchen. Drei Jahre nach diesem Ereignis verdingte er sich als Musiklehrer an einem Mädchenpensionat, wo er auf die Klavierlehrerin und Pianistin Marie-Félicité Moke traf und sich mit ihr verlobte. Neben dieser Anstellung komponierte er immer neue Stücke und gewann endlich mit seiner Kantate »Sardanapale« den Rom-Preis, auf welchen er bereits vier Jahre lang hin gearbeitet hatte. Mit diesem Preis war sein Einkommen auf mindestens fünf Jahre gesichert, außerdem erhielt er ein Stipendium in Rom. Im Januar 1831 traf er dort auf Felix Mendelssohn Bartholdy, der schon 1826 mit seiner Ouvertüre »Sommernachtstraum« einen Shakespeare-Text zur Vorlage benutzt hatte. In der Folge fühlte sich Berlioz inspiriert, sich weiterhin mit den englischen Dramentexten des Poeten von Avon auseinanderzusetzen. In dieser Zeit erhielt er einen Brief von der Mutter seiner Verlobten, die ihm mitteilte, dass das Bündnis aufgehoben und Marie-Félicité den reichen Pariser Klavierbauer Camille Pleyel heiraten würde. Die Legende besagt, dass er sich, von dieser Nachricht geschockt, sofort auf den Weg zurück nach Paris machte, um alle an diesem Komplott beteiligten Personen und schließlich sich selbst umzubringen. Sein Plan war es, sich mit einer gestohlenen Pistole und in Frauenkleidern Zugang zu den Wohnräumen der Familie Moke in Paris zu verschaffen und dort ein Blutbad anzurichten. Glücklicherweise nahm eine damalige Reise von Rom nach Paris mehrere Tage und Zwischenstopps in Anspruch. So kam er zuerst nach Genua, wo sich sein Gemüt soweit beruhigt 3 zu haben schien, dass er nur noch sich selbst umbringen wollte. Jedoch wurde er von Freunden abgehalten. Sein Weg führte ihn weiter nach Nizza, wo er nun vollends seinen Mordplan verwarf und sich eine einmonatige Auszeit nahm. Er bewohnte ein Zimmer direkt am Meer, wachte durch das Rauschen der Wellen auf, beobachtete die Schiffe im Hafen und erkundete die umliegende Gegend. In seiner Niedergeschlagenheit suchte er Ablenkung in seiner Arbeit. Er erinnerte sich an Shakespeare. Besonders angetan hatte es ihm die niederschmetternde Geschichte des König Lear, der anscheinend die gleichen Schmerzen erlitten hatte, wie Berlioz ein paar Wochen zuvor. König Lear war ein stolzer Mann, der sich zur Ruhe setzen und sein Reich auf seine drei Töchter aufteilen wollte. Um eine Entscheidung herbeizuführen, veranstaltete er einen Liebestest, den seine Lieblingstochter Cordelia verlor. Stattdessen bekamen die beiden anderen Töchter den gesamten Besitz. In ihrer Gier verstießen sie den König, der einsam im englischen Moor herumirrte und darüber wahnsinnig wurde. Seine Lieblingstochter, inzwischen mit dem französischen König verheiratet, erfuhr vom Schicksal ihres Vaters und eilte ihm mit einer Armee zu Hilfe. Gemeinsam mit Königstreuen kämpften sie gegen die Verräter. Cordelia und ihr Vater gerieten dabei in Gefangenschaft und sollten getötet werden. Zwar gewannen die Krieger des Königs den Kampf, aber für Cordelia kam jede Hilfe zu spät. König Lear erkannte nun das erschreckende Ausmaß seines Fehlers, beweinte den Tod seiner Tochter und starb als gebrochener Mann. Zur musikalischen Wiedergabe eines solchen Programms bedurfte es einer Erweiterung des traditionellen Klangspektrums. Neben den bisherigen musikalischen Ausdrucksmitteln, wie Rhythmik, Kontrapunkt oder motivisch-thematischer Arbeit in der klassischen Periode, emanzipierte sich nun die Klangfarbe als ästhetisches Kompositionsmittel. Tiefe Streicher, noch an Beethoven erinnernd, dominieren den Anfang der Ouvertüre. König Lear wird charakterisiert. In der Folge taucht dieses Motiv immer wieder auf, mal mit fanfarenschmetternden Bläsern und Pauken, dann mit hektischen, nicht zu bremsenden, schneidenden Streichern. Ganz nach Gemütszustand ändert sich auch die Orchestrierung. Ein ebensolches Charaktermotiv gibt Berlioz Cordelia. In den hohen Lagen erklingen die Streicher in lieblicher Begleitung durch die Holzbläser. Einen Höhepunkt erreicht das Geschehen mit der Verstoßung des Königs und dem einsetzenden Allegro, welches in einem verrückten Tempo den Wahnsinn Lears nachzeichnet. Die Ouvertüre scheint glücklich zu enden, doch in der letzten Minute hören wir vom Tod Cordelias und dem im Chaos versinkenden Reich Lears. August Wilhelm Schlegel, ein Schriftsteller und Zeitzeuge beschreibt dies so: »[Eine] furchtbare Sinfonie, in der die Menschheit, während die Erde von Gewittern bebt, ihr ganzes Leid auszuschreien scheint.« Das zweite Stück des Abends scheint ebenfalls biografisch beeinflusst zu sein. Jedenfalls erkennen Kritiker im Konzert für Viola und Orchester op. posth. von Béla Bartók den Lebensweg des Komponisten wieder. Eine immer wieder zitierte Legende unterstreicht diesen Eindruck: »Es tut mir leid, dass ich mit vollem Gepäck scheiden muss.«, dies sollen die letzten Worte Bartóks auf dem Totenbett gewesen sein. Ein Sprichwort sagt: Reise mit leeren Taschen, damit du viele Eindrücke darin einpacken kannst. Bartók erwähnt hier seine Koffer, die er während seiner (Lebens-)Reise füllte und deren Eindrücke er zum Schluss nicht mehr zu Papier bringen konnte. Noch im Jahr 1944 nahm er aus Geldnot einen Auftrag des Bratschisten William Primrose für ein Konzert an. Zur Vorbereitung studierte er das bisherige Repertoire für Viola, um die technischen Möglichkeiten des Instruments auszuloten. Dabei ließ er sich von Hector Berlioz’ »Harold en Italie« mit konzertanter Viola und seiner Klangfarbigkeit inspirieren. Rezitativisch werden wir bei Bartók von der Solo-Viola begrüßt, die uns rhapsodisch etwas zu erzählen scheint. Dabei steigert sie sich in explosive Erregung hinein, um dann wieder in melancholische Resignation zurückzufallen. Ebenso erscheint ihr Spiel manchmal schroff und widerborstig, dann wieder sanft, fast wehmütig. Das Orchester erhält dabei nur eine Nebenrolle, wogegen dem Solisten in virtuosen Partien höchstes technisches Können abverlangt wird. 4 Es schließt sich ein zweiter Satz voller erhabener Ruhe und Wärme an. Der volle Klang der Viola ermöglicht diese friedvollen Momente, welche fast schon meditativ anwirken. An seine Biografie angelehnt, könnte man meinen, hier seine tiefe Traurigkeit zu hören: Ein Emigrant, ein Flüchtling, gelandet in der grenzenlosen Moderne New York Citys – ohne Aussicht auf Rückkehr. Trauer um die Heimat, welcher er in der Einsamkeit am Saranac Lake nahe zu kommen sucht. Im letzten Satz kommt er diesem Zuhause wieder näher. Nützlich vor allem für diesen Satz waren sicherlich seine früheren Studien der ungarischen Volksmusik. Das Allegro vivace begegnet uns mit tänzerischem Schwung und dem Temperament des Balkans. Jedoch ist das Spiel der Viola ähnlich wie im ersten Satz zwiegespalten zwischen den Gefühlen für die gute alte Heimat und der Angst vor den Verwüstungen des 2. Weltkriegs. Béla Bartók konnte dieses Werk leider nicht mehr beenden. Wie andere seiner Kompositionen wurde auch diese von seinem ehemaligen Schüler Tibor Serly, ebenfalls einem Bratschisten, fertiggestellt. Das berühmteste Werk dieses Abends erklingt nach der Pause. Nun können wir in direkter Gegenüberstellung den Kontrast zwischen den gegnerischen Lagern der Programmmusiker und den Vertretern der absoluten Musik anhand der 3. Sinfonie in F-Dur op. 90 von Johannes Brahms hören, den Unterschied zwischen extern intendierter und aus sich selbst heraus geschaffener Musik. Brahms begann recht spät mit der Komposition von Sinfonien. Noch um 1870 schrieb er dem Dirigenten Hermann Levi: »Ich werde nie eine Sinfonie komponieren! Du hast keinen Begriff davon, wie es unser einem zu Mute ist, wenn er immer so einen Riesen [Beethoven] hinter sich marschieren hat.« Doch schon sein Freund Robert Schumann hatte ihn gedrängt, eine Sinfonie zu schreiben. Denn nur ein solches Großwerk bringt einen Komponisten in der Gunst des Publikums und der Kritiker voran. Für seine 1. Sinfonie benötigte Brahms dann doch vierzehn Jahre und vollendete sie 1876. Auch er musste zunächst seinen eigenen sinfonischen Stil und seinen eigenen Gattungsbegriff gegenüber Beethoven festigen. In der 1883 fertiggestellten Sinfonie Nr. 3 finden wir diesen nun ausgeprägt vor. Ähnlich wie bei Beethovens 5. Sinfonie wird das Eröffnungsmotiv, hier ein aufwärtssteigendes Motto in den Bläsern, zur Grundlage für die restliche Sinfonie. Jedoch bringt Brahms dieses Akkord-Motiv nicht plakativ an exponierter Stelle, sondern bindet es geschickt in den harmonischen Ablauf ein. Ohne Notenanalyse bleibt es für den Hörer oftmals sogar unerkannt. Es besteht aus einem Dur-Moll-Wechsel, der sich ebenfalls durch das gesamte Werk zieht. Genau wie dieses Motiv arbeitet er auch alle anderen Themen mit Hilfe der »entwickelten Variation« charakteristisch aus. Besonders im zweiten Satz, dem Andante, kann man dies am pastoralen Hauptthema in den Klarinetten verfolgen. Es wirkt fast kammermusikalisch, was ihn, wie auch am Schluss der Sinfonie, wieder von Beethoven abgrenzt. Anstelle des Scherzos im dritten Satz tritt nun bei Brahms ein Poco allegretto. Besonders markant für den Hörer sind die »Seufzer«-Passagen, die in ihrem Schwelgen an Tschaikowski erinnern. Es schließt sich der letzte Satz, ein Konglomerat der bisherigen Themen, an. Am Anfang erinnert es wieder an den stolzen Beethoven, wird dann aber mit den Synthesen der vorangegangenen Sätze zusammengeführt. Nach etwa zwei Minuten taucht das Lieblingsmotiv des Publikums auf, weshalb sich diese Sinfonie einer großen Beliebtheit erfreut. Oder vielleicht doch eher wegen der Erinnerungen an die 5. Sinfonie Beethovens, die auch für den Hörer erkennbar wiederkehren. Jedoch hat sich Brahms im Gegensatz zu seinem großen Vorbild noch eine Satzformverschiebung herausgenommen. Eine überdimensionale Coda lässt das Werk nicht enden. Die Themen werden noch einmal variiert, welches den Anschein einer zweiten Durchführung erweckt. Danach erlischt die Sinfonie, ohne großes Pathos. Jessica Brömel, M.A 5