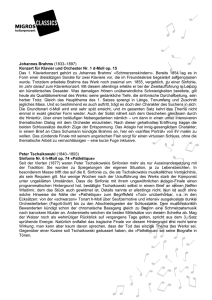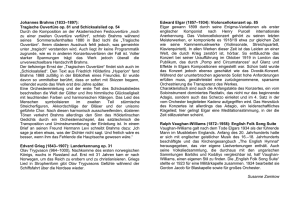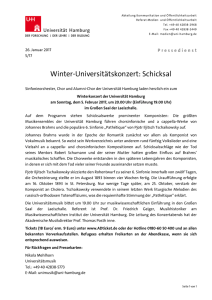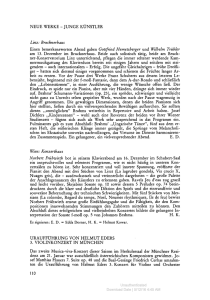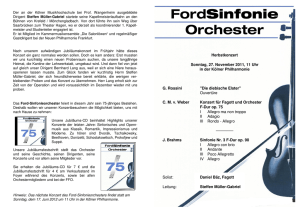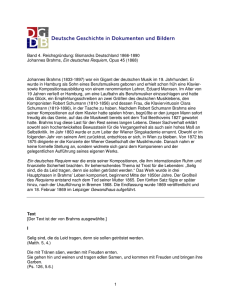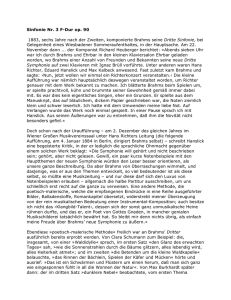93.134 Beiheft-Text als
Werbung

Sinfonie Nr. 1 c-moll op. 68 Der von Beethoven begründete sinfonische Anspruch, der Schubert bereits zur Last geworden war, ihn freilich auch zu sich selber finden ließ, bedrückte Brahms wahrlich nicht weniger. Die Umstände sind bekannt: Der erste Plan zu einer Sinfonie wurde 1854 gefasst, als eine Sonate für zwei Klaviere vorlag, mit deren Gestalt Brahms nicht zufrieden war; die Umwandlung zur Sinfonie misslang; beim dritten Versuch prägte sich das Material zum d-moll-Klavierkonzert aus. Kein Wunder, dass der zweite Anlauf dann erst recht Zeit in Anspruch nahm: Der 1855 begonnene erste Sinfonie- Satz war, noch ohne den Sostenuto- Anfang, nicht vor 1862 vollendet; zur endgültigen Ausarbeitung des ganzen Werkes aber kam es erst in den Jahren 1874 bis 76. Die Uraufführung der 1. Sinfonie fand am 4. November 1876 in Karlsruhe statt, Dirigent war Otto Dessoff. Nun war Brahms, wie der Dirigent Carl Schuricht es formulierte, »trotz der Fülle des Geschaffenen weder Viel- noch Schnellschreiber – kein Werk ging in den Druck, das er zuvor nicht hätte lange ausreifen lassen«. Die so erreichte Genauigkeit und Konzentration konnte schließlich der Neuen Musik (neben anderem) beispielhaft werden. Arnold Schönberg (1931): »Von Brahms habe ich gelernt: 1. Vieles von dem, was mir durch Mozart unbewusst zugeflogen war, insbesondere Ungradtaktigkeit, Erweiterung und Verkürzung der Phrasen. 2. Plastik der Gestaltung: nicht sparen, nicht knausern, wenn die Deutlichkeit größeren Raum verlangt; jede Gestalt zu Ende ausführen. 3. Systematik des Satzbildes. 4. Ökonomie und dennoch: Reichtum.« Das lang umsorgte erste Ergebnis der Brahmschen Beschäftigung mit der Sinfonie jedenfalls hat, wie Eduard Hanslick in seiner Besprechung rühmte, zu einem »so ernsten, komplizierten, von gewöhnlichen Effekten so weit absehenden Werk« geführt, dass ein »schnelles Verständnis nicht gleich« zu erwarten war. »Grillparzers Bekenntnis: ›Ich wollte allerdings Effekt machen, aber nicht auf das Publikum, sondern auf mich selbst‹ könnte als Wahlspruch auf der [1.] Sinfonie von Brahms stehen. Sie gehört, das leuchtet sofort auch dem Laien ein, zu den eigentümlichsten und großartigsten Werken der Sinfonieliteratur.« Brahms habe sich, schreibt Hanslick weiter, »in den ihm von Haus aus verwandten Vorstellungskreis des späteren Beethoven ganz hineingelebt; er ahmt nicht nach, aber was er aus seinem Innern schöpft, ist ähnlich empfunden. So erinnert denn Brahms in dem eigentümlich geistigen oder übersinnlichen Ausdruck und durch die schöne Länge seiner Melodien, durch die Kühnheit und Originalität der Modulation, durch die polyphone Gestaltungskraft, vor allem durch den männlichen hohen Ernst des Ganzen an Beethovens sinfonischen Stil. Man hat als einen Hauptcharakterzug das ethische Element in Beethovens Musik hervorgehoben, welche stets überzeugen, nicht erfreuen will. Dies sondert sie so auffallend von aller ›Unterhaltungsmusik‹, womit wir noch keineswegs etwas künstlerisch Wertloses bezeichnen wollen. Diesen strengen, ethischen Charakter von Beethovens Musik, welche selbst im Frohsinn und Mutwillen einen ernsten Geist, eine dem Ewigen zugewandte Seele verrät, finden wir sehr entscheidend auch in Brahms.« Nachdem das Werk bald zum Gegenstand der Konzertführer geworden war, wurde besonders gern und ausgiebig auf das ins Ohr fallende Hornthema in der Final-Einleitung verwiesen. Der BrahmsBiograph Max Kalbeck apostrophierte es als »eine starke Stimme, eine ›Stimme des Herrn‹« und führte aus: »und man wüsste nicht, von wannen sie käme, wenn nicht aus der Tiefe einer heiligen Kraft des Herzens, das sich selbst überwunden und seinen verlorenen Gott in dich wiedergefunden hat. Fromme Gemüter mögen ihr immerhin die Worte unterlegen: ›Fürchte dich nicht, spricht der Herr, sei getrost, ich bin bei dir!‹« Einst aber, am 12. September 1868, hatte das Thema zum Geburtstagsgruß an Clara Schumann gedient: »Also blus das Alphorn heut«, hatte Brahms per Postkarte mitgeteilt, die Tempoangabe Adagio darüber gesetzt und die Worte unterlegt: »Hoch aufm Berg, tief im Thal grüß ich dich viel tausendmal!« Tragische Ouvertüre d-moll op. 81 Im Jahre 1879 wurde Brahms, dem Hamburger in Wien, von der Universität Breslau die Ehrendoktor-Würde verliehen. Für die Promotionsfeier komponierte der Ausgezeichnete ein Vorspiel, das er bald, ohne mit dem Titel zufrieden zu sein, Akademische Festouvertüre nannte. Kaum fertig mit dem Stück, konnte er am 28. August 1880 aus Ischl, seinem oberösterreichischen Sommerquartier, Theodor Billroth melden: »Die Akademische hat mich noch zu einer zweiten Ouvertüre verführt, die ich nur eine ›Dramatische‹ zu nennen weiß – was mir wieder nicht gefällt. Früher gefiel mir bloß meine Musik nicht, jetzt auch der Titel nicht, das ist am Ende Eitelkeit – ?« In mehreren Briefen dann finden sich Umschreibungen der beiden Ouvertüren (eine »recht lustige« und eine »recht tragische«; »die eine weint, die andre lacht«), an die sich, ohne dass damit die Entscheidung aus der Hand gegeben wäre, die Mitteilung samt Frage knüpft: »für beide suche ich übrigens eigentlich noch hübschere Titel, fällt Ihnen was ein?« Jedenfalls: beide, »die zueinander in einer ähnlichen Beziehung stehen wie die erste und zweite Sinfonie«, so Florence May, die englische Clara Schumann-Schülerin und BrahmsBiographin (1905), »bieten wieder ein Beispiel für des Komponisten Gewohnheit, von Zeit zu Zeit schnell nacheinander oder selbst gleichzeitig zwei Werke in derselben Form zu schreiben, die von entgegen gesetzten subjektiven Eigenschaften beseelt werden.« Nachdem die Tragische Ouvertüre am 26. Dezember 1880 in einem Wiener Philharmoniker- Konzert von Hans Richter und danach wiederholt vom Komponisten selbst dirigiert worden war, schrieb Hermann Deiters: »In diesem Werk sehen wir den kraftvollen Helden mit einem ehernen, unerbittlichen Schicksal ringen und kämpfend erliegen; vorübergehende Siegeshoffnung kann das verhängte Geschick nicht aufhalten. Wir haben nicht das Bedürfnis, ob und welche Tragödie der Komponist vielleicht im Sinne hatte, zu erfahren; wen das unübertrefflich gewaltige Thema nicht überzeugt, dem wird auch weiteres Grübeln nichts helfen. « Wiewohl es nicht schwer wäre, sich den folgenden Sachverhalt zu vergegenwärtigen: Brahms hat, so heißt es, bei der Komposition Skizzen verwendet, die mehr als zehn Jahre zuvor in Zusammenhang mit einer Inszenierung des Goethe’schen »Faust« zu Papier gebracht worden waren. Paul Fiebig