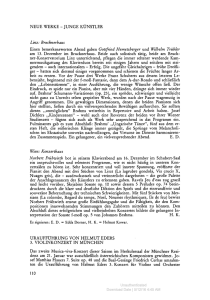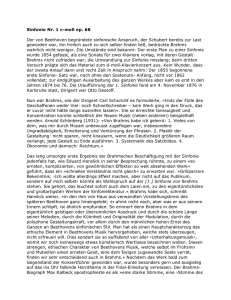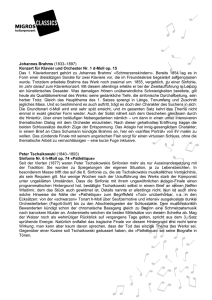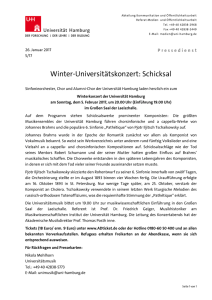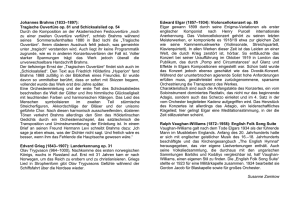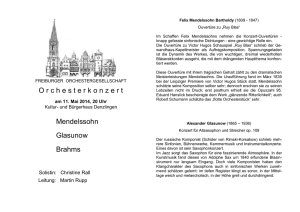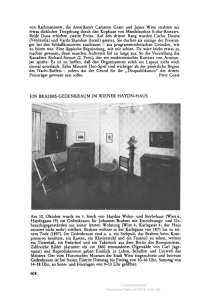Sinfonie Nr. 3 F-Dur op. 90 1883, sechs Jahre nach der Zweiten
Werbung

Sinfonie Nr. 3 F-Dur op. 90 1883, sechs Jahre nach der Zweiten, komponierte Brahms seine Dritte Sinfonie, bei Gelegenheit eines Wiesbadener Sommeraufenthaltes, in der Hauptsache. Am 22. November dann ... der Komponist Richard Heuberger berichtet: »Abends sieben Uhr war ich durch Brahms und Ehrbar in den kleinen Klaviersalon Ehrbar geladen worden, wo Brahms einer Anzahl von Freunden und Bekannten seine neue Dritte Symphonie auf zwei Klavieren mit Ignaz Brüll vorführte. Unter anderen waren Hans Richter, Eduard Hanslick und Max Kalbeck anwesend. Fast zuletzt kam Brahms und sagte: ›Nun, jetzt wollen wir einmal ein Richterkonzert veranstalten.‹ Die kleine Aufführung war nämlich hauptsächlich deswegen veranstaltet worden, um Richter genauer mit dem Werk bekannt zu machen. Ich blätterte Brahms beim Spielen um, er spielte prachtvoll, kühn und brummte seiner Gewohnheit gemäß immer dabei mit. Es war dies kein eigentliches Singen, eher ein Grunzen. Er spielte aus dem Manuskript, das auf bläulichem, dickem Papier geschrieben war, die Noten ziemlich klein und schwer leserlich. Ich hatte mit dem Umwenden meine liebe Not. Auf Verlangen wurde das Werk noch einmal gespielt. In einer Pause sprach ich mit Hanslick. Aus seinen Äußerungen war zu entnehmen, daß ihm die Novität nicht besonders gefiel.« Doch schon nach der Uraufführung – am 2. Dezember des gleichen Jahres im Wiener Großen Musikvereinssaal unter Hans Richters Leitung (die folgende Aufführung, am 4. Januar 1884 in Berlin, dirigiert Brahms selbst) – schreibt Hanslick eine begeisterte Kritik, in der er lediglich die sprachliche Ohnmacht gegenüber einem solchen Werk beklagt: »Die Symphonie will gehört und nicht beschrieben sein; gehört, aber nicht gelesen. Gewiß, ein paar kurze Notenbeispiele mit den Hauptthemen der neuen Symphonie würden den Leser besser orientieren, als unsere ganze Beschreibung. Da aber Brahms von Überraschungen wimmelt, und dasjenige, was er aus den Themen entwickelt, so viel bedeutender ist als diese selbst, so müßte eine Musikzeitung – und nur diese darf sich den Luxus von Notenbeispielen erlauben – allgemach die halbe Partitur ausschreiben, um uns schließlich erst recht auf die ganze zu verweisen. Eine andere Methode, die poetisch-malerische, welche die empfangenen Eindrücke in eine Reihe ausgeführter Bilder, Balladenstoffe, Romankapitel übersetzt, widerstrebt meiner Überzeugung von der rein musikalischen Bedeutung einer Instrumental-Komposition; auch besitze ich nicht das ›Klangbild-Talent‹, dessen sich der sonst ganz unmusikalische Heine rühmen durfte, und das er, ein Poet von Gottes Gnaden, in mancher genialen Musikschilderei tatsächlich bewährt hat. So bleibt mir denn nichts übrig, als einfach meine Freude über Brahms’ neue Symphonie zu äußern.« Ebendiese »poetisch-malerische Methode« freilich war an Brahms’ Dritter ausführlich bereits erprobt worden. Von Clara Schumann zum Beispiel: die, insgesamt, von einer »Waldidylle« sprach, im ersten Satz »den Glanz des erwachten Tages« sah, »wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume glitzern, alles lebendig wird, alles Heiterkeit atmet«; und im zweiten »die Betenden um die kleine Waldkapelle« belauschte, »das Rinnen der Bächlein, Spielen der Käfer und Mücken« hörte und ausrief: »Das ist ein Schwärmen und Flüstern um einen herum, daß man sich ganz wie eingesponnen fühlt in all die Wonnen der Natur«. Von Max Burkhardt später dann: der im dritten Satz »dunklere Nebel« beobachtete, vom ersten Thema »wehmütig an vergangene gute alte Zeiten« sich erinnert fühlte, im As-DurMittelteil Vorboten kommenden »Unheils« vernahm: »die Holzbläser scheinen mit zaghaftem Bitten das Unheil abhalten zu wollen«. Von Joseph Joachim auch: den im Finale die Hero-und-Leander-Geschichte anwandelte – »ungewollt kommt mir beim Gedanken an das zweite Thema in C-Dur der kühne Schwimmer, gehoben die Brust von den Wellen und der mächtigen Leidenschaft, vors Auge, rüstig, heldenhaft ausholend, zum Ziel, zum Ziel, trotz der Elemente, und immer anstürmen! Armer Sterblicher – aber wie schön und versöhnend die Apotheose, die Erlösung im Untergange!« »Man kann sich«, hat Brahms-Freund Theodor Billroth resümiert, »ein Bild, eine Statue, eine Landschaft wohl vor dem inneren Auge erscheinen lassen, doch der ruhende Zustand dieser Bilder kann für mich nie den Reiz haben wie Bewegungen von Tonformen mit ihren Verschlingungen in-, über- und hintereinander, der rascheren und langsameren Bewegung in rhythmischer Gliederung.« Womit der Angelegenheit das letzte Wort gesprochen wäre? Sinfonie Nr. 4 e-moll op. 98 Seine Vierte Sinfonie hat Brahms in den Sommermonaten 1884 und 85 in der Steiermark (in Mürzzuschlag) komponiert. Anfang September 1885 meldete er an Hans von Bülow: »Leider ist es mit dem Klavierkonzert, das ich gern geschrieben hätte, nichts Rechtes geworden. Ich weiß nicht, sind die beiden vorigen zu gut oder zu schlecht, aber sie sind mir hinderlich. Ein paar Entr’actes aber liegen da – was man so zusammen gewöhnlich eine Symphonie nennt. Unterwegs auf den Konzertfahrten mit den Meiningern habe ich mir oft mit Vergnügen ausgemalt, wie ich sie bei Euch hübsch und behaglich probierte, und das tue ich auch heute noch.« Vorgeführt hat Brahms sein neues Werk zunächst einmal im Wiener Freundeskreis, auf zwei Klavieren. Heftige Kritik war die Folge: der erste Satz wäre »unverständlich«, der dritte »unbedeutend« schon im Hinblick auf seine Melodik, das Passacaglia-Finale für eine Sinfonie ganz und gar »unpassend«. – Den dritten Satz, dahingehend resümiert Max Kalbeck die Brahms’sche Reaktion auf die Einwände, »wollte er nicht verteidigen, denn über den Wert von Melodien wäre nicht zu streiten. Das Finale wollte er mit dem Hinweis auf das Finale der Eroica rechtfertigen, ohne den Gehalt und Wert beider Sätze in Vergleich zu ziehen, rein in formaler Hinsicht. Beethoven habe in seinen Sonaten und Symphonien sich nicht geniert, mit Variationen abzuschließen.« Bald darauf ging es an die Vorbereitung der Orchesterproben mit der Meininger Hofkapelle, von deren erster, am 22. Oktober 1885, Bülow an seinen Berliner Konzertagenten Hermann Wolff sogleich berichtete: »Nr. 4 riesig, ganz eigenartig, ganz neu, eherne Individualität. Atmet beispiellose Energie von A bis Z.« Die vom Komponisten selber geleitete Uraufführung drei Tage später wurde ein voller Erfolg. Nun hatten wieder die Kritiker das Wort. Die beiden Hauptexponenten im Parteienstreit, Hugo Wolf und Eduard Hanslick, urteilten diesmal besonders eindeutig; Hugo Wolf: »Auffallend ist der Krebsgang in dem Produzieren Brahms’. Zwar hat sich dasselbe nie über das Niveau des Mittelmäßigen aufschwingen können; aber solche Nichtigkeit, Hohlheit und Duckmäuserei, wie sie in der emoll- Symphonie herrscht, ist noch in keinem Werke von Brahms in so beängstigender Weise an das Tageslicht getreten. Die Kunst, ohne Einfälle zu komponieren, hat entschieden in Brahms ihren würdigsten Vertreter gefunden. Ganz wie der liebe Gott versteht auch Herr Brahms sich auf das Kunststück, aus nichts etwas zu machen.« Dagegen Eduard Hanslick: »In der Energie echt symphonischer Erfindung, in der souveränen Beherrschung aller Geheimnisse der Kontrapunktik, der Harmonie und Instrumentation, in der Logik der Entwicklung bei schönster Freiheit der Phantasie steht Brahms ganz einzig da. Diese Vorzüge finden wir in seiner Vierten Symphonie wieder; ja sie scheinen – zwar nicht in der melodischen Erfindung, doch jedenfalls in der Kunst der Ausführung – noch höher emporgewachsen.« Ganz so gegensätzlich, wie die beiden Kritiken sich ausnehmen, sind sie nicht. Hugo Wolfs boshafte Einschätzung »die Kunst, ohne Einfälle zu komponieren« und Eduard Hanslicks gewissenhafte Einschränkung »zwar nicht in der melodischen Erfindung, doch jedenfalls in der Kunst der Ausarbeitung « unterscheiden sich im Blickwinkel, nicht der Beobachtung nach. Arnold Schönberg (der einst angetreten war, das Brahmsische mit dem Wagnerischen in seiner Musik zu versöhnen, mindestens zu verbinden): Es komme nicht »auf ein paar Noten« an, sondern auf »die musikalischen Schicksale dieser Noten«...