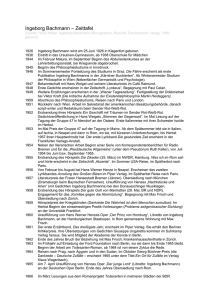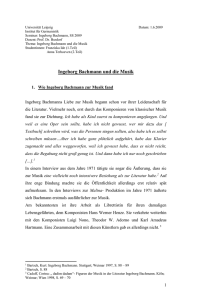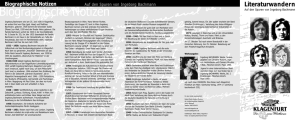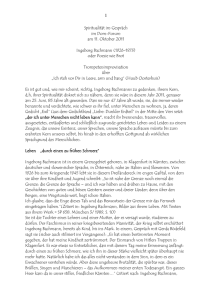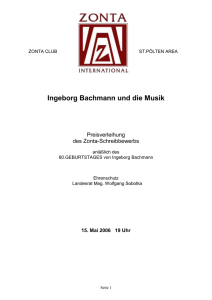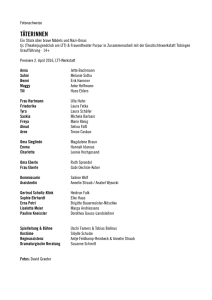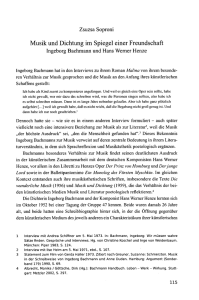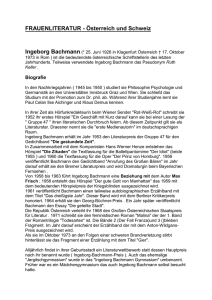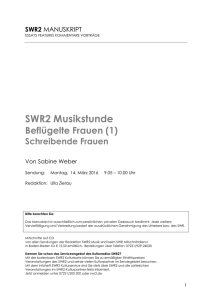INGEBORG BACHMANN ODER IST DIE ZUKUNFT WIRKLICH WEIBLICH
Werbung
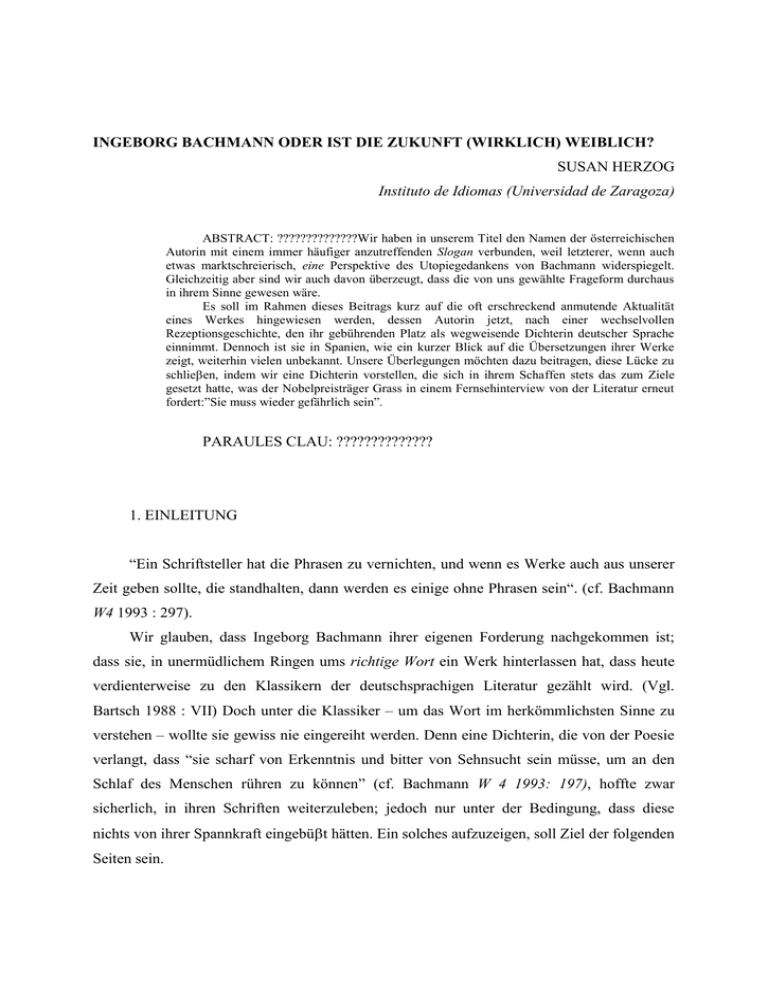
INGEBORG BACHMANN ODER IST DIE ZUKUNFT (WIRKLICH) WEIBLICH? SUSAN HERZOG Instituto de Idiomas (Universidad de Zaragoza) ABSTRACT: ??????????????Wir haben in unserem Titel den Namen der österreichischen Autorin mit einem immer häufiger anzutreffenden Slogan verbunden, weil letzterer, wenn auch etwas marktschreierisch, eine Perspektive des Utopiegedankens von Bachmann widerspiegelt. Gleichzeitig aber sind wir auch davon überzeugt, dass die von uns gewählte Frageform durchaus in ihrem Sinne gewesen wäre. Es soll im Rahmen dieses Beitrags kurz auf die oft erschreckend anmutende Aktualität eines Werkes hingewiesen werden, dessen Autorin jetzt, nach einer wechselvollen Rezeptionsgeschichte, den ihr gebührenden Platz als wegweisende Dichterin deutscher Sprache einnimmt. Dennoch ist sie in Spanien, wie ein kurzer Blick auf die Übersetzungen ihrer Werke zeigt, weiterhin vielen unbekannt. Unsere Überlegungen möchten dazu beitragen, diese Lücke zu schlieen, indem wir eine Dichterin vorstellen, die sich in ihrem Schaffen stets das zum Ziele gesetzt hatte, was der Nobelpreisträger Grass in einem Fernsehinterview von der Literatur erneut fordert:”Sie muss wieder gefährlich sein”. PARAULES CLAU: ?????????????? 1. EINLEITUNG “Ein Schriftsteller hat die Phrasen zu vernichten, und wenn es Werke auch aus unserer Zeit geben sollte, die standhalten, dann werden es einige ohne Phrasen sein“. (cf. Bachmann W4 1993 : 297). Wir glauben, dass Ingeborg Bachmann ihrer eigenen Forderung nachgekommen ist; dass sie, in unermüdlichem Ringen ums richtige Wort ein Werk hinterlassen hat, dass heute verdienterweise zu den Klassikern der deutschsprachigen Literatur gezählt wird. (Vgl. Bartsch 1988 : VII) Doch unter die Klassiker – um das Wort im herkömmlichsten Sinne zu verstehen – wollte sie gewiss nie eingereiht werden. Denn eine Dichterin, die von der Poesie verlangt, dass “sie scharf von Erkenntnis und bitter von Sehnsucht sein müsse, um an den Schlaf des Menschen rühren zu können” (cf. Bachmann W 4 1993: 197), hoffte zwar sicherlich, in ihren Schriften weiterzuleben; jedoch nur unter der Bedingung, dass diese nichts von ihrer Spannkraft eingebüt hätten. Ein solches aufzuzeigen, soll Ziel der folgenden Seiten sein. 2. INGEBORG BACHMANN IN SPANIEN Doch wer ist Ingeborg Bachmann überhaupt? Diese rhetorische Frage will nicht polemisieren, sondern ganz realistisch eine Problemkonstante der Auslandgermanistik aufzeigen, welche oft übersehen wird. Ein kurzer Blick auf die Rezeptionsgeschichte genügt, um festzustellen, dass das Werk der österreichischen Dichterin in Spanien, im Gegensatz zu Nachbarländern wie Italien oder Frankreich, praktisch unbekannt ist. Ein Teil ihrer Prosa – Das dreiigste Jahr (A los treinta años), Malina (Malina), Simultan (Tres senderos al lago) und die theoretischen Uberlegungen ihrer Frankfurter Vorlesungen (Problemas de la literatura contemporánea, conferencias de Francfort) - sind zwar auf Spanisch übersetzt und ein- oder sogar zweimal verlegt worden, heute aber vergriffen. Nur die Lyrik macht hier ein Ausnahme (1). Wenn wir dem Thema der Werkübersetzungen besondere Aufmerksamkeit widmen, so nicht in erster Linie deshalb, weil Studenten, die sich mit der deutschsprachigen Literatur auseinandersetzen, auch Zugang zu spanischen Versionen haben sollten – eine Frage übrigens, die eine eigene Diskussion verdiente. Viel bedeutungsvoller scheint uns jedoch der Umstand, dass eine Lektüre, wenn sie praktisch in “luftleerem Raum” stattfindet, weil der zu lesende Autor im eigenen Land eine unbekannte Gröe ist, zu einem elitären, historisierenden und letztlich sterilen Prozess wird. Ein solcher Fossilisierungskult aber kann zu Langeweile, Missverständnissen oder gar Abneigung führen. Vielleicht – Utopiedenken sollte nie ganz ausgeklammert werden – würden von Verlegerseite her Neuausgaben ins Auge gefasst, wenn der Name Bachmann wieder häufiger auf Tagungen oder Kongressen ausgesprochen würde? 3. LEBEN UND WERK 3.1. Frühe Jahre Das Werk von Ingeborg Bachmann erlebt zwar momentan eine Glanzzeit in den duetschsprachigen Ländern, doch wie es das Schicksal so vieler anderer, wegweisender Autoren war, ist auch sie erst nach ihrem Tode richtig gewürdigt worden und selbst dieser Verstehensprozess vollzog sich schubweise, über mehrer Jahrzehnte hin. Das mag sicherlich daran liegen, dass sie, wie man so schön sagt, ihrer Zeit voraus war - eine Problematik, der sich seit Urzeiten unzählige Künstler ausgesetzt sehen. Ärgerlicher aber ist es, in dieser Vita feststellen zu müssen, wie viele Fehlinterpretationen oder Frivolitäten als absolut überflüssige, zusätzliche Belastung durch ein im wesentliche männliches Kritikerkontigent verursacht worden sind. Klaus Amman zeigt dies in seinem 1997 erschienen Buch, Ingeborg Bachmann und die literarische Öfffentlichkeit mit einer Deutlichkeit auf, welche durch ihre rigurose Objektivität nur umso brutaler wirkt. Zu Beginn ihrer Karriere jedoch scheint die Lehrerstochter aus Kärnten, wie sie von Hermann Hakel, einem ihrer Mentoren, genannt wird, vom Glück begünstigt: Sie trägt im Jahre 1953 auf der Tagung der Gruppe 47 im Mainz einige Gedichte vor, wird zur Preisträgerin erkoren und schlagartig berühmt. Doch dieser frühe Erfolg sollte sich im folgenden eher als Hemmschuh, denn als Wegbereiter erweisen. Als die junge Lyrikerin einige Jahre später den Prosaband Das dreiigste Jahr vorlegt, äuern sich die meisten Reszensenten sehr distanziert. Die Kritik wollte die Autorin durchaus nicht aus dem Ghetto der Lyrik entlassen, deren zeitlose Schönheit sie betörte.Heute erstaunt den unvoreingenommenen Leser diese ästhetisch-naive Sehweise, wenn er sich der Brisanz von Bachmanns lyrischen Texten gegenübersieht. Sprachliche Vollkommenheit ja, aber im Dienste einer stets wiederkehrenden Denunzierung von Gewalt, Krieg, Gewissenslosigkeit. und fehlender Vergangenheitsbewältigung. Dieses sich hartnäckig behauptende, verklärte Image der Poetessa (um die von Max Frisch popularisierte Bezeichnung zu verwenden) wurde noch in entscheidendnder Weise von der Titelstory untermauert, welche der Spiegel im Jahr 1954 (Nr. 34) publizerte. Hier wird die Dichterin ihren Lesern folgendermassen vorgestellt: “viel blondes Haar, sanftbraune Augen, still und scheu in Ausdruck und Rede und ‘philosophisch vorbelastet’” (Amann 1997: 33). Die erwähnte, philosophische Vorbelastung, ein Hinweis auf die Tatsache, dass Bachmann über Heidegger promoviert hatte, ist mehr als eine paternalistische Note. Sie zeigt ein erstes Unbehagen darüber, dass sich die Schriftstellerin nicht nahtlos in die “charkteristische Verschränkung von Geschlechterrolle und Gattungsrolle der Lyrik” (cf. Amann 1997: 33) einordnen lässt. Auch ihr Auftreten auf weiteren Tagungen der Gruppe 47 bringt Unstimmigkeiten im Bachmann-Bild zu Tage, wie aus verschiedenen Reminiszenzen hervorgeht. Zum einen sah man sich einer Dichterin gegenüber, die mit schwacher, oft brechender Stimme ihr Lyrik vortrug, und bei der ersten Lesung gar ohnmächtig wurde, zum anderen erahnte man anscheinend doch schnell den kompromisslosen Willen hinter der zerbrechlichen Fassade. Nicht anders ist es zu erklären, dass Ilse Aichinger, die im Jahre 1952 mit dem Preis der Gruppe 47 ausgezeichnet worden war, den nicht besonders originellen Spitznamen Fräulein Kafka erhielt, während sich Heinrich von Doderer auf unsere Autorin kurz als der Bachmann bezog . Diese Anekdoten sind mehr als ein Jammerlied über die ach so oft missverstandenen schreibenden Frauen. Sie zeigen nicht nur Irrungen und Wirrungen in den Interpretierungsversuchen eines Leserpublikums, sondern reflektieren gleichzeitig, und dies ist, wie wir im weiteren sehen werden, von weit gröerer Bedeutung, die Etappen eines Selbstfindungsprozesses von seiten der Dichterin. Vorerst jedoch macht Ingeborg Bachmann Schluss mit der Lyrik – ein Entschluss, den sie in unmissverständlicherweise im letzten Gedicht Delikatessen ausdrückt, das mit der klaren Absage:”Mein Teil, es soll verloren gehen” (cf. Bachmann W 1 1993: 173) endet. 3.2. Das Prosawerk Diese Haltung sollte sie teuer zu stehen kommen. Wenn man den von Christine Koschel und Inge von Weidenbaum herausgegebenen Band von aufgezeichneten Gesprächen und Interviews mit Ingeborg Bachmann durchblättert, fällt sofort auf, mit wlcher Zähigkeit ihre Gesprächspartner noch bis kurz vor Bachmanns Tod auf dem Thema der Lyrik beharren. Vor diesem Hintergrund ist es nicht weiter erstaunlich, dass der bereits erwähnte erste Prosaband von Kurzgeschichten Das dreiigste Jahr zwar mit Interesse gelesen wurde, sich aber sofort Stimmen vernehmen lieen, die “ihr väterlich gütig stilistische Entgleisungen diagnostizierten, welche die inzwischen berühmte Dichterin als typische Anfängerin zeigten”. (Amann 1997 : 35) Ein neues Etikett wurde gesucht und gefunden: das der lyrischen Prosa (was immer auch unter diesem Begriff zu verstehen sei). Wenn wir das Umfeld betrachten, in dem Ingeborg Bachmann schrieb – wir befinden uns Ende der fünfziger Jahre, knapp der Nullstunde und dem Kahlschlag entronnen, wo Heinrich Böll, Günter Grass oder Uwe Johnson “epische Realpolitik” betreiben und die “vorhandene Gesellschaft erzählerisch erforschen” (cf. Amann 1997: 34), so ist diese Katalogisierung unter lyrische Prosa ganz eindeutig mit einem negativen Vorzeichen versehen. Im Klartext also: Schuster, bleib bei deinem Leisten!. Darüber wurde, wie meistens, vieles übersehen. Zum Beispiel die Tatsache, dass Bachmann, die praktisch seit ihrer allerfrühsten Jugend ebenso viel schrieb, wie sie las, seit jeher Lyrik und Prosa verfasste. Ihre ersten Publikationen waren Kurzgeschichten, und ihren Lebensunterhalt bestritt sie, die schon mit 27 Jahren den kühnen Entschluss gefasst hatte, als freie Schriftstellerin zu leben, mit einer breitgefächerten Produktion an Hörspielen, Libretti, Buchkritiken, Essays und Artikeln jeder Art. Sowie die groe Lyrikerin also weit mehr tat, als weltfremd in ihrem elfenbeinernen Turm zu ästhetisieren, so hatte sie sich auch schon seit Beginn ihrer Schaffenszeit in überzeugender Weise mit anderen Gattungen auseinandergesetzt – ihre Hörspiele, die mit groem Erfolg gesendet wurden, sind ein guter Beweis dafür. Bachmanns eigene Meinung zur Gattungsfrage klingt denn auch überraschend einfach und überzeugend: Manchmal will ich eine Kurzgeschichte schreiben oder ein Hörspiel machen, und plötzlich merke ich, da etwas anderes daraus wird. So bin ich auch einmal zu einem “Drehbuch” gekommen, so fand ich auch zu meinem ersten Roman. Es ist, als würde sich alles in einem Kreis abspielen [...] Die Möglichkeiten müssen nur erfat und richtig bearbeitet werden” (cf. Bachmann 1994: 58). Warum also “dieser Einteilungswahn”, der, wie die Schriftstellerin in einem Interview sagt, “macht, da man ein Hauptfach zugewiesen bekommt, in meinem Fall die Lyrik, und dann womöglich noch Prosa als Wahlfach [...]”? (cf. Bachmann 1994: 41) Zugegeben, Bachmann machte es sich und anderen nicht leicht. Während viele Autoren mühelos “mit den stilistischen Eroberungen anderer operieren” (cf. Bachmann 1994: 48), hinterfragt sie eigene und fremde Texte mit gleicher Intensität und Strenge auf Inhalt und Form, was aus ihrer Perspektive dann etwa heien : Wie ist der Schriftsteller seiner moralischen Verpflichtung, die er als Autor eingegangen ist, nachgekommen? Oder: Entspricht die von ihm gewählte Sprache auch diesen Anforderungen?. Der unaufhörliche Neuschreibungsprozess, der aus dem Nachlass von Ingeborg Bachmann zu ersehen ist, zeigt deutlich die Rigurosität dieses Vorgehens, das von Martin Walser als “fröstelnd machenden Vollkommenheitsanspruch” bezeichnet wird (cf. Stoll 1992: 17) Auf der Suche nach der angemessenen Form, Dinge zu sagen oder zu verschweigen, schafft sie in mühseliger Knochenarbeit ein Werk, das wohl zum komplexesten des 20. Jahrhundert gehört. Während die Diskussion, ob der Roman tot sei oder nicht, hohe Wellen schlägt, stellt sie trocken fest, dass man in diesem Falle “die Leiche eben wieder exhumieren müsse” (cf. Bachmann 1994: 78) und zieht sich gut zehn Jahre zurück, um an einem Romanzyklus zu schreiben.Von den entstandenen Werken hält sie nur eines für publikationswürdig, den im Jahre 1971 erscheinenden Roman Malina. Obwohl das Buch auf der Bestsellerliste steht, entfesselt sein Erscheinen einen Sturm indignierter Stimmen – “neuromantischer Sprachtüll” (cf. Kurt Batt, zitiert in Beicken 1992: 201) oder “selbstbeobachtete Notierung einer fortschreitenden Neurose” (Christian Gebert zitiert in Gürtler 1985: 112) sind einige der saftigsten Kommentare, die sie sich anhören muss. Wie bereits bei ihren Gedichtzyklen waren viele Kritiker in ihrer Lektüre an der Oberfläche haftengeblieben. Aber während die Lyrik, wie die Autorin in Delikatessen mit Bitterkeit feststellt “Aug und Ohr verköstigt / mit Worthappen erster Güte“ (cf. Bachmann W 1 1993: 173) und damit auch dem Leser Genuss bereitet, der am Text vorbeiliest, ist Prosa aus spröderem Stoff geschaffen und lässt nicht ungestraft so mit sich umgehen.. Bachmann wird nur noch einen Band Kurzgeschichten veröffentlichen: Simultan (den der berüchtigte Kritiker Marcel Reich-Ranicki als “zynisch angestrebte Trivialliteratur” (cf. Beicken 1992: 202) einstuft), bis sie im Jahre 1973 an den Folgen eines Brandunfalles stirbt. Damit aber kommt vorerst weder die gnädige Ruhe eines allgemeinen Vergessens, noch eine unvoreingenommenere Auseinandersetzung mit dem Werk der Dichterin. Die morbidfaszinierende Legende Bachmann wird in den Jahren nach ihrem Tod noch genüsslich weiter ausgeschlachtet, um dieses plastische Verb zu gebrauchen, mit dem eine ihrer Protagonistinnen auf sich selbst Bezug nimmt (vgl. Bachmann W 3 1993: 515) Ein entscheidender Wendepunkt kommt im Jahre 1978 mit dem Erscheinen der vierbändigen Werkausgabe, in der auch Fragmente aus dem Nachlass veröffentlicht werden. Langsam werden zähbeibehaltene Vereinfachungen zur Seite gelegt, und die BachmannForschung erhält neue Impulse durch die feministische Kulturkritik, sowie durch den Poststrukturalismus. In den neunziger Jahren schlielich finden wir eine Flut von Publikationen, die sich mit verschiedenen Aspekten ihres Werkes auseinandersetzen, wobei die Prosatexte immer mehr in den Vordergrund rücken. 4. EINE STUDIE IN GEWALT Wir hatten von der Aktualität dieses Werkes gesprochen und wollen aus dem überreichen Angebot, an dem sich diese Behauptung aufzeigen lässt, auf einen Themenkreis eingehen, der uns besonders repräsentativ erscheint und der mit Bachmanns lapidarer Feststellung “die Gesellschaft ist ein Mordschauplatz” (cf. Bachmann Werke 3 1993: 276) zusammengefasst werden kann.. Hierbei wird sich erweisen (zu einer eingehenden Analyse ist leider im Rahmen dieses Beitrags kein Platz) wie ausschlaggebend Bachmanns äuerst komplexe Art der Komposition – der Terminus ist nicht durch Zufall der Musik entliehen und wird von ihr selbst wiederholt verwendet – ihr Anliegen als Autorin unterstützt. Eine Erzähltechnik, die oft um ein Ich kreist, dessen Gespaltenheit eine Schriftstellergeneration vorwegnimmt. Wenn wir, auf knappestem Raum, eine globale Definition des Gesamtwerkes von Ingeborg Bachmann geben wollten, so könnten wir es als eine Studie in Gewalt bezeichnen. Eine Studie, die mit groer Genauigkeit dem Ursprung und den Erscheinungsformen von privater und öffentlicher Gewalt nachgeht. Wir erhalten von der Autorin präzise Angaben, zu welchem Zeitpunkt die Gewalt in ihr eigenes Leben getreten ist: ein erstes Mal in privater Form, als Ausdruck der kleinen Geschichte, wenn die Sechsjährige auf dem Heimweg von der Schule von einem etwas älteren Buben völlig unerwartet ins Gesicht geschlagen wird: “Die Worte sind nicht vergessen, auch nicht das Bubengesicht, der wichtige erste Anruf, nicht meine erste wilde Freude, das Stehenbleiben, Zögern, und auf dieser Brücke der erste Schritt auf den anderen zu, und gleich darauf das Klatschein einer harten Hand ins Gesicht:‘Da, du, jetzt hast du es!‘ Es war der erste Schlag in mein Gesicht und das erste Bewutsein von der tiefen Befriedigung eines anderen, zu schlagen. Die erste Erkenntis des Schmerzes. Mit den Händen an den Riemen der Schultasche und ohne zu weinen und mit gleichmäigen Schritten ist jemand, der einmal ich war, den Schulweg nach Hause getrottet, [...] zum erstenmal unter die Menschen gefallen“ (Bachmann Werke 4 1993 : 25). Doch es ist das zweite öffentliche, gewissermaen legitime Einbrechen der Gewalt, das der groen Geschichte, welches das definitve Ende der Kindheit zur Folge hat Es hat einen bestimmten Moment gegeben, der hat meine Kindheit zertrümmert. Der Einmarsch von Hitlers Truppen in Klagenfurt. Es war etwas so Entsetzliches, da mit diesem Tag meine Erinnerung anfängt. [...], diese ungeheure Brutalität, die spürbar war, dieses Brüllen, Singen und Marschieren – das Aufkommen der ersten Todesangst. Ein ganzes Heer kam da in unser stilles, friedliches Kärnten“ (cf. Bachmann 1994 : 111). Von nun an agiert dieses Leitmotiv, einem janusköpfigen Monster gleich, in allen Gattungsformen der Dichterin und wird von ihr in unaufhörlichem Verarbeitungsprozess aus den verschiedensten Perspektiven dargestellt, sozialhistorisch analysiert, psychoanalytisch hinterfragt und mit fast biblischer Ausdruckskraft imme wieder aufs Neue ausgedrückt. Während der eng mit der Sprache verknüpfte Utopiegedanken in den frühen Werken noch einen mildernden Ausgleich zu schaffen vermag, ist dieses prekäre Gleichgewicht mit dem Fortschreiten der Jahre immer schwerwiegenderen Störfaktoren unterworfen. Bereits frühste Kurzgeschichten wie Im Himmel und auf Erden stehen unter dem Zeichen der Gewalt. Die Protagonistin Amelie, welche von ihrem Geliebten manchmal nur so nebenbei geschlagen wird, begeht Selbstmord, nachdem sie von seinem Betrug erfahren hat:“Da stürzte die Einfalt aus ihren Augen und wechselte mit einem Abgrund des Wissens. [...] Sie lief, ohne etwas fragen zu müssen oder erfahren zu wollen, ans Fenster und sprang in den dunklen Hof, [...]“ (cf. Bachmann W 2 1993: 18). Auch den Gedichtzyklen wird Gewalt als treibender Motor eingeschrieben, wie wir einem Auszug des Gedichtes Früher Mittag entnehmen können: Wo Deutschlands Himmel die Erde schwärzt, sucht ein enthaupteter Engel ein Grab für seinen Ha, und reicht dir die Schüssel des Herzens. Eine Handvoll Schmerz verliert sich über den Hügel. Sieben Jahre später fällt es dir wieder ein, am Brunnen vor dem Tore, blick nicht zu tief hinein, die Augen gehen dir über. Sieben Jahre später, in einem Totenhaus, trinken die Henker von gestern den goldenen Becher aus. Die Augen täten dir sinken.“ (cf. Bachmann W 1 1993: 44). und in Hörspielen wie Der gute Gott von Manhattan kann die ruhige Ordnung der Gesellschaft, welche durch die absolute Liebe von Jennifer zu Jan in Gefahr geraten ist, nur durch einenGewaltakt aufrecht erhalten werden. “Vom Wesen der Gewalt, Gewalt verschleiert im Normalverhalten, Gewalt in den menschlichen Beziehungen, in der Sprache, in der Liebe handeln auch die Prosatexte in Das dreiigste Jahr [...]“ (cf. Beicken 1992: 165). In höchster Verdichtung aber findet sich dieses Thema im Todesartenzyklus – ein wahres Manuale der Gewalt und all ihrer Spielarten – welches sich aus den posthum veröffentlichten Fragmenten Der Fall Franza, Requiem für Fanny Goldmann und Aga Rottwitz, sowie dem bereits erwähnten Roman Malina zusammensetzt. Bachmann fragt sich in der Vorrede zum Fall Franza “wohin das Virus Verbrechen gegangen sei – es könne doch nicht vor zwanzig Jahren plötzlich aus unserer Welt verschwunden sein, blo weil hier Mord nicht mehr ausgezeichnet, verlangt, mit Orden bedacht und unterstützt werde“. (cf. Bachmann W 3 1993: 341) und sie behauptet weiter: [...] da noch heute sehr viele Menschen nicht sterben, sondern ermordet werden. [...] Die Verbrechen, die Geist verlangen, an unseren Geist rühren und weniger an unsere Sinne, also die uns am tiefsten berühren – dort fliet kein Blut, und das Gemetzel findet innerhalb des Erlaubten und der Sitten statt, innerhalb einer Gesellschaft, deren schwache Nerven vor den Bestialitäten erzittern“ (cf. Bachmann W 3 1993: 342). Die Gewalt, ein Erbe des Faschismus, wird jetzt privat weiterpraktiziert, bis wieder bessere Zeiten kommen. Ein Groteil der Opfer im Werke von Bachmann sind Frauen – wie die Protagonistinnen des Todesartenzyklus‘, die von ihren Männern als psychologische Fallstudie ausgebeutet und ihrer selbst beraubt oder als literarischer Stoff ausgeschlachtet werden. Doch die Autorin ist exakt: geistige und körperliche Gewalt (und von beidem findet sich übergenug in ihrem Werk) ist an kein Geschlecht gebunden. Gewalt von Mann zu Mann finden wir im Wien der Restuarantionszeit, wo sich die Fronten an den Biertisch verlegt haben, oder von Frau zu Frau in der Erzählung Sodoma und Gomorrah. Bachmanns Projekt war es, die unheilvolle Verstrickung von kleiner und groer Geschichte, die Verflechtung ihrer Machstrukturen anhand eines groen Roman-Zyklus‘ aufzuzeigen, dessen Ouvertüre das Werk Malina sein sollte und der als Schauplatz “das Haus Österreich und seine Gesellschaft – vom Kärtner Bauern von der Provinz bis zu den Intellektuellen“ (cf. Bachmann 1994: 127) gehabt hätte. Der frühe Tod der Dichterin machte dies zunichte. Genauere Studien ihres Nachlasses und Fragmentkontrastierungen geben aber Aufschluss über die Entwicklung dieses komplexen Projektes. Wie aus vielen Interviews hervorgeht, glaubte Bachmann nicht an eine Momentaufnahme der Geschichte. Sie unterstützte zwar Manifeste gegen nukleare Aufrüstung und den Vietnamkrieg, verstand aber ihr soziales und politisches Engagment als Schriftstellerin gerade nicht als einfache Denunzierung aktueller Missstände. Fur sie gibt es “in der Kunst keinen Frotschritt in der Horizontalen, sondern nur das immer neue Aufreien einer Vertikalen“. (cf. Bachmann W 4 1993: 194) Wie Rita Morrien in ihren Überlegungen zum Franza-Fragment feststellt: Gerade durch die Verknüpfung der persönlichen und der ‚groen‘ Geschichte wird ein Erkenntnisproze in Gang gesetzt, der weit über die individuelle Ebene hinausreicht. [...]Der im ‚Franza-Fragment‘ skizzierte Faschismus – verstanden als ‚Vernichtenwollen des Anderen‘ – ist ein Phänomen, das unabhängig von Ort und Zeit, sämtliche Bereiche des menschlichen Zusammenleben prägt. Bachmanns wichtige Leistung besteht darin, die Interdependenz von privaten und politischen, gegenwärtigen und historischen Verdrängungsstrategien transparent zu machen und die Notwendigkeit indiviueller wie kollektiver Erinnerungs- bezw. Ausgrabungsarbeiten aufzuzeigen“ (cf. Morrien 1996: 99). So wird der in Rom lebenden und schreibenden Autorin das von Elias Canetti als Kränkungsstadt bezeichnete Wien zum Modell, an dem sie im Kleinen aufzeigen kann, was überall Geltung hat. Hier hat sie die nötige Distanz und Freiheit, hier wird sie “nicht mundtot“ (cf. Bachmann 1994: 59) gemacht. Dieser Erinnerungsprozess, der gegen Verdrängungsstrategien ankämpft und für Protagonistinnen wie Franza oder das Ich aus Malina zur einzigen Überlebenschance wird, ist direkt an die Sprache geknüpft. Beide aber sehen sich einem progressiven Sprachzerfall ausgesetzt, der zu einem totalen Identitätsverlust führen muss. Franza wird durch ihren Mann, den Psychiater Jordan, der alle ihre Äuerungen registriert und analysiert, zur Fallstudie gemacht und ihrer eigenen Sprache beraubt. Die bis nachÄgypten führende Flucht macht einen schmerzvollen Erinnerungsprozess möglich, der eine Rückgewinnung von Sprach- und Ausdrucksvermögen erahnen lässt -, der körperliche Zerfall als direkte Auswirkung des vorangegangenen Sprachentzuges ist jedoch bereits zu weit fortgeschritten. In Malina wird das meiste der Ausgrabungsarbeiten an einer verdrängten Vergangenheit ins zentrale Traumkapitel verlegt. Das von einer zu Ende gehenden Liebesbeziehung gebrandmarkte, extrem verletzliche Ich sieht sich hier in einer rasanten Abfolge von Halluzinationen und Träumen einer übermächtigen Vaterfigur gegenüber, deren einziges Ziel es ist, die Protagonistin körperlich und geistig auszulöschen. Doch nicht nur als Schlächter oder Henker tritt ihr dieser gegenüber, sondern auch als Operndirektor, Filmregisseur oder Couturier. Die Tochter, die im wirklichen Leben als Schriftstellerin arbeitet, wird durch einen, in verschiedenen Perspektiven dargestellten Kunstbetrieb ausgebeutet, vergewaltigt und mundtot gemacht. Dieses Stilllegen greift auf jegliche Art von Artikulation über, so dass das weibliche Textbegehren sogar mit Hilfe seines ureigensten Handwerkzeuges, der Tinte, erstickt wird: [...] doch ehe er mir die Zunge ausreit, geschieht das Entsetzliche, ein blauer, riesiger Klecks fährt mir in den Mund, damit ich keinen Laut mehr hervorbringen kann. Mein Blau, mein herrliches Blau, in dem die Pfauen spazieren, und mein Blau der Fernen, mein blauer Zufall am Horizont“! (cf. Bachmann W 3 1993: 177). Auch in Malina zeichnet sich, als direkte Folge der Erinnerungsarbeit, eine zunehmende Widerstandskraft der Protagonistin ab, aber dieses Ich, dessen Gespaltenheit in der Gebundenheit an den männlichen Doppelgänger Malina zum Ausdruck kommt, verschwindet am Ende des Romans durch einen Spalt in der Wand. Der letzte Satz lautet:“Es war Mord“ (cf. Bachmann W 3 1993: 337). Im Zentrum des Romans ‚Malina‘ steht der Versuch, die ‚dunkle Geschichte‘ des namenlosen Ich zu rekonstruieren, wobei Widersprüche, Elipsen und die Einflechtung scheinbar unzusammenhängender Textbestandteile geradezu Strukturmerkmale dieses Erinnerungs- und Erzählobjektes sind. Stück für Stück wird ein Bild zusammengefügt, das jedoch bis zum Schlu kein heiles klares Antlitz ergibt, sondern eine rätselhafte Maske bleibt“ (cf. Morris 1996: 118). Diese Komposition in Form eines Kriminalromas, die wir häufig bei Bachmann finden, hat didaktisch-therapeutische Absichten: Alle diese Texte zeigen, dass etwas verschwiegen wird, “und leiten über die Erfahrung des ereignishaften Textes dazu an, der eigenen verschwiegenen Erfahrung näher zu kommen. Lesen wird vorgestellt als Einüben einer archäologischen Tätigkeit, die mit dem Lesenden kriminalistische Annäherung an die verdeckte Sprache, das kollektiv Verschwiegene, vollzieht“. (Bannasch 1997 : 112) Der souveräne Gebrauch der Intertextualität unterstützt diese Vorhaben, das zu einer fruchtbaren Auseinandersetzung von Lesendem und Autor werden soll. Im Aufrütteln dieses anonymen Du findet Bachmann am Ende ihrer Schaffenszeit noch die einzige Sinngebung, welche der schizophrenen Welt des Schriftstellers gegönnt ist: es (das Schreiben, A.d..A.)) ist eine seltsame, absonderliche Art zu existieren, asozial, einsam, verdammt, es ist etwas verdammt daran, und nur das Veröffentlichte, die Bücher, werden sozial, assozierter, finden einen Weg zu einem Du mit der verzeifelt gesuchten und manchmal gewonnenen Wirklichkeit“. (cf. Bachmann W 4 1993: 294). sagt die Autorin in ihrer letzten Dankesrede zur Verleihung des Anton-Wildgans-Preises. Und konsequent setzt sie ihr eigenes Verständnis von Sprache und Schrift in seiner Doppelfunktion von "aussagen und verschweigen müssen" gegen die “vergiftete Sprache des politischen Journalismus“ ab (Bannasch 1997 : 108), indem sie dessen Art von Wachrütteln, welche auf keiner eigenen Leidenserfahrung basiert, als letztlich unmoralisch definiert: Wach sind doch nur diejenigen, die es sich ohne euch vorstellen können“ sagt die Journalstin Elisabeth aus Drei Wege zum See zu einem bekannten Fotojournalisten.“Glaubst du, da du mir die zerstörten Dörfer und Leichen vorstellen mut, damit ich mir den Krieg vorstelle? [...] Und jemand, der es nicht wei, der blättert in euren gelungenen Bilderfolgen herum als Ästhet oder blo angeekelt, aber das dürfte wohl von der Qualität der Aufnahmen abhängen[...]“ (cf. Bachmann W 2 1993: 417). Und mit letzter Einsicht in die Gefahr, welche diese entfremdete Spache darstellt, formuliert Bachmann die tiefbesorgte Frage:“Ist es denn noch nie jemand in den Sinn gekommen, da man die Menschen umbringt, wenn man ihnen das Sprechen abnimmt, und damit das Erleben und Denken?“ (zitiert in Bannasch 1997: 105). 5. SCHLUSSFOLGERUNGEN Unser Anliegen war es, Leben und Werk einer Schriftstellerin in Erinnerung zu rufen, die es verdiente, auch in Spanien wieder einem breiteren Publikum zugänglich gemacht zu werden. Es schien uns wichtig, ihrer Biographie einen verhältnismäig groen Platz einzuräumen, um im Detail aufzeigen zu können, welche Fehlinterpretationen oder Manipulationen, sicher oft aus geschlechtspezifischen Gründen, dazu beigetragen haben, das Bild der Autorin zu verfálschen. Ein Prozess, der direkte Auswirkungen nicht nur auf das Leben, sondern auch auf das Werk der Autorin zur Folge hatte, und ihr Schaffen auf wesentliche Weise mitbestimmte. Auf unseren mehrdeutigen Titel bezugnehmend möchten wir der Hoffnung Ausdruck geben, dass die Zukunft den heutigen Schrifststellerinnen besser gesinnt sein möge, auf dass sich ihre künstlerische Entwicklung ungestört von solchem Beiwerk vollziehen könne. Innerhalb der komplexen Produktion von Ingeborg Bachmann hatten wir die Problemkonstante Gewalt herausgegegriffen, weil an ihr eine geradezu erschreckende Aktualität abzulesen ist. Die steigende Gewaltspirale im privaten und öffentlichen Bereich, der wir uns heute gegenübersehen, wurde von der Autorin schon sehr früh vorausgeahnt, und der Verdienst Bachmanns ist es, in hellsichtiger Weise Ursachen, Wechselwirkungen und Mechanismen dieses Phänomens analysiert zu haben – eine breitgefächerte Untersuchung, die weiterhin Gültigkeit hat. Ebenso ausschlaggebend ist in diesem Zusammenhang ihre Auseinandersetzung mit der Sprache, welche im Rahmen dieses Beitrags nur kurz erwähnt werden konnte. Sprachutopie verstanden als das Streben nach einer schönen und reinen Sprache (vgl. Bachmann W 4 1993: 268), eine Forderung, die natürlich in erster Linie an den Schriftsteller gestellt wird, in scharfem Kontrast zur Gaunersprache (cf. Bachmann W 1993: 112) der wir im Alltagsleben ausgesetzt sind, ist ein Leitmotiv, das Bachmanns Werk wie ein roter Faden durchzieht. Ein Leitmotiv allerdings, das einer steten, klar zum Pessimismus tendierenden Entwicklung unterworfen ist, die sich bereits in Erzählungen wie Alles oder der Titelerzählung aus Das dreiigste Jahr abzeichnet. Das Thema der schönen Sprache in der Variante des schönen Buches, welche das Ich aus Malina für seinen Geliebten Ivan schreiben will, wird zwar noch einmal im Spätwerk übernommen, kann sich aber nicht frei entfalten und bleibt schlielich nichts weiter als gespenstisch herbeigesehnte Utopie, da die Protagonistin, wie bereits erwähnt, ihrer Sprache beraubt wurde und als erstes versuchen muss, diese über einen schmerzvollen Erinnerungsprozess zurückzugewinnen. Mit der Kontroverse von erinnern und verschweigen, nicht-vergessen oder vergessen im Kontext der Vergangenheitsbewältigung zeigt sich einmal mehr, wei aktuell Bachmanns Texte sind, da uns diese Auseinandersetzung direkt ins Hier und Heute führt. Während also der Glaube an die schöne Sprache in den letzten Texten Bachmanns starke Einbuen gelitten hat, feiert die Gaunersprache, vor allem in Kombination mit der Medienwelt Hoch-Zeit. “Die Sprache ist die Strafe“ (cf. Bachmann W 3, 1993: 97) sagt das Ich zu guter letzt im Interview mit Herrn Mühlbauer – ein Interview, das zu einer brilliantamüsanten Abrechnung mit der Presse wird. Was aber bleibt nach all diesen pessimistischen Ausführungen noch dem Schriftsteller, dem die Autorin einst (in den Frankfurter Vorlesungen ) eine so wichtige Mission in der Gesellschaft zugewiesen hatte? Das letzte utopische Programm Bachmanns, das sich diese bis in ihre späten Texte bewahrt hat, und welches allein sie vielleicht befähigt, weiterzuschreiben, ist die Hoffnung auf das anonyme, verstehende Du des Lesers, der die Möglichkeit hat, ihre Arbeit dort aufzunehmen, wo die Autorin sie unterbrechen muss, und damit den Funken von Bachmanns magischer Beschwörungsformel weitertragen kann, der da sagt: Ein Tag wird kommen., an dem die Menschen schwarzgoldene Augen haben, sie werden die Schönheit sehen, sie werden vom Schmutz befreit sein und von jeder Last, sie werden sich in die Lüfte heben, sie werden unter Wasser gehen, sie werden ihre Schwielen und ihre Nöte vergessen. Ein Tag wird kommen, sie werden frei sein, es werden alle Menschen frei sein, auch von der Freiheit, die sie gemeint haben. Es wird eine gröere Freiheit sein, sie wird über die Maen sein, sie wird für ein ganzes Leben sein [...] (cf. Bachmann 1994: 92). Wenn man in Betracht zieht, dass die Schriftstellerin keinen Zweifel darüber bestehen lässt, dass es ihrer Meinung nach vor allem die Männer dieser Gesellschaft sind, die an einer “unheilbaren Krankheit“(cf. Bachmann 1994: 71) leiden, dann dürfte diese möglich Hilfe wohl in erster Linie von weiblicher Seite zu erwarten sein2. BIBLIOGRAPHIE Amann, Klaus. 1997. “Denn ich habe zu schreiben. Und über den Rest hat man zu schweigen“. Ingeborg Bachmann und die literarische Öffentlichkeit.. Klagenfurt: Drava Verlag Bachmann, Ingeborg. 1993. Werke, Bde 1-4, Hg. v. Koschel, Christine, von Weidenbaum, Inge. München: Piper Verlag. Bachmann, Ingeborg. 1994. Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews, Hg. v. Koschel, Christine, von Weidenbaum, Inge. München: Piper Verlag. Bannasch, Bettina. 1997. Von vorletzten Dingen: Schreiben nach “Malina“: Ingeborg Bachmanns “Simultan“-Erzählungen. Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann. Bartsch, Kurt. 1988. Ingeborg Bachmann. Stuttgart: Verlag Metzler (Sammlung Metzler: Band 242). Beicken, Peter. 1992. Ingeborg Bachmann. München: Piper Verlag. Gürtler, Christa. 1985. Schreiben Frauen anders? Untersuchungen zu Ingeborg Bachmann und Barbara Frischmuth. Stuttgart: Verlag Hans-Dieter Heinz. Morrien, Rita. 1996. Weibliches Textbegehren bei Ingeborg Bachmann, Marlen Haushofer und Unica Zürn. Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann (Reihe Literaturwissenschaft – Band 193). Stoll, Andrea (Hg.). 1992. Ingeborg Bachmanns “Malina“. Frankfurt: Suhrkamp Verlag. (1) Wir verweisen auf die zweisprachig herausgegebenenen Übersetzungen: Pascual, Teresa /Schepers, Karin (Üb.), 1995, Poesía completa, Valencia: Edicions Alfons El Magnanim, Poesía: 25 und Dreymüller, Cecilia/García, Concha (Üb), 1999, Madrid, Ediciones Hiperión on va???????? 2 Es mag erstaunt haben, dass in diesem Kontext nie das Stichwort Feminsmus gefallen ist. Wir haben damit der Haltung Ingeborg Bachmanns Rechnung getragen, welche im öffentlichen Bereich (Interviews, Essays oder Reden) eine streng geschlechtsneutrale oder sogar klar distanzierte Stellung zu dieser Frage eingenommen hat.Im Rahmen dieses Beitrags war eine Untersuchung ihrer Gründe nicht möglich. Es ist jedoch unschwer einzusehen, warum sich im letzten Jahrzehnt Untersuchungen gehäuft habent, welche ihr Leben und Werk aus feministishcer Perspektive beleuchten.