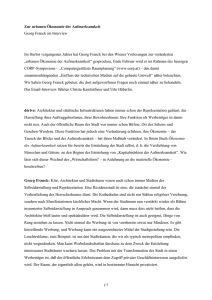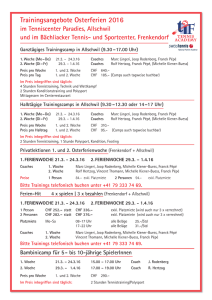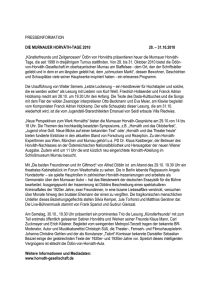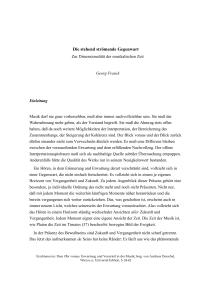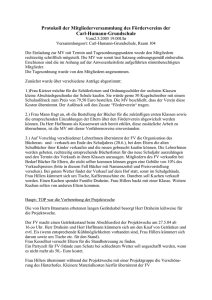Christiane Edinger - Werke für Violine von Eduard Franck (1817
Werbung
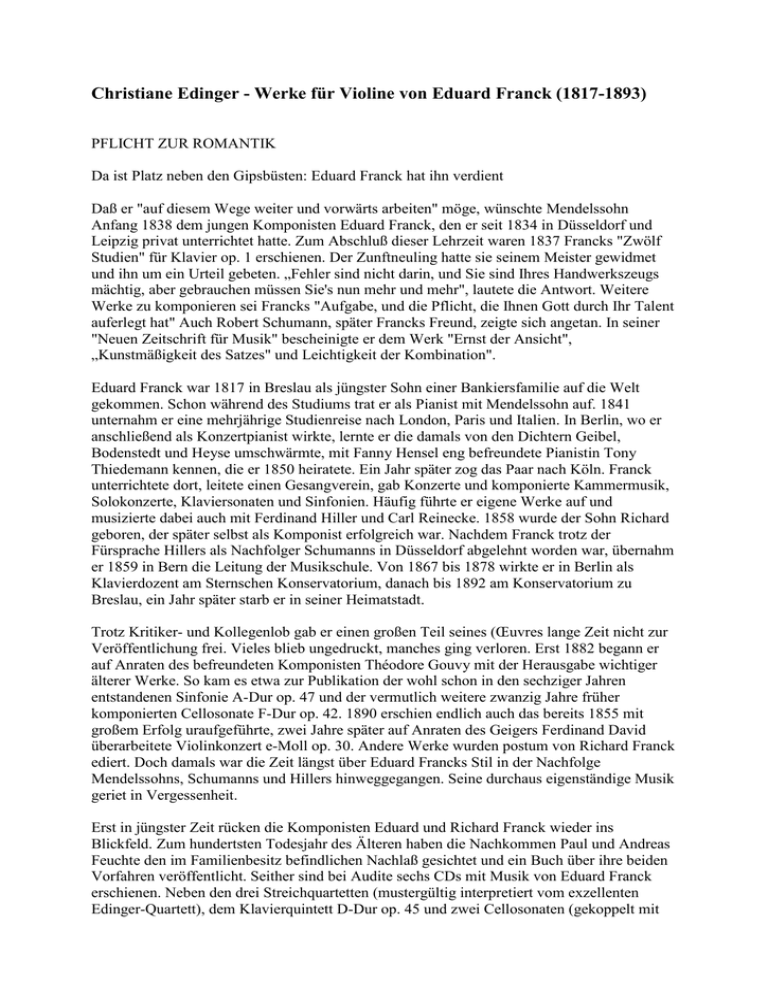
Christiane Edinger - Werke für Violine von Eduard Franck (1817-1893) PFLICHT ZUR ROMANTIK Da ist Platz neben den Gipsbüsten: Eduard Franck hat ihn verdient Daß er "auf diesem Wege weiter und vorwärts arbeiten" möge, wünschte Mendelssohn Anfang 1838 dem jungen Komponisten Eduard Franck, den er seit 1834 in Düsseldorf und Leipzig privat unterrichtet hatte. Zum Abschluß dieser Lehrzeit waren 1837 Francks "Zwölf Studien" für Klavier op. 1 erschienen. Der Zunftneuling hatte sie seinem Meister gewidmet und ihn um ein Urteil gebeten. „Fehler sind nicht darin, und Sie sind Ihres Handwerkszeugs mächtig, aber gebrauchen müssen Sie's nun mehr und mehr", lautete die Antwort. Weitere Werke zu komponieren sei Francks "Aufgabe, und die Pflicht, die Ihnen Gott durch Ihr Talent auferlegt hat" Auch Robert Schumann, später Francks Freund, zeigte sich angetan. In seiner "Neuen Zeitschrift für Musik" bescheinigte er dem Werk "Ernst der Ansicht", „Kunstmäßigkeit des Satzes" und Leichtigkeit der Kombination". Eduard Franck war 1817 in Breslau als jüngster Sohn einer Bankiersfamilie auf die Welt gekommen. Schon während des Studiums trat er als Pianist mit Mendelssohn auf. 1841 unternahm er eine mehrjährige Studienreise nach London, Paris und Italien. In Berlin, wo er anschließend als Konzertpianist wirkte, lernte er die damals von den Dichtern Geibel, Bodenstedt und Heyse umschwärmte, mit Fanny Hensel eng befreundete Pianistin Tony Thiedemann kennen, die er 1850 heiratete. Ein Jahr später zog das Paar nach Köln. Franck unterrichtete dort, leitete einen Gesangverein, gab Konzerte und komponierte Kammermusik, Solokonzerte, Klaviersonaten und Sinfonien. Häufig führte er eigene Werke auf und musizierte dabei auch mit Ferdinand Hiller und Carl Reinecke. 1858 wurde der Sohn Richard geboren, der später selbst als Komponist erfolgreich war. Nachdem Franck trotz der Fürsprache Hillers als Nachfolger Schumanns in Düsseldorf abgelehnt worden war, übernahm er 1859 in Bern die Leitung der Musikschule. Von 1867 bis 1878 wirkte er in Berlin als Klavierdozent am Sternschen Konservatorium, danach bis 1892 am Konservatorium zu Breslau, ein Jahr später starb er in seiner Heimatstadt. Trotz Kritiker- und Kollegenlob gab er einen großen Teil seines (Œuvres lange Zeit nicht zur Veröffentlichung frei. Vieles blieb ungedruckt, manches ging verloren. Erst 1882 begann er auf Anraten des befreundeten Komponisten Théodore Gouvy mit der Herausgabe wichtiger älterer Werke. So kam es etwa zur Publikation der wohl schon in den sechziger Jahren entstandenen Sinfonie A-Dur op. 47 und der vermutlich weitere zwanzig Jahre früher komponierten Cellosonate F-Dur op. 42. 1890 erschien endlich auch das bereits 1855 mit großem Erfolg uraufgeführte, zwei Jahre später auf Anraten des Geigers Ferdinand David überarbeitete Violinkonzert e-Moll op. 30. Andere Werke wurden postum von Richard Franck ediert. Doch damals war die Zeit längst über Eduard Francks Stil in der Nachfolge Mendelssohns, Schumanns und Hillers hinweggegangen. Seine durchaus eigenständige Musik geriet in Vergessenheit. Erst in jüngster Zeit rücken die Komponisten Eduard und Richard Franck wieder ins Blickfeld. Zum hundertsten Todesjahr des Älteren haben die Nachkommen Paul und Andreas Feuchte den im Familienbesitz befindlichen Nachlaß gesichtet und ein Buch über ihre beiden Vorfahren veröffentlicht. Seither sind bei Audite sechs CDs mit Musik von Eduard Franck erschienen. Neben den drei Streichquartetten (mustergültig interpretiert vom exzellenten Edinger-Quartett), dem Klavierquintett D-Dur op. 45 und zwei Cellosonaten (gekoppelt mit Werken für Cello und Klavier von Richard Franck und Reinecke) liegen nun auch die beiden Violinkonzerte und zwei der sechs Sinfonien vor. Die vorbildlichen Ersteinspielungen mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Saarbrücken unter Hans-Peter Frank fördern originelle hochromantische Orchesterwerke zutage. Gewiß haben etwa bei der Sinfonie in A-Dur Mendelssohn und Schumann Pate gestanden, doch Franck war kein Epigone. Harmonisch und in der Orchesterbehandlung ging er wie Raff, Reinecke und Bruch weit über die Vorbilder hinaus. Manches nimmt bereits Bruckner oder Brahms vorweg. Die Saarbrücker warten mit sattem Streicherklang und weichen, zart leuchtenden Bläserfarben auf. Hans-Peter Frank läßt spannungsgeladen musizieren und gibt den großflächig konzipierten, dicht gearbeiteten Sätzen Raum zur Entfaltung ihrer reichen Binnenstruktur. Das kommt nicht zuletzt der bis vor kurzem verschollenen, möglicherweise bereits 1856 entstandenen, 1883 überarbeiteten, aber nie publizierten Sinfonie B-Dur op. 52 zugute. Ihr ausladender, tief melancholischer, in spätromantische Harmonik vorstoßender Adagiosatz braucht den Vergleich mit Brahms nicht zu scheuen. Auch die beiden Violinkonzerte hätten es verdient, ins Repertoire übernommen zu werden. Die Geigerin Christiane Edinger nimmt sie als bedeutende Gattungsbeiträge ernst. Das e-Moll-Werk, dessen Neufassung 1861 unter Hillers Leitung uraufgeführt wurde, reklamiert sie seelenvoll und kultiviert als eigenwillige Replik Francks auf Mendelssohns Konzert in derselben Tonart, mit dem es seinerzeit auf eine Stufe gestellt wurde; Kritiker priesen seinen "edlen Charakter" und die "poetische Stimmung". Als Franck das Opus fast dreißig Jahre später in Druck gab, wurde es als "veraltet" übergangen. Seine Qualität indes ist offenkundig. Der weit ausgreifende Kopfsatz mündet in einen verhaltenen Zusammenbruch, aus dem die Solovioline diatonisch schlicht aufsteigt. Zusammen mit dem choralartigen Beginn des Mittelsatzes und dem attacca anschließenden stürmischen Finale läßt dies auf ein geheimes Programm schließen, obwohl Franck nach außen wie Brahms der klassizistischen Ästhetik "absoluter" Musik treu blieb. Als helleres Gegenstück erweist sich das um 1875 komponierte, unveröffentlichte Violinkonzert D-Dur op. 57, das zu Francks Lebzeiten nie gespielt wurde. Es besteht aus einem von Beethoven inspirierten Kopfsatz, einem traumverhangenen, an Schumanns Zweite gemahnenden Adagio und einem ungarisch angehauchten Finale mit virtuosem, stellenweise fast bachisch klingendem Solopart. Daß diese packende Musik mehr als hundert Jahre auf ihre Uraufführung warten mußte, kann man in Abwandlung von Mahlers vielzitiertem Ausspruch eigentlich nur mit der als Tradition verbrämten Schlamperei eines verkrusteten Konzertbetriebs erklären. Die fulminante Interpretation ist ein überzeugendes Plädoyer gegen derlei kanongläubige Gipsbüstenfixiertheit. WERNER M. GRIMMEL Frankfurter Allgemeine Zeitung - 17. August 2001