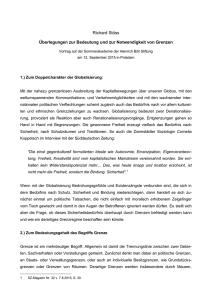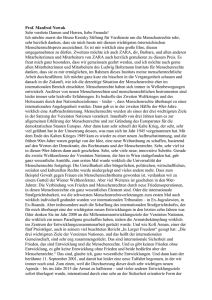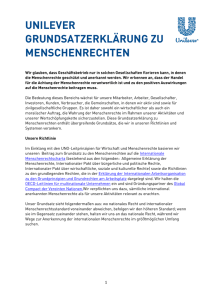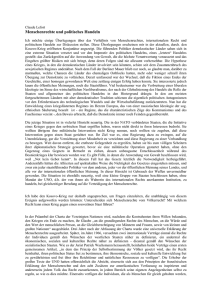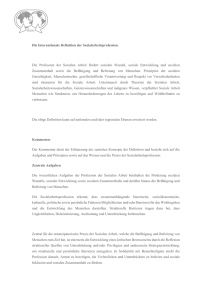Menschenrechte und kulturelle Identität - Ruhr
Werbung
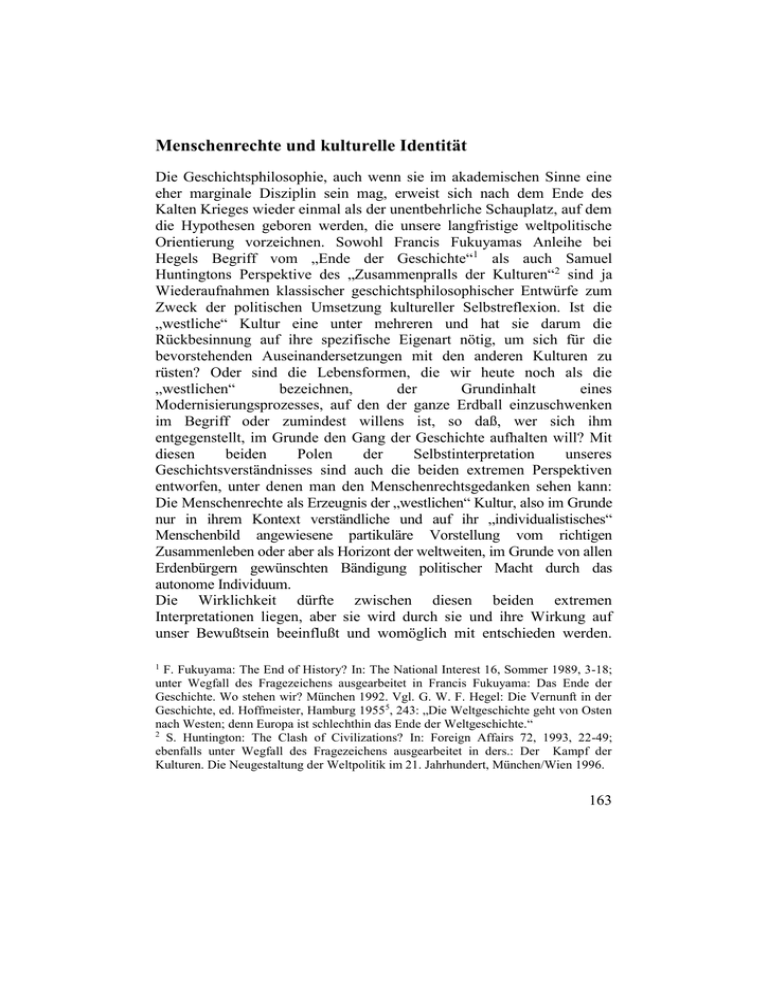
Menschenrechte und kulturelle Identität Die Geschichtsphilosophie, auch wenn sie im akademischen Sinne eine eher marginale Disziplin sein mag, erweist sich nach dem Ende des Kalten Krieges wieder einmal als der unentbehrliche Schauplatz, auf dem die Hypothesen geboren werden, die unsere langfristige weltpolitische Orientierung vorzeichnen. Sowohl Francis Fukuyamas Anleihe bei Hegels Begriff vom „Ende der Geschichte“1 als auch Samuel Huntingtons Perspektive des „Zusammenpralls der Kulturen“2 sind ja Wiederaufnahmen klassischer geschichtsphilosophischer Entwürfe zum Zweck der politischen Umsetzung kultureller Selbstreflexion. Ist die „westliche“ Kultur eine unter mehreren und hat sie darum die Rückbesinnung auf ihre spezifische Eigenart nötig, um sich für die bevorstehenden Auseinandersetzungen mit den anderen Kulturen zu rüsten? Oder sind die Lebensformen, die wir heute noch als die „westlichen“ bezeichnen, der Grundinhalt eines Modernisierungsprozesses, auf den der ganze Erdball einzuschwenken im Begriff oder zumindest willens ist, so daß, wer sich ihm entgegenstellt, im Grunde den Gang der Geschichte aufhalten will? Mit diesen beiden Polen der Selbstinterpretation unseres Geschichtsverständnisses sind auch die beiden extremen Perspektiven entworfen, unter denen man den Menschenrechtsgedanken sehen kann: Die Menschenrechte als Erzeugnis der „westlichen“ Kultur, also im Grunde nur in ihrem Kontext verständliche und auf ihr „individualistisches“ Menschenbild angewiesene partikuläre Vorstellung vom richtigen Zusammenleben oder aber als Horizont der weltweiten, im Grunde von allen Erdenbürgern gewünschten Bändigung politischer Macht durch das autonome Individuum. Die Wirklichkeit dürfte zwischen diesen beiden extremen Interpretationen liegen, aber sie wird durch sie und ihre Wirkung auf unser Bewußtsein beeinflußt und womöglich mit entschieden werden. 1 F. Fukuyama: The End of History? In: The National Interest 16, Sommer 1989, 3-18; unter Wegfall des Fragezeichens ausgearbeitet in Francis Fukuyama: Das Ende der Geschichte. Wo stehen wir? München 1992. Vgl. G. W. F. Hegel: Die Vernunft in der Geschichte, ed. Hoffmeister, Hamburg 19555, 243: „Die Weltgeschichte geht von Osten nach Westen; denn Europa ist schlechthin das Ende der Weltgeschichte.“ 2 S. Huntington: The Clash of Civilizations? In: Foreign Affairs 72, 1993, 22-49; ebenfalls unter Wegfall des Fragezeichens ausgearbeitet in ders.: Der Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert, München/Wien 1996. 163 Einerseits bekennen sich fast alle Staaten der Welt zu den Menschenrechten als Grundlage ihrer Verfassung und bietet die Bezugnahme auf die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ von 1948 ein entscheidendes Hilfsmittel der Austragung ideologischer Streitigkeiten;3 andererseits nehmen wir durchaus Konflikte wahr, die auf eine Einschränkung oder mögliche Infragestellung der politischen Grundbedeutung des Menschenrechtsgedankens schließen lassen können. Der Streit um den „Schador“, die traditionelle Kopfbedeckung, die eine Schülerin als Ausdruck ihrer religiösen und kulturellen Identität, ihre Lehrerin jedoch als Symbol der Mißachtung der Rechte der Frau empfand, ist ein inzwischen vielfach aufgetretenes Beispiel dafür. Ein anderes bietet die Prügelstrafe, zu der ein junger Amerikaner in Singapur – notabene aufgrund eines der englischen Kolonialherrschaft entstammenden Gesetzes – verurteilt wurde und die in der amerikanischen Öffentlichkeit auf schärfste Kritik und geradezu auf Verachtung des kulturellen Niveaus stieße, auf das man sie zurückführte. Und daß es im Spannungsfeld zwischen Rechtsschutz der Person und der Achtung kultureller Identität nicht nur um die Bedürfnisse von Minderheiten geht, zeigte der Fall des „Kruzifix-Urteils“, mit dem das deutsche Bundesverfassungsgericht den Anspruch auf negative Religionsfreiheit über eine Praxis der Gestaltung öffentlicher Räume stellte, für welche sich die bayerische Regierung nicht etwa auf religiöse, sondern auf die Prinzipien kultureller Identität gestützt hatte. Philosophisch kann man zur Lösung solcher Konflikte sicher kein Patentrezept entwerfen, aber zumindest zur Klärung der Frage beizutragen versuchen, auf welcher Ebene überhaupt diskutiert werden muß, wenn man ihrer Lösung oder wenigstens ihrer interkulturell vermittelbaren Behandlung näherkommen will. Es geht also darum, sich auf die Eigenart der hierzu in Betracht kommenden Diskursformen zu besinnen. Unerläßlich bleibt die kultur- und geistesgeschichtliche Betrachtungsweise, die das Verständnis vom Menschen, vom Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft und von den Fundamenten der Rechtsordnung in den je verschiedenen Kulturkreisen vergleichend analysiert und aufgrund dessen die Ursachen ideologischer und philosophischer Streitigkeiten freizulegen versucht. Wo es um die 3 Vgl. dazu H. von Senger: Der Menschenrechtsgedanke im Lichte chinesischer Werte, in: W. Schweidler (Hrsg.): Menschenrechte und Gemeinsinn – westlicher und östlicher Weg? Sankt Augustin 1998, 267-293. 164 Menschenrechte im konkreten Sinne geht, muß aber der politische Diskurs auch ganz direkt zum Medium der darstellenden Austragung des Konflikts werden, muß man also versuchen, den politischen Gehalt jener Antithesen – ob in grundsätzlicher Sympathie oder kritischer Distanz – nachzuvollziehen, mit denen „östliches“ sich als Alternative eigenen Rechts dem „westlichen“ Menschenrechtsverständnis entgegen- oder gegenüberstellt. Zumindest bedacht werden müssen freilich auch Diskursformen, die zu diesen eher herkömmlichen Betrachtungsweisen bis zu einem gewissen Grad querstehen, so etwa die emanzipatorischfeministische Rekonstruktion der Menschenrechte als Medium der Transformation der Bürgergesellschaft zum Zustand realer Gleichberechtigung der Geschlechter4; vor allem aber auch der ökonomische Diskurs, der auf der Basis einer funktionalistischen Interpretation der Menschenrechte die fundamentale Basis interkultureller Verständigung im koordinierten Streben nach ökonomischem Vorteil und sozialer Modernisierung sieht und sich Rationalität im Grunde nur als Nutzenkalkül vorstellen kann, der freilich nicht unbedingt individualistisch gefaßt werden muß, sondern gegenüber kulturell variablen Interpretationen des jeweiligen ökonomischen Subjekts unter Umständen offen bleiben kann.5 In diesem Beitrag soll als Ausgangspunkt unserer Überlegungen zunächst die Frage nach dem rechtlichen Diskurs als Austragungsort der genannten Spannung gestellt werden. Wir versuchen also, das Problem der Vereinbarung von Menschenrechten und kultureller Identität als Angelegenheit des juristischen Diskurses und seiner Grenzen zu begreifen. Gezeigt werden soll, daß auf dieser Ebene das Problem nicht befriedigend zu bewältigen ist. „Kulturelle Identität“ läßt sich nicht einfach als eines der „Menschenrechte“ begreifen und etwa in Form von 4 Vgl. dazu E. Mack: Sind Frauenrechte Menschenrechte? Ihre Bedeutung in einem interkulturellen Dialog, in: W. Schweidler (Hrsg.): Menschenrechte und Gemeinsinn, a.a.O., 47-64. 5 Dieser Ansatz wird skizziert von B. Hirsch: Menschenrechte aus ökonomischrationalem Interesse. Eine Rekonstruktion am Beispiel China, in: W. Schweidler: Menschenrechte und Gemeinsinn, a.a.O., S. 65-88; vgl. zu dem genannten Verhältnis zwischen individueller und kollektiver Interpretation des Rationalitätskalküls den Begriff der „kollektiven Selbstverpflichtung“ bei K. Homann: Rationalität und Demokratie, Tübingen 1988, 281 ff. und zu den gerade auch in diesen Ansatz durch den Begriff des „Fortschritts“ eingesenkten massiven geschichtsphilosophischen Voraussetzungen den Rückgriff auf Popper bei K. Homann: Die Interdependenz von Zielen und Mitteln, Tübingen 1980, 171 ff., 183 f., 279. 165 Grundrechten positivieren, einklagen und gegen andere Rechtsgüter zur Abwägung bringen. Versucht man dies, so erreicht man entweder zu wenig, d.h. man formuliert Ansprüche, die bereits rechtlich konkretisiert sind, oder zu viel, d.h. man relativiert dadurch genau die juristischstaatsrechtliche Grundlage, auf deren Basis man sich zu stellen glaubt. Der Begriff der kulturellen Identität weist über die Grenzen des rechtlichen Diskurses hinaus auf Formen des Denkens und Sprechens, in denen der verantwortliche Umgang mit diesen Grenzen als indirekte, aus ihm ausgeschlossene und trotzdem für ihn konstitutive Grundlage des rechtlichen Diskurses selbst in Erinnerung gehalten werden muß. Warum also läßt sich „kulturelle Identität“ nicht einfach als Menschenrecht, also als personaler Rechtsanspruch begreifen, der vom Staat den Bürger oder möglicherweise ganzen Gruppen seiner Bürger zu gewährleisten ist und gegen andere Menschenrechte jeweils abgewogen und im Kontext mit ihnen konkretisiert werden muß? Die Antwort kann sich nur aus der Analyse des Ortes ergeben, der innerhalb des Gesamtkontextes des rechtlichen Diskurses dem Menschenrechtsbegriff zukommt. Worin besteht die Eigenart des rechtlichen Diskurses? Den für unseren Zusammenhang entscheidenden Gesichtspunkt hat Kant in der Einleitung zur Rechtslehre der „Metaphysik der Sitten“6 hervorgehoben, indem er den rechtlichen Zwang als „Verhinderung eines Hindernisses der Freiheit nach allgemeinen Gesetzen“ definiert: Der rechtliche Diskurs ist wesentlich als Negation einer Negation strukturiert. Er findet statt, wo Beziehungen gestört sind, die durch die mit ihm verwobenen Institutionen wieder in Ordnung bzw. zur Geltung gebracht werden sollen. Daß solche Beziehungen bestehen, setzt Kant voraus, wenn er den Zustand, in dem die Freiheit nach allgemeinen Gesetzen organisiert ist, den „bürgerlichen Zustand“7 nennt, „in welcher jedem das Seine erhalten werden kann“8. Diesen Zustand einzugehen und in ihm zu verbleiben ist uns nach Kant durch ein nicht weiter ableitbares „Postulat der Vernunft“ 9 aufgegeben. Diese Begründung soll in unserem Zusammenhang nicht 6 I. Kant: Die Metaphysik der Sitten, in: Werke in 6 Bänden, Bd. IV, Darmstadt 1983, AB 35. Ebd., § 8, vgl. § 15 (die „bürgerliche Verfassung“). 8 Ebd., Einteilung, AB 43 f. 9 Vgl. ebd., AB 28 f. 7 166 weiter diskutiert werden.10 Die auf ihr beruhende Analyse aber kann den Ausgangspunkt für unsere Erörterung bilden. Das Recht im Sinne der gesetzlichen Ordnung eines souveränen Staates ist im Wesen ein System der Verhinderung von Eingriffen in Beziehungsverhältnisse, aufgrund derer Menschen gegen ihre Mitbürger und in einem gewissen Maß gegen alle Mitmenschen überhaupt etwas zusteht. Im Rechtsdiskurs setzt man einen konkreten Adressaten, einen Anspruchsgegner voraus, in bezug auf welchen gesetzlich geregelte Zwänge eingeklagt werden, und man identifiziert diesen Gegner vermöge der Handlungen oder Unterlassungen, durch die er die vom Gesetz zu schützenden bzw. wiederherzustellenden Beziehungen gestört hat. Das Gesetz konkretisiert sich also als Negation von Unrecht, nicht als Schöpfung von Recht. Weniger als im Wortlaut drückt sich diese Grundtatsache in der Struktur des Systems unserer Gesetze aus, die ihre Logik aus den Formen möglichen Unrechts bezieht – und nicht etwa aus einer vorgegebenen quasi-rechtlichen Ordnung, die durch das Gesetz etwa in die gesellschaftliche Realität zu übersetzen wäre. Was beim Strafrecht evident ist, gilt im Kern nicht weniger für das Bürgerliche Recht: Es ist im Kern ein Katalog von Störungsbeseitigungen. Unmöglichkeit, Verzug, Sachmangel, Schadensersatz, auch noch die Formvorschriften des Sachen- oder Erbrechts sind Teile eines Systems von Vorschriften, das relativ auf bestimmte geschichtlich konkretisierte Typen von Konfliktsituationen bürgerlichen Zusammenlebens Verletzungen verhindert, Störungen beseitigt, Verstöße gegen einen Sinn sozialer Verhältnisse berichtigt, der seinerseits nur in Form von Gesetzen, also in Form der Negation seiner Negation konkreten sozialen Bestand gewinnt. Sogar das Familienrecht beginnt mit dem Satz: „Aus einem Verlöbnisse kann nicht auf die Eingehung der Ehe geklagt werden“ und: „Das Versprechen einer Strafe für den Fall, daß die Eingehung der Ehe unterbleibt, ist nichtig.“11 Diese in sich negative Konstitution des Gesetzes ist gerade für demokratisches Staatsverständnis von entscheidender Bedeutung. Daß alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, besagt eben nicht, daß das Volk zwischen Führern zu wählen hätte, die mit konkurrierenden 10 Vgl. dazu mein Buch: Geistesmacht und Menschenrecht. Der Universalanspruch der Menschenrechte und das Problem der Ersten Philosophie, Freiburg i.Br./München 1994, insbes. §§ 18 bis 21. 11 BGB § 1297. 167 Ordnungsentwürfen vor es hintreten, sondern daß es Regierende nur einsetzt, um einen Entwurf zu schützen und zu verwalten, den es sich selbst schon vorher und unabhängig von ihnen gegeben hat und der zuletzt der Entwurf der Menschen ist, aus denen er besteht. Nur deshalb geht es in der demokratischen Auseinandersetzung um den Erlaß neuer Gesetze regelmäßig um die Frage, ob die bestehenden Gesetze nicht schon „ausreichen“. Wenn der Gesetzgeber nicht zeigen kann, wo im gesetzlichen Anspruchsgefüge der Bürger etwas in Unordnung ist, hat er kein Recht, ein neues Gesetz zu erlassen. Was folgt aus dieser strukturellen Ausgangsfeststellung der in sich negativen Konstitution des bürgerlichen Gesetzes für die Frage nach seiner legitimatorischen Basis? Es folgt daraus, daß man Recht nicht aus Eigenschaften oder Strebungen des Menschen ableiten kann, sondern nur aus menschlichen Verhältnissen und Beziehungen. Rechte beruhen daher auch nicht auf Interessen; es ist gerade eine Hauptschwäche des Begriffs „Interesse“, daß er die Differenzen zwischen faktischen und relationalen Gegebenheiten verwischt.12 Gerade hier aber – und nicht zwischen „Sein“ und „Sollen“ – verläuft die entscheidende Trennlinie. Man kann, wie es etwa Alan Gewirth tut13, das Verhältnis gegenseitiger Anerkennung, durch das ein Mensch überhaupt erst den Rechtsanspruch eines anderen wahrnehmen kann, als den logischen Schritt von der Tatsachen- zur Sollensaussage und insofern als die „Lösung des SeinsSollens-Problems“ betrachten. Aber man muß sich dann darüber im Klaren sein, daß dieser Schritt wiederum in konkret existierenden „seienden“ Institutionen real gegeben sein muß und nicht durch eine abstrakte Theorie der gesellschaftlichen Realität quasi hinzugefügt werden kann. Man könnte insofern auch umgekehrt sagen, daß die für rechtliche Verhältnisse konstitutive intersubjektive Anerkennung gerade darauf beruht, daß wir uns einen Diskurs geschaffen haben, in dem wir bestimmte Sollensanforderungen zum Bestandteil unserer Selbstbeschreibung – als „Personen“ oder eben Rechtssubjekte – gemacht haben, wodurch wir die Unbegründbarkeit unseres Selbstverständnisses aus gänzlich unrelationalen Fakten von vornherein festgehalten und institutionalisiert haben. Nicht ob Rechte sich aus 12 Vgl. dazu D. Birnbacher: Sind wir für die Natur verantwortlich, in: ders. (Hrsg.): Ökologie und Ethik, Stuttgart 1980, 103-139, insbes. 125 f. 13 A. Gewirth: The „Is-Ought“ Problem Resolved, in: ders.: Human Rights. Essays on Justification and Applications, Chicago 1982, 100-127, insbes. 120. 168 „Seiendem“ ableiten lassen, sondern ob die relevanten Tatsachen faktische Eigenschaften oder interpersonal konstituierte Relationen sind, ist die Frage, auf die es für die philosophische Frage nach der Begründung von menschlichem Recht letztlich ankommt. Von der Feststellung faktischer Eigenschaften oder Interessen eines isolierten Individuums zur Anerkennung von Rechten gibt es in der Tat keine logische Brücke. Daraus, daß ich zwei Arme habe und sie behalten möchte, folgt nicht, daß ich das Recht habe, sie zu behalten. Gegen meine Eigenschaften kann nicht „verstoßen“, meine Interessen können (wenn man die Sprache korrekt verwendet) nicht „verletzt“ werden. Nur wenn zwischen mir und anderen Menschen ein Verhältnis besteht, aufgrund dessen mein Bestreben, meine beiden Arme zu behalte, ihnen als ein ihnen und mir gemeinsames, sie mit mir auf genuin menschliche Weise verbindendes Bestreben wahrnehmbar wird, nur dann kann ihnen auch die Anerkennung dieses Bestrebens als Implikation bestehender Tatsachen wahrnehmbar werden. Gegen die Erhaltungsbedingungen eines Verhältnisses, gegen die Existenzvoraussetzungen einer gemeinsamen Beziehung kann zwischen Menschen sehr wohl „verstoßen“ werden, und erst vor dem Hintergrund dieser Möglichkeit bekommt die Forderung einen Sinn, daß die durch einen solchen Verstoß hervorgerufenen Störungen zu verhindern oder wiedergutzumachen sind. Natürlich folgt auch aus der bloßen Tatsache, daß ein Verhältnis existiert, nicht, daß es weiter existieren solle. Aber „die Tatsache“, daß ein Verhältnis existiert, ist nicht in der Weise gegeben, daß sie in einem Augenblick vorhanden und im nächsten ausgelöscht sein könnte, wie eine faktische Eigenschaft isolierter Individuen. Zwischenmenschliche Verhältnisse von der Art, die zu schützen den Sinn des Rechts ausmacht, existieren als Gefüge strukturell koordinierter Entscheidungen, durch welche die Glieder dieser Verhältnisse, also die menschlichen Personen, gezwungen werden, deren künftiges Bestehen als Implikation augenblicklicher Entscheidungen anzuerkennen. Das Gesetz hat gerade den Sinn, diese Implikation zu bewahren, so daß wir prinzipiell natürlich frei sind, die zugrundeliegenden Verhältnisse als ganze zu zerstören, jedoch dazu gezwungen werden, uns ihnen, wenn wir vor dieser Gesamtkonsequenz zurückscheuen, ganz zu fügen. Die Entscheidung selbst, durch welche dieses Gefüge insgesamt aufrechterhalten wird, sind allerdings letztlich individuelle Akte autonomer Personen. Auch wenn der Inhalt der für das Recht konstitutiven Verhältnisse interpersonal konstituiert wird, so trägt die Verantwortung für die Aufrechterhaltung 169 dieser Verhältnisse letztlich immer der einzelne Mensch, und er als personaler Rechtsträger ist die letzte Legitimationsquelle ihrer gesetzlichen Aufrechterhaltung. Daß es sich bei diesem augenblicksübergreifenden, institutionellen Gefüge um eine genuin menschlichen Zusammenhang handelt, zeigt sich letztlich daran, daß ich als Mensch gegen nichtmenschliche Wesen keine Rechte habe. Ein Bär, der mir einen Arm abbeißt, verletzt nicht mein Recht auf körperliche Unversehrtheit, auch wenn die Konsequenzen, die sich daraus für meine Ausstattung mit individuellen Eigenschaften ergeben, die gleichen sind wie wenn mir ein Mensch den Arm abschlägt. Die Elster, die sich mit meinem Ring davonmacht, verletzt nicht mein Eigentumsrecht. Tiere können die genuin menschliche Beziehung, die wir mit unseren Gesetzen anerkennen und schützen, nicht stören, was immer sie uns antun, während hingegen zwischen Menschen immer anerkannt gewesen ist, daß ein bestimmtes Verhalten gegenüber Tieren auch die Störung genuin menschlicher Rechtsbeziehungen bedeuten kann. Es ist somit eine Grundeinsicht in die paradoxe Konstitution des Menschseins, daß wir uns wesentlich aus der Verhinderung von Störungen eines Beziehungsgefüges definieren, was gerade durch die Möglichkeit seines Gestörtwerdens konstituiert ist, so daß wir wesentlich durch eine Möglichkeit, die wir beständig zu verhindern suchen, die Differenz zu allen natürlichen Wesen konstituieren, die nicht sind wie wir.14 Ebensowenig wie die Rechte im allgemeinen sind nun aber die Menschenrechte durch ein bestimmtes Ensemble von Eigenschaften oder Interessen konstituiert. Ebenso wie die Rechte im allgemeinen erhalten die Menschenrechte ihre Realität durch eine spezifische Beziehung und deren mögliche Verletzung, also durch potentielles Unrecht. Man darf also nicht meinen, es seien eine Anzahl besonders schützenswerter Eigenschaften an uns, durch die im Unterschied zu weniger wichtigen Eigenschaften die ganz besonders wichtigen Rechte definiert wären, die wir „Menschenrechte“ nennen. Wieder kann die Verletzung ein und desselben Schutzgutes eine Menschenrechtsverletzung sein oder nicht. Wenn ein Verbrecher mich foltert, um mich zu zwingen, das Versteck 14 Vgl. hierzu die inhaltlich analogen Gedankenfiguren der konfuzianischen Unterscheidung von Mensch und Tier bei H.-G. Möller: Die Präsenz des Menschen in der antiken chinesischen Philosophie, in: W. Schweidler (Hrsg): Menschenrechte und Gemeinsinn, a.a.O., 163-176. 170 meines Safeschlüssels preiszugeben, dann begeht er keine „Menschenrechtsverletzung“, obwohl sich seine Tat äußerlich nicht von der eines Polizisten unterscheiden mag, der mich foltert, um mich von politischer Betätigung und freier Meinungsäußerung abzuhalten. Der Teil des Rechtsdiskurses, innerhalb dessen der Menschenrechtsbegriff seine Bedeutung erlangt und aus dem er nicht ohne irreführende Konsequenzen herausgelöst werden kann, konstituiert sich durch ein Verhältnis, das zwischen mir und dem Verbrecher nicht, wohl aber zwischen dem Polizisten und mir besteht, nämlich durch die Beziehung zwischen der individuellen menschlichen Person und der staatlichen Zwangsordnung, die Herrschaftsanspruch über sie erhebt. Mit dem Menschenrechtsbegriff wird zum Ausdruck gebracht, daß das Verhältnis zwischen Bürger und Staat innerhalb der allgemein zwischen Menschen bestehenden Rechtsverhältnisse nicht eines unter vielen ist, sondern daß ihm eine konstitutive Bedeutung für die Aufrechterhaltung derjenigen Beziehungen zwischen Menschen zukommt, von denen der rechtliche Diskurs als ganzer getragen ist. Staatliches Unrecht bedroht nicht bestimmte Schutzgüter, die dem „normalen“ Verbrecher aus irgendeinem Grunde entzogen wären; sondern staatliches Unrecht bedroht vielmehr die Erhaltungsbedingungen jenes vorgesetzlichen Beziehungsgefüges, aufgrund dessen wir überhaupt von „Unrecht“, „Rechtsverletzung“ und damit auch „Verbrechen“ sprechen können. Die Inhalte der menschenrechtlichen Schutzgewährleistungen haben nicht den Sinn, Recht zu definieren, sondern diejenige Institution, die als einzige die Macht hat, die vorgesetzlichen Bedingungen für die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht aus der Welt zu schaffen, nämlich den Staat, um eben diese Macht zu bringen. Mit dem Begriff „Menschenrecht“ und seinem semantischen Umfeld hat der Rechtsdiskurs die Bedingungen seiner Referentialität in sich selbst aufgenommen, sie zu einem Teil seiner selbst transformiert und dadurch zumindest teilweise die Herrschaft über, aber auch die Verantwortung für die Rechtfertigung seiner selbst übernommen.15 Was bedeutet all dies nun für die Frage nach dem Verhältnis von Menschenrecht und kultureller Identität? Es bedeutet zunächst, daß die Berechtigung des Menschenrechtsdiskurses nicht davon abhängt, ob es 15 Vgl. zu dieser Transformationsleistung und dem Verhältnis zwischen Menschenrechten und Grundrechten mein Buch: Geistesmacht und Menschenrecht, a.a.O., § 43 und meinen Aufsatz: Die Menschenrechte als metaphysischer Verzicht, in diesem Band. 171 eine kulturinvariante „Natur des Menschen“, ein kulturübergreifendes „Menschenbild“ oder irgendeine andere Manifestation eines global anerkannten Kataloges allen Menschen gemeinsamer Eigenschaften oder Interessen gibt. Der Hinweis darauf, daß der Menschenrechtsdiskurs aus einem soziokulturell und geschichtlich partikulären, bedingten Umfeld hervorgegangen sei, ist zwar geistesgeschichtlich berechtigt, aber für die Frage nach der universellen Geltung der Menschenrechte nicht entscheidend. Nicht die Universalität einer „Natur des Menschen“, sondern die Universalität der Formen staatlichen Unrechts begründet den kulturübergreifenden Anspruch der Menschenrechte.16 Die Menschenrechte konkretisieren sich als Antithese zu Folter, willkürlicher Verhaftung, sozialer oder anderweitiger Diskriminierung, Rede- und Demonstrationsverbot, Unterdrückung der Religionsausübung, Massenvertreibung, Genozid und einer Reihe anderer Formen typischen staatlichen Unrechts. Soweit wir heute sehen, gibt es hinsichtlich dieser Formen keine kulturell geprägten Unterschiede von signifikanter Bedeutung. Nur von solchen Unterschieden her wäre jedoch die kulturelle Relativierung des weltweiten Gültigkeitsanspruchs der Menschenrechte rational zu rechtfertigen. Ob kulturelle Identität ein Schutzgut ist, das durch die Gewährleistung der Menschenrechte umgriffen wird, ist daher nicht dadurch herauszufinden, daß man fragt, inwieweit die Bewahrung oder der Respekt vor kultureller Identität zu einer wie auch immer definierten menschlichen Natur gehöre. Vielmehr geht es nur darum, ob die Mißachtung kultureller Identität zu den weltweit virulenten Formen staatlichen Unrechts gehört. Und diese Frage ist ohne große 16 Ernstzunehmen ist hier freilich der Hinweis auf die strenge Differenzierung in von Natur aus Herrschende und Beherrschte in der altchinesischen Philosophie, vgl. H.-G. Möller: Die Präsenz des Menschen in der antiken chinesischen Philosophie, a.a.O. Der prinzipielle Ausschluß dieses Gedankens aus der politischen Philosophie, wie er von Hobbes im 15. Kapitel des Leviathan (Frankfurt a.M. 1984) vorgenommen worden ist, stellt zweifellos einen Meilenstein der Grundlegung des menschenrechtlichen Staatsverständnisses dar. Doch andererseits ist wieder festzuhalten, daß die vorneuzeitliche Tradition auch unter Zugrundelegung einer solchen Vorstellung der Dichotomie von Herrschenden und Beherrschten selbstverständlich den Topos des Unrechts der Herrschenden kannte; das Gesetz ist seit Platon und Aristoteles gerade als das Instrument interpretiert worden, daß die Ungerechtigkeit der Herrschenden (christlich gesprochen: ihre Pflichtverletzung gegenüber Gott) zu bekämpfen habe. Der Gedanke möglichen staatlichen Unrechts ist insofern auch mit un- und vordemokratischem Herrschaftsverständnis durchaus kompatibel. 172 Problematisierung zu bejahen: Die Unterdrükkung der Sprache und des Brauchtums, der religiösen Institutionen und der eigenständigen Formen von Erziehung und Bildung von nationalen Minderheiten oder sogar ganzer Völker durch Regierungen gehört zum typischen Potential staatlicher Mißachtung personaler Selbstbestimmung und muß ein Angriffsobjekt im Kampf um die weltweite Durchsetzung und den Schutz der Menschenrechte sein. Aber so eindeutig diese Antwort ist, so unergiebig bleibt sie für unsere anfangs skizzierte Problemstellung. So geht es ja bei dem erwähnten Fall des Streits um die Kopfbedeckung eines islamischen Mädchens gerade darum, ob der Respekt vor kultureller Identität so weit zu gehen hat, daß ein den allgemeinen Freiheits- und Gleichheitsverbürgungen entspringendes Recht wie das der Emanzipation im Verhältnis der Geschlechter an ihm seine Grenze findet. Der eigentliche Hintergrund der Frage nach dem Verhältnis von Menschenrecht und kultureller Identität besteht nicht in einem Schutzbereich, dem bislang im globalen Ringen um die Durchsetzung der Menschenrechte zuwenig Aufmerksamkeit geschenkt worden wäre; sondern er besteht in Änderungen unserer Formen des Zusammenlebens, und zwar Änderungen im weltweiten Maßstab, die uns vor die Frage stellen, ob nicht fundamentale Umgewichtungen unserer Rechtsbeziehungen als ganzer notwendig sind und wie diese sich gegebenenfalls im Menschenrechtsbegriff und im Menschenrechtsdiskurs auszuwirken haben. Es geht hier um Änderungen, die möglicherweise auch das Verhältnis zwischen dem Rechtsdiskurs und jenen vorgesetzlichen Verhältnissen betreffen, den wir bei der bisherigen Ortsbestimmung des Menschenrechtsbegriffs ständig vorausgesetzt und in Anspruch genommen haben. Wir müssen hier nun endlich die Natur der immer wieder angesprochenen vorgesetzlichen Verhältnisse in den Blick nehmen. Zu ihrer Charakterisierung brauchen wir den Begriff der „kulturellen Identität“, und die sie betreffenden Veränderungen unserer sozialen Realität sind es, die seine Thematisierung innerhalb des Menschenrechtsdiskurses nötig machen. Man muß dabei zunächst auf den Bedeutungswandel eingehen, den der Begriff „Kultur“ selbst in neuerer Zeit durchlaufen hat. Die Aufklärung hatte ihn streng universalistisch definiert: Kultur als der Zustand, zu dem die Menschheit sich, aus dem Naturzustand heraustretend, aufgeschwungen hat, der nun von einigen wenigen fortgeschrittenen Völkern und Nationen 173 exemplarisch verkörpert wird und in den wir die zurückgebliebenen Teile der Menschheit hinüberzuziehen die moralische Pflicht haben.17 Dieser strikte Universalismus entspricht weder dem ursprünglichen Sinn des Wortes „Kultur“ – abgeleitet vom lateinischen „colere“ und immer verbunden mit dem Genitiv: Kultur des Gartens, eines Hauses, bestimmter menschlicher Fähigkeiten usw.18 – noch dem heute herrschenden pluralistischen Kulturbegriff, der es überhaupt erst sinnvoll macht, von „kultureller Identität“ zu sprechen. Der hier vorausgesetzte Sinn ist der, in dem Oswald Spengler von den Kulturen spricht, deren jede „ihre eigne Idee, ihre eignen Leidenschaften, ihr eignes Leben“ hat.19 Erst vor diesem Hintergrund kann man sinnvollerweise fordern, daß Menschen die kulturelle Prägung anderer als ein zu schützendes Gut anerkennen sollen und daß es eine prinzipielle Gleichwertigkeit unterschiedlicher Kulturen auf der Welt gebe. Hinter dem pluralistischen Kulturbegriff steht eindeutig eine andere Geschichtsphilosophie als hinter dem universalistischen, und die Frage ist, wie diese Differenz sich im Verhältnis zum Menschenrechtsbegriff auswirkt. Zunächst muß man sich darüber im Klaren sein, daß der pluralistische Kulturbegriff, wenn er sich nicht ins Unverbindliche auflösen soll, relativ auf geschichtlich gewachsene menschliche Gemeinschaften wird. Ernest Gellner definiert in diesem Sinne Kulturen als „Systeme von Vorstellungen und Überzeugungen, an denen sich Denken und Verhalten“ menschlicher Individuen im Kontext des sie umgreifenden Sozialverbandes orientieren.20 Orientierung setzt die Gültigkeit bestimmter Vorbildlichkeitsmaßstäbe und Verhaltensmuster voraus, aufgrund derer sich die eine von einer anderen kulturell definierten Gemeinschaft unterscheiden läßt. Man versteht fremde Kulturen gerade nicht, wenn man nicht zumindest zu verstehen versucht, welche Grundvorstellungen ihre Angehörigen dazu veranlassen, einander als vorbildlich oder weniger vorbildlich, als näher- oder fernerstehend zu betrachten. Ein pluralistischer Begriff von „kultureller Identität“ kann überhaupt nichts anderes bedeuten als die interkulturelle Anerkennung 17 So spricht Kant im Mutmaßlichen Anfang der Menschengeschichte, a.a.O., A 24, vom Ziel einer „vollendeten Kultur“, zu der dann ein „immerwährender Friede“ gehören würde. 18 Vgl. dazu H. Maier: Natur und Kultur, in: ders.: Eine Kultur oder viele? Politische Essays, Stuttgart 1995, 9-34, insbes. 26 ff. 19 O. Spengler: Der Untergang des Abendlandes, München 1980 6, 28 f. 20 E. Gellner: Pflug, Schwert und Buch. Grundlinien der Menschheitsgeschichte, München 1993, 13. 174 einer Vielfalt solcher intrakulturell anerkannter Einheitsprinzipien. Und eben solche Maßstäbe und Verhaltensmuster sind es, an denen sich das Gesetz in seiner konstitutiven Funktion, die Störung des als richtig anerkannten gesellschaftlichen Zusammenlebens zu beheben und zu verhindern, ausrichtet. Die vorgesetzlichen Verhältnisse, die wir ohne Gesetze nicht erhalten hätten und die wir uns unabhängig von Gesetzen gar nicht vorstellen können, die aber trotzdem immer schon in Anspruch genommen werden, wenn Gesetze zur ihrem Schutz und ihrer Ausgestaltung erlassen werden, sind kulturelle Strukturen, insofern sie eine Homogenität in zentralen Überzeugungen und Lebensformen der die Rechtsordnung tragenden Gemeinschaft von Menschen voraussetzen und auch zum Ausdruck bringen.21 Wo der Wille einer konkreten geschichtlichen Gemeinschaft von Menschen, miteinander zusammenzuleben und eine Rechtsordnung nach innen durchzusetzen und nach außen zu verteidigen, fehlt oder entfällt, dort bricht auch das Recht und mit ihm der Maßstab der Rechtsverletzung und damit auch der Referentialität des Menschenrechtsdiskurses zusammen. Zugleich aber kann diese vorgesetzliche Homogenität vom Recht weder erzeugt noch in die Gesetze inhaltlich integriert werden. Es ist kein Unrecht, wenn Menschen zu der Überzeugung gelangen, daß sie nicht mehr zu der Gemeinschaft gehören, deren Ordnung bisher für sie galt und wenn sie darum beschließen, eine neue Gemeinschaft zu begründen oder als schon entstandene anzuerkennen. Andererseits kann man sich nicht einfach mit der Behauptung, man „gehöre nicht mehr dazu“, von einer gegebenen Rechtsordnung verabschieden. Die geschichtlich-kulturellen Voraussetzungen, die zur internationalen Anerkennung neuer Rechtsordnungen führen, sind notwendigerweise umstritten. Der Menschenrechtsgedanke ist nicht stark genug, sie selbst noch einmal in Als („relative“) Homogenität definiert E.-W. Böckenförde: Demokratie als Verfassungsprinzip, in: ders.: Staat, Verfassung, Demokratie. Studien zur Verfassungstheorie und zum Verfassungsrecht, Frankfurt a.M. 1991, 348 f., einen „sozialpsychologischen Zustand, in welchem die vorhandenen politischen, ökonomischen, sozialen, auch kulturellen Gegensätzlichkeiten und Interessen durch ein gemeinsames Wir-Bewußtsein, einen sich aktualisierenden Gemeinschaftswillen gebunden erscheinen (...). Soweit relative Homogenität vorhanden ist, vermag sie eine Vielzahl von Spannungen und Unterschieden zu verarbeiten und übergreifend auszuhalten, grenzt sich allerdings von dem ihr Fremden deutlich ab. Im wesentlichen ist sie gleichbedeutend mit der vorrechtlichen Gleichartigkeit als der metarechtlichen Grundlage der demokratischen Gleichheit.“ 21 175 Anwendungsfälle einer Rechtsordnung zu transformieren, denn in ihnen stehen umgekehrt seine Grundlagen zur historischen Disposition. Will er sich gegen diese historische Kontingenz Geltung und Unabhängigkeit bewahren, dann muß er – unter der Bedingung, daß der aufklärerischuniversalistische Kulturbegriff durch den pluralistischen verdrängt und gegen oder neben diesem nicht einfach zurückzugewinnen ist – eine eigene geschichtsübergreifende Basis in Anspruch nehmen, die mit dem Kulturbegriff in seiner pluralistischen Fassung ihrerseits nicht mehr zu vereinbaren ist. Nur wenn es eine Art vorrechtlicher, aber nicht mehr kulturell definierter Homogenität der Menschheit als ganzer gibt, dann kann der Menschenrechtsgedanke auch noch beanspruchen, den Vorgängen rechtliche Grenzen zu ziehen, die zur Bildung neuer staatlicher Gemeinschaften auf der Welt führen. In dieser Begrenzungsfunktion des Rechtsdiskurses gegen die Implikationen des nicht mehr universalistisch gefaßten Kulturbegriffs gründet die immer noch existente Verpflichtung des Menschenrechtsgedankens gegenüber der Naturrechtsidee. Aristoteles hat diese Verknüpfung zwischen innergemeinschaftlicher und allgemeinmenschlicher Homogenität auf den Begriff des „guten Lebens“ gebracht, indem er definierte, daß „der Staat keine Gemeinschaft (...) nur zum Schutze wider gegenseitige Beeinträchtigungen und zur Pflege des Tauschverkehrs ist, sondern daß dies zwar da sein muß, wenn ein Staat vorhanden sein soll, daß aber, auch wenn es alles da ist, noch kein Staat vorhanden ist, sondern als solcher erst zu gelten hat: die Gemeinschaft in einem guten Leben (...) zum Zwecke eines vollkommenen und sich selbst genügenden Daseins“22. Diese Bestimmung macht nicht unbedingt die Annahme einer invarianten „Natur des Menschen“ notwendig, auch wenn Aristoteles selbst von einer solchen ausgegangen sein mag. Meine Gemeinschaft kann die Lebensformen und Überzeugungen, in denen sich die Auffassung einer anderen Gemeinschaft vom „guten Leben“ ausdrückt, auch dann akzeptieren, wenn sie sich von den unsrigen unterscheiden, solange sie nur den einen grundlegenden proportionalen Anerkennungsakt zu leisten fähig ist: der anderen Gemeinschaft zuzugestehen, daß für sie die ihrigen 22 Aristoteles: Politik, in: Philosophische Schriften, Bd. 4, übersetzt von E. Rolfes, Darmstadt 1995, 1280 b. 176 Vorstellungen vom guten Leben eine entsprechende Bedeutung haben wie für uns die unsrigen und daß diese Bedeutung eine Verständigungsgrundlage bietet. Verständnis für und Verständigung über die Gemeinschaft aller Menschen ist mit unaufhebbarer kultureller Pluralität vereinbar. In diesem Leitfaden läßt sich die neuere Diskussion des Aristotelischen Gedankens, ausgehend spätestens von Hegel23 und von ihm her über Autoren wie Joachim Ritter24 und Leo Strauss25 bis zu der sehr kritischen Aristoteles-Interpretation von Alasdair MacIntyre26, bündeln. Die Abhängigkeit des Gedankens einer grundsätzlichen Einheit der Menschheit von kultureller Homogenität kann durchaus zugestanden werden, wenn man die Offenheit kulturell homogener Gemeinschaften gegen die Pluralität möglicher Konkretisierungsweisen der humanen Homogenität voraussetzt; und gerade im Ringen um diese Offenheit entfaltet der Menschenrechtsgedanke dann seine kulturübergreifende Bedeutung auch auf dem Feld, auf dem die nichtgesetzlichen, konkretgeschichtlichen Grundlagen des Gesetzes sich bilden. In eben diese ohnehin schon komplizierte Verknüpfung zwischen vorgesetzlicher Homogenität und übergesetzlichem Legitimationsanspruch einer geschichtlich gewachsenen und immer auch Hegels Analyse der „alten Welt“ als derjenigen, in der das Selbstbewußtsein noch nicht zur Abstraktion der Subjektivität gekommen sei, in der Rechtsphilosophie (G. W. F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts, in: Werke, Bd. 7, Frankfurt a.M. 1986), § 279 Anm., vgl. § 356, kann man als Markierung eben des Übergangs von der Identifikation humaner Homogenität mit der der eigenen Gemeinschaft zur Anerkennung einer Pluralität von Wahmehmungsweisen jenes einen menschheitlichen Verpflichtungszusammenhanges lesen, ohne den auch nach Hegel die Einheit staatlichen Rechts nicht legitimierbar ist. 24 Vgl. J. Ritter: „Naturrecht” bei Aristoteles. Zum Problem einer Erneuerung des Naturrechts, Stuttgart 1961, 21, 32 ff., wonach die Verbindung zwischen dem Lebensfeld der Polis und der politischen Theorie gerade durch die moderne Entzweiung zwischen menschlicher Bedürfnis- und Sozialnatur zerrissen worden sei. Zugleich geht Ritter von der universalen, d.h. im Hegelschen Sinne substanziellen Bedeutung derjenigen griechischen Polis aus, auf welche die Theorie des Aristoteles geschichtlich und kulturell relativ war, vgl. J. Ritter: Metaphysik und Politik. Studien zu Aristoteles und Hegel, Frankfurt a.M. 1969, 102 ff. 25 L. Strauss: Naturrecht und Geschichte, Frankfurt a.M. 1989, vgl. 155 ff., 162 ff., hebt insbesondere auf das in der Platonischen und Aristotelischen Ethik aufgebaute Spannungsverhältnis zwischen der notwendigen Einbindung des Bürgers in die Gemeinschaft (vgl. 157: die „offensichtliche Abhängigkeit des philosophischen Lebens von der Polis“) und seiner gemeinschaftstranszendierenden Vollendung im Philosophieren ab. 26 A. MacIntyre: Geschichte der Ethik im Überblick, Königstein i. T. 1984, Kap. 7 und 8. 23 177 kulturell geprägten Rechtsordnung schiebt sich nun die Veränderung, vor deren Hintergrund die Frage nach „kultureller Identität“ sich erst in ihrer wirklichen Brisanz stellt. Man kann diese Veränderung als die Tendenz zur kulturellen Enthomogenisierung bezeichnen, die zwar heute noch vor allem die westlichen Industriegesellschaften betrifft, sich aber durch weltweite Wanderungs-, Modernisierungs- und Medienentwicklungen zu einem globalen Phänomen zu wandeln scheint. Es ist fraglich, ob unsere bislang vollzogene Rekonstruktion des Verhältnisses von Menschenrecht und kultureller Identität zur Bewältigung dieser Veränderungstendenz genügt. Dies zeigt sich schnell, wenn wir das Fazit aus den bisher gewonnenen Ergebnissen ziehen. Wie kann und muß kulturelle Identität aufgrund der Eigenart des Menschenrechtsdiskurses in diesen einbezogen werden? Die Antwort lautet: So wie es schon der Fall ist! Die Freiheit des religiösen Bekenntnisses, der Erziehung seiner Kinder, der Gestaltung der kulturell geprägten Umwelt, der Respekt vor der Sprache und dem Brauchtum, all das sind Güter, die jenseits jeglicher Reflexion über kulturelle Identität bereits durch die bürgerlichen Freiheitsgewährleistungen und die Grundgebote der staatsbürgerlichen Gleichheit (insbesondere also Diskriminierungs- und Willkürverbot) gesichert sind – sofern der Staat diese ernst nimmt. Umgekehrt lassen sich Verletzungen der grundlegenden Schutzgüter kultureller Identität weitgehend als Verletzungen individueller Menschenrechte und der Gleichheitsgebote rekonstruieren. Es ist kaum zu sehen, inwiefern durch die Ausformung eines „Menschenrechts auf kulturelle Identität“ hier zur Schutzaufgabe und zu den Grundinhalten der Menschenrechte noch etwas Wesentliches hinzugefügt werden könnte. Die einzige Ausnahme bietet der Bereich, in dem die angeführten geschichtlichen Wandlungen sich abspielen, die zur Veränderung der konkreten Gemeinschaften führen, von denen eine rechtliche Ordnung getragen werden muß. Wo es zwischen Menschen innerhalb eines existierenden Staates strittig ist, ob sie noch eine zusammengehörige Gemeinschaft bilden, wo also die Bewußtseinsbildung über die zugrundeliegende kulturelle Realität selbst ein entscheidender Faktor der Gestaltung dieser Realität ist, dort kann das intransigente Festhalten an Freiheits- und Gleichheitsgewährleistungen ein indirektes Mittel der Unterdrückung personaler Entfaltung von Individuen darstellen. Die für alle Staatsbürger „gleiche“ Versorgung mit den Erziehungs- und Bildungsmaßstäben einer herrschenden, aber eben doch partikulären Mehrheitsbevölkerung kann gerade gegen die kulturell 178 geprägten Elemente des Selbstverständnisses einer Minderheit verstoßen, die sich aus dem von der Mehrheit beherrschten Staat zu emanzipieren im Begriff ist. Gleichheit der Behandlung aller Staatsbürger wird dann zum formalistisch-ideologischen Vorwand für die Verweigerung der Chance einer Minderheit, sich über ihre mögliche Sezession aus dem Staatsverband ein eigenes Bewußtsein zu bilden. Auf dem hier angesprochenen Gebiet des Schutzes von nationalen Minderheiten und Volksgruppen sind Anstrengungen erforderlich, die über den sonstigen Standard der Gewährleistung und Positivierung bürgerlicher und sozialer Grundrechte hinausgehen, etwa was regionale Selbstverwaltung, den Schutz der Sprache einer nationalen Minderheit im Erziehungs- und Justizbereich angeht usw. Aber es wäre auf eine nicht ungefährliche Weise irreführend, diese Bereiche unter dem Gesamttitel eines „Menschenrechts auf kulturelle Identität“ zusammenfassen zu wollen. Denn die Rechte, die ein Mensch aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe oder nationalen Minderheit beanspruchen kann, entstammen ein und derselben Quelle wie seine bürgerlichen Freiheitsund Gleichheitsansprüche. „Das Volk“ ist also keinesfalls eine zusätzliche Rechts- oder Legitimationsquelle staatlicher Macht neben der individuellen Person. Daß wir trotzdem von „Volks-“ oder „Volksgruppenrechten“ sprechen, ergibt sich aus der Einsicht, daß bestimmte Bedrohungen der Rechte der Menschen gar nicht von ihnen selbst, sondern nur von der politischen Gemeinschaft, zu der sie gehören, abgewehrt werden können. Der Krieg, die Drohung mit Krieg, internationale Erpressung, aber eben auch die soziale Diskriminierung einer Gruppe aufgrund ihrer kulturell geprägten Eigenart, betreffen die Person als Rechtsträger unter Umständen genauso zentral oder noch gravierender als der rein individuelle Menschenrechtsverstoß. Und nur insofern ihre Gemeinschaftsgebundenheit hier Ursache und Grundlage ihrer Bedrohung ist, konkretisiert sich der Respekt vor der Person als Schutz ihrer gemeinschaftlichen Identität. Man kann insofern sagen, daß kulturelle Identität ein transitorischer Gesichtspunkt ist, der im Menschenrechtsdiskurs genau dann zur Geltung gebracht werden muß, wenn die Gewährleistung der universalen Menschenrechte einer bestimmten Gruppe von Menschen eben wegen ihrer kulturellen Eigenart ganz oder teilweise verweigert wird und der darauf abzielt, das Diskriminierungs- und Willkürverbot im Verhältnis zwischen Staat und 179 allen Bürgern umfassend durchzusetzen.27 Die Verpflichtungsquelle selbst, die dem Staat diesen Respekt gebietet, bleibt aber die menschliche Person mit ihrem Anspruch auf gleiches Recht und gleiche Würde. Es ist gerade nicht ihre kulturelle Prägung, sondern deren fälschliche Inanspruchnahme, wodurch sich eine Verknüpfung zwischen den Rechten und der gemeinschaftlichen Identität einer Person konstituiert. Unser Fazit lautet somit, daß der Begriff der „kulturellen Identität“ jener Veränderung, die sich durch den Prozeß der kulturellen Enthomogenisierung geschichtlich gewachsener Gemeinschaften abzeichnet, jedenfalls dann nicht gerecht wird, wenn man ihn unmittelbar innerhalb des Menschenrechtsdiskurses als eine diesen ergänzende und wesentlich mitge-staltende Kategorie zur Geltung zu bringen versucht. Wenn wir von der Funktion des Menschenrechtsbegriffs als legitimatorischer Rückbindung staatlicher Gewalt an vorgesetzliche interpersonale Verhältnisse ausgehen, dann ist mit dem Einbezug des Aspekts der kulturellen Identität in die Menschenrechtsforderungen gerade deshalb nicht viel zu gewinnen, weil die vorgesetzlichen Verhältnisse eben wesentlich kulturelle Verhältnisse sind und der Schutz der menschlichen Person seit jeher unausdrücklich mit dem Schutz ihrer kulturellen Identität weitgehend identisch gewesen ist. Wenn man daher schon glaubt, Recht und kulturelle Identität einer neuen, bisher nicht realisierten Zuordnung zuführen zu müssen, dann muß man bereit sein, den Menschenrechtsbegriff selbst in Frage zu stellen und also das gesamte Beziehungsgefüge, von dem unsere bisherigen Erörterungen ausgegangen waren, zu problematisieren. Eine rechtlich relevante Eigenbedeutung gegenüber der Menschenrechtsidee kann der Kulturbegriff nur gewinnen, wenn er dazu anhebt, den aus seinem eigenen Anwendungsfeld verdrängten aufklärerischen Universalismus auch noch aus der Domäne zu vertreiben, in welche ihn der Menschenrechtsbegriff transformiert hat. In diesem Sinne wäre darum nunmehr radikal zu fragen: Ändert sich mit dem Übergang zu einer kulturell nicht mehr homogenen Gesellschaft, also zu einer Gesellschaft, die ihre Identität nicht mehr im Ausgang von einer ihr zugrundeliegenden gemeinschaftlichen Einheit, sondern eher aus einem Geschehen der gegenseitigen Anerkennung einer Pluralität 27 Das ist genau die Funktion, die E. Mack: Sind Frauenrechte Menschenrechte? Ihre Bedeutung in einem interkulturellen Dialog, a.a.O., dem Begriff der „Frauenrechte“ in ihrem Verhältnis zu den Menschenrechten zuweist. 180 nebeneinanderstehender kultureller Identitäten findet, die Grundlage des rechtlichen Diskurses? Anders gefragt: Wenn einerseits nur relativ auf bestehende vorgesetzliche Maßstäbe des Zusammenlebens das Unrecht identifizierbar ist, an dem der Rechtsdiskurs sein Maß zu nehmen hat, und wenn andererseits diese vorgesetzlichen Maßstäbe sich dergestalt zu wandeln im Begriff sind, daß multikulturelle Vielfalt an die Stelle geschichtlich gewachsener Homogenität tritt – muß dann nicht auch unser Begriff vom Unrecht zwangsläufig ein „toleranter“, d.h. auf die Überzeugungen der ihm unterworfenen Gesellschaftsmitglieder relativer Be-griff werden? Und muß dann aber nicht auch die im Menschenrechtsbe-griff implizierte Annahme universal anwendbarer Maßstäbe für staatliches Unrecht fallengelassen und zur Disposition eines gegenseitigen interkulturellen Anerkennungsgeschehens gestellt werden, das sich auf eine noch schwer zu definierende Weise durch die politischen Strukturen nationaler und internationaler Rechtssetzung hindurch abspielt? Auf diese Fragen ist eindeutig verneinend zu antworten, womit man freilich die Spannung zwischen universalistischem Menschenrechts- und pluralistischem Kulturkonzept auch nicht löst, sondern nur vollends deutlich macht. Die wesentlichen Argumente für die verneinende Antwort sind die folgenden: l. Wir haben bisher vorausgesetzt, daß der Prozeß der gegenseitigen Anerkennung kultureller Identität innerhalb unserer Gesellschaften und auch im Verhältnis zwischen unserer und anderen Gesellschaften sich nicht einfach naturwüchsig vollzieht, sondern daß er sich rational rechtfertigen läßt und zumindest in Einklang mit unseren Vorstellungen von Recht und Unrecht zwischen Menschen steht. Woher nehmen wir eigentlich diese Überzeugung? Wodurch also ist die Forderung nach pluralistischer Anerkennung einer Vielfalt von kulturellen Verhaltensmustern, nach kultureller Toleranz begründet? Wenn alle unsere Vorstellungen vom richtigen Zusammenleben allein auf unsere – im pluralistischen Sinne – „kulturelle“ Prägung zurückgingen, dann müßten wir auch die Forderung nach kultureller Toleranz noch als kulturrelativ und damit im Notfall aufgebbar ansehen. Dann müßten wir anderen Kräften zugestehen, daß es „für sie“ richtig sein mag, wenn sie gegen kulturelle Toleranz sind und kulturelle Pluralität auszurotten versuchen. Diesen absurden Selbstwiderspruch kann man nur vermeiden, wenn man auf die Frage nach dem Grund der kulturellen Toleranz eine universalistische Antwort gibt: Wir haben die kulturelle Identität anderer 181 Menschen zu respektieren, weil diese Menschen als Personen dieselbe Würde und das gleiche Recht haben wie wir. Es ist eben nicht ihre Kultur als solche, die wir ja auch dann respektieren wollen, wenn wir sie eingestandenermaßen nicht wirklich verstehen, sondern es ist ihre Freiheit und Gleichheit im Verhältnis zu uns, die wir uns anzuerkennen genötigt sehen. Die Kultur für wichtiger zu erklären als den lebenden Menschen: das wäre der eigentliche „Kulturimperialismus“. Unsere Wertschätzung und Kenntnis fremder Identität mögen wir unserer Kultur verdanken; aber die Überzeugung von der Richtigkeit und rationalen Begründbarkeit solcher Wertschätzung und Kenntnis verdanken wir jenem universalistischen Diskurs, dessen rechtliche Grundbedeutung der Menschenrechtsgedanke zu explizieren versucht. 2. Auch und gerade wenn man keinen strikt universalistischen Kulturbegriff vertritt, muß man doch von bestimmten gemeinsamen Kriterien ausgehen, die eine menschliche Gemeinschaft erfüllen muß, wenn man ihr eine eigene kulturelle Identität zubilligen können soll. Nicht jedes Anderssein als solches ist gleich eine kulturelle Differenz. Denn sonst könnte jeder Verstoß gegen die Würde menschlicher Personen damit gerechtfertigt werden, daß der Täter erklärt, sein Umgang mit dem Opfer entspräche nun einmal seinem kulturellen Selbstverständnis und müsse deshalb respektiert werden. Für die Beurteilung der Frage, wann das Verhalten von Männern gegenüber Frauen einen Akt würdeverletzender sexueller Belästigung darstellt, kann die kulturelle Identität der Beteiligten durchaus unter verschiedenen Aspekten eine Rolle spielen, aber gewiß nicht in der Weise, daß den sexuellen Belästigern der Status einer eigenen kulturellen Gemeinschaft zugebilligt wird, deren Praktiken und Bedürfnisse nun einmal zu respektieren seien. Die „Unabhängigkeit von eines anderen nötigender Willkür“28 schützt uns auch vor willkürlicher Usurpation des Kulturbegriffs, aber eben deshalb kann sie nur durch einen kulturübergreifenden Begriff des Rechts gesichert werden, wonach jeder Mensch frei entscheiden können muß, ob er die Lebensformen eines anderen mit diesem zu teilen bereit ist oder nicht. 28 Kants Definition des Menschenrechts in der Metaphysik der Sitten, Rechtslehre, Einteilung, B 45, a.a.O. 182 3. Judith N. Shklar hat in ihrem Buch „Über Ungerechtigkeit“29 die Bedeutung herausgestellt, die für die Feststellung von Unrecht der Perspektive der von ihm betroffenen Opfer zukommt. Nicht alles Unrecht, für das ich Verantwortung zu übernehmen habe, beruht auf meinem vorangegangenen aktiven Tun. Es gibt auch „passives Unrecht“, und zwar dann, wenn ich aus Feigheit oder Bequemlichkeit gesellschaftliche Mißstände wie z.B. Korruption oder Behördenwillkür, solange sie mir selbst nicht schaden, hinnehme und zulasse, daß durch sie die berechtigten Erwartungen anderer Menschen enttäuscht werden. Eine Gesellschaft, in der diese Art von Gleichgültigkeit gegenüber dem Unrechtsbewußtsein der potentiellen Opfer herrscht, kann auf Dauer nicht bestehen. Aber andererseits kommen wir auch nicht um die Beurteilung der Frage herum, wann Unrechtsbewußtsein berechtigt ist und wann nicht; denn sonst könnten wir zwischen dem Unglück, das jemandem zustößt, und dem Unrecht, das ihm zugefügt wird, nicht mehr unterscheiden. Es bliebe seiner Willkür unterlassen, was er als Unglück und was als Ungerechtigkeit empfindet. Diese Willkür würde sich aber ebenso einstellen, wenn wir von der völligen Kulturrelativität des Unrechtsbewußtseins und damit auch der genannten Grenze zwischen Unrecht und Unglück ausgingen. Dann wäre unsere Bereitschaft, für gesellschaftliche Zustände, durch die andere sich benachteiligt fühlen, Verantwortung zu übernehmen, einfach deshalb irrelevant, weil das einzige Maß für die Beantwortung der Frage, welche gesellschaftlichen Zustände denn nun wirklich als ungerecht anzusehen seien, durch unser eigenes Unrechtsbewußtsein definiert würde. Die Bereitschaft, die genuine Perspektive der Opfer ungerechter gesellschaftlicher Verhältnisse gelten zu lassen, verliert ihren Wert, wenn die Definition, wer Opfer ist, in die Willkür der Gesellschaftsmitglieder gestellt wird. Dann besteht das Unglück benachteiligter Gruppen eben da-rin, daß ihre Angehörigen mit einem nur ihnen selbst nachvollziehbaren Unrechtsbewußtsein ausgestattet sind, und für dieses Unglück trägt man keine Verantwortung. Vor solcher Willkür kann wiederum nur eine Rechtsordnung schützen, bei deren Gestaltung das Unrechtsbewußtsein aller Mitglieder der Gesellschaft zu einem gerechten Ausgleich und in ein sie gegenseitig verpflichtendes Gesamtverhältnis gebracht wird. Hier, auf dem Feld der gesetzgeberischen Auseinandersetzung um die adäquate 29 J. N. Shklar: Über Ungerechtigkeit. Erkundungen zu einem moralischen Gefühl, New Haven/London 1990, deutsch Berlin 1992, vgl. insbes. 69 ff., 135 ff. 183 gesetzliche Umsetzung der durch die Lebensformen der Gesellschaftsmitglieder vorgegebenen zwischenmenschlichen Beziehungen und Verhältnisse, muß die Kompromißleistung erbracht werden, auf der alle innergesellschaftliche Toleranz schließlich erst aufbauen kann.30 Die Grenzlinie zwischen Opfer, Täter und Neutralem muß zwar in einem offenen, von Toleranz getragenen gesellschaftlichen Rechtsfindungsprozeß gefunden werden, dann aber in Form unverrückbarer gesetzlicher Ordnung jeglicher Willkür entzogen bleiben. Nur unter dieser Voraussetzung kann dann wieder im demokratischen Staat um die Veränderung dieser Grenzlinie geworben und gerungen werden. Diese Argumente machen es unmöglich, das Gebot des Respekts vor kultureller Identität gegen die Forderung einer auf eindeutig identifizierbarem Unrecht beruhenden Gesetzesordnung und damit auch gegen die Fundierung des Verhältnisses von Gesetz und Recht im Gedanken der unrelativierbaren Menschenrechte auszuspielen. Die Kompetenz zum kulturübergreifenden Rechtsdiskurs ist ihrerseits eine Bedingung der Rationalität von Diskursen, innerhalb derer sich Menschen über ein Nebeneinander von Lebensformen verständigen, das sich innerhalb der durch die Rechtsordnung zugelassenen Toleranzgrenzen abspielen kann. Insofern ist Jürgen Habermas zuzustimmen, wenn er in der „Multikulturalismus“-Diskussion mit Charles Taylor festhält, daß die Verpflichtung gegenüber der kulturellen Identität anderer Menschen „aus Rechtsan-sprüchen und keineswegs aus einer allgemeinen Wertschätzung der jeweiligen Kultur“31 folgt und daß der kulturelle Kontext, aus dem die Rechtsordnung einer Gemeinschaft hervorgegangen ist, der unaufgebbare Horizont bleibt, „innerhalb dessen die Staatsbürger, ob sie es wollen oder nicht, ihre ethisch-politischen Selbstverständigungsdiskurse führen“32. Die kulturell differenzierten Selbstverständigungsdiskurse innerhalb einer Gesellschaft müssen respektiert werden, aber weder ihre Ergebnisse noch ihre Erhaltungs- und 30 Weshalb der formale Wert der Toleranz auch nicht die inhaltliche Auseinandersetzung um Menschenrechte und Gerechtigkeit ersetzen kann; vgl. dazu meine Kritik: Toleranz: legitim oder legitimierend?; zu W. Becker: Toleranz als Grundwert der Demokratie, in: Ethik und Sozialwissenschaften. Streitforum für Erwägungskultur, 8, 1997, Heft 4, 457-460. 31 J. Habermas: Anerkennungskämpfe im demokratischen Rechtsstaat, in: C. Taylor: Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung, Princeton 1992, 147 ff., hier 172 f. 32 Ebd., 169. 184 Gelingensbedingungen können ein Begrenzungsprinzip des rechtlichen Diskurses bilden. Auch der Respekt vor fremder kultureller Identität ist zuletzt Ausdruck unserer Überzeugungen von Menschenrecht und Menschenwürde. Das Fazit dieser Überlegungen muß darum lauten, daß „kulturelle Identität“ direkt überhaupt nicht zu den Menschenrechten in Beziehung gesetzt werden kann. Faßt man sie als eines der Menschenrechte auf, so bewegt man sich in einem bereits vom Rechtsdiskurs weitgehend bewältigten Bezirk und wiederholt eher das Problem, als daß man der Lösung näherkäme; führt man sie aber gegen den universalen, alle gesellschaftlichen Gruppen verpflichtenden Anspruch des rechtlichen Diskurses ins Feld, dann zerstört man die Rationalitätsbedingungen der eigenen Argumentationsbasis. Nichtsdestoweniger bleibt das Problem, das sich durch die „multikulturelle“ Enthomogenisierung rechtlich geordneter Gesellschaften stellt, bestehen. Die Spannung, die wir durch den begrifflichen Gegensatz zwischen Menschenrecht und kultureller Identität zu rekonstruieren versuchten, ist nicht aufgelöst. War unser Ergebnis insofern rein negativ? Ist der Begriff der „kulturellen Identität“ schlicht ungeeignet, möglicherweise sogar kontraproduktiv für ihre Aufarbeitung und müssen wir uns also nach einer gänzlich anderen Kategorie umsehen? Die kritischen Einwände, die vor allem Gregor Paul gegen den Begriff „kulturelle Identität“ erhoben hat,33 sind ernstzunehmen. Sobald man dieses Konzept normativ versteht und es zur Bezeichnung einer angeblich dem einzelnen vorgegebenen, durch Einsicht in den künftigen Gang der Geschichte feststellbaren Gemeinschaft einsetzt, ist seine totalitäre oder doch diktatorische Dynamik mit Händen zu greifen. Wer die Definitionsmacht für eine derartige zukunftswirksame kulturelle Identität beansprucht, reklamiert damit auch die Macht, den Bürgern seines Staates vorzugeben, wo und wie sie ihr Leben im Dienst an ihr zu führen haben. So gefaßt, ist der Begriff ein ideologisches Instrument, um die Wirklichkeit, aus der er sich rechtfertigt, erst durch nicht mehr zu rechtfertigende Faktenschaffung herbeizuführen. Aber diese diktatorische Dynamik teilt der Begriff mit vielen anderen, die, wie etwa der der Vgl. G. Paul: Universalität und Kritik: „Westliche Prinzipien”, in: W. Schweidler (Hrsg.): Menschenrechte und Gemeinsinn, a.a.O., 139-160, sowie G. Paul: Kulturelle Identität: ein gefährliches Phantom? Eine kritische Begriffsanalyse, in: T. Ogawa u. a. (Hrsg.): Philosophische Beiträge zum interkulturellen Gesprach, Berlin 1998. 33 185 „Nation“34, der „Gemeinschaft“ und durchaus auch der der „Gesellschaft“, doch unentbehrlich zur Kennzeichnung der vorgesetzlichen Grundlagen des Rechts sind. Ebenso wie bei diesen bleibt auch beim Begriff der „kulturellen Identität“ Raum für eine deskriptive, strikt retrospektiv orientierte Interpretation, die geschichtlich gewachsene Strukturen menschlichen Zusammenlebens und unaufgebbare Elemente des Selbstverständnisses personaler Individuen festhält, ohne die wir beispielsweise die Emanzipations- und Anerkennungskämpfe in multiethnischen Gemeinwesen oder zwischen den Angehörigen verschiedener Rassen nicht beschreiben könnten. Wiederum wäre es Ausdruck ideologisch verkappter Emanzipationsverweigerung, wenn wir uns den konkreten Benachteiligungserfahrungen, aber auch Beteiligungserwartungen von Menschen, die sich durch kulturelle Differenz zu einer Mehrheit oder einer Anzahl von ihnen verschiedener innergesellschaftlicher Gruppen wesentlich geprägt erfahren, durch Ignoranz gegenüber ihrer Selbstbeschreibung entziehen wollten. Insofern könnte die Zurückweisung der Kategorie der „kulturellen Identität“ ebenso diktatorische Implikationen haben wie ihre normative Überspitzung. Die Frage, wie wir unser Insistieren auf einer für alle Gesellschaftsmitglieder gültigen, auf eindeutig identifizierbaren Unrechtskriterien basierenden Rechtsordnung mit dem Bewußtsein der Relevanz kultureller Identitätsverschiebungen zu verbinden vermögen, läßt sich so nicht beiseite schieben. Der Ausweg aus der Einsicht, daß dieses Problem besteht und daß es gleichwohl nicht durch die direkte Konfrontation zwischen rechtlicher Zwangsordnung und kulturellem Selbstverständigungsdiskurs zu bewältigen ist, kann nur in dem Versuch bestehen, zu einer indirekten Zuordnung der beiden Seiten zu gelangen. Wenn der kulturelle Selbstverständigungsdiskurs ein Feld beschreibt, das für die rechtliche Gestaltung unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens von fundamentaler Bedeutung ist, von dem aus jedoch dieser rechtlichen Gestaltung keine aus sich selbst heraus legitimierbare Grenze gezogen werden kann, dann ergibt sich die Konsequenz, daß der indirekte Einbezug wesentlicher kultureller Identitätsverschiebungen nur in Form der verantwortlichen Selbstbe-grenzung des rechtlichen Diskurses 34 Vgl. dazu etwa R. Poole: Freedom, Citizenship, and National Identity, in: The Philosophical Forum, Vol. XXVIII, No. 1-2, 1996/97, 125-148, insbes. 137 ff. 186 legitim vollzogen werden kann und daß sich gerade in dieser Aufgabe eine der entscheidenden Erweiterungen der Funktion und Bedeutung des Menschenrechtsbegriffs vollziehen müssen wird. Wir können kulturelle Identität nicht zu einem Interpretationskriterium des Inhalts der Menschenrechte machen, aber wir müssen ihr in der Besinnung auf die Grenzen gerecht zu werden versuchen, die unserem Umgang mit dem Menschenrechtsbegriff als Gestaltungsprinzip der gesellschaftlichen Beziehungen gezogen sind. Das heißt: Die Verantwortung gegenüber den kulturellen Erhaltungsbedingungen unserer Rechtsordnung zeigt sich wesentlich in den sozialen Gestaltungsakten, in welchen wir auf die Implementierung des Menschenrechtsbegriffs und der mit ihm verbundenen Konsequenzen der Verrechtlichung zwischen-menschlicher Verhältnisse gerade verzichten. Wenn es der Sinn des Menschenrechtsgedankens ist, staatliche Macht sich durch die Begrenzung ihrer selbst gegenüber dem Anspruch des Individuums auf eigenverantwortliche Lebensführung legitimieren zu lassen, dann muß sich dieser Sinn auch noch in der Selbstanwendung des Gedankens zeigen. Als verfassungsmäßig konkretisierte Grundrechte sind die Menschenrechte selbst noch ein Teil der staatlichen Zwangsgesetzgebung. Bändigung staatlicher Macht und Begrenzung ihres eigenen Anspruchs fallen in diesem Bereich zusammen. In einem menschenrechtlich legitimierten Staat kann es keine Autorität geben, die über derjenigen stünde, welche für die Rückbindung aller staatlichen Gewalten an die Menschenrechte kompetent ist. Aber diese staatliche Gewalt übernimmt auch die Verantwortung für die Selbstbegrenzung der Grundrechte im Kontext der Gesamtgestaltung der menschlichen Verhältnisse, auf denen die staatliche Rechtsordnung beruht. Zu dieser Verantwortung gehört wesentlich die Einsicht, daß die natürlichen Näheverhältnisse, ohne die es keinen Zusammenhalt einer menschlichen Gemeinschaft gibt, nicht vollständig in rechtliche Zwangsregelungen transformiert werden können. Man kann im Kontext einer schon bestehenden Gemeinschaft soziale Verpflichtungen – wie etwa die Pflicht der Kinder, ihre Eltern zu pflegen, die Treuepflicht der Ehegatten oder die Solidarität zwischen den Regionen des eigenen Landes – durch die umfassende Ausdehnung des gesetzlichen Anspruchsgefüges regeln, steuern, konservieren, wohl auch weitgehend ersetzen. Aber man muß dazu individuelle Vorteilserwartungen mobilisieren, die mit jenen ursprünglichen Nähebeziehungen nichts mehr zu tun haben, auf welchen nicht nur die so kompensierten Verpflichtungen, sondern auch die Identität der Gemein187 schaft, die die kompensierende Rechtsordnung trägt, beruhten. Die Menschenrechte gefährden ihre eigene Grundlage, wenn sie zum Prinzip der Kompensation jener geschichtlich geprägten gemeinschaftlichen Identität werden, die doch die rechtlich nicht mehr einholbare Basis der Beziehungen bildet, ohne die es eine die Menschenrechte konkretisierende gesetzliche Ordnung nicht geben kann. Nicht der Gegensatz zwischen dem „Guten“ und dem „Gerechten“ steht hinter dem Spannungsverhältnis zwischen rechtlichem und kulturellem Diskurs, wohl aber ein zwischenmenschliches Anspruchsgefüge, das im Recht immer schon vorausgesetzt wird und das in der Tat einer eigentlich „ungerechten“ Ordnung entstammt, nämlich der Ordnung der Nähe, durch die ein Mensch einem anderen in einer Weise verpflichtet wird, die sich geschichtlicher und sozialer Kontingenz verdankt und letztlich eine Ordnung des Glücks ist. Eine gerechte Gesellschaft und Rechtsordnung kann es nur geben auf der Basis einer sie tragenden Gemeinschaft, die ihren Halt in demjenigen findet, was ein Mensch nur für die Seinigen und niemals für alle tut. Charles Taylor hat in der Diskussion mit Habermas darauf hingewiesen, daß hierin der eigentliche Sinn der vielbeschworenen Verantwortung für die „künftigen Generationen“ besteht. „In multikulturellen Gesellschaften bedeutet“, so Habermas, „die gleichberechtigte Koexistenz der Lebensformen für jeden Bürger eine gesicherte Chance, ungekränkt in einer kulturellen Herkunftswelt aufzuwachsen und seine Kinder darin aufwachsen zu lassen, die Chance, sich mit dieser Kultur auseinanderzusetzen, sie konventionell fortzusetzen oder sie zu transformieren (...)“.35 Damit ist präzise der Horizont bezeichnet, innerhalb dessen der rechtliche Diskurs auch das interkulturelle Zusammenleben regieren kann. Zu diesem aber gibt es einen nicht deckungsgleichen anderen Horizont, einen historischen Längsschnitt gewissermaßen, zu dem die Beziehung zu den gegenwärtig lebenden Menschen und ihrer Gesellschaft nur einen Querschnitt bildet. Taylor führt hier das Beispiel Quebec an, jene Politik der „survivance“, die das von jedem quebecianischen Gesetzgeber verfolgte Bemühen bezeichnet, die frankophone Prägung künftiger Generationen zu erhalten. Was diese Politik trägt, das sind nicht Rechtsbeziehungen, sondern etwas anderes. „Es geht hier nämlich“, so Taylor, 35 In: C. Taylor: Multikulturalismus, a.a.O., 175. 188 „nicht nur darum, das Französische für diejenigen verfügbar zu halten, die sich dafür entscheiden (...). Vielmehr will die Politik der survivance sicherstellen, daß es auch in Zukunft eine Gruppe von Menschen gibt, die von der Möglichkeit, die französische Sprache zu nutzen, tatsächlich Gebrauch macht. Diese Politik ist aktiv bestrebt, Angehörige dieser Gruppe zu erzeugen, indem sie zum Beispiel dafür sorgt, daß sich auch künftige Generationen als Frankophone identifizieren. Man kann nicht behaupten, daß eine solche Politik nur darauf aus sei, einer bestehenden Bevölkerung eine bestimmte Möglichkeit zu eröffnen.“36 Wo die derzeit lebende Generation sich über die Prägung der Lebensformen derjenigen Menschen verständigen muß, die sich ihr gegenüber nicht mehr zu dieser Prägung werden äußern können, dort kann uns der rechtliche Diskurs allein nicht mehr die Entscheidungen vorgeben. Dort ist er selbst auf das angewiesen, was er durch den Menschenrechtsbegriff der ihm tragenden Gemeinschaft abverlangt, nämlich freiwillige Machtbegrenzung. Und eben weil der Einsatz für die Realisierung der Menschenrechte die Grundform bildet, in der der rechtliche Diskurs dieses Verlangen gegenüber den ihn tragenden Verhältnissen durchsetzt, können die Menschenrechte nicht selbst noch einmal die letzte Verständigungsbasis der Selbstbegrenzung des rechtlichen Diskurses gegenüber kultureller Identität und ihrem Wandel sein. 36 Ebd., 52. 189