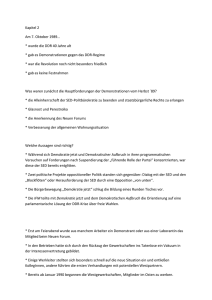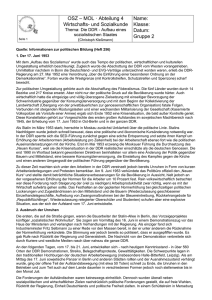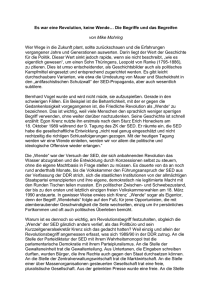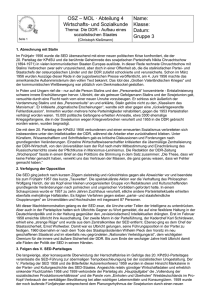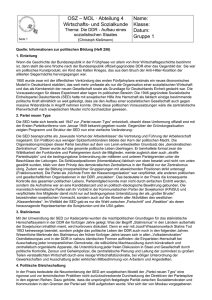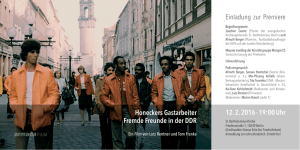Wandel durch Dialog – vor und nach dem Umbruch 1989/90
Werbung
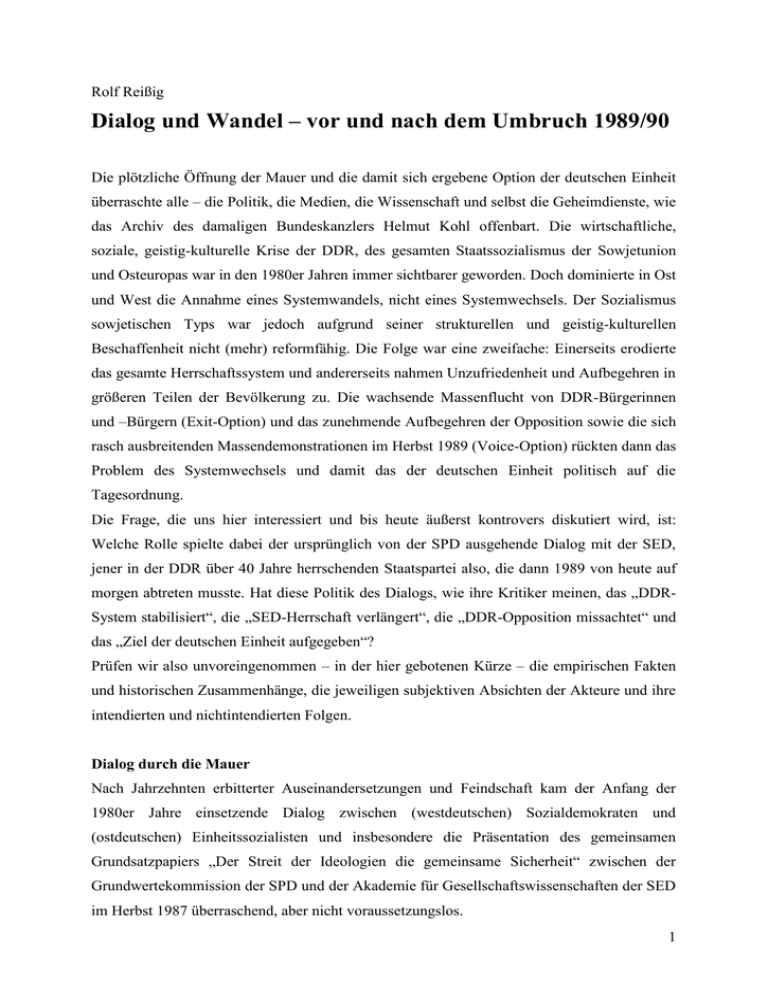
Rolf Reißig Dialog und Wandel – vor und nach dem Umbruch 1989/90 Die plötzliche Öffnung der Mauer und die damit sich ergebene Option der deutschen Einheit überraschte alle – die Politik, die Medien, die Wissenschaft und selbst die Geheimdienste, wie das Archiv des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl offenbart. Die wirtschaftliche, soziale, geistig-kulturelle Krise der DDR, des gesamten Staatssozialismus der Sowjetunion und Osteuropas war in den 1980er Jahren immer sichtbarer geworden. Doch dominierte in Ost und West die Annahme eines Systemwandels, nicht eines Systemwechsels. Der Sozialismus sowjetischen Typs war jedoch aufgrund seiner strukturellen und geistig-kulturellen Beschaffenheit nicht (mehr) reformfähig. Die Folge war eine zweifache: Einerseits erodierte das gesamte Herrschaftssystem und andererseits nahmen Unzufriedenheit und Aufbegehren in größeren Teilen der Bevölkerung zu. Die wachsende Massenflucht von DDR-Bürgerinnen und –Bürgern (Exit-Option) und das zunehmende Aufbegehren der Opposition sowie die sich rasch ausbreitenden Massendemonstrationen im Herbst 1989 (Voice-Option) rückten dann das Problem des Systemwechsels und damit das der deutschen Einheit politisch auf die Tagesordnung. Die Frage, die uns hier interessiert und bis heute äußerst kontrovers diskutiert wird, ist: Welche Rolle spielte dabei der ursprünglich von der SPD ausgehende Dialog mit der SED, jener in der DDR über 40 Jahre herrschenden Staatspartei also, die dann 1989 von heute auf morgen abtreten musste. Hat diese Politik des Dialogs, wie ihre Kritiker meinen, das „DDRSystem stabilisiert“, die „SED-Herrschaft verlängert“, die „DDR-Opposition missachtet“ und das „Ziel der deutschen Einheit aufgegeben“? Prüfen wir also unvoreingenommen – in der hier gebotenen Kürze – die empirischen Fakten und historischen Zusammenhänge, die jeweiligen subjektiven Absichten der Akteure und ihre intendierten und nichtintendierten Folgen. Dialog durch die Mauer Nach Jahrzehnten erbitterter Auseinandersetzungen und Feindschaft kam der Anfang der 1980er Jahre einsetzende Dialog zwischen (westdeutschen) Sozialdemokraten und (ostdeutschen) Einheitssozialisten und insbesondere die Präsentation des gemeinsamen Grundsatzpapiers „Der Streit der Ideologien die gemeinsame Sicherheit“ zwischen der Grundwertekommission der SPD und der Akademie für Gesellschaftswissenschaften der SED im Herbst 1987 überraschend, aber nicht voraussetzungslos. 1 Das scheinbar Unmögliche war möglich geworden – weil es fußte bzw. sich orientierte an der schon vordem entwickelten und praktizierten „Neuen Ostpolitik“ Willy Brandts und Egon Bahrs mit ihren Leitideen „Gemeinsame Sicherheit“ und „Wandel durch Annäherung“ sowie den dabei geschaffenen Tatbeständen (Verträge mit Moskau, Warschau, deutsch-deutscher Grundlagenvertrag) und gewonnenen Erfahrungen im Ringen um eine Entschärfung des OstWest-Konflikts durch Vertrauensbildung und Kooperation. Das Unmögliche war möglich und notwendig geworden, weil die Ost-West-Entspannung seit Ende der 1970er Jahre in die Krise geraten war und sich zugleich menschheitsgefährdende Konflikte herausbildeten – das forcierte atomare Wettrüsten zwischen Ost und West und die Gefahr des Umschlagens in eine atomare Auseinandersetzung , der Nord-Süd-Konflikt und nicht zuletzt der Umweltkonflikt. In einer solch zugespitzten historischen Situation musste geprüft werden, ob und wie hier zwischen Ost und West gemeinsame oder parallele Interessen bestehen und eine kooperative Bearbeitung dieser globalen und auch deutsch-deutschen Konflikte möglich wird. Die erste Initiative zu solchen Gesprächen zwischen SPD und SED Anfang der 1980er Jahre ging übrigens – was öffentlich und auch in beiden Parteien nie publik wurde – von Willy Brandt aus, der diese in einem persönlichen Brief an den Generalsekretär der SED Honecker vorschlug (Reißig, 2002, S. 29f.). In den folgenden Gesprächen zwischen SPD- und SEDPolitikern ging es um Fragen des Abbaus der militärischen Spannungen und der praktischen Verbesserungen der Ost-West-Beziehungen sowie der Situation der Menschen im geteilten Land. Ideologiegespräche, ein Dialog von west- und ostdeutschen Intellektuellen war beiderseits jedoch nicht vorgesehen. Die Idee dazu wurde zunächst in privaten Gesprächen zwischen dem damaligen Vorsitzenden der Grundwertekommission der SPD Erhard Eppler und einem Leipziger Philosophieprofessor geboren. Von Letzterem kam dann der direkte Vorschlag für solche Treffen zwischen Ost-West-Intellektuellen. Daraus wurden in der Folgezeit von 1984-1989 die acht Dialogrunden zwischen der Grundwertekommission der SPD und Wissenschaftlern der Akademie für Gesellschaftswissenschaften der SED sowie weiteren Institutionen, Universitäten und Hochschulen der DDR (ebd., S. 46-71). Genau genommen war dies im Vergleich zu den üblichen deutsch-deutschen Kontakten und auch SPD-SED-Gesprächen ein Sonderfall. Das betraf nicht nur die Akteure (Intellektuelle), die Formen (mehrere Tage, Dialog als offener und gemeinsamer Such- und Lernprozess, Öffentlichkeit durch Teilnahme west- und ostdeutscher Medienvertreter, gemeinsame Grundsatzerklärung) sondern vor allem auch die Inhalte. Gegenstand und Inhalt dieses Dialogs waren nicht die üblichen „kleinen“ (dringend notwendigen) Schritte der Deutschlandpolitik, sondern die „großen“ ideologisch-politischen Streitfragen des Ost-West2 Konflikts. Was ansonsten in den SPD-SED-Gesprächen und deutsch-deutschen Verhandlungen bewusst ausgeklammert blieb, weil es die beiden Seiten seit jeher voneinander trennte, Kompromisse in den anstehenden Sachfragen verhinderte und daher eher als störend empfunden wurde, stand hier nun im Mittelpunkt: Frieden, Fortschritt, Arbeit, Demokratie, Menschenrechte und gesellschaftlicher Wandel in Ost und West. Was sich hier vollzog, war das, was man den ersten systemübergreifenden Dialog nennen kann. Das wichtigste, zunächst gar nicht vorgesehene Ergebnis war das oben genannte gemeinsame Grundsatzpapier „Der Streit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit“, das am 27. August 1987 auf Pressekonferenzen in Bonn und Ostberlin vorgestellt und diskutiert wurde. Diese Erklärung, gedacht als gemeinsamer Appell an die Öffentlichkeit und adressiert vor allem an die Gesellschaften in Ost und West, sorgte umgehend für Irritationen. Nicht alle wussten sie produktiv zu nutzen. Statt die politischen Karten neu zu mischen, wurde nicht selten das Resultat des Dialogs erst einmal in die alten Schubladen einsortiert. Die Kritiker in der Bundesrepublik sahen darin einen „Verrat der Sozialdemokratie an der westlichen Wertegemeinschaft“ und eine „Ignorierung der Gefahren des Kommunismus“, die in der SED eine beginnende „Sozialdemokratisierung“ der Staatspartei und eine „Aufweichung der DDR“. Verwundern konnte das kaum, denn mit diesem Unterfangen wurde Neuland beschritten, was für beide Seiten Chancen und Risiken bargt. Gemeinsame Grundsatzerklärung – die neuen Botschaften Die drei Schlüsselbegriffe des Dialogpapiers lauteten: Gemeinsame Sicherheit – Friedlicher Wettstreit der Gesellschaftssysteme – Politische Kultur des Streits und Dialogs. Zwischen diesen Schlüsselbegriffen wurde ein enger, innerer Zusammenhang hergestellt: Gemeinsame Sicherheit: Frieden, so die erste Botschaft, ist nicht mehr gegeneinander zu errüsten, sondern nur noch miteinander zu vereinbaren. Ein Konzept, wie es bereits die Palme-Kommission und namentlich Egon Bahr erarbeitet hatten. Der potenzielle Gegner wird zum unentbehrlichen Partner der Friedenssicherung und bei der Bewältigung der globalen Konflikte. Das spezifisch Neue im Papier lautete aber: Rüstungskontrolle und Abrüstung sind für Friedenssicherung und Entspannung wichtig, aber nicht ausreichend. Notwendig sind dafür zugleich die schrittweise Überwindung der Feindbildpropaganda, die Entmilitarisierung des Denkens und die Schaffung friedensfähiger Ideologien in Ost und West. Systemwettstreit: Auch bei gemeinsamer Sicherheit blieben aber grundlegende Gegensätze der Systeme zwischen Ost und West bestehen und ihre Austragung unvermeidbar. Doch dafür sollten nun ein neuer Rahmen geschaffen und neue Spielregeln vereinbart werden. 3 Grundvoraussetzung dafür war – so das Papier – die wechselseitige Akzeptanz der Existenzberechtigung der anderen Seite, ihrer Friedens- und Reformfähigkeit. Und der Wettstreit sollte nicht länger mit dem Ziel globaler Hegemonie und Machtausdehnung, sondern um die Lösung der die Menschen weltweit bedrängenden Probleme geführt werden – Sicherheit, Entwicklung, Umweltschutz, Freiheit und Gleichheit. Deshalb sollten auch die Menschen anhand des praktischen Beispiels und Vergleichs selbst die Schiedsrichter sein. Dies alles erforderte eine Neue Kultur des Streits und Dialogs: Dialog und Öffnung nach außen verlangen Dialog und Öffnung nach innen; Abbau der Feindbilder, Akzeptanz der Andersdenkenden, offene Diskussionen über die Ergebnisse des Gesellschaftswettstreits, umfassende Informiertheit der Bürger, wissenschaftlichen und kulturellen Austausch sowie Besuch und Gegenbesuch über Systemgrenzen hinweg. Alles explizite Forderungen in der gemeinsamen Erklärung. Was mit dem Papier als Ganzem formuliert wurde, waren zuerst einmal Absichten, nicht eine gegebene Realität. Das Papier war insofern gedacht als Impulsgeber für soziale, ökologische und demokratische Veränderungen in Ost und West. Vom Wandel durch Annäherung zum Wandel durch Dialog und Wettstreit verschiedener Entwicklungs- und Gesellschaftsmodelle. Der bekannte, aus dem DDR-Verband ausgeschlossene Schriftsteller Rolf Schneider schrieb kurz nach Veröffentlichung des Papiers in einem Spiegel-Essay vom SPD-SED-Papier als „Magna Charta einer möglichen Perestroika in der DDR“ (Schneider, 1987, S. 174f.). Das Papier war kein „Auftragswerk“ und nicht einmal mit den SED-Oberen abgestimmt worden. Und dennoch fand es, auch für die vier Ost-West-Autoren überraschend, die persönliche Zustimmung Honeckers. Das Rätselraten um dessen Motive hält bis heute an. Er sah in diesem Papier mit der SPD-Grundwertekommission, das vor Honeckers erstmaliger Kenntnisnahme bereits vier Wochen zuvor im Präsidiums der SPD (nicht öffentlich) diskutiert und gebilligt wurde, offensichtlich einen wichtigen Akt der DDR-Friedenspolitik. Auch führte er ja selbst seit längerem regelmäßige und vertrauensvolle Gespräche mit SPDSpitzenpolitikern, so u.a. mit Hans-Jochen Vogel, Egon Bahr, Johannes Rau, Oskar Lafontaine, Gerhard Schröder, Karsten Voigt, Björn Engholm. Und nicht zuletzt stand der offizielle Besuch bei Helmut Kohl bevor. Was sich abzeichnete und bald bestätigte – Sinn und Anliegen des Papiers wurden weder von ihm und der SED-Führung noch von der Mehrzahl der Funktionsträger erfasst. Ein Umdenken fand nicht statt. Die SED glaubte, ihre bisherige Doppelstrategie – Dialog und gewisse Flexibilität nach außen, Dialog- und Reformverweigerung nach innen – unbeschadet fortsetzen zu können. Doch genau das war mit dem Dialogpapier infrage gestellt und durchbrochen worden. Denn seine zentrale Maxime 4 lautete: Dialog nach außen verlangt Dialog und Öffnung nach innen. Kein Wunder, dass sich hierzu in der DDR eine breite und zunächst auch öffentliche Diskussion entwickelte. Kein anderes Dokument der Deutschlandpolitik erzeugte solche gesellschaftliche Turbulenzen. Übrigens nicht nur in der DDR, die hier im Fokus meiner Darstellungen steht, sondern auch in der Bundesrepublik. Die Ausgangssituation in der Bundesrepublik war eine andere. Meinungsstreit und Dialog gelten eigentlich als Bestandteile moderner pluralistischer Gesellschaften. Auf welche strukturellen und mentalen Blockaden, Vorurteile und Abwehrreaktionen neue Formen der Streitkultur – zumal zwischen ungewöhnlichen Partnern und Konkurrenten – stoßen, zeigte sich in den Diskussionen um dieses Dialogpapier. Zentrale Thesen des Papiers – wie die von der wechselseitigen Akzeptanz der Existenzberechtigung und der prinzipiellen Friedens- und Reformfähigkeit – stießen keineswegs nur bei den Regierenden im Osten, sondern auch bei denen im Westen auf heftigen Widerspruch. Breite Ablehnung im herrschenden Lager erfuhr hier vor allem die These vom politischen Veränderungsbedarf im eigenen Bereich, der nur auf der anderen Seite gesehen wurde. Genau genommen bildete sich – eher unbeabsichtigt – eine konservative Allianz von Kräften in der DDR und in der Bundesrepublik gegen eine neue „Kultur des politischen Streits“ und des Eintretens für progressiven gesellschaftlichen Wandel in Ost und West heraus. Dialog und Streit in der DDR In der SED selbst kam es zu den lebhaftesten, interessantesten und kontroversesten Diskussionen seit den 1960er Jahren (Reformversuche mit dem sog. „Neuen Ökonomischen System der Leitung und Planung der Volkswirtschaft). Zusammen mit den neuen PerestroikaSignalen aus Moskau bewirkte es ein Gefühl der Erleichterung und der Hoffnung auf Veränderungen. Zuerst stand der Streit zwischen alten Glaubenssätzen und den neuen Begriffen im Mittelpunkt: Friedensfähigkeit statt Aggressivität des Imperialismus? Reformfähigkeit statt bevorstehenden Niedergangs des Kapitalismus? Systemwettstreit mit offenem Ausgang statt gesetzmäßigen welthistorischen Siegs des Realsozialismus? Sozialdemokratie als Partner einer „Koalition der Vernunft“ statt Stütze des Kapitals und gefährliche ideologische Abweichung? Angemerkt sei, dass DDR-Wissenschaftler hier schon längst Revisionen und Neudefinitionen vorgenommen und eine kritische Reformdiskussion initiiert hatten. Dies wurde damals auch im Westen aufmerksam registriert (s. u.a. Ziegler, 1989; FES-Studie, 1989). 5 Ab Frühjahr 1988 kam es dann auch innerhalb der SED, weit über dieses Papier hinaus, verstärkt zu einer gesellschaftspolitischen Debatte um Dialog, Offenheit, Demokratie und Reform in der DDR. Breites Echo und fast ungeteilte Zustimmung fand das Dialogpapier in den Evangelischen Kirchen. Stimmten doch viele Forderungen des Papiers mit den seit langem erhobenen Forderungen der Evangelischen Kirchen der DDR überein (Abbau von Feindbildern, gesellschaftlicher Dialog, Akzeptanz von Andersdenkenden, demokratischer Wandel). Und entgegen heutigen Deutungen fand das gemeinsame SPD-SED-Papier auch bei einer Mehrheit in den Bürgerrechtsgruppen zunächst alles in allem einen positiven Widerhall. Das Papier diente ihnen zugleich als Berufungsinstanz für ihre kritischen Forderungen an die DDR-Machthaber. Skepsis jedoch blieb und wurde bald durch die Ereignisse um die Umweltbibliothek Ende November 1987 (polizeiliche Durchsuchung, Beschlagnahme von Druckerzeugnissen, Verhaftungen) und die Liebknecht-Luxemburg-DemonstrationAnfang 1988 (Verhaftung und Ausweisung von Aktivisten der DDR-Bürgerrechtsbewegung) bestätigt und verstärkt. Dennoch berief sich bis Ende 1989 eine Mehrheit immer wieder auch auf dieses Dialogpapier. Auch im Nachhinein bekundeten bekannte Bürgerrechtler (u.a. Friedrich Schorlemmer, Wolfgang Ullmann, Walter Romberg, Jens Reich, Richard Schröder, Werner Schulz, Konrad Weiß) in ihren Briefen an den damaligen SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel die Bedeutung des SPD-SED-Dialogpapiers für die inneren Auseinandersetzungen in der SED und für den friedlichen Wandel in der DDR (s. Archiv der Sozialen Demokratie, 1991/1992). Auch international (u.a. Tagung von elf sozialdemokratischen/sozialistischen und sechs kommunistischen Parteien in Freudenberg 1988) fand das Papier bemerkenswerte Resonanz, nicht zuletzt bei reformkommunistischen Parteien in Ost und West sowie in der Sozialistischen Internationale. So gab es selbst Angebote mehrerer sozialdemokratischer und sozialistischer Parteien an die DDR-Autoren, ähnliche gemeinsame Erklärungen zu erarbeiten. Trotz unterschiedlicher Reaktionen und Positionen war das SPD-SED-Dialogpapier in der DDR-Gesellschaft alles in allem mehrheitsfähig geworden, doch anders, als es sich die SEDFührung vorstellte. Kaum jemand bestritt seinen Wert als Ausdruck neuen Denkens in OstWest-Sicherheitsfragen und den Anteil der DDR daran. Aber das eigentlich Interessante am Papier waren für diese Mehrheit in der DDR die Forderungen nach offener Diskussion innerhalb eines jeden Systems, nach Einbeziehung aller Personen und Gruppen in den gesellschaftlichen Dialog, nach Informiertheit der Bürger, nach Besuch und Gegenbesuch und 6 Wettstreit der verschiedenen gesellschaftlichen Entwicklungsmodelle sowie nach demokratischen Reformen. Dabei ging es dieser Mehrheit damals (noch) nicht um die Abschaffung der DDR, sondern um deren Demokratisierung und um einen Wandel in Ost und West. Es entstand die (kurzfristige) Möglichkeit der Herausbildung einer gesellschaftlichen Koalition für eine demokratische Reformentwicklung. Eine für die DDR der 1980er Jahre einmalige Situation; und Chance, die jedoch – wie sich bald zeigen sollte – nicht mehr wirksam werden konnte. Die Gegner des Papiers in der DDR waren vorübergehend in die Defensive geraten und sahen ihr Wahrheits- und damit Machtmonopol gefährdet und bliesen nun zur Gegenoffensive. Diese begann mit Kurt Hagers (SED-Politbüromitglied und oberster „Ideologiewächter“) ersten Versuchen zur Uminterpretation von Grundideen des Papiers (u.a. zur Frage der Feindbilder sowie der Friedens- und Reformfähigkeit der beiden Systeme) bereits im Oktober 1987; über die Anweisung des SED-Propagandachefs Joachim Herrmann an die Medien, die Berichterstattung über die Diskussion des Papiers einzustellen, da sie nur „zu Konfusionen und Illusionen in der SED geführt“ habe; Margot Honeckers (damals Ministerin für Volksbildung) brüske Zurückweisung des Vorschlags einer deutsch-deutschen Schulbuchkommission; dem Verbot, das Papier als Broschüre mit Kommentaren zu drucken; und Erich Mielkes (Staatssicherheitschef) zunehmenden Warnungen vor „gefährlichen Diskussionen“, die das Papier ausgelöst habe und die durch das Wirken „negativ-feindlicher Kräfte des Untergrunds“, unterstützt von Kreisen der SPD, zu ernsthaften Gefährdungen der DDR führen könnten (BStU, 1988). Das außenpolitische Dokument werde – so die SED-Führung – von verschiedenen Kräften zur innenpolitischen Destabilisierung und Unterwanderung der DDR „missbraucht“. Deshalb wurde von ihr ab Mitte 1988 eine Missbrauchskampagne initiiert. Es folgten zugleich zunehmende Repressionen, auch innerhalb der SED, u.a. allein 1988 23 000 Parteiverfahren gegen „Abweichler“ und „Nörgler“. Gemaßregelt wurden auch DDR-Autoren des SPD-SEDDialogpapiers, die an seinem Geist (Dialog, Reform und Wandel) festhielten und ihn weiterhin öffentlich vertraten. Honecker bezeichnete sie im Nachhinein gar als ein „Nest voller Feinde“ (Honecker, 1992/2011, S. 130). Die offene Auflehnung in der SED war aber bis zum Spätsommer 1989 eher selten. Die verinnerlichte Parteidisziplin und das Hoffen auf Veränderungen von „oben“ und aus der SED selbst wirkten dem lange Zeit entgegen. Die restaurativen Kreise und Apparate in der SED konnten in dieser Auseinandersetzung, in der es keinesfalls nur um das Dialogpapier ging (u.a. Auseinandersetzung um die Informations-, Wirtschafts-, Demokratiepolitik der SED und um Moskaus Perestroika- und Glasnostkurs), 7 noch einmal ihre Vormachtstellung behaupten. Es wurde jedoch ein Pyrrhussieg, denn die Glaubwürdigkeitskrise der SED-Führung vertiefte sich zusehends. Die beginnende Erosion der SED, vor allem jedoch der demokratische Aufbruch in der Bevölkerung, führten dann 1989 zur schnellen Implosion der SED und der DDR. Statt Wandel mit der SED und Wandel der DDR - Sturz der Staatspartei und Ende der DDR. Das aber zwingt zur Frage: Was bewirkte das Dialogpapier, das Dialogprojekt? Das gemeinsame Papier war – wie damals noch allgemein üblich – nicht von der Annahme eines plötzlichen Sturzes der SED und eines baldigen Zusammenbruchs der DDR ausgegangen, sondern von einem längeren Reform- und Wandlungsprozess in Ost und West. Dieses mit dem Dialogpapier eingeleitete Experiment ging so also nicht wie gedacht auf. Die ost- und westdeutschen Dialogakteure hatten zu lange die Reformfähigkeit des Sozialismus über- und die Abwendung der Menschen von der DDR unterschätzt. Sind damit Sinn und Anliegen des Dialogpapiers infrage gestellt? Sind sie am Ende gar einer Illusion aufgesessen? Vergleiche zwischen den mit der gemeinsamen Erklärung verfolgten Absichten und ihren Wirkungen können da hilfreich sein. So hat zum einen die breit gefächerte Politik des Ost-West-Dialogs – anders als die Politik der Abstandsnahme und der Konfrontation – wesentlich zur Zivilisierung des epochalen OstWest-Konflikts, zur Verhinderung einer militärischen Auseinandersetzung sowie zur friedlichen Öffnung der geschlossenen Ost-West-Strukturen und damit schließlich auch der Mauer beigetragen. Dies gilt bis heute als historischer Erfolg der Ost-West-Entspannungsund Dialogpolitik, die in dieser oder jener Form von Akteuren beider Seiten getragen wurde. Für die DDR wurde diese Entwicklung jedoch zu einer Überforderung. Sie war den neuen Herausforderungen von Öffnung und Wandel nicht mehr gewachsen und die SED fand keine adäquaten gesellschaftlichen Strategien mehr. Honeckers Westpolitik als Öffnungsexperiment nach außen blieb ohne die erforderlichen innenpolitischen Folgerungen. Im Nachhinein wird deutlich: 1987 ist das Jahr des Höhepunkts der Deutschlandpolitik der DDR und zugleich das Jahr ihres beginnenden endgültigen Falls. Zum anderen haben die Diskussionen um das Papier (Abbau Feindbilder, Gewaltverzicht, Dialog, gesellschaftlicher Wandel, Kooperation Ost-West) und ihre Wirkungen die politische Kultur in der DDR (anders als in der stark konservativ geprägten Bundesrepublik) und selbst innerhalb der SED verändert, und dort auch das gesellschaftskritische und demokratischreformorientierte Potenzial gestärkt (vgl. auch Weber, 1991; Klein, 1997). 8 1989 gab es dann nicht nur eine Bewegung gegen die Staatspartei, sondern auch eine Reformbewegung in ihr (u.a. sichtbar in den breiten Aktionen zur Absetzung der SEDFührung um Honecker und dann auch seines Nachfolgers Egon Krenz). Dies trug zum friedlichen Verlauf des zunächst nichtintendierten Umbruchs bei. Im Herbst 1989 stand anders als 1953, 1956, 1961, 1968 erstmals die Mehrheit der SED-Mitglieder nicht mehr hinter ihrer Führung. Die entscheidende Quelle der Herbstrevolution 1989 – mit ihren ersten demokratisch-gesellschaftlichen Veränderungen wie den Runden Tischen, der Wahl von Betriebsräten, der Erarbeitung eines neuen Verfassungsentwurfs – waren der Protest und Aufbruch in der DDR-Gesellschaft. Doch gab es auch in den systemischen Strukturen und Organisationen selbst Differenzierungen, verschiedene Strömungen und Gegenstrukturen. Ein Umstand, der heute, ideologisch motiviert, fast völlig negiert wird. Auch ein kritischer Rückblick stellt also Sinn und Anliegen der gemeinsamen DialogErklärung nicht wirklich infrage. Im Gegenteil. Was bleibt, 25 Jahre nach dem Systemumbruch von 1989/90? Die politische Situation hat sich seit diesem Umbruch und dem Fall der Mauer grundlegend verändert. Der Ost-West-Systemkonflikt ist überwunden. Die deutsche Einheit ist hergestellt, demokratisch legitimiert und auch international respektiert. Europa wächst zusammen. Eine Welt-Gesellschaft ist möglich geworden. Das Dialogpapier war ein Produkt des Ost-WestGegensatzes und des Systemkonflikts der 1980er Jahre und ist insofern Geschichte geworden. Aber der Abstand zum damaligen Geschehen hat einen erstaunlichen Effekt. Er macht deutlich, wie aktuell dieses Anliegen noch heute ist. Die in diesem Dialogpapier benannten großen Menschheitsprobleme harren bis heute der Lösung. Das zivilisatorische Projekt der Moderne (D. S. Lutz), den Krieg als Institution abzuschaffen, die Gewalt als gesellschaftliche und zwischenstaatliche Verkehrsform zu eliminieren, globale Probleme gemeinsam anzugehen und schrittweise eine soziale und demokratische Weltgesellschaft zu gestalten, ist bis heute nicht Wirklichkeit geworden. Militärische Konflikte, herkömmliche und sogenannte neue Kriege prägen das Bild unserer Zeit: Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien, Georgien, Mali. Die ökologische Krise hat sich weiter zugespitzt. Die sozialen Klüfte und Spaltungen haben sich weltweit vertieft. Die Chance grundlegender globaler Wandlungen, die sich mit der historischen Zäsur, den demokratischen Systemumbrüchen von 1998/90 und dem Ende der Extreme (Hobsbawm) ergab, wurde nicht genutzt. Im Gegenteil – neokonservative Strategien begannen das Weltgeschehen zu 9 dominieren. Viele der heutigen Konflikte haben darin ihre Wurzeln. Eine Neuorientierung der internationalen Politik wurde und wird notwendig. Die Grundideen der Erklärung von 1987 – Dialog und gesellschaftlicher Wandel als gestaltende Prinzipien der Politik – sind aktueller denn je. National und international. Das betrifft zum einen den Dialog als Modell, als Konzept und Stil konfliktverarbeitender Politik. Dialog ist auch heute dort am nötigsten, wo er am unmöglichsten scheint. Die Anforderungen an eine Politik und Kultur des Dialogs sind gerade heute beträchtlich. Denn die gegenwärtigen Konflikte und Konfliktmotivationen sind breiter, unübersichtlicher und neben sozioökonomischen, soziopolitischen und machtpolitischen Ursachen zugleich mit verschiedenartigen nationalen, kulturellen, religiösen, ethnischen Faktoren verbunden. Der Ausweg ist nicht, wie wir bis heute immer wieder erleben, die Verschärfung des konfrontativen Kurses, die Militarisierung des Politischen, Kriege unterschiedlichster Art. Doch keines der großen globalen oder regionalen Probleme unserer Zeit – gravierende soziale Ungleichheit, Armut weiter Teile der Erdbevölkerung, Hunger und Flüchtlingsströme, ökologische Krisen und Schäden, Klimawandel, Ressourcenknappheit – ist militärisch oder konfrontativ lösbar. Die einzig vernünftige Alternative ist – trotz konträrer Ausgangslage und unterschiedlicher Interessen – die Suche nach Dialog als Mittel der Konfliktregulierung, der Verständigung und Versöhnung, die Suche nach Formen nationaler, regionaler und globaler Kooperation, nach Wegen zur gemeinsamen Lösung der Konflikte. Hierbei erfordert Dialog auch heute die Entmilitarisierung des Denkens, den Abbau des Misstrauens und den Ausbau von wechselseitigem Vertrauen durch die schrittweise Überwindung des Freund-Feind-, GutBöse-Denkens. Ein ernsthafter, Erfolg versprechender Dialog – das zeigen alle Erfahrungen – kann auch nur als gleichberechtigter Dialog, der vom „Stärkeren“ ausgehen sollte, geführt werden. Doch ohne die Verbindung dieses Dialogs mit gesellschaftlichem Wandel im Sinne der Förderung von Öffentlichkeit, Zivilgesellschaft, Demokratie und Menschenrechte kann Dialog nicht erfolgreich sein und sind die Konflikte des 21. Jahrhunderts nicht dauerhaft regulierbar und eine Weltgesellschaft nicht realisierbar. Und Wandel selbst braucht heute mehr denn je gesellschaftlichen Dialog und Diskurs, gesellschaftliche Such- und Lernprozesse. Dialog und Wandel bedingen sich also wechselseitig. Damit tritt die zweite Grundidee des Papiers – die der Reformfähigkeit und des Wandels der Systeme – unmittelbar in den Blick. Das SPD-SED-Papier hatte den Systemen in Ost und West eine prinzipielle Reformfähigkeit zugesprochen. Und die Reformnotwendigkeit konnte nicht übersehen werden, vor allem nicht im Osten, aber auch nicht im Westen. 10 Denn in den 1970er Jahren hatte eine „systemübergreifende Krise europäischer Industriegesellschaften“ eingesetzt (Steiner, 2005, S. 1), die die kapitalistischen des Westens ebenso traf wie die realsozialistischen des Ostens. Die staatssozialistisch-fordistischen Gesellschaften fanden – auf Grund ihrer strukturellen und subjektiven Reformunfähigkeit – auf die neuen Herausforderungen des gesellschaftlichen Strukturwandels und der Transformation keine überzeugende Antwort. Die Folge war, wie gezeigt, eine schleichende Erosion, die schließlich die Implosion ihres Gesellschafts- und Wirtschaftsmodells bewirkte. In den kapitalistisch-fordistischen Gesellschaften kam es zu vielfältigen Auseinandersetzungen und auch zu Versuchen progressiver gesellschaftlicher Akteure, den „Teilhabekapitalismus“ (Land) der Nachkriegszeit emanzipatorisch, demokratisch und sozialökologisch umzubauen. Doch letztlich setzte sich – beginnend in den USA und Großbritannien – die Fraktion des Kapitals durch, die im Neoliberalismus und Marktfundamentalismus die Antwort auf die Krise und die neuen Herausforderungen suchte. Eingeleitet und vorangetrieben wurde eine restaurative, eine marktliberale Transformation der Wirtschaft (Übergang vom sozialstaatlich regulierten Kapitalismus zur „Entbettung“ des Marktes und zur Dominanz des Finanzmarktkapitalismus), des Staates (Übergang vom Sozial- zum Wettbewerbsstaat) und der Gesellschaft (Übergang von einer partiellen Teilhabezu einer marktradikalen Konkurrenzgesellschaft). Eine Entwicklung, die sich mit dem Ende der Systemkonfrontation noch verstärkte. So beschreibt Wolfgang Streeck die Zeit seit den 1970er Jahren als „langgezogene Wende vom Sozialkapitalismus der Nachkriegszeit zum Neoliberalismus des beginnenden 21. Jahrhunderts“ (Streeck, 2013, S. 19). Doch führte der Zusammenbruch des diktatorischen Sozialismus sowjetischen Typs in Osteuropa zunächst zu der verbreiteten Annahme vom „Ende der großen Gesellschaftsalternativen“ (Bell, 1989), ja vom „Ende der Geschichte“ (Fukuyama, 1992). Das hat sich jedoch nicht bestätigt. Im Gegenteil. Die postsozialistische Transformation nach 1989 wurde nicht zum Ende, sondern zum Beginn einer neuen Ära der Transformation, nicht zuletzt in den westlich-kapitalistischen Gesellschaften. Die Reformfähigkeit der westlichen Gesellschaften ist mehr denn je gefragt und muss sich unter den grundlegend veränderten Bedingungen erst noch beweisen. Eine sozial-ökologische und solidarisch-demokratische Gesellschafts-Transformation, wie sie in Umrissen und spezifisch für Ost und West im Dialogpapier von 1987 bereits angemahnt und angedacht wurde, wird nun zur größten gemeinsamen Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Denn das bisherige und zumeist wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Fortschritt produzierende Entwicklungsmodell des 11 Westens ist seit längerem an seine gesellschaftlichen und natürlichen Grenzen gestoßen. Von der kapitalistischen Wachstumslogik mit ihren unbegrenzten und die Natur zerstörenden Ressourcenverbrauch über den rasch sich vollziehenden Klimawandel bis zur Verschärfung der sozialen Ungleichheiten und Spaltungen weltweit. „Gesellschaft im Umbruch“ (Baethge, Bertelsheimer, 2005) und „Historischer Übergang“ ist deshalb eine adäquate Zeitdiagnose. Umbruch nicht verstanden als neues Zusammenbruchszenario, sondern als evolutionäre und qualitative Transformationsepoche. Und Transformation – gestützt auf die kulturellen, sozialen und demokratisch-rechtlichen Errungenschaften der Moderne – verstanden als längerfristiger Übergang zu einem neuen Typ nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung, sozialer Teilhabe, demokratischer Bürgerbeteiligung und sozialer und humaner Lebensqualität. Genau genommen handelt es sich nach der von Karl Polanyi analysierten ersten großen Transformation (Polanyi, 1944/1975) nun um die zweite, große Transformation der Neuzeit (vgl. dazu Reißig, 2009). „Rückblickend ist nicht mehr strittig, dass die 1970er Jahre eine Wendezeit waren“ (Streeck, 2013, S. 13), genauer die Wendezeit in diesem Epochenumbruch. Diese seit den 1970er Jahren heranreifende Transformation hin zu einem neuen Entwicklungsmodell und -pfad, zu einer sozialen, ökologischen, solidarischen Moderne konnte 1989/90 aus unterschiedlichen Gründen nicht in Angriff genommen werden und wurde „vertagt“ – mit Folgewirkungen für Ost und West und auch für das vereinte Deutschland. So wurde ein Produktions-, Sozial- und Kulturmodell fortgeführt (Westdeutschland) und übernommen (Ostdeutschland), das zum Zeitpunkt der deutschen Vereinigung seine Erfolgsgeschichte schon hinter sich hatte und wo die Grundlagen seines Funktionierens bereits erodierten. Dies führte in Ostdeutschland dennoch zu wichtigen Entwicklungen und Ergebnissen und hat die Stärke und Robustheit der „alten“ Bundesrepublik manifestiert, aber die der „neuen“ zugleich blockiert, strukturell und mental (Reißig, 2010a, S. 20-25). Deutsche Einheit neu denken Der gewählte Modus der DDR-Transformation und ein Ost-West-Angleichungsprozess als übergeordnete Zielvorstellung haben ihre Potenziale inzwischen längst ausgereizt. Es geht daher beim „Projekt Ostdeutschland“ nun nicht mehr zuerst um eine Zeitverschiebung (von ursprünglich 10 Jahren, über 20/30 Jahre bis nun 40/50 Jahre), um kleinere Korrekturen und modifizierte Instrumente des strukturellen Wandels, sondern um einen tiefgreifenden anderen Wandel. Der sozial-ökologische Umbauprozess ist die grundlegende Herausforderung für Ost und West und kann nur gemeinsam ge- oder misslingen. 12 Maßstab und Meßlatte gelingender Transformation und deutscher Vereinigung sind deshalb nicht mehr so sehr „Auf- und Einholen“, nicht mehr primär die gängigen quantitativen OstWest-Vergleiche, sondern „Entwicklungs- und Zukunftspotenziale“, „Handlungs- und Teilhabechancen“, „Selbstbestimmtes Leben“, neue „Soziale und kulturelle Lebensqualität“ (Reißig, 2010b). Der Osten wäre hierbei nicht mehr und von vornherein „Nachzügler“, sondern könnte auch die Rolle eines „Motors“ (z.B. bei Umbau der Arbeitsgesellschaft, Nutzung des Sozialkapitals für nachhaltige Entwicklung, Regionalisierung, Energiegenossenschaften, Stadtumbau) einnehmen. Und Zusammenwachsen sollte nun durch Zusammen(Ost-West gemeinsam)-Wachsen erfolgen. Und das bedingt – nun im vereinten Deutschland – wiederum eine neue Kultur des Dialogs und Wandels, des gemeinsamen Such- und Lernprozesses bei der Gestaltung einer zukunftsfähigen sozial-ökologischen und demokratisch-solidarischen Gesellschaft. Quellen- und Literaturverzeichnis Archiv der sozialen Demokratie (AdsD). Briefe von DDR-Bürgerrechtlern und Kirchenrepräsentanten aus den Jahren 1991 und 1992 an den ehemaligen SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel mit einer Stellungnahme zum SPD-SED-Dialog und seinen Folgen für die oppositionellen Kräfte in der DDR, Bonn. Baethge, M., Bartelheimer, P. (2005). Berichterstattung zur sozioökonomischen Entwicklung in Deutschland. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. BStU. MfS. ZAIG-Information Nr. 5734, S.1-8; BStU: MfS HA XX, Nr. 3332. 10. August 1988, S. 1-13. Bell, D. (1989). Beitrag. In: Die Zeit, 19. Dezember. Hamburg. Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.). (1989). DDR und Menschenrechte. Bonn. Fukuyama, F. (1992). Das Ende der Geschichte. Wo stehen wir? München: Verlag Kindler. Honecker, E. (1992/2011). Letzte Aufzeichnungen. Mit einem Vorwort von Margot Honecker. Berlin: Verlag edition ost. Klein, T. (1997). Zu Opposition und Widerstand in der SED. In Herbst/Stephan/Winkler (Hrsg.), Die SED. Ein Handbuch (S. 197-215). Berlin: Dietz Verlag. Polanyi, K. (1995). The Great Transformation. Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen (1944). Frankfurt Main: Suhrkamp. Reißig, R. (2002). Dialog durch die Mauer. Die umstrittene Annäherung von SPD und SED. Mit einem Nachwort von Erhard Eppler. Frankfurt a. M./New York: Campus Verlag, 449 S. 13 Reißig, R. (2009). Gesellschafts-Transformation im 21. Jahrhundert. Ein neues Konzept sozialen Wandels. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Reißig, R. (2010a). Von der privilegierten und blockierten zur zukunftsorientierten Transformation. In Aus Politik und Zeitgeschichte, (S. 20-25), H. „Deutsche Einheit“ 30/31. Bonn. Reißig, R. (2010b). Deutsche Einheit: Weiter- und Neu-Denken. In Brähler, E./Mohr, I. (Hrsg.), 20 Jahre deutsche Einheit – Facetten einer geteilten Wirklichkeit. Gießen: Psychosozial Verlag. Schneider, R. (1987). Perestroika in der DDR. In Der Spiegel, Nr. 46, S. 174/175. Hamburg. Steiner, A. (2006). Bundesrepublik und DDR in der Doppelkrise europäischer Industriegesellschaften. Zum sozialökonomischen Wandel in den 1970er Jahren. In Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History. Online-Ausgabe (3), S. 1-3. Streeck, W. (2013). Gekaufte Zeit: Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus. Berlin: Suhrkamp. Weber, H. (1991). DDR. Grundriß der Geschichte 1945-1990. Hannover: FackelträgerVerlag. Ziegler, U. (1989). Die neue Sicht der DDR in der Systemauseinandersetzung. In Aus Politik und Zeitgeschichte, (S. 28-38), H. 34. Bonn. 14