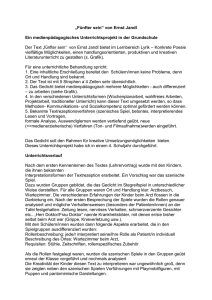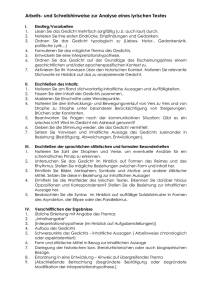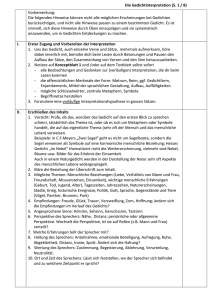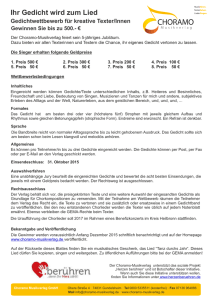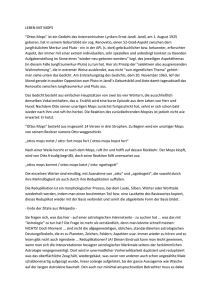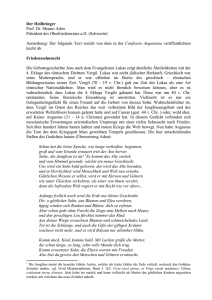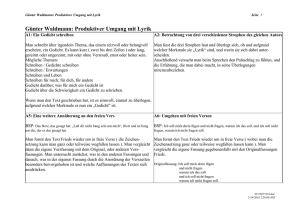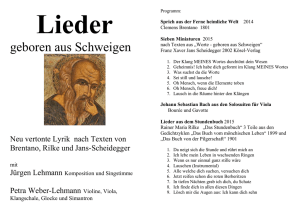3. Die Sprachkrise bei Ernst Jandl
Werbung

Universität Utrecht Bachelorarbeit Korrektor: Prof. Dr. A.B.M. Naaijkens Block 4, 2010-2011 Zweite Korrektorin: Dr. J. Enklaar-Lagendijk ‚Erwarte von Wörtern nichts/sie tun es nicht für dich‘1 Die Sprachkrise und ihr poetischer Ausdruck in der Lyrik Ernst Jandls Vorgelegt von: Abgabedatum: 11.7.2011 Wörterzahl: 13.210 1 Aus dem Gedicht von wörtern in Jandl 2011: 33. Anne Veerman Studiengang Duitse Taal en Cultuur BA 3. Studienjahr Stud.Nr: 3350061 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ............................................................................................................................... 3 2. Die Sprachkrise ...................................................................................................................... 4 2.1. Vorbereitende Überlegungen zur Sprachkrise ab dem Ende des 18. Jahrhunderts ......... 4 2.2. Sozial-historische Hintergründe der Jahrhundertwende: Eine kurze Einleitung ............. 8 2.2.2.Die Sprachkrise in der Philosophie .......................................................................... 10 2.2.3. Die literarische Sprachkrise ..................................................................................... 13 2.2.4. Schlussfolgerung: Konturen der Sprachkrise um 1900 ........................................... 18 3. Die Sprachkrise bei Ernst Jandl ........................................................................................... 20 3.1. Jandls literarischer Hintergrund: Dadaismus, Die Wiener Gruppe, konkrete Poesie .... 20 3.2. Gedichtanalysen ............................................................................................................. 23 3.2.1. schtzngrmm .............................................................................................................. 23 3.2.2. wien : heldenplatz ................................................................................................... 25 3.2.3. tagenglas: franz hochedlinger-gasse, menschenfleiss, Biography .......................... 29 3.2.4. inhalt ........................................................................................................................ 31 3.2.5. von wörtern, zweites sonett ...................................................................................... 32 4. Schluss .................................................................................................................................. 34 5. Anhang: Behandelte Gedichte .............................................................................................. 36 6. Literaturverzeichnis .............................................................................................................. 42 2 1. Einleitung Die Literatur um 1900 wurde von einer Krise des sprachlichen Bewusstseins gekennzeichnet (vgl. Von Polenz 2009: 149): In dieser Periode waren Sprachskepsis und Sprachverzweiflung Gegenstand zahlreicher philosophischer, sprachanalytischer und literarischer Texte im deutschsprachigen Raum (vgl. Beutin u.a. 2008: 359). Obwohl die Sprachkrise in verschiedenen Literaturgeschichten nur bei der Behandlung der Literatur um die Jahrhundertwende erwähnt wird, lässt sich feststellen, dass sie jedoch ihre Spuren in der Literatur hinterlassen hat, wobei Joachim Kühn behauptet, dass die Sprachkritik die Dichtung von 1900 bis 1976 beherrscht hat (vgl. ebd.: 2) und Peter von Polenz sogar meint, dass die Sprachkrise bis heute immer noch nicht überwunden sei (vgl. Von Polenz 2009: 149). Jetzt erhebt sich die Frage, wie die Sprachkrise sich ´weiterentwickelt´ hat und in welcher Form sie in der modernen deutschsprachigen Literatur anwesend ist: Hat sie sich wesentlich geändert oder gibt es Parallelen zwischen der Sprachkrise des 20. Jahrhunderts und der Sprachkrise in der modernen Literatur des 21. Jahrhunderts? Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Ausprägung der Sprachkrise in Werken um 1900 und in den modernen Gedichten des experimentellen und sprachspielerischen Dichters Ernst Jandl. Im ersten Teil der Arbeit wird anhand von Sekundärliteratur versucht, die Merkmale der Sprachkrise um 1900 festzustellen, wobei zunächst die vorbereitenden Tendenzen zur Sprachkrise in der Philosophie geschildert werden. Daraufhin werden anhand der Ansichten verschiedener Sprachkritiker, nämlich der Philosophen Nietzsche und Mauthner und des Schriftstellers Hofmannsthal, die Merkmale der Sprachkrise um 1900 beschrieben. Dabei werden auch zwei sprachkritische Gedichte von Rainer Maria Rilke und Christian Morgenstern analysiert, um einen Eindruck zu bekommen von der Weise, auf die Dichter um 1900 ihre Verzweiflung über die Sprache in ihrer Lyrik ausdrückten. Schließlich werden in einem abschließenden Paragraphen die wichtigsten Merkmale der Sprachkrise um 1900 festgestellt. Im Fokus des zweiten Teils steht die Analyse der Gedichte Jandls. Zuerst wird der literarische Hintergrund Jandls, nämlich die Auffassungen der Dadaisten, der Mitglieder der Wiener Gruppe und der konkreten Lyriker, kurz erörtert. Daraufhin werden einige Gedichte Jandls, in denen sich eine Kritik an der Sprache ausprägt, analysiert. Schließlich wird anhand der im vorigen Kapitel gegebenen Arbeitsdefinition des Phänomens Sprachkrise festgestellt, in welcher Form die Sprachkrise in Jandls Gedichten anwesend ist, auf welche Weisen Jandl in seinen Gedichten Kritik an der Sprache äußert und wie diese Kritik sich im Vergleich zu der für die Sprachkrise kennzeichnenden Sprachkritik weiterentwickelt hat. 3 2. Die Sprachkrise 2.1. Vorbereitende Überlegungen zur Sprachkrise ab dem Ende des 18. Jahrhunderts Obwohl die Sprachkrise sich erst um 1900 in berühmten und wirkungsreichen Werken wie Nietzsches Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne (1873), Hofmannsthals Chandos-Brief (1902) und Fritz Mauthners Beiträge zu einer Kritik der Sprache (1901/02) ausprägte, lässt sich feststellen, dass wichtige Anregungen für das spätere sprachkritische Denken des späten 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts von den Jahren um 1800 ausgingen (vgl. Kiesel 2004: 177). In dieser Periode erfuhr das kritische Denken über die Sprache „eine auffallende Intensivierung” (ebd.: 177) durch die Sprachdiskussionen, die unter Philosophen und Sprachtheoretikern stattfanden. In diesem Kapitel wird anhand von Ansichten verschiedener Wissenschaftler festgestellt, welche Werke die Grundlage für die spätere Sprachkrise gelegt haben und es werden diese Werke mit Hilfe der Sekundärliteratur vorgestellt. Helmuth Kiesel stellt in seinem Werk Geschichte der literarischen Moderne: Sprache, Ästhetik, Dichtung im zwanzigsten Jahrhundert (2004) fest, dass die „radikale Sprachskepsis” (ebd.: 177) um die Jahrhundertwende aus Zweifeln an der Vorstellung entstand, es gebe „zwischen der wahrnehmbaren Welt, dem erkennenden menschlichen Geist und der darstellenden Sprache eine sachlogische Übereinstimmung“ (ebd.: 177). Er nimmt dabei die Erkenntnislehre des Aufklärungsphilosophen Immanuel Kant als Ausgangspunkt seiner historischen Beschreibung der Sprachkrise und stellt fest, dass Kant mit seiner Kritik der reinen Vernunft (1781) das Vertrauen “in die unmittelbare und objektadäquate Erkennbarkeit“ (ebd.: 177f.) der Welt zerstört und damit die Grundlage für die Verknüpfung von Sprach- und Erkenntniskritik gelegt hat, die für die Sprachkrise der Moderne kennzeichnend ist (vgl. ebd.: 177). In diesem Werk verneint Kant, dass die Welt unmittelbar erkennbar sei (vgl. ebd.: 177f), indem er behauptet, der Mensch nehme die Welt nicht wahr, wie sie wirklich ist, sondern mittels Strukturen, der sogenannten „Anschauungsformen“ und „Verstandesbegriffe“, die den menschlichen Geist bei der Wahrnehmung führen und auf diese Weise die Erfahrungen und Wahrnehmungen strukturieren (vgl. De Pater/Swiggers 2000: 179). Es lässt sich allerdings feststellen, dass Kant in seinem Werk der Rolle der Sprache bei der Erkenntnis keine Aufmerksamkeit zuwendet: Sowohl Kiesel als auch Wilhelmus Antonius de Pater und Pierre Swiggers (2000) betonen, dass Kant sich nicht davon bewusst war, dass die Sprache „auch die Sprache eine wahrnehmungs- und erkenntnisrelevante Rolle spielen […] könnte“. Er betrachtete das Phänomen Sprache nur als „Mittel zur Formulierung und Mitteilung von 4 Erkenntnissen“ (Kiesel 2004: 178) und nahm nicht wahr, dass die Sprache den Strukturen, die Erkenntnis ermöglichen und strukturieren, zugeordnet werden könne (vgl. ebd.: 179). Viele Zeitgenossen reagierten erschüttert auf Kants Befunde. Der Schriftsteller Heinrich von Kleist erklärte zum Beispiel, dass durch die kantische Erkenntnislehre das Streben nach der Wahrheit für ihn unmöglich und sinnlos geworden sei. In dem sogenannten Kant-Brief an seine Verlobte Wilhelmine von Zenge am 22. März 1801 vergleicht er die kantischen Strukturen mit Augengläsern, die die Sicht der Menschen auf die Welt beeinflussen, um seiner Verlobten die Ideen Kants zu erklären (vgl. Kiesel 2004: 178): Wenn alle Menschen statt der Augen grüne Gläser hätten, so würden sie urteilen müssen, die Gegenstände, welche sie dadurch erblicken, sind grün - und nie würden sie entscheiden können, ob ihr Auge ihnen die Dinge zeigt, wie sie sind, oder ob es nicht etwas zu ihnen hinzutut, was nicht ihnen, sondern dem Auge gehört (Kleist 1985, zit. nach Kiesel 2004: 178). Hierauf folgert er: „So ist es auch mit dem Verstande. Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaft Wahrheit ist, oder ob es uns nur so scheint“ (Kleist 1985, zit. nach Kiesel 2004: 178). Daneben beschreibt Kleist, wie er durch diese Erkenntnis in einen Zustand gerät, der nach Kiesel der Situation des fiktiven Lord Chandos aus dem berühmten Chandos-Brief ähnelt: Er wird gequält durch eine „innerliche Unruhe“ (Kleist 1801) und den Gedanken, dass sein höchstes Ziel, nämlich das Streben nach der Wahrheit, zerstört sei, während ein „innerlicher Ekel” (Kleist 1985, zit. nach Kiesel 2004: 178) ihn bei der schriftstellerischen Arbeit hindert (vgl. Kiesel 2004: 178). Es lässt sich sagen, dass Kleist in diesem Zustand die Erkenntniskritik mit der Unfähigkeit zu sprechen oder zu schreiben verknüpft: Die Unfähigkeit, die Wahrheit zu erkennen, prägt sich aus in dem Nicht-SprechenKönnen und in der Unfähigkeit sich mittels Sprache auszudrücken. Obwohl Kleist über „die Unfähigkeit der Sprache, die Regungen der Seele hinreichend genau mitzuteilen“ (Kleist 1985, zit. nach Kiesel 2004: 178) klagte, verneint Kiesel, dass sich ein Ansatz zu einer systematischen Sprachkritik in seinem Werk finden lasse (vgl. Kiesel 2004: 178). Dieter Heimböckel vertritt in seinem Werk Emphatische Unaussprechlichkeit: Sprachkritik im Werk Heinrich von Kleists (2003) allerdings die Auffassung, dass Kleist als Vorbereiter der Sprachkrise um die Jahrhundertwende betrachtet werden könne und behauptet, dass in den Werken Kleists genauso wie in der Literatur um 1900 eine “Störung im Verhältnis zur Welt” (Schneider 1998, zit. nach Heimböckel 2003: 324) ausgedrückt werde. 5 De Pater, Swiggers, Kiesel und Helmut Arntzen (1982) behaupten dennoch, dass nicht Kleist, sondern andere Zeitgenossen Kants, nämlich die Philosophen Hamann, Herder und Humboldt, das Problem und die Bedeutung der Sprache für den „Aufbau und Erkenntnis der Wirklichkeit” (Arntzen 1982: 247) zum ersten Mal erkannten und Kritik an der Abwesenheit der Sprache in Kants Kritik der reinen Vernunft übten. De Pater und Swiggers stellen zum Beispiel fest, dass der Philosoph Johann Georg Hamann in seiner Metakritik über den Purismus der Vernunft (1784) Kant den Vorwurf machte, dieser hätte die Vernunft von jeder Tradition und Erfahrung und von der Sprache getrennt. Nach seiner Meinung haben wir durch Wörter Zugang zu der Wirklichkeit und gibt es keine Trennung zwischen Sprache und Denken (vgl. De Pater/Swiggers 2000: 179). Obwohl Hamann kein Sprachkritiker war, wies er als einer der ersten darauf hin, dass neben den von Kant genannten Erkenntnisstrukturen Sprache auch als Möglichkeit der Welterkenntnis zu betrachten wäre (vgl. Kiesel 2004: 179). Genauso wie Hamann übte Johann Gottfried Herder Kritik an Kants Auffassungen, indem er feststellte, dass Kant die wichtige Rolle der Sprache unberücksichtigt gelassen hatte (vgl. De Pater/Swiggers 2000: 180f.). Herder behauptete, die Sprache sei die Triebfeder der menschlichen Seele, weil das Denken immer mit der Sprache verknüpft sei. Weiterhin erklärt er, dass Ideen immer mit Hilfe der Sprache geformt und ausgedrückt werden und dass das Denken deswegen eine innerliche Sprache ist, während man, wenn man spricht, laut denkt (vgl. De Pater/Swiggers 2000: 181). Schließlich lässt sich sagen, dass Hamann und Herder im Vergleich zu früheren Denkern wie Francis Bacon, John Locke und Gottfried Wilhelm Leibniz auf eine Neubestimmung der Sprache hingewiesen haben, die sich für die spätere Sprachkrise um 1900 als wegweisend erwiesen hat (vgl. Heimböckel 2003: 321), wie Dieter Heimböckel behauptet: Hamann und Herder kehrten sich beide vom christlichen Sprachmodell ab, das davon ausging, dass die Sprache einen göttlichen Ursprung hatte und behaupteten, die Sprache sei „das einzige erste und letzte Organon [Instrument] der Vernunft“ (Heimböckel 2003: 321). Durch diese Einsicht wurden die kantischen Strukturen, die die Wahrnehmung und Erfahrung lenkten, durch die Sprache als strukturierendes Element ersetzt (vgl. De Pater/Swiggers 2000: 179). Der Sprachwissenschaftler und Philosoph Wilhelm von Humboldt wurde von diesen Auffassungen beeinflusst: Er meinte genauso wie Herder und Hamann, dass Kant zu wenig Aufmerksamkeit auf den Verband zwischen Sprache und Denken verwendet hatte (vgl. ebd.: 186). Daneben konstatierte Humboldt, dass die Sprache eine wichtige Rolle für “das menschliche Bewusstsein und die Auffassung von Ich und Welt“ spielte. Er ging davon aus, dass Bewusstsein und Denken unlöslich mit Sprache verbunden seien und betrachtete Sprache 6 als das „Organ des inneren Seyns“ und sogar „das bildende Organ des Gedankens“ (Humboldt 1903-1936, zit. nach Kiesel 2004: 180). Weiterhin arbeitete er die Idee von der Sprache als Mittel zur Strukturierung der Wirklichkeit weiter aus, indem er sie als „Weltansicht“ (ebd.: 180) zwischen der Natur und den Menschen bezeichnete (vgl. Kiesel 2004: 180). Kiesel weist darauf hin, dass Humboldt genauso wie Hamann und Herder keine Kritik an der Sprache übte: Er schenkte der Ausdrucksmöglichkeit der Sprache sogar sein vollstes Vertrauen indem er behauptete, die Sprache habe trotz einiger Schwächen die Fähigkeit alles auszudrücken (vgl. Kiesel 2004: 181), wie aus dem folgenden Zitat ersichtlich wird: „Nichts in dem Inneren des Menschen ist so tief, so fein, so weit umfassend, das nicht in die Sprache überginge und in ihr erkennbar wäre“ (Humboldt 1936, zit. nach Kiesel 2004: 181). Im letzten Drittel des 19. Jahrhundert entwickelte der Gymnasialdirektor und Sprachtheoretiker Gustav Greber die Sprachauffassungen Humboldts in seinen Werken Die Sprache als Kunst (1871 und 1873 in zwei Bänden) und Die Sprache und das Erkennen (1884) weiter, indem er feststellte, dass die Sprache nicht dafür geeignet sei, die Dinge in der Welt zu bezeichnen, weil sie etwas Künstliches ist (vgl. Kiesel 2004: 181). Nach ihm ist die Sprache “wesentlich metaphorisch“ (ebd.: 181), wie Kiesel zusammenfasst: “Die Laute und Wörter, aus denen sich die Sprache zusammensetzt, sind Bilder oder Metaphern der Nervenreize und Empfindungen, die durch das Gewahrwerden der Dinge ausgelöst werden” (ebd.: 181). Mit dieser Sprachauffassung übte Gerber im Gegensatz zu seinen Vorgängern Hamann, Herder und Humboldt Kritik am Funktionieren der Sprache als Mittel zum Ausdruck, wie das folgende Zitat illustriert: Nichts ist falscher, als anzunehmen, dass wir durch die Sprache die Dinge in der Welt bezeichnen. Wir haben an der Sprache freilich ein Mittel, um uns mit allen Dingen theoretisch in Verbindung zu setzen, aber ein durchaus künstliches, künstlich in dem doppelten Sinne, daß [sic] die Sprache wesentlich nur Menschenwerk ist, Naturgültigkeit nicht besitzt, nur u n s e r e Beziehung zu den Dingen ausdrückt; und daß [sic] es nur Werke der K u n s t sind, durch welche dies gelingt: mittelst eines Einzelnen, nämlich mittelst eines Lautbildes, ein Allgemeines, nämlich die vorgestellte Idee, zu bezeichnen (vgl. Greber 1886). Aufgrund der besprochenen Ansichten in der Sekundärliteratur lässt sich schließen, dass die Reflexionen zur Entstehung der Sprachkrise um 1900, die sich durch die Verbindung von Sprach- und Erkenntniskritik kennzeichnete (vgl. Kiesel 2004: 178) wesentlich beigetragen haben: Kant legte mit seiner Erkenntnislehre die Basis für Diskussionen über das Verhältnis zwischen Sprache und Wirklichkeit und die spätere Verbindung von Sprach- und 7 Erkenntniskritik; Kleist verknüpfte die Erkenntniskritik mit der Unfähigkeit zu sprechen und kann deswegen als Vorgänger des fiktiven Lord Chandos betrachtet werden; Hamann, Humboldt und Herder wiesen auf die große Rolle der Sprache bei der Erkenntnis hin und Nietzsche basierte seine Sprachüberlegungen auf den Ideen Gerbers, wie Kiesel feststellt (vgl. ebd.: 182f). 2.2. Sozial-historische Hintergründe der Jahrhundertwende: Eine kurze Einleitung Obwohl die Bezeichnung ´Jahrhundertwende´ erahnen lässt, dass die Faszination und der Optimismus für das neue Jahrhundert und dessen Entwicklungen in dieser Periode durchaus anwesend waren, gibt es noch einen anderen Terminus der in dieser Periode bedeutend ist und der vielmehr die Schattenseite des Jahrhundertwechsels widerspiegelt, nämlich den Begriff ´Fin de siècle´. Dieser Begriff deutet auf ein „Gefühl des Fertigseins, des Zu-Ende-Gehens“ hin, wie die österreichische Schriftstellerin Marie Herzfeld in ihrem Essay “Fin-de-siècle“ umschreibt (Herzfeld 1893, zit. nach Fähnders 2010: 95). Dieses Lebensgefühl, dass um die Jahrhundertwende vorherrschte, kennzeichnete sich durch eine „Niedergangs- und Endzeitstimmung” und eine allgemeine Müdigkeit der Epoche gegenüber. Obwohl später auch Optimisten erschienen, die das sogenannte ´Anti-Fin de siècle´ forderten und dem Jahrhundert mit Enthusiasmus entgegentraten, blieb das „Endbewusstsein“, nämlich die Einsicht, dass eine Epoche enden wird und enden muss, doch typisch für diese Epoche (vgl. Fähnders 2010: 97). Wohl der wichtigste Grund für diese andauernde pessimistische Haltung war, dass die Zeit um die Jahrhundertwende eine Zeit des Aufbruchs und der Erschütterung alter Werte war, was zum Werteverlust und Verlust des autonomen, selbstbestimmenden Ichs oder Subjekts (vgl. Beutin e.a.: 355),, zu der sogenannten „Ichlosigkeit der Moderne“ (Fähnders 2010: 85) führte. Die Ideen des Physikers Ernst Mach spielten eine wichtige Rolle bei der Entwicklung eines veränderten Blicks auf das Ich. In seinem 1885 erschienenen Werk Analyse der Empfindungen umschreibt er eine „Auflösung des Ich“ (Hinderer 2001: 392), indem er feststellt: „Nicht das Ich ist das Primäre, sondern die Elemente (Empfindungen). Die Elemente bilden das Ich“. Aufgrund dieser Beobachtungen folgert Mach, dass das Ich „unrettbar“ sei (Mach 1900, zit. nach Fähnders 2010: 42). Der österreichische Schriftsteller Hermann Bahr griff Machs Aussage auf, indem er sie in seinem Dialog vom Tragischen (1903) zitierte und weiter ausarbeitete: 8 ‘Das Ich ist unrettbar‘. Es ist nur ein Name. Es ist nur eine Illusion. Es ist ein Behelf, den wir praktisch brauchen, um unsere Vorstellungen zu ordnen. Es gibt nichts als Verbindungen von Farben, Tönen, Wärmen, Drücken, Räumen, Zeiten“ (Bahr 1968, zit. nach Fähnders 2010: 85). Diese Ideen blieben nicht ohne Wirkung: Das Thema der Auflösung des Ichs und die Erfahrung des Subjektzerfalls wurden um die Jahrhundertwende in vielen literarischen Texten verarbeitet (Kimmich/Wilke 2006: 70), indem viele Autoren ihre Annahme oder Erfahrung, dass das Ich sich nicht mehr von der Umwelt abgrenze, sondern „mit der Umwelt verwoben und unbeständig […]: flüchtig, verwandlungsfähig […]“ sei, in ihren Werken darstellten (Kiesel 2004: 129). Weiterhin erschütterten die nietzscheanische Philosophie und die freudianische Psychoanalyse das alte Weltbild. Erstere verkündete den Tod Gottes und damit den Anfang des Zeitraums des modernen starken Ichs oder des Übermenschen und den Verlust alter, traditioneller Werte, während letztere das Bild eines schwachen Ichs, dass nicht über sich selbst bestimmen kann, sondern von dem ´Es´ und dem ´Über-Ich´ beherrscht wird, entwarf und so Abschied von einem selbständigen Ich nahm (vgl. Fähnders 2010: 84). Hinzu kamen die Entwertung von traditionellen Werten und Institutionen in der Privatsphäre, wie die Familie und die Kirche und das Verschwinden von gesellschaftlichen Bedingungen wie die Gebundenheit von Sexualität an Liebe und Ehe. All diese Entwicklungen hatten zur Folge, dass eine Verwirrung entstand, in dem man wieder nach dem Sinn des Lebens und dem eigenen Ich suchen musste und die sich in der Literatur als “Ich-Krise, Sprachkrise und Bewusstseinskrise“ niederschlug (vgl. Beutin u.a.: 355f.). Der Autor der Moderne wurde mit einer neuen, fremden „Umbruchssituation“ (ebd.: 357) konfrontiert, mit einem anderen Blick auf Sprache und Wirklichkeit (vgl. ebd.: 357), wobei die Frage, ob die Wirklichkeit noch mit sprachlichen Mitteln ausgedrückt werden könne, im Vordergrund stand. Dieser Blick auf Sprache und Wirklichkeit wird in diesem Kapitel anhand der Behandlung von Ansichten von Sprachkritikern aus dieser Epoche besprochen. Dabei wird mit Hilfe von Sekundärliteratur versucht, einen Überblick über die Sprachkrise in der Philosophie und die Sprachkrise in der Literatur zu verschaffen, indem die sprachkritischen Werke von Nietzsche, Mauthner und Hofmannsthal und sprachkritische Gedichte von Rilke und Morgenstern behandelt werden. Schließlich werden die wichtigsten Merkmale der Sprachkrise um 1900, die sich in diesen Werken ausprägen, in einem abschließenden Paragraphen vorgestellt. 9 2.2.2.Die Sprachkrise in der Philosophie Die Sprachkrise bei Nietzsche: Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne (1873) Friedrich Nietzsches Essay Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne kann nach Kiesel als die „eigentliche Eröffnung […] der modernen Sprachkrise“ (Kiesel 2004: 183) angesehen werden, weil es in diesem Essay die für die Sprachkrise charakterisierende Verbindung von Erkenntnis- und Sprachkritik gibt (vgl. ebd.: 183). Im ersten Teil konzentriert Nietzsche sich auf die menschliche Erkenntnis und behauptet, dass diese Erkenntnis nichts mit der absoluten, objektiven Wahrheit zu tun hat (vgl. ebd.: 183), denn sie [die Menschen] sind tief eingetaucht in Illusionen und Traumbilder, ihr Auge gleitet nur auf der Oberfläche der Dinge und sieht „Formen“, ihre Empfindung führt nirgends in die Wahrheit, sondern begnügt sich, Reize zu empfangen und gleichsam ein tastendes Spiel auf dem Rücken der Dinge zu spielen (Nietzsche 1966: 3102). Kurz darauf stellt Nietzsche allerdings fest, dass der Mensch, obwohl er keine absolute Wahrheit kennt, doch einen „Trieb zur Wahrheit“ (310) besitze und er geht davon aus, dass der Mensch aus diesem Grund versucht, eine ´Wahrheit´ mittels Sprache festzulegen (vgl. 311): „Jetzt wird nämlich das fixiert, was von nun an „Wahrheit” heißen soll, das heißt, es wird eine gleichmäßig gültige und verbindliche Bezeichnung der Dinge erfunden […]” (311). Nach dieser Auseinandersetzung fragt er sich, ob die Sprache die Wirklichkeit denn wirklich ausdrücken kann: „[…] wie steht es mit jenen Konventionen der Sprache? Sind sie vielleicht Erzeugnisse der Erkenntnis, des Wahrheitssinnes, decken sich die Bezeichnungen und die Dinge? Ist die Sprache der adäquate Ausdruck aller Realitäten?“ (311) In seinem Essay beantwortet Nietzsche diese Frage durchaus negativ (Kiesel 2004: 183): Genauso wie Gerber entlarvt er die Sprache als etwas Falsches und Künstliches (Heimböckel 2003: 325), indem er behauptet, dass die Sprache nur Nervenreizen in Lauten ausdrücke (vgl. 312), wodurch sie nicht die Wirklichkeit, sondern nur “die Relationen der Dinge zu den Menschen” ausdrücke, wobei sie sich von den „kühnsten Metaphern” bediene: „Ein Nervenreiz, zuerst übertragen in ein Bild! Erste Metapher. Das Bild wieder nachgeformt in einem Laut! Zweite Metapher“ (312). Er stellt daraufhin fest, dass wir nur subjektive ´Wahrheiten´, die wir selbst anhand der Sprache entworfen haben, kennen: „Wir glauben, etwas von den Dingen selbst zu wissen, wenn wir von Bäumen, Farben, Schnee und Blumen reden“, während wir “nichts als 2 Im Folgenden werden Zitate aus diesem Werk durch Angabe der Seitenzahl belegt. 10 Metaphern der Dinge, die den ursprünglichen Wesenheiten ganz und gar nicht entsprechen“ (312f.) verwenden. Hierdurch erweisen sich die Wahrheiten, die die Menschen mit ihrer Sprache auszudrücken glauben (vgl. Kiesel 2004: 184) als Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind, Metaphern, die abgenutzt und sinnlos kraftlos geworden sind, Münzen, die ihr Bild verloren haben und nun als Metall, nicht mehr als Münzen, in Betracht kommen“ (314), denn die Menschen drücken mittels der Sprache nicht die Wahrheit und Wirklichkeit aus, sondern nur wie sie sich die Dinge vorstellen und wie sie sie empfinden (vgl. Kiesel 2004: 184). Weil die Menschen vergessen, dass die Sprache metaphorisch und „anthropomorph” (ebd.: 184) – ´menschliche Eigenschaften besitzend´ - ist, glauben sie, dass sie zur objektiven Erkenntnis der Welt imstande seien (vgl. ebd.: 184). In Wirklichkeit werden sie aber in einem “Sprach- und Begriffsgefängnis“ (Vietta/Hans-Georg Kemper 1990, zit. nach Heimböckel 2003: 326) eingeschlossen, in dem sie die Dinge nicht „adäquat erfassen und begreifen“ (ebd.: 326) können. Über Wahrheit und Lüge wurde zunächst wenig Aufmerksamkeit entgegengebracht, auch nicht unter den Autoren, die sich nach Nietzsche mit Sprachkritik auseinandergesetzt haben (vgl. Kiesel 2004: 186). Anscheinend haben sowohl der Philosoph und Sprachkritiker Fritz Mauthner als auch der Schriftsteller Hugo von Hofmannsthal Über Wahrheit und Luge nicht gekannt: Mauthner warf Nietzsche sogar vor, dass er als Sprachkritiker „über einige aufzuckende Lichtblitze nicht hinausgelangt“ (Mauthner 1901/1902, zit. nach Kiesel 2004: 186) sei. Daneben zieht Kiesel in Zweifel, ob Hofmannsthal seinen Chandos-Brief überhaupt geschrieben hätte, wenn er Nietzsches Essay gelesen hätte (vgl. Kiesel 2004: 186). Schließlich ist festzustellen, dass die Sichtweise von Nietzsche auf die Sprache als metaphorisches und künstliches System Parallelen aufweist mit den Überlegungen des berühmten Linguisten Ferdinand de Saussure, der heutzutage als Begründer der modernen Linguistik betrachtet wird. In seinen Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft (1916) spricht er von dem ´arbiträren Charakter des sprachlichen Zeichens´: Aus seiner Sicht gibt es keinen natürlichen Zusammenhang zwischen einem sprachlichen Zeichen und dessen Bedeutung. Die Bedeutung eines Zeichens entsteht nur aufgrund einer Konvention, einer Verabredung zwischen Menschen (vgl. Brillenburg Wurth/Rigney 2008: 89) und hat also nichts mit den realen Dingen und Sachverhalten zu tun. Deswegen ist Sprache als ein soziales Produkt zu bezeichnen, das von Konventionen gesteuert wird. 11 Die Sprachkrise bei Mauthner: Beiträge zu einer Kritik der Sprache (1901/1902) Der Philosoph und Schriftsteller Fritz Mauthner wird als einer der wichtigsten Vertreter der Sprachskepsis und Sprachkritik der literarischen Moderne betrachtet (vgl. ebd.: 186). Sein dreibändiges Werk Beiträge zu einer Kritik der Sprache, in dem er den „Wahrheitsgehalt” (Sprengel 2004: 82) der Sprache kritisiert, gilt dabei als eines der fundamentalen Werke im 20. Jahrhundert und als einflussreiches Werk für viele Autoren (vgl. Arntzen 1982: 251), unter ihnen der Schriftsteller Hofmannsthal. Im Folgenden werden nur einige der Thesen, die er im ersten Teil des ersten Bands (Wesen der Sprache) vertritt und die für diese Arbeit relevant sind, mit Hilfe von Sekundärliteratur kurz vorgestellt. Schon in der Einleitung vom ersten Band der Beiträge kommt Mauthners Skepsis der Sprache gegenüber zum Ausdruck, als er feststellt, dass sie als „Erkenntniswerkzeug” (Mauthner 1923: 913) nicht geeignet ist: ”Im Anfang war das Wort." Mit dem Worte stehen die Menschen am Anfang der Welterkenntnis und sie bleiben stehen, wenn sie beim Worte bleiben. Wer weiter schreiten will, auch nur um den kleinwinzigen Schritt, um welchen die Denkarbeit eines ganzen Lebens weiter bringen kann, der muss sich vom Worte befreien und vom Wortaberglauben, der muss seine Welt von der Tyrannei der Sprache zu erlösen versuchen (1). Diese Betrachtung der Sprache als Beeinträchtigung bei der Erkenntnis führt Mauthner weiter aus, indem er behauptet, dass die Sprache als Mittel zur Erkenntnis als unzuverlässig und irreführend (vgl. Kiesel 2004: 187) zu beobachten ist. Seines Erachtens entsprechen die Worte, mit denen die Menschen sich ausdrücken, nicht der Wirklichkeit, da „das Wort […] ein so blasses Abstraktum [ist], dass ihm kaum mehr etwas Wirkliches entspricht” (4). Diese Worte rufen keine “Bilder der Wirklichkeitswelt” hervor, “sondern nur Bilder von Bildern von Bildern”, während “jedes einzelne Wort […] in sich eine endlose Entwicklung von Metapher zu Metapher“ trägt (Mauthner 1901/1902, zit. nach Kiesel 2004: 187). Daneben behauptet Mauthner, dass die Welterkenntnis durch die Sprache wegen der unbeständigen Bedeutung und Mehrdeutigkeit der Sprache unmöglich sei, wie er im folgenden Zitat illustriert: „Weil die Sprache lebendig ist, so bleibt sie nicht unverändert vom Anfang eines Satzes bis zu seinem Ende. "Im Anfang war das Wort"; da, beim Aussprechen des fünften Wortes, verwandelt schon das erste Wort "im Anfang" seinen Sinn“ (2). Er betont hingegen, 3 Im Folgenden werden Zitate aus diesem Werk durch Angabe der Seitenzahl belegt. 12 dass die Menschen davon ausgehen, dass die Sprache ein zuverlässiger „treuer Führer” ist, während sie in Wirklichkeit durch die mehrdeutigen, in “Nebel“ gehüllten Wörter ahnungslos irregeführt werden (94). Auffallend ist allerdings, dass Mauthner zwischen verschiedenen Funktionen der Sprache unterscheidet, nämlich zwischen Sprache als „elende[m] Erkenntniswerkzeug“ und Sprache als „herrliche[m] Kunstmittel“ (Mauthner 1968, zit. nach Heimböckel 2003: 330) für die Dichtung, in der sie als Kunst auftritt (vgl. Heimböckel 2003: 330f.). Wo die Sprache seiner Meinung nach einerseits als Erkenntnismittel jämmerlich versagt, da sie die Wirklichkeit nicht abbilden kann, ist sie andererseits als dichterisches Mittel durchaus geeignet, weil das Ziel der Dichtung nach Mauthner nicht die Erkenntnis oder das ´Ausdrücken´ der Wirklichkeit sei, sondern die „Artikulation von Stimmungen und Gefühlen“, wobei nicht der „Vorstellungswert“ der Sprache, sondern deren „Klangwert“ am wichtigsten sei (Kiesel 2004: 187). 2.2.3. Die literarische Sprachkrise Hugo von Hofmannsthal: Ein Brief (1902) Der Prosatext Ein Brief, auch Chandos-Brief genannt, gilt heute als der Schlüsseltext der literarischen Moderne (Kimmich/Wilke 2006: 112), der das sprachkritische Bewusstsein der Moderne spiegelt (vgl. Beutin e.a. 2008: 358) und sogar als „Geburtsurkunde der modernen Literatur“ (Koch 1989: 131) bezeichnet wird. Der Text ist mittlerweile so oft interpretiert und analysiert worden, dass die Rezeptionsgeschichte des Textes kaum mehr überschaubar ist (vgl. Fähnders 2010: 118). In diesem Teilkapitel wird versucht, anhand verschiedener Sekundärquellen eine kurze, aber doch aufschlussreiche Beschreibung der Sprachkritik in diesem Werk zu geben. In dem fiktiven Brief, der an den berühmten Philosophen und Staatsmann Francis Bacon gerichtet ist, beschreibt der 26jährige Dichter Lord Chandos, wie ihm „völlig die Fähigkeit abhanden gekommen [ist], über irgendetwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen” (Hofmannsthal 1951: 124) und entschuldigt er sich auf diese Weise wegen „des gänzlichen Verzichtes auf literarische Betätigung“ (7). Am Anfang des Briefes schildert Chandos, wie er, bevor er in seinen krisenhaften Zustand stürzte, noch imstande war, die Welt als Einheit wahrzunehmen (vgl. Kiesel 2004: 192): „[…] Mir erschien damals in einer Art von andauernder Trunkenheit das ganze Dasein als eine große Einheit: geistige und körperliche Welt schien mir keinen Gegensatz zu bilden, ebensowenig höfliches und tierisches Wesen, 4 Im Folgenden werden Zitate aus diesem Werk durch Angabe der Seitenzahl belegt. 13 Kunst und Unkunst, Einsamkeit und Gesellschaft […] Überall war ich mitten drinnen, wurde nie ein Scheinhaftes gewahr“ (11). Kurz darauf umschreibt Chandos allerdings, wie diese Einheit und damit den Zusammenhang zwischen Wirklichkeit und Sprache für ihn definitiv zerstört wurde, wodurch er sein früheres Vertrauen in die Sprache verlor: Es zerfiel mir alles in Teile, die Teile wieder in Teile, und nichts mehr ließ sich mit einem Begriff umspannen. Die einzelnen Worte schwammen um mich; sie gerannen zu Augen, die mich anstarrten und in die ich wieder hineinstarren muss: Wirbel sind sie, in die hinabzusehen mich schwindelt, die sich unaufhaltsam drehen und durch die man ins Leere kommt (14). Dabei scheinen verschiedene Funktionen der Sprache, die Chandos bisher vertraut waren, hintereinander auszufallen: Zuerst zerfallen abstrakte Worte, wie „‘Geist‘, ‚Seele‘ oder ‚Körper´” ihm „im Munde wie modrige Pilze“ (12f.), danach kann er sogar die Worte, die in alltäglichen Gesprächen vorkommen, nicht mehr ertragen (vgl. Heimböckel 2003: 333), weil sie nach seiner Ansicht „so unbeweisbar, so lügenhaft, so löcherig wie nur möglich” (14) sind: „Es wurden mir auch im familiären und hausbackenen Gespräch alle die Urteile, die leichthin und mit schlafwandelnder Sicherheit abgegeben zu werden pflegen, so bedenklich, dass ich aufhören musste, an solchen Gesprächen irgend teilzunehmen“ (Hofmannsthal 1902, zit. nach Heimböckel 2003: 333). Aus diesen Erkenntnissen geht hervor, dass Chandos sowohl die sogenannte Referenzfunktion der Sprache, nämlich die Funktion, auf Dinge zu verweisen, als auch die soziale Funktion der Sprache, die Funktion der Sprache als Kommunikationsmittel, verwirft. Aufgrund der Verbindung von Sprache und Erkenntnis im Brief lässt sich feststellen, dass die Sprachkrise von Chandos gleichzeitig als „Erkenntnis- und Orientierungskrise“ aber auch als „Ich-Krise“ gekennzeichnet werden kann (Kiesel 2004: 194), da es zwischen Chandos und der Welt jetzt keine Einheit mehr gibt, sondern eine Spaltung zwischen ihm als wahrnehmendem Subjekt und der Welt als wahrgenommenem Objekt (vgl. ebd.: 194). Der Identitätsverlust, der diese Krise zur Folge hat, wird schon aus einem der ersten Sätzen seines Briefes ersichtlich: „Kaum weiß ich, ob ich noch derselbe bin, an den Ihr kostbarer Brief sich wendet […]“ (7). Chandos kann sich kaum noch mit seinem jüngeren Ich identifizieren (vgl. Nägele 1970: 723), weil er sich dessen bewusst wird, dass er durch seinen veränderten Blick auf die Welt und seine Einsicht, dass Sprache die Wirklichkeit nicht wiedergeben könne, nicht mehr der Schriftsteller ist, der er vor einigen Jahren war. Als Folge seiner Erkenntnisse leidet er unter einer „furchtbare[n] Einsamkeit“ (ebd.: 15) und einer „geistige[n] Starrnis“ (7). 14 Es lässt sich allerdings feststellen, dass Chandos´ Zustand der Melancholie durch sogenannte „gute Augenblicke” unterbrochen wird (vgl. Kiesel 2004: 197), in denen es ein „fieberisches Denken“ gibt, ein „Denken in einem Material, das unmittelbarer, glühender ist als Worte” (21). Diese ‚wortlose[n] Augenblicke‘ können logischerweise auch nicht mittels Sprache beschrieben werden (vgl. Kiesel 2004: 195), wie Chandos deutlich macht: „Es wird mir nicht leicht, Ihnen anzudeuten, worin diese guten Augenblicke bestehen; die Worte lassen mich wiederum im Stich. Denn es ist ja etwas völlig Unbenanntes und auch wohl kaum benennbares, das in solchen Augenblicken […] mir sich ankündet” (15). Später versucht er trotzdem zu schildern, wie er diese Augenblicke erfährt, nämlich als „[…] ein ungeheueres Anteilnehmen, ein Hinüberfließen in jene Geschöpfe […]“ (17), wobei er nicht weiß, ob er diese Erfahrungen körperlich oder geistlich erfährt (vgl. 19). Kimmich und Wilke bezeichnen diese Augenblicke als “epiphanische Erlebnisse”, offenbarende Momente „eines gelingenden, unmittelbaren Erlebens“ (Kimmich/Wilke 2006: 117) von Gegenständen und Wesen, während Kiesel annimmt, dass diese Augenblicke als Momente zu betrachten sind, in denen es keine Relation zwischen Subjekt und Objekt mehr gibt, sondern eine „Ganzheit von Welt und Sein“ (Kiesel 2004: 197). Gleichzeitig können diese Augenblicke auch als eine Mach‘sche Auflösung des Ichs beobachtet werden: Chandos verliert sich in der Betrachtung von Gegenständen und ist nicht nur das beobachtende Subjekt, sondern Subjekt und Objekt zugleich. Es ist zu beobachten, dass Chandos seine Sprachnot mit Hilfe von metaphern- und bildreicher Sprache auszudrücken versucht: Er umschreibt, wie die Worte ihm wie „modrige Pilze” im Mund zerfallen, sein Sprachzweifel “breitet sich […] aus wie ein um sich fressender Rost” und eine seiner Visionen umschreibt er als einen „Splitter“ in seinem Gehirn (vgl. Kimmich/Wilke 2006: 120). Obwohl es angeblich scheint, dass es eine Kluft zwischen dieser „Beredsamkeit“ (Heimböckel 2003: 333) des Chandos und dem Sprachverlust, unter dem er leidet, gibt, werden diese beiden Elemente nach Fähnders im Brief kombiniert, um eine Bändigung der Sprachkrise zu erreichen: „Die Krise wird […] zur produktiven Sprachkritik umgemodelt: weder schweigt Hofmannsthal, noch verstummt Chandos” (Fähnders 2010: 118). Nach seiner Meinung gehen im Brief Sprachkrise und Sprachkompetenz Hand in Hand (vgl. Fähnders 2010: 118): Indem Chandos eine Sprache verwendet, die reich an Metaphern und Bildern ist, um seine Sprachkrise zu beschreiben, wird „die Ohnmacht vor den Begriffen kompensiert durch die Macht über die Bilder, durch die Kunst der metaphorischen […] Rede” (ebd. Riedel 1996, zit. nach Fähnders 2010: 118). 15 Jedoch lässt sich sagen, dass der Brief in Schweigen mündet, da Chandos behauptet, dass er nie mehr ein englisches oder lateinisches Buch mehr schreiben wird, da es eine andere Sprache gibt, die er beschreibt als „eine Sprache, von deren Worten mir auch nicht eines bekannt ist, eine Sprache, in welcher die stummen Dinge zu mir sprechen“ (22). Kimmich und Wilke behaupten, dass diese ´Sprache der Dinge´ die einzige Sprache ist, mit deren Hilfe Chandos seine Erfahrungen während der ´guten Augenblicke´ ausdrücken vermag, weil die Dinge in dieser Sprache selbst sprechen, während sie üblicherweise nur indirekt sprechen, wenn man über sie redet oder schreibt (vgl. Kimmich/Wilke 2006: 119). Sprachkritische Gedichte: Rilke, Morgenstern Um einen Eindruck davon zu bekommen, auf welche Weise Sprachkritik in Gedichten nach 1900 zum Ausdruck kam, werden in diesem Teilkapitel zwei sprachkritische Gedichte kurz analysiert, nämlich Ich fürchte mich so für des Menschen Wort von Rainer Maria Rilke und Fisches Nachtgesang von Christian Morgenstern. In seinem Gedicht Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort, das 1899 in dem Gedichtband „Mir zu Feier“ erschien, beklagt sich Rilke, der selbst unter einer langwierigen Identitäts- und Schreibkrise sowie unter Zweifeln über die Brauchbarkeit der Sprache litt (vgl. Kiesel 2004: 218), über die Mangelhaftigkeit der Sprache, indem er das lyrische Ich über seine Angst vor der Sprache der Menschen erzählen lässt. Laut diesem Ich kann diese Sprache die Dinge nicht beschreiben, obwohl die Menschen selbst der Meinung sind, dass sie mit dieser Sprache ein geeignetes Ausdrucksmittel in Händen haben, mit dessen Hilfe sie alles benennen und beschreiben können und wodurch ihnen nichts mehr als unerklärlich oder erstaunlich erscheint: „sie wissen alles, was wird und war; / kein Berg ist ihnen mehr wunderbar“ (Rilke 1909: 91, V. 6/7). Daneben meinen die Menschen aufgrund ihrer vermeintlichen Fähigkeit, alles in Worten fassen zu können, fast göttergleich zu sein, wie das lyrische Ich umschreibt: „Ihr Garten und Gut grenzt gerade an Gott” (V. 8). In der letzten Strophe wird die Grenze zwischen dem Ich und den Menschen überschritten, indem das Ich die Menschen nicht mehr mit dem Wort ‚sie‘ auf Abstand hält, sondern sie direkt mit ‚ihr‘ anredet. In dieser Strophe fordert er sie auf, Abstand von den Dingen zu nehmen, weil sie aus seiner Sicht die Dinge ermorden, wenn sie die Sprache benutzen, um die Dinge direkt ‚anzufassen‘. Mit ihrer Sprache brechen sie das Singen der Dinge, das das Ich so gerne hört, rüde ab, wodurch die Dinge „starr und stumm“ (V. 11) werden, woraufhin das lyrische Ich folgert: „Ihr bringt mir alle die Dinge um“ (V. 12). Hierdurch entsteht der Eindruck, dass das lyrische Ich genauso wie Lord Chandos nach einem 16 ‚Reden‘ oder in diesem Fall nach einem Singen der Dinge selbst strebt, weil ihre Bedeutung oder vielmehr ihre Essenz durch die Sprache der Menschen, die in seinen Augen zu „deutlich“ (V. 1) ist, vernichtet wird. Charles Hohmann vertritt die These, dass Rilke in diesem Gedicht mit seiner Warnung, man zerstöre mit Worten die Dinge, anzudeuten versucht, dass der Dichter die Unvollkommenheit der Sprache überwinden kann, indem er das Wesen der Dinge in Gedichten fasst, wie Rilke später selbst in seinen Ding-Gedichten versuchen würde (Hohmann o.J.). In diesen Gedichten lässt Rilke das lyrische Ich zurücktreten, um die Dinge genau beobachten und beschreiben zu können (vgl. Kimmich/Wilke 2006: 138) und auf diese Weise die Dinge „in ihrer Wesenheit zu fassen” (Hohmann o.J.): Hier verschwindet genauso wie in dem Chandos-Brief das Ich, um sich in der Beobachtung der Dinge zu verlieren. Beispielsweise ist das berühmte Dinggedicht Der Panther, in dem Rilke ein detailliertes Bild eines eingesperrten Panthers in dem Pariser Jardin des Plantes schildert, wobei er sowohl die äußerlichen Merkmale - den weichen Gang, den müden Blick - als auch das Innere des Tieres darstellt: „Dann geht ein Bild hinein, / geht durch der Glieder angespannte Stille - / und hört im Herzen auf zu sein“ (Rilke 1907). Die Vorstelllung, die in den Dinggedichten zum Ausdruck kommt, nämlich dass die Essenz der Dinge erst durch die „heraufbeschwörende Kraft des dichterischen Worts” festgehalten werden kann, ist nach Kiesel für den Großteil der modernen Dichtung von wesentlicher Bedeutung (vgl. Kiesel 2004: 199). Schließlich lässt sich feststellen, dass Rilke in diesem Gedicht die Aufmerksamkeit der Leser auf die Sprache selbst lenkt, indem er sie durch viele Wiederholungen als sehr regelmäßig und ´ordentlich´ erscheinen lässt. Es gibt im Gedicht zum Beispiel ein umarmendes Reimschema und viele Alliterationen, wie „Hund und Haus” im dritten Vers und Garten – Gut – grenzt – gerade – Gott im achten Vers. Daneben lässt sich beobachten, dass es einen ´fließenden´ Rhythmus im Gedicht gibt: Obwohl es kein regelmäßiges, immer zurückkehrendes Versmaß gibt, wird durch die Anwesenheit der vier Hebungen pro Zeile und den immer wiederkehrenden Endreim doch der Eindruck erweckt, dass die Betonung der Worte immer regelmäßig ´auf- und niedergeht´. Es lässt sich konstatieren, dass Inhalt und Sprache des Gedichts zusammen die Sprachkritik zustande bringen: Rilke hat die Sprache der Menschen, die er als verwerflich betrachtet, hier auf eine andere Weise eingesetzt, indem er sie mittels Alliterationen und Wiederholungen auf eine dichterische Weise verwendet hat. Eine ganz andere Weise, auf die verschiedene Dichter um 1900 sich mit der Sprachkrise auseinandersetzen, ist das Spielen mit der Sprache, das sich in radikaler Form in der Lyrik von avantgardistischen Autoren ab 1910 (vgl. Kiesel 2004: 201), aber auch schon früher, in der Lyrik Christian Morgensterns finden lässt. Er übt in seinem Gedichtband 17 Galgenlieder (1905) Kritik an der Sprache, indem er Sprachkonventionen durchbricht und auf diese Weise die von Nietzsches und Mauthner vertretene Überzeugung, dass Sprache ungeeignet sei, die Wirklichkeit zu repräsentieren, in seinen Gedichten sprachlich umsetzt (vgl. Kimmich/Wilke 2006: 99). Ein berühmtes Gedicht aus diesem Band, in dem diese Auffassung über die Sprache bis ins Extreme weitergeführt worden ist, ist Fisches Nachtgesang. Es lässt sich beobachten, dass die Sprache in diesem Gedicht - mit Ausnahme des Gedichttitels – komplett durch etwas Bildhaftes ersetzt worden ist, nämlich durch Hebungen (-) und Senkungen (U), die den Nachtgesang des Fisches wortlos darstellen. Durch die Verwendung von sprachlosen Zeichen wird der Eindruck erzeugt, dass die Dinge oder die Ereignisse, in diesem Fall das Singen des Fisches, hier unmittelbar und ohne Umwege wiedergegeben werden. Im Gegensatz zu den Dingen aus Rilkes Gedicht wird das Singen der Dinge hier nicht unterbrochen, sondern hört der Gesang nicht auf zu klingen, weil die Sprache, die versagt, dieses Singen adäquat wiederzugeben oder nur festzulegen, hier schweigt. Hier ist der Inhalt des Gedichts nicht mehr das Wichtigste, sondern die Form, die durch ihre sprachlose Verfremdung die Aufmerksamkeit der Leser auf sich zieht: Hier wird nicht nur mit der ´normalen´ Umgangssprache der Menschen, sondern auch mit der klassischen Auffassung und Struktur von Gedichten gebrochen (vgl. Wilson 2003: 262). Schließlich lässt sich konstatieren, dass es auch in diesem Gedicht eine ´Ichlosigkeit´ gibt (vgl. Kimmich/Wilke 2006: 99): Das sprachlose ´Bild´ des Gesangs der Dinge steht im Vordergrund, während das lyrische Ich abwesend ist. 2.2.4. Schlussfolgerung: Konturen der Sprachkrise um 1900 Aufgrund der Behandlung der Werke in dem vorgehenden Kapitel lässt sich sagen, dass die Sprachkrise um 1900 als eine Verbindung von Sprach-, Erkenntnis- und Orientierungskritik und gleichzeitig als Ich-Krise aufzufassen sei. In den philosophischen Texten, die in diesem Kapitel behandelt wurden, wird vor allem die Rolle der Sprache als unzulängliches und unzuverlässiges Mittel zur Erkenntnis in den Vordergrund gerückt. Nietzsche behauptet, dass die menschliche Erkenntnis nichts mit der absoluten Wahrheit zu tun hätte, woraufhin er feststellt, dass die Sprache, die die Menschen verwenden um eine Wahrheit festzulegen, nicht die Dinge selbst beschreibe, sondern nur die Beziehung der Menschen zu diesen Dingen. Aus seiner Sicht sei die Sprache deswegen als etwas Falsches und Künstliches zu betrachten, das die Wirklichkeit nicht abbilden kann. Auch Mauthner folgert, dass die Sprache als Erkenntnismittel nicht geeignet sei, weil Worte nur „Bilder von Bildern von Bildern” sind (Mauthner 1901/1902, zit. nach Kiesel 2004: 187) und die Sprache eine unbeständige 18 Bedeutung hat und mehrdeutig ist. Im Gegensatz zu Nietzsche behauptet er allerdings, dass die Sprache als dichterisches Mittel schon geeignet sei, da das Ziel der Dichtung nicht das Beschreiben der Wirklichkeit sei. Im Chandos-Brief wird die Sprachkrise auch als Erkenntniskrise betrachtet: Chandos ist nicht mehr imstande, die Welt als Einheit wahrzunehmen, wodurch der Zusammenhang zwischen Sprache und Welt verschwindet und er sein Vertrauen in die Sprache verliert. An die Stelle der ´normalen´ Sprache, die Sprache der Menschen, tritt dennoch eine andere Sprache, wovon Chandos jedoch kein Wort kennt, nämlich die stumme Sprache der Dinge. Wegen der Unzulänglichkeit seiner eigenen Sprache im Vergleich zu dieser Sprache beschließt Chandos, zu schweigen. Ferner lässt sich erkennen, dass die Erkenntniskrise in dem Brief mit einer Ich-Krise einhergeht: Durch die Kluft zwischen Chandos und der Welt leitet er unter Identitätsverlust, während er während der sogenannten ´guten Augenblicke´ ein Verschwinden des Ichs erfährt. Auch Rilke unterscheidet in seinem Gedicht zwischen der Sprache der Menschen und dem Singen der Dinge, und warnt die Menschen vor der Zerstörung der Dinge durch die Sprache. Daneben lässt sich konstatieren, dass sowohl Rilke als auch Morgenstern in ihren Gedichten versuchen, eine eigene, einzigartige dichterische Sprache zu kreieren, die sich von der üblichen Sprache der Menschen abhebt: Rilke verwendet Alliterationen und Klangwiederholungen, während Morgenstern mit der Sprache spielt und im Fall des Gedichts Fisches Nachtgesang die Sprache sogar komplett schweigen lässt, wodurch nur die Sprache der Dinge, in diesem Fall der Nachtgesang des Fisches, übrig bleibt. Hierdurch entsteht der Eindruck, dass Morgenstern den Streben von Chandos und Rilke, sich in der stummen Sprache auszudrücken und die Dinge selbst ´singen´ und ´reden´ zu lassen, in diesem Gedicht verwirklicht: Das Bild bringt die Sprache hier zum Schweigen, aber den Fisch zum Sprechen. Ferner prägt die Auflösung des Ichs, die bei Rilke in seinen Dinggedichten stattfindet, sich auch in Morgensterns Gedicht aus: Das lyrische Ich ist hier abwesend, es gibt nur noch das Bild und die ´stumme Sprache´ der Dinge. 19 3. Die Sprachkrise bei Ernst Jandl 3.1. Jandls literarischer Hintergrund: Dadaismus, Die Wiener Gruppe, konkrete Poesie Der Autor Ernst Jandl (1925-2000) ist heutzutage nicht aus der deutschsprachigen Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wegzudenken (vgl. Kaukoreit/Pfoser 2002: 7). Neben Hörspielen, Prosatexten, Theaterstücken, Übersetzungen, Rezensionen und Vorträgen veröffentlichte er mehr als zwanzig Gedichtbände. Sein sehr verschiedenes Oeuvre erstreckt sich von konventionellen Gedichten in Alltagssprache, in denen traditionelle poetische Muster eingesetzt werden, über experimentelle Formen wie visuelle Gedichte, Lautgedichte und Gedichte in denen die Sprache von Gastarbeitern und Migranten, die er selbst als ‚heruntergekommene Sprache‘ bezeichnete, verwendet wird (vgl. Jens 1990: 608). Jandl selbst behauptete aufgrund der Verschiedenheit seiner Gedichte, dass er die Frage, welcher poetischen Richtung er angehöre, nicht beantworten könne (vgl. Kaukoreit/Pfoser 2002: 8). Bekannt wurde er jedoch vor allem durch seine experimentelle, sprachspielerische und konkrete Lyrik, die er vortrug und auf Schallplatten verewigte und mit der er ein großes Publikum begeisterte. In diesen Gedichten werden Sprachspiel und Ernst miteinander vereinigt, um den Leser zum ´Mitmachen‘, zu einer aktiven Aufnahme des Gedichts und dessen Sprache zu bewegen, wie W. Harig zusammenfasst: „Die Ernsthaftigkeit des Spielerischen und das Spielerische des Ernstes sind in Jandl zur existentiellen Einheit verschmolzen. Jandl ist ein ernster Mensch, der spielt, weil die Notwendigkeit des Spiels zum Überleben des Menschen für ihn zum Programm geworden ist: Der Mensch überlebt nur, wenn er Interesse zeigt, Anteil nimmt, dazwischentritt“. Ernst Jandl selbst drückt seinen Wünsch, den Leser zu einer aufmerksamen und kritischen Lektüre zu bewegen, kurz und bündig aus: „was ich will, sind gedichte, die nicht kalt lassen” (Jens 1990: 608). Als Vorbereitung auf die Analyse einiger Gedichte Jandls wird in diesem Paragraphen der literarische Hintergrund Jandls erörtert, indem einige Gruppen und Strömungen, die seine Auffassungen über Lyrik und Sprache geprägt haben, vorgestellt werden, nämlich der Dadaismus, die Wiener Gruppe und die konkrete Poesie. Es lässt sich erkennen, dass die Wurzeln der Sprachspiele Jandls in der Kunstrichtung des Dadaismus liegen, die als radikale Weiterentwicklung der sprachkritischen Ideen um 1900 zu betrachten ist. Jandl selbst hat mehrmals bestätigt, sich an dadaistischen Dichtern geschult zu haben (Kiesel 2004: 285). Die Dadaisten betrachteten die Sprache als „die schlimmste Konvention [von allen]“ (Breton 1920, zit. nach Szymańska 2009: 40) und entwarfen mit ihren Sprachspielen eine neue, „authentische” Sprache, die laut Kiesel als die Sprache zu betrachten ist, die Chandos sich wünschte, nämlich eine, „die eine natürliche Verwandtschaft 20 mit den Dingen haben und ihr Wesen ausdrücken sollte; […] die Kommunikation mit den Dingen ermöglichen sollte” (Kiesel 2004: 209). Das hervorragendste Beispiel eines dadaistischen Sprachspiels ist das sogenannte ‚Lautgedicht‘, das heutzutage als Inbegriff des Dadaismus gilt und das von Hugo Ball, einem der Begründer der Dada-Bewegung, erfunden wurde (vgl. ebd.: 208). Ball notierte am 23. Juni 1916, dass er „eine neue Gattung von Versen erfunden [hatte], ‚Verse ohne Worte‘ oder Lautgedichte“ (Ball 1992, zit. nach Kiesel 2004: 208), und erläuterte in einem Bericht am 24. Juni 1916 die Idee hinter dieser neuen Art von Dichtung, die Jandl etwa vierzig Jahre später in seiner experimentellen Lyrik weiterentwickeln würde: Man verzichte mit dieser Art Klanggedichte in Bausch und Bogen auf die durch den Journalismus verdorbene und unmöglich gewordene Sprache. Man ziehe sich in die innerste Alchimie des Wortes zurück, man gebe auch das Wort noch preis, und bewahre so der Dichtung ihren letzten heiligsten Bezirk. Man verzichte darauf, aus zweiter Hand zu dichten: nämlich Worte zu übernehmen (von Sätzen ganz zu schweigen), die man nicht funkelnagelneu für den eigenen Gebrauch erfunden habe (ebd.: 209). Weiterhin ist festzustellen, dass Jandl, der einen engen Kontakt zu den Lyrikern der Wiener Gruppe hatte und der sich in seinem Gedicht verwandte als „der Onkel“ (Jandl 1990: 8) der Gruppe bezeichnete, weitgehend von ihnen beeinflusst wurde (vgl. Baumann/Oberle 1996: 291). Diese Gruppe war eine Vereinigung von österreichischen Schriftstellern, die die Absicht verfolgten, die künstlerischen Mittel der historischen Avantgarden – Bewegungen wie Dadaismus, Futurismus, Expressionismus, Surrealismus - weiterzuentwickeln, um auf diese Weise eine neue „zeitgemäßere“ Kunst zu schaffen (Kiesel 2004: 284). Sie knüpften an die neuen dichterischen Ausdrucksmöglichkeiten der Dadaisten an, indem sie experimentelle Texte produzierten, in denen die Sprache als Gegenstand im Vordergrund gestellt und der „traditionelle Mitteilungscharakter der Sprache” vernichtet wurde. Daneben wollten sie in ihren Werken auf eine spielerische Weise zeigen, wie das System Sprache, die „Sprachfabrik”, funktioniere, wie Vera-Rose Hermann und Lydia Murauer (1988) behaupten. Hermann und Murauer zufolge betrachten die Autoren der Gruppe die Sprache als einen „großen Apparat”, der immer dasselbe produziert. Wenn der Autor allerdings darstellt, wie die Fabrik der Sprache funktioniert, sei er keinen „Konsument[en] vorgefertigter sprachlicher Normen“ mehr, sondern wird zu dem „Maschinenmeister und Oberaufseher, der die Produktion überwacht“ (Hermann/Murauer 1988: 157), der sich aktiv mit der Sprache auseinandersetzt und eine neue, unkonventionelle Sprache ´produziert´. Um den veränderten 21 Charakter der Sprache in der Dichtung artikulieren zu können, beschäftigten sich viele Dichter der Gruppe mit konkreter Poesie (vgl. Beutin u.a. 2008: 630). In der konkreten Poesie, einer literarischen Strömung die eine lange Tradition von der Antike bis ins Barock hat, aber in den fünfziger Jahren einen Aufschwung erfuhr (vgl. Klarer 1999: 66), wenden die Texte sich sowohl gegen die „Inhaltlichkeit der Poesie” als gegen die traditionellen Versformen (vgl. Beutin u.a. 2008: 629), indem die Sprache als Material in den Mittelpunkt gerückt wird. Die Verfasser dieser Lyrik gingen davon aus, dass die Poesie nicht das Ziel habe, „Gedanken, Gefühle, Befindlichkeiten“ darzustellen, sondern dass Poesie „Arbeit in und an der Sprache“ sei (vgl. Barner 2006: 230). Sie versuchten mittels Sprachexperimente, in denen sie mit konventionellen sprachlichen Mitteln brachen und spielerisch mit der Sprache umgingen, den Leser dazu anzuregen, sich aus dem Denken der üblichen grammatikalischen Strukturen und Modelle zu befreien und ihn auf diese Weise zum individuellen und bewusstem Denken und zu einem „neuen Sprachverständnis“ zu bewegen (vgl. De Nil 1985: 7). Auch der „Sprach-Hexer” (Spiegel Online 2000) und “Wortverdreher” (Baumann/Oberle 1985: 291) Jandl strebt nach einer Verfremdung, einem ‚Stolpern‘ der Sprache, wie aus seiner eigenen Umschreibung seiner Werke ersichtlich wird: „Im übrigen schrieb und schreibe ich Texte, deren Einordnung ich anderen überlasse, in einer auf verschiedene Weise aus dem gewohnten in ein ungewohntes Gleichgewicht gebrachten Sprache“ (vgl. Kaukoreit/Pfoser 2002: 8). Aus Jandls Sicht soll die Dichtung zu einem neuen Verständnis der Sprache und der Dichtung führen (vgl. Bayerl 2002: 244), wie er in seinem Buch Die schöne Kunst des Schreibens (1976) erklärt: In der Poesie […] brauchen wir alles, woran wir uns nicht gewöhnt haben; wir brauchen es, um Poesie überhaupt anfangen zu können, etwas, das ein Beginnen ist. Alles, woran wir uns ständig gewöhnt haben, lässt kein Beginnen mehr zu, lässt nicht zu, dass wir irgend etwas damit anfangen (Jandl 1976, zit. nach Bayerl 2002: 244). Laut Jandl braucht Poesie demnach Kreativität und neu erfundene Konventionen, damit sie etwas Neues und Unkonventionelles und neue Erfahrungen hervorbringen kann, aber auch eine dadaistische Zerstörung der alten Sprache, einen ´Neubeginn der Sprache´, der durch Sprachspielereien und Sprachwitze entsteht. In den folgenden Gedichtanalysen wird festgestellt, auf welche Weisen Jandl die Sprache einsetzt, um Kritik an der ´alten´, üblichen Sprache zu liefern und gleichzeitig eine ´neue´ Sprache zu kreieren, um die Sprachkrise wie 22 sie auch in der Literatur und Philosophie um 1900 vorkommt, nämlich die Unmöglichkeit der alten Sprache, die Wirklichkeit wahrheitsgetreu zu beschreiben, überwinden zu können. 3.2. Gedichtanalysen 3.2.1. schtzngrmm Das Gedicht schtzngrmm, das 1966 in dem Band Laut und luise unter der Rubrik Krieg und so erschien, ist eines der bekanntesten, meistgedruckten und meistinterpretierten Gedichte Jandls (vgl. Wulff 1978: 129). Das Gedicht ist als „phonetisches Kriegsgedicht” (De Nil 1985: 14) zu umschreiben: Kriegserlebnisse werden hier mittels klanglicher Spielereien dargestellt. Das erste ´Wort´, schtzngrmm, das zugleich Titel des Gedichts ist, versetzt den Leser laut Lieve de Nil sofort in den “militärischen Bereich“, da dieses Wort als Zusammenziehung des Wortes ‚Schützengräben´ aufzufassen ist, das durch das Weglassen der Vokale und Zusammenziehung der Konsonanten b und n zu einem m eine verfremdende Form bekommt (ebd.: 12), die dem Leser wie ein Brummen von Kriegsmaschinen entgegenkommt. Das Ausfallen der Vokale lässt sich im ganzen Gedicht finden: Hier gibt es nur ´harte´ Konsonanten und keine „Milderung” durch ‚weiche‘ Vokale (Hinderer 2002: 57) oder „sanfte Labiale“ wie w oder b (Hiebel 2006: 233). Gleichzeitig lässt sich das Ausfallen der Vokale im Gedicht als Symbol für den Verlust von Menschenleben in den Schützengräben auffassen, wie Rolf Schneider in seiner Interpretation des Gedichts feststellt: „Mir scheint im Fortfall der Vokale zunächst die simple Einsicht versteckt, dass der Schützengraben ein Ort ist, wo sich Verluste ereignen“ (Schneider 1985, zit. nach Hinderer 2002: 56). In der zweiten Zeile des Gedichts wird das ´Wort´ ´schtzngrmm´ wiederholt, woraufhin der Kriegslärm in der dritten Zeile wirklich losbricht: Hier findet man eine t-Reihe, in der der Konsonant t achtmal wiederholt wird. Diese Reihe ruft wegen der Erwähnung der Schützengräben am Anfang des Gedichts die Assoziation mit dem Lärm eines Maschinengewehrs hervor. Die Lautgruppe grrrmmm auf der vierten Zeile kann als das Brummen eines Motors aufgefasst werden, bevor das Feuern der Maschinengewehre in einer neuen t-Wiederholung wieder anfängt, bis auf der sechsten Zeile und auf der siebten Zeile „etwas Zischendes”, wie ein Schuss oder eine pfeifende Bombe vorbeikommt, als die Laute s-------c--------h erscheinen (De Nil 1985: 12). Nach diesem kurzen Intermezzo kehrt das Wort schtzngrmm wieder, diesmal nicht nur als „Konsonantenskelett” (Wulff 1978: 129) des Wortes ‚Schützengräben´, sondern als eine Verstümmelung dieses Skeletts, wie ein Soldat, der durch einen Bombeneinschlag eines seiner Glieder verloren hat, nämlich als tzngrmm. Danach erscheint der erste Teil der Klanggruppe ´schtzngrmm´, nämlich ´schü´, der in 23 ´tzngrmm´ weggefallen ist, wieder in dem ´Wort´ schtzn in der 12. und 13. Zeile, das als der Laut einer zischenden Granate oder als Schusslaut, aber auch als eine Verkürzung des Wortes ´schützen´ betrachtet werden kann und bei dem es laut De Nil undeutlich ist, ob mit diesem Wort einen Befehl zum Schützen oder den Wünsch, sich vor dem Feuern zu schützen, geäußert wird (vgl. De Nil 1985: 13). Daraufhin folgt wieder das Schießen der Maschinengewehre und andere Kriegsgeräusche, wie grrt, scht und tssssssssssssss, die von den Lautgruppen schtzngrmm und tzngrmm unterbrochen werden. Diese Gruppen ziehen sich wie strukturierende Soldatenmärsche durch das Gedicht und erinnern den Leser an den Ort, an dem er sich beim Lesen zusammen mit den kämpfenden Soldaten befindet. Schließlich ertönen die Maschinengewehre in der 28. Zeile ein letztes Mal, bis die Beantwortung der Schüsse aus der feindlichen Linie in der Wiederholung des Wortes ´scht´ und in dem abschließenden, alles zerstörenden ´grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr´ erschallt. Nach dem Schweigen dieses letzten Schusses, in der letzten Zeile, bleibt nur das ´t-tt´ übrig, das man als ´tot´ erkennen kann: Der Lärm endet mit dem „Resultat, auf das Feuerwaffen und Geschütze zielen“ (Hiebel 2006: 234), nämlich mit dem plötzlichen Tod, der hier durch einen knallenden, „explosiven Schlussakkord” (ebd.: 235) lautlich dargestellt wird. Das ´Wort´ t-tt artikuliert hier den Leitgedanken des Gedichts, der das Gedicht zum Anti-Kriegsgedicht macht, wie De Nil zusammenfasst: „Die Kriegshandlungen führen in den Abgrund des Todes“ (De Nil 1985: 13). Es lässt sich sagen, dass Jandl den Schützengrabenkrieg und dessen Lärm in diesem ´Sprechgedicht´, das laut Jandl „erst durch lautes Sprechen wirksam“ wird (Universität Duisburg/Essen o.J.), mittels Laute dargestellt hat, wie er selbst erklärt: „Laut und Lautfolgen werden [hier] imitatorisch eingesetzt: die Stimme imitiert Schlachtlärm“ (Jandl 1985, zit. nach Hinderer 2002: 59). In diesem Gedicht wird eine neue Sprache entworfen, eine ´Kriegssprache´, die den Krieg nicht mittels ´normaler´ Wörter zu beschreiben versucht, sondern mittels nichtsprachlicher Geräusche, abweichender, zusammengezogener Wörter und Wiederholungen die im Krieg anwesend sind, wie das Feuern und Gegenfeuer des Feindes. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass alle Wörter und Klänge die in diesem Gedicht vorkommen, Teile des Wortes ´Schützengräben´ sind, die in neuen Elementen wieder zusammengefügt worden sind. Alles was sich in diesem Gedicht ´ereignet´, findet in den Schützengräben statt und hat eine eigene klängliche Funktion. Weiterhin fällt auf, dass das lyrische Ich hier abwesend bleibt, da hier nur Objekte, nämlich die Kriegswaffen, zum Sprechen gebracht werden (vgl. Hiebel 2006: 233) und die Sprache der Menschen größtenteils 24 schweigt: Nur die Wörtern ´Schützengräben´, ´tot´ und ´schützen´, die gleichzeitig als Onomatopöien die Laute des Krieges darstellen, sind noch als ´normale´ Wörter zu erkennen. Indem Jandl den Krieg nicht mittels ´normaler´ Sprache auszudrücken versucht, sondern ein Sprachspiel mit den akustischen Aspekten der Sprache betreibt, geht er, wie er selber in dem Dokumentarfilm Deutsch sein Kunstsprach (2005) von Moritz Neumüller erklärt, über das “Ernste, Schwere dieses Themas“ hinaus (Neumüller 2005). Hier spielt Jandl mit der Sprache, indem er sie in Silben, Laute, Buchstaben zerlegt und zeigt, dass man auch ohne ernste Wörter etwas Grauenhaftes wie den Zweiten Weltkrieg darstellen kann. Hierbei bleibt das ernste Thema des Krieges jedoch anwesend, da die Folge der Lautgruppen mit der Gruppe ´t-tt´ abgeschlossen wird, die die schrecklichen Folgen des Krieges, nämlich das massenhafte Sterben der Soldaten, darstellt. Es lässt sich sagen, dass die Schwierigkeit, den Krieg in Worten auszudrücken, hier durch das Zerstören der Sprache und die Sprachspielereien im Gedicht überwunden wird. In diesem Gedicht hat Jandl die Sprache entgrenzt, in die Richtung einer ´maschinellen Sprache´ erweitert, da es im Krieg Erfahrungen gibt, die für Außenstehenden jenseits des Vorstellbaren liegen, wodurch eine Erneuerung der Sprache notwendig ist. Außerdem lässt sich sagen, dass Jandl Sprachkritik äußert, indem er mit konventionellen Sprachnormen bricht und stattdessen eine neue, verfremdende Sprache entwirft, mit der er den Leser zu einer bewussten, aktiven Aufnahme des Gedichts zwingt: Der Leser muss das Gedicht aufmerksam lesen, damit er verstehen kann, worüber das Gedicht, das auf den ersten Blick nur aus sinnlosen Lautgruppen zu bestehen scheint, handelt. 3.2.2. wien : heldenplatz Ein anderer „Jandl-Klassiker” (Kaukoreit/Pfoser 2002: 9), in dem die Sprache als verfremdendes Element in den Vordergrund tritt, ist das Gedicht wien : heldenplatz, das vor schtzngrmm in der Rubrik krieg und so in laut und luise veröffentlicht wurde. Genauso wie schtzngrmm verweist das Gedicht auf ein historisches Ereignis, in diesem Fall auf ein besonderes Ereignis in der Geschichte Österreichs, nämlich auf die Rede Hitlers auf dem Wiener Heldenplatz am 15. März 1938, in der er den Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich vor einer großen, begeisterten Menschenmasse verkündete. Das Gedicht basiert auf Jandls eigenen Beobachtungen: Er war als Zwölfjähriger bei der Rede anwesend (vgl. Ruprechter 2002: 34f.). Bei einer ersten Betrachtung des Gedichts stellt sich heraus, dass es im Gedicht eine gewöhnliche Syntax gibt, während es Wörter gibt, die dem Leser fremd vorkommen. Laut 25 Jandl entsteht die Spannung des Gedichts gerade aufgrund dieser Kluft „zwischen dem beschädigten Wort und der unverletzten Syntax” (Jandl 1985, zit. nach Ruprechter 2002: 37). Es lässt sich sagen, dass hier ein dadaistisches Element in den Vordergrund tritt, nämlich das Verstoßen gegen das ‚Dichten aus zweiter Hand‘, das Ball in seinem Bericht über das Lautgedichten kritisiert: Im Gedicht gibt es neben den normalen Wörtern, die der Leser sofort erkennt, viele neue Wortneuschöpfungen, wie „glanze“ (Vers 1), „versaggerte“, „maschenhaftem“ (beide V. 2), „maskelknie“ (3), „stirnscheitelunterschwang“ (6) und „gottelbock“ (11). Diese Wörter unterbrechen durch „Verstehensirritationen” (Ruprechter 2002: 37) den Lesestrom und bewirken auf diese Weise ein fortdauerndes Lavieren zwischen Verstehen und Nicht-Verstehen. Jedoch bleibt die Syntax intakt, wodurch der Leser erkennen kann, welcher Wortart die Wörter entstammen, obwohl er nicht weiß, was sie bedeuten: „versaggerte” ist ein Verb, „maskelknie“, „stirnscheitelunterschwang“ und „gottelbock“ sind Substantive, „maschenhaftem“ und „glanze“ sind Adjektive (vgl. ebd.: 36f.). Es lässt sich sagen, dass Jandl nicht nur Neologismen wie ´versaggern´ einsetzt, bei denen die Bedeutung schwer zu bestimmen ist, sondern auch neue Wörter ´produziert´, indem er Wörter miteinander kombiniert (wie bei „stirnscheitelunterschwang”) und in- und übereinander schiebt, wie bei dem Wort „glanze” (1), das als eine Zusammenziehung der Wörter ´glanz´ und ´ganz´ zu erkennen ist, wobei der Satzteil “der glanze Heldenplatz” sich als “der ganze und glänzende Heldenplatz´ lesen lässt (vgl. ebd.: 38). Durch diese Zusammenziehungen entsteht demnach nicht nur eine Verfremdung, sondern auch eine Mehrdeutigkeit der Wörter, da verschiedene Bedeutungen miteinander kombiniert werden. Obwohl die Wortneuschöpfungen den Leser zunächst verwirren, lässt sich bei einer genaueren Betrachtung erkennen, dass Jandl mit seinen neu erfundenen Wörtern Assoziationen mit thematischen Feldern beim Leser wachzurufen versucht, um auf diese Weise die damalige Situation auf dem Heldenplatz, die „Orgie des Fanatismus” und die Hysterie der Menschenmenge, in der jedes Individuum und alle Rationalität ausgelöscht wurde (ebd.: 36), zu beschreiben, wobei Peter Pabisch behauptet, dass Jandl die Ereignisse bei der Rede „so wiedergab, wie es kein Historiker echter gekonnt hätte“ (Pabisch 1992: 85). Dabei ist festzustellen, dass die erkennbaren, normalen Wörter dem Leser helfen, die Zusammenhänge innerhalb des Gedichtes zu erkennen. In der ersten Strophe wird die lärmende, brüllende Menschenmasse auf dem Heldenplatz wiedergegeben, worauf in der zweiten Strophe Hitler erscheint, der im Gedicht mit den Wörtern „gottelbock” (3. Strophe, V. 11) und „stirnscheitelunterschwang” (2. Strophe, V. 6) angedeutet wird. Das erste Wort charakterisiert Hitler als Verkörperung des Bösen, als der Teufel in der Gestalt eines Bockes, 26 der auf dem Heldenplatz allerdings wie ein Gott („gottel-„ – eine Zusammenziehung von ‚Gott‘ und ‚Teufel‘) angebetet wird. Das Wort „stirnscheitelunterschwang“ verweist auf das Aussehen Hitlers, auf die Haarsträhne, die ihm in die Stirn hängt und die er ständig mit Schwung aus dem Gesicht streicht. Daneben lässt sich beim genaueren Hinsehen erkennen, dass der Name Hitlers sich in diesem Wort verbirgt, obwohl Jandl behauptete, dass Hitler „ohne Namensnennung“ im Gedicht anwesend sei: „stirnscHeITeLuntErschwang“ (Ruprechter 2002: 37). In der dritten Strophe fängt die Rede, der „stimmstummel” (12) Hitlers, an und gerät die Masse in Entzücken, die Menschen ´würmeln´, was die Assoziation mit unruhigen Bewegungen erzeugt. Mit diesen Zusammenhängen als Anhaltspunkte kann man untersuchen, wie Jandl die Neologismen einsetzt, um Assoziationen mit Themenfeldern wachzurufen. Eines der wichtigsten Motive, auf die die neuen Wörter verweisen, ist das Motiv der Jagd. Im zweiten Vers des Gedichts wird beschrieben, dass die Menschen auf dem Platz in die politische Netze des Nationalsozialismus gelockt worden sind (vgl. Pabisch 1992: 81). Sie bilden zusammen ein ‚maschenhaftes Männchenmeere‘ (2), wobei das Wort ´maschenhaft´ sowohl auf die Menschen, die massenhaft dem Führer zujubeln, als auch auf Fangnetzen ´Maschen´ eines Netzes - verweist, die die Masse verhaften (vgl. Ruprechter 2002: 36). Ruprechter behauptet, dass neben der Verhaftung der Masse auch die Jagd auf Andersdenkenden, die als „eigenwäscher“ (9) bezeichnet werden, beschrieben wird. Laut ihm werden diese Menschen entweder „zugenummert“ oder „zum Nummer degradiert“, wie dies in den Konzentrationslagern des Dritten Reiches geschah, oder „hingesenst“ (9), ein Wort das den Leser an Wörter wie ´hinschaffen´ und ´hinschicken´, aber auch an Wörter wie ´hinscheiden´ und ´hinschlachten´ erinnert und das laut Ruprechter als das Töten der Andersdenkenden aufgefasst werden kann (ebd.: 42): Sie werden hingeschickt, um hingeschlachtet zu werden. Andere Wörter, die auf die Jagd verweisen, sind „pirsch“ (10), das als Imperativ mit einem Ausrufezeichen als Startzeichen für die Jagd aufgefasst werden kann, das Hitler am Anfang seiner Rede ausruft (vgl. Pabisch 1992: 83), „bluten” (13) und “balzerig” (13), das auf das ‚Balzen‘, die Paarung von Tieren verweist. Mit dem Wort „balzen“ tritt gleichzeitig auch ein anderes Motiv in Erscheinung, das unlöslich mit der Kraft der Rede Hitlers verbunden ist, nämlich das Motiv der Erotik: Die Menschenmasse gerät in Ekstase durch Hitlers fesselnde Stimme, die die Masse „blendet und bannt“ (ebd.: 83). Hier erscheint etwas „Triebhaft-Sexuelle[s]“, das das Geschehen auf dem Heldenplatz als eine Orgie erscheinen lässt. Die Menschen auf dem Platz verehren Hitler, der in ihren Augen als ein erlösender Gott erscheint, wobei vor allem die Frauen von ihm 27 begeistert sind, wie besonders aus der ersten Strophe des Gedichts hervorgeht. In dieser Strophe versuchen die Frauen in der Menschenmasse, sich “ans Maskelknie” (3) zu heften, was Ruprechter als das Suchen nach „etwas Männliches“ interpretiert, da „maskel-“ seiner Ansicht nach auf „Muskel“ und „maskulin“ verweist (Ruprechter 2002: 43). Daneben sind die Frauen „hoffensdick” (4), ein Wort das mehrere Assoziationen hervorruft. Einerseits lässt sich feststellen, dass die Frauen dem Leben im deutschen Reich erwartungs- und hoffnungsvoll entgegensehen, andererseits wird durch die Kombination der Wörter ´dick´ und ´Hoffnung´ eine Verbindung zu dem Ausdruck ´in der Hoffnung sein´ - schwanger sein – hergestellt, wodurch das Motiv der Sexualität unterschwellig anwesend bleibt. Dabei wird beschrieben, wie die Frauen „brüllzten“, was als eine Kombination von “balzen” und “brüllen” betrachtet werden kann (vgl. Pabisch 1992: 83), wodurch ein sexueller, aber auch aggressiver Unterton entsteht. Es lässt sich schließen, dass Jandl hier ´mehrdimensionale´ Wörter einsetzt, in denen verschiedene Bedeutungen und Assoziationen miteinander verschmelzen, um auf diese Weise die Stimmung auf dem Heldenplatz einzufangen und „das Unsagbare sagbar zu machen” (ebd.: 84). Die ´normale´ Sprache, in der die Wörter klar umrissene Bedeutungen haben, reicht hier für das Schildern der Situation auf dem Platz mit ihrem Lärm, ihrem Chaos und aggressiven und sexuellen Untertönen nicht aus. Um ein komplettes Bild dieser komplexen Situation in nur einem Gedicht schildern zu können, braucht man Wörter, die die verschiedenen Eindrücke gleichzeitig beschreiben. Wie Pabisch folgert, lässt Jandl sich beim Beschreiben dieser Eindrücke „nicht von der Ungeheuerlichkeit der historischen Tatsachen emotional beherrschen“, sondern beherrscht er „die Thematik durch seine kreative Leistung“ (ebd.: 84): Er versucht die überwältigenden, fast unbeschreiblichen Ereignisse mittels einer neuen Sprache zu beschreiben, um sie auf diese Weise mittels Wörter ´beherrschen´ oder sogar vielleicht als schockierende Erfahrungen bewältigen zu können. Hierbei lässt sich sagen, dass die Sprache im Gedicht nicht so sehr als Mittel zur Abbildung der Geschehnisse, sondern vielmehr als künstliches Mittel hervortritt durch das Spiel mit den Bedeutungen der Wörter (vgl. Ruprechter 2002: 35): Bei der ersten Betrachtung sieht der Leser zunächst nur die ´fremden´ Wörter, während er erst bei einer zweiten, genaueren Betrachtung entdeckt, wovon das Gedicht berichtet. Schließlich lässt sich erkennen, dass das Gedicht immer für verschiedene Deutungen offen bleibt. Obwohl der Leser die Syntax und die thematischen Feldern auf die die neuen Wörter verweisen als Anhaltspunkte beim Interpretieren des Gedichts verwenden kann (vgl. ebd.: 44), gibt es Wörter im Gedicht, deren Bedeutung schwer zu bestimmen bleibt und wird jeder Leser die verschiedenen Wörter anders interpretieren, 28 wodurch die Vieldeutigkeit des Gedichts und die Unsicherheit über die Interpretierung des Gedichts immer anwesend bleiben. Jandl selbst bezeichnet die “Wille zur Unsicherheit“ des Dichters allerdings als ein typisches Merkmal der experimentellen Dichtung (vgl. Pabisch 1992: 85). Es lässt sich feststellen, dass Jandl mit dieser ´unsicheren Sprache´ im Gedicht eine Sprache entworfen hat, die im Gegensatz zu der normalen Sprache nicht immer als deutliches Mittel zur Mitteilung dienen und die nicht immer begriffen werden muss. Diese Sprache sagt genug, auch wenn ihre Leser ihre Bedeutungen nicht kennen und bleibt gerade durch ihre Mehrdeutigkeit die Leser faszinieren. 3.2.3. tagenglas: franz hochedlinger-gasse, menschenfleiss, Biography Neben dem Spielen mit Lauten und Wortbedeutungen gibt es noch eine andere Weise, auf die Jandl versucht, eine neue, verfremdende Sprache zu entwerfen, nämlich die der Verwendung des Dialekts und insbesondere der Sprache von Gastarbeitern und Migranten, die er als „heruntergekommene Sprache“ (Jandl 1985, zit. nach Kiesel 2004: 86) bezeichnet, als eine Sprache, die „unter das Niveau unserer Alltagssprache gedrückt [ist]“ (Jandl 1985, zit. nach Stemmler/Horlacher 1997: 150). In diesem Paragraphen werden zwei Gedichte aus dem 14teiligen Zyklus tagenglas, in dem Jandl dieses fehlerhafte, „kaputte Deutsch” (Hummelt 2010: 17) eingesetzt hat, analysiert. In der ersten Strophe von dem ersten Gedicht des Zyklus, franz hochedlinger-gasse, beschreibt das lyrische Ich eine Gasse, in der die Straße mit Erbrochenem, Hundehaufen und Spucke beschmutzt ist. Daraufhin beschreibt das Ich in der zweiten Strophe den plötzlichen und unerklärlichen Drang, sich vorzustellen, wie er den Schmutz auf der Straße verzehren wird: „ich denken müssen / in mund nehmen / aufschlecken schlucken / denken müssen nicht wollen“. Das Ich verwendet bei seiner Beschreibung dieser ekelerregenden Situation eine primitive Sprache, die den Leser an die Sprache eines Immigranten, die die Sprache seiner neuen Heimat noch nicht beherrscht, erinnert. Er konjugiert seine Verben nicht und benutzt falsche Wortstellungen und neu erfundene Wörter wie „wursten von hunden” (3) statt ‚Hundehaufen‘ und “saufenkotz” statt ´Kotze´, wodurch der Eindruck entsteht, dass er bestimmte Wörter noch nicht kennt und die Lücken in seinem mangelhaften Vokabular deswegen auf kreative Weise auszufüllen versucht, während er Wörter die er schon kennt, miteinander kombiniert. Es lässt sich sagen, dass Jandl diese Sprache nicht nur verwendet hat, um eine verfremdende Spannung zwischen ihr und der Standardsprache zu erzeugen, sondern auch um die „wirklichkeitsnähe“ (Rühm 1985, zit. nach Kiesel 2004: 285) dieser Sprache in den Vordergrund zu rücken. Die mangelhafte Sprache eines Nicht-Integrierten wird in diesem 29 Gedicht eingesetzt mit dem Ziel, das Abstoßende und Verdrängte darstellen zu können (vgl. Hummelt 2010: 17) und auf diese Weise „einer ungewaschenen Wirklichkeit nahe zu sein, die wir uns durch saubere Grammatik und schönen Satzbau vielleicht abschirmen möchten“, wie Peter Neumann zusammenfasst (Neumann 1996: 38). Erst durch die Verwendung dieser Sprache erweisen sich triviale, ordinäre und schockierende Themen als „poesiefähig“ (Fues/Mauser 1995: 393), oder wie Jandl selbst feststellt: „sie [diese Sprache] erlaubt die Behandlung von Themen, die im Gedicht konventioneller Sprache heute kaum mehr möglich sind“ (Jens 1990: 610). Auch in dem Gedicht menschenfleiss wird das Gastarbeiterdeutsch aus franz hochedlinger-gasse verwendet. Hier wird die Sprache durch das Ausfallen von der Flexion der Verben und die Verwendung falscher Kasusformen (wie in der 12. Zeile: „kein arbeit”) beschädigt (vgl. Fues/Mauser 1995: 393). Ein anderes auffallendes Element im Gedicht ist die doppelte Negation, die sich fast in jeder Zeile finden lässt. Einerseits lässt sich feststellen, dass durch die zwei Negationen betont wird, dass man, wenn man faul ist, gar nichts macht, sogar ´zwei Mal nichts´ macht, während andererseits zu erkennen ist, dass die beiden negativen Elementen zu einem positiven Element verschmelzen, da Minus mal Minus Plus macht: „das zweifache Nein [lässt] sich [hier] als Ja“ (Kratzer 2007: 23) verstehen. Aus letzerer Sicht lässt sich sagen, dass in diesem Gedicht nicht das Faulsein, sondern der Fleiß definiert und thematisiert wird. Dies wird auch in der letzter Strophe bestätigt, in der behauptet wird, dass es keine Faulheit gibt, da ein Mensch nie faul sein kann, solange er noch lebt, spricht und atmet: „ein faulsein / solang mund geht auf und zu / solang luft geht aus und ein / ist überhaupt nicht“. Schließlich lässt sich vermuten, dass Jandl die doppelte Negation eingesetzt hat, um den Leser zum aufmerksamen Lesen und zu einer genauen Beobachtung der Worte aufzufordern, kurz, er zwingt den Leser, fleißig zu sein und die zwei Leseweisen des Gedichts zu entdecken. Hier lässt sich genauso wie in wien : heldenplatz eine mehrdeutige Sprache erkennen, die den Leser zur Aufmerksamkeit auffordert und die Möglichkeiten der ´alten´ Sprache erweitert. Eine andere Sprache die Jandl häufig in seinen Gedichten einsetzt, ist eine Sprache die das Bild zum ´Sprechen´ bringen kann und in der das Bildhafte anwesend sein kann, nämlich die Sprache der konkreten, visuellen Poesie. Als Beispiel soll hier das Gedicht Biography dienen, in dem Text und Bild miteinander kombiniert werden. In dieser „Kurzbiographie” (Hiebel 2006: 236), in der das Leben eines Künstlers „auf das Wesentlichste reduziert wird“ (ebd.: 237), gibt es nur fünf Wörter, nämlich COMING, AND, GOING, earth und art. Das Leben des Künstlers fängt mit dem Wort „COMING…“ an, als er zur Welt gebracht wird. 30 Daraufhin folgt das Wort „earth” in der zweiten Zeile und fängt der Text an, sich zu verbreitern, als Verbildlichung von dem Aufwachsen des Künstlers. Das Wort „earth“ wird in der dritten Zeile in drei Teile zerlegt, wobei die „e” und „h“-Zeichen sich immer mehr von dem Wort „art“ entfernen, das sich vorher in der Mitte des Worts „earth“ verbarg und das auf die Kunst als Mittelpunkt in dem Leben des Künstlers verweist. In der siebten Zeile gibt es allerdings eine Wende im Leben des Künstlers, nämlich den Moment in dem der Alterungsprozess anfängt: „…AND GOING“ . Ab dieser Wende fängt das Wort „art“ an, sich wieder zurück in “earth“ zu verwandeln, wobei der Text immer schmaler wird. Schließlich wird der Künstler wenn er stirbt wieder zur Erde, zum Staub. Hier tritt das eigentliche Thema des Gedichts in den Vordergrund: „Vom Staub bist du genommen, zum Staub wirst du zurückkehren“ (ebd.: 236f.). Es lässt sich schließen, dass sowohl der Inhalt – die Wörter des Gedichts – als auch die Form des Gedichts die Geburt, das Wachsen, Älterwerden und schließlich den Tod darstellen. Der Text wird durch ihr Verbreitern und ´Schrumpfen´ zum Bild für das Wachsen und Älterwerden und formt auf diese Weise ein Bild, das mit dem Inhalt des Gedichts kommuniziert, wodurch ein „Text-Bild“ entsteht, in dem die Kraft des Bildes nicht verloren geht, sondern das Bild anwesend bleibt und den Inhalt des Gedichts unterstützt. Außerdem ist festzustellen, dass die Buchstaben des Gedichts zusammen die Form eines Sarges bilden (vgl. ebd.: 237). Der Sarg verweist hierbei nochmals auf die Unabwendbarkeit des Todes: Während des Lebens ist die Drohung des Todes immer anwesend, da es feststeht, dass jeder Mensch wieder zum Staub werden wird. 3.2.4. inhalt Im Gegensatz zu den soeben behandelten Gedichten, die durch die Verwendung von abweichenden dichterischen Sprachen eher chaotisch und verfremdend wirken, erscheint das Gedicht inhalt als ein ´ruhiges´, eher konventionelles Gedicht. Hier gibt es weder zerstörte Wörter, die Maschinen und Kriegslaute nachahmen, noch fremde, unbekannte und fehlerhafte Wörter, worüber man sich den Kopf zerbrechen muss, um sie interpretieren zu können, noch die unkonventionelle bildhafte Sprache eines konkreten Gedichts. Jedoch verbirgt sich unter dieser konventionellen Oberfläche eine unangenehme Erfahrung wobei die Sprache ebenfalls versagt, nämlich die des Nicht-Schreiben-Könnens, wenn man ein Gedicht schreiben möchte, das sich allerdings „nicht schreiben lässt” (Siblewski 2011: 82). Ernst Jandl litt häufig unter Schreibblockaden und begann seine frustrierenden Erfahrungen mit Schreibschwierigkeiten dichterisch zu verarbeiten, als er sich in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre immer mehr mit seinen autobiographischen Erlebnissen als poetisches Material zu beschäftigen und sich 31 immer mehr vom sprachlichen Experiment abzusetzen begann (vgl. Kaukoreit/Pfoser 2002: 10). In dem 1979 erschienenen Gedicht inhalt macht er deutlich, was den Dichter genau beim Schreiben hindert, nämlich der flüchtige und ungreifbare Charakter der Sprache und der Gegenstände, über die er schreiben möchte. Sowohl die Sprache als auch die Gegenstände rutschen dem Dichter im Gedicht durch die Finger, bevor er sie fassen und auf seinem unbeschriebenen Blatt festhalten kann (vgl. Siblewski 2011: 82). Er kann den zukünftigen Inhalt des Gedichts, der aus verschiedenen Gegenständen wie „ein ganzes Leben / ein ganzes Denken, ein ganzes Erinnern” (Jandl 2011: 24) besteht, wohl spüren, aber immer wenn er versucht, diese Gegenstände in einem Gedicht zu beschreiben, wird ihm sowohl der Inhalt als auch das Mittel, um diesen Inhalt festzuhalten, nämlich „eine ganze Sprache”, abgenommen. Er erzählt in der ersten Strophe über die Abwesenheit der Gegenstände und der Sprache: “Um ein Gedicht zu schreiben / habe ich nichts“ (ebd.: 24), zählt dann auf, welche Quellen ihm bei der Arbeit an einem Gedicht zur Verfügung stehen könnten, nämlich die ganze Sprache, ein ganzes Leben, Denken und Erinnern, aber wird sich dessen wieder bewusst, dass diese Quellen für ihn ungreifbar sind und wiederholt seine Klage aus der ersten Strophe. Die Quellen für das Gedicht lassen sich nicht fassen, geschweige denn, dass sie sich niederschreiben lassen, da sogar die Sprache, das Mittel das man zum Aufschreiben braucht, sich als unerreichbar erweist. Infolgedessen „greift [er] ins Leere” (Siblewski 2011: 83), was auch in der Typographie des Gedichts zum Ausdruck kommt: Nach der letzten Strophe wird das unfreiwillige Schweigen des Dichters wiedergegeben, indem nur das Weiß eines leeren, unbeschriebenen Blattes übrig bleibt. Es lässt sich schließen, dass dieses Gedicht ausdrückt, dass der Dichter die Sprache nicht mehr als zuverlässiges Mittel betrachten kann, da sie ihn plötzlich im Stich lässt. Hier gibt es kein Spiel mit der Sprache, in dem die alte Sprache erweitert wird, sondern gibt es nur ein schmuckloses Gedicht, in dem dem Dichter keine neuen Wörter mehr einfallen: Er befindet sich in einem Teufelskreis, in dem es nur unerreichbare Dinge gibt und letztendlich nur sein ohnmächtiges Schweigen übrig bleibt. 3.2.5. von wörtern, zweites sonett Ein anderes Gedicht in dem die Unzuverlässigkeit der Sprache sowie die Unmöglichkeit des Schreibens artikuliert wird, ist das Gedicht von wörtern. Aus den ersten vier Zeilen, „erwarte / von wörtern nichts / sie tun es nicht / für dich” (Jandl 2011: 33) geht hervor, dass die Sprache dem Dichter nicht beim Schreiben eines Gedichts helfen wird und dass er deswegen nichts von ihr erwarten soll. In dem nächsten ´Satz´ im Gedicht, „sie kommen / gierig / überschwemmen dich / und dein papier“, wird die Aggressivität der Sprache betont: Sie lässt 32 den Dichter fast in einem tosenden Wörtermeer ertrinken, in dem sich kein Gedicht aus der chaotischen Wörtermasse machen lässt. In dem letzten Satz des Gedichts wird die Ziellosigkeit dieser Aggressivität allerdings aufgezeigt: „nicht was sie dir / antun / doch was du dem geringsten / von ihnen / angetan / kann etwas sein” (ebd.: 33). Aus diesen Zeilen wird ersichtlich, dass die Wörter selbst kein Kunstwerk produzieren können: Die Sprache braucht die Einmischung des Dichters, damit sie zum Gedicht, zur Kunst werden kann. Er muss die Wörter erst etwas „antun”, er muss sie ´bekämpfen´, bearbeiten und in eine Form bringen, bevor sie zusammen ein Gedicht bilden können. Die Sprache selbst kann nichts ausrichten, wie Jandl selbst in einem Interview bestätigte, als Antwort auf die Frage, ob die Sprache mit sich selbst spiele oder spreche: „Der Mensch spricht mittels der Sprache. Er kann mit ihr auch Sprach-Spiele veranstalten. Die Sprache allein kann überhaupt nichts tun“ (Spiegel Online 1995). In dem Gedicht zweites sonett gibt es eine schärfere Kritik an der Sprache. In den ersten zwei Zeilen wird festgestellt, dass man nicht immer eine Bedeutung braucht, um eine Zeile zu schreiben: „die zeile will die zeile sein / hier muss nicht erst noch sinn hinein“ (ebd.: 49): Hier wird eine ´unsichere´ Sprache, wie sie auch in wien : heldenplatz vorkommt, vor einer deutlichen, sinnhaften Sprache bevorzugt. In der 3. und 4. Zeile gibt es daraufhin ein unerbittliches Urteil über die Sprache: Sie ist, im Gegensatz zu der unsicheren Sprache die der Dichter kreieren will, „mit sinn […] beladen“ und dadurch „dreckig“. Deswegen soll sie im „reinen Schaum der schönen Lieder“ reingewaschen werden, damit sie wieder von allem Sinn und damit von allen Klischees, die sich an dem Sinn haften, befreit werden kann. Die „schönen Lieder“ sind hierbei als unkonventionelle Gedichte aufzufassen, die eine neue Sprache ohne Klischees kreieren, Gedichte als schtzngrmm und wien : heldenplatz. Aus dem zweiten Teil des ‚Satzes‘ wird dann ersichtlich, dass diese Sprache obwohl sie „aus dem Schlamm getaucht” (8) und gereinigt worden ist, doch wieder in ihrer alten Form zurückkehren wird, weil die Menschen sie in dieser Form kennen, wollen und brauchen und deswegen nie damit aufhören werden, diese ´unreine´ Sprache zu verwenden. Ab der 9. Zeile werden die Folgen der Verwendung dieser Sprache auf erschütternde Weise deutlich: Die Menschen sind wegen der Unreinheit ihrer Sprache nicht imstande, ein schönes Bild ´anzufassen´, was hier als ´in Worte fassen´ aufgefasst werden kann. Sie versuchen, das Bild zu berühren, zu umschreiben, aber es reißt sich aus seinem Rahmen, da es nicht mit Hilfe der menschlichen Sprache dargestellt werden kann. Zurück bleibt eine Leere, die die Menschen nicht ausfüllen können, weil ihr Leben zu kurz ist um eine neue, ´visuelle´ Sprache, die die Bilder beschreiben kann, eine Sprache wie in dem Gedicht Biography, zu entwerfen. 33 4. Schluss Aus dem ersten Teil dieser Arbeit geht hervor, dass die Sprachkrise um 1900 als eine Verbindung von Sprach- Erkenntnis- und Orientierungskritik und gleichzeitig als Ich-Krise aufzufassen sei: In den Texten Nietzsches, Mauthners und Hofmannsthals wird die Sprache als künstliches, unzulängliches und unzuverlässiges Mittel zur Erkenntnis betrachtet, wobei der fiktive Lord Chandos infolge seines veränderten Blicks auf die Sprache unter Identitätsverlust leidet. In der Lyrik um 1900 wird die Sprache kritisiert, indem Dichter wie Rilke und Morgenstern eine eigene, neue Sprache kreieren. Rilke warnt die Menschen in seinem Gedicht Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort vor der Zerstörung der Dinge durch die Sprache, entwirft eine dichterische Sprache, in der Alliterationen und Klangwiederholungen den Ton angeben und versucht, in seinen Dinggedichten die Dinge selbst ´sprechen´ zu lassen, indem er das lyrische Ich zurücktreten lässt. Morgenstern übt in seinem Gedicht Fisches nachtgesang eine radikalere Kritik an der Sprache: Er lässt die Sprache komplett schweigen, um auf diese Weise die Dinge sprechen zu lassen. Auch in seinem Gedicht gibt es eine Auflösung des Ichs, da nur die stumme Sprache der Dinge hier übrig bleibt. Es lässt sich feststellen, dass verschiedene Elemente, die für die Sprachkrise um 1900 kennzeichnend sind, in Jandls Dichtung aufgegriffen und mit Hilfe von Elementen aus dem Dadaismus, der konkreten Poesie und der Lyrik der Wiener Gruppe weiterentwickelt werden. Genauso wie die Philosophen und Dichter um 1900 scheint Jandl davon auszugehen, dass die alte Sprache nicht dazu geeignet ist, die Wirklichkeit zu repräsentieren, da manche Ereignisse so schockierend und grauenhaft sind, wie die Ereignisse aus der Kriegswirklichkeit in schtzngrmm und wien: heldenplatz, dass sie nicht mit Hilfe der alten, konventionellen Sprache beschrieben werden können und man deswegen eine neue, klischeefreie, ´unsichere´ Sprache braucht, die „das Unsagbare sagbar“ (Pabisch 1992: 84) machen kann. Jandl setzt deswegen eine Anhäufung von neuen, verfremden Sprachen ein, die als Weiterentwicklungen der neuen dichterischen Sprachen in den Gedichten Rilkes und Morgensterns betrachtet werden können: In dem Sprechgedicht schtzngrmm lässt er das lyrische Ich und die ´normale´ Sprache verschwinden, um in einem dadaistischen Sprachspiel die Kriegswaffen ertönen zu lassen, genauso wie Morgenstern die Sprache schweigen und den Fisch singen lässt, entwirft in wien : heldenplatz neue, mehrdeutige Wörter um die überwältigende Situation auf dem Heldenplatz darstellen zu können und lässt in seinen Gedichten franz hochedlinger-gasse und menschenfleiss die Gastarbeiter zu Worte kommen, um die „ungewaschene Wirklichkeit” (Neumann 1996: 38) darstellen zu können. Daneben lässt er Sprache und Bild in seinem 34 visuellen Gedicht Biography zusammenfließen: Das Bild wird hier nicht aus dem Rahmen gerissen, wie dies in dem Gedicht zweites sonnett wegen der Mangelhaftigkeit der Sprache geschieht, sondern unterstützt den Inhalt des Gedichts, scheint hier als Teil einer wörtlich bildhaften Sprache ´mitzusprechen´. Hier wird genauso wie in schtzngrmm eine neue Sprache entworfen, die Sprache der Dinge, wie Chandos sie in seinem Brief umschrieb, die im Gegensatz zu der konventionellen Sprache die Dinge, seien es Kriegswaffen oder Bilder, selbst sprechen lässt. Weiterhin ist festzustellen, dass Jandl durch das Verwenden der neuen visuellen, mehrdeutigen, ´lautlichen´, heruntergekommenen und dadurch verfremdenden Sprachen den Leser dazu auffordert, ein neues Sprachverständnis zu entwickeln, um sich genauso wie er selbst kritisch mit der Sprache auseinanderzusetzen. Genauso wie in Hofmannsthals Ein Brief gehen Sprachkritik und die Fähigkeit, aus Sprache Kunst zu machen, hier Hand in Hand: Durch das Entwerfen eines Neubeginns der Sprache überwindet Jandl in diesen Gedichten als „Sprachkneter” (Döhl o.J.) die Sprachkrise, die Unmöglichkeit, die Dinge zu beschreiben. Ferner lässt sich sagen, dass Jandl nicht nur auf sprachlicher, sondern auch auf inhaltlicher Ebene die Sprache als unzuverlässig und mangelhaft entlarvt: Nach seiner Ansicht ist diese Sprache im Gegensatz zu der neuen, reinen Sprache der „schönen Lieder” aus dem Gedicht zweites sonett als klischeehaft und ´unrein´ zu betrachten. Daneben stellt er die Sprache in dem Gedicht inhalt als ungreifbar und launisch dar, da sie den Dichter beim Schreiben im Stich lässt, wodurch er unfreiwillig zum Schweigen gezwungen wird. Auch in von wörtern leidet den Dichter unter dem Nicht-Schreiben-Können, da die Sprache ihm nicht beim Schreiben eines Gedichts helfen wird. Infolgedessen lässt sich feststellen, dass die Sprachkrise in diesen Gedichten nicht überwunden wird: Hier gibt es keine verfremdenden Sprachspiele, in denen die alte Sprache zerstört und erneuert wird, sondern nur schmucklose Gedichte, in denen die Sprache sich dem Dichter entzieht und letztendlich schweigt. Genauso wie Lord Chandos leidet das lyrische Ich in diesen Gedichten unter Schreibblockaden, unter der Unmöglichkeit des Schreibens, und schildert damit die Situation Jandls: Obwohl er die Sprachkrise einerseits in mehreren Gedichten überwindet, indem er die Sprache auf eine spielerische Weise einsetzt und neue dichterische Sprachen kreiert, leidet er andererseits wie ein moderner Lord Chandos unter der Unzulänglichkeit der Sprache und unter dem NichtSchreiben-Können. 35 5. Anhang: Behandelte Gedichte Rainer Maria Rilke: Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort. Sie sprechen alles so deutlich aus: Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus, und hier ist Beginn, und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott, sie wissen alles, was wird und war; kein Berg ist ihnen mehr wunderbar; ihr Garten und Gut grenzt grade an Gott. Ich will immer warnen und wehren: Bleibt fern. Die Dinge singen hör ich so gern. Ihr rührt sie an: sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um. (Rilke 1909: 91) Christian Morgenstern: Fisches Nachtgesang. URL: http://weilwirunslieben.files.wordpress.com/2010/04/fisches-nachtgesang-1905.jpg (Stand: 28.6.2011) 36 Rainer Maria Rilke: Der Panther Im Jardin des Plantes, Paris Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf -. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. (Rilke 1907) Ernst Jandl: schtzngrmm schtzngrmm schtzngrmm t-t-t-t t-t-t-t grrrmmmmm t-t-t-t s-------c-------h tzngrmm tzngrmm tzgrmm grrmmmmm schtzn schtzn t-t-t-t t-t-t-t schtzngrmm schtzngrmm tssssssssssssssssssss grrt grrrrrt grrrrrrrrrt scht scht t-t-t-t-t-t-t-t-t-t scht tzngrmm 37 tzngrmm t-t-t-t-t-t.t-t-t-t scht scht scht scht scht grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr t-tt (De Nil 1985: 11f.) Ernst Jandl: wien :heldenplatz der glanze heldenplatz zirka versaggerte in maschenhaftem menschenmeere darunter auch frauen die ans maskelknie zu heften heftig sich versuchten, hoffensdick. und brüllzten wesentlich. verwogener stirnscheitelunterschwung nach nöten nördlich, kechelte mit zu-nummernder aufs bluten feilzer stimme hinsensend sämmertliche eigenwäscher. pirsch! döppelte der gottelbock von Sa-Atz zu Sa-Atz mit hünig sprenkem stimmstummel balzerig würmelte es im männechensee und den weibern ward so pfingstig ums heil zumahn: wenn ein knie-ender sie hirschelte. (Ruprechter 2002: 34) Ernst Jandl: inhalt um ein gedicht zu machen habe ich nichts eine ganze sprache ein ganzes leben ein ganzes denken ein ganzes erinnern um ein gedicht zu machen habe ich nichts (Jandl 2011: 24) 38 Ernst Jandl: von wörtern erwarte von wörtern nichts sie tun es nicht für dich sie kommen gierig überschwemmen dich und dein papier nicht was sie dir antun doch was du dem geringsten von ihnen angetan kann etwas sein (ebd.: 33) Ernst Jandl: zweites sonett die zeile will die zeile sein hier muss nicht erst noch sinn hinein mit sinn die sprache ist beladen und dreckig, also lasst sie baden im reinen schaum der schönen lieder und fürchtet nicht, sie käm nie wieder wie ihr sie kennt und wollt und braucht wie wir erst aus dem schlamm getaucht. wir setzen uns mit tränen nieder denn unser leben war zu kurz wir streckten eben erst die arme nach einem schönen bilde aus da riss es sich aus seinem rahmen nichts blieb darin zurück. amen. aus. (ebd.: 49) 39 Ernst Jandl: Biography COMING ... e art h art h e art h e art h e art h e e ... AND GOING art h e art h e art h e art h e art h In: Jandl, Ernst. 1990. Gesammelte Werke 1: Gedichte. Frankfurt am Main: Luchterhand Literaturverlag. Ernst Jandl franz hochedlinger-gasse wo gehen ich liegen spucken wursten von hunden saufenkotz ich denken müssen in mund nehmen aufschlecken schlucken denken müssen nicht wollen (Hummelt 2010: 17) Ernst Jandl menschenfleiss ein faulsein ist nicht lesen kein buch ist nicht lesen keine zeitung ist überhaupt nicht kein lesen ein faulsein ist nicht lernen kein lesen und schreiben ist nicht lernen kein rechnen ist überhaupt nicht kein lernen ein faulsein ist nicht rühren keinen finger ist nicht tun keinen handgriff 40 ist überhaupt nicht kein arbeit ein faulsein solang mund geht auf und zu solang luft geht aus und ein ist überhaupt nicht Quelle: http://gedicht.canandanann.nl/poetry/jandl.htm#menschenfleiss_ 41 6. Literaturverzeichnis Primärliteratur Hofmannsthal, Hugo von. 1951. Gesammelte Werke in Einzelausgaben: Prosa II. Herausgegeben von Herbert Steiner. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag. Jandl, Ernst. 1990. idyllen. 3. Auflage. Frankfurt am Main: Luchterhand Literaturverlag. Jandl, Ernst. 2011. Gedichte über Gedichte. Herausgegeben von Klaus Siblewski. Stuttgart: Reclam. Mauthner, Fritz. 1923. Beiträge zu einer Kritik der Sprache: Erster Band. Zur Sprache und zur Psychologie. Dritte, um Zusätze vermehrte Auflage. Leipzig: Verlag von Felix Meiner Nietzsche, Friedrich. 1966. Werke in drei Bänden. 5. durchgesehene Auflage, dritter Band. Hrsg. von Karl Schlechta. München: Carl Hanser Verlag. Rilke, Rainer Maria. 1909. Die frühen Gedichte. Leipzig: Insel Verlag. Sekundärliteratur Arntzen, Helmut. 1982. „Sprachdenken und Sprachkritik”. In: Glaser, Horst Albert; Trommler, Frank (Hrsg.). 1982. Deutsche Literatur: Eine Sozialgeschichte, Band 8. Jahrhundertwende: Vom Naturalismus zum Expressionismus 1880-1918. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH. Barner, Wilfried (Hrsg.). 2006. Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. 2., erweiterte Auflage. Nördlingen: C.H. Beck. Baumann, Barbara; Oberle, Birgitta. 1996. Deutsche Literatur in Epochen. 2. überarbeitete Auflage. Ismaning: Max Hueber Verlag. Bayerl, Sabine. 2002. Von der Sprache der Musik zur Musik der Sprache: Konzepte der Spracherweiterung bei Adorno, Kristeva und Barthes. Würburg: Verlag Königshausen & Neumann. Beutin u.a. 2008. Deutsche Literaturgeschichte: Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 7. erw. Aufl. Stuttgart/Weimar: Verlag J.B. Metzler. Brillenburg Wurth, Kiene; Rigney, Ann (Hrsg.). 2008. Het leven van teksten: Een inleiding tot de literatuurwetenschap. 2., überarbeitete Auflage. Amsterdam: Amsterdam University Press. De Nil, Lieve. 1985. „Die Lyrik Ernst Jandls: Eine Einführung“. In: De Vos, Jaak (Hrsg.). 1985. An der Grenzen der Sprache: Interpretationen moderner deutscher Lyrik. Gent: Seminarie voor Duitse Taalkunde. 42 De Pater, Wim A; Swiggers, Pierre. 2000. Taal en teken: een historisch-systematische inleiding in de taalfilosofie. Leuven: Universitaire Pers Leuven. Fähnders, Walter. 2010. Avantgarde und Moderne 1890-1933: Lehrbuch Germanistik. 2. akt. und erw. Auflage. Stuttgart/Weimar: Verlag J.B. Metzler. Fues, Wolfram Malte; Mauser, Wolfgang (Hrsg.). 1995. Verbergendes Enthüllen: Zur Theorie und Kunst dichterischen Verkleidens. Würzburg: Verlag Königshausen und Neumann. Heimböckel, Dieter. 2003. Emphatische Unaussprechlichkeit: Sprachkritik im Werk Heinrich von Kleists. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Hermann, Vera-Rose; Murauer, Lydia. „jeder satz kann der erste sein – Zur Wiener Gruppe“. In: Schütze, Jochen C.; Treichel, Hans-Ulrich; Voss, Dietmar (Hrsg.). 1988. Die Fremdheit der Sprache: Studien zur Literatur der Moderne. Hamburg: Argument-Verlag. Hiebel, Hans. 2006. Das Spektrum der modernen Poesie: Interpretationen deutschsprachiger Lyrik 1900-2000 im internationalen Kontext der Moderne. Teil II (19452000). Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann. Hinderer, Walter (Hrsg.). 2001. Geschichte der deutschen Lyrik: Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Zweite, erweiterte Auflage. Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann. Hinderer, Walter. “Kunst ist Arbeit an der Sprache: Ernst Jandls schtzngrmm im Kontext“. In: Kaukoreit, Volker; Pfoser, Kristina (Hrsg.). 2002. Interpretationen: Gedichte von Ernst Jandl. Stuttgart: Reclam. Kaukoreit, Volker; Pfoser, Kristina (Hrsg.). 2002. Interpretationen: Gedichte von Ernst Jandl. Stuttgart: Reclam. Kiesel, Helmuth. 2004. Geschichte der literarischen Moderne: Sprache, Ästhetik, Dichtung im zwanzigsten Jahrhundert. München: Verlag C.H. Beck oHG. Kimmich, Dorothee; Wilke, Tobias. 2006. Einführung in die Literatur der Jahrhundertwende. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Klarer, Mario. 1999. Einführung in die neuere Literaturwissenschaft. Darmstadt: Primus Verlag. Koch, Hans-Albrecht. 1989. Hugo von Hofmannsthal. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Kühn, Joachim. 1975. Gescheiterte Sprachkritik: Fritz Mauthners Leben und Werk. Berlin/New York: Verlag Walter de Gruyter. 43 Nägele, Rainer. 1970. “Die Sprachkrise und ihr dichterischer Ausdruck bei Hofmannsthal“. The German Quarterly, Volume 43, No. 4, S. 720-732. Neumann, Peter Horst. 1996. “Über Ernst Jandls Gedicht-Zyklus ‚tagenglas’” In: Text + Kritik: Zeitschrift für Literatur, Heft 129: Ernst Jandl. München: Edition Text und Kritik GmbH. Pabisch, Peter. 1992. Luslustigtig: Phänomene deutschsprachiger Lyrik 1945 bis 1980. Köln/Weimar: Böhlau. Ruprechter, Walter. “Politische Dichtung aus dem Sprachlabor”. In: Kaukoreit, Volker; Pfoser, Kristina (Hrsg.). 2002. Interpretationen: Gedichte von Ernst Jandl. Stuttgart: Reclam. Siblewski, Klaus. 2011. Wenn das Vergangene überholt ist und das Neue erst hergestellt werden muss: Jandls Gedichte über Gedichte – ein Nachwort. In: Jandl, Ernst. 2011. Gedichte über Gedichte. Herausgegeben von Klaus Siblewski. Stuttgart: Reclam. Stemmler, Theo; Horlacher, Stefan (Hrsg.). 1997. Sinn im Unsinn: Über Unsinnsdichtung vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert. Tübingen: Gunter Narr Verlag. Szymańska, Magdalena. 2009. Dada und die Wiener Gruppe. Hamburg: Diplomica Verlag. Von Polenz, Peter. 1983. “Die Sprachkrise der Jahrhundertwende und das bürgerliche Bildungsdeutsch”. In: Sprache und Literatur in Wissenschaft und Unterricht, Volume 14, No. 52, S. 3-13. Von Polenz, Peter. 2009. Geschichte der deutschen Sprache. 10. Auflage. Berlin: Verlag Walther de Gruyter. Wilson, Anthony T. 2003. Über die Galgenlieder Christian Morgensterns. Würzburg: Verlag Königshausen und Neumann. Wulff, Michael. 1978. Konkrete Poesie und sprachimmanente Lüge: Von Ernst Jandl zu Ansätzen einer Sprachästhetik. Stuttgart: Akademischer Verlag Hans-Dieter Heinz. Internet Döhl, Reinhard. o.J. „Wie konkret sind Ernst Jandls Texte oder Ernst Jandl und Stuttgart“. URL: http://www.stuttgarter-schule.de/jandlstu.htm (26.6.2011) Greber, Gustav. 1886. Die Sprache als Kunst. Text online auf der Website Gleichsatz. URL: http://www.gleichsatz.de/b-u-t/trad/gerb1.html (Stand: 18.12.2010). Hohmann, Charles. o.J. Deutsche Lyrik der Nachkriegszeit: Orientierungshilfen. URL: http://www.hohmann.ch/Vademecum_Moderne_Lyrik.pdf (Stand: 10.12.2010). 44 Hummelt, Norbert. 2010. Manuskript der SWR2 (Südwestrundfunk)-Literatur-Sendung „Um ein Gedicht zu machen habe ich nichts: Ernst Jandls Spätwerk“. Sendung am 09.03.2010, 22.05 Uhr. URL: http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/literatur//id=5926370/property=download/nid=659892/mtjn2u/swr2-literatur-20100309.pdf (Stand: 22.6.2011) Kleist, Heinrich von. 1801. Brief an Wilhelmine von Zenge (Kantbrief). Online auf der Website www.kleist.org: Das Kleist-Portal. URL: http://www.kleist.org/briefe/037.htm (Stand: 20.3.2011). Kratzer, Denise. 2007. „Ernst Jandls Lautpoesie: Was zeichnet Ernst Jandls Literatur aus?“ URL: http://www.denisekratzer.com/jandl.pdf Rilke, Rainer Maria. 1907. Gedicht: Der Panther. Online auf www.rilke.de. URL: http://www.rilke.de/gedichte/der_panther.htm (Stand: 13.5.2011). Spiegel Online.„Eine üble Vorstellung: Hölderlin-Preisträger Ernst Jandl über das harte Los des Lyrikers“. URL: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9186646.html (Stand: 16.5.2011). Spiegel Online. 2000. „Gestorben: Ernst Jandl“. URL: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-16694748.html (Stand: 11.7.2011). Website Universität Duisburg-Essen. o.J. Ernst Jandl. URL: http://www.unidue.de/einladung/Vorlesungen/lyrik/jandl.htm (Stand: 11.4.2011) Fragment aus dem Dokumentarfilm Deutsch sein Kunstsprach: Die (Un-)Übersetzbarkeit der Poesie Ernst Jandls (2005). Buch und Regie: Moritz Neumüller für Satel Film Wien, ORF. URL: http://www.youtube.com/watch?v=oL0XZIblfZo&feature=related (Stand: 15.04.2011) 45