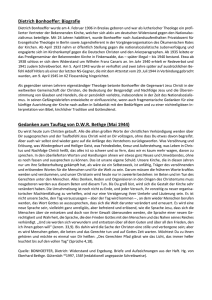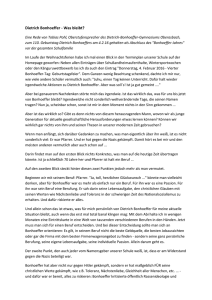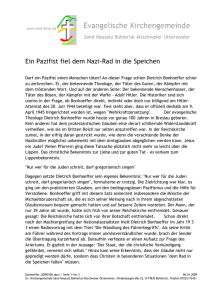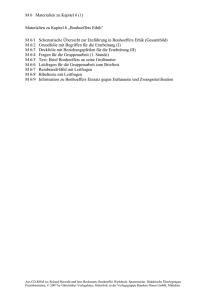Wer bin ich - Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
Werbung
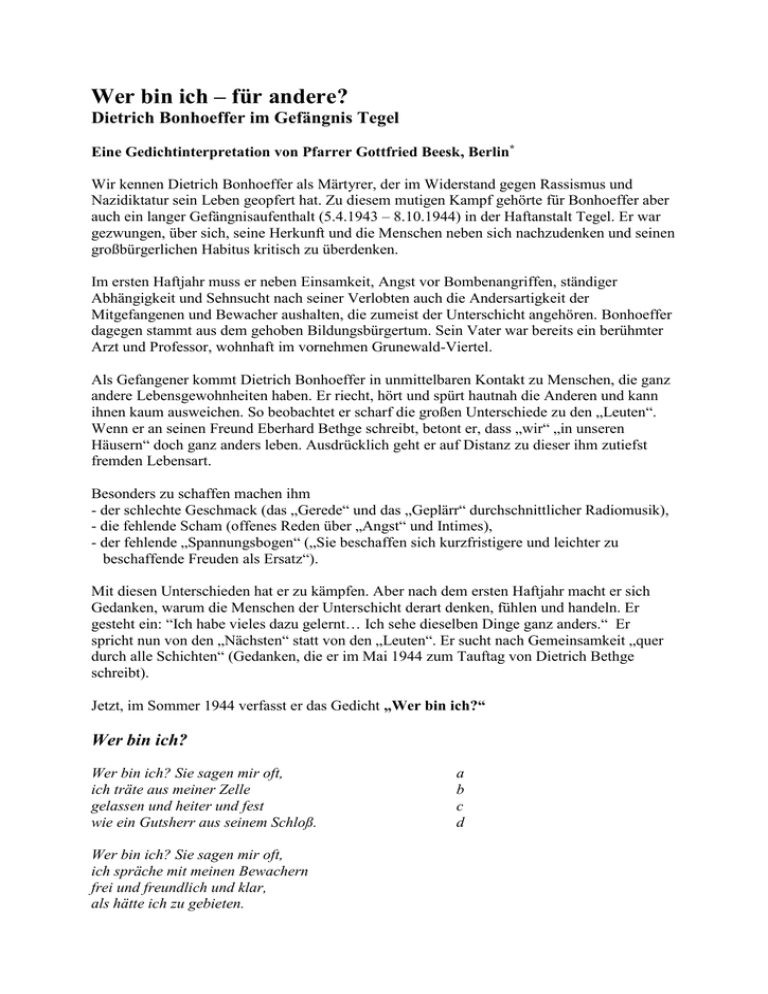
Wer bin ich – für andere? Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis Tegel Eine Gedichtinterpretation von Pfarrer Gottfried Beesk, Berlin* Wir kennen Dietrich Bonhoeffer als Märtyrer, der im Widerstand gegen Rassismus und Nazidiktatur sein Leben geopfert hat. Zu diesem mutigen Kampf gehörte für Bonhoeffer aber auch ein langer Gefängnisaufenthalt (5.4.1943 – 8.10.1944) in der Haftanstalt Tegel. Er war gezwungen, über sich, seine Herkunft und die Menschen neben sich nachzudenken und seinen großbürgerlichen Habitus kritisch zu überdenken. Im ersten Haftjahr muss er neben Einsamkeit, Angst vor Bombenangriffen, ständiger Abhängigkeit und Sehnsucht nach seiner Verlobten auch die Andersartigkeit der Mitgefangenen und Bewacher aushalten, die zumeist der Unterschicht angehören. Bonhoeffer dagegen stammt aus dem gehoben Bildungsbürgertum. Sein Vater war bereits ein berühmter Arzt und Professor, wohnhaft im vornehmen Grunewald-Viertel. Als Gefangener kommt Dietrich Bonhoeffer in unmittelbaren Kontakt zu Menschen, die ganz andere Lebensgewohnheiten haben. Er riecht, hört und spürt hautnah die Anderen und kann ihnen kaum ausweichen. So beobachtet er scharf die großen Unterschiede zu den „Leuten“. Wenn er an seinen Freund Eberhard Bethge schreibt, betont er, dass „wir“ „in unseren Häusern“ doch ganz anders leben. Ausdrücklich geht er auf Distanz zu dieser ihm zutiefst fremden Lebensart. Besonders zu schaffen machen ihm - der schlechte Geschmack (das „Gerede“ und das „Geplärr“ durchschnittlicher Radiomusik), - die fehlende Scham (offenes Reden über „Angst“ und Intimes), - der fehlende „Spannungsbogen“ („Sie beschaffen sich kurzfristigere und leichter zu beschaffende Freuden als Ersatz“). Mit diesen Unterschieden hat er zu kämpfen. Aber nach dem ersten Haftjahr macht er sich Gedanken, warum die Menschen der Unterschicht derart denken, fühlen und handeln. Er gesteht ein: “Ich habe vieles dazu gelernt… Ich sehe dieselben Dinge ganz anders.“ Er spricht nun von den „Nächsten“ statt von den „Leuten“. Er sucht nach Gemeinsamkeit „quer durch alle Schichten“ (Gedanken, die er im Mai 1944 zum Tauftag von Dietrich Bethge schreibt). Jetzt, im Sommer 1944 verfasst er das Gedicht „Wer bin ich?“ Wer bin ich? Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloß. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spräche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. a b c d Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben nach Blumen, nach Vogelstimmen dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein andrer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott! Diese Worte haben bis heute viele Leser und Hörer angerührt, lässt Bonhoeffer uns doch tief in sein geängstigtes Herz blicken. Dabei sind die ersten drei Strophen wenig beachtet oder gar als Beschreibung einer „Maske“ angesehen worden, die Bonhoeffer vor sich her getragen habe und nun endlich fallen lassen muss. Das Gedicht offenbart etwas anderes. TEIL I Die drei nach einem festen Schema komponierten Strophen beschreiben den Habitus Bonhoeffers, der ihm von Kindheit an inkorporiert, also in Fleisch und Blut übergegangen ist. Dieser Habitus hat ihm sein Leben lang Halt geboten und wird ihm Kraft bis an sein Ende geben. Ich habe die Strophen so angeordnet, dass ihr Aufbau deutlich wird. Sie sind in gleicher Weise gegliedert: jeweils vier Zeilen in jeder Strophe nach dem Muster a, b, c und d. Zeile a: Wer bin ich? Sie sagen mir oft (auch)... Die erste Zeile zeigt, wie eng Bonhoeffer seine eigene Frage nach sich selbst mit der Einschätzung durch andere verknüpft. Beides ist in der Gefängnissituation, wo jeder den anderen scharf beobachtet und genau einschätzen muss, nicht zu trennen. Offenbar hat Bonhoeffer auf die anderen einen so starken Eindruck gemacht hat, dass sie ihm dies offen mitgeteilt haben. Besonders seine „Ruhe und Heiterkeit“ bewunderten sie. Zeile b: Wie beschreiben nun andere (oder sind es doch eigene Formulierungen?) ihn oder - genauer seinen großbürgerlichen Habitus? Nicht an seiner Bildung, nicht am Geld oder seiner Herkunft machen sie seinen Habitus fest, wie wir das üblicherweise erwarten würden. Nein, sie erkennen seine herausgehobene Stellung erstens an seiner Körperhaltung, an seinem Gang, buchstäblich am „Auftreten“. in Zeile b der 2. Strophe an seiner Sprache, die ihn offenbar von anderen deutlich unterscheidet. Also: allein schon Gang und Sprache kennzeichnen einen Menschen und verraten viel über seine soziale Stellung (z.B. Richard von Weizsäcker). in Zeile b der 3. Strophe an seiner inneren Haltung, die ihm anhaftet und unerschütterlich wirken lässt. Das alles sind Eigenschaften, die von Kindheit an „inkorporiert“ (Bourdieu) sind und unverwechselbar einem Großbürger anhaften. Zeile c: Diese Merkmale werden durch treffende Eigenschaftswörter veranschaulicht, z.B. klar, heiter, frei, gleichmütig usw. Sie alle sind sehr häufig in Bonhoeffers Briefen zu finden. Jeweils die ersten beiden in Zeile c betonen das Lockere und Gelassene seines Habitus, das jeweils dritte Adjektiv aber hebt das Konsequente und Unerschrockene im Wesen Bonhoeffers hervor. Diese Mischung macht einmal mehr das Besondere der Oberschicht aus. Zeile d: Jede Strophe mündet ein in einen Vergleich: „wie/als“: - wie ein Gutsherr, - als jemand, der zu gebieten hat, - wie einer, der Siegen gewohnt ist. Diese Vergleiche fügen Entscheidendes hinzu: sie benennen die Überlegenheit bzw. den Vorsprung, den der großbürgerliche Habitus seinem Träger verschafft. Es ist die ihm zugebilligte Fähigkeit, Herrschaft auszuüben, einfach schon deshalb, weil er „etwas darstellt“. Die anderen, denen das abging, haben diese Überlegenheit als natürlich hingenommen und Bonhoeffer dafür bewundert (vielleicht auch beneidet, aber es ihm nicht zu sagen gewagt, wie mir ein Mithäftling erzählte). So beschreibt Bonhoeffer zutreffend die soziologische Wirklichkeit, die scheinbar natürlich vorgegeben ist und eine Hierarchie begründet. In den Familien werden diese Unterschiede ständig reproduziert. Damit verfestigen sich diese Zustände, unter Umständen über Generationen hinweg. So werden die gesellschaftlichen Machtverhältnisse stabilisiert (siehe PISA). Teil II Bin ich, so fragt Bonhoeffer nun aber auch, nur der Aufrechte und Gelassene, der geborene Sieger-Typ? Oder gibt es noch eine andere Seite von mir, gerade hier inmitten von Not und Enge? Er ist hin und her gerissen. Soll er an seiner großbürgerlichen Haltung, die Überlegenheit und Ruhe ausstrahlt, festhalten? Oder darf er Gefühle der Ohnmacht, die er mit anderen teilt, offen äußern, ohne seine Würde zu verlieren? In diesem Gedichte sind es besonders die unterschiedlichen Eigenschaftswörter in Teil I und Teil II, die diesen krassen Widerspruch in seinem Innern zeigen. In den ersten drei Strophen beschreibt er sich mit gesetzten Worten wie: fest, klar, freundlich, gelassen und stolz. Doch jetzt folgen hier, hastig vorgetragen, die genauen Gegenworte: unruhig, krank, hungernd, zitternd, müde, ohnmächtig, leer... Damit will Bonhoeffer weit mehr sagen, als dass es ihm ab und zu gut und dann wieder ziemlich schlecht geht. Vielmehr erfährt er am eigenen Leibe, dass er den Raum der Freiheit (wie er der Oberschicht vergönnt ist), in dem er bisher sein Leben freizügig führen und gestalten konnte, verlassen muss. Wird er die Kontinuität mit der Vergangenheit wahren können oder muss ein Bruch vollzogen werden? Diese Frage bewegt ihn ständig. Doch eines ist für ihn immer deutlicher: Er wird im Gefängnis mit den vielen anderen neben sich im Raum der Notwendigkeiten (in dem sich die Unterschicht täglich bewegt) leben müssen, im Raum, wo Enge und Bedürftigkeit bestimmend sind. Da ist jetzt sein Platz! Bonhoeffer beginnt in diesem Mit-Leiden die anderen noch tiefer zu verstehen und eine Brücke über alle Schichten hinweg zu suchen. Das Gedicht zeigt also eine Wende an, auch wenn hier noch alles sehr widersprüchlich erlebt wird. Er bleibt ja seinem Habitus verhaftet - keiner kann aus seiner Haut! -, aber er steht doch vor etwas Neuem. Eines hilft ihm: In Gott findet er mitten im Zwiespalt (sein Habitus ist in eine Krise geraten) einen Halt. Wenigstens vor Gott und seinem Freund Bethge gegenüber gesteht er jetzt seine Ängste und Sehnsüchte ein und wagt es, sich zu öffnen und auch über Intimes und Innerliches zu reden. Er spricht aus, was ihm zu schaffen macht. Darin liegt wohl immer der Beginn von etwas Neuem. Seinem Neffen Walter Schleicher, der als 20jähriger an der Front ist, schreibt er: „Hast Du das Empfinden, dass Du durch die Lebensart, wie Du sie von Haus aus mitbekommen hast, für das Zusammenleben mit anderen Menschen etwas voraus hast oder umgekehrt, daß sie Dich hauptsächlich in Schwierigkeiten bringt,… hast Du das Gefühl, daß vielleicht in unseren Häusern auf gewisse Dinge zu wenig oder zu viel Gewicht gelegt worden ist?“ Bonhoeffer kommt zu der Einsicht, dass es auch im gehobenen Bürgertum bei aller Bildung und bei allem guten Geschmack bestimmte Defizite geben könnte. Diese Erkenntnis ist neu und richtungweisend, weil damit ein Tor zu etwas Neuem aufgestoßen wird. Er fährt fort: „Es ist ja schließlich für die Zukunft die wichtigste Frage, wie wir eine Basis des Zusammenlebens der Menschen miteinander finden.“ Diese Basis wünscht sich Bonhoeffer für das Leben im Gefängnis, aber dann vor allem für die Zeit im Nachkriegsdeutschland. Unterschiede dürfen nicht trennen: diese Einsicht prägte auch sein theologisches Denken in Tegel: - Es bedarf einer neuen Sprache, die mitten in das Leben aller Menschen hineinreicht. - Die Kirche, also die Christen werden nur dann glaubwürdig sein, wenn sie am alltäglichen Leben der Menschen teilhaben. So begegnet uns Gott in Christus. Er verzichtet auf Privilegien. Bonhoeffer spricht vom „ohnmächtigen Gott“. - Christus ist der Mensch „für andere“. Deshalb ist Kirche nur Kirche, wenn sie „für andere da“ ist und alles Eigentum den Notleidenden schenkt. Diese Vision von Kirche ist Bonhoeffer erwachsen einmal aus seinen Erfahrungen im Gefängnis, dann aber auch aus dem brennenden Wunsch nach Nähe und gemeinsamer Basis. Nur wer zuerst fragt: „Wer bin ich?“ und „Was trennt mich von anderen?“, wird für andere da sein können. So fordert uns Bonhoeffer auch heute immer wieder heraus, etwas von seinem Vermächtnis im Alltag einzulösen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Gottfried Beesk ist Berliner Pfarrer i.R. und hat einen Studienurlaub zu Bonhoeffer-Studien genutzt. Sein Interesse an Bonhoeffers Gedicht entstand in seiner Zeit als Gefängnispfarrer. Dieser Text wurde bereit gestellt von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Weitere Materialien für die Gemeindearbeit finden Sie unter www.asf-ev.de/service/kirchengemeinden.