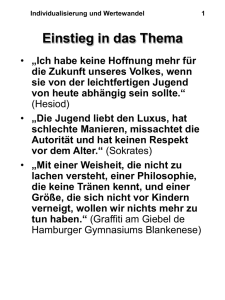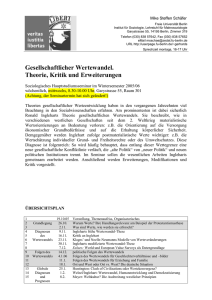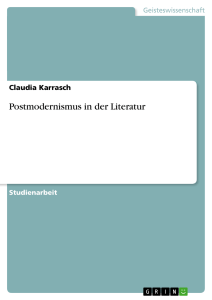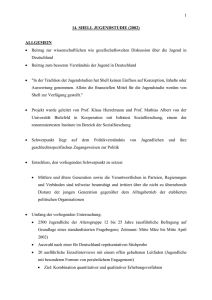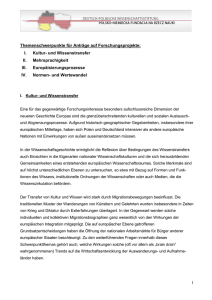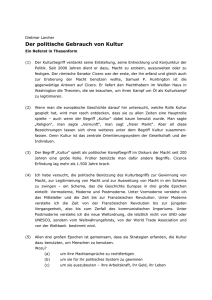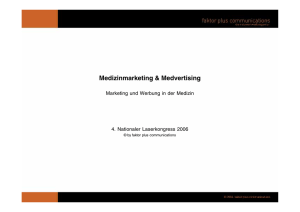Einführungsvortrag Prof. Rödder (17. Oktober 2006)
Werbung
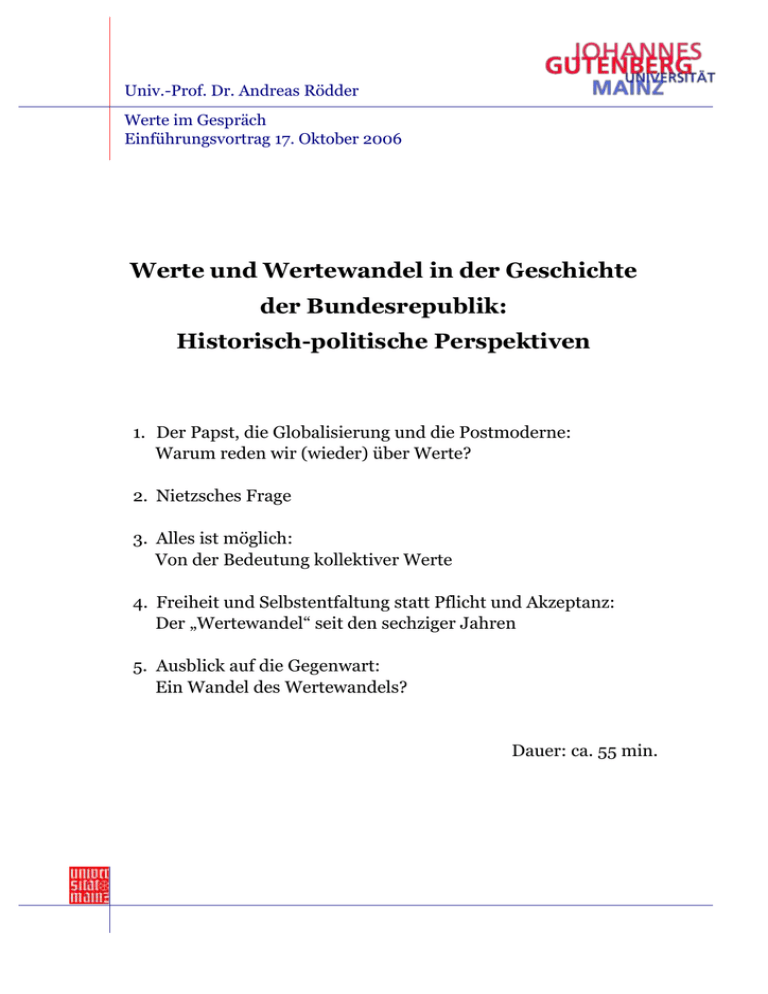
Univ.-Prof. Dr. Andreas Rödder Werte im Gespräch Einführungsvortrag 17. Oktober 2006 Werte und Wertewandel in der Geschichte der Bundesrepublik: Historisch-politische Perspektiven 1. Der Papst, die Globalisierung und die Postmoderne: Warum reden wir (wieder) über Werte? 2. Nietzsches Frage 3. Alles ist möglich: Von der Bedeutung kollektiver Werte 4. Freiheit und Selbstentfaltung statt Pflicht und Akzeptanz: Der „Wertewandel“ seit den sechziger Jahren 5. Ausblick auf die Gegenwart: Ein Wandel des Wertewandels? Dauer: ca. 55 min. 2 I. Der Papst, die Postmoderne und die Globalisierung: Warum reden wir (wieder) über Werte? Werte sind im Gespräch, wie schon ein flüchtiger Blick auf den Buchmarkt zeigt: „Werte als Wegweiser“ und „Werte für Europa“ finden wir in den Auslagen, Jimmy Carter beklagt „Unsere gefährdeten Werte“; „Wertewandel“, „Werteverlust“ und „Wertezerfall“ werden wahlweise kritisiert oder kritisch hinterfragt, „Wert und Werte“ werden als „Ethik für Manager“ angeboten oder die „Sehnsucht nach den alten Werten“, beschworen. „Werte bilden“, fordert Wolfgang Thierse, „Schluß mit lustig“ ruft uns Peter Hahne vom Lerchenberg zu, und die größte Aufmerksamkeit in diesem Herbst erregte Bernhard Bueb mit seinem „Lob der Disziplin“ – einer jener Sekundärtugenden, mit denen man Oskar Lafontaine zufolge auch ein KZ leiten konnte, oder auch, wie Helmut Schmidt konterte, es befreien. „Werte in Zeiten des Umbruchs“ forderte auch Joseph Kardinal Ratzinger, der als Papst Benedikt XVI. in seiner Regensburger Rede über Glaube und Vernunft im September 20061 die Empfindlichkeiten eines schwelenden Konflikts traf, der immer öfter als ein „Kampf der Kulturen“2 verstanden wird, als ein Zivilisationskonflikt zwischen christlichem Okzident und muslimischem Orient, zwischen West und Ost. Dabei tritt der Papst keineswegs als der Anwalt des Westens auf, wie wir ihn mit den westlichen Industrie- und Überflußgesellschaften verbinden. Vielmehr hält er gerade jenem modernen oder postmodernen Westen vor, daß er die Stimme des Göttlichen nicht mehr höre und sich allzu weit den Gefahren des Hedonismus, des Relativismus und des Nihilismus ausgeliefert habe, daß es ihm an den rechten „Werten in Zeiten des Umbruchs“ mangele.3 Dabei waren es gerade die sogenannten „westlichen Werte“ gewesen, die Westeuropa und den USA als Banner im säkularen Konflikt des 20. Jahrhunderts gedient hatten: im Ost-West-Konflikt zwischen parlamentarischer Demokratie, Freiheit und Marktwirtschaft auf westlicher Seite gegenüber Planwirtschaft und Diktatur mit dem Endziel der klassenlosen kommunistischen Gesellschaft im Osten. Die Teilung Europas zu überwinden und „eine Einheit zu schmieden, die auf den westlichen Werten beruht“, das war das Fanal, mit dem George Bush sr. in den Endkampf des Ost-West-Konflikts zog.4 Und mitten im Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums stritten die 3 Spitzen der amerikanischen und der sowjetischen Regierung, als sie Anfang Dezember 1989 vor Malta zu einem Gipfeltreffen zusammenkamen, stritten Gorbatschow, Bush und Außenminister über – Werte: Selbstbestimmung und Wahlfreiheit, Demokratie und Markt, Offenheit und Pluralismus, das waren die „westlichen Werte“, wie sie die Amerikaner vertraten. Recht indigniert antwortete Gorbatschow: „Auch wir teilen sie. Das sind doch Werte, die der gesamten Menschheit gehören.“5 In der Tat hatte Gorbatschow – ohne recht zu merken, was er tat – in vielem westliche Werte übernommen, und in der Tat schienen der Westen und die westlichen Werte am Ende des Ost-West-Konflikts in globalem Maßstab gesiegt zu haben – so sehr, daß schon von einem „Ende der Geschichte“6 die Rede war, nicht im hegelianischen oder marxistischen Sinne freilich, sondern im Sinne des westlichen Pluralismus. „Ein neues Zeitalter der Demokratie, des Friedens und der Einheit“ war es, das die Staats- und Regierungschefs der KSZE-Staaten im November 1990 in der Charta von Paris ausriefen.7 Wir wissen, daß alles anders gekommen ist: Kriege, Terrorismus und Gewalt, Spannungen und Unsicherheit suchen eine unübersichtlicher gewordene Welt seit dem Ende des Ost-West-Konflikts heim. Und wenn wir auf Deutschland schauen, dann haben sich auch hier die Erwartungen des Jahres 1990 alles andere als erfüllt, als einem vereinten Deutschland eine so glänzende und prosperierende Zukunft prophezeit wurde, daß viele es als die dominierende „Zentralmacht Europas“ sahen und manche schon ein „Viertes Reich“ befürchteten. Doch neben manch anderem ist Deutschland, belastet durch einen unreformierten Sozialstaat und die Kosten der deutschen Einheit, die Globalisierung in die Quere gekommen, die mit ihren entfesselten Marktkräften schweren Druck auf Politik, Gesellschaft und den Einzelnen ausübt. Die beschleunigten technologischen und ökonomischen Entwicklungen eröffnen neue Chancen ebenso wie neue Risiken, wobei im „alten Europa“ und in Deutschland zumal angesichts der Krise, in die das Land geraten ist, vor allem die Risiken wahrgenommen werden: die Risiken einer neuen sozialen Spaltung und einer Erosion der Mittelschichten im Zeichen vordringender Arbeitslosigkeit – Siemens und BenQ oder Airbus sind nur die aktuellsten Beispiele. Wohin dies alles führt, ist kaum absehbar, und eben dies erzeugt Unsicherheit. 4 Unsicherheit im Sinne von Ungewißheit hat neben der Globalisierung noch eine weitere, eine gesellschaftlich-kulturelle Entwicklung erzeugt: die Postmoderne, das sozialkulturelle Signum von den siebziger Jahren bis zur Jahrtausendwende. Postmoderne bedeutete radikale Pluralisierung im Sinne des „anything goes“8: „alles ist möglich“, von Familien- und Privatheitsformen oder Lebensstilen über die Religionsausübung und Spiritualität bis zu den Fernsehprogrammen. Als Kern dieser Postmoderne benannte einer ihrer wichtigsten Theoretiker, Jean-François Lyotard, das „Ende der großen Erzählungen“, der großen Erzählung vor allem der Aufklärung: der Vorstellung von der Emanzipation des Menschen durch Vernunft. An ihre Stelle trete, so Lyotard, Paralogie: wörtlich übersetzt „Widervernünftigkeit“, Paradoxie und Ironie, und Zersplitterung, eine unaufhebbare Pluralität, bis, in der Weiterung, hin zur Vorstellung von multiplen Persönlichkeiten und Identitäten ohne einen konsistenten Kern.9 Alle Realität, so das Credo des eng mit der Postmoderne verwandten Konstruktivismus, alle Wirklichkeit sei nur Konstrukt, sei nur das Produkt von Kommunikation, von kommunikativ verhandelter Sinnzuschreibung. Nach Michel Foucault, dem einflußreichsten Theoretiker innerhalb der westlichen Humanwissenschaften, dienten all solche Zuschreibungen nur zur Errichtung bzw. der Befestigung von Macht, indem sie vom „Anderen“ abgrenzten, das als das „Andere“ erst konstruiert werde: Ausländer, Homosexuelle, psychisch Kranke oder Straftäter. All dies, so der radikale Konstruktivismus, werde erst durch Zuschreibung geschaffen. Einen substantiellen Wesenskern der Phänomene gab es demzufolge nicht, kein vorgängiges Sein und keine unhintergehbare Verbindlichkeit. Diese Perspektive hilft, vieles von dem zu hinterfragen, was man einfach für gegeben hält, und zu erkennen, daß es nicht einfach gegeben ist oder war. Ein Beispiel ist die Nation: keine einfach gegebene Größe, sondern das Produkt von Abgrenzungsprozessen und Feindbildern im 19. Jahrhundert – oder auch die Geschlechterbeziehungen, in denen es keine natürliche Ordnung gibt, sondern sehr wohl Zuschreibungen von dem, was man für weiblich und was man für männlich hält. Und erst recht wirkte der Konstruktivismus massiv anti-totalitär. Zugleich stellte der Konstruktivismus alles in Frage: Ehe und Familie, die Essenz der Person und das Gewissen, Recht und Werte, falsch und richtig, letztlich gut und böse. Das „Ende aller Gewißheit“ hat Zygmunt Baumann dies genannt10, und die Protagonisten der Postmoderne haben darin vor allem Chancen zur Kreativität und zur Selbstschöpfung einer Patchworkidentität gesehen11, die Chance, sich selbst nach Belieben „neu zu erfinden“. Dieses „Ende 5 aller Gewißheiten“ erzeugt zugleich massive Verunsicherungen und Desorientierung, wenn es keine verläßlichen Grundlagen und Gewißheiten mehr gibt, nicht einmal einen verbindlichen common sense, sondern nur ein anything goes in einer immer pluraleren Vielfalt von Möglichkeiten – was in den westlichen Wohlstandsgesellschaften zugleich mit einem verbreiteten Hedonismus einhergeht, wie ihn nicht zuletzt die audiovisuellen Massenmedien transportieren. Hedonismus, Relativismus, Nihilismus – das waren die Stichworte der Kritik des Papstes am Westen. Und im „Ende aller Gewißheiten“, in der eigenen Selbst-Ungewißheit liegen zugleich die Schwierigkeiten eines Westens, der nicht an sich glaubt, weil es an sich nichts zu glauben gibt12, in dieser SelbstUngewißheit liegen die Schwierigkeiten des Westens in der Auseinandersetzung mit einem Islam, für dessen weltweit hörbare Vertreter es kein anything goes gibt. Das gibt es, im Gegensatz zum „alten Europa“, auch in der amerikanischen Führung des George W. Bush nicht, die von zivil-religiöser Selbstgewißheit beseelt ist – und sich in das Unternehmen Irak-Krieg gestürzt hat. „Unsere gefährdeten Werte“ beklagt daher Jimmy Carter – was also? Dies hier nicht weiter, aber so viel: Postmoderne und Globalisierung haben die westlichen Gesellschaften und insbesondere die deutsche in fundamentale Unsicherheiten geführt. Unsicherheit bedeutet aber, nach Orientierung zu suchen, und Orientierung geben Werte, denn so sind sie definiert – bzw. wollen wir sie folgendermaßen definieren: als allgemeine und grundlegende Orientierungsstandards, die für das Denken, Reden und Handeln der Menschen auf individueller und kollektiver Ebene als verbindlich akzeptiert, dabei explizit artikuliert oder implizit angenommen werden. II. Nietzsches Frage Was Werte sind, wird zwar unterschiedlich verstanden – schon Ende der sechziger Jahre wurden 180 Definitionen gezählt –, aber es läßt sich einigermaßen nachvollziehbar definieren. Was Werte sind, ist also nicht so sehr das Problem – mehr schon ist es die Frage nach dem woher und warum. Werte sind, darüber besteht nicht nur im Zeitalter des Konstruktivismus Einigkeit, nicht einfach da. Max Scheler entwickelte im Zeitalter des Ersten Weltkriegs eine ontologische Wertethik, die besagte, daß präexistente Werte von 6 außen vorgegeben seien und daß der Mensch diese apriorischen Werte nur zu entdecken brauche und zu internalisieren habe. Scheler geriet darüber aber schlußendlich selbst in Zweifel, und in der Tat war diese neu-kantiansche Wertphilosophie mehr die Abwehr einer drohenden Einsicht, der sich das 20. Jahrhundert schließlich nicht entziehen konnte: daß Werte in der gesellschaftlichen Wirklichkeit nämlich nicht vorgegeben und überzeitlich gültig sind, sondern daß sie gemacht, daß sie gesetzt werden. Aber es gibt doch überzeitliche Werte und Tugenden, so läßt sich einwenden, seit alters her: die vier Kardinaltugenden etwa – Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit und Gerechtigkeit – gegenüber den sieben Todsünden: Völlerei, Unkeuschheit, Habsucht, Trägheit, Zorn, Stolz und Neid – vier Kardinaltugenden, die Thomas von Aquin um die Trias von Glaube, Liebe und Hoffnung erweiterte, oder die Werte vom Guten, dem Wahren und dem Schönen. In der Tat: es gibt sie seit langem, und immer wieder greifen Menschen auf sie zurück – was ist höherer Maßstab als das „Gute“? Allein: sie werden je unterschiedlich gefüllt und sind in ganz unterschiedlichem Maße in Geltung. Gelten die sieben Todsünden noch als Sünden, überhaupt als Problem? Beispiel „Unkeuschheit“: jeder Kiosk, ein Blick in das Abendprogramm im Fernsehen oder ein Klick auf Bild.de: „klick dich durch zum Seitensprung“ suggerieren uns eine Normalität, in der ein Begriff wie „Keuschheit“ hoffnungslos antiquiert wirkt. Oder Sünde, überhaupt: wir werden dazu kommen, daß auch das Tötungsverbot alles andere als eindeutig und verbindlich war und ist. Im nächsten Abschnitt werden wir erleben, was Nietzsche als „Umwertung aller Werte“ bezeichnete. Dieser Schlußsatz aus „Der Antichrist. Fluch auf das Christentum“, seinem Spätwerk hart am Rande des Wahnsinns, war jedoch anders gemeint: Nietzsche vertrat dort die These vom „Sklavenaufstand in der Moral“: demzufolge hatte das Christentum sich mit einer Moral der Schwäche und der Schwachen, von Brüderlichkeit und Erbarmen gegen die Starken und Vornehmen durchgesetzt. Empirisch war das reichlich abenteuerlich argumentiert, aber Nietzsche hatte die zentrale Frage gestellt: „unter welchen Bedingungen erfand sich der Mensch jene Werturteile gut und böse“? Wenn es kein präexistentes Gutes oder Wahres mehr gab, dann trat der Wert „an die Stelle, an der in der philosophischen Tradition der Begriff des ‚Guten’ stand.“13 Dies bedeutet einen eklatanten Verlust an Gewißheit bereits an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, der ja auch zu den vielfältigen 7 sprichwörtlichen Leiden an der Moderne führte. Denn Werte waren und sind wandelbar, sie wandeln sich von innen heraus, sowohl auf kollektivgesellschaftlicher als auch auf individueller Ebene, als auch durch äußere Setzung. Was dies bedeutet und welche Tragweite es hat, werde ich nun anhand des deutschen Traumas schlechthin erörtern: der Ermordung der europäischen Juden im Zweiten Weltkrieg. Ich werde eine der schwierigsten Fragen der Geschichtswissenschaft, die Frage, warum „ganz normale Männer“ hunderttausende Männer, Frauen und Kinder an Erschießungsgruben und in Vernichtungslagern umbrachten, im Hinblick auf die gesamtgesellschaftlichen Werte und Normen diskutieren und mich dabei auf ebenso beunruhigende wie höchst plausible sozialpsychologische Erkenntnisse stützen14, die zugleich die Bedeutung unseres Themas aufzeigen. III. Alles ist möglich: Von der Bedeutung kollektiver Werte Warum werden Menschen, die keineswegs radikale Ideologen, notorische Kriminelle oder Sadisten sind, sondern „ganz normale Männer“, zu Massenmördern? Unendlich viel ist darüber im Hinblick auf den Holocaust nachgedacht und geschrieben worden, und Christopher Browning kam mit seiner Studie über das Polizeibataillon 101 einer nachvollziehbaren Erklärung am nächsten15. Und doch bleibt, konfrontiert mit dem Unbegreiflichen, die unübersteigbare Frage: wie konnten diese Menschen nur? Harald Welzer nun, ein historisch arbeitender Sozialpsychologe, tut etwas ebenso Einfaches wie durchschlagend Plausibles: er dreht die Perspektive der Ausnahmesituation, der Überwindung von moralischen Hemmungen und ethischen Barrieren einfach um: zugunsten der Perspektive einer so empfundenen Normalität des Gewalthandelns – gestützt im übrigen durch den Umstand, daß die Täter der Einsatzgruppen in Vernehmungen der 60er und 70er Jahre ihr Tun nach wie vor als normal darstellten, selbst wenn sie sich damit selbst belasteten. Natürlich kam beim konkreten Vollzug des Judenmordes vielerlei zusammen: nicht zuletzt die konkrete Situation des Krieges und der konkreten sozialen Gruppe – davon werde ich im folgenden nicht umfassend sprechen, sondern 8 verkürzt auf das Wesentliche im Hinblick auf unser Thema: die Bedeutung der gesamtgesellschaftlich akzeptierten Werte. Die Mörder von Berditschew und Babi Yar, von Auschwitz und Treblinka waren überzeugt, etwas Notwendiges zu tun, und sie taten es mit professioneller Distanz zu ihrem Objekt, so wie ein Chirurg arbeitet. Auf diese Weise schrieben sie ihrem Handeln Sinn zu, und das ist das Entscheidende: die Zuschreibung von Sinn. Dies ist zuerst ein individueller Prozeß, und er läuft im Zusammenhang mit dem psychologischen Mechanismus der kognitiven Konsonanz ab, mit dem Menschen ihre Einstellungen und ihr Verhalten in Einklang bringen und stimmig machen. Im Kern ein individueller Vorgang, eingebettet in den situativen Kontext einer bestimmten sozialen Situation, in diesem Fall die Situation des Auftrags, die Juden eines Ortes zu liquidieren – wie gesagt: diese beiden inneren Kreise des Tatzusammenhangs werde ich hier nicht näher verhandeln. Der erste, äußere oder grundlegende „Kreis des Tatzusammenhangs“16 aber ist ein gesellschaftlicher, der Kreis nämlich der gesamtgesellschaftlich akzeptierten Normen und Werte. Menschen tun in aller Regel, so sagen es uns die empirischen Erkenntnisse der Sozialpsychologie, was allgemein bzw. was in ihrer Umgebung als richtig angesehen wird, sprich: was der so empfundenen bzw. der gesetzten „Normalität“ entspricht. In Normalität steckt schon der Begriff der Norm – und in der Tat stehen die Ebenen der immateriellen Werte und des konkreten Handelns in engem Zusammenhang und Wechselverhältnis. Anpassungsfähigkeit ist ein herausragendes Merkmal der Spezies Mensch; Konformität und Gehorsam stellen wesentliche Antriebsfaktoren sozialen Handelns dar – das haben vielfältige sozialpsychologische Experimente schon seit den fünfziger Jahren belegt, und es entspricht auch den Ergebnissen der Allensbacher Meinungsforschung bzw. der Theorie von der „Schweigespirale“: Menschen sagen in der Regel öffentlich nur das, womit sie nicht auf Widerspruch stoßen. Eben dieser Referenzrahmen des so empfundenen Normalen hatte sich im nationalsozialistischen Deutschland verschoben. Nicht daß in Deutschland, wie es Daniel Goldhagen so überzogen plakativ formuliert hat, ein indigener eliminatorischer Antisemitismus geherrscht hätte. Aber die Juden waren seit 1933 sukzessive herausdefiniert worden aus dem Kreis des zu schützenden Menschengeschlechts und waren umdefiniert worden Schädlingen. Dies war der Hintergrund und die Grundlage dafür, daß die Angehörigen der Einsatzgruppen und der Polizei in der nochmals radikal verschärften Situation des Krieges, vor 9 allem im Rußlandfeldzug seit dem Sommer 1941 und in einer konkreten Situation in einer Gruppe außerhalb und fernab ihres gewohnten Umfeldes, daß diese Täter es letztlich für etwas Normales hielten, Juden zu töten, so wie man Schädlinge ausmerzt, Fliegen und Mücken erschlägt. Dahin zu kommen, war ein stufenweiser Prozeß, ein Prozeß, in dem sich das Normengefüge im Zusammenhang mit der sozialen Praxis verschoben hatte und an dessen Ende sich eine so empfundene Normalität etabliert hatte, zu der auch Massenmord gehörte. Harald Welzer beschreibt dieses eigendynamische Kontinuum mit großer Eindringlichkeit: Es ist „zweifellos jeweils etwas anderes, ob ich die Straßenseite wechsele, wenn mir ein jüdischer Bekannter begegnet, weil ich fürchte, in eine peinliche Situation zu geraten, oder ob ich in die schöne Wohnung, aus der zuvor eine jüdische Familie ‚entmietet’ wurde, oder ob ich den Tod eines Menschen durch eine Unterschrift unter ein ärztliches Formular anordne oder ob ich Krematoriumsöfen entwerfe oder ob ich den Karabiner am Hinterkopf eines auf den nackten Leichen seiner Eltern liegenden Kindes ansetze. All dies sind qualitativ verschiedene Stufen, die unterschiedlich schwierig zu überschreiten sind, aber ich fürchte, dabei handelt es sich um ein Kontinuum, an dessen Anfang etwas scheinbar Harmloses steht und dessen Ende durch die Vernichtung markiert ist. es ist nur für die meisten von uns wichtig, die ersten überschritten zu haben, um die letzten überschreiten zu können.“17 Wie gesagt: die Tötung ist eine Handlung in einer bestimmten Situation, aber die Grundlage dafür ist ein Prozeß, die Verschiebung des Normengefüges, eine Verschiebung der so empfundenen Normalität, und dies in Verbindung mit sozialer Praxis. Diese so empfundene Normalität wirkte auch in der Erinnerung der Täter weiter, bis hin zum völligen Unverständnis für das Unverständnis anderer: Franz Stangl, der Kommandant des Vernichtungslagers Treblinka empörte sich noch in den siebziger Jahren über den Vorwurf, er hätte Juden im Vernichtungslager unkorrekt behandelt. Er legte vielmehr größten Wert darauf, daß er einem Juden hatte Recht widerfahren lassen, dem ein SS-Mann seine Uhr weggenommen hatte – daß er eben diesen Juden wenig später töten ließ, stellte für ihn kein Problem dar. Wir sehen: ein Teil des Normensystems, sich korrekt zu verhalten, ist hier noch in Kraft, aber ein anderer, fundamentaler Teil, der Rahmen hat sich ganz verschoben: die Tötung von Hunderttausenden gilt als etwas Notwendiges, als moralische Pflicht. 10 Oder eine Krankenschwester: „Wenn mir vorgehalten wird, ob ich auf entsprechenden Befehl hin einen Diebstahl ausgeführt hätte, so sage ich hierzu, daß ich das nicht getan hätte. Die Verabreichung von Medikamenten und sei es auch zum Zweck der Tötung von Geisteskranken gewesen, sah ich allerdings als eine mir obliegende Dienstpflicht an, die ich nicht verweigern durfte.“18 Wir sehen auch: es war nicht der Befehlsnotstand, der die Täter zu ihrem Tun bewegte, sondern sie maßen ihrem Tun durchaus Sinn im Rahmen der so empfundenen Normalität bei – und dieser Rahmen wurde durch den Begriff „ordnungsgemäß“ gezogen. So liest sich sogar Himmlers berüchtigte Posener Rede, der im Hinblick auf die „Ausrottung des jüdischen Volkes“ davon sprach, dies „durchgehalten zu haben und dabei – abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwächen – anständig geblieben zu sein“19: als Ausdruck einer so empfundenen, mit chirurgischer Professionalität ausgeführten Notwendigkeit eines Massenmordes. Was dem voraufgeht, noch einmal, ist eine Verschiebung von Norm und Normalität, von falsch und richtig, eine Umkehr der Grundsätze der modernen Verfassungsentwicklung, wie sie in der amerikanischen Declaration of Independence niedergelegt worden waren: that all men are created equal und daß sie über unveräußerliche Rechte verfügen: life, liberty and the pursuit of happiness – eine Umkehr des Zentralebegriffs aller Ethik: des Guten und eine Umkehr des fünften Gebots im Vernichtungskrieg in sein Gegenteil: „Du sollst töten“ – die „Umwertung aller Werte“. Natürlich gab es Ausnahmen von dieser Verschiebung des kollektiven Normengefüges samt der damit verbundenen sozialen Normalität: Menschen, die sich entzogen, verweigerten oder gar Widerstand leisteten. Sozialpsychologische Experimente zeigen aber, wie sehr die umgebende Normalität den Menschen prägt und wie schwer demgegenüber individuelles nonkonformes Handeln fällt – und nur wenige tun dies. Das heiß aber umgekehrt: der Weg in einen aktiven Widerstand war viel weiter, als es die heute so suggestiv und vorschnell gestellte Frage voraussetzt, warum die Einzelnen keinen Widerstand geleistet haben. Daß sie es nicht taten, war nicht nur eine Frage von Gewalt, die sie bedrohte, sondern von einer elementaren Normalität, die sie umgab. Und warum soll es in dieser Zeit und obendrein unter massiv verschärften Bedingungen anders gewesen sein als heute: Auch heute ist die kollektive, die gesamtgesellschaftlich akzeptierte Normalität und Norm handlungsleitend – nur merken wir es in der Regel gar nicht, was 11 wiederum im historischen Umkehrschluß heißt: die Zeitgenossen des Nationalsozialismus auch nicht. Nun ist die Normalität in einer pluralistischen Gesellschaft weniger dramatisch als in einer Diktatur, noch dazu einer solchen wie der des Nationalsozialismus. In pluralistischen Gesellschaften gibt es keinen zentral steuernden Willen samt seiner destruktiven Gewaltpotentiale, vielmehr sind die bedingenden Kräfte kaleidoskopisch aufgefächert. Die allgemein akzeptierten Werte werden im öffentlichen Diskurs ausgehandelt, dabei beeinflußt durch die soziale Praxis, die wiederum durch das gültige Werte- und Normensystem bestimmt wird. So verschiebt sich auch in pluralistisch-demokratischen Gesellschaften das als Normalität Akzeptierte, das normative Gefüge von falsch und richtig, oft unmerklich und zugleich kollektiv handlungsleitend, aber ohne Garantie für die Richtung. Ich möchte drei Schlußfolgerungen aus diesen Beobachtungen ziehen. Erstens eine allgemeine historische Lehre, in aller Eindringlichkeit: alles ist möglich, grundsätzlich überall und binnen kurzer Zeit. Ein Blick auf die Massenmorde der neunziger Jahre im ehemaligen Jugoslawien oder in Ruanda genügt. Und auch die Staaten, die lange Zeit den Mythos von Widerstand oder Neutralität gegenüber dem NS-Deutschland pflegten, haben schmerzlich erkennen müssen, daß sie viel weitergehend, viel aktiver und viel freiwilliger mit NS-Deutschland kooperiert, ja kollaboriert haben, als es mit ihrem Selbstbild vereinbar war: Frankreich, die Niederlande oder die Schweiz nur zum Beispiel.20 Oder das berühmt-berüchtigte Milgram-Experiment mit Probanden, die einem vermeintlichen Schüler Stromschläge verabreichen sollten, um ihn für falsche Antworten zu bestrafen. Die Dosis wurde mal um mal mit dem Argument gesteigert, der Schüler sei damit einverstanden und diese Bestrafung sei für das wissenschaftliche Experiment notwendig. Auch als der vermeintliche Schüler nicht nur schmerzerfüllt schrie und um Aufhören bettelte, sondern sogar bereits verstummt war, verabreichten die Testpersonen noch weitere Stromschläge, deren Dosis im Ernstfall absolut tödlich gewesen wäre. Alles ist möglich: die Kreuzzüge oder Sklaverei, die Verbrennung von Hexen in Europa oder die Verbrennung von Witwen in Indien, die Ausrottung der Indianer oder islamistische Selbstmordattentate. „Thin is the crust of civilisation over the boiling lava of human passions“21, schrieb Robert Cecil, der nachmalige 3. Marquess of Salisbury im Jahr 1857 – “ganz dünn ist die Kruste der Zivilisation über der kochenden Lava menschlicher Leidenschaften.“ Nicht 12 daß der Mensch von Grund auf schlecht ist, so möchte man modifizieren, aber er ist zu allem in der Lage, und ihm ist alles zuzutrauen. Wir alle potentielle Massenmörder? Undenkbar, und doch passiert. Und daher ist die normative Einhegung durch einen Rahmen allgemein verbindlicher normen und Werte so entscheidend – zumal, und das ist entscheidend, die Teilnehmer am MilgramExperiment oder an einer Witwenverbrennung ebenso wie die islamistischen Selbstmordattentäter oder auch die Mörder der Juden in Osteuropa der subjektiven Überzeugung waren, daß es richtig und notwendig ist, was sie tun. Damit bin ich bei der zweiten Schlußfolgerung: der Bedeutung der Werteebene, des Rahmens der allgemein akzeptierten Werte und der daraus abgeleiteten gültigen Normen – denn sie sind kollektiv handlungsleitend. Dieser Rahmen ermöglichte den Judenmord durch Angehörige eines Landes, das als das Kulturvolk schlechthin galt, und ein anders gezogener Rahmen machte aus diesen Deutschen weithin gute Demokraten – oder weithin konforme DDRBürger. Die allgemein akzeptierten Werte sind die Voraussetzung für Barrierefreiheit für Behinderte oder für die Tötung sogenannten „lebensunwerten Lebens“, für gender mainstreaming ebenso wie für Kinderlosigkeit als normal gewordene Lebensform, für Straffreiheit von Abtreibung, für Antidiskriminierung oder für allgemeine Toleranz – sie bedingen, alles zusammen und ganz zugespitzt, Menschenrechte ebenso wie Massenmord. Das heißt: es gibt historisch-empirisch keine verläßlich vorgängigen, universellen, überzeitlich verbindlichen, unverrückbar gültigen Werte. Und dies führt uns zur dritten Schlußfolgerung: die allgemein verbindlichen Werte müssen gesetzt werden – im Grunde eine postmodern-konstruktivistische Position. Heißt das aber auch, daß wir jeden Gedanken an Substanz, Konsistenz und Verbindlichkeit aufgeben müssen? Hier setzt die Philosophie von Hans Joas ein: Normen und Werte sind, so Joas, nötig und möglich. Er verbindet die Einsicht in die kontingente Entstehung von Werten mit ihrer universalen Gültigkeit und verbindet somit Wertepluralismus mit moralischem Universalismus. Dabei sind es, wie Hans Joas in dieser Reihe selbst ausführen wird, insbesondere Gewalterfahrungen, die den Wert der Menschenwürde befördern.22 Und natürlich müssen wir die Werte nicht aus dem Nichts holen, sondern können auf den Reichtum der abendländischen Philosophie, der jüdischchristlichen Tradition und der Aufklärung zurückgreifen: dann sind es im Kern das fünfte Gebot und die Menschenwürde, die Grund- und Menschenrechte, die 13 auch durch die „Umwertung aller Werte“ ihre Gültigkeit nicht verloren haben. Was das aber konkret bedeutet, ist stets wandelbar, wie uns allein die Diskussionen um Abtreibung, Sterbehilfe und Stammzellforschung vor Augen führen, und es bewegt sich, wie die gesamte Geschichte, stets auf dünnem Eis. Aber auch jenseits der Elementarfragen von Leben, Tod und Menschenwürde wandeln sich die Werte bzw. ihre allgemeine Akzeptanz, und das ist es, auf verschiedenen Feldern, was wir im engeren gegenwartsorientierten Sinne unter dem „Wertewandel“ verstehen. Dieser „Wertewandel“ hat sich in der Bundesrepublik seit den sechziger Jahren vollzogen, in engem Zusammenhang und in Wechselwirkung mit einer veränderten sozialen Praxis im Zeichen von Pluralisierung und Individualisierung. IV. Freiheit und Selbstentfaltung statt Pflicht und Akzeptanz: Der „Wertewandel“ seit den sechziger Jahren Die sozialkulturelle Entwicklung im Zeichen des Wertewandels spielte und spielt sich in wesentlichem Maße im Bereich der Privatheitsformen ab, mit substantiellen öffentlichen und gesellschaftlich-politischen Weiterungen. Pluralisierung ist das Stichwort, in der sozialen Praxis ebenso wie, eng damit verbunden, im Hinblick auf die allgemein akzeptierten Normen und Werte. Dabei haben wir es mit einem „Wertewandelsschub“23 zwischen den mittleren sechziger und den mittleren siebziger Jahren zu tun, parallel zum Durchbruch zu spürbarem Massenwohlstand und etablierter Konsumgesellschaft. Diese Entwicklung hat sich in der Zeit danach weiter fortgesetzt und vor allem in den achtziger Jahren verstärkt. Pluralisierung heißt zunächst, daß aus der Kernfamilie eines verheirateten Ehepaares mit Kindern – der Norm und auch der Regel in den fünfziger Jahren – sich allein schon vier Paarkombinationen herausbildeten: verheiratete und unverheiratete Paare mit und ohne eigene und nicht eigene Kinder. Hinzu kamen die Alleinerziehenden sowie die Alleinlebenden und, neuerdings sozial zumindest offiziell nicht mehr geächtet, homosexuelle Lebensgemeinschaften. Fast alle dieser Lebensformen sind als soziale Massenphänomene ebenso neu wie der Tatbestand der gewollten Kinderlosigkeit als ein akzeptiertes und sozial üblich gewordenes Phänomen. Auf diese Weise haben sich die Geburtenraten seit den sechziger Jahren beinahe halbiert, und die Reproduktion der 14 Gesellschaft um den Faktor 0,7 geht inzwischen in die zweite Generation. Diese Pluralisierung der Formen des Zusammenlebens steht in enger Wechselwirkung mit einer Fülle von weiteren Entwicklungen, von denen ich vier herausstellen möchte: Geschlechterbeziehungen, Sexualmoral, Freizeit und Entkirchlichung. Erstens: die Geschlechterbeziehungen im Zeichen dessen, was Trutz von Trotha bekannt thesenfreudig – wir dürfen auf sein Gespräch über Familien- und Privatheitswerte mit Andreas Wirsching freuen – die „Entfamiliarisierung der Frau“24 genannt hat, jedenfalls ihrer Lösung aus dem Modell der „ErnährerHausfrau-Familie“. Die Entwicklung der Geschlechterbeziehungen seit den sechziger, eher siebziger Jahren zählt zu den tiefstgreifenden Veränderungen in der Geschichte der Bundesrepublik, die sich erst jetzt wirklich in voller Breite durchsetzt. Politisch zunächst von der „neuen Frauenbewegung“ in den siebziger Jahren aufgebracht, setzte sich der Anspruch auf Gleichberechtigung bzw. den Abbau von geschlechtsspezifischer sozialer Ungleichheit vor allem auf dem Wege einer schrittweisen Veränderung der allgemein akzeptierten Werte und Normen, der so empfundenen Normalität durch. Was ich meine, zeigt sich in nuce an unserem automatischen Befremden über einen Satz, der im Wahlkampf von 1972 nicht allzu viele störte: „Wir haben die richtigen Männer“, plakatierte die SPD – „Wählen Sie Anke Fuchs“. Der Unterschied zu einer Zeit, in der die Bundesrepublik von ihrer ersten Kanzlerin regiert wird und im Bundeskabinett sechs von 16 Positionen mit Frauen besetzt sind, liegt auf der Hand. Daß Angela Merkel dabei um ihre Weiblichkeit wenig Aufhebens macht, macht diesen Wandel nur um so deutlicher. Und natürlich wird dies durch einen Beruf sichtbar. Denn Berufstätigkeit von Frauen war der Kristallisationskern der weiblichen Emanzipation – ganz im Sinne der Moderne: denn im Gegensatz zur vormodernen ständischen Gesellschaft wird gesellschaftlicher Status in der modernen Leistungsgesellschaft nicht durch Geburt, sondern in erster Linie über Erwerbstätigkeit und Berufsposition zugewiesen.25 Der wirksamste Katalysator dieser Entwicklung war Bildung – insofern waren es in wesentlichem Maße Frauen, die von den Bildungsreformen seit den sechziger und siebziger Jahren profitierten. Überhaupt die Bildungsreformen: viel wird an Universitäten und Schulen, oft mit gutem Recht, über den Verfall von Bildung und Bildungsinstitutionen lamentiert. Ein anderes wird aber dabei übersehen: nämlich eine gleichzeitige Höherqualifizierung von weiten Teilen der Bevölkerung und somit, in den guten Zeiten der Bundesrepublik, eine allgemeine gesellschaftliche „Umschichtung 15 nach oben“26. Zugleich beförderte zunehmende Bildung die Individualisierungsund Pluralisierungstendenzen im Bereich von Werten sowie von Privatheitsformen und Lebensstilen. Damit kommen wir zum Ausgangspunkt zurück und nun zur zweiten Entwicklung. Indem die sogenannte bürgerliche Kernfamilie nicht mehr den Norm- und den Regelfall darstellte, verlor auch die Institution Ehe an Funktion und Bedeutung. Fand es noch 1967 weniger als ein Viertel der jungen Frauen in Ordnung, mit einem Mann unverheiratet zusammenzuleben, so hatte sich das Verhältnis bereits wenige Jahre später umgekehrt: nun sahen gut drei Viertel nichts dabei. Ehe und Elternschaft entkoppelten sich ebenso wie Partnerschaft überhaupt und Elternschaft, und ebenso Sexualität und Ehe. Dahinter steht ein Wandel der Sexualmoral, der weit über die sexuelle Befreiung im Umfeld von 1968 und der Kommune 1 hinausging, ja auch hier vielmehr durch allgemeine sozialkulturelle Prozesse vorangetrieben wurde, in diesem Falle nicht zuletzt die Massenmedien im Zeitalter des dualen Rundfunksystems. Allgemein ist eine zunehmende Permissivität festzustellen, sowohl in den Haltungen als auch – dort allerdings, wie die Sexualwissenschaftler gemessen haben, weniger – im Verhalten. Damit sind wir bei einer dritten Entwicklung: der Freizeitgestaltung im Zeichen anspruchsvoller individualisierter Lebensstile. Freizeit gewann in der sozialen Praxis und mehr noch im Diskurs der achtziger Jahre eine solche Bedeutung, daß Sozialwissenschaftler ihr eine größere Bedeutung für die Struktur der Gesellschaft zuzuschreiben begannen als der materiellen Schichtung. Statt nach Klassen und Schichten wurde die Gesellschaft – nicht zuletzt von der Marktforschung – nach „neuen sozialen Milieus“ unterschieden: subkulturellen Einheiten, die sich nach Wertorientierungen und Lebensstilen unterscheiden – vom „konservativen gehobenen Milieu“ über das „aufstiegsorientierte Milieu“ oder das „hedonistische Milieu“ bis zum „traditionslosen Arbeitermilieu“.27 Diese gesellschaftlichen Gesamtbeschreibungen, die sich auch in Begriffen wie „Erlebnisgesellschaft“ oder – kritisch – „Spaßgesellschaft“ niederschlugen, stammen aus der prosperierenden Wohlstandsgesellschaft der achtziger Jahre. Nun ist dieser Wohlstand unübersehbar rückläufig, und Peter Scholl-Latour ebenso wie Peter Hahne haben das „Ende der Spaßgesellschaft“ ausgerufen. Nach wie vor aber beschreiben diese „neuen sozialen Milieus“ eine wesentliche 16 Strukturierung der bundesdeutschen Gesellschaft, wie auch eine neue Studie über „Lebensstile und religiöse Orientierung“ bestätigt28. Damit sind wir bei der vierten Entwicklung: dem Rückgang von Kirchenbindung, am deutlichsten ablesbar an den Kirchenbesucherzahlen, die seit den sechziger Jahren erheblich zurückgegangen sind – zu diesem Thema werden mit Karl Gabriel ein führender Religionssoziologe und mit Daniel Deckers einer der besten Kenner der katholischen Kirche in Deutschland sprechen. Religion ist zunehmend privatisiert worden, und Religiosität ist diffuser geworden – ganz zu schweigen vom sozialistischen Erbe der flächendeckenden Entkirchlichung in den neuen Ländern. Die Kirchen haben an allgemeingesellschaftlicher Normsetzungskompetenz verloren, wie sich im Falle der Sexualmoral oder der Abtreibung zeigte. Zugleich hat der Rückgang an Kirchenbindung Auswirkungen auf die allgemeinen Werthaltungen: wie die Allensbacher Meinungsforscher mit einem obligat kulturpessimistischen Einschlag festgestellt haben, urteilen kirchlich Gebundene nämlich in vielen gesellschaftlichen Fragen moralisch anders als kirchlich nicht Gebundene: von Abtreibung und Sterbehilfe bis hin zur Steuerhinterziehung und zum Schwarzfahren.29 Diese Entwicklungen sind seit den siebziger Jahren von einer internationalen und interdisziplinären sozialwissenschaftlichen Wertewandelsforschung empirisch untersucht worden, in aller Regel mit den Methoden der Umfrageforschung. Eine besonders plausible Kategorisierung des Wertewandels hat dabei Helmut Klages mit seiner Speyerer Wertewandelsforschung erarbeitet. Er beschrieb die Veränderungen der Präferenzen im gesamtgesellschaftlichen Werte- und Normengefüge seit den mittleren sechziger Jahren als eine Verschiebung von Pflicht- und Akzeptanzwerten – Akzeptanz verstanden als die Hinnahme des Vorfindlichen – hin zu Freiheits- und Selbstentfaltungswerten.30 Freiheits- und Selbstentfaltungswerte, das sind partizipatorische Werte wie Freiheit und freier Wille, Selbstbestimmung, Autonomie des Individuums und Emanzipation von Autoritäten, verbunden mit tendenziell hedonistischen Werten wie Genuß, Erfüllung, Ungebundenheit und Abwechslung. Demgegenüber verloren Pflicht- und Akzeptanzwerte an Wertschätzung und gesamtgesellschaftlicher Verbindlichkeit: 17 Disziplin und Leistung, Ordnung und Pflichterfüllung, Verzicht und Treue, Anpassung und Gehorsam, Bindung und Verpflichtung. Dies betrifft in wesentlichem Maße die Werte, die die historische Bürgertumsforschung, mit Bezug vor allem auf das 19. Jahrhundert, als die klassischen bürgerlichen Werte ausgemacht hat: Arbeitsethos und Leistungsbereitschaft im Zeichen von Erfolgsstreben, Disziplin und Pflichtbewußtsein Selbständigkeit des selbstverantwortlichen Individuums, das sich zugleich auf das Gemeinwohl verpflichtet sieht Bildung und Hochkultur Religiosität und Kirchlichkeit sowie die bürgerliche Familie.31 Im ersten Werte-Gespräch haben wir die Gelegenheit, diese Bedeutung der bürgerlichen Werte mit zwei hochrangigen Sozialhistorikern, mit Klaus Tenfelde und Andreas Schulz zu diskutieren. Aber noch einmal zurück zu Helmut Klages: Sein zentrales Beispiel ist die Entwicklung der Erziehungswerte: hier stellt er eine „dramatische Scherenbewegung“ seit den mittleren sechziger Jahren fest. Die Wertegruppe „Gehorsam und Unterordnung“ verlor nämlich beharrlich an Bedeutung, wohingegen die Wertegruppe „Selbständigkeit und freier Wille“ in erheblichem Maße an Bedeutung gewann.32 Es ist genau diese Entwicklung, die Bernhard Bueb mit seinem vieldiskutierten „Lob der Disziplin“ fundamental kritisiert: „Der Erziehung ist vor Jahrzehnten das Fundament weggebrochen: die vorbehaltlose Anerkennung von Autorität und Disziplin. [...] Viele irren ziel- und führungslos durchs Land. Denn der Konsens, wie man Kinder und Jugendliche erziehen soll, ist einem beliebigen, individuell geprägten Erziehungsstil gewichen. Es gibt keine Übereinkunft über die Notwendigkeit, die Legitimation und die praktische Ausübung von Autorität und Disziplin.“ Denn nur durch Disziplin, so Bueb, erwirbt man wirkliche Freiheit.33 Sein Gespräch mit dem Bildungshistoriker Heinz-Elmar Tenorth wird sicher einer der Höhepunkte in einer Reihe sein, in der alle Gespräche hohes Niveau und reiche Erkenntnis versprechen: etwa mit den beiden grand old men Gerhard A. Ritter und Hans-Peter Schwarz über Sozialpolitik, Staat und Nation oder mit dem früheren Generalinspekteur der Bundeswehr, Klaus Naumann, und Ute Frevert aus Yale über militärische und zivile Werte. Noch einmal zurück zu Bernhard Bueb: was er, wie eben zitiert, über die Erziehung sagt, klingt beinahe wie eine Abrechnung mit dem gesamten 18 Wertewandel, mit der gesamten Pluralität der Postmoderne. Deutet sich darin, daß solches wieder ausgesprochen wird, ein „Wandel des Wertewandels“ an? V. Ausblick auf die Gegenwart: Ein Wandel des Wertewandels? Ein „Wandel des Wertewandels“ ist schon seit einigen Jahren von seiten der Sozialwissenschaften ins Gespräch gebracht worden, von Stefan Hradil34 etwa, auf den wir uns in der großen Abschlußdiskussion freuen dürfen. Seit den neunziger Jahren, so haben die Allensbacher Meinungsforschung oder die ShellJugendstudien festgestellt, haben Gemeinschaftswerte und Sicherheitswerte an Bedeutung gewonnen: Sicherheit insbesondere bezogen auf den Arbeitsplatz, und gemeinschaftliche Wertvorstellungen im Hinblick auf langfristig verbindliche Partnerschaften, Familie und Treue oder auf Solidarität und Nächstenliebe. Ist dies ein Richtungswandel der Wertvorstellungen, in den sich auch das „Lob der Disziplin“ einfügt oder wie er sich in der Begeisterung für den Papst und den Weltjugendtag niederschlägt? Die jüngste Studie über „Lebensstile und religiöse Orientierung“ spricht eine andere Sprache: zwei Drittel der Gesellschaft, die modernen und postmodernen Milieus der Individualisten und der MultiOptionalisten, stehen der katholischen Kirche grundsätzlich distanziert gegenüber. Und selbst in den traditionell kirchennahen Milieus erodiert die Bindung an die Kirche, wie ja etwa im Fall der CDU und namentlich ihrer Parteiführung ganz deutlich erkennbar ist.35 Ein neuerlicher Bedeutungsgewinn von klassischen bzw. Pflichtwerten wie Familie, Bindung oder Disziplin hat bislang weder auf die öffentliche massenmediale Kommunikation und deren Standards nachhaltig durchgeschlagen noch auf die soziale Praxis: weder steigen die Zahlen der Geburten und Eheschließungen an, noch geht jene der Ehescheidungen zurück, im Gegenteil. Allerdings deuten sich auf sprachlicher Ebene Verschiebungen an: die Unbefangenheit, mit der heutzutage wieder von „Elite“ gesprochen wird, selbst auf politisch linker Seite, deutet darauf hin, daß hier Veränderungen im Gange sind. Und wenn in der Tat die materielle bzw. Wohlstandsentwicklung für die Entwicklung allgemein gültiger Wertvorstellungen so bedeutsam ist, wie es zu 19 sein scheint, da der Wertewandel seit den sechziger Jahren einherging mit dem Durchbruch der Konsum- und Wohlstandsgesellschaft – dann wird sich die möglicherweise fortschreitende Erosion des deutschen Wohlfahrtsstaates und auch der Wohlstandsgesellschaft mit ihrer starken Mittelschicht, dann wird sich eine solche Entwicklung auch auf die Entwicklung der gesamtgesellschaftlich akzeptierten und praktizierten Werte und Normen auswirken, dann stehen uns möglicherweise einschneidende Veränderungen bevor. Als Historiker kann ich weder die Frage beantworten, ob bzw. welche Werte wir brauchen. Noch will ich prognostizieren. Denn wenn es eine verläßliche historische Lehre für die Gegenwart gibt, dann die, daß die Entwicklungen der Zukunft anders verlaufen als gedacht und auch nicht linear – wie es die sozialwissenschaftliche Wertewandelsforschung zumeist angenommen hat, wenn sie etwa den Wertewandel als „vorläufige[n] Schlußstein“ der „inzwischen ausgereifte[n] Moderne“ und als einen Prozeß ständig wachsender Autonomie und Individualisierung aufgefaßt hat36. Historische Entwicklungen verlaufen aller Erfahrung nach vielmehr kurvenreich und vom Standpunkt der Gegenwart aus meist unabsehbar. Und wir haben gesehen: alles ist möglich – von der Menschenwürde bis zum Massenmord. Die Aufgabe der historischen Perspektive liegt darin, die Gegenwart im größeren Zusammenhang der Vergangenheit neu zu sehen. Auf diese Weise vermag die historische Betrachtung auch die sozialwissenschaftliche Wertewandelsforschung zu erweitern, die in aller Regel auf den knappen Zeitraum ihrer je eigenen Gegenwart konzentriert war und die somit den Wertewandel nicht in eine langfristige Perspektive einzuordnen vermochte.37 Dieses Defizit erkennt die sozialwissenschaftliche Wertewandelsforschung auch selbst: daß nämlich die zentrale Frage nach wie vor offen ist, ob es sich bei den Wertewandeln des späten 20. und des frühen 21. Jahrhunderts „nur um kurzfristige Schwankungen oder in der Tat um einen langfristigen Wertewandel“ und historischen Trendbruch handelt.38 Um eben diese historische Perspektive des Wertewandels – auch wissenschaftlich weithin Neuland – bemühen sich die „Werte im Gespräch“, vom Kaiserreich bis heute, von bürgerlichen Werten über Familie und Erziehung oder Staat und Nation bis zu militärischen und zivilen Werten. Ich hoffe, ich habe zumindest andeuten können, daß der Themenkomplex von weitreichender und grundlegender Bedeutung ist und daß unsere Reihe reichlich Gesprächsstoff enthält. 20 Benedikt XVI., Glaube, Vernunft und Universität, in: FAZ vom 13. September 2006, S. 8. Samuel P. Huntington, The clash of civilisations and the remaking of world order, London 1998. 3 Vgl. Joseph Kardinal Ratzinger, Werte in Zeiten des Umbruchs. Die Herausforderungen der Zukunft bestehen, Freiburg 2005, S. 43-46 und 50-52 4 George Bush auf einer Pressekonferenz nach dem NATO-Gipfel in Brüssel, 30. Mai 1989, hier nach Philip Zelikow/Condoleezza Rice, Sternstunde der Diplomatie. Die deutsche Einheit und das Ende der Spaltung Europas, Berlin 1997, S. 62. 5 Zit. nach Michail Gorbatschow, Gipfelgespräche. Geheime Protokolle aus meiner Amtszeit, Berlin 1993, S. 128. 6 Francis Fukuyama, Das Ende der Geschichte. Wo stehen wir? München 1992. 7 Charta von Paris für ein neues Europa. Erklärung des Pariser KSZE-Treffens der Staats- und Regierungschefs vom 21. November 1990, zit. nach Karl Kaiser, Deutschlands Vereinigung. Die internationalen Aspekte, Bergisch Gladbach 1991, S. 368. 8 Paul Feyerabend, Anything goes. Wider den Methodenzwang. Frankfurt a.M. 1976, bes. S. 13 und 21. 9 Jean-François Lyotard, Das postmoderne Wissen. Ein Bericht, hrsg. von Peter Engelmann, Wien 1999, S. 112, 119f. und 175-177. 10 Zygmunt Baumann, Postmoderne Ethik, Hamburg 1996. 11 Richard Rorty, hier nach Hans Joas, Die Entstehung der Werte, Frankfurt a.M. 1997, S. 229. 12 Vgl. Gerhard Schulze, Hedonismus. Schriftenreihe der Vontobel-Stiftung, Zürich 2005, S. 14. 13 Hans Joas, Die Entstehung der Werte, Frankfurt a.M. 1997, S. 39; ; vgl. auch die Gleichsetzung von „moralische[r] güte“ und „werth“ bei Moses Mendelssohn, hier nach Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Vierzehnten Bandes I. Abteilung 2. Teil, Neuausg. Leipzig 1960, S. 460. 14 Harald Welzer, Täter. Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden. Frankfurt a.M. 2005. 15 Christopher Browning, Ganz normale Männer. Das Reserve-Bataillon 101 und die „Endlösung“ in Polen. Reinbek 1993 16 Welzer, Täter (wie Anm. 14), S. 16. 17 Welzer, Täter (wie Anm. 14), S. 257. 18 Welzer, Täter (wie Anm. 14), S. 24-30 (Stangl) und 67 (Krankenschwester). 19 Heinrich Himmler, Rede auf der SS-Gruppenführertagung in Posen am 4. Oktober 1943, in: Internationaler Militärgerichtshof, Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher, Nürnberg 1948, Bd. 29, S. 149 (1919-PS). 20 Vgl. etwa den eindringlichen „Epilog: Erinnerungen aus dem Totenhaus“ von Tony Judt, Geschichte Europas von 1945 bis zur Gegenwart, München 2006, S. 933-966, bes. S. 939953. 21 Robert Cecil, Mr. T. Gladstone on Kansas, Saturday Review III, Nr. 78 (25. April 1857), S. 384. 22 Vgl. Hans Joas, Die Entstehung der Werte (wie Anm. 11), v.a. S. 252-293; vgl. auch Hans Joas, Kriege und Werte. Studien zur Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts, Weilerswist 2000. 23 Helmut Klages, Werte und Wertwandel, in: Bernhard Schäfers/ Wolfgang Zapf (Hrsg.), Handwörterbuch zur Gesellschaft Deutschlands. 2. Aufl. Bonn 2001, S. 726-738, hier S. 730f. 24 Trutz von Trotha, Zum Wandel der Familie, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 42 (1990), S. 452-473, hier S. 459. 25 Vgl. Lothar Gall, Vom Stand zur Klasse? Zu Entstehung und Struktur der modernen Gesellschaft, in: HZ 261 (1995), S. 1-21, bes. S. 6-11. 26 Rainer Geißler, Die Sozialstruktur Deutschlands. Zur gesellschaftlichen Entwicklung mit einer Zwischenbilanz zur Vereinigung. 2. Aufl. Opladen 1996, S. 234. 27 Vgl. Horst Nowak/ Ulrich Becker, Es kommt der „neue“ Konsument, in: Form. Zeitschrift für Gestaltung 111 (1985), S. 14 (Lebensweltforschung des Heidelberger Sinus-Instituts). 28 Vgl. Carsten Wippermann, Zusammenfassung und zentrale Tendenzen [zu: Lebensstile und religiöse Orientierung. Milieu Welten. Ergebnisse einer aktuellen Studie], zur debatte 4/2006, S. 29f. 1 2 21 Vgl. Renate Köcher, Religiös in einer säkularisierten Welt, in: Elisabeth Noelle-Neumann/ Renate Köcher, Die verletzte Nation. Über den Versuch der Deutschen, ihren Charakter zu ändern, Stuttgart 1987, S. 164-281 und 298f., bes. S. 187. 30 Vgl. Helmut Klages, Wertorientierungen im Wandel. Rückblick, Gegenwartsanalyse, Prognosen. Frankfurt a.M. 1984; Ders., Traditionsbruch als Herausforderung. Perspektiven der Wertewandelsgesellschaft. Frankfurt a.M. 1993, S. 9f., 15, 23 und 26. 31 Vgl. Andreas Schulz, Lebenswelt und Kultur des Bürgertums im 19. und 20. Jahrhundert. (= Enzyklopädie deutscher Geschichte. Bd. 75), München 2005, S. 3, 8-9, 19-22; vgl. auch die Aufschlüsselung von Pflicht- und Akzeptanz- sowie von Freiheits- und Selbstentfaltungswerten bei Helmut Klages, Wertorientierungen im Wandel. Rückblick, Gegenwartsanalyse, Prognosen, Frankfurt a. M./New York 1984, S. 17f. 32 Helmut Klages, Werte und Wertwandel, in: Bernhard Schäfers/ Wolfgang Zapf (Hrsg.), Handwörterbuch zur Gesellschaft Deutschlands. 2. Aufl. Bonn 2001, S. 726-738, hier S. 730. 33 Bernhard Bueb, Lob der Disziplin. Eine Streitschrift, Berlin 2006, S. 11. 34 Stefan Hradil, Vom Wandel des Wertewandels – Die Individualisierung und eine ihrer Gegenbewegungen. in: Wolfgang Glatzer/ Roland Habich/ Karl Ulrich Mayer (Hg.), Sozialer Wandel und gesellschaftliche Dauerbeobachtung. Opladen 2002, S. 31-47. 35 Vgl. Anm. 28. 36 Vgl. Thomas Gensicke, Sozialer Wandel durch Modernisierung, Individualisierung und Wertewandel, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 42/1996, S. 3-17, hier S. 5. und schon den Klassiker der Wertewandelsforschung: Ronald Inglehart, The Silent Revolution. Changing Values and Political Styles Among Western Publics, Princeton: Princeton University Press 1977; vgl. dazu Andreas Rödder, Vom Materialismus zum Postmaterialismus? Ronald Ingleharts Diagnosen des Wertewandels, ihre Grenzen und ihre Perspektiven, in: Zeithistorische Forschungen 2006 (im Druck). Skeptisch gegenüber dem linearen Verlauf von Wertewandelsprozessen auch Hradil, Wandel des Wertewandels (wie Anm. 32), S. 42f. und 45. 37 Die eben zitierte Interpretation des Wertewandels als Schlußstein der Modernisierung steht dazu insofern nicht im Widerspruch, als es sich dabei um eine recht pauschale, aber nicht historisch-empirisch fundierte Aussage handelt. 38 Jürg Berthold, Wertewandel; Werteforschung, in: Joachim Ritter/Karlfried Gründer/Gottfried Gabriel (Hrsg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 12, Basel 2004, S. 609-611, hier S. 611. 29