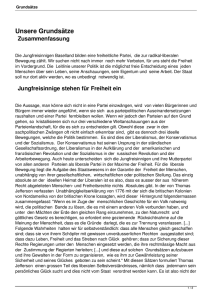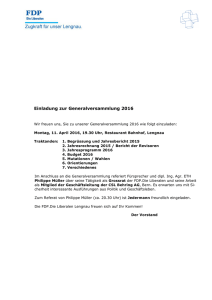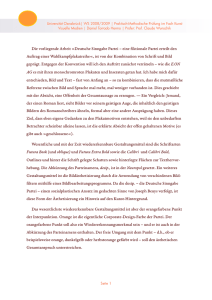1. Einleitung - Universität Potsdam
Werbung

Universität Potsdam Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät Die Bedeutung des Liberalismus bei der Wiederbegründung des deutschen Parteiensystems von 1945 - 1953 (Bundesrepublik Deutschland und Deutsche Demokratische Republik) Diplomarbeit im Studiengang Politikwissenschaften Eingereicht am Lehrstuhl „Politisches System der Bundesrepublik Deutschland“ Erstgutachter: Prof. Dr. Jürgen Dittberner Zweitgutachter: Dr. Jochen Franzke Wintersemester 2006/07 Abgabedatum: 08.01.2007 Verfasser: Marco Kirchhof Park Babelsberg 14, 14482 Potsdam Tel.: 0176/21144988 E-Mail: [email protected] Matrikelnummer 71 85 14 2 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung __________________________________________________________________ 4 2. Die Entwicklung der Liberalen bis 1933 _________________________________________ 6 3. Der Neuaufbau ab 1945 _____________________________________________________ 15 3.1. Der Berliner Gründerkreis ______________________________________________ 17 3.2 Der Stuttgarter Kreis ___________________________________________________ 19 4. Die Situationen in den einzelnen Besatzungszonen _______________________________ 21 4.1 Die sowjetische Zone __________________________________________________ 21 4.2 Die amerikanische Zone ________________________________________________ 23 4.3 Die britische Zone ____________________________________________________ 25 4.4 Die französische Zone _________________________________________________ 26 5. Die theoretischen Ansätze und Konzepte nach 1945 ______________________________ 30 5.1 Die liberale Volkspartei ________________________________________________ 30 5.2 Die Rechtspartei ______________________________________________________ 32 5.3 Die Partei der breiten bürgerlichen Mitte ___________________________________ 33 6. Die wichtigsten Vertreter der drei Modelle und die Umsetzungen der Konzepte in die Praxis ______________________________________________________________________ 34 6.1. Die LDP(D) unter Wilhelm Külz ________________________________________ 35 6.2. Die hessische LDP unter August Martin Euler ______________________________ 38 6.3. Die DVP unter Ernst Mayer ____________________________________________ 46 7. Stuttgart oder Berlin? _______________________________________________________ 52 8. Die gesamtdeutsche liberale Partei DPD________________________________________ 64 9. Die Entwicklung der LDP(D) bis 1953 _________________________________________ 67 9.1 Das Umbruchjahr 1948_________________________________________________ 67 9.2. Die Jahre der Gleichschaltung 1949-1953 _________________________________ 69 10. Die Entwicklung der Liberalen in der Westzone ________________________________ 71 10.1 Von der DPD zur FDP ________________________________________________ 72 10.2 Die Gründung der FDP ________________________________________________ 75 10.3 Bürgerliche Milieupartei oder rechte Sammlungsbewegung? __________________ 79 11. Die Entwicklung der FDP bis 1953 ___________________________________________ 80 11.1 Die Südweststaat-Krise________________________________________________ 82 11.2 Eine Partei – zwei Programme __________________________________________ 88 11.3 Die Naumann-Affäre _________________________________________________ 93 3 11.4 Die FDP nach der Bundestagswahl 1953 __________________________________ 98 12. Fazit ___________________________________________________________________ 101 13. Literatur- und Quellenverzeichnis __________________________________________ 108 15. Ehrenwörtliche Erklärung _________________________________________________ 116 16. Danksagung _____________________________________________________________ 117 4 1. Einleitung Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Konzeptionsansätzen, mit welchen die Liberalen innerhalb des Betrachtungszeitraumes versuchten, eine starke sowie stabile liberale Partei zu konstituieren und so erfolgreich liberale Politik betreiben zu können. Eine für die Herausbildung des deutschen Parteieinsystems wichtige Frage ist, inwieweit die Liberalen hierbei agierten oder lediglich reagierten. Entstand das System einzig und allein aus dem Willen der Siegermächte heraus, also ohne jegliche Einflussmöglichkeit für die deutsche Politiker? Für die Liberalen soll nachgewiesen werden, dass für die Parteienentstehung eine Vielzahl verschiedener Einflüsse, Bedingungen, regionaler Traditionen und die Aktivitäten unterschiedlichster Persönlichkeiten die entscheidenden Faktoren waren. Auf eine umfassende Definition des Begriffs Liberalismus soll verzichtet und dieser nur zur Unterscheidung zu anderen politischen Richtungen als gegeben angenommen werden. Allerdings wird die Bezeichnung „liberal“ nur genutzt wenn die Verwirklichung folgender Ziele angestrebt wurde: Parlamentarismus und Demokratie, rechtsstaatliche Ordnung und Schutz des Individuums, Freiheits- und Bürgerrechten, Privateigentum und Marktwirtschaft, Trennung von Kirche und Staat, sowie, innerhalb des Betrachtungszeitraumes, die deutsche Einheit. Diese Ziele waren und sind unter den Anhängern des Liberalismus allgemeingültig anerkannt, auch wenn es hierbei unterschiedliche Gewichtungen gab und gibt, und bilden die Grundlage aller liberalen Gesellschaftspolitik. Als innerparteiliches Hauptanliegen wird die Überwindung der Spaltung Deutschlands, die Durchsetzung der o.g. Ziele und die Gewinnung sowie der Erhalt der Einheit der liberalen Bewegung angenommen. Weitere Grenzen waren dieser Arbeit aufgrund der Materiallage gesetzt. Die Frage nach den liberalen Parteikonzeptionen wurde bisher kaum erörtert. Zwar ist Literatur über die Gründerjahre der Parteien und der beiden deutschen Staaten zahlreich vorhanden, jedoch beschäftigt sich erstere zumeist nur mit Landesverbänden, lokalen Vereinigungen und Einzelpersönlichkeiten oder setzt wie die zweitere erst ab 1949 ein. Werke über die LDP(D)1 beschäftigen sich meistens lediglich mit den Bedingungen und Entwicklungen innerhalb der SBZ bzw. dem Verhältnis der LDP(D) zur SED, während Publikationen die die FDP zu Thema haben sich, wenn überhaupt, nur am Rande mit den Ost-Liberalen beschäftigen. Die Publikationen die sich mit den Richtungskämpfen innerhalb der FDP beschäftigen, 1 Zur besseren Unterscheidung zwischen der Liberal-Demokratischen Partei (LDP) Hessens und der LDP der SBZ (Liberal-Demokratische Partei Deutschlands) wird letztere im Folgendem stets als LDP(D) bezeichnet. Diese Bezeichnung ist auch dahin gehend die exaktere, da die Liberal-Demokraten der SBZ stets einen gesamtdeutschen Anspruch vertraten und die Abkürzung LDPD ab 1951 offiziell eingeführt wurde. 5 vernachlässigen zumeist in ihren Darstellungen die Auseinandersetzungen zwischen den Liberalen in Ost und West vor Heppenheim. Den Veröffentlichungen zur Geschichte der einzelnen Landesverbände fehlt wiederum die gesamtdeutsche Perspektive, auch lässt sich bei einigen dieser Bücher ein gewisses Bestreben erkennen die jeweilige Partei in gutem Licht darzustellen, also eventuelle Schattenseiten zu vernachlässigen. Eventuell vorhandene Lücken durch Interviews mit maßgeblichen Funktionsträgern aus dieser Frühphase der Parteienbildung zu schließen war nicht möglich, da die meisten Persönlichkeiten der Gründerphase entweder bereits verstorben bzw. Befragungen aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich waren. Aus diesen Gründen bilden „Der deutsche Liberalismus 1945 bis 1955: Deutschland- und Gesellschaftspolitik der ost- und westdeutschen Liberalen in der Entstehungsphase der beiden deutschen Staaten“ von Theo Rütten und „Zwischen liberaler Milieupartei und nationaler Sammlungsbewegung. Gründung, Entwicklung und Struktur der Freien Demokratischen Partei 1945-1949“ von Dieter Hein, die Basisgrundlage für die vorliegende Arbeit. Als Erweiterung dieser Basis konnten mehrere Aufsätze diverser Autoren, sowie, „Die Bundestagswahlkämpfe der FDP 1949-2002“ von Marco Michel, Jörg Michael Gutschers „Die Entwicklung der FDP von ihren Anfängen bis 1961“ und Publikationen Erich Mendes genutzt werden. Hieraus ergab sich die, nach drei Konzepten unterscheidende, vorliegende Gliederung, der Arbeit. Diese Konzepte wurden jeweils an einem Beispiel, an zwei Landesparteien bzw. an der LDP(D) als Zonenpartei, verdeutlicht. Hierbei konnte auf die Publikationen über die Landesparteien bzw. über die LDP(D) zurückgegriffen werden, wodurch das Manko des begrenzten Materials in gewisser Weise ausgeglichen werden konnte. Der Hauptaspekt der Arbeit soll auf der Betrachtung der inneren Entwicklung der liberalen Parteien liegen, so dass bedeutende Ereignisse in dieser Zeit nur Erwähnung finden, wenn sie sich direkt auf die liberalen Parteien ausgewirkt haben. Im Interesse der Überschaubarkeit der Arbeit wird auch auf eine Betrachtung der Finanzierungssysteme der liberalen Parteien verzichtete. Ebenso wird auf die Untersuchung der Gründe für Teilnahme bzw. Nichtteilnahme an bestimmten wichtigen politischen Prozessen innerhalb des Betrachtungsraumes, wie z.B. dem „Volkskongress“ abgesehen. Genauso muss auf eine Schilderung, Analyse und Bewertung von Ereignissen, wie der Berlinblockade, der Münchner Ministerpräsidentenkonferenz oder des Volksaufstandes 1953 in der DDR verzichtet werden. Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, welche verschiedenen Konzepte bestanden, um eine starke liberale Partei im neuentstehenden Parteiensystem zu verankern, diese Vorstellungen zu benennen und herauszuarbeiten. 6 Im Folgenden wird daher an Hand einiger Beispiele gezeigt, welche unterschiedlichen Ansätze und Konzepte für die Liberalen von 1945-53 eine Rolle spielten, welche innerparteilichen Auseinandersetzungen stattfanden und wie versucht wurde, Abspaltungen zu vermeiden. Das Jahr 1953 wurde als Begrenzung gewählt, da dieses sowohl für Ost2- als auch für West-Liberalen3 einen gewissen Endpunkt für die bisherige Entwicklung darstellt. Weshalb es sinnvoll erscheint, diese Arbeit an diesem Punkt enden zu lassen, um ihren Rahmen nicht zu sprengen. Als Einstieg wurde eine Abriss der Entwicklung von der Paulskirche bis zum Ende der Weimarer Republik gewählte, da so die Handlungsmotive vieler liberaler Politiker besser verständlich werden. 2. Die Entwicklung der Liberalen bis 1933 Seit dem Beginn der liberalen Bewegung zeichneten sich deren Anhänger durch einen außerordentlichen Hang zur Zersplitterung aus. Die Lehre der Individualität schien Unorganisiertheit, Eigensinn und Egoismus geradezu in sich zu bündeln. Immer wieder zerfielen Gruppen, Fraktionen und Parteien der Liberalen in Grüppchen. Die häufigsten Gründe für Abspaltungen waren meist eher persönlicher denn programmatischer Natur. Dennoch kann auch hier eine gewisse Bruchlinie innerhalb der Liberalen ermittelt werden. Von Anfang an existierte eine Strömung, deren Hauptziel die Umgestaltung der Gesellschaft war, und eine andere, deren Streben auf die Einheit der Nation gerichtet war. Für die einen war die innere Struktur das Maß aller Dinge, für die anderen galt die Vertretung des Reichs nach außen als das Nonplusultra. Diese Spaltung bildete über fast ein Jahrhundert hinweg das Axiom des deutschen Liberalismus. Das Schisma zwischen Sozial-Liberalen (auch als Linksliberale bzw. Demokraten bezeichnet) und NationalLiberalen (auch Rechte, Wirtschaftsliberale oder schlicht Liberale genannt) schien unauflöslich und von Dauer zu sein. Bereits 1848 deutete sich die später stärker um sich greifende Zersplitterung des deutschen Liberalismus an, als in der Frankfurter Paulskirche 1848/1849 die bürgerlich-liberalen Fraktionen Casino und Württemberger Hof für konstitutionelle Monarchie, Volkssouveränität und parlamentarische Rechte eintraten, die Minderheit der Radikaldemokraten jedoch eine deutsche Republik und die Beseitigung monarchistischer Strukturen forderte. Aus dieser Zeit 2 Der Sturz Hamanns und der Aufstieg Hans Lochs zum alleinigen LDP(D)-Vorsitzenden sowie die sich nach dem 17.06.1953 konsolidierende Herrschaft der SED bedeuteten das Ende jeglicher liberaler Selbständigkeit. 3 Die Stimmenverluste zur zweiten Bundestagswahl und die anschließende Wahl Dehlers zum Fraktions- später auch Parteivorsitzenden der FDP kündigten leiteten eine Wandlung der Partei ein. 7 stammte auch die jahrzehntelang gültige Unterscheidung zwischen Liberalen, die als die Rechten galten, und Demokraten, die den linken Teil des bürgerlichen Spektrums bildeten. Dennoch gelang es, die bürgerlichen Gruppen in einer gemeinsamen Partei zusammenzufassen. Die Deutsche Fortschrittspartei, die am 6. Juni 1861 im preußischen Abgeordnetenhaus von liberalen Abgeordneten gründete wurde, war – mit in einem Parteiprogramm formulierten politischen Zielen nach heutigem Verständnis – die erste programmpolitische Partei Deutschlands. Die Mitglieder entstammten dem 1859 gegründeten Deutschen Nationalverein, in dem beide Richtungen des Liberalismus vertreten waren. Das Programm der Partei orientierte sich am traditionellen Liberalismus. So wurde vor allem die Einheit Deutschlands, die Volksvertretung, das Prinzip des Rechtsstaates sowie eine Selbstverantwortung der Kommunen gefordert. Seit 1861 war die Fortschrittspartei Mehrheitsfraktion im preußischen Abgeordnetenhaus und konnte bis 1866 diesen Status behaupten. Nach dem preußischen Verfassungskonflikt in den 1860er-Jahren kam es zwischen 1866 und 1868 zu starken Spannungen und heftigen Flügelkämpfen innerhalb der Partei, besonders in der Frage der Indemnitätsvorlage4. Diese Auseinandersetzungen führten zur Spaltung des parteipolitisch organisierten deutschen Liberalismus und sollten Auswirkungen bis in die Gegenwart haben. Als Folge der Billigung der Indemnitätsvorlage von 1866/67 brach die Fortschrittspartei auseinander. Die großbürgerlichen und national orientierten Kräfte gründeten 1867 die Nationalliberale Partei (NLP), die demokratisch-republikanischen geprägten Mitglieder bildeten 1868 die Deutsche Volkspartei (DtVP) des Kaiserreichs. Der „Rest“ der Fortschrittspartei bestand bis 1884 fort und ging danach in einer Fusion mit der Liberalen Vereinigung auf. Gemeinsam firmierte man von da an bis 1910 als Deutsche Freisinnige Partei. Die Nationalliberale Partei unterstützte die Politik Bismarcks und favorisierte im Prozess der Reichseinigung die Kleindeutsche Lösung, die Österreich vom Deutschen Reich ausschloss. Der Einheit und Freiheit der Nation wurde der Vorrang vor demokratischen Freiheitsrechten 4 Da das Parlament, das das Budgetrecht inne hatte, der Heeresreform von 1863 die Zusage verweigerte, für die Rüstung jedoch Geld benötigt wurde, nutzte Bismarck eine Lücke in der Verfassung, um die Heeresreform ohne Einwilligung des Parlaments, sondern lediglich mit der des Königs durchzuführen. Die Proteste des Abgeordnetenhauses gegen Bismarcks Vorgehen blieben vergebens. Nach dem Sieg Preußens im Deutschen Krieg wollte Bismarck im Nachhinein für sein Vorgehen eine Amnestie erwirken. Mit der Indemnitätsvorlage im September 1866 erkannte er das Budgetbewilligungsrecht des Parlaments endgültig an. Er gestand ein, die Verfassung einseitig ausgelegt zu haben. Im Gegenzug wurde ihm bescheinigt, dass er in dieser Ausnahmesituation nicht anders hätte handeln können. Dies war der Versuch Bismarcks, eine Aussöhnung mit den Liberalen zu erzielen. 8 eingeräumt, denn die Nationalliberalen gingen von der These aus, dass die Einigung Deutschlands sowie die sich anschließende Schaffung eines gesamtdeutschen Nationalstaates eine Parlamentarisierung des öffentlichen Lebens und eine Mehrung der bürgerlichen Freiheitsrechte geradezu zwingend nach sich ziehen würden. Diese wurden aber zunehmend in den Hintergrund gedrängt. So gab es ob der Zustimmung sowohl zum „Kulturkampf“ als auch zum „Sozialistengesetz“, die beide liberalen Grundsätzen zuwiderliefen, starke innerparteiliche Differenzen. Dessen ungeachtet kam es nur ein einziges Mal zu einer Parteiabspaltung. Nach einem heftigen Streit über die Wiedereinführung von Schutzzöllen verließen 28 führende Parteimitglieder5 die Reichstagsfraktion, da sie die von ihnen als reaktionär empfundene Politik nicht weiter unterstützen wollten. Diese Sezessionisten bildeten später die Liberale Vereinigung. Dennoch blieb die NLP die stärkste und stabilste der liberalen Parteien des Kaiserreichs, auch wenn ihre Bindungskraft allmählich nachließ6. Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, unterhielt man ab 1890 enge Beziehungen zum Alldeutschen Verband, dem Deutschen Flottenverein und zur Großindustrie. Erst unter Stresemanns Regie wurde ab 1900 mit dem verstärkten Aufbau eines Vereinsnetzes und einer allmählichen Annäherung an die Linksliberalen begonnen. Nach dem Ersten Weltkrieg zerfiel die Nationalliberale Partei. Ihr größter Teil ging in der Deutschen Volkspartei (DVP) der Weimarer Republik auf. Die DtVP ging aus dem linken Flügel der Fortschrittspartei und der 1863 gegründeten südwestdeutschen Demokratischen Volkspartei hervor. Ihre Hochburgen hatte die Partei in Süddeutschland. Aus diesem Grund forderte sie bis 1870 die Großdeutsche Lösung. Da diese Variante mit Österreich de facto einen Vielvölkerstaat bedeutet hätte, forderte man, um für das künftige Reich den Zusammenhalt zu gewährleisten, starke föderalistische Strukturen, mehr demokratische Rechte für den Reichstag sowie soziale Reformen für die ärmeren Schichten der Bevölkerung. Im Gegensatz zu den Nationalliberalen behielt die Forderung nach demokratischen Freiheitsrechten bei der DtVP Priorität vor der nationalen Einigung. Die Reichseinheit von 1871 führte zu einer Sinnkrise der DtVP, da nun die erhoffte Großdeutsche Lösung gegenstandslos geworden war. Daraufhin musste die Parteiprogrammatik überarbeitet werden. Man hielt weiterhin an demokratisch-föderalistischen Grundsätzen7 fest und bezog 5 U. a. Theodor Mommsen, Eduart Lasker, Georg von Siemens, Ludwig Bamberger und Franz August Freiherr Schenk von Stauffenberg. 6 Hatten die Wahlergebnisse 1871 noch bei 30 % gelegen, erreichte die NLP 1912 nur noch 14 %. 7 Die DtVP forderte u. a. allgemeines, gleiches Wahlrecht, die Stärkung des Parlaments gegenüber Reichsregierung und Kaiser, die strenge Trennung von Kirche und Staat sowie Plebiszite über alle wichtigen Gesetze. 9 letztlich eine Position der Grundsatzopposition gegen die Politik Bismarcks 8, ebenso wie später gegen die wilhelminische Politik9. Gelegentlich arbeitete die DtVP mit der Sozialdemokratischen Partei (SPD) auf dem Gebiet der Sozialpolitik zusammen. Ab 1900 kam es vermehrt zu Absprachen und zur Zusammenarbeit mit anderen linksliberalen Parteien. Die Höhepunkte dieses Zusammenwirkens waren das gemeinsame „Frankfurter Minimalprogramm“ und der gemeinsam geführte Wahlkampf von 1907, der seinen Abschluss in einer Fraktionsgemeinschaft von DtVP, Freisinniger Vereinigung und Freisinniger Volkspartei fand. 1910 fusionierten diese Parteien mit anderen linksliberalen Gruppen zur Fortschrittlichen Volkspartei. Aus dieser wiederum ging 1918 die Deutsche Demokratische Partei (DDP) hervor. Die fatale Neigung zur Zersplitterung zeigt sich am weiteren Werdegang der Fortschrittspartei. Nach der o. e. Fusion mit der Liberalen Vereinigung erfolgten keine gemeinsame Programmatik oder einheitliche Parteiarbeit. In den neun Jahren ihres Bestehens veranstaltete die Deutsch-Freisinnige Partei keinen einzigen Parteitag. Die bereits vor der Fusion bestehenden Gegensätze wurden nie ausgeräumt, sodass es immer wieder zu Spannungen kam, insbesondere wegen der Kolonialpolitik und des Militäretats. Diese führten am 06.05.1893 zum Eklat. Bei der Abstimmung im Reichstag über die Heeresvorlage stimmte eine Gruppe von sechs Abgeordneten, unter der Führung von Georg von Siemens, dieser im Gegensatz zur übrigen Fraktion zu. Eugen Richter, Parteichef der Deutsch-Freisinnigen, forderte daraufhin den Ausschluss der Abweichler, wofür er auch eine knappe Mehrheit erhielt. Überraschenderweise erklärten sich die in der Abstimmung Unterlegenen mit den Ausgeschlossenen solidarisch, verließen ebenfalls die Fraktion und bildeten fortan die Freisinnige Vereinigung. Diese kann als Musterbeispiel einer Honoratiorenpartei angesehen werden. Sie verfügte weder über strenge Organisationsstrukturen noch über einen festen Mitgliederstamm, auch wollte sie nicht als Partei gelten10. Eugen Richter hingegen gründet aus den „Überresten“ der DeutschFreisinnigen die Freisinnige Volkspartei. Geradezu dogmatisch lehnte Parteichef Richter künftig jegliche Form von Mitregierung sowie jede erneute Parteienfusion ab. Die Freisinnige Volkspartei entwickelte sich zu einer Fundamentalopposition und verweigerte jedwede Form von Wahlabsprachen oder Listenverbindungen mit anderen Parteien. Erst nach dem Tod So wurden sowohl Kulturkampf als auch das „Sozialistengesetz“ abgelehnt, lediglich die Sozialgesetze von 1880 fanden die Zustimmung der DtVP. 9 Alle Eckpunkte der kaiserlichen Politik, wie Flotten-, Kolonial-, Außenpolitik und Aufrüstungsprogramm, erfuhren die Ablehnung der DtVP. 10 Laut ihrem Fraktionsvorsitzenden Paul Schrader bevorzugte man die Bezeichnung „Wahlverein der Liberalen“. 8 10 Richters lockerte sich dessen Dogma und die Partei begann, sich wieder zu öffnen. 1910 ging sie schließlich in der neuen Fortschrittlichen Volkspartei auf. Mit dem Aufkommen der Sozialdemokratie mussten die Liberalen nach und nach ihren Einfluss als prägende politische Kraft mit den Sozialisten teilen und – bezogen auf das Wählerpotenzial – bis Anfang des 20. Jahrhunderts an sie abgeben. Erst in der Weimarer Republik spielten die Liberalen neben SPD und Zentrum wieder eine sehr wichtige Rolle innerhalb des parlamentarischen Parteienspektrums. Nach dem Ersten Weltkrieg gingen die bestehenden liberalen Parteien in zwei neu gegründeten Parteien auf: der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) und der Deutschen Volkspartei (DVP). Die DDP war die direkte Nachfolgerin der FVP, ihr Gründungsaufruf, den Theodor Wolff am 16.11.1918 im Berliner Tageblatt veröffentlichte, war von vielen namhaften Persönlichkeiten, wie Albert Einstein, Max Weber, Hjalmar Schacht und Hellmut von Gerlach, unterzeichnet. Die DDP stand in der Tradition ihrer zahlreichen Vorgängerinnen, d. h., sie war linksliberal orientiert, bekannte sich zum Privateigentum, lehnte Sozialisierungen entschieden ab, befürwortete aber die Zerschlagung von Monopolen und Kartellen sowie die Ausweitung der Arbeitnehmerrechte und trat zudem für die Trennung von Kirche und Staat ein. Als liberaler Partner der SPD war die DDP von Beginn an eine der wichtigsten Stützen der Weimarer Republik, in deren Verfassung die Handschrift der Deutsch-Demokraten leicht erkennbar war. So war die DDP bis 1932 auch an fast allen (17 von 20) Kabinetten Weimars beteiligt. Mit Friedrich Naumann, Walther Rathenau, Theodor Heuss, Reinhold Maier und Hugo Preuß waren einige der bedeutendsten Politiker Weimars und der frühen Bundesrepublik Mitglieder der DDP gewesen. Die großen Anfangserfolge, fast 19 % bei den Reichtagswahlen 1919, und der frühe Tod des Parteivorsitzenden Naumann verhinderten jedoch den Auf- bzw. Ausbau der Organisationsstruktur, sodass dem ab 1922 einsetzenden, sich allmählich verstärkenden Abwärtstrend nicht wirksam begegnet werden konnte. Die Partei war nicht allein aus den verschiedenen linksliberalen Gruppen des Kaiserreichs entstanden, sondern es schlossen sich ihr auch ehemalige Nationalliberale wie Wilhelm Külz an. Jedoch gelang es der DDP nicht, ihre historische Chance zu nutzen und die liberalen Strömungen endlich in einer Partei zu vereinigen. Als man Gustav Stresemann, dem vom linken Flügel her tiefste Ablehnung entgegenschlug, und einigen seiner Anhänger die 11 Parteimitgliedschaft verweigerte, entschloss sich dieser zur Gründung einer weiteren liberalen Partei, der DVP, die das Erbe der NLP antreten sollte. Die DDP vereinigte sich 1930 nach heftigen innerparteilichen Auseinandersetzungen mit der aus der bündischen Tradition kommenden Volksnationalen Reichsvereinigung, bekannter unter dem Namen „Jungdeutscher Orden“, und benannte sich in Deutsche Staatspartei (DStP) um. Damit folgte sie dem nationalistischen Trend am Ende der zunehmend krisengeschüttelten Weimarer Republik, die zu dieser Zeit im Grunde schon faktisch gescheitert war. Bedingt durch diese Entwicklung trat fast der gesamte linke Flügel aus der Partei aus, darunter auch der Pazifist und Friedensnobelpreisträger von 1927 Ludwig Quidde. Dieser linke Flügel der vormaligen DDP gründete die kurzlebige Radikaldemokratische Partei, die aber in den letzten Jahren der Republik politisch erfolglos blieb. Während die DDP eine eher sozialliberale Politik vertrat und die Republik von Anbeginn an mittrug, ist für die DVP festzustellen, dass bedingt durch ihre Entstehung aus der Nationalliberalen Partei, die das Kaisertum gestützt hatte, eine starke Gruppe von republikfeindlichen Monarchisten fortbestand. Erschwerend kam hinzu, dass sich die Nationalliberalen sehr schnell erneut aufspalteten. Die Partei verlor ihre Flügel und die Zersplitterung des liberalen Lagers schritt weiter fort. Die der kleineren Gruppe des linken Flügels der NLP Angehörenden wechselten entweder bereits 1918 in die DDP oder vollzogen diesen Schritt innerhalb der nächsten 18 Monate. Der rechte national-völkisch orientierte Flügel begründete die Deutschnationale Volkspartei (DNVP). Dennoch blieb die DVP eine wichtige und einflussreiche Partei. Sie stellte nach 1920 mit Gustav Stresemann über mehrere Jahre hinweg den Außenminister der Weimarer Republik und 1923 für wenige Monate in einer Mehrparteienkoalition kurzzeitig sogar den Reichskanzler. Stresemann versöhnte die Partei mit der demokratischen Staatsform. Nach seinem Tod (1929) orientierte sich die DVP immer stärker nach rechts – bis hin zur Duldung und schließlich Unterstützung der rechtsdiktatorischen Inhalte der völkischen Parteien DNVP und NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Die aus Teilen des rechten Flügels der NLP, mehreren Rechts- und Konservativparteien entstandene DNVP verdeutlicht, wie bedenklich es war, den Liberalismus lediglich auf Privatwirtschaft, Individualismus und Meinungsfreiheit zu reduzieren, denn auch die DNVP empfand sich als Trägerin des Rechtsliberalismus, mehr jedoch noch als Erbin der „Deutschnationalen Bewegung“. So überwogen nationale, monarchistische und antisemitische Überzeugungen in der Partei deutlich die liberalen Tendenzen. Diese waren fast gänzlich auf 12 den Wirtschaftsliberalismus reduziert. Die DNVP stand der Republik feindlich gegenüber und forderte eine Renaissance des Kaisertums. Sie wirkte maßgeblich an der Entstehung der Dolchstoßlegende mit. Dazu beteiligte sie sich an Rufmordkampagnen gegen die „Verräter des Novembers 1918“. Dennoch schien sich allmählich doch das liberale Erbe der Partei durchzusetzen. So distanzierte man sich ab 1922 vorsichtig vom Antisemitismus, was zu massiven Austritten und der Gründung der Deutschvölkischen Partei führte. Ab Mitte der 20er-Jahre gab man die Forderung zur Wiederherstellung der Monarchie auf, forderte nunmehr lediglich einen starken Reichspräsidenten, quasi als „Ersatzkaiser“, und beteiligte sich an Koalitionen in Reichs- und Länderregierungen. Die DNVP schien auf dem Weg zu einer (sehr) rechtsliberalen Partei zu sein. Jedoch reagierte die Partei auf das enttäuschende Wahlergebnis von 1928 mit einem sehr deutlichen Rechtsruck. Dieser wurde durch die Wahl Hugenbergs an die Parteispitze nochmals verstärkt. Mit Hugenberg fuhr die Partei erneut einen radikalen Rechtskurs. Die gemäßigten und liberalen Mitglieder wurden allmählich herausgedrängt11. Ab 1929 kooperierte die DNVP mit der NSDAP, wobei Erstere allerdings relativ schnell ins Hintertreffen geriet, da sie den Nationalsozialisten zwar half, „salonfähig“ zu werden, selbst aber kaum Stimmengewinne aus dem NS-nahen Milieu erzielen konnte. Dessen ungeachtet gründete Hugenberg 1932 gemeinsam mit Hitler die „Harzburger Front“. Gleichwohl verlor die DNVP gegenüber der NSDAP stetig mehr an Bedeutung. Man wurde zwar noch am ersten Kabinett Hitlers beteiligt, was das Ende der Partei, die sich am 27.06.1933 selbst auflöste, dennoch nicht herauszögerte. Die Mehrzahl ihrer Mitglieder und sämtliche ihrer Abgeordneten traten der NSDAP bei. Aus Dissidenten aller drei Parteien wiederum formierte sich die Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (ab 1925 Wirtschaftspartei). Trotz einiger beachtlicher Erfolge zwischen 1924193012 blieb sie die unbedeutendste liberal orientierte Partei der Weimarer Republik und verlor ab 1930 noch stärker als die anderen an Bedeutung. Insgesamt lässt sich die Entwicklung der DDP und auch die der DVP am besten mit den Worten Ernst Mayers beschreiben, der ausführte: „Die [...] Demokratische Partei stand von 1919 bis 1933 fast ununterbrochen in der Verantwortung und war dem Andrängen der Opposition von links und rechts ausgesetzt. Die hinter ihr stehenden Wählerschichten waren im besonderen Maße Leidtragende der wirtschaftlichen Folgen des verlorenen ersten Weltkrieges und des Vertrages von Versailles. Diese Mittelschicht, nicht wie die des Zentrums in einer [...] konfessionellen Bindung verankert und nicht wie die der SPD [und der Aus Protest gegen den Kurs Hugenbergs verließen u. a. Hans Schlange-Schöningen und Gottfried Reinhold Treviranus die DNVP. 12 Bei den Reichstagswahlen 1928 4,5 %; im 1. Kabinett Brüning stellte sie mit Johann Viktor Bredt den Reichsjustizminister. 11 13 KPD] gewerkschaftlich und betrieblich organisiert, war in der Vereinzelung und in ihrer Existenznot auch besonders anfällig für die Heilsbotschaften der Nazis, denen sie von Jahr zu Jahr mehr folgte. So bestand die alte Demokratische Partei, die im Verlaß auf ihre traditionelle Bindung auch nur sehr mangelhaft organisiert war, 1933 nur noch aus einer treu zur demokratischen Sache stehenden Führerschaft und einer geringen Zahl Getreuer im Lande.“13 Selbiges gilt natürlich auch für die DVP der Weimarer Republik. Dem Ermächtigungsgesetz von 1933 stimmten die Liberalen im Reichstag zu. Innerhalb der „Staatsparteiler“ kam es hierbei zu sehr starken Auseinandersetzungen in der Fraktion, zu der sowohl Theodor Heuss als auch Reinhold Maier gehörten. Erst als sich drei der fünf Abgeordneten zu einem Plazet entschlossen, entschied man sich für ein einheitlich positives Votum. Diese Entscheidung wurde von vielen Parteifreunden scharf kritisiert, so u. a. vom damaligen Dresdner Oberbürgermeister Wilhelm Külz. Auch nach 1945 sollte diese Zustimmung immer wieder negativ auf die beteiligten Fraktionsmitglieder zurückfallen: „Theodor Heuss und Reinhold Maier brachten nach 1945 ein schweres Erbe“14 in die neue liberale Partei ein. Dem Schisma des Liberalismus gesellte sich auf linksliberaler Seite zudem eine weitreichende Zersplitterung hinzu, die verbunden mit der beängstigenden Kurzlebigkeit sämtlicher Einigungs- und Fusionsversuche zu einem wesentlichen Faktor der politischen Schwäche wurde. Zudem verfestigten sich die jeweiligen Positionen zu Dogmen und „Polarisationen“, die sich als lähmend für die Liberalen insgesamt auswirkten. Zu verhärtet waren die Fronten zwischen „prinzipienloser Bejahung“ und „prinzipienstarrer Negation“. Im November 1918 änderte sich die Ausgangslage: „Die Überzeugung, man könne sich den Luxus zweier liberaler Parteien nicht mehr leisten, fand in den Revolutionstagen immer weitere Verbreitung.“15 Dennoch wurde letztlich keine Einigung, sondern lediglich eine Umgruppierung bzw. Umordnung erreicht, die Spaltung aber blieb bestehen. Selbst 1933 gab es aufgrund des erheblichen Widerstands gegen die Fusionspläne von DVP und DStP16 kein Zusammengehen dieser beiden zu Splittergruppen herabgesunkenen Parteien. 13 Zitiert in: Wieck, Christliche und Freie Demokraten, S. 152. Dittberner, „Die FDP“, S. 13. 15 Hein, Milieupartei, S. 22. 16 U. a. stießen solche Pläne auf den entschiedenen Widerstand von Theodor Heuss. 14 14 „Ein zweites Phänomen, das zugleich in besonderer Weise Ausdruck der Krise des Liberalismus wie auch ein wesentlicher sie begünstigender Faktor gewesen ist, war die organisatorische Rückständigkeit und Schwäche der liberalen Parteien.“17 Trotz oder aber gerade weil der Liberalismus die älteste der modernen Politrichtungen war, zeigte er organisatorische Mängel auf, die sich in der modernen Industrie- und Massengesellschaft nachteilig auswirken mussten. Lange Zeit fußte die liberale Bewegung nur auf loser Gesinnungsgemeinschaft. Eine feste und verbindliche Partei- bzw. Fraktionsmitgliedschaft wurde geradezu als Verletzung des freiheitlichen Prinzips betrachtet und daher scharf abgelehnt. Die Organisationsstruktur beschränkte sich auf lokale Komitees und Vereine, die gleichfalls keine feste Form besaßen und deren Hauptfunktionen die Kandidatenaufstellung, Spendenakquisition sowie die Wahlkampfdurchführung waren. Zwischen den Wahlen ruhten die Aktivitäten zumeist. Nur zögerlich bildeten sich Wahlkampfzentralen heraus, und aus diesen entstand erst allmählich eine frühe Form der Parteiführung. Doch war deren Einfluss auf die Fraktion anfangs sehr gering. Erst ab 1880 setzten sich die Zuordnungen von Partei und Fraktion durch. Nachteilig wirkte sich für die Liberalen auch das von ihnen mehrheitlich geforderte allgemeine Wahlrecht aus. Das neu entstandene Wählerpotenzial kam fast ausschließlich der SPD, dem Zentrum und den Konservativen zugute, da seine Erschließung eine straffere Organisation, stärkere Mitgliedereinbindung und -aktivierung sowie feste Bindungen der Fraktion an Parteivorgaben erforderlich machten. Konnte dies nicht gewährleistet werden, waren zumindest außerparteiliche Organisationen erforderlich, um dieses Defizit auszugleichen. So erfüllten die katholische Kirche und kirchlich geprägte Vereine diese Aufgaben für das Zentrum. Trotz nicht zu verleugnender Bemühungen18 gelang es den Liberalen bis 1919 nur in ungenügendem Maße, sich auf die neuen Anforderungen einzustellen. Dass sich der Anpassungsdruck in der Zeit der Weimarer Republik durch Faktoren wie Verhältniswahl, Frauenwahlrecht usw. immer weiter erhöhte, wurde aufgrund der anfänglichen Erfolge von DDP und DVP lange Zeit ignoriert. Die späteren Reformversuche blieben im Wesentlichen ohne Erfolg. Gründe hierfür waren u. a. die traditionellen individualistischen Überzeugungen, denen sich die meisten Liberalen nach wie vor verpflichtet fühlten, sowie das nur mäßige Interesse der Parteibasis in Fragen von Organisation und Agitation. Den liberalen Parteien bis 1945 ist gemeinsam, dass sie nur über schwache Organisationsstrukturen verfügten, eine schwache Mitgliederbasis besaßen und ihre 17 Hein, Milieupartei, S. 23. U. a. ein verstärkter Ausbau des Vereinswesens, regelmäßiges Abhalten von Parteitagen sowie erste Versuche zum Parteiapparataufbau. 18 15 Programmatik nur gering ausgeprägt war und sie somit dem Typus der Honoratiorenpartei entsprachen. Den durchorganisierten Massenparteien waren sie so in der politischen Auseinandersetzung kaum gewachsen. Zudem war der Liberalismus als solcher in den Augen vieler Deutscher diskreditiert, wurde er doch zum großen Teil für Inflation, Wirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit verantwortlich gemacht. Hauptsächlich wurden mit den Liberalen Zerstrittenheit und Parteiengezänk in Verbindung gebracht, sodass der Freisinn ganz allgemein in Verruf geriet und sich die Meinung bildete, er sei ein für das Allgemeinwohl insgesamt äußerst schädliches, egozentriertes Fehlkonstrukt. In der Zeit des Nationalsozialismus galt der Liberalismus als verfemt und wurde bekämpft. Die entsprechenden Parteien wurden, wenn sie sich nicht selbst auflösten, wie alle anderen demokratischen Parteien auch verboten. Viele, vor allem linke Liberale, wurden politisch verfolgt oder sahen sich zur Emigration gezwungen, wenn sie sich dem System nicht anpassten. Die in Deutschland Verbliebenen verbrachten die folgenden Jahre in der so genannten inneren Emigration, d. h. in weitest gehender politischer Untätigkeit. 3. Der Neuaufbau ab 1945 Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches war der Gedanke der parteiübergreifenden politischen Zusammenarbeit weit verbreitet und stark ausgeprägt. Angesichts der massiven Probleme schienen Auseinandersetzungen zudem einfach nicht angebracht zu sein. Hinzu kam außerdem, dass es an vielen Orten bereits kurz nach der Kapitulation zur Kooperation aller nicht nationalsozialistischen Kräfte gekommen war. Zum Teil hatte diese gemeinschaftliche Arbeit bereits auch schon vorher eingesetzt, wenn es z. B. um die kampflose Übergabe einer Stadt oder um die Aufnahme von Flüchtlingen ging. Außerdem betrafen Lebensmittelknappheit, Flüchtlingsproblematik, Wohnungsmangel und allgemeine Versorgungsnot die Liberalen genau so wie die Konservativen, die Vertreter des politischen Katholizismus, die Sozialdemokraten oder die Kommunisten. Die bereits angesprochenen Schwierigkeiten wurden auch in den späteren Monaten nicht wesentlich entschärft. Unter diesen Umständen war es also kaum verwunderlich, dass die unterschiedlichen politischen Gruppen, selbst wenn sie sich sonst diametral feindlich gegenüberstanden, zur Zusammenarbeit bereit waren. Nur durch gemeinsame Anstrengungen schien es möglich, die massiven Alltagsprobleme zumindest abzumildern. Zudem zeigte sich, dass ein einheitlich geschlossenes Auftreten gegenüber der Besatzungsmacht stets von Vorteil war. Auf diesem Wege konnte Petitionen und Hilfsersuchen mehr Geltung verschafft werden. Auch später 16 waren Allparteienregierungen in Städten und Gemeinden, später auch in den Ländern, eher die Regel als die Ausnahme. Auch der Begriff „Block“ hatte in den ersten Nachkriegsmonaten eine positive Bedeutung. Gab es unter den obwaltenden Umständen überhaupt noch Spielraum für eine liberale Partei, d. h., würde sie überhaupt noch ein ausreichendes Maß an Anhängern und vor allem an Wählern erschließen können? Würde eine solche Partei überhaupt noch eine Existenzberechtigung besitzen? Die Ausgangspositionen waren denkbar ungünstig. Immerhin hatte bisher noch jede liberale Partei mit Zersetzungserscheinungen und schleichendem Bedeutungsverlust zu kämpfen. So ist es kaum verwunderlich, dass das Konzept des „Bürgerblocks“, d. h. einer bürgerlichen Sammlungspartei im Sinne einer Bündelung aller rechts von der SPD stehenden Kräfte, großen Zuspruch erfuhr19. Dessen ungeachtet kam es nur vereinzelt zur Bildung einer solchen Partei20. Immerhin hielt sich die Idee als solche jedoch noch bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten. Wieso kam es dennoch nicht zum Entstehen des Bürgerblocks? Hierfür können drei Hauptgründe bestimmt werden. Zuerst sind die bestehenden Unstimmigkeiten bzw. sogar das Misstrauen zwischen den beteiligten bürgerlichen Gruppen zu nennen. Hier zeigte sich, dass alte Ressentiments noch nicht überwunden waren. Als Beispiel hierfür können die unterschiedlichen Auffassungen zur Trennung von Kirche und Staat21 oder auch hinsichtlich der Fragen der Wirtschaftsordnung22 gelten. Zudem darf nicht vergessen werden, dass sich Liberale und das politische Christentum (besonders der politische Katholizismus) über Jahrzehnte hinweg feindlich gegenübergestanden hatten. Zum Zweiten ist hier der schlichte Unwille der jeweiligen Besatzungsmacht, einer solchen Parteienkonstruktion das Plazet zu erteilen, zu nennen. Zum Dritten wurden die Beteiligten besonders in der Provinz von den Entwicklungen in den Zentren schlicht und ergreifend „überrollt“, sodass die Entwürfe und Konzeptionen der „Großen“ relativ rasch übernommen wurden, weshalb der Gedanke der bürgerlichen Sammlung nicht weiter verfolgt wurde. 19 Zu den Unterstützern dieser Idee zählten u. a. Wilhelm Heile und Theodor Heuss. U. a. der Heilbronner Kreis. 21 Eine der Hauptauseinandersetzungen war das Für (christliche Demokraten) und Wider (liberale Demokraten) der Konfessionsschulen und Reichskonkordatsanerkennung. 22 Die Differenzen ergaben sich aus den sich widersprechenden marktwirtschaftlichen Prinzipien, die die Liberalen vertraten, und den Sozialisierungsvorstellungen, die z. B. im christlichen Sozialismus eine Rolle spielten. 20 17 Aus diesem Grund empfiehlt es sich, einen besonderen Blick auf die Gründungszentren der liberalen Bewegung zu werfen. Im Folgenden werden daher die wichtigsten Zentren genannt und ihre Gründerkreise beschrieben. 3.1. Der Berliner Gründerkreis Bereits am 10.06.1945 erließ die Sowjetische Militäradministration Deutschlands (SMAD) ihren Befehl Nr. 2, der die „Bildung und Tätigkeit aller antifaschistischen Parteien [...], die sich die endgültige Ausrottung der Überreste des Faschismus und die Festigung der Grundlage der Demokratie und der bürgerlichen Freiheiten in Deutschland und die Entwicklung in diese Richtung zum Ziel“23 setzten, sich vom örtlich zuständigen Kommandanten registrieren ließen sowie sich der Kontrolle der SMAD unterwarfen, gestattete. Am 16.06.1945 versammelte sich daher eine sechsköpfige Gruppe Honoratioren und beschloss in klassisch liberaler Manier die Gründung einer neuen Partei. Drei Mitglieder des liberalen Gründerkreises hatten vor 1933 der Weimarer DDP angehört, darunter die beiden ehemaligen Reichsminister Wilhelm Külz und Eugen Schiffer, von dessen Schwiegersohn Waldemar Koch die Initiative für die Bildung des Gründerkreises ausgegangen war. Zum ersten Vorsitzenden wurde, dank der Fürsprache Eugen Schiffers, Waldemar Koch gewählt. Wilhelm Külz amtierte als zweiter Vorsitzender, Artur Lieutenant bekleidete die Funktion des Geschäftsführers. Dass die Wurzeln der neuen Organisation im Weimarer Linksliberalismus lagen, zeigte bereits der gewünschte Name, der „Deutsche Demokratische Partei“ lauten sollte. Man wollte folglich, ohne große Überlegungen über Standortbestimmung und Wahlchancen im eventuell neu entstehenden Parteiensystem anzustellen, an die Traditionslinie der DDP anknüpfen. Diese Konzeption wurde allerdings bereits wenige Tage später wieder verworfen, als Koch und Külz von den Bemühungen ehemaliger Zentrumspolitiker um Andreas Hermes und Jakob Kaiser, eine große überkonfessionelle, bürgerliche Partei, die Christlich-Demokratische Union (CDU), zu gründen, erfuhren. War diese Nachricht als solche noch nicht besonders Besorgnis erregend, da sich das Zentrum bereits nach dem Ersten Weltkrieg kurzfristig in „ChristlichSoziale Volkspartei“ umbenannt hatte, so wirkte doch geradezu alarmierend, dass sich namhafte Liberale, wie Walter Schreiber, Ernst Lemmer und Otto Nuschke, lieber an diesem 23 Zitiert nach: Krippendorff, S. 21. 18 Projekt beteiligten, als an einer DDP-Neugründung mitzuwirken. Nicht nur, dass der KochKülz-Kreis bei vielen dieser Liberalen fest mit deren Beitritt zu ihrer Partei gerechnet hatte, sondern auch deren Begründungen, aus denen ersichtlich wurde, dass sie sich einer liberalen Neugründung völlig bewusst und aus Resignation entzogen, stimmten bedenklich. So erklärte Lemmer beispielsweise sein Fernbleiben damit, dass er „endlich einmal einer wirklich großen Partei angehören“ wolle und die „Chance, eine solche zu werden, habe allein die erstmals beide christlichen Konfessionen vereinigende CDU“24. Am deutlichsten sprach sich wohl Walter Schreiber aus, als er erklärte, „nach den Erfahrungen von Weimar im Liberalismus ‚keine parteibildende Kraft mehr’“25 zu sehen. Derartig brüskiert versuchte nunmehr der Koch-Külz-Kreis seinerseits, seine Grenzen weiter zu fassen. Man sah sich veranlasst, selbst eine Sammlung von bürgerlichen Kräften zu betreiben und nahm mit anderen Gruppen Kontakt auf. Darum formulierte Külz in der ersten Fassung26 des Gründungsaufrufs die Zielsetzung „alle diejenigen Deutschen zusammenschließen [zu wollen], die früher der Deutschen Volkspartei, der Deutschnationalen Partei, der Wirtschaftspartei oder der Demokratischen Partei angehörten“27. So traf sich Koch am 22.07.1945 mit Vertretern der ehemaligen DVP, um die Möglichkeiten für eine gemeinsame Partei zu klären. Zwar konnte man sich schnell grundsätzlich auf diese Option einigen, jedoch lehnten die ehemaligen Volksparteiler den Namen DDP kategorisch ab. Ihrem Namensvorschlag „Liberal-Demokratische Partei“ wollte wiederum Koch nicht zustimmen, da er fürchtete, durch das Attribut „liberal“ allzu viele potenziell interessierte, christlich orientierte Gruppen und Personen unnötig zu verprellen. So blieben diese Gespräche vorerst ohne das gewünschte Ergebnis. Nach diesem letztlich erfolglosen Bemühen traf Koch sich am 29.07.1945 zu Sondierungsgesprächen mit der CDU und ihrem Vertreter Schreiber. Erneut führte hier die Namensfrage zu einer heftigen Kontroverse. Während die Betonung des Christlichen im Parteinamen auf grundsätzliche Ablehnung bei Koch stieß, wollten die Gründer der CDU gerade darauf nicht verzichten, sodass „mit diesem Gespräch [...] die Entscheidung für die Existenz von zwei konkurrierenden bürgerlichen Parteien gefallen“28 war. Der Koch-Külz-Kreis entschloss sich deshalb, seine „Parteikonzeption erneut zu modifizieren und schärfer zu fassen“29. Ganz bewusst wollte man sich künftig von der CDU, in der man allerdings nach wie vor nur ein 24 Ebd., S. 35 Ebd. 26 Diese stieß wegen der Erwähnung von DVP und DNVP bei SMAD, KPD und SPD auf starke Ablehnung, sodass Koch und Külz dem Druck nachgaben und in der zweiten endgültigen Fassung den entsprechenden Passus strichen. 27 Erster Gründungsaufruf der LDP/DDP; abgedruckt in Hein, Milieupartei, S. 29. 28 Ebd. 29 Ebd. 25 19 „getarntes Zentrum mit demokratischem Anhängsel“30 sah, abgrenzen. Deshalb brauchte man sich folglich nicht mehr weiter „um ehemalige Zentrumsanhänger [...] bemühen, sondern [wollte] in klarer Frontstellung gegen Zentrum und CDU die Wähler der beiden [ehemalig] liberalen Parteien und [...] der DNVP möglichst geschlossen [...] sammeln, also das Ausgreifen der CDU in diese Bereiche [...] unterbinden“31. Aus diesem Grund wurden zukünftig auch religiöse Einflüsse generell abgelehnt und sämtliche bisherige Rücksichtnahmen auf religiöse Gefühle obsolet. So erklärte Waldemar Koch ganz offiziell die Ablehnung seiner Partei gegen „die Verquickung von Religion und Politik“32. Außerdem wurde der zuvor abgelehnte Namensvorschlag „Liberal-Demokratische Partei“ nunmehr doch angenommen. Dieser schien die Botschaft der Vereinigung der beiden Strömungen des Freisinns am besten zu transportieren, brachte er doch die alten jeweiligen Bezeichnungen Demokraten (Linke) und Liberale (Rechte) in den Namen der neuen Partei ein. Der liberale Aspekt stand damit weiterhin im Vordergrund. Des Weiteren wollte man sich für dezidiert liberale Forderungen, wie „Freiheit in Wort und Schrift“ sowie die „Erhaltung [...] des Privateigentums und der freien Wirtschaft“, einsetzen. Die Verstaatlichung von Betrieben sollte jedoch gerechtfertigt sein, „wenn ein überwiegendes Interesse des Gesamtwohls dies gebietet.“33 Völlig offen blieb hingegen die Verortung im Parteiensystem, was allerdings eher den speziellen Bedingungen der SBZ zuzurechnen ist. Die von der SMAD erzwungene Mitgliedschaft und Zusammenarbeit in der „antifaschistischdemokratischen Einheitsfront“ boykottierte eine klare Positionierung innerhalb des politischen Spektrums. 3.2 Der Stuttgarter Kreis Die wichtigste Figur für die Entstehung des Stuttgarter Gründungskreises war ohne Zweifel der aus einer liberalen Traditionsfamilie stammende Wolfgang Haußmann34. Er hatte bereits im April 1945 in der Bewegung „Rettet Stuttgart“ mitgewirkt und durch sein couragiertes Engagement – er erlitt dabei eine schwere Beinverletzung – die Zerstörung der Stadt verhindert. Aus den Mitgliedern jener Bewegung setzte sich auch die von der 30 Külz zitiert in Hein, Milieupartei, S. 30. Ebd. 32 Zitiert nach: Frölich, Liberaldemokratische Partei Deutschlands, S. 314. 33 Zitiert nach: Stephan, Parteien und Organisationen der DDR, S. 1140f. 34 Sein Großvater, Onkel und Vater waren bedeutende Politiker der württembergischen Demokratischen Volkspartei, der DtVP, der Fortschrittlichen Volkspartei und, wie er selbst, der DDP gewesen. 31 20 Besatzungsmacht eingesetzte vorläufige obere Verwaltungsebene der Stadt Stuttgart zusammen, an deren Spitze Arnulf Klett als Oberbürgermeister und Haußmann als Stellvertreter35 standen. Mit dem Ziel, diese für den Stuttgarter Kreis zu gewinnen, sammelte Haußmann frühzeitig frühere DDP-Politiker wie Karl Lautenschlager, von 1911-1933 Stuttgarter Oberbürgermeister, sowie einige wenige DVP’ler, wie den ehemaligen Privatsekretär Stresemanns, Henry Bernhard, um sich und nahm frühzeitig Kontakt zu Reinhold Maier und Theodor Heuss, die sich in Gmünd bzw. Heidelberg aufhielten, auf. Sowohl Maier als auch Heuss folgten dem Ruf aus Stuttgart und fungierten neben Haußmann als Schlüsselfiguren. Allerdings war an eine offizielle parteipolitische Arbeit als solche aufgrund von Nachkriegsnot und der generell ablehnenden Haltung der französischen Besatzung gegenüber den Liberalen noch nicht zu denken. Laut der Chronik der Stadt Stuttgart war „die Stimmung der Bevölkerung in den ersten Monaten mit den Worten: Niedergeschlagenheit und Passivität, Gerüchtemacherei, Rachsucht und Denunziation“36 zu beschreiben. Zusätzlich wurde die Situation durch „gekürzte Lebensmittelrationen, die zum Teil unter das Kalorienmaß der Kriegszeit absanken37“, verschärft, sodass sich der Zustand der „allgemeinen Unzufriedenheit“38 verfestigte. Dennoch lehnte die französische Besatzungsmacht weiterhin eigenständiges Handeln der Besetzten ab. „Deutsche Bestrebungen zu irgendeiner Art der Mitarbeit und Mitbestimmung galten, wenn nicht überhaupt anmaßend, so doch verfrüht.“39 Erst nach dem Abzug der Franzosen und der Übernahme Stuttgarts durch die Amerikaner besserten sich die Chancen. Zwar galt noch einige Zeit das Credo: „Auf keinen Fall darf Politik betrieben werden!“ 40, aber der Stuttgarter Kreis sollte schon bald Erfolge vorweisen können. So wurde Reinhold Maier am 07.09.1945, nachdem Kurt Schumacher verzichtet hatte, die Ernennung zum Ministerpräsidenten Württemberg-Badens von der amerikanischen Militäradministration angeboten, die er zum 14.09.1945 annahm. Heuss wurde nach Vorschlag Maiers zum Kultminister [sic!] des Landes ernannt und siedelte folglich dauerhaft nach Stuttgart über. Auch im kommunalen Bereich gab es Erfolge. So zählte der vorläufige Gemeinderat sechs liberale Mitglieder. Zudem erhielten sowohl Bernhard41 als auch Heuss42 jeweils eine der begehrten Presselizenzen, sodass man auf dem Zeitungsmarkt gut vertreten war. 35 Dieses Amt trat er allerdings, bedingt durch seine Verletzung, erst zum 20.08.1945 an. Vietzen, S. 248f. 37 Rothmund, S. 205. 38 Ebd. 39 Ebd. 40 Vietzen, S. 150. 41 Für die Stuttgarter-Zeitung, die fortan als Sprachrohr des Zirkels und später der DVP wirkte. 36 21 Ab August fanden auch vermehrt regelmäßige Treffen in Haußmanns Wohnung statt. Hier wurde „am 18. September 1945 [...] in Stuttgart in der Hohenzollernstraße 18 die ‚Demokratische Volkspartei’ gegründet [...]. Was in keinem anderen der damals erst entstehenden Länder möglich war, geschah hier: Die Gründung einer liberalen Landespartei43 erfolgte vor der Konstituierung der Christlich-Demokratischen Partei“44. Der Name „Demokratischen Volkspartei“ war keineswegs zufällig gewählt. Ganz bewusst sollte so an die württembergische Volkspartei von 1864 erinnert werden, an deren antipreußischen und föderalistischen Traditionen man anknüpfen wollte. 4. Die Situationen in den einzelnen Besatzungszonen Im folgenden Kapitel soll ein kurzer Überblick über die Startbedingungen zur Parteienbildung in den vier verschiedenen Besatzungszonen gegeben werden und einige diesbezügliche Unterschiede veranschaulicht werden. Zudem werden die Auswirkungen der unterschiedlichen Startbedingungen kurz benannt werden. 4.1 Die sowjetische Zone Da am Beispiel der LDP(D) die wichtigsten Gegebenheiten in der SBZ ersichtlich werden, sollen an dieser Stelle lediglich einige allgemeine Punkte benannt werden. Der alles beherrschende Gedanke für das Handeln der SMAD war die Erweiterung des Einflusses Moskaus auf Gesamtdeutschland und die gleichzeitige „Bestandssicherung“ in der SBZ. Diesen beiden Zielen dienten sämtliche Maßnahmen der Besatzungsmacht. Der Befehl Nr. 2 der SMAD erlaubte nicht nur die Gründung von Parteien, sondern verbot zugleich die Etablierung unabhängiger und nicht in Berlin entstandener Vereinigungen, damit die Besatzungsmacht die neuen Parteien besser beobachten und beeinflussen konnte. So wurden die Berliner Parteien schnell zum zentralen Kristallisationspunkt zahlreicher Gründungsinitiativen. Um die Kontrolle über die lizenzierten Parteien zu erhalten, wurde 42 Für die Rhein-Neckar-Zeitung. Eigentlich erfolgte zu diesem Datum lediglich die Gründung der DVP Stuttgarts, während sich die eigentliche Landespartei erst am 14.12.1945 konstituierte. Jedoch zeigt diese Vorwegnahme Haußmanns, in seinen Erinnerungen, dass bereits von Anfang an die Absicht bestand, weit über die Grenzen Stuttgarts hinaus zuwirken. 44 Rothmund, S. 215. 43 22 diesen eine „freiwillige“ Mitgliedschaft in der „Einheitsfront der antifaschistischen demokratischen Parteien“, dem späteren „Block“, nahe gelegt. Zugleich wurde der zentralistische Aufbau der Parteien gefördert. Zu unterscheiden ist zwischen den bürgerlichen Parteien und der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) sowie der späteren Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED). Während Erstere systematisch benachteiligt wurden und de facto als Transmissionsriemen bzw. Dekoration für die Westmächte vorgesehen waren, wurde Letztere immer wieder auf verschiedene Arten gefördert und bevorzugt. Die Existenz von CDU und LDP(D) hing einzig und allein von der Gnade der SMAD ab, die nur der gesamtdeutschen Perspektive wegen auf die Errichtung eines Einparteiensystems verzichtet hatte. Als eine besondere Belastung stellte sich für die beiden bürgerlichen Parteien die Mitgliedschaft im „Block“ dar. Da hier quasi kontinuierlich eine sozialistische Politik betrieben wurde und ein Zwang zur Einmütigkeit bestand sowie jede Sitzung unter den Augen der SMAD stattfand, befanden sich CDU und LDP(D) permanent in der Defensive. Statt zu agieren, sahen sie sich gezwungen zu reagieren. Große Vorhaben wie die Bodenreform konnten sie nicht verhindern, lediglich punktuelle Abmilderungen waren durchsetzbar. Diese Blockpolitik wurde zur offenen Flanke aller bürgerlichen SBZ-Parteien, denn ihre westlichen Schwesterparteien warfen ihnen oft eine Hörigkeit gegenüber Moskau vor. Jedoch ergaben sich aus der Lizenzpolitik der SMAD auch einige nicht zu unterschätzende Vorteile für die Parteien. So sorgte der geforderte Zentralismus dafür, dass ohne größere innerparteiliche Auseinandersetzungen Landes- und Zonenparteien entstanden. Die Tatsache dass die SMAD nach KPD, SPD, CDU und LDP(D) über Jahre keine weiteren Lizenzen ausstellte, sorgte für einen raschen Auf- und Ausbau der Parteiorganisationen sowie schnell anwachsende Mitgliederzahlen, die weit über dem Niveau ihrer Schwesterparteien im Westen lagen. Auch verfügten die SBZ-Parteien bereits sehr früh über eigene, wenn auch von der SMAD kontrollierte, Publikationsmittel und eine relativ gute finanzielle Ausstattung, was einen weiteren deutlichen Entwicklungsvorsprung gegenüber ihren westlichen Schwesterparteien bedeutete. Diese Startvorteile ermöglichten es den Parteien der SBZ, ihre gesamtdeutschen Ansprüche zu untermauern. Im Vergleich zu ihren westlichen Pendants waren die SBZ-Parteien viel stärker gesamtdeutsch ausgerichtet, die Wiedererlangung der deutschen Einheit war, zumindest in den ersten Jahren, ihr oberstes Ziel und vorderstes Streben. 23 4.2 Die amerikanische Zone Die Parteienentwicklung in der amerikanischen Zone gestaltete sich wesentlich schwieriger als in der SBZ. Das Gebot, dass alle politischen Vereinigungen der ausdrücklichen Genehmigung des amerikanischen Militärgouverneurs bedurften, wurde zumindest zu Beginn sehr restriktiv gehandhabt. Die Regelung wurde als faktisches Verbot jedweder politischen Arbeit ausgelegt und durchgesetzt. „Die Deutschen sollten sich erst dann politisch betätigen dürfen, wenn das ‚gigantische Programm der Austilgung des Nationalsozialismus und der Umerziehung zur Demokratie’ Früchte getragen hatte.“45 Theodor Heuss bezeichnete dieses Umerziehungsprogramm mit seinem, zumindest anfangs sehr starren Vorgehen nach Instruktionsschablonen, einmal bitter ironisch als „Gebrauchsanweisung für die Domestizierung einer wilden Bevölkerung“46. Spätestens nach dem Befehl Nr. 2 der Sowjets wurde diese Handhabung auch im amerikanischen Kommandostab heftig kritisiert und hinterfragt. Hatte es zuvor schon Zweifel daran gegeben, ob diese Regelung bei Anhängern totalitärer Lehren – am Anfang waren damit vor allem die Nationalsozialisten, später immer mehr die Kommunisten gemeint – überhaupt eine nachhaltige Wirkung erzielen könnte, so kam nach den Parteigründungen in der SBZ die Sorge hinzu, dass diese Parteien – da ohne Konkurrenz – über ihre Zone hinauswachsen und somit auch zu Einfluss in den Zonen der Alliierten gelangen würden. Der Einflusszugewinn der SBZ-Parteien würde zwangsläufig auch einer Ausweitung des sowjetischen Einflusses gleichkommen, so die Befürchtungen im US-Hauptquartier. Aus diesen Gründen wurde am 07.07.1945 die Regelung dahingehend verändert, dass von da an Orts- und Gemeinderäte zugelassen wurden, die der zuständigen Militärverwaltung vor Ort bei bestimmten Themen, z. B. Versorgungs- und Entnazifizierungsproblemen, behilflich sein sollten. Dies war nahe liegend, denn „in den Gemeinden war schon bald der Ruf nach unbelasteten Männern zu vernehmen gewesen, die fähig wären, die noch ziellos dahintreibenden Dinge in den Griff zu bekommen“47. Auf der Potsdamer Konferenz traten die Amerikaner gemeinsam mit den Briten endgültig die „Flucht nach vorn“ an, denn das Potsdamer Abkommen enthielt auf ihren Wunsch hin den Passus, dass Parteien zuzulassen und zu fördern seien. Jedoch sollte gleichzeitig auf eine strikte Dezentralisierung aller politischen Strukturen hingearbeitet werden, u. a. durch Stärkung der Gemeindeselbstverwaltung. Außerdem sollten rasch demokratische Wahlen 45 Rothmund, S. 204. Reutimann, S. 17. 47 Rothmund, S. 205. 46 24 abgehalten werden. Die meisten dieser Maßnahmen zielten darauf ab, den sowjetischen Einfluss einzudämmen und aus der SBZ initiierte Parteiengründungen zu unterbinden. Besonders diese Gefahr hoffte man mit der Taktik des „grass roots approach“48 zu umgehen, weshalb Eisenhower am 07.08.1945 lediglich die Weisung erteilte, Parteien auf Kreisebene zuzulassen. Allerdings verzögerte sich die Umsetzung dieser Weisung aus bürokratischen Gründen um mehrere Wochen. Dennoch wurde am 20.09.1945 bekannt gegeben, dass im Januar Gemeindewahlen, im März Kreistagswahlen und im Mai Wahlen in den Städten durchgeführt werden sollten. Alle neuen Parteien sollten sich also schon sehr früh der Wettbewerbssituation einer Wahl stellen müssen. Die amerikanische Militäradministration hoffte so auch, die eventuell wiedererstarkten Kommunisten bereits im Vorfeld zu schwächen bzw. zu isolieren. Jedoch verlief diese Taktik des strikten Aufbaus von „unten nach oben“ alles andere als nach Wunsch und Plan. Nicht nur, dass die meisten Gründerkreise von Politikern, die bereits in der Weimarer Republik aktiv gewesen waren, geleitet bzw. gegründet wurden, was dem Ansinnen der Militäradministration zuwiderlief, auch konzentrierten sich diese Gründungen besonders auf die mittleren bis großen Städte der Zone, wohingegen viele Kreise49 bis Mitte Dezember gänzlich ohne Parteigründungen blieben. Obwohl diese Umsetzungen nicht den ursprünglichen Plänen entsprachen, wurden diese Entwicklungen mit der am 23.11.1945 erteilten Erlaubnis zur Gründung von Landesparteien und mit der Billigung von Zonenparteien am 28.02.1946 nachträglich abgesegnet. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der von der Militäradministration geplante dezentrale Parteienaufbau nicht erfolgreich war. Dennoch wurde das Ziel, den Einfluss der SBZ-Parteien zu minimieren, erreicht, denn die „amerikanische Politik verstärkte mithin – und dies war ja durchaus intendiert – die [...] ohnehin vorhandenen föderalistischen Tendenzen [und] begrenzte damit zugleich die Einflussmöglichkeiten der ,Reichsparteiführungen’ und förderte in den Landesparteien eine in weiten Bereichen eigenständige Politik“50. Auch nach der Errichtung von Zonenparteien blieben die Landesparteien und das Land die Hauptbezugspunkte, weil für einfache Parteimitglieder und die meisten Funktionäre die Zonen- oder gar Reichsverbände eher nachrangige Bedeutung besaßen. Also eines „organischen“ Wachstums von unten nach oben. Hein geht von etwa 50 % aus. Vgl. Hein, Milieupartei, S. 37. 50 Vgl. Hein, Milieupartei, S. 38. 48 49 25 4.3 Die britische Zone Die Gründungen der Parteien der britischen Zone verliefen unter fast identischen Bedingungen wie im amerikanischen Besatzungsgebiet. Auch hier bestand anfangs das „Politikverbot“, das später durch die Bewilligung kommunaler Beiräte abgeschwächt und schließlich im Potsdamer Abkommen weitestgehend abgeschafft wurde. Diese Kongruenzen sind allerdings nicht besonders verwunderlich, bedenkt man, wie eng sich die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich in den ersten Nachkriegsjahren miteinander abstimmten. So entstand das Bild eines gemeinschaftlichen Blocks innerhalb der Siegermächte, den vergleichbare deutschlandpolitische Vorstellungen – und nicht nur diese – miteinander verbanden. Diese analoge Entwicklung unterschied die angloamerikanischen Besatzungsgebiete sowohl von der sowjetischen als auch der französischen Zone. Dennoch ergaben sich einige nicht zu vernachlässigende Unterschiede, und die Entwicklungen verliefen keinesfalls völlig parallel. Die für die Parteienbildung wichtigsten Abweichungen, die im Folgenden kurz angesprochen werden sollen, sollten Auswirkungen bis weit in die 50er-Jahre hinein haben. Der erste Unterschied zwischen britischer und amerikanischer Zone lässt sich in der Handhabung des „Politikverbots“ erkennen. Die Briten handhabten dieses Credo wesentlich weniger strikt als die US-Amerikaner. Auch war ihre Ableitung des Grundansatzes eine völlig andere. Während die Amerikaner vorläufig jedwede parteipolitische Tätigkeit unterbanden, sah die britische Interpretation lediglich ein Demonstrations- und Versammlungsverbot vor. Selbst Letzteres wurde zum Teil sehr lax und uneinheitlich durchgesetzt, sodass je nach lokaler Gegebenheit und Strenge der örtlichen Kommandantur Vorgespräche bzw. sogar Vorbereitungen für Parteienbildungen im kleineren Kreis in einem halb legalen Rahmen möglich waren. Auch bei der Umsetzung des Potsdamer Abkommens in Bezug auf die strikte Dezentralität der Parteiengründungen lässt sich, wie beispielsweise Wieck51 aufzeigt, ein Unterschied zum US-Äquivalent feststellen. Während die Amerikaner unter allen Umständen das „GrassRoots“-Prinzip durchzusetzen versuchten, ließen die Briten auch hier eine zum Teil erstaunliche Flexibilität erkennen. So wurden mit der am 15.09.1945 erlassenen „Verordnung Nr. 12 der Militärregierung über die Gründung und Betätigung politischer Parteien“ neben der Gründung von Kreisparteien auch Zusammenschlüsse auf höheren Ebenen als dieser ermöglicht. So entstanden relativ schnell nicht nur Kreis- sondern auch Provinz-, Landes- und 51 Vgl. Wieck, Gründung der CDU ab S. 36 bzw. Hein, Milieupartei, S. 85. 26 schließlich Zonenparteien. Wobei zu beachten ist, dass oftmals die Einigung der Parteien, nicht wie beabsichtigt, von oben nach unten erfolgte, sondern die obere Ebene als einheitsstiftendes „Dach“ für die unteren Ebenen diente. Die dritte maßgebliche Abweichung vom US-Modell war die britische Herangehensweise an die Organisation von Wahlen. Während man bei den zuvor genannten Unterschieden jeweils der Entwicklung der amerikanischen Zone vorausgeeilt war, wurde in diesem Punkt eine eher zurückhaltende Position eingenommen. Erst relativ spät wurden Wahlen angesetzt, in den Kommunen etwa ein Jahr nach der Verordnung Nr. 12 und für die Länder gar erst im April 194752. Dementsprechend verlagerte sich auch die weitere Rückübertragung von Verwaltungsverantwortung an deutschen Politiker weiter nach hinten. Als Auswirkungen dieses unterschiedlichen Verlaufs der Parteienentstehung können im Wesentlichen folgende Punkte genannt werden: Zum Ersten der organisatorische Vorsprung, den die Parteien der britischen Zone besaßen, da ihre Sondierungen bereits Monate vor denen der in der amerikanischen Zone beheimateten Gründungskreise erfolgen konnten. Zum Zweiten hatten sich die Bedeutung, Wertlegung und Orientierung immer mehr auf die höheren Ebenen der Parteien verlagert, sodass das Primat der Willensbildung bereits relativ früh auf die Landesebene verlagert wurde. Mit der Entstehung der Zonenparteien erfuhr dieser Trend zur zentralistisch geführten Partei einen erneuten Auftrieb. Durch die verspätete Wahlterminierung wurde zumindest der von den Amerikanern gewünschte Effekt, die Parteien, weil verhältnismäßig schnell dem Wettbewerb durch Wahlen ausgesetzt, auf eine realpolitische und kompromissbereite Linie einschwenken zu lassen, unterbunden. Stattdessen bildete sich ein Trend zur überstarken Prinzipienhaftigkeit in der Parteienpolitik heraus, der denkbar ungeeignet war, programmatische Gegensätze zu überbrücken. 4.4 Die französische Zone Die französische Besatzungsmacht zeigte sich in punkto Parteienzulassung und politischer Betätigung der Besetzten als die zögerlichste aller Siegermächte. Nirgendwo sonst kamen die parteibildenden Prozesse so schwer und langsam in Gang wie im französisch besetzten Südwesten. Erst am 13.12.1945 begann hier das Lizenzierungsverfahren. Zusätzlich verhinderte die Besatzungspolitik lange Zeit eine eigenständige parteipolitische Entwicklung. 52 Vgl. Hein, Milieupartei, S. 85. 27 So unterband sie die Entfaltung von selbstständigen Gründerkreisen und die Herausbildung von parteiähnlichen Organisationen. Der Grund hierfür ist in dem sehr ausgeprägten Sicherheitsbedürfnis der französischen Regierung zu sehen, dem jede eigenständige Betätigung, die von Deutschen ausging, wenn nicht als Vorstufe zum Widerstand, so doch wenigstens als höchst verdächtig erschien. In diesem Zusammenhang ist auch zu sehen, dass die Franzosen im Gegensatz zu den Amerikanern und Briten, die in ihren Besatzungszonen bestrebt waren, möglichst große Länder zusammenzufassen, die Schaffung möglichst kleiner Verwaltungseinheiten anstrebten. Als Beispiel sei hier nur die Handhabung der Verwaltungsaufteilung des heutigen BadenWürttembergs erwähnt. Während die Amerikaner ihre Teile Nord-Badens und NordWürttembergs bereits sehr früh zu einem Land Württemberg-Baden zusammenfassten, wurde in den französisch besetzten Teilen strikt an der Aufteilung festgehalten, und es wurden so dementsprechend zwei Länder, Baden und Württemberg-Hohenzollern, geschaffen. Auch bei der Parteienlizenzierung wurden Sonderwege beschritten, denn weder das angloamerikanische noch das sowjetische Modell wurde übernommen. Obwohl sonst eher Förderer aller föderalistischen Tendenzen, verweigerten sich die französischen Militärgouverneure der Idee des dezentralen Parteiaufbaus, sondern bestanden auf einer zentralistischen Gründung. Dies entsprach allerdings ebenso nicht dem sowjetischen Konzept, da sich der Zentralismus nur auf die Landesebene beschränkte, eine Ausbreitung auf die gesamte Zone oder gar darüber hinaus war weder gewünscht noch beabsichtigt. So verlangten die Militärgouverneure, dass „jede politische Partei eine Landesdirektion [habe]. Außerdem müssten örtliche Ausschüsse gebildet werden. Soweit sich ein solcher örtlicher Ausschuss der Landesdirektion der Partei unterstelle, werde er ohne weiteres anerkannt“53. Hinzu kam die Auflage, dass das Element der Landespartei zwingend festgeschrieben wurde, so hieß es beispielsweise für das Land Württemberg-Hohenzollern „der Gouverneur wünscht, dass die Parteien in ihrer Bezeichnung das Wort ‚württembergisch’ zu führen“54 haben. Wieck schrieb hierzu: „Zugelassen werden sollten danach nur Parteien, die weder mit anderen Gruppen im übrigen Deutschland Verbindung besaßen noch für einen zentralistischen Staatsaufbau eintraten. Aus diesem Grund wollten die Franzosen auch nur die Gründung von ‚Landesparteien’, die sich ausschließlich mit ‚Landesangelegenheiten’ zu beschäftigen hätten, genehmigen“55. Selbst vorsichtigen Formulierungen zur eventuellen Reichseinheit, wie beispielsweise „Gemeinschaft der deutschen Länder“ traten die Behörden Frankreichs 53 Protokoll der Gouverneurssitzung vom 08.01.1946. Zitiert in: Hein, Milieupartei, S.157. Protokoll der Gouverneurssitzung vom 08.01.1946. Zitiert in: Hein, Milieupartei, S.158. 55 Wieck, Christliche und Freie Demokraten, S. 158. 54 28 vehement entgegen, gestatte wurde maximal von einer „Gemeinschaft der süddeutschen Länder“ zu sprechen bzw. zu schreiben. Um sich die Kontrolle über die politischen Institutionen ihrer Zone zu sichern, ging die französische Militärregierung soweit, alle zentralistisch bzw. des Zentralismus verdächtigen Organisationen entweder zu untersagen oder zu partikularisieren. Dies konnte zum Teil zu sehr skurrilen Ergebnissen führen. So berichtet Dr. Fleig, ein Mitbegründer der BCSV56, davon, dass „sogar das Rote Kreuz [...] nicht mehr Deutsches heißen [durfte], sondern [...] sich Badisches nennen [musste]“57. Zusätzlich wurde versucht, eine Art Informationssperre zu errichten, Dr. Fleig schreibt hierzu: „In den ersten Zeitungen durfte nichts von einem Deutschen Reich geschrieben werden; die Zensur strich alles Derartige“58. Die französische Militärregierung handelt faktisch als Gegenpart sowohl der Alliierten als auch der Sowjets. Während die Sowjets die Parteien ihrer Zone stets ermutigten, interzonal zu wirken, und den Status der „Reichsparteien“ ausdrücklich billigten, versuchten die Franzosen, gerade dieses zu verhindern, „ihre“ Parteien sollten auf gar keinen Fall zonale oder interzonale Bedeutung erlangen, vielmehr sollten faktisch die Landesgrenzen auch die Grenzen der parteipolitischen Tätigkeiten bilden. Weshalb beide, Sowjets und Franzosen, die zentralisierte Parteiengründung favorisierten, ist damit zu begründen, dass hierin die Möglichkeit der maximalen Einflussnahme gesehen wurde. Diesem Begehren und nicht den angloamerikanischen Überlegungen des langsamen Wachstums ist auch die Gestattung von Landesparteigründungen geschuldet. Die französische Militärregierung wählte also einen Weg zwischen den anderen westlichen Alliierten und den Sowjets und betrieben eine partikulare Zentralisierung „ihrer“ Lizenzparteien voran. Die zudem gezielt betriebene Isolation der „französischen“ Landesverbände untereinander führte dazu, dass wenn die Parteien „überhaupt überregionale Kontakte unterhielten, gingen sie über die Zonengrenzen hinweg in die Nachbarländer oder [...] zur ‚Reichsparteileitung’“ 59 in Berlin, was den Zielen der Besatzungsmacht gänzlich widersprach. Es war ihr folglich nicht gelungen, sämtliche äußeren Einflüsse von „ihren“ Parteien fern zu halten. So war es beispielsweise der LDP(D) bereits sehr früh gelungen, auf die Liberalen in Rheinland-Pfalz Einfluss zu nehmen und stabile, wenn auch meist inoffizielle Verbindungen aufzubauen 60. Der Name auf dem ersten Lizenzierungsantrag der Liberalen des südlichen Rheinlands lautete 56 Badische Christlich-Soziale Volkspartei. Wieck, Christliche und Freie Demokraten, S. 158. 58 Ebd. 59 Hein, Milieupartei, S. 275. 60 Ebd. S. 157ff und S. 173f. 57 29 deshalb auch LDP, der aber auf Druck der Besatzungsmacht in „Liberale Partei RheinlandPfalz“ umgeändert werden musste. Zur insgesamt schlechten Ausgangsbasis für alle Parteien kam für die Liberalen noch die Ungeneigtheit der Besatzungsmacht hinzu. In der Regel erhielten die Liberalen erst nach mehreren Monaten Verzögerung ihre Lizenzen, was sie in Hinsicht auf Parteiorganisation und -entwicklung nochmals deutlich zurückwarf. So ist es kaum verwunderlich, dass, als sich in den anderen Besatzungsgebieten bereits Zonenparteien gebildet hatten und das Für und Wider einer gesamtdeutschen Partei erwogen wurde, „sich die Liberalen im französisch besetzten Südwesten Deutschlands noch nicht einmal als Landesorganisationen konsolidiert“61 hatten. Erst am 04.01.1947, als die Isolierung durch die Militärbehörden nachgelassen hatte, wurde der Versuch unternommen, einen Zonenverband der französischen Zone zu gründen. Auf Einladung der badischen Demokratischen Partei trafen sich die Vertreter der jeweiligen Landesparteien in Freiburg, um die Bildung einer „Arbeitsgemeinschaft der Demokratischen Parteien in der französischen Zone“ zu beschließen. Bereits am 15.02.1947 erklärte der Militärgouverneur Badens, dass seiner Meinung nach „die neue in Aussicht genommene Organisation eher den Charakter einer demokratischen Einheitspartei für die ganze französische Besatzungszone [...] als einer Verbindung der in Betracht kommenden Parteien“ habe, außerdem lehne er „die eine oder die andere dieser Lösungen ab“62. Die Militärregierung beharrte darauf, dass sie die Parteien lediglich auf Landesebene zugelassen habe und keine zonale oder gar eine über die Zone hinausreichende Organisation akzeptieren würde. Somit blieb die französisch besetzte Zone die Einzige, in der es niemals zur Errichtung eines Zonenverbandes kam. Zwar nahmen später einige Delegierte aus der französischen Zone an Interzonengesprächen teil, fungierten aber maximal als Beobachter bzw. Botschafter ihrer eigenen Landesverbände. Zu einer einheitlichen Linie fanden die einzelnen Delegierten auch auf dieser Grundlage nicht. Die Schwäche der „französischen“ Liberalen resultiert hauptsächlich aus dem stark restriktiven Einfluss, den ihre Besatzungsmacht auf die parteipolitischen Belange nahm. „Es ist wahrscheinlich, dass nirgendwo anders in den westlichen Besatzungszonen auch nur ein annähernd so starker Druck von einer Militärregierung auf die [...] sich neu bildenden Parteien ausgeübt wurde [...], dass die Franzosen [...] mit stärksten Mitteln versuchten, die politische Neugestaltung [...] ganz ihren eigenen Zielen unterzuordnen.“63 Die Summe dieser genannten Gegebenheiten macht deutlich, warum es den Liberalen des französisch besetzten Südwestens nicht gelang, Einfluss auf die gesamtdeutschen Entwicklungen zu nehmen oder 61 Ebd. Schreiben der französischen Militärregierung für Baden vom 15.02.1947, zitiert in: Hein, Milieupartei, S. 277. 63 Wieck, Christliche und Freie Demokraten, S. 114. 62 30 sie gar mitzubestimmen. Aus diesem Grund sind ihre Entwicklungen und Programmatiken auch für den Rest dieser Arbeit zu vernachlässigen. 5. Die theoretischen Ansätze und Konzepte nach 1945 Die Situation der Liberalen nach dem Zweiten Weltkrieg, nach 12 Jahren der Unterdrückung, lässt sich wie folgt beschreiben: „Der Marxist hatte in den 12 Jahren als Regulativ seiner Meinung die marxistische Lehre64, der Anhänger des Zentrums die Satzungen seiner Kirche. Sie alle hatten es 1945 sehr viel leichter als die Demokraten. Die einen kannten sich aus Gewerkschaften bzw. Arbeitsfront, die anderen aus der Kirchenbank, die einen konnten an die personellen Restbestände ehemaliger Massenorganisationen anknüpfen, die anderen hatten Pfarrer und Schwestern als Kernpunkte einer neuen Organisation. Den Demokraten fehlte dies alles.“65 Im Folgenden sollen die drei Modelle – liberale Volkspartei, Rechtspartei und Partei der breiten bürgerlichen Mitte –, mit denen liberale Politiker innerhalb des Betrachtungszeitraumes versuchten, die o. g. Nachteile zu überwinden, um eine möglichst starke Partei liberaler Ausrichtung aufbauen zu können, kurz vorgestellt und an einem praktizierten Beispiel veranschaulicht werden. 5.1 Die liberale Volkspartei Das Konzept der Volkspartei nahm den alten Anspruch vieler Vorgängerinnen, den diese allerdings meist nur nominell erhoben hatten, auf, eine Partei für das gesamte Volk zu sein. In dieser Konzeption werden besonders Gedanken Friedrich Naumanns wieder aufgenommen und vertreten. „Liberalismus muß wieder Volksglaube werden“66, verlangte er und gab eine bezeichnende Definition: „Wer darauf noch hofft, der ist liberal.“67 Außerdem stellte er fest: „[E]s ist wieder ein allgemeiner deutscher Liberalismus nötig, eine Volkspartei, in der 64 Gleiches galt selbstverständlich auch für die damaligen noch marxistisch orientierten Sozialdemokraten. Ernst Mayer in einem Bericht an die amerikanische Militärregierung, zitiert in: Wieck, Christliche und Freie Demokraten, S. 152. 66 Friedrich Naumann, S. 43. 67 Ebd. 65 31 Demokratie und Nationalsinn beieinander wohnen, eine breite schaffende Mehrheitspartei mit freien neuen Gedanken.“68 Ziel war und ist es folglich, große Teile der Bevölkerung über die unterschiedlichsten Klassen und Schichten hinweg zu erreichen und möglichst fest zusammenzuschließen. Eine solche Partei soll nicht als Vertreterin einer Bevölkerungs- oder Interessengruppe, sondern muss als allgemein gültige Botschafterin gelten können. Die wichtigste Neuerung dieser Konzeption ist also die angestrebte Einbindung von Bevölkerungsschichten bzw. Teilen davon, die bisher dem Liberalismus ferngeblieben sind oder ihm gar ablehnend gegenüberstehen, voranzutreiben. Um den beabsichtigten Zuspruch zu erhalten, ist allerdings eine gewisse programmatische Unschärfe unabdingbar. Für eine Verbreiterung der potenziellen Anhängerschaft müsste eine Verwässerung der liberalen Leitgedanken, eventuell sogar Kompromisse mit anderen Leitbildern, in Kauf genommen werden. In diesen Abweichungen liegt auch die Gefahr des Volksparteikonzeptes, denn die Abweichungen und Kompromisse könnten letztendlich das Wesen der Partei als solches in gänzlich andere unliberale Richtungen lenken. Zwar soll eine liberale Volkspartei prinzipiell ihren Platz in der Mitte des Parteienspektrums finden bzw. erhalten, aber das ständige Ausloten der eigenen liberalen Grenzen nach rechts und links birgt zusätzliche Risiken in sich. Allzu leicht entsteht so die Gefahr, die Ideen und Ideale des Liberalismus auf einige wenige Grundsätze zu reduzieren, sodass auch extreme Ausrichtungen möglich werden. Dies kann umso leichter geschehen, da keine klaren Grenzen, nach rechts oder links vorgegeben sind. Dennoch war und ist das Modell trotz der gegebenen Schwierigkeiten außerordentlich attraktiv, da es davon ausgeht, dass eine liberale Partei zu einer sehr starken und eventuell sogar zur bestimmenden Partei aufsteigen und dennoch eine Partei der Mitte bleiben kann. Insgesamt muss jedoch festgestellt werden, dass es, da sich der Liberalismus für diese Konzeption nur wenig eignet, starken Zwängen von außen und einer straffen Organisiertheit im Inneren sowie der permanenten Bereitschaft, den Spielraum der liberalen Prinzipien bis an ihre äußersten Grenzen auszureizen, bedarf, um das Volksparteimodell erfolgreich umsetzen zu können. 68 Ebd., S. 35f. 32 5.2 Die Rechtspartei Die Rechtsparteikonzeption ist auf den ersten Blick der der Volkspartei recht ähnlich. Auch ihr Ziel ist eine starke liberale Partei, die so großen Zuspruch erfährt, dass an ihr kein Weg vorbeiführt. Auch in diesem Konzept wird das Aufweichen einiger Grundsätze zugunsten der Ausweitung der Anhängerschaft gebilligt bzw. ist man bereit, einige Prinzipien sehr „großzügig“ auszulegen. Die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Konzept der Volkspartei und dem der Rechtspartei liegen darin, dass bei Ersterem eine Öffnung nach beiden Seiten des Spektrums angedacht ist und zum Erreichen dieses Ziels eine Bereitschaft, den Spielraum der liberalen Prinzipien bis an ihre äußersten Grenzen auszureizen, postuliert wird, wohingegen bei Letzterem nur eine Öffnung zum rechten Rand hin gewünscht und dabei auch ein gelegentliches Übertreten der Grenzen zum Nationalismus gebilligt wird. Soll die Volkspartei auch weiterhin eine Partei der bürgerlichen Mitte, wenn auch mit sehr starken Flügeln nach rechts und links sein, verzichtet das Rechtsparteikonzept hierauf und verschiebt den Standort der Partei konsequent nach rechts. Während das Konzept der Volkspartei Kompromisse mit anderen politischen Leitideen und auch die Übernahme anderer Ideen in ihren Forderungskatalog vorsieht, jedoch nur, wenn dies mit den liberalen Grundsätzen in Einklang zu bringen ist, sieht das Konzept der Rechtspartei sogar vor, auf liberale Ideen, die der Entwicklung zur Massenpartei zuwiderliefen, gänzlich zu verzichten. Von den liberalen Grundsätzen sollen lediglich die als attraktiv geltenden genutzt werden, sodass der Begriff Liberalismus faktisch auf Begriffe wie Marktwirtschaft, Privateigentum oder Antisozialismus reduziert wird. Die Grundüberlegung, die dem Rechtsparteikonzept zugrunde liegt, ist schlicht und einfach die, dass man am rechten Rand des Parteienspektrums ein großes Wählerreservoir vermutet, das nur auf seine Erschließung wartet. Da sich die meisten Parteien im Nachkriegsdeutschland auf Links-, Mitte-Links- und Mitte-Rechts-Positionen festgelegt haben, ist in diese Richtungen kaum Zugewinn an Wählerstimmen möglich, so die weiteren Überlegungen. Während also links von der CDU ein harter Konkurrenzkampf herrscht, bei dem zudem die meisten „Claims“ bereits abgesteckt sind, ist das „Fischen“ am rechten Rand fast völlig konkurrenzlos möglich. Hier Stimmen zu gewinnen, erscheint vergleichsweise mehr als einfach und scheint außerdem mit schnellen Wahlerfolgen verbunden zu sein. 33 5.3 Die Partei der breiten bürgerlichen Mitte Das Konzept der Partei der Mitte könnte auch als eine Art Projekt der „reinen Lehre“ bezeichnet werden. Im Gegensatz zu den anderen beiden Entwürfen soll hier auf jegliche Abweichungen und Kompromisse, die eine Aufweichung oder Verwässerung der liberalen Grundsätze bedeuten würden, generell verzichtet werden. Die Prinzipientreue steht über dem Gedanken der Verbreiterung der Wähler- und Anhängerbasis. Ein weiterer Gegensatz zum Konzept von Volkspartei und Rechtspartei zeigt sich darin, dass eine scharfe Abgrenzung nach links und rechts angestrebt wird, allerdings ohne sich dabei Kooperationsmöglichkeiten in die jeweilige Richtung zu verbauen. Es wird davon ausgegangen, dass weder Rechte noch Linke eine absolute Mehrheit erreichen können, ferner diese – da einander diametral gegenüberstehend – zu einer gemeinsamen Koalition unfähig sind und bleiben. Zum Erreichen einer Regierungsmehrheit wird daher immer die Partei der Mitte benötigt werden, sodass ihr eine quasi ewig währende Schlüsselrolle zukäme. Dies bedeutet, dass die liberale Mittelpartei je nachdem, wie es der Situation nach erforderlich ist, einmal mit den Vertretern der Rechten und ein anderes Mal mit deren Äquivalent auf der linken Seite des Parteienspektrums zusammenarbeiten kann. Im Idealfall kann so die Mittelpartei ein Maximum ihrer Vorstellungen bzw. Ideen durchsetzen und verwirklichen. Sie sucht sich ihre Bündnispartner selbst, was sie de facto zur Herrin der Politik machen würden. Bei geschickter Verhandlungstaktik würden für sie so trotz ihrer geringen Größe die höchsten Staatsämter in Reichweite liegen, z. B. bei einer von ihr gestellten Minderheitsregierung. Ernst Mayer beschrieb die Konzeption wie folgt: „Im übrigen [sind die] grundsätzlichen Unterschiede zwischen den beiden Flügelparteien SPD und CDU [...] so groß [...], dass bei einem abwechselnden Regieren beider zu große Erschütterungen unseres staatlichen Lebens eintreten müssten, um eine ausgleichende Mittelpartei nicht als notwendig erscheinen zu lassen. Eine solche wird, immer nach beiden Seiten kämpfend, selten die Chance haben, eine große Massenpartei zu werden, aber sie wird auch als kleinere Partei die Möglichkeit haben, einen Ausgleich auf mittlerer Linie herbeizuführen ...“69 Die Gefahr in diesem Konzept ist zweierlei Gestalt. Zum Ersten gilt zwar der Leitsatz Reinhold Maiers „klein aber fein“, dennoch muss eine ausreichend große Wählerschaft der Partei gerade wegen ihrer exakt mittigen Ausrichtung die Stimme geben. Dies setzt allerdings eine ungemein treue Stammwählerschaft und den freiwilligen Verzicht der Partei auf traditionelle Koalitionen und auf taktische Wechselwähler voraus, denn welchen Vorteil 69 Ernst Mayer in einem Bericht an die amerikanische Militärregierung; zitiert in: Wieck, Christliche und Freie Demokraten, S. 152. 34 sollten Letztere aus ihrem Übertritt gewinnen? Weder könnten sie ihr eigenes Lager stärken, noch würden sie genau wissen, zu welchem Partner sich die Mittelpartei letztendlich bekennen würde. Auch müssten bei Koalitionen, sollen diese stabil sein, stets gewisse Kompromisse geschlossen werden, sodass zumindest für eine Legislaturperiode die exakte Mitte verlassen werden müsste, also die Gesamtkonzeption in diesem Punkt nicht funktionieren kann. Zum anderen birgt die absolute Mitte auch die Gefahr in sich, zwischen den größeren Blöcken aufgerieben zu werden. Auch verkennt diese Grundkonzeption völlig die Möglichkeit des Eindringens in ihr Revier durch andere Parteien ebenso wie die von möglichen Flügelkämpfen innerhalb der eigenen Partei. Durch Übernahme von Teilen der Agenda könnten andere Parteien durchaus versucht sein, in das Lager der Liberalen einzubrechen, um auf diese Weise doch noch zu einer eigenen Mehrheit zu gelangen. Zudem ist zweifelhaft, ob sich nicht auch in der eigenen Partei gewisse Präferenzen zur jeweils einer Richtung herausbilden würden. Dies würde, sollte bei Koalitionen die andere den Zuschlag erhalten, durchaus zu parteiinternen Auseinandersetzungen führen. 6. Die wichtigsten Vertreter der drei Modelle und die Umsetzungen der Konzepte in die Praxis Die praktische Umsetzung der verschiedenen Modelle wird im Folgenden anhand der drei wichtigsten Vertreter des jeweiligen Konzepts veranschaulicht. Dies geschieht anhand der Zonenpartei LDP(D) und der Landesparteien LDP (Hessen) und DVP (Württemberg-Baden). Da bei der Ausrichtung der Parteien die jeweiligen Führungspersönlichkeiten eine entscheidende Rolle spielten, muss stark auf die jeweiligen Führungspersönlichkeiten der Parteien bezug genommen werden. Da aus den Gründerphasen der Parteien keine feste Programmatik vorhanden war, müssen die Aussagen der Männer an der Spitze als allgemeingültig angenommen werden. 35 6.1. Die LDP(D) unter Wilhelm Külz Im Gegensatz zu den liberalen Parteien der Weimarer Republik entwickelte sich die LDP(D) zu einer Mitgliederpartei. Anfang des Jahres 1946 zählte sie bereits 100.000 Mitglieder 70 und war damit die größte liberale Organisation in ganz Deutschland. Sie wurde schon früh als Sammelbecken für Nicht-Marxisten begriffen und ihr individuelles Freiheitsverständnis machte sie für breite Bevölkerungsschichten attraktiv. Obwohl die Kontakte zu liberalen Schwesterorganisationen im Westen in den ersten Nachkriegsjahren recht eng waren und die Liberaldemokraten diese organisatorisch und finanziell unterstützten, konnte der Berliner Kreis seinen Führungsanspruch dennoch nicht über die Grenzen der SBZ hinaus durchsetzen. Ursache hierfür war der Einfluss der Sowjets sowie der KPD/SED auf die liberaldemokratische Politik, der von vielen Liberalen im Westen erkannt oder zumindest befürchtet wurde. Dieser Einfluss zeigte sich zunächst in der Einbindung der LDP(D) in den „Block der antifaschistisch-demokratischen Parteien“, dem sie am 14.07.1945 beitrat. „Dieser Block, der zunächst als eine Art Allparteienkoalition zur Überwindung der schlimmsten Not erschien und ursprünglich eine gleichberechtigte Zusammenarbeit aller Partner sein sollte, wandelte sich [...] mehr und mehr zum Vollzugsorgan der SED-Bündnispolitik.“71 Der begrenzte Spielraum der LDP(D) wurde noch im Herbst 1945 bei der Auseinandersetzung um die Bodenreform deutlich. Die entschädigungslose Enteignung der Großgrundbesitzer wurde mehrheitlich abgelehnt. Als der Vorsitzende Koch jedoch offen dagegen opponierte, wurde er durch die SMAD zum Rücktritt gezwungen, indem sie drohte, der Partei andernfalls die in Aussicht gestellten Presselizenzen zu verweigern. Den Parteivorsitz übernahm daraufhin Wilhelm Külz, der bis dahin Stellvertreter gewesen war. Külz vermied offene Auseinandersetzungen mit der Besatzungsmacht und zeigte sich kompromissbereit, weil er die Auffassung vertrat, keine Politik gegen die SMAD verwirklichen zu können. Während er deshalb aus dem Westen stark kritisiert wurde, galt er in der SBZ weiterhin als politische Autorität und wurde auf der ersten Delegiertenkonferenz im Februar 1946 in seinem Amt bestätigt. Das kompromissbereite Verhalten von Külz, für das er später oft, besonders von westzonalen Liberalen kritisiert wurde, hatte durchaus einen tieferen Sinn. Zum einen hoffte Külz, durch ein gutes Verhältnis zur SMAD Druck von seiner Partei nehmen zu können. Zum anderen setzte sich Külz wie kein anderer Politiker im Betrachtungszeitraum für die Wiedergewinnung 70 71 Vgl. Malycha, S. 33. Frölich, Liberaldemokratische Partei Deutschlands, S. 315. 36 der deutschen Einheit ein. Wenn dieses Ziel erreicht werden würde, so die Überlegung von Külz, würden die meisten Blockentscheidungen Makulatur werden, da, hiervon war Külz fest überzeugt, die deutsche Einheit nur eine Frage der Zeit sein würde und die SED in den dann folgenden freien Wahlen keine parlamentarische Mehrheit würde erringen können. Die külz’sche Nachgiebigkeit lag also im Wesentlichen darin begründet, dass Külz nicht an die Dauerhaftigkeit der deutschen Teilung glaubte, die der SED gemachten Zugeständnisse also seiner Meinung nach nur von temporärer Natur waren. Daher war sowohl für die LDP(D) als auch für ihren Vorsitzenden die gesamtdeutsche Perspektive im Handeln und Agieren von immenser Wichtigkeit, verhieß doch das Erreichen des Ziels der deutschen Einheit auch die Wiedererlangung der persönlichen wie auch politischen Freiheit. Um dieses Ziel zu erreichen, waren deshalb keine Opfer (z. B. Nachgiebigkeit gegenüber der SED) zu groß und keine Handlungen zu verzweifelt, als das diese nicht zu erbringen wären. In der Zwischenzeit galt es der SMAD zu zeigen, dass die LDP(D) eine Existenzberechtigung besaß, d. h., den Status einer Partei, die für viele, wenn möglich sogar alle Schichten wählbar war zu erreichen, war auch eine Sache des politischen Überlebens. Für die LDP(D) ermutigend war das Ergebnis der Landtagswahlen vom 20.10.1946. Obwohl die Partei bei der Kandidatenaufstellung massiv durch die SMAD behindert und bei der Papierzuteilung benachteiligt wurde, ging sie aus den Wahlen mit durchschnittlich knapp 25 %72 als zweitstärkste Kraft hervor. In Sachsen-Anhalt stellte sie mit Erhard Hübner sogar den einzigen Ministerpräsidenten, der nicht der SED angehörte. Bei ihrem organisatorischen Aufbau orientierte sich die LDP(D) stark am Vorbild der Massenparteien Weimars. So unterschied sie, ähnlich wie z. B. SPD und KPD, zwischen Ortsgruppen und Betriebsgruppen, Ziel war es, vermehrt Arbeiter anzusprechen. Bis zur Gründung der Einheitsgewerkschaft FDGB wurde sogar über die Formierung einer liberalen Massengewerkschaft nachgedacht73. Ebenfalls ungewöhnlich für eine liberale Partei war es, dass die LDP(D) auch Parteischulungszentren aufbaute, um eine gewisse Form der Kaderförderung zu betreiben. Unter dem Vorsitzenden Külz besaß die LDP(D) kein Parteiprogramm, zum einen, um sich nicht vorzeitig festlegen zu müssen, d. h. jederzeit einen flexiblen Kurs steuern zu können, zum anderen, um weder SMAD noch SED zusätzliche Angriffsfläche zu bieten. Lange Zeit galt in der Partei: „Solange wir kein geschriebenes Programm kennen, heißt unser Programm: Dr. Külz!“74 72 Vgl. Sommer, Die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands, S. 46. Vgl. Krippendorff, S. 75f. 74 Hermann Kastner auf dem 2. Parteitag der LDP(D). Zitiert nach: Rütten, Liberalismus, S.121. 73 37 Die Partei, die dem Typus der linken Volkspartei am nächsten kam, war ohne Zweifel die LDP der SBZ. Jedoch war das Streben des Kreises um Külz nach der Volkspartei nicht allein darin zu sehen, dass man aus Prestigegründen diesen Status erreichen wollte, vielmehr war die Gewinnung des Status Volkspartei und dessen Erhaltung eine Art Lebensversicherung für die Liberalen in der SBZ. Külz’ Überlegungen lassen sich in etwa wie folgt grob umreißen: Das Überleben der LDP hing fast gänzlich vom Wohlwollen der SMAD ihr gegenüber ab, weshalb jedwede politische Aktion, die als Provokation ausgelegt werden konnte, unterbleiben musste. Da die SMAD die Mitarbeit aller Parteien im Block wünschte, konnte die LDP sich nicht verweigern, selbst wenn es dort zu Beschlüssen kam, die nur schwer mit liberalen Prinzipien in Einklang zu bringen waren. Auch akzeptierte die SMAD außer der KPD/SED nur Parteien, die eine Existenzberechtigung aufweisen konnten, dies bedeutete, diese Parteien mussten eine nicht zu vernachlässigende große Gruppe bzw. Schicht o. Ä. repräsentieren. Aus Sicht der SMAD waren dies die KPD (ihr direkter Verbündeter, daher über dieser Regel schwebend), die SPD (traditionelle Arbeiterklasse) und die CDU (Christen). Die LDP musste also, wenn sie überleben wollte, alles daran setzen, die nicht konfessionell gebundenen und nicht sozialistisch orientierten Wähler zu gewinnen, so gesehen also dasselbe Problem, das sich auch ihren Schwesterparteien in den Westzonen stellte. Allerdings hing für die LDP der SBZ wesentlich mehr davon ab, ob es ihr gelingen würde, dieser Aufgabe gerecht zu werden. Es ging um Sein oder Nichtsein der Partei, eventuell sogar der gesamten liberalen Weltanschauung. Ähnlich wie Euler später in Hessen erkannte auch Külz, dass für die LDP im neuen Parteiensystem nur wenig Platz blieb. Da sowohl KPD als auch SPD sowie später natürlich auch die SED sozialistische Ziele verfolgten und auch ein nicht unbeträchtlicher Teil der CDU Anhänger des „christlichen Sozialismus“ waren, blieb für die Liberalen lediglich der rechte Teil des Parteienspektrums übrig. Wie ungern sie diesen zu füllen bereit waren, zeigte sich an der Äußerung nach der Hoffnung auf eine „ehrliche Rechtspartei“, denn viele der parlamentarisch Erfahrenen ahnten bereits, was die Rechtsposition für die LDP bedeuten würde, denn die politischen Gegner würden künftig immer wieder die Liberalen als die „Nachfolger“ der Reaktion bzw. die abgemilderte Form der Nazis darstellen und verunglimpfen können. Allerdings bot die Tatsache, die einzige nicht sozialistische Partei zu sein, auch eine große Chance, nämlich die, hierüber den Status einer Partei für das ganze Volk zu erlangen. Eine Volkspartei würde die SMAD weder verbieten, noch könnte sie deren Forderungen ignorieren, so die Überlegungen in dieser Hinsicht. 38 War das Überleben dann vorläufig gesichert, mussten alle Kräfte für die Widererlangung der Reichseinheit mobilisiert werden, da in einer freien Wahl, so die feste Überzeugung von Külz, die SED verlieren würde. Bis es allerdings soweit war, musste sowohl gegenüber der SED als auch gegenüber der SMAD guter Willen demonstriert werden, was bedeutete Bodenreform und Verstaatlichungen als gegeben und unabänderlich hinzunehmen bzw. sogar mitzutragen. Nach der Wiederherstellung der staatlichen Einheit und der erwarteten Wahlniederlage der SED würden die meisten der Blockbeschlüsse ganz einfach wieder aufgehoben werden. Külz’ Überlegungen werden in etwa darauf hinausgelaufen sein, dass kurzfristig wohlgefälliges Verhalten gegenüber der SMAD und gute Beziehungen zu einzelnen hohen Offizieren das Überleben der Liberalen würden sichern können. Mittelfristig jedoch waren das Errichten einer liberalen Volkspartei und die Herstellung der deutschen Einheit die einzige Möglichkeit, Eigenständigkeit und Fortbestand der Partei bzw. (und) der liberalen Idee zu sichern. Um allerdings aus den bisherigen Beschränkungen der Liberalen auf bürgerliche Kreise auszubrechen, bedurfte es mehr als nur des Verweises, die einzigen Nichtsozialisten zu sein. Vielmehr mussten bestimmte Formen der Massenpartei kopiert und übernommen werden, z. B. Parteischulen, feste Strukturen, Betriebsgruppen parallel zu den Kreisverbänden. So begann innerhalb der LDP eine für eine liberale Partei bis dato völlig untypische Zentralisierung. Die entstandenen Landesverbände besaßen zwar weiter einige Freiheiten, jedoch wurden Entscheidungen prinzipiell nur noch von der Reichsparteileitung bzw. dem Parteivorstand gefällt. Auch die Aus- und Weiterbildung von Personal erfolgte per zentraler Planung. 6.2. Die hessische LDP unter August Martin Euler Kein liberaler Politiker innerhalb des Betrachtungszeitraums verkörperte so sehr die Konzeption der Rechtspartei wie August-Martin Euler. Zwar waren sowohl Friedrich Middelhauve, Arthur Stegner u. a. ebenso Vertreter des Rechtskurses, aber keiner war bei der Umsetzung so erfolgreich wie der langjährige Landesvorsitzende Hessens. Bis weit in die 50er-Jahre der Bundesrepublik galt Euler als derjenige, der der nationalen Sammlung Gesicht und Stimme gab. Gleiches galt auch für den hessischen Landesverband, wo dieser Kurs, so erschien es zumindest dem Betrachter von außen, absolut unumstritten akzeptiert wurde. Dies war jedoch nicht von Anfang an so, wie ein kurzer Abriss über die Entstehung und die ersten Jahre der hessischen LDP zeigt. „Während die SPD, die CDU und auch die KPD sich 39 schon im Herbst des Jahres 1945 gründeten, taten sich liberale Gruppierungen in den Städten Hessens mit einer gemeinsamen landespolitischen Gründung schwer.“75 Die Unterschiede zur Entwicklung in der SBZ und im Südwesten Deutschlands zeigten sich zu Beginn des liberalen Neuaufbaus in Hessen. Ein monistisches Zentrum mit großer „Strahlkraft“, wie es Stuttgart und in noch stärkerem Maße Berlin darstellten, existierte in Hessen nicht. Zwar hatten mehrere hessische Städte eine liberale Tradition, die mit der Stuttgarts und Heidelbergs vergleichbar war, aber dennoch „hatte der Liberalismus im hessischen Raum nie jene relativ weitreichende Geschlossenheit […] erreicht, die sich im deutschen Südwesten beobachten lässt“76, Grund hierfür war, dass „Struktur und Ausrichtung einer alten Reichsstadt und Handelsmetropole wie Frankfurt am Main nur zu deutlich geschieden [war] von jener der jeweils in hohem Maße durch den öffentlichen Dienst geprägten, untereinander auch keineswegs einheitlichen Städte Darmstadt, Wiesbaden und Marburg, und beide Formen trennte wiederum eine tiefe Kluft von den politischen Kräften Mittel- und Nordhessens, die im parteipolitischen Rahmen der liberalen Bewegung ein vielfach eher agrarisch-konservatives Milieu vertraten.“77 Diese sich zum Teil auch nach 1945 verfeindet gegenüberstehenden liberalen Strömungen, so wie das Fehlen eines Kristallisationspunktes, wie ihn, wenn auch nicht gänzlich unumstritten, Stuttgart und Berlin darstellten, waren einer der Gründe für den schleppenden Parteiaufbau in Hessen. Hinzu kam, dass, anders als in Berlin, organisatorische Schwächen nicht durch die Präsenz von hoch angesehenen Führungspersönlichkeiten wettgemacht werden konnten, d. h., dass die Initiatoren der hessischen Gründerkreise lediglich über lokale Bekanntheit verfügten bzw. nur als Kommunalpolitiker in Erscheinung getreten oder gar gänzliche Neueinsteiger waren. Aus den genannten Gründen ergab sich, dass nicht nur eine zeitliche Verzögerung die hessischen Liberalen, im Vergleich zur SBZ, behinderte, sonder auch „eine unvergleichlich schmalere Grundlage als in Württemberg-Baden“78 zur Verfügung stand. Da ein monistisches Zentrum fehlte, ergaben sich mehrere verschiedene Gründerkreise, von denen die wichtigsten im Folgenden kurz gestreift werden: In Frankfurt bildete sich um den Unternehmer Georg-Ludwig Fertsch, der „früher in der DVP [Weimars] kommunalpolitisch aktiv gewesen war“, ein „aus den lokalen Führungsspitzen beider liberale[n] Parteien der Zeit vor 1933“79 bestehender liberaler Zirkel. Der Frankfurter Kreis war also von Anfang an darauf ausgelegt, beide liberalen Richtungen in sich zu vereinigen. Unter Fertschs Führung Aus der Festrede Ruth Wagners zu „60 Jahre FDP Hessen“ am 08.01.2006. Hein, Milieupartei, S. 55. 77 Ebd. 78 Ebd., S. 56. 79 Ebd. 75 76 40 wurde Anfang September 1945 die „Liberal Demokratische Partei“ gegründet, der am 28.09.1945 die Zulassung der Militärregierung erteilt wurde. Die Wahl des Parteinamens erinnerte nicht zufällig an die der Berliner „Reichspartei“. Sie wurde vielmehr „jedenfalls von Fertsch – als bewußte Anlehnung an die Berliner Parteigründung und Unterordnung unter die ,Reichsparteileitung’ verstanden“. Ferner wollten die Frankfurter mit dem Namen LDP, genau wie der Koch-Külz-Kreis einige Monate zuvor, die neue liberale Einheit zum Ausdruck bringen und mit dem Vergangenen brechen. So sah man sich zwar als „Vereinigung von Liberalismus und Demokratie im Sinne der beiden überkommenen liberalen Parteirichtungen. [Zudem sollte] über deren frühere Anhängerschaft hinaus […], das Bürgertum im weitesten Sinne des Wortes vertreten“80 werden. Die LDP sah sich nicht als Fortsetzungspartei, sondern als völlige Neugründung, was sie bereits in ihren frühesten Wahlaufrufen betonte. Darin wurde der traditionellen Konzeption, die die Stuttgarter vertraten, eine deutliche Absage erteilt. So stellt ein Aufruf vom Januar 1945 klar: „Es ist ganz unmöglich, an Vergangenes anzuknüpfen oder es gar erhalten zu wollen. Sentimentalitäten sind im politischen Leben fehl am Ort […]. Die Liberaldemokraten richten […] ihren Blick nicht rückwärts; die Partei ist eine völlige Neugründung.“81 Die Fraktionen nahmen also die Position der Mitte innerhalb des liberalen Spektrums ein. Als „im württemberg-badischen Sinne eines ganz überwiegend auf der linksliberalen Parteitradition fußenden Neubeginns wich von ihr vor allem die Entwicklung in der Universitätsstadt Marburg ab.“82 Hier fanden sich bereits „im Frühjahr und Sommer 1945 vorwiegend ehemalige DDP-Mitglieder“83 zusammen. Trotz dieser frühen Zusammenkunft und des starken liberalen Engagements innerhalb des provisorischen Stadtrats dauerte es bis Oktober 1945, bis die Gründung einer Partei angestrebt wurde. Die Marburger Liberalen konkretisierten ihre dahingehenden Bemühungen erst, als die Vertreter von SPD und KPD ihre Lizenzen bereits beantragt hatten. „Die offizielle Konstituierung der neuen Partei erfolgt […] am 27. Oktober 1945 unter der Bezeichnung ,Demokratische Volkspartei’.“84 Auch diese Namenswahl bzw. ihre Übereinstimmung mit der der Stuttgarter Liberalen war keinesfalls zufällig. Der für die Marburger DVP-Gründung federführende Karl-Theodor Bleek verfügte über exzellente persönliche Kontakte nach Stuttgart. Er und Theodor Heuss kannten und schätzten sich bereits seit ihren gemeinsamen Berliner Zeiten von vor 1933. Auffällig ist zudem, dass ohne die Unterstützung aus dem Südwesten nur wenige dezidiert linksliberale 80 Aus dem Aufruf der LDP zu den Gemeindewahlen 20./27.01.1946, zitiert nach: Hein, Milieupartei, S. 57. Ebd. 82 Ebd., S. 58. 83 Ebd. 84 Ebd. 81 41 lokale Parteien entstanden. So kam es lediglich in Gießen (Demokratische Partei, November 1945) und in den Kreisen Findberg (DP, November 1945) und Waldeck (Deutsche Demokratische Partei) zu entsprechenden Gründungen. „Politisch gewichtiger […] waren jene Kreise […] in Nordhessen, in denen die nationalliberalen Kräfte von vornherein die Oberhand hatten oder jedenfalls noch in der Gründungsphase gewannen.“85 Als Beispiel für Erstere kann der Kreis der Liberalen Bad Hersfeld genannt werden, nicht nur, weil die beiden dominierenden Persönlichkeiten hier Max Becker und eben August-Martin Euler waren, sondern vor allem, weil man hier unter dem Namen „Stresemann-Partei“ mehr als deutlich Bezug auf die DVP Weimars nahm. Wie stark die gegenseitigen Abneigungen zwischen ehemaligen DDP’lern und DVP-Anhängern waren, zeigt sich am Beispiel von Kassel. Hier war man auf deutliche Trennung geradezu erpicht gewesen. So wurde selbst in der vorläufigen Bürgervertretung die Separierung beibehalten. Als im Oktober 1945 die Linksliberalen die „Demokratische Partei“ Kassels gründeten, auch um der Frankfurter LDP eine Absage zu erteilen, strebten die Nationalliberalen um Fritz Catta wie selbstverständlich eine eigne Partei an. Deren Konstituierung scheiterte jedoch am Veto der Militärregierung. „Erst unter diesem äußeren Druck kam es zur Vereinigung beider liberaler Initiativen in einer gemeinsamen ‚Liberal-Demokratischen Partei’ […], wobei der linksliberale Kreis […] schon bald ganz an den Rand gedrängt wurde.“86 Aus den beschriebenen Gründen ist es wenig verwunderlich, dass auch die Gründung der Landespartei letztlich eher auf äußeren Druck hin erfolgte, als aus innerer Überzeugung. Die Druckkulisse ergab sich aus den bereits für das Frühjahr 1946 von der Militärregierung anberaumten Wahlen für Kommune, Stadt bzw. Kreis und Land. Sollten die Wahlen nicht zum Desaster geraten, waren der Aufbau einer Organisation und die Bündelung der vorhandenen Kräfte nötig. Dieser Einsicht entsprechend folgten die Gruppierungen aus Marburg, Kassel und Bad Hersfeld der Einladung der Frankfurter Gruppe zur Gründung einer Landesorganisation. Jedoch war, um zu dieser Einsicht zu gelangen, eine weitere Erhöhung des Drucks nötig gewesen, denn erst als bereits die Landeslizenzen für KPD, SPD und CDU erteilt worden waren, waren alle liberalen Gruppierungen bereit, an der Versammlung teilzunehmen, zu der Fertsch am 29.12.1945 in die Mainmetropole einlud. Auf der Gründungsversammlung konnte Fertsch seine Vorstellungen weitestgehend durchsetzen. So gab sich der Landesverband mit „Liberal-Demokratische Partei Landesverband Großhessen“ nicht nur den von ihm gewünschten Namen, auch inhaltlich folgten die Delegierten seiner Linie. So wurde per Beschluss bestätigt, dass „es sich bei der Liberal-Demokratischen Partei 85 86 Ebd., S. 59. Ebd., S. 60, vgl. auch Luckemeyer, S. 118ff. 42 nicht um die Fortsetzung alter bürgerlicher Parteien handelt[e], sondern um den Zusammenschluß aller aufbauwilligen Kreise mit neuen und zeitgemäßen Zielen.“87 Zudem suchte man die enge Anlehnung an die Berliner „Reichsparteileitung“, deren Satzung weitgehend unverändert übernommen wurde. Folglich bekannte sich auch die hessische LDP „zum demokratischen Einheitsstaat, dem geheimen und gleichen Wahlrecht, den Menschenund Bürgerrechten, einem geordneten Rechtsstaat […], zu ‚freien Initiativen des arbeitenden Menschen’, der christlichen Gemeinschaftsschule, [dem] Privateigentum, aber auch [der] Verstaatlichung von Unternehmen [sic!]“88, wenn es das „Gemeinwohl“ erforderlich machte. Auch personell folgten die Delegierten der Frankfurter Linie, indem sie Fertsch zum ersten Vorsitzenden wählten. Die landesweite Zulassung der LDP durch die amerikanische Besatzungsmacht erfolgte am 11.01.1946. Da die ersten Kommunalwahlen bereits für den 20. bzw. 27.01.1946 angesetzt waren, kann das schlechte Abschneiden der Liberalen bei diesem ersten demokratischen Urnengang seit 1933 nur wenig überraschen. Zwar galten die meisten schlechten Voraussetzungen, wie kaum Papier, schlechte Verkehrsverbindungen, Mangel an Versammlungsräumen, wenige Möglichkeiten einer zentralen Organisation usw., auch für die anderen Parteien, doch bei der LDP kam noch zusätzlich hinzu, dass die Partei in vielen Landesteilen schlicht und ergreifend noch nicht existent war. So beschreibt die heutige FDP-Vorsitzende Hessens, Ruth Wagner, die damalige Situation wie folgt: „Die Gründung [der LDP] in den Landkreisen war nur spärlich und in den beiden Städten Darmstadt und Wiesbaden wurden ebenfalls Kreisverbände erst zu Beginn des Jahres 1946 gegründet.“89 Dennoch muss das Ergebnis von lediglich 2,7 % sehr ernüchternd bis beängstigend auf die Beteiligten gewirkt haben. Zwar wiesen die Kreistagswahlen dank verbesserter und gefestigter Organisation bereits ein Ergebnis von 6,2 % auf, jedoch dürften viele Hoffnungen und Erwartungen mehr als deutlich enttäuscht worden sein. Fest steht, dass es bereits im Frühjahr 1946 erneut zu Konflikten unter den Liberalen kam, denn bereits auf dem ersten Landesparteitag der LDP am 01.06.1946 in Gießen erfolgte eine Personalentscheidung, die die späteren Jahre entscheidend prägen sollte. Der Parteitag fasste in Abwesenheit des Gründungsvorsitzenden Fertsch einstimmig den Beschluss, „die geschäftliche und repräsentative Vertretung der LDP für Groß-Hessen hauptamtlich“90 auf August Martin Euler zu übertragen. Zwar wurde Fertsch erneut als erster Vorsitzender bestätigt, faktisch aber hatte ihn der Parteitag entmachtet. So ist es nicht verwunderlich, dass 87 Vgl. Tagesordnung der Konferenz vom 29.12.1945, zitiert in: Hein, Milieupartei, S. 61. Aus der Festrede Ruth Wagners zu „60 Jahre FDP Hessen“ am 08.01.2006. 89 Ebd. 90 Luckemeyer, S. 132. 88 43 Fertsch bereits am 21.06.1946 von seinem Parteiamt zurücktrat. Euler führte daraufhin den hessischen Landesverband bis zum Marburger Parteitag am 20.06.1947 als „geschäftsführender“ Vorsitzender weiter, um sich dort schließlich ganz offiziell zum Landesvorsitzenden und Karl-Theodor Bleek zu seinem Stellvertreter küren zu lassen. Dass Eulers Wahl 1946 keine graduelle, sondern eine elementare Veränderung bedeutete, zeigte sich bereits wenige Wochen nach seiner Ernennung zum „geschäftsführenden“ Vorsitzenden. Euler strebte einen kompletten Kurswechsel der hessischen LDP an. So ging er nicht nur auf Distanz zur Schwesterpartei LDP(D), sondern entwickelte sich zu einem ihrer heftigsten Kritiker. Doch auch intern wurde der Richtungswechsel bald spürbar. So erfolgte ein groß angelegter Austausch des politischen Personals. „Von Ausnahmen wie Bleek abgesehen wurden in Partei und Fraktion Anhänger von Fertsch und ehemalige Linksliberale zunehmend durch neue dem Euler-Kurs verbundene Kräfte ersetzt.“91 Zwar ist diese Vorgehensweise bei Führungswechseln nicht unüblich, jedoch sollte festgehalten werden, wen Euler statt dessen in die Führungsebenen berief. Mit den genannten neuen Kräften waren nämlich „nicht in erster Linie jene früheren DVP-Mitglieder wie Max Becker oder Fritz Catta, die […] nie einen Zweifel an ihrer dezidiert liberalen Grundeinstellung aufkommen ließen [gemeint], sonder Politiker wie der […] frühere Präsident des Reichslandbundes Karl Hepp oder der […] ehemalige Deutschnationale Heinrich Fassbender.“92 Besonders in den Landkreisen wurden auf Eulers Initiative der LDP viele ehemalige DNVP-Mitglieder und Sympathisanten zugeführt. „[G]erade sie waren nicht nur die entscheidenden Stützen von Eulers Rechtskurs, sie prägten zugleich den sozialen Charakter des hessischen Landesverbandes immer stärker.“93 Letzte Zweifel, in welche Richtung er die LDP zu steuern gedachte, räumte Euler höchst selbst in einem viel beachteten Artikel mit dem Titel „Die Rechtspartei“ im LDP-Kurier aus94. Für ihn war der Kampf gegen den „antidemokratischen ‚Kollektivismus’ der Kommunisten und der Nationalsozialisten“ die Hauptaufgabe aller demokratischen Parteien von vor 1933 gewesen. Jedoch hätten sie alle, laut Euler, hierbei ausnahmslos versagt; die Sozialdemokraten und Deutschnationalen, weil sie eine „ideologische Begünstigung“ gewährt hätten, die anderen Parteien durch die schlichte „laue Unentschlossenheit“ sowie ihre „Zersplitterung“. Da dieses Versagen auch ausdrücklich die liberalen Parteien Weimars mit einschloss, konnte bzw. durfte es konsequenterweise auch kein Wiederanknüpfen an deren Traditionslinien geben. 91 Hein, Milieupartei, S. 62. Ebd., S. 63. 93 Ebd., vgl. auch Luckemeyer, S. 162ff. 94 Die folgenden Zitaten sind diesem Artikel entnommen, zitiert in: Hein, Milieupartei, S. 63f. 92 44 Nach Eulers Auffassung hätten folglich die Liberal-Demokraten „im Gegensatz zur SPD […] den Schluss gezogen, dass völlig neu angefangen werden musste und daß es eine Identifizierung mit irgendwelchen Parteien und ihren Überlieferungen aus der Zeit vor 1933 nicht geben dürfe. Die LDP [würde] deshalb mit immer neuer Entschiedenheit verkünden, daß sie eine völlig neue Partei ist, daß die Vergangenheit nur den Anschauungsunterricht darüber gibt, wie man es nicht machen dürfe und welche Fehler zu vermeiden sind.“ Ergo war nach Eulers Verständnis die strenge Ausrichtung an der Traditionslinie, wie sie z. B. in Stuttgart praktiziert wurde, ein gänzlich falscher und geradezu törichter Grundansatz, der zwangsläufig zum Scheitern verurteilt war. Für eine liberale Partei nach 1945 wäre, laut Euler, eine in jeder Beziehung andere Ausgangslage vorhanden, die sich von der von vor 1933 dahingehend unterscheide, dass die kollektivistische Bedrohung von rechts zur Gänze wegfiele, denn, so führte Euler weiter aus, die nationalsozialistische Variante des Kollektivismus habe in der „größten Katastrophe Deutschlands [, dem Zweiten Weltkrieg,] ihr Ende gefunden“ und falle daher als Bedrohung künftig aus. Die aktuelle Gefahr bestünde durch die andere Form des Kollektivismus – die marxistisch-sozialistische! Diese bilde schon allein deshalb „eine größere Gefahr für die Wiederbegründung von Recht und Freiheit in Deutschland“, weil ihr nicht nur die Kräfte von Sozialdemokraten und Sozialisten zu wüchsen, sondern auch die der „christlichen Sozialisten“, d. h., einer „halb oder dreiviertel sozialistischen CDU“ [sic!]. Daher sei eine Neudefinition der politischen Begriffe „ ‚[r]echts’ und ‚links’ im neuen Sinne erforderlich“, denn es stünde außer Frage, dass die LiberalDemokratische Partei als die „entscheidende Gegnerin jeder Art von Kollektivismus und Sozialismus […] seit zwei Jahren im neuen Parteiensystem die Rechtspartei [sei]“. So ist nur allzu verständlich, dass der neue LDP-Vorsitzende verkündete: „[W]enn von manchen Seiten heute eine Rechtspartei gefordert wird, so läßt sich dem gegenüber nur sagen: Öffnen Sie die verschlafenen Augen, die Rechtspartei ist schon lange da.“ Die Gründungen weiterer „Rechtsparteien“, so Euler, würden lediglich die Kräfte zersplittern, die gebündelt in der LDP „ihre Hauptaufgabe darin sehen sollten, der […] von links ausgehenden Gefahr des Kollektivismus und des Zuchthausstaates zu begegnen“. Wer dennoch die Gründung weiterer Rechtsparteien forcierte, „stelle entweder den persönlichen Ehrgeiz über alles [oder aber er wolle im Grunde nichts anderes als] die Wiedererrichtung einer Partei des nationalsozialistischen Kollektivismus“. Diese aber dürfe es „in Deutschland nicht wieder geben“. Soweit Euler in dem besagten Artikel. Was war nun das wesentlich Neue in Eulers Aussagen? Denn auch die LDP der SBZ und Liberale in andern Teilen Deutschlands hatten festgestellt, dass liberale Parteien, die sich nicht allein auf DDP-Traditionen gründeten, schnell an den rechten Rand des neuen 45 Parteienspektrums gedrängt wurden. Neu war hauptsächlich wohl der Fakt, dass Euler diese Stellung als Rechtspartei im Gegensatz zu den meisten seiner Parteifreunde nicht nur nicht fürchtete, sondern guthieß und diese Etikettierung sogar noch vorantrieb. Seine Situationsanalyse, die darauf hinauslief, dass von einer liberalen Grundposition ausgehend, angesichts der Übermacht von Sozialdemokraten, Kommunisten und christlichen Sozialisten, einer dezidiert antisozialistischen Partei nur der Platz auf der rechten Seite des politischen Spektrums blieb, schien zumindest für Hessen durchaus richtig gewesen zu sein, was seine überaus guten Wahlergebnisse sowohl bei Landtags- als auch Bundestagswahlen beweisen. Jedoch zeigen sich an Eulers Beispiel auch die Grenzen einer solchen Rechtspartei. Zwar erreichte er für eine liberale Partei geradezu Schwindel erregend hohe Wahlergebnisse, sodass die Liberalen in Hessen zeitweise die zweitstärkste Partei waren und die CDU hinter sich ließen, aber sie blieben zugleich doch die Oppositionspartei. Während des gesamten Betrachtungszeitraumes vermochten es die Liberalen trotz hoher Wahlergebnisse, die mit 31,8 % bei der Landtagswahl 1950 ihren absoluten Höhepunkt erreichten, nicht, eine Regierungsbeteiligung zu erlangen. Der Preis für Eulers scharfen Rechtskurs war, dass die hessischen Liberalen trotz ihrer relativen Stärke ohne echte politische Gestaltungskraft blieben, da sich, zumindest auf Landesebene, kein Koalitionspartner auf sie einlassen wollte. Die neue Stärke konnte also kaum genutzt werden. Auch sollte beachtet werden, dass zwischen dem, was Euler forderte bzw. nach außen kommunizierte, und seinem tatsächlichen politischen Handeln deutliche Unterschiede feststellbar sind. Euler nutzte zwar Vokabular und z. T. auch Symbole der nationalen Rechten, um von dieser Seite möglichst viele Wähler binden zu können, jedoch vertrat er tatsächlich nie eine dementsprechende Politik. Während das deutsch-nationale Lager die deutsche Einheit, die Neutralität zwischen den Blöcken und vor allem die absolute nationale Souveränität einforderte, war Euler einer der ersten deutschen Politiker, der für einen Weststaat eintrat und damit den Osten Deutschlands verloren gab, die Westintegration einforderte sowie dem Gedanken einer Europäischen Union sehr offen gegenüber stand. Die rechte Ausrichtung, so lässt sich vermuten, war in Eulers Fall lediglich Mittel zum Zweck der Stimmengewinnung. Nach heutigen Maßstäben gemessen würde Euler wohl eher als Rechtspopulist einzuordnen sein, denn, wie z. T. behauptet, als überzeugter Rechter. Jedoch war Euler zum Zweck der Stimmenmaximierung stets bereit, mit politischen Gruppen zu kooperieren, die mit dem Liberalismus lediglich die antisozialistische Haltung gemein hatten. So ging Euler, um seine Partei in ländlich geprägten Wahlkreisen mehrheitsfähig zu machen, ein Bündnis mit Kurt Wittmer-Eigenbrodt, dem einflussreichen Präsidenten des 46 Hessischen Bauernverbandes ein95. Dass dieser Verband eher konservativ-national und agrarisch orientiert war, spielte für Euler keine Rolle, entscheidend waren lediglich die aus dieser Kooperation zu erwartenden Stimmengewinne.96 Fortan war Euler, der bis dahin nur wenig mit Agrarpolitik vertraut war, ein entschiedener Verteidiger der landwirtschaftlichen Interessen. 6.3. Die DVP unter Ernst Mayer Die DVP Württemberg-Badens betonte wie keine andere liberale Partei die demokratische, d. h. die linksliberale Tradition. Bereits auf der Kundgebung des 03.11.1945 betonte Haußmann, dass die neue Partei eben „keine Fusion der alten Demokraten und der alten Volkspartei“97 sei, sondern für die Fortsetzung der alten demokratischen Traditionslinie im Südwesten stehe. Da aber auch den traditionellen Liberalen in der DVP klar war, dass bei den anstehenden Wahlen die Wählersubstanz der ehemaligen DDP nur sehr schmal sein würde, betonte Haußmann noch in derselben Rede, dass man bereit sei „die Arme weit aufzumachen für alle, die auf dem Boden der Demokratie ehrlich mitarbeiten wollen“. 98 Diese Aussage ist jedoch mit einer gewissen Skepsis zu lesen, da die „großen Drei“ (Haußmann, Mayer und Maier) stets eine Konzeption der „reinen Lehre“ vertraten und u. a. sämtliche Versuche, eine bürgerliche Sammlungspartei zu errichten, unterbanden. Das Angebot der „weit geöffneten Arme“ ist daher mehr als Hommage an die Anhänger der Sammlungsidee in den eigenen Reihen, wie z. B. Theodor Heuss, zu verstehen, denn als ehrliches Kooperationsangebot. Die Konzeption der DVP-Führung sah nicht die Größe der linken Partei als das wichtigste und entscheidende Element, sondern ihre Schlüsselposition zwischen den Blöcken. Diese Mittelposition war von Haus aus nicht dazu geeignet, große Wählermassen anzuziehen oder gar zu binden. Natürlich erhoffte man sich, einen nicht geringen Teil der bürgerlich-demokratisch orientierten Wähler binden zu können, jedoch zeigt sich am folgenden Beispiel, das man dabei aber bestimmte Grenzen nicht bereit war zu überschreiten. 95 Vgl. Luckemayer, S. 166ff. Diese waren allerdings beachtlich, so gewannen die Liberalen 7 Direktmandate in überwiegend landwirtschaftlich geprägten Regionen und wurden mit 28,1 % der Stimmen hinter der SPD (32,1 %) zur zweitstärksten Partei. Euler selbst setzte sich mit 35,5 % der Stimmen in seinem Wahlkreis im Prestigeduell gegen den Spitzenkandidaten der CDU Hans Schlange-Schönigen (13,6 %) durch. Vgl. Luckemeyer S. 178ff. 97 Zitiert in: Hein, Milieupartei, S. 44. 98 Ebd. 96 47 Bereits am 20.08.1945 wandte sich Alfred Krämer an Reinhold Maier, mit dem er seit „Weimarer Zeiten“ bekannt war, mit der Idee einer neuen liberalen Partei. Krämer hatte bis 1933 für die DVP Weimars im Stuttgarter Gemeinderat gesessen. Er ließ Maier wissen, dass er (Krämer) mit einigen Anhängern der alten Volkspartei in Verbindung stehe und gemeinsam mit dem Stuttgarter Kreis um Haußmann eine gemeinsame, Rechts- und Linksliberale vereinende Partei gründen wolle. Es sollte auf diesem Wege „auf liberaler und demokratischer Grundlage unter einer entsprechenden Bezeichnung, die beide Gedankengänge zum Ausdruck [brächte], eine Einheit“99 erzeugt werden. Diese neue „Einheitspartei“ sollte auf bürgerlicher Seite ein gewisses Gegengewicht gegenüber der „Christlich-Sozialen Partei“ aufbauen. Krämer selbst traute ihr durchaus zu, die Mehrheit im bürgerlichen Lager zu erringen. Um die neue Partei weiter zu verstärken, regte Krämer an, auch „unbelasteten Volksgenossen“100, d. h. ehemaligen DNVP’lern den Zutritt/die Aufnahme nicht zu verwehren. Interessanterweise decken sich Krämers Vorschläge, besonders die liberale Vereinigung und der Parteiname, der beide Strömungen verdeutlichen sollte, mit den Konzepten der LDP der SBZ. Ob Krämer von dieser instrumentalisiert oder lediglich inspiriert worden war, lässt sich leider nicht feststellen. Auch dafür, ob Maier auf die Anschreiben Krämers reagierte, gibt es keine verlässlichen Quellen. Es kann jedoch angenommen werden, dass Maier Krämers Anfragen schlicht ignorierte. Auch nach der Gründung der DVP bemühte sich Krämer weiterhin, die Ausrichtung in Richtung seiner Idee zu beeinflussen. Da die Kontaktaufnahme über Maier augenscheinlich nicht funktioniert hatte, schrieb Krämer nun direkt an Haußmann. Er erklärte seine Bereitschaft, in die DVP einzutreten, unter der Bedingung, „dass meine Freunde bei Ihnen um Aufnahme nicht nach[zu]suchen haben, sondern als gleichberechtigt paritätisch eingeschaltet werden“101. Haußmann und der Stuttgarter Vorstand lehnten dies strikt ab. Warum der Kreis um Krämer letztlich weder eine rechtsliberale Parteiengründung in Erwägung zog, noch durch geschlossene Eintritte versuchten Einfluss auszuüben, kann nicht endgültig geklärt werden, Krämer selbst trat später tatsächlich der DVP bei, ohne jedoch seine Ideen weiterhin zu verfolgen. Hier wird deutlich, dass Haußmann, Mayer und Maier eher bereit waren, die ehemaligen DVP-Wähler „abwandern“ zu lassen, als eine „Verwässerung“ ihrer eigenen Grundkonzeption hinzunehmen. Die DVP-Spitze war bereit und willens, ihre Vorstellung von der Mittelpartei mit äußerster Hartnäckigkeit durchzusetzen. 99 Schreiben Krämer an Maier, zitiert in: Hein, Milieupartei, S. 45. Ebd. 101 Ebd. 100 48 Dennoch blieb diese Ausrichtung nicht unangefochten. Während es jedoch recht erfolgreich gelang, äußere Einflüsse abzuwehren, blieb eine weitaus gewichtigere Form der potenziellen Unterminierung des Konstrukts der Mittelpartei bestehen, nämlich die nach wie vor in der DVP vorhandene Anhängerschaft der Sammlungsidee. Prominentester Befürworter dieser Idee war Theodor Heuss. Er war zwar dem Ruf nach Stuttgart gefolgt, hatte aber seine Auffassung in Hinblick auf die bürgerliche Sammlung nicht aufgegeben. Noch Ende 1945 hielt er die „Taufrede“ für die Heilbronner Volkspartei102. Heuss musste sich darüber im Klaren sein, dass er sich damit in Opposition zu seinem Vorsitzenden Haußmann setzte. Der Wunsch nach dem Bürgerblock musste, auch angesichts der prominenten Unterstützung, so groß gewesen sein, dass weder Haußmann noch Maier ihn ignorieren konnten. Doch nicht nur die theoretischen Abweichungen von Heuss stellten den Führungsanspruch des Stuttgarter Kreises infrage. Mehr als die heuss’schen Gedankenspiele bedeutete die Existenz der nordwürttembergischen Volksparteien ein ständiges Ärgernis. Die Volksparteien aus Heidenheim, Heilbronn, Esslingen und Leonberg waren ein nicht zu vernachlässigendes Hindernis auf dem Weg zur Durchsetzung der Stuttgarter Konzeption. Darüber hinaus kam es u. a. zwischen Heidelberg und Stuttgart zu Differenzen, da Erstere den Führungsanspruch von Letzteren nicht akzeptieren wollten. Bei diesen Auseinandersetzungen spielten sowohl persönliche als auch politische Animositäten eine nicht unerhebliche Rolle. Diese Schwierigkeiten führten dazu, dass „sich [...] unter dem Druck dieser relativ breiten gegenläufigen Bewegung der Führungszirkel um Haußmann und Maier bereit finden [muss], für mehrere Monate eine zweigleisige Entwicklung der DVP [zu] akzeptieren: Einerseits kamen Gespräche mit der Christlich-Sozialen Partei über eine Zusammenarbeit in Gang, andererseits wurde die weitere Konsolidierung der Partei vorangetrieben“103. Über die Vorgehensweise Maiers und Haußmanns existieren unterschiedliche Berichte. Während Hein schreibt, die beiden „hatten zwar jede offene Stellungnahme gegen eine Fusion vermieden, konkrete Vereinbarungen jedoch zu verhindern gewusst“104, also eher indirekt gewirkt, zitiert Wieck den Zeitzeugen Staatssekretär a. D. Paul Binder: „Wie mir im Sommer 1947 der damalige Kultminister und jetzige Bundespräsident, Herr Dr. Th. Heuss, mitteilte, ist die Verschmelzung der demokratischen Kreise mit der CDU in Stuttgart lediglich an dem Einspruch des damaligen Ministerpräsidenten, Dr. Reinhold Maier, gescheitert.“105 Im Gegensatz zu Hein geht Wieck deshalb von einer deutlich aktiveren Rolle der Stuttgarter Führung aus. Diesen Punkt unterstreicht auch Willy Dürr mit seiner Aussage: „Leider hat sich 102 Vgl. Wieck, Christliche und Freie Demokraten, S. 150f. Ebd., S. 151f. 104 Hein, Milieupartei, S. 53. 105 Wieck, Christliche und Freie Demokraten, S. 150. 103 49 das Heilbronner Experiment in Stuttgart nicht verwirklicht. Die dortigen Liberalen Maier und Haußmann und die Volksdienstler wünschten diese Einigung auch gar nicht.“106 Dass zwischen ehemaligen Volksdienstlern und Liberalen eine tiefe gegenseitige Ablehnung bestand, lässt sich mit mehreren Quellen belegen. So erklärt die Göppinger Resolution der ExVolksdienstler vom 01.10.1945, „... eine Verschmelzung der Christlich-Sozialen Volkspartei mit der [...] Demokratischen Volkspartei wird grundsätzlich abgelehnt, weil wir in der DVP ein Wiederaufleben der früheren Nationalliberalen Partei erblicken müssen, deren Weltanschauung und politische Tendenzen zu einer Verwässerung unserer politischen Grundsätze führen müssten“107. Während also vielen ehemaligen Zentrumspolitikern beispielsweise in Berlin bei der Gründung der CDU Bedenken kamen, dass in der Union liberal-protestantische Elemente obsiegen und den christlichen Grundgedanken überlagern könnten, zeigte sich, dass diese Vorbehalte zumindest gegenüber den Volksdienstlern Württembergs und Badens haltlos waren. Die Politiker, Mitglieder und Anhänger des ehemaligen CSVDs standen „dem Liberalismus in seiner Gesamtheit noch ablehnender als die Katholiken“108 gegenüber. Bereits im Sommer 1945 hatten die Wortführer des Ex-CDVDs ihre Bereitschaft zur Gründung einer interkonfessionellen Partei signalisiert, „zur Bedingung machten die Volksdienstler allerdings, dass die Liberalen [...] nicht zum dritten Partner werden dürften“109. Dass es zu Beginn des Jahres 1946 dennoch zu Kooperationsgesprächen mit den Liberalen kam, lag an dreierlei Gründen. Zum einen erschien vielen Christdemokraten die Basis des Volksdienstes allein als zu schmal, um dauerhaft auch protestantische Kreise gewinnen zu können. Zum Zweiten wollte man so einer Gefahr vorbeugen, die Willy Dürr wie folgt beschreibt: „Dr. Heuss versuchte mit der Heilbronner Volkspartei auch auf Landesebene eine ähnliche Sammlung, deren Sinn die Ausschaltung einer konfessionellen Partei war, voranzutreiben.“110 Dies kam also auch der Absicht vieler christlich-demokratischer Politiker und Gründer entgegen, war doch die Bewahrung ihrer christlichen Grundsätze in diesem Parteienmodell keinesfalls sicher. Zum Dritten wollten sowohl Befürworter als auch Gegner einer Fusion den Gesprächen endlich die von ihnen jeweils gewünschte Richtung geben und sie zum Abschluss bringen. Die endgültigen Kooperationsgespräche wurden am 12.01.1946 in Stuttgart geführt und waren entsprechend prominent besetzt. Für die DVP saßen u. a. Heuss, Mayer und 106 Ebd., S. 151. Ebd., S. 145. 108 Ebd. 109 Ebd., S. 146. 110 Ebd., S. 150. 107 50 Haußmann, für die Union (in Württemberg-Baden CSVP) Andre und der Vorsitzende der CDU der SBZ Andreas Hermes am Verhandlungstisch. Bei dieser Gesprächsrunde zeigten sich erneut unterschiedliche Zielsetzungen bei der DVP und daher auch verschiedene Verhandlungstaktiken. So war besonders Heuss „bestrebt, das Gespräch gar nicht erst in eine kontroverse Diskussion von Grundsatzfragen abgleiten zu lassen, sondern die Fusionsfrage zunächst offen zu halten und sie über eine sich allmählich intensivierende Zusammenarbeit [...] zu einer positiven Beantwortung zu führen.“111 Dass sich das Gespräch genau in die entgegengesetzte Richtung entwickelte, lag am Vertreter der „Reichsparteileitung“ der CDU und am Landesvorsitzenden der DVP sowie deren Generalsekretär. „Hermes auf der einen sowie Haußmann und Mayer auf der anderen Seite [hatten dem Gespräch] bewusst diese [negative] Wendung gegeben“112, denn kurz nachdem beide Seiten die „prinzipielle Bereitschaft zur Billigung einer demokratischen Einheitspartei“113 bekräftigt hatten, wurde nicht mehr über Zwischenschritte und eventuelle Kompromisse gesprochen, sondern einzig und allein über den Weg zum Zusammenschluss gestritten. Während Hermes erklärte, eine Fusion von CSVP und DVP wäre nur unter dem Dach der „Reichs-CDU“ möglich, was den Beitritt beider zu dieser und die Unterordnung unter die Berliner Zentrale zur Folge gehabt hätte, sah Mayers Taktik vor, die regionalen Besonderheiten zu betonen und deshalb auf regionale Vereinbarungen bzw. Verhandlungen zwischen den beiden Parteien als einzig möglichen Weg zu bestehen. „Damit stellten sie [Mayer und Haußmann] die CSVP praktisch vor die Alternative, sich entweder für den letztlich höchst unsicheren Weg einer Offenhaltung der Fusionsfrage oder aber für die Zusammenarbeit mit den anderen Unionsparteien [...] zu entscheiden.“114 Die Debatte wurde mit solcher Heftigkeit geführt, dass Mayer am 17.01.1946 notierte: „[D]ie Verhandlungen [sind] praktisch und zwar im negativen Sinne abgeschlossen.“115 Dennoch scheint es noch gewisse Überlegungen, zumindest in der Union, in Richtung einer „großen Lösung“, d. h. über den Zusammenschluss mit den Liberalen, gegeben zu haben, jedoch obsiegte ab Frühjahr 1946 das Prinzip über die Taktik. Wieck beschreibt die Überlegungen der christlichen Demokraten sicherlich sehr exakt, denn er notiert: „Ihr Zusammenschluss mit den Liberalen hätte der neuen interkonfessionellen Partei sicher eine sehr viel breitere Basis gegeben, sie wären aber gezwungen gewesen, der Forderung der Gruppe um Haußmann nachzugeben, die das Wort ,christlich’ im Parteinamen aufzunehmen 111 Hein, Milieupartei, S. 54. Ebd. 113 Ebd. 114 Ebd. 115 Aktennotiz von Mayer, zitiert in Hein, Milieupartei, S. 54. 112 51 nicht bereit war, so wie in Schul- und Kulturfragen [...] Kompromisse zu schließen. Die Vereinigung mit den Volksdienstlern brachte ihnen dagegen sehr viel weniger Anhänger ein, diese wenigen verfochten jedoch politische Grundsätze, die den ihren sehr nahe waren.“116 Auch hier zeigt sich eine gewisse Differenz in der Literatur. Während Hein die gescheiterten Kooperationsverhandlungen als Hauptgrund für das Ende des Parteienmodells à la Heilbronn sieht, geht Wieck von den oben genannten Überlegungen in Unionskreisen sowie einer paritätischen Schuld der „Stuttgarter“ und der Volksdienstler aus: „Der Heilbronner Versuch [..] scheiterte also an den Stuttgarter Liberalen, [...] er scheiterte aber auch ebenso sehr an den ehemaligen Volksdienstlern, denen der Liberalismus der politische Feind war und blieb.“117 Wieck führt als Zeitzeugen einen Mitbegründer der CDU Stuttgarts, Johannes Gross, auf: „Wir haben 1945 die Chance, mit den ,liberalen’ Protestanten oder den Korntalern 118 (?) zusammenzugehen. Da wir uns für die letztere Lösung entschieden hatten, ist die CDU in Württemberg kleiner geblieben.“119 Der heftigste Widerstand gegen die Stuttgarter Dominanz gab es in Heidelberg. Nach dem Weggang von Theodor Heuss war hier das Projekt „bürgerliche Sammlung“ sehr bald beendet worden. Unter der Führung von Karl Grathwohl begannen linksliberal orientierte Kreise mit der Wiedereinrichtung der alten „Demokratischen Partei“ (DP), die sie am 06.11.1945 mit der Wiedergründung auch abschlossen. „Obwohl diese Entwicklung [...] ganz im Sinne der Stuttgarter Parteiführung um Haußmann liegen musste, blieben die Beziehungen zwischen Heidelberg und Stuttgart gespannt.“120 Grathwohl und seine Gruppe sahen in der Christdemokratie, wie auch viele andere Stuttgarter Liberale, nichts anderes, als die Fortsetzung des Zentrums unter neuem Namen. Aus diesem Grunde und der bekannten Feindschaft vieler Liberaler zum politischen Katholizismus lehnten sie auch jedwede Kooperation mit den Christdemokraten ab. Diese Ablehnung bezog sich jedoch auch auf jene liberalen Kreise, die, wie Heuss, eine solche Zusammenarbeit nicht ablehnten. Hieraus und aus den alten landsmannschaftlichen Ressentiments der Badener gegenüber den Württembergern speiste sich der Argwohn, den die Gruppe um Grathwohl den Stuttgartern entgegenbrachte. Die Anwesenheit von Theodor Heuss in Stuttgart und dessen exponierte Stellung waren Grund genug, der DVP vorzuwerfen, heimlich die Fusion mit den Christdemokraten zu forcieren. 116 Wieck, Christliche und Freie Demokraten, S. 155. Ebd., S. 151. 118 Gemeint sind die Volksdienstler, deren Hochburg in Württemberg in der Gemeinde von Korntal lag. 119 Wieck, Christliche und Freie Demokraten, S. 156. 120 Hein, Milieupartei, S. 52. 117 52 Diese Spannungen hielten noch bis ins Jahr 1946 hinein, also auch nach der Konstituierung der Landespartei, an. So weigerte sich die DP kategorisch, den Namen des Landesverbandes anzunehmen, da dieser dem der Stuttgarter entsprach. Erst als Ernst Mayer seinen Heidelberger Parteifreunden androhte, die DP, „als nur örtlich zugelassen, von der amerikanischen Militärregierung verbieten zu lassen und [eine] neue Ortsgruppe zu gründen“121, lenkte diese ein. Im Konflikt mit anderen liberalen Gruppen hatte es sich für die Stuttgarter bezahlt gemacht, dass sie bereits früh, am 14.01.1945, die landesweite Zulassung erlangt hatten. So konnten sie am traditionsreichen Dreikönigstag am 06.01.1946 zur konstituierenden Landesversammlung nach Stuttgart einladen. Dies wiederum konnte als vollständiger Erfolg gewertet werden, zum Ersten, weil alle liberalen Gruppen Vertreter entsandten, zum Zweiten, weil der Name DVP auch für die Landespartei übernommen wurde, und zum Dritten, weil es gelang, im Landesvorstand ein „eindeutiges Übergewicht für die Befürworter des von Haußmann eingeschlagenen Kurses sicherzustellen“122. So wurde Haußmann selbst erster DVPLandesvorsitzender, Mayer Generalsekretär und Karl Beacher zum Schatzmeister gewählt. Von nun an, da die Stuttgarter den Landesvorstand dominierten, konnten „Abweichler“, wie das Beispiel Heidelberg zeigte, relativ schnell zur Raison gebracht werden. Fakt ist jedoch, dass keine der kleinen Sammlungsparteien die erste Jahreshälfte 1946 überlebte, sie wurden entweder von der Union oder der DVP aufgesogen. Die Konsolidierung und Stabilisierung der DVP ging vor allem deshalb so zügig voran, weil ab März 1946 alle divergierenden Richtungen innerhalb der Partei beseitigt bzw. „auf Linie“ gebracht worden waren. 7. Stuttgart oder Berlin? – Die Auseinandersetzungen zwischen DVP und LDP(D) am Beispiel der Gründung der amerikanischen Zonenpartei – Die Versuche von Külz, den Einheitskurs zu halten, zwangen ihn zu widersprüchlichem Handeln, da er einerseits die SMAD zufrieden stellen musste, anderseits gleichzeitig die Westalliierten und seine eigenen Parteifreunde in deren Zonen nicht verprellen durfte. So erklärte er auf dem Parteitag der LDP in Eisenach „Die Frage nach westlicher oder östlicher Orientierung gibt es für uns nicht, wir kennen nur eine Orientierung, die heißt schlicht und 121 122 Ebd. Wieck, Christliche und Freie Demokraten, S. 157. 53 zwingend: Deutschland.“123, um dies zu erreichen musste Külz jedoch Zugeständnisse an die SED und die SMAD machen. Dies „trug ihm im Westen das Etikett des Russen- oder Kommunistenfreundes ein [und] bewirkte ein in den Jahren 1946 und 1947 ständig steigendes Misstrauen [ihm] gegenüber“124. Dennoch war Külz Ende 1945 bis weit in das Jahr 1947 hinein die unumstrittene Führungspersönlichkeit der Liberalen und besaß mit seiner LDP(D) die Führungsrolle innerhalb der liberalen Schwesterparteien. Dessen ungeachtet waren bereits die ersten Monate von Auseinandersetzungen um diese Führungsrolle geprägt. Hierbei zeigte sich die besondere Fähigkeit Külz’, sein Vorgehen stets den veränderten Gegebenheiten anzupassen und durch diese Geschmeidigkeit den Abläufen seinen Stempel aufzudrücken. Den Gründungen liberaler Parteien in den Westzonen stand man in der LDP(D)-Führung gelassen gegenüber, auch wenn diese meist keiner direkten Einflussnahme aus Berlin unterlagen. Zum einen erschien fraglich, ob diese lokalen bzw. regionalen Parteien je fähig sein würden, die Berliner Führungsposition herauszufordern. Auch gab es keine Anzeichen nach derartigen Bestrebungen. Schließlich hatte es bereits in der SBZ von Berlin unabhängige Gründungen gegeben, ohne dass diese für den Koch-Külz-Kreis zur Opposition erwachsen wären. Dass ab Anfang 1946 dennoch eine Änderung der ursprünglichen Konzeption erfolgte, lag an den z. B. bei der Errichtung des britischen Zonenverbandes deutlich werdenden Aversionen gegen den Zentralismusgedanken der Berliner Führung. Die Reserviertheit der westdeutschen Liberalen zeigte sich offen bei der Delegiertenversammlung der LDP im Februar 1946 in Weimar, an der sie einfach nicht teilnahmen. Infolge dessen korrigierte Külz die bisher übliche Vorgehensweise und nahm von einem Versuch der Unterwerfung und Eingliederung der FDP Abstand, da diesem Unternehmen augenscheinlich nur wenig Erfolg beschieden sein würde. Die neue Strategie sah nunmehr vor, die Unabhängigkeit der Schwesterparteien zu respektieren, ohne dabei allerdings den Berliner Führungsanspruch gänzlich aufzugeben. Külz’ Idee, die er u. a. den Liberalen der US-Zone am 24.03.1946 in Frankfurt am Main unterbreitete, sah vor, dass sich zuerst innerhalb der Zonen liberale Arbeitsgemeinschaften nach Vorbild der LDP (SBZ) und der FDP (britische Zone) bilden sollten. Diese Zonenverbände sollten dann „ihrerseits 123 124 Rütten, Liberalismus, S. 48. Ebd., S. 49. in Arbeitsgemeinschaft mit der Liberal- 54 Demokratischen-Partei Deutschlands“125 treten. Die Frankfurter Zonentagung sollte, so die Hoffnung von Külz, diesen Vorschlag billigen und somit in den beabsichtigten Einigungskurs eingebunden werden. Die Erfolgsaussichten waren nicht schlecht, zumal die hessische LDP ausdrücklich im „Auftrag der Reichsparteileitung“126 eingeladen hatte und Külz selbst zusammen mit seinem Stellvertreter Arthur Lieutenant extra aus Berlin angereist war, um gegebenenfalls sofort persönlich intervenieren zu können. Als sein Gegenspieler trat einmal mehr Ernst Mayer, der Generalsekretär der DVP, auf, der mit der Maßgabe seines Vorstands angereist war, entschiedenen Widerstand gegen jedwede Kooperationsvorschläge zu leisteten und maximal einem Zonenverband die Bewilligung zu erteilen. Mayer lehnte jeglichen Führungsanspruch der LDP(D) kategorisch ab und bestand u. a. auf der Formulierung, dass die Partner in „Arbeitsgemeinschaft mit den liberaldemokratischen und freien demokratischen Parteien Deutschlands“127 treten würden, um damit eine Parität der Zonenverbände zu erreichen. Auf diesem Wege sollte eine Dominanz der LDP(D) verhindert werden. Letztlich folgten die bayerischen und hessischen Liberalen zwar den Empfehlungen von Külz, eine Zonenpartei zu gründen, bei der Vorbereitung der Konstituierung aber folgte man den Vorstellungen Mayers. Am Ende der Tagung wurde also lediglich der Beschluss gefasst, einen Zonenverband zu gründen. Über die von Külz angeregte deutschlandweite Arbeitsgemeinschaft konnte keine Einigung erzielt werden. Auch die Errichtung des Zonenverbandes musste der Vorsitzende der LDP der SBZ eher als Rück- den als Fortschritt interpretieren, denn nicht nur, dass Stuttgart als „Vorort“ des Verbandes benannt wurde, noch schwerer wog der Umstand, dass ausgerechnet Ernst Mayer die Federführung übertragen wurde. Dies bedeutete, dass die DVP alle Chancen erhielt, den neu zugründenden Zonenverband ihren Stempel aufzudrücken. Deshalb stellte Mayer durchaus treffend fest, dass Külz „mit seinem Erfolg recht wenig zufrieden“128 gewesen war. Auf der Tagung in Frankfurt war der Gegensatz zwischen Stuttgart und Berlin, der die folgenden zwei Jahre maßgeblich bestimmen sollte, erstmals offen zutage getreten. Wieso aber stellten sich die Stuttgarter so massiv gegen alle Berliner Bemühungen? 125 Hein, Milieupartei, S. 265. Vgl. Wieck, Christliche und Freie Demokraten, S. 201 ff; Hoffmann, S. 91 ff; Hein, Milieupartei, S. 265. 127 Ebd. 128 Ebd. 126 55 War es, wie Gutscher schreibt, nur die berechtigte Sorge der DVP-Führung, unter den Einfluss der Sowjets zu geraten bzw. befürchtete man eine undemokratische Entwicklung, wenn zügig eine Reichspartei errichtet würde? Laut Gutscher widersetzten die Südwest-Liberalen „sich von Anfang an den Külzschen Versuchen, eine Berliner zentrale Parteileitung durchzusetzen. [Da sie] argwöhnte[n] – wie die weiteren Ereignisse wohl zu Recht erwiesen – daß dahinter die Führungsabsichten der Ost-LDP stehen könnten.“129 Dass dies gleichbedeutend mit der Unterwerfung unter die Sowjets sein müsste, wird damit begründet, dass „bekannt war, dass der Ost-LDP-Vorsitzende Külz schon mehrfach kommunistischem Druck erlegen war“130, somit die Handlungsfreiheit einer liberalen Rechtspartei mit Sitz in Berlin nicht gegeben sei. Ein eigener Führungsanspruch der DVP als Grund scheidet laut Gutscher aus, denn er führt aus: „Schärfster Gegner derartiger Ambitionen [gemeint ist der Führungsanspruch der Berliner] waren die Stuttgarter Demokraten, denen es nicht um den Ausbau regionaler oder persönlicher Machtpositionen, sonder allein um den ‚ruhigen, sachlichen Aufbau’ einer liberalen Parteiorganisation ging, der von ‚unten’ und nicht durch Erlaß von ‚oben’ her erfolgen sollte.“131 Dass man keinesfalls überregionale Zusammenschlüsse verhindern wollte, „das brachte der Stuttgarter Vereinigungsparteitag vom September 1946 deutlich zum Ausdruck“132, so Gutscher. Ähnlich argumentiert auch Wieck, der die Vorwürfe vieler Zeitgenossen zu relativieren versucht, wenn er schreibt: „Es ging in diesen Auseinandersetzungen [...] keineswegs um irgendeinen regional bedingten Egoismus und auch nicht um persönliche Machtkämpfe, sondern die westdeutschen Gruppen wurden in ihrer Haltung durch die klare Erkenntnis bestimmt, dass die Parteien [in der SBZ] nicht frei in ihren Entschließungen waren und es in der Zukunft immer weniger sein würden.“133 Gänzlich anders analysiert Krippendorff, für den das Verhalten der Südwest-Liberalen das Ergebnis aus sich vermischenden „traditionell Berlin-feindliche[n] und aktuell-politische[n] Motiven“134 ist. Auch Hein führt das Argument über die eingeschränkte Freiheit der LDP der SBZ an, jedoch lediglich als Teilmotiv. Danach empfanden es die DVP-Politiker als unerträglich, politische „Arbeit beeinflussen zu lassen von Parolen, wie sie Külz ausgibt, vielleicht ausgeben muß“135. Ernst Mayer erklärte gar, dass „in dieser Zone [SBZ] keinerlei 129 Gutscher, S. 26. Ebd. 131 Ebd. 132 Ebd. 133 Wieck, Christliche und Freie Demokraten, S. 203. 134 Krippendorff, S. 141. 135 Schreiben von Theodor Heuss an Thomas Dehler, zitiert in Hein, Milieupartei, S. 266. 130 56 Freiheit“136 existiere, weshalb Widerstand nötig sei. Als den wichtigeren Aspekt sieht Hein aber den eigenen Führungsanspruch der DVP, denn „die Propagierung ‚eines organischen Wachstums von unten nach oben’ hatte mithin nicht zuletzt die Aufgabe, den eigenen organisatorischen Vorsprung zu sichern und einer führenden Rolle der DVP in einer zukünftigen deutschen liberalen Partei den Weg zu bereiten.“137 Mögliche Gründe für das Handeln der Stuttgarter benennt auch Rütten, verzichtet jedoch darauf, diese zu belegen oder zu entkräften. Er stellt lediglich fest: „Ob hinter der Politik der DVP die nicht unberechtigte Sorge stand, als Teil einer liberalen gesamtdeutschen Partei unter der Führung von Külz mitverantwortlich zu werden an Verletzungen von Menschenrechten in der SBZ, ob den Schwaben die Freiheit des Unternehmers zu lieb war, um eine gesellschaftspolitische, risikoreiche, offensive Deutschlandpolitik zusammen mit Külz zu betreiben, ob in der DVP nicht an die Möglichkeit geglaubt wurde, daß das geeinte Deutschland existieren könne, ohne in den sowjetischen Machtbereich integriert zu werden, diese Fragen werden erst in Zukunft geklärt werden können.“138 Endgültig fest stünden, so Rütten, nur folgende Fakten: Erstens, „daß zur Jahreswende 1946/47 der Führungsanspruch von Külz innerhalb des deutschen Liberalismus fast unumstritten war“139; dass aber zweitens „die, was Organisationsgrad und Wählerzuspruch anging, zweitstärkste Gruppe der Liberalen, nämlich die Demokratische Volkspartei Württemberg-Badens […] offensichtlich schon im Verlaufe des Jahres 1946 Widerstand gegen die Politik von Külz [leistete]“140; und drittens, dass dieser Widerstand „schon im Spätsommer 1946 zum regelrechten Kampf gegen die Vorherrschaft der LDP in der liberalen Gesamtpartei führte“141. Welche Argumente waren nun die ausschlaggebenden? Fest steht, dass Ernst Mayer, bevor er DVP-Generalsekretär wurde und in seine schwäbische Heimat zurückkehrte, die identische Funktion in der LDP Sachsens ausübte, er also die politischen Gegebenheiten der SBZ aus eigenen Erfahrungen heraus kannte. Dies sprach er auch häufig selbst an: „Persönlich ist meine Einstellung gegen den Osten bekannt und die Ablehnung der Berliner Bestrebungen. Sie erfolgte vielleicht schärfer, weil ich die Verhältnisse selbst kenn, unter denen die Freunde dort leben müssen.“142 Die persönlichen 136 Vgl. Wieck, Christliche und Freie Demokraten, S. 201 ff; Hoffmann, S. 91 ff; Hein, Milieupartei, S. 266. Hein, Milieupartei, S. 267. 138 Rütten, Liberalismus, S. 53. 139 Ebd., S. 50. 140 Ebd., S. 51. 141 Ebd. 142 Mayer auf der Zonenkonferenz am 31.08.1946, zitiert in Hein, Milieupartei, S. 266. 137 57 Erfahrungen ihres Generalsekretärs können und werden innerhalb der DVP eine gewisse Rolle gespielt haben. Jedoch muss einschränkend erwähnt werden, dass Mayer die SBZ bereits zum Jahreswechsel 1945/46 verlassen hatte, also nur eine relativ kurze Zeit dort politisch tätig gewesen war. Auch gilt es zu beachten, dass die Monate seiner Anwesenheit alle in den Zeitraum der Aufbauphase der LDP fielen und die Parteianfänge auch in den westlichen Zonen von starker Überwachung und Reglementierung seitens der Besatzungsmacht geprägt waren. Das Motiv des Antisowjetismus lässt sich ebenfalls nachweisen. So ist in den Aufzeichnungen Reinhold Maiers vom Mai 1945 folgende Grundüberlegung zu finden: „Es [ist] für die Zukunft entscheidend […], ob die Amerikaner in Deutschland bleiben. Wenn nicht, so kommt mit Allgewalt die neue Diktatur der östlichen Welt. Deutschland ist übergefährdet.“143 Aus dieser Sicht erscheint der als sowjet-freundlich geltende Külz dieser Gefährdung als geradezu ignorant gegenüberzustehen, somit als jemand, der die Gesamtpartei, die Zone und das gesamte Land in fahrlässiger Weise der Gnade der Sowjets ausliefern würde. Auch hierzu sollten folgende Fakten bedacht werden: Zum einen war die Furcht vor den Sowjets keine schwäbische Eigenart, da viele Liberale diese – Zonen übergreifend – teilten. Zum anderen konnten wohl selbst die Beteiligten schwerlich politische Prognosen wagen, die weiter als einige Monate in die Zukunft wiesen, allein schon deshalb, weil die meisten Deutschland betreffenden Entscheidungen von den Siegermächten und nicht von deutschen Politikern oder Parteien getroffen wurden. Die oft behauptete Sowjet-Hörigkeit von Külz, die aus einigen Entscheidungen der LDP, wie z. B. deren Zustimmung zu Enteignungen in der SBZ, abgeleitet wurde, ließ sich letztlich, dies durfte auch den Beobachtern aus Württemberg-Baden bekannt gewesen sein, nicht auf die innere Überzeugung der Ost-Liberalen zurückführen, sondern auf den Willen der Besatzungsmacht. Hieraus ergibt sich, dass dieser Vorwurf ein nicht widerlegbares Faktum vernachlässigt, nämlich das der eingeschränkten Freiheit der politischen Entscheidung. Doch wie bereits im entsprechenden Kapital erwähnt, hoffte Külz ja gerade, diese durch seine gesamtdeutschen Bemühungen nach und nach zurückzugewinnen. Zudem galt, wie bereits erwähnt, dass in sämtlichen Zonen die politische Handlungsfreiheit zumindest zwischen 1945 und 1946 noch stark eingeschränkt war und es zum Teil auch noch lange blieb. Auch für das Motiv der traditionellen Haltung lassen sich zahlreiche Belege finden. So sprach Reinhold Maier auf einer DVP-Kundgebung im Juni 1946 aus, was viele seiner Landsleute dachten, als er erklärte: „Berlin war immer ein ungeeignetes Pflaster für Demokratie.“144 Die 143 144 Maier, Ende und Wende, S. 256. Zitiert in Hein, Milieupartei, S. 267. 58 „Demokratie Berliner Prägung“ – Maier bezeichnete sie als „Asphaltdemokratie“ – „war für die bei uns beheimatete bodenständige Demokratie, einer Demokratie in einem lebenstüchtigen, aber besinnlichen Volk, ein Schaden, eine Bedrohung, ein Hindernis.“145 Hieraus schlussfolgerte Maier, dass „die Regeneration des deutschen Parteiwesens […] nicht von Berlin aus erfolgen [darf],“ denn „hier liegt im Südwesten die überlegene Begabung. Von unserem Lande muß die deutsche Demokratie […] neu geboren werden.“146 Diese feindselige Haltung gegenüber Berlin wurde sowohl bedingt durch die traditionelle antipreußische Haltung der Südwest-Liberalen als auch durch ihr föderalistisches Streben, das den Berliner Überlegungen zum Einheitsstaat – wenn auch in dezentraler Form – diametral entgegen stand. Dass die föderalistischen Bestrebungen in der DVP gelegentlich ausuferten, legt eine Rede von Theodor Heuss nahe, in der er zum Thema Föderalismus ausführt: „[D]aran [am Föderalismus] werden wir festhalten; aber nicht um schwäbische Partikularisten zu werden, eine Gefahr, in der wir heute stehen.“147 Als Auftakt für die Auseinandersetzungen zwischen LDP(D) und DVP muss der Parteitag der FDP der britischen Zone in Bad Pyrmont am 19.05.1946 gesehen werden. Während die LDP(D) mit ihren Spitzenvertretern, d. h. Külz und weiteren Vorstandsmitgliedern, vertreten war, fehlten die DVP-Vertreter. Das Fernbleiben wurde mit unaufschiebbaren Wahlkampfverpflichtungen begründet. Festgehalten werden sollte auf jeden Fall, dass die DVP zu Anfang ihre organisatorische Stärke kaum nutzte, um Parteigründungen in den benachbarten Ländern anzuregen bzw. in ihrem Sinne zu beeinflussen. Geschah dies – wie z. B. in Marburg – dennoch, so lag dieser Handlung keine Parteistrategie zugrunde, sondern war lediglich auf persönliche Kontakte zurückzuführen, folgte also keiner Strategie. Exemplarisch hierfür ist auch die Haltung der DVP gegenüber den bayerischen Liberalen. Hein bemerkt hierzu, dass die DVP „aus einer Art selbstgewählter Isolation heraus […] die Gelegenheit versäumte, Einfluß auf die Partei des Nachbarlands zu gewinnen“148. Diese Verhaltensweise der Südwest-Liberalen führte dazu, dass ihnen – nicht völlig zu unrecht – über den gesamten Betrachtungszeitraum hinweg immer wieder der Vorwurf des Egoismus und der Rücksichtslosigkeit gegenüber den Liberalen der andern Länder gemacht wurde. Dennoch sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die LDP(D), die eine gänzlich andere Politik praktizierte und daher bereits sehr früh ihre Emissäre von Berlin aus in die Länder sandte, nur 145 Ebd. Ebd. 147 Zitiert in Hein, Milieupartei, S. 268. 148 Ebd., S. 71. 146 59 wenige Erfolge erringen konnte. Zwar wurden zahlreiche Initiativen angeregt, jedoch gelang es nur selten, direkten Einfluss zu gewinnen. Als Ausnahmen können hierbei die LDP Hessens und Teile der bayerischen Gründungen (besonders im Raum München) gesehen werden. Die Zurückhaltung der DVP-Führung in diesem Fall muss wohl als ein Zeichen des Vertrauens auf die eigene Stärke gewertet werden. Angesichts der eigenen strukturellen und organisatorischen Stärke glaubte man, keine Bündnisse eingehen zu müssen. Nur gelegentlich, wenn es galt Berliner Vorstöße abzuwehren, war die DVP zu einem kurzfristigen Engagement über die württemberg-badischen Landesgrenzen hinaus bereit. Die Parteiführung beabsichtigte, „die Partei nicht mehr als tragbar zu binden“149. Gleichzeitig sei jedoch „die Führung mit den befreundeten Parteien zu halten“, um „sie nicht noch mehr dem Einfluss der russischen Zone preiszugeben.“150 Das Fernbleiben der Stuttgarter verstand Külz zu nutzen, indem er in Bad Pyrmont die bisherige Linie der LDP(D) verließ. Diese hatte bis zum 19.05.1946 gelautet: Eine Reichspartei ist nicht zu gründen, da sie bereits in Form der LDP(D) besteht. Die einzelnen Landesverbände haben sich zum Wohl aller Liberalen dieser Reichspartei anzuschließen, d. h. beizutreten und unterzuordnen, d. h. die Berliner Vormachtstellung anzuerkennen. In Pyrmont aber trug Külz den unterschiedlichen Zonenentwicklungen Rechnung und akzeptierte die anderen liberalen Zonenparteien als gleichwertige Partner. Auf Basis der Zonenverbände sollte ein gemeinsamer Koordinierungsausschuss gebildet und so die Fusion zu einer gemeinsamen, gesamtdeutschen Partei vorbereitet werden. Die Vertreter in der SBZ, der britischen Zone sowie die Delegierten der hessischen LDP und der bayerischen FDP fassten hierzu den Beschluss, „sich zu einer demokratischen Partei für ganz Deutschland zusammenzuschließen“151. Külz hatte zwar den Führungsanspruch der LDP[D] preisgeben müssen, war aber einer isolierten, rein westdeutschen Gründung zuvorgekommen und hatte die Zonen-FDP auf seine Seite gebracht. Sehr verärgert reagierten die Führer der DVP auf diese neuen Entwicklungen. Ernst Mayer sprach den Delegierten von Bad Pyrmont gar jegliches „Recht, […] solche Fusionsbeschlüsse zu fassen“152, ab. Die Absage der DVP an jegliche Fusionsbestrebung begründete ihr Generalsekretär damit, dass „die Zeit für eine Reichspartei […] noch nicht gekommen“ 153 sei. Außerdem solle „keiner demokratischen Partei in einer anderen Zone zugemutet werden, auch 149 Aktennotiz von Ernst Mayer, zitiert in: Krippendorff, S. 162. Ebd. 151 Wortlaut der Resolution, zitiert in: Hein, Milieupartei, S. 282. 152 Schreiben Mayers an die Vorsitzenden der FDP, LDP(D), zitiert in: Hein, Milieupartei, S. 283. 153 Ebd. 150 60 nur stillzuschweigen, von einer Billigung gar nicht zu reden, zu dem Weg, den die LiberalDemokratische Partei der Ostzone […] gehen [muss]“154. Intern bezeichnete Mayer den Verzicht auf die Entsendung einer DVP-Delegation nach Bad Pyrmont nachträglich als „verhängnisvoll“, da nunmehr die Gefahr bestand „von Berlin aus überrundet“155 zu werden. Durch die Vereinbarungen von Bad Pyrmont sah sich die DVP nun ihrerseits zu einem Strategiewechsel gezwungen. Der bisherige Isolationskurs ließ sich nicht länger durchhalten. So gut die DVP auch im Südwesten aufgestellt sein mochte, einem Bündnis aus FDP und LDP(D) würde sie über kurz oder lang unterliegen müssen, erst recht, wenn sich die LDP Hessens und die FDP Bayerns dem Zonenbündnis anschließen sollten. Dem wollten die Stuttgarter „dadurch begegnen, daß sie sich selbst im Rahmen ihrer Zone aktiv in die Kooperationsmöglichkeiten einschalteten. [Ziel war es,] dem Berliner Führungsanspruch in einem Zonenverband ein unüberwindliches Hindernis entgegenzusetzen.“156 So kam es nach den oben genannten Ereignissen in Frankfurt zu intensiven Bemühungen seitens der DVP, einen amerikanischen Zonenverband zu gründen. Die in Frankfurt gefassten Entschlüsse hatten bis Ende Mai nur auf dem Papier existiert. Ernst Mayer rühmte sich sogar, „dass er die Angelegenheit [Zonenparteigründung] dilatorisch behandelt und […] alles auf die Arbeit im eigenen Land konzentriert“ 157 hätte. Unter den neuen Gegebenheiten sah sich Mayer nun jedoch gezwungen – auch dem Drängen der Hessen und Bayern nachgebend –, die zonale Zusammenwirkung zu intensivieren und endlich eine Zonenkonferenz einzuberufen. Auf der am 13.-14.07.1946 in Augsburg stattfindenden Konferenz sah sich Mayer massiven Vorwürfen aus Hessen und Bayern ausgesetzt. So wurde sowohl ihm persönlich als auch der DVP im Allgemeinen zur Last gelegt, sich in den vergangenen Monaten „in egoistischer Weise nur mit [sich] selbst beschäftigt und die anderen im Stich gelassen“158 zu haben. Dass die Konferenz nicht vollends zu einem Scherbengericht für den Generalsekretär der DVP wurde, lag an zwei Gründen: Zum Ersten an internen Veränderungen und organisatorischen Schwächen bei seinen Gesprächs- und Verhandlungspartnern. So war mit Euler ein heftiger Kritiker der LDP(D) die neue Führungspersönlichkeit der hessischen Liberalen geworden, und die Liberalen in Bayern verfügten zu dieser Zeit weder über einen Landesverband noch über unumstrittene Wortführer, sodass keine gemeinsame gegnerische Position gefunden wurde. Der zweite Grund war die zum Teil historisch bedingte Furcht vor 154 Ebd. Aktennotiz von Ernst Mayer, zitiert in: Krippendorff, S. 162. 156 Hein, Milieupartei, S. 283, vgl. auch Krippendorff, S. 162. 157 Aktennotiz von Ernst Mayer, zitiert in: Krippendorff, S. 162. 158 Aktennotiz von Ernst Mayer, zitiert in: Krippendorff, S. 163, vgl. auch Hein, Milieupartei, S. 269. 155 61 einer Berliner Dominanz. Schließlich gelang es Mayer, das Verhalten Külz’ nach dem Erfurter Parteitag der LDP(D) für seine Zwecke zu nutzen, indem er „das Mißtrauen gegen Berlin“159 stärkte und so von eigenen Fehlern ablenkte. Der Erfurter Zonenparteitag, der vom 6.-8.07.1946 – also kurz vor der Augsburger Konferenz – tagte, hatte die Hoffnungen von Külz auf eine Beschleunigung für die gesamtdeutsche Partei weitgehend enttäuscht. Nur wenige namhafte bzw. bevollmächtigte Vertreter der Westzonen waren überhaupt angereist. „Wohl aus Enttäuschung darüber entschloß sich Külz zu einem […] politischen Theatercoup: Unmittelbar anschließend an den Parteitag nahm er die westlichen Gäste mit nach Berlin und konstituierte mit ihnen, die dazu in keiner Weise legitimiert waren, kurzerhand eine ‚LiberalDemokratische-Partei Deutschlands’.“160 Vorgesehen wurden auch ein paritätischer Vorstand sowie ein geschäftsführender Vorsitzender. „Das Ganze war nur ein der persönlichen Überredungskunst Külz’ zu verdankendes und politisch ebenso wertloses wie im Westen durchweg abgelehntes Manöver.“161 Angesichts dieses Berliner „Possenspiels“162 stellte Mayer die Konferenzteilnehmer in Augsburg ultimativ vor die Alternative: „Ihr könnt Euch entscheiden, entweder wir [Stuttgart] oder Berlin, etwas anderes gibt es nicht.“163 Der Entschluss der Teilnehmer, eine zweite Zonenkonferenz, diesmal in Stuttgart, abzuhalten, stellte bereits eine symbolträchtige Antwort auf Mayers Frage dar, ebenso die Festlegung des 6. Januars [dem Dreikönigstag] als anzustrebendes Datum für die Konstituierung der Zonenpartei. Das Entscheidende der Augsburger Konferenz war jedoch, dass sich hier erstmals „ein Wandel der DVP-Position von einer eher destruktiven Einstellung zur überregionalen Zusammenarbeit zu einem stärker offensiven Verständnis einer solchen Kooperation an[deutete]“164. Die Württemberg-Badener mussten also von ihrer bisher üblichen Praxis abgehen. Mayer schlussfolgerte: „Wir sind durch unsere Zurückhaltung zweifelslos in sehr starkem Maße schuldig geworden“, denn „es besteht die Gefahr von Berlin aus überrundet zu werden.“165 Bei einem Festhalten an der bisherigen Praxis befürchtete der DVPGeneralsekretär „daß wir […] von unseren Freunden […] des Separatismus und der Reichsfeindschaft gezeiht [werden]“.166 159 Krippendorff, S. 145. Ebd. S. 144. 161 Ebd. 162 Aktennotiz von Ernst Mayer, zitiert in: Krippendorff, S. 163. 163 Mayer laut Sitzungsprotokoll, zitiert in: Wieck, Christliche und Freie Demokraten, S. 204, siehe auch Rütten, Liberalismus, S. 51. 164 Hein, Milieupartei, S. 270. 165 Aktennotiz von Ernst Mayer, zitiert in: Krippendorff S. 164, siehe auch Hein, Milieupartei, S. 270. 166 Ebd. 160 62 Stattdessen empfahl Mayer, „den Ansprüchen Berlins […] dadurch zu begegnen, dass wir zur Gründung der Zonenpartei kommen.“167 Zugleich mahnte er zur Eile in dieser Angelegenheit, denn er vermerkte: „[Ich] halte es nach all dem für die dringenste [sic!] Aufgabe […] dass der geschäftsführende Landesvorstand [der DVP] sich in allernächster Zeit [!] mit den Dingen beschäftigt.“168 Die Gründe, weshalb Mayer plötzlich so sehr auf eine zügige Konstituierung der Zonenpartei drängte, waren zweierlei Art. Zu allererst wollte er die Gefahr der innerparteilichen Isolation der DVP bannen, wozu der Zonenverband ein effektives Mittel zu sein versprach, außerdem erschien ihm der Zeitpunkt äußerst günstig. Der „Theatercoup“ von Külz hatte die bereits bestehenden Bedenken gegen dessen LDP(D) geschürt, wohingegen der Zorn über das Verhalten der DVP einstweilen verflogen war. Mayer hoffte, durch eine zügig durchgeführte Gründung der Zonenpartei diese für die LDP(D) ungünstige Stimmung nutzen zu können. Auf diese Art würde Berlin kaum, Stuttgart hingegen sehr großen Einfluss auf den neuen Zonenverband erlangen können. Mayer ging davon aus, dass „die Führung unsers Landes […] von allen als selbstverständlich anerkannt [wird]“.169 Die Einschätzungen des Generalsekretärs sollten sich bewahrheiten. Auf der zweiten Zonenkonferenz, am 21.08.1946 in Stuttgart, wurden die meisten DVP-Vorschläge übernommen. Mayer gelang es sogar, den Gründungstermin auf den 28.09.1946 vorverlegen zu lassen. Ebenso wurde die neu zu gründende Partei bereits in der Vorphase den Stuttgarter Bedürfnissen angepasst, d. h., sie wurde abgeschwächt. „Lediglich eine Dachorganisation über den drei Landesparteien mit einem gemeinsamen Vorstand, einem Rahmenprogramm und einer knappen Satzung, die den einzelnen Parteien alle Freiheiten läßt und sich im wesentlichen auf die gegenseitige Zusammenarbeit der 3 Landesparteien beschränkt“ 170, sollte konstituiert werden. Einzig bei der Namenswahl herrschte Dissens, da insbesondere die hessischen Liberal-Demokraten sich weigerten, künftig unter dem Namen „Demokratische Volkspartei“ zu firmieren. So blieb dieser Punkt auch der einzige, in dem nicht den Stuttgarter Erwartungen entsprochen wurde. Stattdessen wurde eine Kompromissformel gefunden, die es den Parteien erlaubte, ihre bisherigen Namen beizubehalten und diese lediglich mit den Zusatz „Landesverband der Demokratischen Volkspartei“ zu ergänzen. Der Zonenverband der liberalen Parteien der amerikanischen Besatzungszone wurde am 28.09.1946 auf dem gemeinsamen Parteitag von FDP (Bayer), LDP (Hessen) und DVP in Stuttgart konstituiert. Theodor Heuss wurde zum ersten Vorsitzenden, Thomas Dehler und 167 Ebd. Ebd. 169 Ebd. 170 Hein, Milieupartei, S. 271. 168 63 August Martin Euler zu seinen Stellvertretern gewählt. Ansonsten nutze die DVP, mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen, den Parteitag weidlich für ihren Wahlkampf aus und präsentierte sich ihren Anhängern als eine weit über die eigenen Landesgrenzen hinaus bedeutende politische Kraft. Die „Demokratische Volkspartei in den Ländern Bayern, Großhessen und WürttembergBaden“ war der erste und letztlich auch einzige zonale Verband im amerikanischen Besatzungsgebiet. Aus diesem Vorsprung einen bleibenden Vorteil zu ziehen, gelang in der Folgezeit jedoch nicht. Die amerikanische Zonenpartei reichte nie auch nur annähernd an die Bedeutung ihrer zonalen Schwestern FDP und LDP(D) heran. Die lag an drei Faktoren. Zum einen ließ sowohl bei den Liberalen Hessens, bedingt durch Eulers Rechtskurs, als auch bei der DVP Württemberg-Badens, wegen deren dezidiert föderalen Grundausrichtung, das Interesse an verstärkter zonaler Zusammenarbeit deutlich nach. Nachdem das gemeinsame Ziel, eine Ausweitung des Einflusses der LDP(D) auf die amerikanische Zone zu unterbinden, erreicht worden war, hatten diese beiden Parteien kaum noch weitere Übereinstimmungen. Des Weiteren „gab [es] denn auch in der amerikanischen Zone […] keinen Politiker, der die Parteipolitik auf der Zonenebene als sein vorrangiges Aufgabenfeld betrachtet hätte“ 171, sodass der Zonenverband in der öffentlichen Wahrnehmung kaum eine Rolle spielte und somit seine durchaus vorhandenen Entwicklungschancen nicht nutzen konnte. Als dritter Grund sind nochmals explizit die Stuttgarter zu erwähnen, die nach der Konstitution des Zonenverbandes in ihre alten Gewohnheiten zurückfielen und „keinen ernsthaften Schritt [unternahmen,] der über die Struktur eines lockeren Dachverbandes hinausgeführt hätte“172. Angesicht dieses Verhaltens ist der Vorwurf, die DVP betrachte den gemeinsamen Zonenverband ausschließlich als „Schutzwall gegen den Reichsausschuß [gemeint war der Koordinierungsausschuss]“173, den ein Vertreter der bayerischen FDP bereits im Frühjahr 1947 gegen Mayer und Heuss vorbrachte, nur allzu verständlich und berechtigt, denn nur aus der Furcht vor einem Einschwenken Bayerns und/oder Hessens auf den Külz-Kurs hatten die Stuttgarter ihr Plazet zur Zonenparteigründung gegeben, und tatsächlich war diese nichts anderes als ein „Schutzwall“ gegen den Einfluss der LDP(D). Die Tatsache, dass nach dem offiziellen Bruch mit den Liberalen der SBZ der Zonenverband der amerikanischen Zone nie mehr in Erscheinung trat, ist deshalb auch der anschaulichste Beweis für den Wahrheitsgehalt des „Schutzwall“-Vorwurfs. Zwar war es den Stuttgartern gelungen, die „Überrundung“ durch Berlin abzuwenden, auch wurde Külz gezwungen von seinem „Theatercoup“ Abstand zu nehmen und zur Konzeption 171 Ebd., S. 273. Ebd., S. 276. 173 Laut Sitzungsprotokoll des Gesamtvorstands vom 14.03.1947. Zitiert in: Hein, Milieupartei, S. 276. 172 64 des Koordinierungsausschusses zurückzukehren, aber die DVP mussten sich letztlich ebenfalls zur Mitarbeit in diesem Ausschuss bereit erklären sowie diesen als verbindliches Organ aller liberalen Parteien anerkennen. Somit war zwar der Versuch von Külz, seinen wichtigsten innerparteilichen Widerpart zu isolieren, nicht gelungen, jedoch erreichte er, dass die DVP dem Aufbau einer gesamtdeutschen liberalen Partei zustimmen und von ihrer prinzipiellen Opposition Abstand nehmen musste. Die Teilnahme der Stuttgarter an der Vorbereitung der Gründung einer „Reichspartei“ wurde also quasi von Berlin erzwungen. 8. Die gesamtdeutsche liberale Partei DPD Die Entwicklungen bis zum Herbst 1946 hatten gezeigt, dass es der DVP trotz der Kritik am Berliner Führungsanspruch, den gelegentlichen külz’schen Alleingängen sowie der Skepsis zur LDP(D) ob ihrer Kompromissbereitschaft gegenüber der SMAD nicht gelungen war, Unterstützung für ihren grundsätzlichen Oppositionskurs zu finden, sodass sich letztlich, aus den bereits beschriebenen Gründen, auch die Stuttgarter zur Kooperation im Koordinierungsausschuss verpflichten musste. In diesem Ausschuss trafen die Kontrahenten aus Berlin und Stuttgart erneut aufeinander, nun aber, um eine gesamtdeutsche liberale Partei zu konstituieren. Bereits an der Frage des Zeitrahmens dieses Vorhabens entwickelte sich erneuter Dissens. Während die Stuttgarter die „augenblickliche Unmöglichkeit einer Reichspartei“174 postulierten und keine weiteren dahingehenden Diskussionen vor den Landtagswahlen in ihrer Zone wünschten, drängten FDP und LDP(D) auf Intensivierung und forderten, dass die ersten Ergebnisse noch vor dem Jahreswechsel 1946/1947 vorliegen sollten175. Insofern überrascht es Koordinierungsausschusses nicht, am dass es 08.11.1946 bereits in bei der ersten Sitzung des Coburg zu tiefen, beiderseitigen Verstimmungen kam, denn in Coburg wurden nicht nur die Errichtung einer paritätisch aufgebauten, gesamtdeutschen „Arbeitsgemeinschaft“ der Liberalen vereinbart sowie mit Otto-Heinrich Greve und Arthur Lieutenant deren Geschäftsführer gewählt, sondern auch ein Bekenntnis zur Reichseinheit und zum dezentralisierten Einheitsstaat beschlossen. Besonders Letzteres führte unter anderem dazu, dass sich die Vertreter der französischen Zone auf Druck der Besatzungsmacht aus dem Ausschuss zurückziehen mussten. Dass die stark föderalistisch 174 175 Rundschreiben Ernst Mayers, zitiert in: Hein, Milieupartei, S. 290. So Friedrich Middelhauve in einem Bericht an den FDP-Zonenvorstand. 65 orientierten Stuttgarter diese Beschlüsse nicht verhinderten, lag einzig und allein daran, dass sie der Sitzung gänzlich ferngeblieben waren. Die Verstimmung der Württemberg-Badener ob der Coburger Beschlüsse hielt mehrere Monate an. So wurden die entsprechenden Sitzungseinladungen vom 14.12.1946 (Coburg) und vom 22.02.1947 (Bad Pyrmont) von ihnen komplett ignoriert. Erst an der Sitzung in Rothenburg ob der Tauber am 17.03.1947, die zeitgleich mit dem „Demokratentag“ des amerikanischen Zonenverbandes stattfand, nahm die DVP wieder teil. Somit waren erstmals auf einer Sitzung des Koordinierungsausschusses Vertreter aller deutschen Liberalen anwesend176. Dass dies möglich wurde, war im Wesentlichen dem Engagement Thomas Dehlers zu verdanken. Dieser hatte auf der Zonenvorstandssitzung vom 14.03.1947 die Absicht Mayers „die Dinge [Koordinierungsausschuss und gesamtdeutsche liberale Partei] wie schon so oft eher dilatorisch zu behandeln“177 vereitelt. Da sich schließlich auch Euler der Forderung Dehlers nach Teilnahme und aktiver Mitarbeit im Koordinierungsausschuss sowie der Schaffung einer „repräsentativen Spitze der deutschen Liberalen“178 anschloss, konnte Mayer sein Plazet nicht verweigern. Die Sitzung des Koordinierungsausschusses begann wenig verwunderlich mit heftigen Vorwürfen sowohl an die Adresse der DVP als Partei („partikularistische Gesinnung“ 179) als auch an Ernst Mayer persönlich („Motor gegen eine Reichseinheit“180). Überraschenderweise wurde jedoch sehr bald nicht mehr darüber debattiert, ob eine Gesamtpartei zu gründen sei, sondern vielmehr über deren Namen und infrage kommende Vorsitzende beraten. Am Ende der Debatten einigte man sich auf zwei Kompromisse. Da die LDP(D) für Külz den Vorsitz beanspruchte und die DVP diesen ebenso vehement für Heuss einforderte, wurde auf den Vorschlag von Euler hin eine Doppelspitze installiert. Heuss und Külz sollten die neue Partei als gleichberechtigte Vorsitzende repräsentieren, Lieutenant und Mayer ebenso gleichrangig als Geschäftsführer agieren. In der Namensfrage einigte man sich letztlich auf „Demokratische Partei Deutschlands“ (DPD). Der bisherige Koordinierungsausschuss sollte als vorläufiger Vorstand der DPD fungieren und bildete damit auch das einzige Organ der neuen Partei. Die DPD-Gründung bildete in zweierlei Hinsicht eine Wendemarke in der Parteiengeschichte der Liberalen nach 1945. Zum einen bedeutete sie das vorläufige Ende der zonalen Allerdings wurde die französische Zone lediglich von einem „Beobachter“ repräsentiert. Hein, Milieupartei, S. 291. 178 Ebd. 179 Ebd. 180 Ebd. 176 177 66 Zersplitterung der liberalen Parteien und stellte die erste gesamtdeutsche Partei dar. Wichtiger ist zum anderen aber, dass in Rothenburg nicht, wie bis dahin üblich, nach den vier Zonen, sondern erstmals nach Ost und West unterschieden wurde. So vermerkte die Sitzungsniederschrift ausdrücklich, dass „Heuss für den Westen, Külz für den Osten bestimmt“181 worden war. Die Wahl der beiden kann also als offizielles Ende der Zonengegensätze und als offizieller Anfang des Ost-West-Gegensatzes interpretiert werden, denn vom bis dato üblichen Modus der Parität nach Zonen wurde bei der Besetzung der Vorsitzendenposten erstmals abgewichen und auf eine weitere Wahl, z. B. von Blücher als Repräsentanten der britischen Zone, verzichtet. Laut der Sitzungsniederschrift verwendete Mayer erstmals ganz offiziell die Begriffe Ost- und Westzone und schränkte den Wirkungsbereich der beiden DPD-Vorsitzenden ein, als er erklärte, „kein Mann der Westzone könne verbindliche Zusagen für die Ostzone geben und umgekehrt“.182 Die DPD, die die Liberalen in ganz Deutschland einen sollte, trug also bereits bei ihrer Gründung den Keim einer erneuten Spaltung in sich. Die reservierte bis ablehnende Haltung sowohl Berlin als auch dem Projekt DPD gegenüber blieb nach Rothenburg besonders im Südwesten erhalten. Zum Teil wurden bereits Überlegungen für die Zeit nach der DPD angestellt. So schieb Mayer bereits im April 1947: „Mag aus der Reichpartei werden was will, wir sind uns auf jeden Fall hier unten näher gekommen, und es läuft dann doch den von mir schon verfolgten Weg, dass wir hier im Süden abseits von großen Deklamationen und anspruchsvollen Beschlüssen die neue Partei vorbereiten und prägen müssen“183. Der Bruch folgte bereits Ende des Jahres 1947. Da Külz seine Übereinstimmung mit der SED im „Bekenntnis zu einer positiven Friedenspolitik“184 erklärte und durch seine Teilnahme an der „Volkskongress-Bewegung“ zu bekräftigen schien, wurde dies im Westen als einseitige Festlegung auf die sowjetische Deutschlandpolitik interpretiert. Theodor Heuss erklärte Külz schriftlich, dass man sich vorerst „mit Ihnen nicht mehr an einen Tisch setzen werde“185. So war der LDP(D)-Vorsitzende auf der letzten DPD-Sitzung nicht anwesend. Die von den Vertretern der Westzonen geforderte Demissionierung von Külz und Lieutenant versagten die Delegierten aus der SBZ ihre Zustimmung. Daraufhin verließen die Vertreter der Ostzone die Sitzung, da offensichtlich war, dass es zu keiner Einigung mehr 181 Sitzungsniederschrift des Koordinierungsausschusses vom 17.03.1947, zitiert in: Hein, Milieupartei, S. 292, Vgl. auch Wieck, Christliche und Freie Demokraten, S. 194f. 182 Ernst Mayer laut Sitzungsniederschrift des Koordinierungsausschusses vom 17.03.1947, zitiert in: Hein, Milieupartei, S. 292. 183 Mayer in einem Brief an Dehler, zitiert in: Rütten, Liberalismus, S. 52, vgl. auch Hein, Milieupartei, S. 274. 184 Zitiert nach: Frölich, Liberaldemokratische Partei Deutschlands, S. 316. 185 Ebd. 67 kommen würde. Nach diesem Ereignis hörte die DPD faktisch auf zu bestehen, auch wenn sie nie offiziell aufgelöst wurde. 9. Die Entwicklung der LDP(D) bis 1953 Nach der Trennung von den westdeutschen Liberalen und mit dem Tod von Wilhelm Külz standen die Liberalen Ostdeutschlands vor den Trümmern ihrer bisherigen Hoffnungen. Nicht nur, dass die erhoffte deutsche Einheit in immer weitere Ferne rückte, auch ihre politischen Möglichkeiten wurden mehr und mehr beschnitten. Diese Entwicklung wurde durch die sich abzeichnende staatliche Teilung Deutschlands nochmals verstärkt. Die Befürchtungen Külz’, dass die Gründung eins Oststaat die Situation der LDP(D) deutlich verschlechtern würde, da dies mit einer „Sowjetisierung“ einhergehen würde, sollte sich letztlich bewahrheiten. Es begann der Umformungsprozess der LDP(D) zu einer gleichgeschalteten und der SED unterworfenen Partei. Am Ende dieses Prozesses stand nicht nur das Ende der politischen Eigenständigkeit der LDP(D), sondern auch die Preisgabe aller ihrer bisher vertretenen Prinzipien durch die Parteispitze. 9.1 Das Umbruchjahr 1948 Die Zurückhaltung und Kooperationsbereitschaft mit der SED wurden von der Mehrheit der LDP(D) solange als taktische Leitlinie akzeptiert, wie die gesellschaftspolitischen Veränderungen die Kerninteressen der Partei noch nicht entscheidend gefährdeten und die Perspektive der Revision in einem vereinigten Deutschland bestand. Alle realistischen Hoffnungen auf eine baldige deutschlandpolitische Verständigung der Alliierten starben jedoch mit dem Scheitern der Londoner Außenministerkonferenz Ende 1947. Die gleichzeitige Verschärfung der Enteignungen stellte die Politik von Külz endgültig infrage. Bereits auf dem sächsischen Landesparteitag im Oktober 1947 wurde die bisherige Parteiführung um Hermann Kastner und Johannes Dieckmann durch Kandidaten ersetzt, die als Garanten einer konfrontativen Politik galten. Zum neuen Landesvorsitzenden wurde 68 Arthur Bretschneider gewählt. Stellvertreter wurden Ralph Liebler und Wolfgang Mischnick186. Durch den überraschenden Tod von Külz am 10.04.1948 verlor die Partei ihre überragende Integrationsfigur, und die innerparteilichen Konflikte traten offen zutage. Als Folge blieb der Vorsitz fast ein Jahr vakant. In dieser Zwischenzeit verstärkte sich der liberaldemokratische Widerstand. Nachdem der spätere Ministerpräsident der DDR, Otto Grotewohl, den Machtanspruch der SED mit neuer Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht hatte, drohte die LDP(D) mit einer am 14.07.1948 veröffentlichten Erklärung das Ende der gemeinsamen „Blockpolitik“ an. Zudem wurden auf dem thüringischen Parteitag Mitte Juli 1948 die Forderungen nach rechtsstaatlichen Verhältnissen und verlässlichen Rahmenbedingungen für die Privatwirtschaft bekräftigt. Offensichtlich begrüßte die Parteibasis diese deutliche Stellungnahme, denn bis „Ende September wuchs die Zahl der Parteimitglieder auf nahezu 200.000 an.“187 SED und Sowjets versuchten daraufhin einerseits, so genannte „reaktionäre Kräfte“ einzuschüchtern und aus ihren Ämtern zu verdrängen. Zahlreiche Liberaldemokraten wurden verhaftet und aus politischen Gründen verurteilt oder entzogen sich den Repressalien durch die Flucht in den Westen. Andererseits wurde der Aufstieg so genannter „fortschrittlicher“ Liberaldemokraten, die zur uneingeschränkten Kooperation mit der SED bereit waren, gefördert. Einen rasanten Aufstieg erfuhren damals beispielsweise Hans Loch, Johannes Dieckmann und Manfred Gerlach. Letzterer wurde mit gerade einmal 20 Jahren gegen die Stimmen seiner eigenen Partei zum stellvertretenden Bürgermeister von Leipzig gewählt. Um das politische Kräfteverhältnis weiter zu ihren Gunsten zu verändern, organisierte die SED bereits im Frühjahr 1948 die Gründung der National-Demokratischen Partei Deutschlands (NDPD) und der Demokratischen Bauernpartei Deutschlands (DBD). „Beide Parteien fungierten von Anfang an als Organe der SED.“188 Insbesondere die Nationaldemokraten versuchten dieselben Zielgruppen zu gewinnen wie die Liberaldemokraten. Da die Nationaldemokraten jedoch eine reine Fremdschöpfung darstellten, unterbleibt ihre nähere Betrachtung in dieser Arbeit. Zudem hatte die von der SMAD kontrollierte Presse eine Kampagne gegen die LDP(D) und ihren kommissarischen Vorsitzenden Arthur Lieutnant gestartet. Ende Juli 1948 stellte die Besatzungsmacht gar die weitere Existenz der LDP(D) in Frage. Lieutnant zog seine 186 Die Wahl Mischniks, der für den Widerstand der jungen LDP(D)-Mitglieder stand, wurde von der SMAD nicht bestätigt, und er durfte sein Amt nicht antreten. Er floh später in den Westen und machte in der FDP Karriere. 187 Malycha, S. 38. 188 Sommer, Die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands, S. 52. 69 Kandidatur für den Parteivorsitz daraufhin zurück, und der vorgesehene Parteitag musste auf unbestimmte Zeit verschoben werden, denn der einzig übrig gebliebene Kandidat, Alphons Gärtner, floh in die Westzonen. Erst auf dem Eisenacher Parteitag im Februar 1949 wurden Karl Hamann und Hermann Kastner zu gleichberechtigten Vorsitzenden gewählt. Beide hielten am Ziel der pluralistischen Demokratie nach westlichem Muster fest, repräsentierten aber nicht mehr die marktwirtschaftlich orientierte Grundüberzeugung der LDP(D). Die Partei forderte keine Revision der Enteignungen, sondern zog sich auf eine defensive Linie, die Verteidigung der verbliebenen privatwirtschaftlichen Räume, zurück. Gleichzeitig wurde fast der gesamte Parteivorstand im Sinne der SED ausgetauscht. Unter anderem erhielten Hans Loch und Johannes Dieckmann Stellvertreterposten. Zwar bekannte sich die LDP(D) im hier verabschiedeten „Eisenacher Programm“ noch einmal „zur pluralistischen Demokratie und zur Unabhängigkeit der Rechtssprechung [...] und zum Schutz des Privateigentums“189, doch schon wenige Monate nach seiner Verabschiedung durfte das Programm nicht mehr öffentlich vorgestellt werden. 9.2. Die Jahre der Gleichschaltung 1949-1953 Bereits zur Gründung der DDR am 07.10.1949 wurde die Kluft zwischen Parteiführung und Basis deutlich. Obwohl die Verfassung die Planwirtschaft festschrieb und weitgehende Enteignungsmöglichkeiten enthielt, wurde sie von den Führungsgremien der LDP(D) begrüßt. Sie wurde als gesellschaftlichen verbindliche Rechtsgrundlage Status angesehen. quo Dies, und die vermeintliche erneute Fixierung des Verschiebung der Parlamentswahlen auf Oktober 1950 und die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze löste an der Parteibasis massive Proteste aus. Diese verschärften sich im November 1949 weiter, nachdem die SED die parlamentarische Beteiligung von NDPD und DBD durchgesetzt hatte. Gleichzeitig setzte eine neue Welle systematischer Verfolgungen ein. Einzelne LDP(D)Funktionäre und ganze Unterverbände polemisierten dennoch weiter gegen den Machtanspruch der SED und leisteten offenen Widerstand. Gegen die Aufstellung einer Einheitsliste zu den Volkskammerwahlen erhob im März 1950 Kastner190 als einziger Parteivorsitzender Bedenken. Erst nachdem ihm Wilhelm Pieck, Präsident der DDR, eine schriftliche Existenzgarantie für eine unabhängige LDP(D) zugesagt 189 Papke, Die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR 1945-1952, S. 40. 190 Seine exzellenten Kontakte zur Besatzungsmacht schützten ihn bisher vor unmittelbaren Übergriffen der SED. 70 hatte, erklärte er seine Zustimmung. Dennoch löste die Bekanntgabe der Einheitsliste zwei Monate später innerparteilich eine weitere Protestwelle aus. Aber auch Resignation begann sich auszubreiten. Im August wurde der Generalsekretär der LDP(D), Günther Stempel, verhaftet, weil er sich der Einheitsliste widersetzte. Als Hermann Kastner sich ebenfalls der Protestwelle anschloss und Einwände erhob, wurde er kurzerhand seines Amtes enthoben und aus der Partei ausgeschlossen. Herbert Täschner wurde neuer Generalsekretär und damit zur Schlüsselfigur bei der Umwandlung der LDP(D) zu einem Transmissionsorgan der SED. Die ehemals dezentrale Struktur der LDP(D) wurde schrittweise dem „demokratischen Zentralismus“ der SED angeglichen. Im Zuge der Auflösung der Länder und der Umstrukturierung der gesamten DDR-Verwaltung 1952 durch die SED wurde die Organisationsstruktur der LDP(D) ebenfalls auf Basis der neuen Bezirksstruktur umgestaltet. Die Einsetzung der neuen Bezirksfunktionäre erfolgte dabei durch die Parteiführung nach Vorschlägen der SED oder bedurfte zumindest deren Zustimmung. So konnten oppositionell gesonnene Funktionäre ausgeschaltet und durch „zuverlässige“ Parteifreunde ersetzt werden. Diese „Strukturreform“ setzte sich analog auch auf der Kreis- und Ortsebene fort. „Durch die gelenkten personalpolitischen Entscheidungen wurden die Liberalen eine von der [...] SED abhängige Organisation.“191 Die Rolle der LDP(D), die ihr von der SED zugedacht wurde, offenbarte sich erstmals im Dezember 1950 im „Arbeitsprogramm“ des Landesverbandes Sachsen-Anhalt. Danach bestand die Aufgabe der LDPD darin, „bürgerliche Bevölkerungskreise praktisch und ideologisch an die neue Gesellschaftsordnung heranzuführen“192. Unter der unmittelbaren Einflussnahme der SED verkehrte die LDP(D) im Juli 1951 ihre ursprüngliche Zielsetzung des Eisenacher Parteitags in ihr Gegenteil, indem sie sich auf die Integration der verbleibenden privatwirtschaftlichen Freiräume in die sozialistische Planwirtschaft umorientierte, statt diese zu schützen. Doch ungeachtet der massiven Eingriffe der SED in die Delegiertenauswahl und der permanenten Sanktionsandrohungen wurde die Politik der Einheitssozialisten unter offenem Beifall kritisiert und ihr Führungsanspruch vereinzelt explizit zurückgewiesen, womit dieser Parteitag gleichzeitig den Selbstbehauptungswillen dieser Partei verdeutlicht. Der durch die SED protegierte Loch konnte dann auch nur in einem gemeinsamen Wahlgang mit Hamann zum Vorsitzenden gewählt werden, denn während Hamann trotz seiner Anpassungsbereitschaft einen großen Rückhalt in der Partei besaß, hätte Loch in einer Einzelwahl kaum eine Chance gehabt. 191 192 Sommer, Die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands, S. 56. Papke, Die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands, S. 42. 71 Am 28.07.1952 ordnete sich die LDP(D) mit ihrer Zustimmung zum „Aufbau des Sozialismus“ jedoch endgültig dem Führungsanspruch der SED unter und gab damit ihre liberale Identität auf. Der Politische Ausschuss der LDP(D) erklärte: „Wir erkennen dabei die führende Rolle der Arbeiterklasse uneingeschränkt an.“193 Stimmungsberichte aus den Ortsund Kreisverbänden zeigen jedoch, dass ein großer Teil der Mitglieder dieses Bekenntnis nicht unterstützte.194 Zum Teil kam es in den Versammlungen zu Tumulten. Viele Parteimitglieder reagierten hingegen mit anhaltender Passivität und dem Rückzug ins Privatleben, was zum Verfall ganzer Ortsgruppen führte. Nach der Verhaftung Hamanns195 im Dezember 1952 übernahm Loch allein den Parteivorsitz. Auf den folgenden Protest an der Parteibasis reagierte die Ostberliner Spitze mit weitreichenden Beschlüssen zur politischen „Säuberung“ der LDP(D). Auf allen Ebenen schlossen Überprüfungskommissionen in den nächsten Jahren tausende Mitglieder aus und setzten illoyale Kreisvorsitzende ab. Ganze Ortsgruppen wurden von der „Staatssicherheit“ verhaftet. Die innerparteiliche Demokratie der LDP(D) war bereits soweit ausgehöhlt, dass Loch auf dem nächsten Parteitag im Mai 1953 ohne größere Probleme bestätigt wurde. „Seitdem lag ihre Parteiführung völlig auf SED-Kurs und folgte fast immer ohne Widerspruch den Vorgaben des Politbüros und dessen Apparates.“196 Als Folge der Anpassung der Parteiführung an die SED verlor die LDP(D) in den zwei Jahren bis Ende 1952 rund ein Drittel ihrer Mitglieder.197 Die Parteimitglieder an der Basis verfielen in der „Hoffnung auf besserer Zeiten“ in eine Art politischer Lethargie und blieben bis auf individuelle Einzelfälle politisch passiv. 10. Die Entwicklung der Liberalen in der Westzone Bereits kurz nach dem endgültigen Bruch der West- mit den Ostliberalen bahnte sich die nächste Auseinandersetzung um die innerparteiliche Vorherrschaft ab. Hatten die Vertreter des traditionellen, milieugebundenen Liberalismus bisher mit den Befürwortern der nationalen Sammlung gegen den Külz-Kurs zusammengearbeitet, so war nach dem 193 Sommer, Die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands, S. 76. Vgl. Sommer, Die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands, S. 83ff. 195 Er wurde als zuständiger, aber über kaum Einfluss verfügender Minister für die gravierenden Versorgungsmängel verantwortlich gemacht. 196 Frölich, Liberaldemokratische Partei Deutschlands, S. 318. 197 Die Zahl der Mitglieder sank von 199.000 (1950) auf 134.033 (1952). Vgl. Sommer, Die LiberalDemokratische Partei Deutschlands, S. 313. 194 72 Ausscheiden der LDP(D) aus der gemeinsamen „Dachpartei“ dieses Bündnis obsolet geworden. So begann bereits kurz nach dem Ausscheiden der LDP(D) eine weitere Auseinandersetzung innerhalb der Liberalen, die für die nächsten Jahre bestimmend sein sollte. In dieser ging es um die zukünftige Ausrichtung der Gesamtpartei, um ihre Konzeption entweder als Partei der Mitte oder aber als rechte Sammlungspartei. Diese prinzipiellen Meinungsunterschiede waren zwar auch zuvor existent, aber bis dahin immer vom Auseinandersetzung zwischen Berlin und Stuttgart verdeckt worden. Die Konflikte zwischen den Traditionsliberalen und den Befürwortern eines strikten Rechtskurses, die Flügelkämpfe innerhalb der später gegründeten Bundespartei drohten diese zu zerreißen. 10.1 Von der DPD zur FDP Anfangs war die Anhängerschaft eines Rechtskurses noch zu schwach gewesen, um die direkte Konfrontation mit den Traditionsliberalen suchen zu können. Quasi im Schatten der Auseinandersetzungen zwischen Berlin und Stuttgart waren Einfluss und Zahl der Befürworter eines Rechtskurses gewachsen. Begünstigt wurde dieser Machtzuwachs durch die Lockerung der Entnazifizierung. So traten ab Anfang 1947 „mehr und mehr jene politischen und sozialen Kräfte bei, die 1945/46 noch an einer Mitwirkung gehindert gewesen waren“198. Bei diesen Kräften handelte es sich zunächst einmal um ehemalige Mitglieder und Unterstützer der DVP Weimars und etwas später, d. h. im Laufe des Jahres 1947, auch im zunehmenden Maße um ehemalige Anhänger der DNVP. Da diese von Haus aus für eine betont nationale Ausrichtung standen, war es von Beginn an nicht unwahrscheinlich, dass deren Auffassungen auch in die neuen liberalen Parteien einfließen und sie mehr in die national-liberale Richtung beeinflussen könnten. Die spätere Aufnahme von weniger belasteten „Ehemaligen“199 ließ eine weitere Verstärkung dieses Trends erwarten. Zugleich erfolgten ab 1946 auch verstärkt Eintritte von weiteren Gruppen, die bisher nicht politisch aktiv gewesen waren. Hierbei handelte es sich sowohl um Vertriebene und Kriegsflüchtlinge als auch um Jugendliche ohne Weimar-Erfahrung. Auch diese Neu-Liberalen ließen durchaus eine Kursverschiebung erwarten, da sie entweder eine andere Sozialisation als die AltLiberalen durchlaufen hatten oder aber nicht die regionale Verwurzelung der Traditionalisten besaßen. 198 199 Vgl. Hein, Der Weg, S. 57. Also ehemaligen Mitgliedern der NSDAP. 73 Den bereits zuvor gefestigten Landesverbänden gelang es, die neuen Mitglieder zu integrieren, ohne dass dies größere Veränderungen auf die Ausrichtung der Landespartei zur Folge gehabt hätte. So lässt sich weder bei den Württemberg-Badenern noch bei den Liberalen der beiden Hansestädte nach 1947 eine Richtungsverschiebung nach rechts erkennen, d. h., der traditionelle, eher links-liberale Kurs der Parteigründer blieb dort auch weiterhin gültig. In den nicht so stark traditionell geprägten Ländern war dies jedoch nicht der Fall. Nördlich der „Mainlinie“200 kam es zu deutlichen Richtungswechseln, wurde der Kurs der Traditionsliberalen abgelehnt sowie eine allgemeine „Abkehr vom Liberalismus alter Prägung“201 gefordert. In diesen Landesverbänden erfolgte ein Paradigmenwechsel hin zum Konzept der Rechtspartei. Dieser Wechsel war oft mit dem Austausch der Parteiführung verbunden. Die bisherigen Vorsitzenden wurden durch Befürworter des Rechtskurses ersetzt, die Linksliberalen sowie die Vertreter des Konzepts der Mittelpartei sahen sich zunehmend an den Rand gedrängt. Dieser Prozess führte dazu, dass mit August Martin Euler in Hessen, Friedrich Middelhauve in Nordrhein-Westfalen, Arthur Stegner in Niedersachsen und Fritz Oellers in Schleswig-Holstein ausgesprochene Vertreter des Rechtskurses an die Spitze ihrer Landesparteien gelangten. Unter der Führung ihrer neuen Vorsitzenden entwickelten sich diese Landesverbände zum Kern des rechten Lagers innerhalb der Liberalen, das den – besonders durch die Stuttgarter vertretenen – Traditionsliberalen allmählich zum bedrohlichen Rivalen erwuchs. Bis etwa Mitte 1948 gingen sich diese beiden Lager jedoch mehr oder weniger aus dem Wege und suchten keine direkte Konfrontation. Während die Vertreter der national gesinnten Liberalen sehr früh die Möglichkeiten erkannt hatten, die sich ihnen im neu gegründeten Wirtschaftsrat der Bi-Zone202 boten, und ihre Spitzenkräfte203 in dieses Gremium entsandten, brachte beispielsweise die DVP-Führung diesem nur sehr geringes Interesse entgegen und beorderte lediglich einige Fachpolitiker nach Frankfurt. Der Wirtschaftsrat wurde also faktisch kampflos dem rechten Flügel überlassen. Dessen Vertreter verstanden es, den Wirtschaftsrat zur Profilierung ihres Kurses zu nutzen, d. h., sie bezogen eine klare Frontstellung gegenüber den Sozialdemokraten und gegen jegliche Form des Sozialismus. Insbesondere traten sie als Verfechter und Verteidiger der Freien Marktwirtschaft auf. Der liberalen Fraktion im Wirtschaftsrat, die sich im Übrigen bereits als FDP204 bezeichnete, 200 Erich Mende im Interview mit Fritz Fliszar, in: Verantwortung für die Freiheit, 40 Jahre F.D.P., S. 128. Zitat Friedrich Middelhauve, in: Hein, Der Weg, S. 57. 202 Amerikanische und britische Besatzungszone. 203 U. a. Blücher und Euler. 204 Ab Februar 1948. 201 74 gelang es, einige bedeutende Entscheidungen zu forcieren. So wurde z. B. Ludwig Erhard auf ihren Vorschlag hin zum Wirtschaftsdirektor der Bi-Zone berufen. Ihre permanente Gegnerschaft zur SPD erzwang förmlich eine koalitionsähnliche Zusammenarbeit der bürgerlichen Gruppen (FDP, DP und Christdemokraten) in diesem Gremium. Die Traditionsliberalen konnten dem lange Zeit nichts entgegensetzten. Dies änderte sich erst, als im September 1948 der Parlamentarische Rat in Bonn zusammentrat. In dieses Gremium entsandte die DVP ihren Spitzenvertreter Heuss, der auch die liberale Fraktion 205 führte. Diese konnten im Prozess der Verfassungsgebung das Modell der Mittelpartei anschaulich praktizieren, denn ganz im Sinne dieses Konzeptes arbeitete die Fraktion der Liberalen, je nach Situation bzw. Sachfrage, sowohl mit den Sozialdemokraten als auch mit den Christdemokraten zusammen und wirkte so als Mittlerin zwischen den Blöcken. Eben diese Praxis führte zur ersten direkten Konfrontation zwischen dem traditionellen und dem rechten Flügel der Liberalen. Als Vertreter von Letzterem warf Middelhauve Heuss vor, zugunsten der Mittlerfunktion auf eigene unverwechselbar liberale Forderungen, wie die Errichtung einer Präsidialdemokratie, den dezentralisierten Einheitsstaat usw., zu verzichten. Obwohl diese Forderungen mehrheitlich nur von den national eingestellten Landesverbänden erhoben wurden, blieben die Vorwürfe Middelhauves nicht ungehört. Zugleich erhoben die traditionell gesinnten Liberalen ihrerseits Vorwürfe ob des „Hugenberg-Kurses“ der rechtsgesinnten Landesverbände. Willy Max Rademacher, Hamburg, und Wolfgang Haußmann, Stuttgart, starteten eine „Artikelkampagne“ gegen die Bestrebungen der rechten Landesverbände und warben gleichzeitig für das Modell der Mittelpartei. Ernst Mayer nutze letztmalig das Mittel des DPD-Rundbriefs, um gegen die Vertreter des Rechtskurses vorzugehen. In den Rundbriefen verlieh Mayer seinen Befürchtungen Ausdruck, dass von einer liberalen Partei erneut die „gefährlichen nationalistischen Instinkte“206 angesprochen werden könnten. Dies geschehe aber „von Leuten, die in ihrer ganzen politischen Auffassung nach gar nicht zu uns gehören“.207 Aber auch aufrechte Liberale würden den „Gebrauch des Harzburger Vokabulariums“ einsetzen, um einen „ehrlichen, aber [letztlich] hoffnungslosen Versuch“208 zur Verhinderung einer Rechtspartei zu unternehmen. Ferner zeigte sich Mayer entsetzt ob der Einstellung vieler junger Liberaler, denn er müsse „fortwährend [...] feststellen, dass die Jahre der maßlosen Bestialität, des unerhörten Leidens und Leides, dass 205 Die anderen Landesverbände entsandten Höpker-Aschoff, Schäfer, Becker und Dehler. Aus dem DPD-Rundbrief an die Mitglieder des Koordinierungsausschusses vom 27.11.1948, zitiert in Hein, Milieupartei, S. 332. 207 Ebd. 208 Ebd. 206 75 die [...] Grausamkeit des Dritten Reiches an ihrem Denken offenbar spurlos vorübergegangen sind“209. In dieser vorbelasteten Atmosphäre fand der Kongress von Heppenheim statt, auf dem eine gemeinsame Partei aller Westzonen konstituiert werden sollte. 10.2 Die Gründung der FDP Bereits kurz nach dem Bruch mit der LDP(D) war unter den Liberalen der Westzone die Forderung laut geworden, wenigstens für die westlichen Besatzungsgebiete eine einheitliche Gesamtpartei zu errichten, um eine weitere Entfremdung zwischen den einzelnen liberalen Parteien zu verhindern. Erneut hatte die DVP den Aufbau einer Gesamtpartei zu verhindern gesucht und auf die bereits bestehende DPD verwiesen, deren Beschaffenheit als loser Dachverband eher ihren Vorstellungen entsprach, als die nun geforderte durchorganisierte Drei-Zonen-Partei. Erst gegen Ende 1948 war man zur Konstituierung einer Drei-ZonenPartei bereit, die auf einer Konferenz vom 11.-12.12.1948 an symbolträchtiger Stelle – in Heppenheim210 – erfolgen sollte. Jedoch war es wegen der bereits genannten Ereignisse dazu gekommen, dass sowohl der rechte als auch der linke Flügel der Liberalen im Vorfeld der Konferenz von Heppenheim eher auf eine Schärfung des eigenen Profils bedacht waren, anstatt sich auf einen tragfähigen Kompromiss zu einigen. So fand die Konferenz, die die Einheit der Liberalen erbringen sollte, schon in einem Klima der Konfrontation statt. Die angereisten 89 Delegierten waren sich bereits darüber im Klaren, dass eine Kompromissfindung zwischen den beiden großen innerparteilichen Lagern schwierig, wenn nicht gar unmöglich sein würde. Bereits die äußere Gestaltung von Tagungsraum sowie Programmvorlage führten zu ersten Streitigkeiten. Der Hauptorganisator der Konferenz, Ernst Mayer, hatte, der Traditionslinie von 1848 entsprechend, beides in den Farben Schwarz-Rot-Gold gestalten lassen. Aber besonders die Schwarz-Rot-Gold-Drapierung des Tagungsraumes erregte das Missfallen der rechten Landesverbände, die dies als eine gegen sie gerichtete Symbolik verstanden. Um ihr nationales Profil zu schärfen, verwandten sie in ihren Ländern die alten kaiserlichen Farben Schwarz-Weiß-Rot. 209 Aus dem DPD-Rundbrief an die Mitglieder des Koordinierungsausschusses vom 27.11.1948, zitiert in Hein, Milieupartei, S. 332. 210 Bereits 1847 hatten sich in Heppenheim liberale Abordnungen getroffen. 76 Angesichts dessen erfolgte am ersten Konferenztag auch keine Austragung der Gegensätze, sondern es wurden lediglich nochmals die unterschiedlichen Standpunkte umrissen sowie Berichte über die Arbeit im Parlamentarischen Rat und im Wirtschaftsrat per Referat abgegeben211 und stattdessen entbrannte ein heftiger Streit um den Parteinamen. Zwar hatte sich die DVP bereiterklärt, den Namen „Freie Demokratische Partei“ trotz seiner, besonders von Heuss beklagter, Farblosigkeit als den der neuen Bundespartei zu akzeptieren, jedoch zeigten sich ganz besonders Eulers Hessen nicht bereit, auf den Begriff „liberal“ zu verzichten. Eulers Namensvorschlag „Liberale Volkspartei“ konnte 35 Stimmen212 auf sich vereinen. Damit wäre diese Gruppe allerdings weiterhin in der Minderheit gewesen. Dies änderte sich jedoch, als Blücher den Namen „Liberale Partei Deutschlands“ als Kompromissvorschlag unterbreitete. Dieser Bezeichnung wollten nun auch die Delegierten aus Nordrhein-Westfalen – mit ihren entscheidenden 17 Stimmen – die Zusage erteilen. Erst als daraufhin der designierte Vorsitzende der Bundespartei, Theodor Heuss, erklärte, dass er sich außerstande sehe, einer Partei dieses Namens vorzusitzen, fiel die Entscheidung für die Bezeichnung FDP. Der Name „Freie Demokratische Partei“ setzte sich letztlich dennoch erst in einer Kampfabstimmung am zweiten Konferenztag mit 64 zu 25 Stimmen gegen den Alternativvorschlag „Liberal-Demokratische Partei“ durch. Was sich in der Namenfrage bereits angedeutet hatte, setzte sich am 12.12.1948 bei den Personalentscheidungen fort. Euler war es gelungen, die rechten Landesverbände darauf festzulegen, ein „Übergewicht Dementsprechend traten bei innerparteilichen Verwerfungen der ehemaligen Staatsparteiler“213 den Abstimmungen für Vorsitz offen zutage. Zwar wurde zu verhindern. und Vorstand die Theodor Heuss zum Bundesvorsitzenden gewählt, jedoch erreichte er lediglich 72 Stimmen, während sein künftiger Stellvertreter Franz Blücher 81 Stimmen auf sich vereinen konnte. Bedeutete dies allein schon eine Schwächung der Position des gerade erst gewählten Vorsitzenden, so bedeutete das Ergebnis der Vorstandswahlen einen vollkommenen Eklat. Der engste Vertraute von Heuss, Ernst Mayer, fiel bei dieser Wahl mit nur 31 erreichten Stimmen glatt durch. Auch der anschließende Versuch, Mayer wenigstens als geschäftsführendes Vorstandsmitglied wählen zu lassen, schlug fehl, da auch in diesem Wahlgang nur eine Minderheit von 40 211 Die Referenten waren mit Höpker-Aschoff (Parlamentarischer Rat) und Blücher (Wirtschaftsrat) allerdings entsprechend prominent besetzt. 212 Euler konnte neben den hessischen auch auf die Stimmen von Baden, Berlin, Bremen und Rheinland-Pfalz zählen. 213 Persönliche Aufzeichnung über die Gründungsversammlung der FDP in Heppenheim, verfasst von CarlHubert Schwennicke. Zitiert in: Rütten, Liberalismus, S. 170. 77 Delegierten für den DVP-Generalsekretär stimmte. Einstimmig wurden hingegen Schwennicke und Wildermuth214 in den geschäftsführenden Vorstand gewählt. Die Nichtwahl Mayers führte die neue Situation innerhalb der Liberalen deutlich vor Augen: Die Vorherrschaft der DVP und damit der traditionsliberalen Richtung war nicht länger gegeben. Wie war es zu dieser Verschiebung gekommen? Wieso konnten die WürttembergBadener ihre bisherige Dominanz nicht aufrechterhalten? Drei Gründe sind hierfür maßgeblich: Zum einen die Tatsache, dass die DVP wegen des Machtkampfes mit der LDP(D) den Machtzuwachs der Apologeten des Rechtskurses unterschätzt und sich von den eigenen Wahlerfolgen hatte blenden lassen. Hieraus ergab sich auch der nächste Grund: Der Delegiertenschlüssel für Heppenheim war auf absolute Wähler- und Mitgliederzahlen angelegt, ein Umstand, der den Verbänden der bevölkerungsreichen Länder zugute kam. Dies garantierte den rechten Landesverbänden fast automatisch eine relative Mehrheit an Delegiertenstimmen215. Und drittens war es für unwahrscheinlich gehalten worden, dass es dem rechten Flügel gelingen würde, sich untereinander auf eine einheitliche Stimmenabgabe zu verständigen216. Die Konferenz von Heppenheim ist daher aus mehrerlei Hinsicht von parteigeschichtlicher Bedeutung. Hier wurde die liberale Bundespartei, die FDP, konstituiert und versucht, die Einheit der Liberalen zu manifestieren. Zugleich begann an dieser Stelle auch ganz offiziell und öffentlich die Konfrontation zwischen den Traditionsliberalen und den Vertretern der nationalen Sammlung, um den künftigen Kurs und die allgemeine Konzeption der Partei. Selbst die gerade erst gegründete Bundespartei schien wieder bedroht zu sein, als Theodor Heuss sechs Tage nach seiner Wahl bereits als „Verlegenheitslösung“ bezeichnet wurde, „die bald durch eine endgültige ersetzt werden müsse“217 und dieser seiner Sorge, die FDP könne durch ihren rechten Flügel „von einem billigen Nationalismus der Phrase überschwemmt werden“218, Ausdruck verlieh. Die Vertreter des rechten Flügels selbst waren in Sorge, dass wegen der „mimosenhaften Empfindlichkeit [der Traditions- bzw. Linksliberalen] gegenüber der Betonung eines gesunden Nationalgefühls“219 der Aufwärtstrend der FDP gebremst oder gar gestoppt werden könnte. 214 Wildermuths Ergebnis überrascht deshalb, weil er eigentlich zu den Unterstützern von Heuss zählte. Ernst Mayer vermutete später, dass Wildermuth dies seinem Ritterkreuz zu verdanken habe. vgl. Hein, Der Weg, S. 57. 215 Die Landesverbände Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen stellten zusammen fast die Hälfte der Delegierten. 216 Dass dieses Annahme nicht gänzlich unberechtigt war, zeigte das unterschiedliche Abstimmungsverhalten des rechten Lagers bei der Namensfrage. 217 So Max Dominicus in einem Schreiben an Blücher, zitiert in Hein, Der Weg, S. 65. 218 So Theodor Heuss in einem Schreiben an Blücher, zitiert in Hein, Der Weg, S. 65. 219 So eine Aktennotiz von Schwennicke. Ebd. 78 Der Öffentlichkeit bot die FDP das Bild einer, vorsichtig ausgedrückt, sehr heterogenen Partei, die sich weder auf ein gemeinsames Programm noch auf den weiteren Politikkurs hatte festlegen können. Die erhoffte Manifestation der Einheit war keinesfalls erreicht worden, allenfalls war es gelungen, die widerstreitenden Lager mit einer provisorischen Klammer zusammenzuhalten. Auch der erste Bundesparteitag vom 10.-12.06.1949 in Bremen verdeutlichte einmal mehr, welch starke Differenzen innerhalb der FDP herrschten. So verwundert es nicht, dass auf dem Bremer Parteitag kein vollwertiges Parteiprogramm, sondern lediglich die „Bremer Plattform“ als vorläufige programmatische Grundlage beschlossen werden konnte. In dieser wurde versucht, die innerparteilichen Differenzen außen vor zu lassen und keine Festlegungen über den künftigen Kurs der FDP zu treffen. In der Plattform ging man lediglich auf einige der aktuellen Probleme in Deutschland ein und war dabei bemüht, möglichst Formulierungen zu finden, denen beide innerparteilichen Lager zustimmen konnten. Auf diesem Wege gelange es, bei den allgemeinpolitischen Problemen Wahl- und Elternrecht sowie Steuern Kompromisse zu finden. Auch in den speziellen Nachkriegsthemen, wie Demontagen, Wohnungsbau und besonders der Problematik der Vertriebenen, konnten Einigungen erzielt werden, sodass diese Themen einmütig beschlossen wurden. Wider Erwarten konnte selbst in der heiklen Frage der Entnazifizierung ein Kompromiss erreicht werden. Man verständigte sich dahingehend, eine Amnestie zu fordern, von der lediglich „kriminell Schuldige“ ausgenommen werden sollten. In der Frage der Raumbeflaggung entbrannte ein neuerlicher heftiger, weil symbolhafter Streit, da der demokratische Flügel auf dem traditionellen Schwarz-Rot-Gold bestand, aber die Vertreter des rechten Flügels ihrerseits auf den Farben Schwarz-Weiß-Rot beharrten. Man verständigte sich in diesem Punkt letztlich drauf, Schwarz-Rot-Gold als die deutschen Farben anzuerkennen, „den schwarz-weiß-roten Farben aber immer ein ehrfurchtsvolles Gedenken [zu] bewahren“220. Dies wurde von der jeweiligen Seite stets in ihrem Sinne interpretiert. Folglich verwendeten einige Landesparteien weiterhin die kaiserlichen Farben für ihre Veranstaltungen und offiziellen Auftritte. Durch die „Bremer Plattform“ wurde versucht, für jeden Wähler etwas Ansprechendes anzubieten, ohne die innerparteilichen Spannungen zu verstärken. Erich Mende fasste dies später wie folgt zusammen: „National, ohne nationalistisch zu werden; liberal, ohne bindungslos zu sein, ausgerichtet auf die Werte der Humanität; sozial, ohne sozialistisch zu werden, orientiert an [...] Eigentum und Freiheit als unabdingbare Normen [...]; christlich, ohne klerikale Einflüsse in der Politik zu dulden: Das waren die Leitsätze, unter denen die 220 Michel, S. 41. 79 Freie Demokratische Partei ihren Wahlkampf führte.“221 Faktisch bedeute dies, dass sich die FDP in der Wirtschaftspolitik gegen die SPD sowie den linken Flügel der CDU positionierte und den Bundestagswahlkampf vor allem mit wirtschaftspolitischen Themen führte, sich jedoch in der Kulturpolitik mit ihrem Konzept der christlichen Gemeinschaftsschule gegen die Vorstellungen der Union stellte und somit ihre Eigenständigkeit unterstrich. Einigkeit herrschte also in der Definition der FDP als strikt antisozialistische, nicht klerikale (jedoch nicht kirchenfeindliche) Partei. Die SPD wurde somit als Hauptgegner im bevorstehenden Wahlkampf gesehen. Einhellig wie selten erklärten die Exponenten der verschiedenen innerparteilichen Gruppen, dass der Bundestagswahlkampf mit aller „Schärfe gegen die SPD geführt werden“222 müsse, „damit eine SPD-Mehrheit verhindert werden kann“223. Ein einheitlicher Bundestagswahlkampf fand dennoch nicht statt. Zu sehr beharrten die größeren Landesparteien auf ihrer Eigenständigkeit, sodass es regional zu sehr unterschiedlichen Strategien und Vorgehensweisen kam. Während die Kampagnen in Süddeutschland – getreu dem Konzept der Mittelpartei – sowohl gegen Sozialdemokraten als auch gegen die Unionsparteien geführt wurden, traten die Freien Demokraten Hamburgs zusammen mit der CDU einen gemeinsamen Wahlblock an. Auch in anderen Ländern kam es zu Wahlabsprachen bzw. Bündnissen, von denen Eulers Allianz mit der „Nationaldemokratischen Partei“ von Heinrich Leuchtgens224, der den vierten Platz auf der hessischen Landesliste erhielt, die umstrittenste, aber zugleich auch mit einem Ergebnis von über 28 % sowie 7 errungenen Direktmandaten die erfolgreichste war225. 10.3 Bürgerliche Milieupartei oder rechte Sammlungsbewegung? Mit dem Ausscheiden der LDP(D) aus der DPD verlor das Konzept der liberalen Volkspartei zunehmend an Bedeutung. Da auch in der SBZ und später noch stärker in der DDR der Volksparteicharakter der LDP(D) eingeschränkt wurde, fehlte alsbald das in der Praxis existierende Modell für dieses Konzept. Die nächsten Jahre der westdeutschen Liberalen waren geprägt durch die Auseinandersetzungen zwischen den Befürwortern der bürgerlichen Milieupartei gegen die der nationalen Sammlungsbewegung. Aus diesem Widerstreit ergaben sich die beiden Flügel 221 Mende, S. 26. Franz Blücher in der Bundesvorstandssitzung der FDP, zitiert in: Michel, S. 43. 223 Ernst Mayer in der Bundesvorstandssitzung der FDP, zitiert in: Michel, S. 43. 224 Leuchtgens, als Vorsitzender der NDP, erhielt den aussichtsreichen vierten Platz auf der hessischen FDPLandesliste, über die er auch in den Bundestag einzog. 225 Tatsächlich ist dieses Ergebnis bis heute unübertroffen geblieben. 222 80 der FDP. Die Anhänger der nationalen Sammlung bildeten den rechten und die Vertreter der liberalen Traditionslinie bzw. der Milieupartei den linken Flügel der Freien Demokraten, wobei die Bezeichnung „links“ für die Traditionsdemokraten mehr der deutlichen Unterstreichung des Gegensatzes zu ihrem innenpolitischen Widerpart geschuldet ist, als dass sie der politischen Richtung dieser Gruppen entspricht. Diesen beiden sehr starken Flügeln stand nur eine relativ kleine Mitte gegenüber, sodass die Flügelkämpfe der nächsten Jahre die Partei immer wieder zu zerreißen drohten. In folgendem Punkt sollen an ausgewählten Beispielen die Flügelkämpfe innerhalb der FDP und das fortwährende Ringen um eine Kompromissfindung, um eine Spaltung der Partei zu verhindern, dargestellt werden. 11. Die Entwicklung der FDP bis 1953 Nach der ersten Bundestagswahl wurde die von Vertretern des linken Flügels der Union226 sowie einigen liberalen Politikern227 ins Spiel gebrachte Möglichkeit einer große Koalition unter Einbindung der Sozialdemokraten nicht verwirklicht. Stattdessen trat die FDP zusammen mit der DP als Juniorpartner an der Seite der Union in die Koalition des bürgerlichen Lagers ein, obschon dieses Bündnis lediglich über eine sehr knappe Mehrheit verfügte. Die Ministerien für Justiz (Dehler), Wohnungsbau (Wildermuth) und Europafragen (Blücher) gingen an die FDP. Zusätzlich stellten die Freien Demokraten auch mit Franz Blücher den Vizekanzler sowie mit Theodor Heuss den ersten Bundespräsidenten. Da Heuss sämtliche seiner Parteiämter von Amtswegen niederlegte und seine bundespräsidiale Rolle als eine politisch neutrale definierte, folglich für seine Partei nicht mehr zur Verfügung stand, verlor die FDP damit einen ihrer wichtigsten Programmatiker. Franz Blücher, sein Nachfolger im Amt des Parteivorsitzenden, war an Debatten über Grundsatzfragen nur wenig interessiert und zudem in die Kabinettsdisziplin in Bonn stark eingebunden, sodass es in den folgenden Jahren zu keiner Klärung der programmatischen Fragen kam. So wies die FDP weiterhin jene Heterogenität auf, die schon in Heppenheim deutlich geworden war. Zwar disziplinierte die Regierungsbeteiligung in Bonn die beiden Flügel der FDP und stabilisierte auf diese Weise die Partei, jedoch musste, um diese 226 Z. B. Jakob Kaiser, Jürgen Hilpert und Karl Arnold. So argumentierte u. a. Dehler für eine Beteiligung der SPD, um in der „schwierigen Zeit der Staatsgründung“ möglichst alle relevanten politischen Kräfte einzubinden, sowie „die im Wahlkampf aufgerissene politischen Kluft zwischen den Parteien zu überbrücken“. Ähnlich plädierten auch Haußmann und Höpker-Aschoff. (Görtemaker, S. 96f). 227 81 innerparteilichen Unterschiede zumindest teilweise zu überbrücken und eine Abgrenzung zu anderen Parteien vorzunehmen, ein liberales Profil präsentiert werden. Da die Erarbeitung eines gemeinsamen Programms nicht möglich war, wurden die unstrittigen Gemeinsamkeiten der Liberalen betont und hervorgehoben. Dies erfolgte allerdings auf der Basis von Gegenpositionen, d. h. da die künftige Parteiausrichtung ungeklärt war und vorerst blieb, einigte man sich darauf, was man nicht wollte. Als gemeinsame Positionen galten daher: der Antimarxismus, der sich in erster Linie sowohl gegen die KPD als auch die SPD richtete, aber sich auch ebenso gegen den christlichen Sozialismus des linken Flügels von CDU/CSU richtete, der Antiklerikalismus, der sich u. a. in der Ablehnung der von den Christdemokraten geforderten Bekenntnisschulen ausdrückte sowie das Eintreten gegen die Beteiligung von Gewerkschaft an wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen und das Eintreten gegen ökonomische Staatsinterventionen228. Diese Gegenpositionen und die Koalition im Bund führten zu einer verstärkten Polararisierung gegen die Sozialdemokraten. So galt die SPD aufgrund ihrer noch sehr starken klassenkämpferischen Ausrichtung als politisch unzuverlässig und stand wegen der marxistischen Grundhaltung auch permanent im Verdacht der Moskauhörigkeit, ihre „Ächtung“ traf folglich in der FDP auf breite Zustimmung. Diese Entwicklung spielte den Befürwortern eines Rechtskurses der FDP in die Karten, da sie ihren Vorstellungen vom Kampf gegen den Sozialismus entsprachen und sie ihnen spürbar Aufwind verliehen. Auf diese Weise stiegen innerparteilich Ansehen und Einfluss von Euler, Middelhauve, von Rechenberg und Stegner, also den Hauptrepräsentanten des rechten Flügels der FDP, weiter an. Die geradezu spektakulären Wahlerfolge, die die Repräsentanten der Parteirechten erzielten, so erreichten die hessische FDP unter Eulers Führung bei den Landtagswahlen 1950 sensationelle 31,8 % und überholten damit die CDU in der Wählergunst, ermutigten zur Beibehaltung bzw. Verstärkung des Rechtskurses. Dieser Zuwachs an Einfluss und Macht stachelte die Angriffslust des rechten Flügels der FDP immer weiter an, sodass es immer häufiger zu innerparteilichen Machtproben kam. Dies zeigte sich unter anderem in immer häufiger stattfindenden Kampfkandidaturen um Parteiämter. Als erster großer Erfolg für den rechten Flügel kann die Wahl von Euler im Januar 1951 zum Fraktionsvorsitzenden der FDP gesehen werden. Auf dem Münchner Bundesparteitag wagte der rechte Flügel gar, einen ihrer Repräsentanten, Hans Albrecht von Rechenberg, in einer Kampfkandidatur gegen den Bundesvorsitzenden Franz Blücher antreten zu lassen. Zwar konnte sich dieser letztlich nochmals mit 153 gegen 91 Stimmen 228 Hiervon ausgenommen wurden allerdings sämtliche Maßnahmen, z. B. Antikartellgesetze, die der Sicherung bzw. Wiederherstellung des wirtschaftlichen Wettbewerbs dienten. 82 durchsetzten. Da jedoch das Antreten von Rechenbergs mehr als Denkzettel gegen den Vorsitzenden und als Wahrnung an die Adresse von Bundeskanzler Adenauer gedacht war, war das Wahlergebnis dementsprechend innerhalb der Parteirechten abgesprochen und inszeniert worden229. Auf demselben Parteitag wurde der Streit um die Nationalhymne von den rechtsgerichteten Delegierten genutzt, um ein weiteres Zeichen zu setzen. Kaum hatte sich Blücher, stellvertretend für den Parteivorstand, zur dritten Strophe des Deutschlandliedes als neuer Nationalhymne bekannt und wollte diese vom Parteitag absingen lassen, stimmten die Delegierten des rechten Flügels lautstark die erste Strophe an230. Zu diesen Muskelspielen der Parteirechten in München und kurz danach zählten auch einige kontroverse Redebeiträge, wie die Forderung nach einer Generalamnestie nach dem „Tabula-rasa-Prinzip“231 und dem Ende der Entnazifizierung (von Rechenberg) oder die Gleichsetzung Kurt Schumachers mit Adolf Hitler (Euler). Mit diesen Demonstrationen gelang es der Parteirechten, ihren gestiegenen Einfluss und ihre gewachsene innerparteiliche Machtposition sichtbar werden zu lassen. Jedoch riefen diese Aktionen und Redebeiträge nicht nur den energischen Widerstand des linken Parteiflügels hervor, sie erregten auch in der als neutral geltenden Parteimitte Unmut und Widerwillen. Selbst der als nachsichtig geltende Blücher, der bis zum Münchner Parteitag stets bemüht war, sein Amt als Parteivorsitzender neutral zu führen, versuchte nun zusammen mit dem linken Parteiflügel, den Einfluss der Parteirechten zurückzudrängen. Seit dem Münchner Parteitag steigerten sich die Auseinandersetzungen innerhalb der FDP, und es begann endgültig der Kampf um die Ausrichtung der Freien Demokratischen Partei, der in den Jahren 1952/53 seinen Höhepunkt fand. In diesen Monaten stand die FDP mehrfach vor der Spaltung, mehrfach wurden bisher nur intern schwelende Konfliktherde und vorhandene Spannungen öffentlich ausgetragen. 11.1 Die Südweststaat-Krise Nach der erfolgreichen Volksabstimmung über eine Fusion der Länder Baden, WürttembergHohenzollern und Württemberg-Baden zum gemeinsamen Bundesland Baden-Württemberg Von Rechenberg selbst gab später an: „Das Wahlergebnis war genau abgezirkelt. Eine Stimme mehr für mich, und Blücher hätte nicht mehr mit gutem Gewissen annehmen können. Ein paar Stimmen weniger, dann wäre der Effekt […] verpufft.“ Zitiert in Rütten, Liberalismus, S. 234 230 Dies wurde vor allem von den bereits in der Weimarer Republik politisch tätigen Mitgliedern als ein Affront gegen die eigenen Traditionen verstanden. So bezeichnete Wildermuth diese Aktion des rechten Flügels auf einer späteren FDP-Vorstandssitzung als eine „SA-ähnliche Geschichte“. Vgl. Rütten, Liberalismus, S. 232ff. 231 Vgl. Rütten, Liberalismus, S. 232. 229 83 erfolgte am 09.03.1952 die Wahl der verfassungsgebenden Landesversammlung. Bei dieser erhielten die DVP 18 %, die CDU 35,9 %, die SPD 28 % und der Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE) 6,3 % der Wählerstimmen. Bundeskanzler Adenauer empfahl dem neuen Bundesland eine Allparteienregierung, um das Zusammenwachsen zu fördern und dieses nicht durch parteipolitische Diskrepanzen zu gefährden. Auch der Bundesvorstand der FDP „war einmütig der Meinung, die Fraktion in Stuttgart solle die große Koalition [Allparteienregierung] anstreben, und wenn dies nicht möglich wäre, mit der CDU in Koalition gehen“232. Jedoch zeigte sich alsbald, dass die Sozialdemokraten keinerlei Interesse an einer solchen Koalition hatten. Der Vorsitzende der Christdemokraten Gebhard Müller bemühte sich nun, keine Koalition nach Bonner Vorbild mit der DVP zu bilden. Dies gestaltete sich für ihn jedoch schwierig, da seine Partei im Wesentlichen noch aus verschiedenen Landesverbänden bestand, er folglich nicht garantieren konnte, dass einigen elementaren Forderungen der Liberalen entsprochen werden würde. Besonders mit den Stuttgarter Liberalen bestanden einige Meinungsverschiedenheiten, so hatten Teile der CDU die Länderfusion energisch abgelehnt, und eine Mehrheit in der Partei pochte auf die Einhaltung des „Reichskonkordats“ und damit auf den Erhalt der von der DVP bekämpften Bekenntnisschule. Eben um diese Fragen hatte die Führung der DVP, Wolfgang Haußmann als Landesvorsitzender und Reinhold Maier als Ministerpräsident in Württemberg-Baden, jahrelange Grundsatzdebatten mit der dortigen CDU geführt. Außerdem regierte Maier bereits seit 1950 mit der SPD, die ihm u. a. auch beim Kampf um die Gemeinschaftsschule gegen die CDU unterstützt hatte, in Stuttgart. Hinzu kam auch noch, dass Maier, der seit 1946 Ministerpräsident von Württemberg-Baden war, diese Position in einer Koalition mit der CDU wohl hätte preisgeben müssen, da die Christdemokraten in Baden und WürttembergHohenzollern stets die Regierungschefs gestellt hatten. Maier und Haußmann warben also in ihrer Fraktion für eine „kleine Koalition“, bestehend aus den Parteien, die die Gründung des Südweststaates stets vorbehaltlos unterstützt hatten. Dies bedeutete ein Regierungsbündnis mit der SPD sowie dem BHE unter dem Ausschluss der Christdemokraten. In den Gesprächen mit den Vertretern der Sozialdemokraten und des Vertriebenenbundes erzielte man schnell Fortschritte. Durch geschickte Verhandlungsführung gelang es Haußmann und Maier sogar, das Amt des Ministerpräsidenten für die DVP zu sichern. Jedoch würde eine solche Koalition bedeuten, dass die DVP-Führung einen ausdrücklichen Wunsch des Bundeskanzlers und einen ebenso unzweifelhaften Beschluss des FDP-Bundesvorstands einfach ignorieren würde. 232 Vgl. Protokoll S. 28, zitiert in Gutscher S. 121. 84 Der Bundesvorstand der Freien Demokraten bemühte sich seinerseits nun nach Kräften, dies zu verhindern. So gelang es Ernst Mayer als Fürsprecher, den Bundespräsidenten Theodor Heuss dafür zu gewinnen, auf seine alten Stuttgarter Weggefährten einzuwirken, um die sich anbahnende Koalition mit der SPD zu verhindern. Zugleich wurde versucht, bei Adenauer auf dessen Einwirken auf die Südwest-CDU zu dringen, um deren Entgegenkommen in einigen Positionen zu erreichen. Am 21.04.1952 konnte Blücher dem Bundesvorstand berichten, dass die CDU in der Schulfrage zur Beibehaltung des Status quo bereit sei, Mayer, immerhin immer noch Generalsekretär der DVP, gab zu Protokoll, dass die Christdemokraten sich den Positionen der DVP soweit angenähert hätten, dass „eine Absage an sie [die CDU] praktisch unmöglich“ wäre, zudem stünden „mindestens 75 % der DVP-Fraktion gegen Wolfgang Haußmann“233. Da aus Stuttgart aber immer noch keine positiven Signale kamen, wurde beschlossen, dass sich Mayer noch einmal fernmündlich mit Haußmann in Verbindung zu setzen habe. Für den Fall der Erfolglosigkeit seiner Intervention solle Hermann Schäfer als Botschafter des Bundesvorstands nach Stuttgart reisen234, um „die drohende SPD/DVPKoalition abzuwenden“235. Sämtliche Bemühungen des Bundesvorstands blieben letztlich erfolglos, denn am 25.04.1952 wurde Reinhold Maier mit den Stimmen von DVP, SPD und BHE unter lautstarken Protesten sowie heftigen Empörungen der Christdemokraten236 zum ersten Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg gewählt. Noch heftiger waren jedoch die Reaktionen auf Maiers Coup in der eigenen Partei. In einem zornigen Rundumschlag forderte Euler die sofortige Einberufung eines Sonderparteitags und den unverzüglichen Parteiausschluss der von ihm als „Demi-Marxisten“ bezeichneten Hauptverantwortlichen Maier und Haußmann. Middelhauve wies zwar diese Forderungen zurück, verlangte aber eine Änderung der Parteisatzung, sodass künftig sämtliche Länderkoalitionen einer Billigung durch die Bundespartei bedürften. Dehler und Schäfer bekräftigten zwar eine „moralische Bindung der DVP-Fraktion an die Bundespartei“237, wollten sich aber nicht für eine generelle Ablehnung von Koalition mit den Sozialdemokraten aussprechen. Auch in Baden-Württemberg selbst sah sich Maier alsbald Angriffen aus den eigenen Reihen ausgesetzt. So erklärte der Vorsitzende der DVP Württemberg-Hohenzollerns, Eduart Leuze, seine Ablehnung gegenüber der Stuttgarter Koalition und drohte, dem 233 Vgl. Sitzungsprotokoll vom 21.04.1952, S. 3, zitiert nach: Gutscher S. 122. Schäfer musste jedoch feststellen, dass Maier und Haußmann bereits Tatsachen geschaffen hatten, sodass er in Stuttgart nichts erreichen konnte. 235 Vgl. Sitzungsprotokoll vom 21.04.1952, S. 3, zitiert nach: Gutscher S. 122. 236 Hierzu muss angemerkt werden, dass Maier seine erste Rede mit den Worten „Gott schütze das neue Bundesland“ schloss, was viele CDU-Abgeordnete als eine direkt gegen sie gerichtete Provokation empfanden. Vgl. Hofmann, S. 262. 237 Vgl. Sitzungsprotokoll vom 11.11.1952, S. 2-3, zitiert nach: Gutscher S. 123. 234 85 Fusionsprozess zu einer gemeinsamen liberalen Landespartei künftig seine Unterstützung zu entziehen238. Die Gründe für diese heftigen Gegenrektionen waren verschiedenartig. Zum einen waren dies innenpolitische Gründe. Die damalige SPD war noch eine marxistische, klassenkämpferische Partei, deren Politik von vielen Liberalen energisch bekämpft wurde. Einige Politiker der FDP sahen in den Sozialdemokraten gar eine permanente Bedrohung für den Fortbestand der Bundesrepublik. Zudem waren beide Parteien schon in vielen Wahlkämpfen erklärte Gegner gewesen. Zum anderen lagen auch außenpolitische Gründe vor. Die Stuttgarter Koalition veränderte die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat, zugleich sollten in diesem Jahr die Verträge zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) verabschiedet werden. Die EVG-Verträge waren ein wichtiger Bestandteil der Außenpolitik der Bundesregierung, wurden jedoch von der SPD auf das Heftigste bekämpft. Nun würde Baden-Württemberg in der entscheidenden Zeit auch den Vorsitz in der Länderkammer innehaben, sodass dieses wichtige Projekt nun im Bundesrat zu scheitern drohte. Es gab also vielerlei Gründe, um die Stuttgarter Koalition zu missbilligen. Obwohl der Bundesvorstand mehrheitlich die Stuttgarter Koalition nicht guthieß, hielt man sich mit einer direkten formalen Stellungnahme vorerst zurück und wollte auf einer Sondersitzung am 01.05.1952, an der nur der Vorstand sowie die direkt Betroffenen, also die Südwest-Liberalen teilnehmen sollten, über den Antrag der Hessen beraten. Kurzfristig sagten sowohl Haußmann als auch Maier ihr Kommen ab, sodass die „Hauptschuldigen“ nicht anwesend waren. Dennoch wurde das Thema Südweststaat besprochen. Besonders der hessische Landesverband forderte einschneidende Maßnahmen gegen Maier und Haußmann.239 Aus den Reihen der Hessen wurde auch die Anschuldigung laut, die DVPLandtagsfraktion sei „Opfer einer Art des politischen Betruges, woran Haußmann schuld“240 wäre. Bemerkenswert ist hierbei, dass Dehler und Schäfer die hessischen Anschuldigungen zurückwiesen, Ernst Mayer und Pfleiderer dies jedoch nicht taten. Man verständigte sich darauf, das zweithöchste Parteiorgan, den Bundeshauptausschuss, einzuberufen, um die Südwest-Krise zu lösen. Am 17.05.1952 trat der Bundeshauptausschuss in Bonn zusammen, abermals war kein Mitglied des DVP-Landesvorstands erschienen. Erneut ließen sich Maier und Haußmann mit der Begründung entschuldigen, bereits andere unaufschiebbare terminliche Verpflichtungen 238 In der Tat blieb Leuze von da an der Gegenspieler Maiers in Baden-Württemberg. Seinen Landesverband löste Leuze erst 1953 nach langen innerparteilichen Auseinadersetzungen auf. 239 Das aggressive Verhalten der Hessen ist damit zu erklären, dass zu dem prinzipiellen Dissens, der zwischen ihnen und der DVP bestand, noch die bevorstehenden Kommunalwahlen (04.05.1952) hinzu kamen. Bei dieser drohten den Hessen Stimmenverluste. 240 Vgl. Sitzungsprotokoll vom 02.05.1952, S. 38, zitiert in: Gutscher S. 124. 86 zu haben, sie baten allerdings darum, die Tagesordnungspunkte, die die Koalition von Stuttgart zum Thema hatten, einstweilen zu streichen. Dieses Mal widersprachen nicht nur die Hessen dieser Bitte. Das wiederholte Nichterscheinen, besonders von Reinhold Maier, hatte dessen Rückhalt in der FDP geschwächt, sodass selbst enge Weggefährten Kritik übten. Sogar Lüders241, Dehler und selbst Heuss242 verlangten die Behandlung der Südwest-Problematik und kritisierten das Verhalten des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Dennoch herrschte über das weitere Vorgehen Uneinigkeit. Die Vorschläge reichten vom weiterhin vom Landesverband Hessen verlangten Ausschlussverfahren über die Rücktrittsforderung gegen Maier als Ministerpräsident bis zu einem von Middelhauve vorgeschlagenen Ehrenratsverfahren gegen Maier und Haußmann. Selbst in den einzelnen innerparteilichen Lagern gelang es nicht, zu einer einheitlichen Haltung zu gelangen. Während Maier in seinem eigenen Lager an Zustimmung zu verlieren schien, stritten sich die Vertreter des rechten Flügels, ob die Angelegenheit mit Härte, wie Euler und Middelhauve vorschlugen, oder mit Augenmaß, wie Mende243 empfahl, zu behandeln sei. So kam es zu einigen überraschenden Allianzen, z. B. als sich Ernst Mayer und Arthur Stegner gemeinsam gegen ein Ehrenratsverfahren aussprachen. Schließlich einigte man sich auf einen Kompromiss. Die Situation sollte auf einem außerordentlichen Landesparteitag in Baden-Württemberg selbst geklärt, auf parteidisziplinäre Schritte vorerst verzichtet werden. Als Maier sich allerdings über den Beschluss des Bundeshauptausschusses hinwegsetzte und statt eines Landesparteitags lediglich einen Landesvertretertag einberief, kam das „Problem Stuttgart“ erneut auf die Tagesordnung des FDP-Vorstands. Erneut hatte sich die Situation für Maier und Haußmann verschlechtert, denn nun sahen selbst Vorstandsmitglieder, die bisher zur Mäßigung geraten hatten, wie Mende, in der von Euler vorgeschlagenen Entlassung der DVP aus der Bundes-FDP ein akzeptable Lösung. Nach einigen Vorschlägen sollte die DVP innerhalb der Liberalen künftig denselben Status erhalten wie die CSU innerhalb der Union. Auf diese Weise hoffte Euler, die stärksten Kräfte der Alt-Liberalen aus der FDP entfernen zu können. So beschloss der Parteivorstand die Einberufung eines außerordentlichen Parteitags zum 12.07.1952 in Essen, auf dem die Stuttgarter Koalition parteiintern diskutiert werden sollte. Frau Lüders äußerte sich speziell zum Nichterscheinen Maiers: „Wir haben allen Grund erstaunt zu sein, wenn ein Familienmitglied von einer Familie dreimal [die beiden vorangegangenen Bundesvorstandsitzungen mitgezählt] eingeladen wird, und dann immer unter fadenscheinigen Gründen wieder absagt. Dann muß man beinahe annehmen, daß das Familienmitglied gar nicht mehr zur Familie gehören will.“; zitiert in: Gutscher, S. 125. 242 Zugleich forderte Heuss die Delegierten auf, nichts Überhastetes [Parteiausschluss] zu tun und riet davon ab, „die Dinge in die Öffentlichkeit zu tragen“, zitiert in: Gutscher, S. 125. 243 Mende galt zu dieser Zeit allgemein als ein Parteigänger Middelhauves, was sich jedoch während der Ereignisse von 1952-53 nicht bestätigen sollte. 241 87 Um diesen Sonderparteitag zu verhindern, nahm Haußmann am 15.06.1952 erstmals seit Monaten wieder an einer Sitzung des Vorstands teil. Er bat darum, statt eines Parteitags mit Gästen, lediglich eine Delegiertenversammlung unter Ausschluss von Gästen abzuhalten. Sein Ersuchen wurde allerdings abgelehnt. Da jedoch befürchtet wurde, es könnte auf dem Parteitag zu einer allgemeinen Diskussion um die politische Ausrichtung der gesamten Partei kommen, einigte man sich darauf, den Parteitag „hinter verschlossenen Türen“, d. h. mit nur einer sehr begrenzten Gästezahl stattfinden zu lassen. Dass der Parteitag quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, ist wahrscheinlich der Hauptgrund für seinen vergleichsweise ruhigen Ablauf. Dennoch musste der Bundesvorstand erneut in stundenlangen Beratungen hinter den Kulissen einen „Waffenstillstand“ zwischen rechtem und linkem Flügel aushandeln, und abermals kam es zum inzwischen üblichen Schlagabtausch zwischen den beiden konkurrierenden Lagern. Allerdings konnte das von Hessen angestrebte Ausschlussverfahren gegen Maier und Haußmann ebenso wie die drohende Abspaltung der DVP vermieden werden. Der in Essen ausgehandelte Kompromiss sah vor, dass die Stuttgarter Koalition vom Parteitag generell missbilligt wurde, aber dennoch fortbestehen durfte, sofern die Verantwortlichen garantierten, dass die Grundsätze der FDP hierbei gewahrt blieben und die innen- und außenpolitische Gesamtlinie der Partei nicht gefährdet würde. Damit wollte man vor allem auf das Stimmverhalten im Bundesrat einwirken, um eine Mehrheit für die abzustimmenden Verträge zu erhalten. Dass die Vertreter des rechten Flügels diesem Kompromiss zustimmten, liegt in der Tatsache begründet, dass es ihnen längst nicht mehr allein um die Stuttgarter Koalition, sondern viel mehr um die Gesamtausrichtung der FDP ging. Mit Reinhold Maier war nunmehr einer ihrer stärksten Widersacher und einer der wichtigsten Exponenten des linken Flügels politisch schwer angeschlagen, was bedeutete, dass sich sowohl er als auch die DVP vorerst bei den innerparteilichen Machtkämpfen würde zurücknehmen müssen. Allein die Tatsache, dass es ihnen gelungen war, einen Sonderparteitag gegen den Willen des stärksten linken Landesverbandes einzufordern, konnte als Erfolg für das rechte Lager gewertet werden. Auch war es den Landesverbänden Hessens und Nordrhein-Westfalens gelungen, in die Essener Resolution auch einen Passus zur Abwehr des „klassenkämpferischen Marxismus“ aufnehmen zu lassen, der der Denkweise des rechten Flügels entgegenkam, aber auch für die Gesamtpartei Gültigkeit besaß. Tatsächlich ging besonders Reinhold Maier aus der Südweststaat-Krise geschwächt hervor, allerdings war dies zu einem großen Teil seinem eigenen Verhalten während dieser Zeit geschuldet. Besonders der Versuch, die Krise „auszusitzen“, hatte ihn in Misskredit innerhalb des eigenen Lagers gebracht und zu immer weiteren Zuspitzungen geführt. Hinzu kam, dass 88 sein späteres Taktieren im Bundesrat und die Probleme, die ihm die CDU bei der Regierungsarbeit in Baden-Württemberg bereitete244, viele seiner persönlichen Kräfte und die seiner Partei banden, zugleich aber weiterhin zu Ansehensverlusten führten. In die großen Auseinandersetzungen um die Parteiprogrammatik gingen die Führungskräfte des stärksten Landesverbandes der Alt-Liberalen in einem denkbar schwachen Zustand. 11.2 Eine Partei – zwei Programme Beide innerparteilichen Strömungen versuchten bis zur Bundestagswahl 1953, die Partei programmatisch möglichst großteilig auf ihre Linie zu bringen. Da bis dahin kein Parteiprogramm existierte, konnten beide relativ frei bei der Ausgestaltung agieren. Die Beeinflussung des künftigen Parteiprogramms in ihrem Sinn war das Ziel beider FDP-Flügel. Dennoch war es eine Überraschung, als Friedrich Middelhauve im Juli 1952 das „Deutsche Programm – Aufruf zur nationalen Sammlung“ als Entwurf des Landesverbandes NordrheinWestfalen vorstellte. In diesem schwarz-weiß-rot umrandeten Programm wurden die Grundforderungen aller national gesinnten Rechten, also nicht nur die des rechten Flügels der FDP, artikuliert und eingefordert. So wurden u. a. die Einführung einer Präsidialdemokratie, in der das direkt zu wählende Staatsoberhaupt unabhängig von den Mehrheitsverhältnissen im Parlament Regierungen ernennen und entlassen können sollte, sowie die Umwandlung der Bundesrepublik in einen dezentralisierten Einheitsstaat, in dem die Länder lediglich als Verwaltungseinheiten fortbestehen sollten, gefordert. Diese und einige andere Forderungen waren bereits verfassungsrechtlich umstritten oder liefen ganz offen dem Grundgesetz zuwider. Weitere Passagen des „Deutschen Programms“245 hingegen, wie das Bekenntnis „zum Deutschen Reich als der überlieferten Lebensform“ des deutschen Volkes sowie der Forderung nach Widergutmachung des „Unrechts“, das „Nationalsozialismus, Siegerwillkür und Entnazifizierung schufen“, die so formuliert die Verbrechen der nationalsozialistischen Herrschaft faktisch mit der Entnazifizierung gleichstellten, waren geeignet, die Grenzen zum Rechtsradikalismus zu verwischen oder gar fließend werdend zu lassen. Überhaupt verwendeten die Autoren des Programms sehr stark das Vokabular der nationalen Rechten. So wurde der Zweite Weltkrieg ganz allgemein als „das Unglück, das über uns kam“ bezeichnet, 244 So blockierte die CDU zusammen mit einigen Abweichlern aus der Regierungskoalition die Durchsetzung wichtiger Landesgesetze sowie die Verabschiedung der Landesverfassung. 245 Im Folgenden wird zitiert aus dem „Deutschen Programm“, abgedruckt bei: www.politik-für-diefreiheit.de/files/77/Deutsche_Programm.pdf 89 das „Deutschlands tiefste Erniedrigung“ zur Folge hatte, die nun mit dem „Deutschen Programm“ überwunden werden sollte. Das „Deutsche Programm“ war von Beginn an nicht mit Blick auf eine mögliche Konsensfähigkeit innerhalb der FDP verfasst worden, sondern zielte vielmehr auf eine Kooperations- bzw. Fusionsmöglichkeit mit anderen Parteien, wie der DP und anderen rechten Parteien. Ziel war es, die FDP zu einer Massenpartei umzuformen, ihr Wähler aus Bevölkerungsschichten zuzuführen, die sich stark von der traditionellen Wählerschaft unterschieden. „Politische Macht sollte die FDP [künftig] zunächst durch ihre schiere Größe, nicht durch geschicktes Taktieren erringen.“246 Interessanterweise finden, wahrscheinlich wegen der Ausrichtung auf Akzeptanz bei rechts-nationalen Parteien, weder die Worte „liberal“ oder „demokratisch“ im „Deutschen Programm“ Verwendung, auch der Name der FDP fällt kein einziges Mal. Bereits im Oktober 1952 trafen sich Euler und andere Repräsentanten des rechten FPDFlügels mit hohen Funktionären der Deutschen Partei (DP). Bereits am 13.10.1952 verkündete Siegfried Zoglmann der Presse, man sei „übereingekommen, auf den kommenden Bundesparteitagen der FDP und der DP die Zusammenfassung aller nationalen Kräfte in Deutschland im Sinne einer sozialen, christlichen, freiheitlichen und rechtsstaatlichen Entwicklung zu beantragen“247. Als das „Deutsche Programm“ auf der Bundesvorstandssitzung am 25.10.1952 scharf kritisiert wurde, verwies Middelhauve stolz darauf, dass dieses „auch die Zustimmung der Deutschen Partei [DP] und der Nationalen Rechten gefunden“248 habe. Euler ergänzte: „Wir fühlen uns den Abgeordneten der DP, die durch ihre Arbeit im Bundestag gezeigt haben, daß sie wirtschafts- und staatspolitisch auf unserer Linie liegen, näher als einigen von uns, die unter dem Titel ‚gegen Faschismus und rechtsradikale Tendenzen zu kämpfen’ ihre geringe Einsicht verbergen. Was die Herrschaften Reif, Margulies, Ilk und Hoffmann aufführen, rechnet dazu.“249 Hiernach kam es zu Tumulten, u. a. warf Otto Bezold seine Akten auf den Tisch und rief: „Da können wir ja Schluß machen, ich gehen nach Hause, hier habe ich nichts mehr verloren.“250 Erst nach beschwörenden Appellen seitens des Parteivorsitzenden Blücher, die Einheit der FDP nicht auf diese Weise zu gefährden, gelang es, die Situation zu beruhigen. Die Antwort der Parteilinken ließ nicht lange auf sich warten. Unter der Federführung von Hans Reif und der Unterstützung der Landesverbände Hamburg, Baden-Württemberg, 246 Vgl. Hans-Heinrich Jansen, S. 202. Zoglmann in der „Frankfurter Rundschau“ vom 13.11.1952, zitiert in Rütten, Liberalismus, S. 242. 248 Laut Sitzungsprotokoll, zitiert in Rütten, Liberalismus, S. 242. 249 Ebd. 250 Ebd. 247 90 Bayern, Berlin und Rheinland-Pfalz entstand „Das Liberale Manifest“. Dieses stellte den Gegenentwurf zum „Deutschen Programm“ dar. Der nationalen Sammlung wurde die „Sammlung aller liberalen Kräfte“, dem Bekenntnis zum Deutschen Reich das uneingeschränkte Bekenntnis zur Bundesrepublik entgegen gesetzt. Im „Liberalen Manifest“251 wurde festgestellt: „Menschen liberaler Gesinnung müssen jetzt zusammenstehen, um die Freiheit des Schaffenden auf allen Gebieten wiederherzustellen und gegen die lebensfeindlichen Tendenzen des Kollektivismus aller Spielarten zu schützen. Kollektivismus und Vermassung sind nicht nur das Ergebnis kommunistischer Bestrebungen, sondern ebenso sehr eines überspannten, in Machtgedanken verirrten Nationalismus“. Gegen diese Gefahren könne man aber nur bestehen, wenn „eine starke liberale Mitte vorhanden ist, gegen die und ohne die Entscheidungen in der Demokratie nicht mehr möglich sind“. Zudem benannte man die historischen Verdienste des Liberalismus, wie den Rechtstaat, das frei gewählte Parlament, Föderalismus und Selbstverwaltung, zu denen man sich weiterhin uneingeschränkt bekannte. Um diese Errungenschaften zu erhalten und zu verteidigen, hieß es im „Liberalen Manifest“: „Wir bekämpfen daher jeden Radikalismus von rechts und links“. Die Zeit des Nationalsozialismus wurde als das „entsetzlichste Unglück aller Zeiten“ beschrieben für das „antiliberale Kräfte“ die Verantwortung trügen. Im Gegensatz zum „Deutschen Programm“ wurden also die liberalen Traditionen und das Grundgesetz der Bundesrepublik verteidigt, außerdem wurde das Konzept der Mittelpartei im Wesentlichen bestätigt. Zudem wurde mit Erscheinen des „Liberalen Manifests“ erstmals der Begriff „liberal“ offiziell als gemeinsames Etikett gewählt. Dies ist besonders deshalb bemerkenswert, da sich die Vertreter der Traditionslinie, z. B. die Anhänger der DVP, selbst stets als „Demokraten“ bezeichnet hatten. Auf dem Parteitag in Bad Ems kam es erneut zur direkten Konfrontation zwischen den beiden Flügeln. Beide Gruppen ließen bereits im Vorfeld des Parteitags keinerlei Neigung zu Kompromissbereitschaft erkennen. Um diese bemühte sich zwar erneut Blücher, der sich einmal mehr in die Rolle eines Schiedsrichters der FDP gedrängt sah, aber allein die beiden folgenden Redner personifizierten den innerparteilichen Konflikt. Mit Reinhold Maier ergriff einer der exponiertesten Vertreter des linken Flügels das Wort. Maier sprach sich energisch gegen das „Deutsche Programm“ aus und warnte vor den Gefahren, die eine Vernachlässigung der liberalen Grundsätze zugunsten einer Öffnung nach rechts bedingen würden. Er sprach den Anhängern des linken Flügels, aber auch den meisten der neutralen Mitte zugehörigen Liberalen aus dem Herzen, als er ausführte: „Ein Schrecken Im Folgenden wird zitiert aus dem „Liberalen Manifest“, abgedruckt bei: www.politik-für-diefreiheit.de/files/77/Das_Liberale_Manifest.pdf 251 91 fuhr uns in die Glieder, als wir von Gerüchten über eine neue FDP hörten, der Freien Deutschen Partei. Übersetzt man nämlich […] das Wort ‚frei’ mit national, so haben wir die neue Firma: Nationale Deutsche Partei. […] Dann machen wir es doch gleich richtig und sagen: Deutschnationale Volkspartei – und diese Partei wollen wir nicht!“252 Direkt nach Maier ergriff, stellvertretend für die Unterstützer des „Deutschen Programms“, August Martin Euler das Wort. Dieser verteidigte nicht nur den Rechtskurs, sondern sprach sogar von einer „Pflicht nach rechts“253, denn nur so könnte den Gefahren für die Demokratie, die von der SPD254 ausgingen, wirksam begegnet werden. Er argumentierte: „Gegenüber den alten Soldaten und den früheren Anhängern des Nationalsozialismus sollten wir eine Politik betreiben, die beherrscht ist von unserer Pflicht, diese Menschen für unseren demokratischen Rechtsstaat und unsere Partei zu gewinnen.“255 Mit den ständigen Warnungen vor der Gefahr, die von rechts drohe, stöße man „diese Menschen, die noch kein inneres Verhältnis zum demokratischen Rechtsstaat haben und die unserer Partei noch nicht gewonnen sind, vor den Kopf“256. Den Alt-Liberalen wie Maier warf Euler vor, die Fehler der Weimarer Zeit, „das nicht entschieden kämpferische Auftreten gegenüber der NSDAP und […] ein allgemeines Räsonnieren gegen die Gefahr von rechts“257, zu wiederholen. Diese Fehler hätten letztlich dazu geführt, „daß diejenigen [die damaligen Staatsparteiler] dann schließlich auch teilweise noch zu denen gehörten, die der Regierung Adolf Hitler das Ermächtigungsgesetz gaben“258. Der Grund, weshalb beide Seiten ihre begabtesten Redner vorschickten und diese sogleich schweres rhetorisches Geschütz auffuhren, war, dass sich keiner der Kontrahenten einer Stimmenmehrheit sicher sein konnte. Das Kräfteverhältnis wurde, trotz eines für die rechten Landesverbände günstigen Delegiertenschlüssels259, als in etwa gleich stark eingeschätzt. So versuchten die Repräsentanten der Parteirechten ebenso wie die der Parteilinken, möglichst große Unterstützung von der Parteimitte zu erhalten. Letztlich fühlte sich keiner der beiden Parteiflügel stark genug, den offenen Kampf und damit auch die Spaltung der Partei zu riskieren. Völlig überraschend jedoch drängte der Bericht der Mandatsprüfungskommission den Streit um die Programmatik der Partei in den Hintergrund. Dieser ergab, dass es bei den Delegiertenwahlen der Landesverbände Bremen, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein- 252 Aus der Bad Emser Parteitagsrede von Reinhold Maier, zitiert nach: Rütten, Liberalismus, S. 244. Michel, S. 53. 254 Die laut Euler versuchte, einen neuen Totalitarismus in Deutschland zu errichten. 255 Aus der Bad Emser Parteitagsrede von August Martin Euler, zitiert nach: Rütten, Liberalismus, S. 245. 256 Ebd. 257 Aus der Bad Emser Parteitagsrede von August Martin Euler, zitiert nach: Rütten, Liberalismus, S. 244. 258 Aus der Bad Emser Parteitagsrede von August Martin Euler, zitiert nach: Rütten, Liberalismus, S. 245. 259 Dieser errechnete sich aus absoluten Mitgliederzahlen und Wählerstimmen, was für die bevölkerungsreichen rechtslastigen Landesverbände, wie Nordrhein-Westfalen und Hessen, von Vorteil war. 253 92 Westfalen zu schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten gekommen war260. Daraufhin stellte sich die Frage, ob der Parteitag überhaupt beschlussfähig sei. So wurde von Bezold auf der eilig einberufenen Vorstandssitzung vorgeschlagen, die wichtigsten Entscheidungen, wie die Wahl des Vorstands, auf den nächsten Parteitag zu verlegen. Doch gerade dieser Vorschlag führte zu einer weiteren Eskalation. Aus Protest verließen mehrere Vorstandsmitglieder die Sitzung261. Dennoch hatte angesichts der Tatsache, dass die meisten Unregelmäßigkeiten in Landesverbänden mit betont rechter Ausrichtung vorgekommen waren, die Bereitschaft der Parteirechten, ihre Vorstellungen per Kampfabstimmung durchzusetzen, merklich abgenommen. So unterbreitete Euler schließlich den Vorschlag, dieses Mal zwei Stellvertretende Vorsitzende anstatt nur einen wählen zu lassen, um so der drohenden Kampfabstimmung zwischen Schäfer und Middelhauve zu entgehen. In der bis 3 Uhr morgens dauernden Sitzung einigte man sich auf drei innerparteiliche Koalitionsgeschäfte: Erstens wurden das „Deutsche Programm“ und „Das Liberale Manifest“ in die zuständigen Parteiausschüsse262 überwiesen. Diesen wurde damit die Aufgabe übertragen, daraus ein einheitliches FDP-Wahlprogramm zu gestalten. Zweitens wurde erstmalig ein zweiter stellvertretender Vorsitzender gewählt. Dieses Amt unterlag wie auch die der Beisitzer dem innerparteilichen Proporz. Drittens wurde der Delegiertenschlüssel für die nachfolgenden Parteitage verändert. Künftig sollten nicht mehr die Mitgliederzahlen, sondern nur noch das Stimmenaufkommen der Bundestagswahlen zur Ermittlung der Delegiertenzahlen maßgeblich sein. Tatsächlich folgten die Delegierten den Vorgaben des Vorstands. Erneut wurde Blücher zum Vorsitzenden und Hermann Schäfer, als Repräsentant der Parteilinken, zu seinem Stellvertreter gewählt. Das neu geschaffene Amt des zweiten Stellvertreters ging an Friedrich Middelhauve, der maßgeblich für das „Deutsche Programm“ verantwortlich gewesen war. Die Vorgänge des Emser Parteitags hatten erneut die Verwerfungen innerhalb der FDP öffentlich werden lassen. Angesichts der Tatsache, dass sowohl „Das Liberale Manifest“ als auch das „Deutsche Programm“ weiterhin vertreten wurden, konnte der neutrale Beobachter zu dem Schluss gelangen, dass sich unter dem Dach der FDP nicht nur zwei Flügel energisch bekämpften, sondern sich zwei ideologisch selbstständige und verfeindete Parteien gegenüberstanden, die lediglich auf die passende Gelegenheit warteten, um ihren Kontrahenten aus der Partei zu zwingen. Vorerst wurden weder das „Deutsche Programm“ noch das „Liberale Manifest“ beschlossen. So wurde von vielen erwartet, dass es schon bald 260 So waren beispielsweise die Delegierten aus Bremen nur vom Landesvorstand ernannt, jedoch nicht gewählt worden, beim Landesverband Niedersachsen wurden die angegebenen Mitgliedszahlen in Zweifel gezogen. 261 U. a. Ernst Mayer und Friedrich Middelhauve. 262 Dem Ausschuss gehörte u. a. erneut Erich Mende an, der eine Synopse der beiden Programme erstellte. 93 zur endgültigen Auseinandersetzung zwischen den beiden Flügeln der FDP kommen und 1953 das Jahr der Entscheidung werden würde. 11.3 Die Naumann-Affäre Das Jahr 1952 hatten dem rechten Flügel der FDP einige denkwürdige Triumphe beschert, die zu nicht unbeträchtlichen „Terraingewinnen“ im Kampf um die Gesamtlinie der Partei führten. Die „großen Drei des rechten Lagers“, die Landesverbände Hessen, NordrheinWestfalen und Niedersachsen, verzeichneten seit Jahren die stärksten Mitgliederzuwächse der gesamten FDP. Dies war zu einem großen Maße ihrer Strategie der Öffnung nach rechts zu verdanken. Tatsächlich hatten sich diese Landesverbände bzw. ihre Repräsentanten bereits sehr früh und sehr stark für die Belange der „Ehemaligen“263 eingesetzt sowie Soldaten- und Vertriebenenverbände unterstützt. Nicht zufällig findet sich deshalb im „Deutschen Programm“ die Forderung, von den „Urteilen der Alliierten, mit denen unser Volk und insbesondere sein Soldatentum diskriminiert werden sollten“264 Abstand zu nehmen. Prominente Vertreter des rechten FDP-Flügels, wie Euler oder Middelhauve, hatten sich bereits sehr früh für ein Ende der Entnazifizierung und eine Generalamnestie stark gemacht. Ähnlich waren sie auch in ihren Landesverbänden verfahren. „Wir haben nicht danach zu fragen, ob jemand früher einmal, so bedauerlich es ist, Schulungsbriefe der NSDAP geschrieben hat. Es ist nicht wesentlich, was der Betreffende 1934 gewesen ist, sondern was er heute ist.“265 Diese Aussage von Middelhauve beschrieb die Einstellung zu diesem Thema innerhalb des national gesinnten Lagers der FDP. Zugleich betonte besonders Euler oftmals, dass die „Ehemaligen“ bessere Streiter für die Sache des Antimarxismus seinen als dessen altliberale Kritiker. Die Verfechter der Rechtspartei waren stets der Meinung gewesen, die durch die Öffnung nach rechts einströmenden Neumitglieder im „Griff“ zu haben, d. h., ihren liberalen Schwerpunkt auch in der von ihnen erstrebten nationalen Sammlung behaupten zu können. Folgt man einigen ihrer Argumentationen, sahen sie ihren Rechtskurs nicht nur als taktisches Mittel, um der FDP neue Kräfte zuzuführen, sondern auch als eine Art Weg zur 263 Dies war die damals übliche Kurzbezeichnung für ehemalige Anhänger des Nationalsozialismus, sie galt sowohl für Parteigänger und Mitglieder als auch für Mitläufer der NSDAP. 264 Zitiert aus dem „Deutschen Programm“, abgedruckt bei: www.politik-für-diefreiheit.de/files/77/Deutsche_Programm.pdf 265 Friedrich Middelhauve. Zitiert nach: Gutscher S. 149. 94 Demokratisierung der „Ehemaligen“, der einstigen Berufssoldaten und der Vertriebenen266. Zudem hoffte man angesichts immer noch vorhandener struktureller Schwächen der liberalen Landesverbände im Vergleich zu den Massenparteien, durch den Rechtskurs einige engagierte Parteiarbeiter gewinnen zu können, um so das Defizit auszugleichen. Besonders im organisatorischen Bereich wollte man vom unbestreitbar vorhandenen Know-how einiger „Ehemaliger“ partizipieren. Den Bedenken der Alt-Liberalen, die um den Erhalt der liberalen Grundsätze fürchteten, entgegnete Middelhauve: „Ich bin der festen Überzeugung, daß wir als FDP, als liberale Partei so stark sind, daß wir das Einströmen der Leute, die vor 10 Jahren einen Standpunkt einnahmen, den wir verurteilt haben, als Mitarbeiter ohne Schaden für die Partei hinnehmen können.“267 Mit Beginn der Naumann-Affäre, benannt nach Werner Naumann, dem letzten Staatssekretär von Joseph Goebbels, wurde der Irrtum dieser Überlegung offenbar. In der Nacht vom 14. zum 15.01.1953 wurden auf Weisung des britischen Hohen Kommissars Kirkpatrick die wichtigsten Vertreter der später als Naumann-Kreis bekannten Gruppe vom englischen Geheimdienst verhaftet. Der Gruppe wurde vorgeworfen, Teil einer neonazistischen Verschwörung zu sein, die versucht hatte, durch gezielte Unterwanderung von Parteien, negativen Einfluss auf die Entwicklung der Bundesrepublik zu nehmen. Die Affäre weitet sich rasch auch auf die FDP aus, da einige der Verschwörer in engem Kontakt zu FDP-Politikern gestanden hatten. Dies verstärkte sich nochmals, als bekannt wurde, dass der persönliche Assistent von Middelhauve, Wolfgang Diewerge, zugleich auch der Vertraute Naumanns in der FDP war. Somit war der engste Mitarbeiter des Landesvorsitzenden der FDP als auch Middelhauve selbst belastet. Aufgrund dieser Tatsachen sowie durch die von den Briten nach und nach veröffentlichten Aufzeichnungen Naumanns sah sich der Bundesvorstand der FDP veranlasst, eine Untersuchungskommission, bestehend aus Thomas Dehler, Fritz Neumayer und Alfred Onnen, zur Klärung einzusetzen. Unter dem Vorsitz von Thomas Dehler begann diese „Dreierkommission“ mit der Analyse, inwieweit FDP-Landesverbände in die Machenschaften des Naumann-Kreises verstrickt waren. Zu bemerken ist, dass aufgrund der innerparteilichen Differenzen und der scharfen Frontstellung gegeneinander, tiefere Einblicke in die Interna eines Landesverbandes bis zu diesem Zeitpunkt so gut wie unmöglich gewesen waren. Die „Dreierkommission“ stellte u. a. nach Sichtung des ihr ab März zugänglichen Materials der britischen Behörden tatsächlich fest, dass Teile der FDP in der Tat fest in der Hand einst höher rangigerer ehemaliger Nationalsozialisten waren. 266 267 Siehe beispielsweise Eulers Äußerungen in Bad Ems, im vorherigen Punkt dieser Arbeit. Gutscher, S. 150. 95 Der Bericht Thomas Dehlers vor dem Bundesvorstand der FDP am 25.04.1953 verdeutlichte auch dem letzten Zweifler, wie tief Teile der FDP in die Naumann-Affäre verstrickt waren. Als besonders belastet erwiesen sich die Landesverbände Nordrhein-Westfalens und Niedersachsens, die besonders auf der Ebene der Geschäftsführer eine beängstigende Entwicklung aufwiesen. Insbesondere bei der Personalgewinnung der beiden Landesverbände schien Naumann eine nicht unwesentliche Rolle gespielt zu haben. So hatte der niedersächsische Landesvorsitzende Stegner, wie Dehler berichtete, mehrfach zwecks Personalgewinnung den telefonischen Kontakt zu Naumann gesucht. Es war sogar zu persönlichen Treffen zwischen Stegners Landesgeschäftsführer Horst Huisgen und Naumann gekommen. Das Prinzip der Außengeschäftsführung268 machte es Naumann relativ leicht, seine Leute zu platzieren. Als Geschäftsführer der Kreis- und Bezirksverbände waren viele, aber anscheinend nicht nur, ehemalige Nationalsozialisten an gut besoldete Positionen gelangt, von denen aus sie die Möglichkeit besaßen, den Prozess der Meinungsbildung in der FDP zu beeinflussen. Der Einfluss der „Ehemaligen“ reichte so weit, dass z. B. die Betreuung der „Deutschen Zukunft“, der Parteizeitung der FDP NRWs, komplett Personen mit NSVergangenheit anvertraut worden war269. Durch den Bericht Dehlers wurde beispielsweise der NRW-Landtagsabgeordnete und außenpolitische Experte der FDP, Ernst Achenbach, sehr schwer belastet. Aus dem Bericht ging hervor, dass Achenbach quasi als „Türöffner“ für Personen aus dem Naumann-Kreis fungiert hatte. Beispielsweise empfahl er Diewerge bei Middelhauve und stellte die beiden einander vor. Nach der Verhaftung des Naumann-Kreises übernahm Achenbach auch die juristische Verteidigung Diewerges. Dehler sah die Hauptschuld für diese Verstrickungen bei Friedrich Middelhauve, den er auch scharf kritisierte: „Wer ist schuld, daß Achenbach etwas bedeutet? Nur, Sie Herr Middelhauve. [...] Diewerge hatte intimste Beziehungen zu Naumann, Ihr nächster Ratgeber, Herr Middelhauve, der Mann dem Sie völlig vertraut haben, den Sie verteidigt haben, ein Werkzeug Naumanns war er!“270 Auch machte Dehler deutlich, dass er mit seiner Aussage Middelhauve direkt gemeint und nicht als stellvertretend für den NRW-Landsvorstand genommen hatte, denn er führte weiter aus: „Ich habe restloses Vertauen zu Mende, Weyer 268 In den Landesverbänden NRW und Niedersachen wurden die Geschäftsführer der Bezirks- und Kreisverbände nicht von diesen Parteigliederungen vorgeschlagen und gewählt, sondern direkt von der Landesgeschäftsführung, also zentral, bestimmt und eingesetzt. 269 Rütten, Plattform, S. 73. 270 Thomas Dehler laut Sitzungsprotokoll des FDP-Bundesvorstand vom 25.04.1953, zitiert nach: Rütten, Liberalismus, S. 255. 96 und anderen Vorstandsmitgliedern von Nordrhein-Westfalen, ich habe es aber nicht zu Ihnen.“271 Auch auf das von Middelhauve vorgelegte „Deutsche Programm“ ging Dehler in seinem Bericht ein: „Es steht fest, daß ein Herr Brand [Walter Brand] mit schlimmster politischer Vergangenheit [Brand war der Adjutant des „Reichsstatthalters Sudetengau“ Konrad Heinlein] das ‚Deutsche Programm’ in Bielefeld vorgelegt hat.“272 Dehler schloss seinen Bericht mit dem Satz: „Wenn das nicht genügt, sie273 politisch zu töten, ist es hoffnungslos.“274 Letztlich konnte die Untersuchungskommission feststellen, dass die FDP als solche nicht unterwandert war. Kein führendes FDP-Mitglied hatte belastende Verbindungen zu Naumann unterhalten, auch an der Basis ließ sich keine Unterwanderung erkennen. Die Unterwanderung betraf größtenteils das mittlere Parteimanagement, weshalb die Kommissionsempfehlung275 lautete: „Diewerge [...] und Brand haben schwer gegen die Grundsätze der FDP verstoßen. Sie sind aus der Partei auszuschließen. Ihre hauptamtliche Tätigkeit in der Partei ist, soweit noch nicht geschehen, zu beendigen.“ Im Fall von Middelhauve kam man zu dem Schluss, dass dieser „durch sein Verhalten eine Gefahr für den Bestand und das Ansehen“ der FDP heraufbeschworen habe, der gute Glaube ihm aber nicht in Abrede gestellt werden könne. Deutlich drastischer wurde über Achenbachs Verhalten beschieden. Es wurde festgestellt, „Herr Dr. Ernst Achenbach hat der Gesamtpartei durch sein Verhalten schwer geschadet. Er hat nach seiner Grundhaltung niemals zu uns gehört. Sein Ausscheiden aus der FDP ist unabweislich.“ Obwohl die Affäre für die Beteiligten somit relativ glimpflich ausging, hatte sie doch für das weitere Schicksal der FDP einschneidende Bedeutung. Die Gefahren, die eine Öffnung nach rechts für die Partei bedeuteten, wurden für jedermann ersichtlich. Die Naumann-Affäre wirkte auf die Befürworter einer Nationalen Sammlung wie ein Schock. Stärker noch als die gesamte Partei hatten sie über viele Wochen hinweg eine durchgängig negative Presse. Somit war ihre Angriffslust vorerst verflogen und einige ihrer wichtigsten Exponenten zumindest moralisch diskreditiert. Von diesem Schlag sollte sich der rechte Flügel in der Folgezeit nicht mehr erholen, sodass mit dem Ende der Naumann-Affäre auch die Ära seines scheinbar unaufhaltsamen Aufstiegs abrupt beendet wurde. 271 Rütten, Liberalismus, S. 255. Ebd. 273 Leider lässt sich nicht eindeutig klären, ob diese Aussage ausschließlich auf die Person Middelhauves oder auf die angestrebte Nationale Sammlung als solche zu beziehen ist. 274 Thomas Dehler laut Sitzungsprotokoll des FDP-Bundesvorstand vom 25.04.1953, zitiert nach: Rütten, Liberalismus, S. 255. 275 Im Folgendem wird zitiert aus dem Bericht der Kommission vom 05.06.1953 an den Gesamtvorstand. Quelle: http://www.kokhavivpublications.com/kuckuck/archiv/karc0007.html 272 97 Warum aber hatte der Naumann-Kreis versucht, gerade die FPD zu unterwandern? Zum einen war das Parteiensystem der Bundesrepublik innerhalb des Betrachtungszeitraumes dieser Arbeit noch keineswegs so gefestigt, wie es sich heute darstellt, sodass viele Beobachter es durchaus für möglich hielten, dass die FDP die CDU innerhalb des bürgerlichen Lagers würde überflügeln können. Ausschlaggebend waren jedoch zum anderen die Tatsache, dass die FDP keine strenge Parteidisziplin und Dogmatik kannte sowie die schon bekannte vorhandene schwache Organisationsstruktur der Liberalen. Diese strukturelle Schwäche war es, die Naumann zur Schlussfolgerung, „[m]it nur 200 Mitgliedern können wir den ganzen Landesverband [Nordrhein-Westfalen] erben“276, kommen ließ. Weit weniger bekannt als dieses Zitat aus Naumanns Aufzeichnungen ist sein Briefwechsel mit Wilhelm Kiefer, der als eine Art Spiritus Rector der rechten Szene fungierte, zum Thema „Unterwanderung der FDP“. Kiefer zeigte sich Naumanns Idee gegenüber sehr skeptisch, er schrieb: „Man sagt mir, daß Sie aufs engste mit der FDP in Rheinland-Westfalen liiert wären und [...] diese in ihrem Bemühen um die nationalen Kräfte sehr unterstützen. [...] Ich kenne die schönen Theorien [...], daß man durch eine solche Unterstützung der Bemühungen Middelhauves dahin kommen müsse und auch kommen werde, die FDP zu unterlaufen und sie unseren Zwecken untertan zu machen. Ich versichere Ihnen, daß sie das nie erreichen.“277 Diese Zweifel speisten sich hauptsächlich aus dem Fakt, dass die Nationalismen von Euler, Middelhauve, von Rechenberg und anderen Exponenten des rechten Flügels der FDP stets, wie bereits erwähnt, taktischer Natur waren und ihnen keine nationalistische Politik als Umsetzung folgte. So waren die exponierten Vertreter des Rechtskurses zugleich auch Befürworter der Westintegration der Bundesrepublik, was sie in der Realpolitik in eine Gegenposition zu den nationalistischen Kreisen brachte. Das erklärte Ziel dieser Gruppen war ein antikommunistisches, bewaffnetes und bündnisfreies bzw. neutrales Deutschland. Die Westintegration galt daher als Verrat an der nationalen Sache. Da die Bejahung der Westbindung aber Konsens durch alle innerparteilichen Lager der Freien Demokraten war und blieb, wandelte sich die Skepsis der nationalistischen Kreise gegenüber Naumanns Plänen in allmähliche Ablehnung. So schrieb Kiefer im November 1952, also noch vor der Aufdeckung des Naumann-Kreises, an Naumann: „Nach der Entscheidung der FDP für die Westverträge, für die auch die Gruppe um Middelhauve sich nunmehr entschieden hat, halte ich ein Zusammengehen unserer Kräfte mit der FDP für untragbar.“278 Es besteht also eine 276 Aus den Tagebuchaufzeichnungen Werner Naumanns, zitiert in: Gutscher, S. 157. Zitiert in: Rütten, Liberalismus, S. 249. 278 Ebd. 277 98 hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch ohne die Naumann-Affäre das Ende der Verfilzung von nationalistischen Gruppen und einem Teil der FDP absehbar gewesen wäre. 11.4 Die FDP nach der Bundestagswahl 1953 Der Herausforderung der zweiten Bundestagswahl musste sich die FDP unter denkbar ungünstigen Bedingungen stellen. Wegen der Flügelkämpfe und der beiden jeweils von einem Parteiflügel zu verantwortenden Krisen, war das Ansehen der Partei als solcher merklich gesunken. Der Dissens zwischen den beiden großen innerparteilichen lagern zeichnete sich auch dafür verantwortlich, dass eine ordnungsgemäße gemeinsame Wahlkampfplanung nicht realisiert werden konnte. Somit ruhte die Wahlkampfvorbereitung erneut ganz auf den Schultern der Landesverbände, was eine einheitliche Linie de facto unmöglich machte. Der einzige zu verzeichnende Vorteil war der, dass sowohl der rechte als auch der linke Flügel der FDP deutlich angeschlagen und geschwächt waren, somit erstmals seit langer Zeit der Partei keine Zerreißprobe bevorstand. So wurde der Wahlparteitag in Lübeck auch zum bis dato harmonischsten in der noch kurzen Geschichte der FDP. Die herrschende weitgehende Einmütigkeit die, „selbst die Formale Abstimmung über das Wahlprogramm erübrigte“279, war jedoch mehr der Kampfmüdigkeit als einer tiefgreifenden Übereinstimmung geschuldet. Die Entscheidung über die Ausrichtung der Partei wurde abermals vertagt, so dass das Lübecker Wahlprogramm jede Festlegung in diese Richtung vermied. Als einzige allgemein gültiger Verhaltensmaßnahme für die Wahl galt die Bitte Blüchers, die Koalitionspolitik in Bonn als Wahlkampfthema außen vor zulassen, bestehende Differenzen mit der CDU also nicht anzusprechen. Zur Koalition mit der CDU Adenauers sah der FDP-Vorsitzende zudem keinerlei Alternative. Aus den Erinnerungen Erich Mendes geht hervor, dass der Wahlkampf 1953 „in allen Landesverbänden zu einem Spießrutenlauf zwischen den beiden anderen Parteien CDU und SPD wurde, die mit offenen und versteckten Vorwürfen und Angriffen gegen die Liberalen nicht sparten, um ihr eigens Wählerpotential aufzubessern“280. Zudem gelang es der FDP kaum eigens Profil zu zeigen, so dass die Regierungserfolge fast ausschließlich Adenauer und der CDU zugerechnet wurden. Der Verzicht auf Kritik am großen Koalitionspartner führte 279 280 Michel, S. 58. Ebd., S. 55. 99 dazu, dass sich der FDP-Vorsitzende Schleswig-Holsteins, Bernhard Leverenz, oft fragte ob er auf einer „FDP-Versammlung oder eine Adenauer-Versammlung war“.281 Somit überraschte es wenig, dass es der FDP nicht gelang ihre Stimmanteile zu halten oder gar auszubauen. Obwohl aus heutiger Sicht der Absturz um 2,4 % von 11,9 % auf 9,5 % nicht sehr dramatisch wirkt, löste er 1953 in der FDP blankes Entsetzten aus. Dies lag vor allem daran, dass es in den bisherigen Hochburgen zu überdurchschnittlich hohen Verlusten gekommen war. So verloren Eulers Hessen im Vergleich zu 1949 mehr als 8 % ( von 28,1 % auf 19,7 %) die streitbaren Südwest-Liberalen um Maier und Haußmann büßten mehr als 5 % (von 18,2 % auf 12,7 %) ein. Obwohl er die FDP für eine Regierungsbildung nicht mehr benötigte, ging Adenauer eine erneute Koalition mit ihr ein, da er eine sich einer verfassungsändernden Mehrheit gewiss sein wollte. So lebten bereits bei der ersten Fraktionssitzung die alten Grabenkämpfe erneut auf, als sich hessische und baden-württembergische Liberale gegenseitig die Verantwortung für das schlechte Abschneiden ihres Landesverbandes zu wiesen. Nach Meinung der Hessen hatten die Stuttgarter Ereignisse maßgeblich zu ihren Verlusten beigetragen, die Südwest-Liberalen wiederum sahen in der Naumann-Affäre den Grund für ihr schlechtes Abschneiden. Für die Südwest-Liberalen war die Wahlschlappe vor allem deshalb besonders schmerzhaft, weil Reinhold Maier die Bundestagswahl zu einer Art Plebiszit sowohl über sein persönliches Schicksal als Ministerpräsident als auch über den Fortbestand der Regierungskoalition gemacht hatte. Maier hatte darauf gehofft mit einem guten Ergebnis, also quasi einer Bestätigung seiner Politik durch den Wähler, den Widerstand der CDU besonders in den Fragen der Landesverfassung Baden-Württembergs brechen zu können. Das es aber den Christdemokraten gelang die absolute Mehrheit der Wählerstimmen in Baden-Württemberg auf sich zu vereinen, sah sich Maier dazu gezwungen sein Amt niederzulegen und seiner Partei den Eintritt in eine Allparteienkoalition unter Führung der CDU zu empfehlen. Somit verloren die Südwest-Liberalen nicht nur Prozente bei der Bundestagswahl sondern auch „ihren“ Ministerpräsidenten. Nachdem sich die Gemüter in dieser Hinsicht wieder beruhigt hatten, wurden erstmals Vorwürfe gegen Blücher ob seiner nachsichtigen Haltung im Wahlkampf gegenüber Adenauer laut. Nach und nach wurde der Parteivorsitzende als Hauptgrund für die Profilschwäche der FDP im Wahlkampf verantwortlich gemacht. Zumal dieser auch weiterhin, mit Verweis auf seine Position als Vizekanzler und Minister, eine kritische Distanz zum Bundeskanzler ablehnte. In 281 Ebd., S. 62. 100 der FDP setzte sich damit relativ rasch die Meinung durch, dass der Vorsitzen möglichst bald auszutauschen sei. Als potentieller Nachfolger für Blücher wurde schnell Thomas Dehler ausgemacht. Dehler hatte als einer der wenigen FDP-Politiker bereits im Wahlkampf eine gewisse Distanz zur CDU erkennen lassen, zudem hatte er seinen Amt als Justizminister282 auf Betreiben Adenauers verloren, so dass er keinerlei Veranlassungen mehr hatte, um mit dem Bundeskanzler schonend umzugehen. Bereits die Wahl Dehlers zum Fraktionsvorsitzenden bedeute einen Paradigmenwechsel in der FDP-Geschichte. In seiner Person wurde der Burgfrieden zwischen linken und rechtem Flügel, seit dem Lübecker Parteitag herrschte, bestätigt, da Dehler in beiden Lager hohe Akzeptanz besaß. Der ehemalige Justizminister stand zu dem für eine neue Art des Umgangs mit der CDU und Bundeskanzler Adenauer. Anstatt sich wie bisher in Rolle des genügsamen Juniorpartners zu fügen und stets die Gemeinsamkeiten mit der Union hervorzuheben, sollte nun der „begrenzte Konflikt“ zur Maxime werden, indem die unterschiedlichen Auffassungen in bestimmten Politikbereichen, wie z.B. der Saarfrage, gezielt betont werden sollte. Mit dem Weg Dehlers an die Parteispitze trat auch eine weitere Parteienkonzeption zu den bisherigen hinzu. Dehlers Konzept entsprach dem der Korrektivpartei, also einer Partei, welches sich mehr oder weniger damit abgefunden hatte im Vergleich zu SPD und CDU klein zu sein, ihre Stärke aber durch Profilierung in ausgewählten Bereichen finden sollte. Dies bedeutet, dass man immer der kleinere Partner einer großen Partei seine müsste, um in einer solchen Koalition nicht wie 1953 befürchtet über kurz oder lang vom großen Partner aufgesogen zu werden, wurde es als erforderlich angesehen sowohl gegen die Opposition als auch gegen den Koalitionspartner Profilschärfung zu betreiben. Die Vorstellungen des Partners sollten korrigiert werden, um eine deutliche liberale Linie zu verdeutlichen. Das Korrektivkonzept übernahm Teile aus den Vorstellung der Rechtspartei, wie das strikte Bekenntnis zur deutschen Einheit und die Konfliktsuche zu den anderen Parteien in ausgewählten Fragen vermied aber die Überzeichnung des nationalen, von der Volkspartei übernahm man das Prinzip der Wählbarkeit durch alle Schichte, welche aber nicht mehr durch Kopieren der Massenparteien sondern durch breite Zustimmung in den bestimmten Politikfragen. Die meisten Anleihen bezog dieses Konzept von der Mittelpartei, verwarf jedoch dessen strikte Bindung an ein traditionelles Milieu, sondern legte besonderes Augenmerk auf die Mittelschicht, nicht mehr die Traditionsbindung sondern die Zustimmung in den mit der Union strittigen Fragen sollte der Partei ihre Wähler zu führen. 282 Dehler war ob des Verlustes seines Ministeramtes gegenüber Adenauer und Heuss zutiefst verbittert. 101 Ab Ende 1953 begann erneut ein Wettstreit der verschiedenen Konzepte für eine liberale Partei. Neben die Konzeption der Rechtpartei und der Mittelpartei trat von da an das Prinzip der Korrektivpartei. Während die beiden älteren Konzept allmählich an Bindungskraft verloren, gewann das neuere des Korrektivs weiter hinzu. 12. Fazit Die Frage, ob die Entwicklung des deutschen Parteiensystems lediglich einem Entwurf der Siegermächte folgend entstanden ist, also für deutsche Politiker keinerlei Möglichkeiten der Einflussnahme bestanden, muss verneint werden. Sollten die ehemaligen Alliierten tatsächlich die Einführung eines Vier-Parteiensystems beschlossen haben, so erfolgte dessen Umsetzung sehr dilettantisch. Denn nur selten gelang eine flächendeckende Ausprägung dieser Konstellation. Besonders mit Hinblick auf die Liberalen lässt sich feststellen, dass von einer generalstabsmäßig geplanten Konstituierung keinesfalls die Rede sein konnte. Auch sprechen die umfangreichen Aktivitäten zur Bürgerblockbildung nicht für eine vorherbestimmtes Parteienmodell. Vielmehr scheint sich zu bewahrheiten, dass vergleichbare Situationen zu ähnlichen Ergebnissen führen. Die Anfangsbedingungen waren für alle Parteien gleichermaßen schwierig. Hieß es doch nach Jahren der Diktatur, in einem vom Krieg schwer gezeichneten Land in mitten des täglichen Überlebenskampfes und dem Fehlen der meisten Mittel der Kommunikation, politisch tätig zu werden. So war die Kooperation aller politischen Politikrichtungen in den ersten Monaten die Regel, es entstanden die ersten Bürgerblocks. Erst allmählich begann die Ausdifferenzierung in verschiedene politische Richtungen und anschließend in Parteien. Hier existierte zwar mit der Lizenzvergabe bzw. deren Verweigerung ein wirksames Steuerungsmittel der Siegermächte, jedoch kam es nur innerhalb der SBZ zu einer konsequenten Anwendung dieses Mittels283. Hier Stellte die SMAD relativ früh klar, dass sie - vorerst - nicht mehr als vier Parteien lizenzieren würde. Dies und die frühe Vergabe der Lizenzen verschafften den Parteien ihrer Zonen einen gewaltigen Entwicklungsvorsprung. In den westlichen Besatzungszonen kann ein Trend zur protektionierten Schaffung eines Vier-Parteien-Systems nicht erkannt werden. Allein die Existenz von bürgerlichen Sammlungsparteien wie der von Heilbronn spricht gegen die These, dass die Entwicklung des deutschen Parteinsystems einem festgefassten Plan folgte und von Anfang an von den 283 Abgesehen von der Tatsache, dass nationalistische oder gar faschistische Parteien in keiner der vier Zonen eine Aussicht auf die Erteilung einer Lizenz hatten. 102 Siegermächten auf eine 4er Konstellation hin ausgerichtet wurde. Hätte ein Grundkonsens unter den Alliierten bestanden, wie z.B. Mitzel behauptet, dann wären solche Sammlungsparteien bereits im Vorfeld unterbunden worden. Auch wäre zu erwarten gewesen, dass die Besatzungsmächte um dieses Vier-Parteien-System zu fördern, aktiv eingegriffen, und z.B. die flächendeckende Gründung von Parteien durchgesetzt hätten. Zudem hat sich gezeigt, dass im Bezug auf die Beeinflussung des Parteiensystems, auch die Besatzungsmächte an gewisse Grenzen stießen. So gelang es z.B. den Amerikanern nicht, den von ihnen gewünschten „organischen“ Parteienaufbau durchzusetzen. Ebenso scheiterten die französischen Versuche, die Parteien ihrer Zone komplett von den Parteien anderer Zonen zu isolieren. Das sich am Anfang vielerorts ein System mit vier Parteien herausbildete, hat seine Ursachen eher darin begründet, dass an die Entwicklungen in Berlin, wo es zu den ersten Parteigründungen kam, versucht wurde anzuknüpfen bzw. diesen zu begegnen, in dem man selbst aktiv wurde. Jedoch sollte auch dieser Aspekt nicht allzu hoch bewertet werden, da angesichts der erschwerten und eingeschränkten Kommunikationswege sich Informationen nur sehr langsam und vage verbreiteten. Die unterschiedlichen Entwicklungswege besonders der westdeutschen lokalen liberalen Parteien zeigen, dass eine Orientierung an ein System von vier Parteien erst relativ spät, meist im Zuge der Gründung von Landesparteien, erfolgte und dieses System nicht allzu lange Bestand hatte, da im Laufe der Zeit mehrere neue Parteien 284 zugelassen wurden. Die von 1945-1953 für die Liberalen maßgeblichen Parteikonzeptionen waren die liberale Volkspartei, die Milieupartei bzw. die Partei der breiten bürgerlichen Mitte/Mittelpartei und die Rechtspartei. Während die beiden erst genannten bereits sehr früh große Anzugskraft besaßen, gelang es der Rechtspartei erst allmählich ihre Bedeutung zu steigern. So waren die ersten Jahre durch die Zwistigkeiten zwischen der LDP(D), die das Konzept der Volkspartei vertrat, und der DVP, die als Prototyp Partei der breiten bürgerlichen Mitte gesehen werden muss, bestimmt. Erst nach dem Ausscheiden der LDP(D) aus dem gemeinsamen Dachverband der Liberalen gelang es den Vertretern des Prinzips der Rechtspartei zum neuen Rivalen der Alt-Liberalen aufzusteigen. Das durch den Wegfall der LDP(D) entstandene innerparteiliche Machtvakuum wurde von den Werbern des Rechtskurses erfolgreich genutzt. Bereits mit dem Gründungstag der FDP begann der Kampf zwischen rechtem und linken Flügel um die Ausrichtung der Gesamtpartei. 284 Als Beispiel seien hier nur lokale Parteien wie die Niedersächsische Landespartei (die spätere Deutsche Partei) oder die Bayernpartei sowie Parteien mit z.T. deutschlandweiter Bedeutung wie das Deutsche Zentrum oder der spätere Bund der Vertriebenen und Entrechteten zu nennen, die in ein Vier-Parteien-System einfach nicht passten. 103 Jedes der drei Konzepte besaß auch gewisse Fehler bzw. beruht auf fehlerhaften Einschätzungen, die sich allerdings erst mit zeitlichem Abstand erkennen lassen. So unterschätzten die Befürworter der Mittelpartei, im geringeren Maße auch die des Konzepts der liberalen Volkspartei, die Anziehungskraft die von einer interkonfessionellen Partei wie der Union ausging bzw. waren davon ausgegangen, dass diese Partei bald wieder auf politischen Katholizismus zurückgeworfen werden und faktisch wieder zum alten Zentrum werden würde. Gleichzeitig überschätzten sie die eigene Bindungskraft, da sie wie selbstredend davon ausgingen, im bürgerlich-protestantischen Milieu über kurz oder lang ohne echte Konkurrenz zu sein. Zudem gingen die Hauptvertreter dieses Konzepts allzu sehr von ihren lokalen bzw. regionalen Gegebenheiten und Traditionen aus, die allerdings nicht auf andere Regionen Deutschlands übertragbar waren. Der Traditionsliberalismus wie er Maier, Haußmann und Mayer vorschwebte verfügte lediglich im deutschen Südwesten sowie in den beiden Hansestädten Hamburg und Bremen über die erforderliche Basis bzw. Milieu und den Rückhalt, den es erforderte die Rolle einer Mittelpartei zu spielen. In andern Teilen Deutschlands war diese Basis einfach zu schmal um Erfolge zeitigen zu können. Aus diesem Grund sahen sowohl der Entwurf der Volkspartei als auch der Rechtspartei eine starke Erweiterung dieser Basis vor. Während jedoch das Modell der Volkspartei eine liberale Mitte als Zentrum für die Partei vorsah, von der aus dann nach links und rechts „erweitert“ werden sollte, strebte das Konzept der Rechtspartei eine Verschiebung nach rechts an. Die Verfechter der rechten Sammlungspartei waren zumindest zeitweise bereit, den Liberalismus ausschließlich auf die Position des Antimarxismus zu reduzieren, also auf einige liberale Grundsätze vorrübergehend zu verzichten, um durch den erhofften Zustrom der rechten Kräfte die Partei deutlich zu verstärken. Dem gegenüber sah das Konzept der liberalen Volkspartei vor, die freisinnigen Grundsätze beizubehalten und nur mit einigen Erweiterungen zu versehen, um z.B. einen größeren Zuspruch bei der Arbeiterschaft zu erzielen. Beide Konzepte vernachlässigten allerdings den Fakt, dass mit einer solchen Veränderung der Grundsätze auch über kurz oder lang eine programmatische Veränderung der Partei erfolgen würde, mit ungewissen Ausgang für ihre liberalen Wurzeln. Bis 1953 konnte sich keines der drei Konzepte durchsetzten. Mit dem Ausscheiden der LDP(D) aus der DPD und der immer stärker werdenden Gleichschaltung der LiberalDemokraten verlor das Konzept der liberalen Volkspartei sowohl seinen wichtigsten Verstreter, als auch seine bis dahin durchaus vorhandene Attraktivität. Die Konzeption der Rechtspartei hatte mit der Naumann-Affäre eine Rückschlag erlitten und war derartig diskreditiert, dass der Plan, die FDP in eine rechte Sammlungspartei umzuwandeln, nicht mehr weiter verfolgt wurde. Auch die Vertreter der Konzeption der Mittelpartei, also die 104 traditionell ausgerichteten Liberalen hatten durch die über Monate andauernde Südwest-StaatKrise an Ansehen verloren und bei der Bundestagswahl empfindliche Einbußen hinnehmen müssen. Zudem bedeutete diese Wahlschlappe sowohl das Ende der so mühsam aufrechterhaltenen Koalition als auch der Ära des Ministerpräsidenten Reinhold Maier. Zum Ende 1953 wurde damit begonnen eine gänzlich neue Konzeption, die der Korrektivpartei, zu erarbeiten. Dieses Konzept wurde allerdings erst ab 1954 mit der Übernahme des Parteivorsitzes durch Thomas Dehler ernsthaft betrieben, so dass es in dieser Arbeit nur benannt, aber nicht analysiert wurde. Die Kontroversen zwischen Berlin (LDP(D)) und Stuttgart (DVP) können als eine Wiederholung des alten Konfliktes aus der Frühzeit der liberalen Bewegung betrachtet werden. Wie bereits in der Paulskirche und später im Preußischen Landtag ging es auch 19451948 um die Fragen, ob der Einheit oder der Freiheit der Vorzug zu geben sei. Während Külz als LDP(D)-Vorsitzender ersehnte durch Einheit zur Freiheit zu gelangen, bestanden Mayer und die Führung der DVP auf dem Grundsatz, dass nur durch Freiheit auch die Einheit errungen werden könnte. Hierbei ist allerdings anzumerken, dass den Liberalen der SBZ die Freiheit sicher ebenso wichtig war wie ihren Pendants im Südwesten, jedoch sahen sie in der Wiederherstellung der deutschen Einheit den einzigen Weg, diese Freiheit wiederzugewinnen. Die späteren Differenzen zwischen dem linken und dem rechten Flügel der FDP erscheinen oberflächlich betrachtet ebenfalls als eine Neuauflage der Streitigkeiten zwischen NationalLiberalen und Liberal-Demokraten zu sein, dies ist jedoch nicht der Fall, da es bei diesen Auseinandersetzungen viel mehr darum ging, ob die FDP künftig eine dezidiert liberale Partei bleiben sollte oder in eine Rechtspartei mit liberalen Elementen umgewandelt werden würde. Es ging hierbei also mehr um den Fortbestand der FDP als Partei des politischen Liberalismus oder um einen grundsätzliche Wechsel ins rechts-nationale Lager. Zwar ließen die Exponenten des Rechtskurses wie Euler oder Middelhauve ihrer rechten Rhetorik keine wirkliche nationalistische Politik folgen, jedoch wurde mit der Naumann-Affäre sehr deutlich, dass die Gefahr der Umgestaltung der FDP in eine rechts-nationale Partei bestanden hatte und bei einem Erfolg des „Deutschen Programms“ wohl auch kaum zu verhindern gewesen wäre. Inwieweit gelang es die eingangs erwähnten Hauptziele der liberalen Bewegung zu verwirklichen? Bei dieser Beurteilung muss zwischen den Entwicklungsverläufen in Ost und West unterschieden werden. Lange Zeit hatten die führenden Köpfe der LDP(D) dem Ziel der deutschen Einheit alles andere untergeordnet und hatten vielen Einengungen der individuellen sowie wirtschaftlichen Freiheiten nicht entgegengewirkt bzw. diesen sogar zugestimmt. Erst ab 1948 wurde der 105 Versuch unternommen, einen Oppositionskurs gegen die SED einzuschlagen, was allerdings die bereits begonnene Gleichschaltung der Partei nicht mehr aufhalten konnte. So konnte die LDP(D) auch nicht die Tatsache nutzen, dass sie die einzige liberale Partei war, der es je gelang eine Massenpartei zu werden. Die Liberal-Demokraten waren zudem die einzige liberale Partei die sich bis 1953 auf ein Parteiprogramm einigen konnte. Unter dem anhaltenden Druck von SED und SMAD gelang es ihr jedoch nicht, diese Umstände zu ihrem Vorteil zu nutzen und liberale Politik zu betreiben. Mit der von SED und SMAD initiierten Gründung der NDPD wurde zudem die Einheit der Liberalen „von außen“ beendet, so dass die Einheit der Liberalen nicht mehr bestand. Spätestens als der von der SED protegierte und in der eigenen Partei zutiefst verhasste Hans Loch zum alleinigen Vorsitzenden wurde, konnte die LDP(D) nicht mehr als anti-sozialistische Partei bezeichnet werden. Der neue Vorsitzende versuchte vielmehr eine Theorie des „neuen Liberalismus“ zu konstruieren, die den Aufbau des Sozialismus als ein ur-liberales Ziel definierte, die Überwindung des „Individualismus“ propagierte und die Umwandlung der LDP(D) in eine sozialistische Partei forderte. In diesem Sinne war die LDP(D) als die Vertreterin der liberalen Volkspartei bei der Durchsetzung der eingangs benannten Ziele am wenigsten erfolgreich. Weder gelang es die liberalen Bürger- und Freiheitsrechte zu verteidigen noch die Marktwirtschaft zu verteidigen. Die Einheit der Liberalen konnte nicht aufrecht erhalten und die deutsche Teilung nicht überwunden werden. Obwohl diese Misserfolge zu einem Großteil „künstlich“ und „von außen“ herbei geführt wurden, wurden die Liberal-Demokarten doch auch Opfer ihrer eigenen Politik. Dadurch, dass vielen führenden Köpfen der LDP(D) der Erhalt der Partei zur einzigen Maxime geworden war, sie sich daher letztlich allen Wünschen von SMAD und SED beugten, erleichterten sie die Gleichschaltung ihrer eigenen Partei beträchtlich und wurden in letzter Konsequenz durch SED-treue Kräfte ersetzt. Die westdeutschen Liberalen waren mit der Gründung der FDP in einer gemeinsamen Partei organisiert. Somit gelang es zumindest auf dem Gebiet der späteren Bundesrepublik die Einheit der liberalen Strömungen vorerst sicher zu stellen. Durch diese, wenn auch mühsam aufrecht erhaltene, Einheit der Liberalen wurde es möglich die Ziele des Liberalismus durchzusetzen. Bereits im Wirtschaftsrat der Bi-Zone, wo die Liberalen als strikte Verfechter der Marktwirtschaft auftraten, bildete sich eine Lagerkonstellation, die der späteren Bundestagskoalition aus Christdemokraten, DP und FDP in weiten Zügen entsprach, so dass diese Institution als Vorort des späteren Regierungsbündnisses gelten kann. Da die Delegation der Liberalen im Wirtschaftsrat stark von den Vertretern des Rechtskurses dominiert wurde, war die strikte Frontstellung, die diese Fraktion gegenüber der SPD einnahm, nicht 106 verwunderlich. Durch ihre konsequente Haltung erreichten die Beauftragten der FDP, dass die bis dato noch unentschlossenen Christdemokraten auf ihre marktwirtschaftliche Linie einschwenkten. So gelang es, die Pläne zur Sozialisierung der Wirtschaft, die von der SPD aber auch von Teilen der CDU vertreten wurden, scheitern zu lassen. Im Parlamentarische Rat zu Bonn vertrat die liberale Fraktion, in der die Vertreter der Mittelparteienkonzeption federführend waren, eher eine Mittlerrolle zwischen den beiden großen Parteien CDU und SPD, ganz wie es diesem Konzept entsprach. Durch dieses Vorgehen waren Entscheidungen fast nur durch die Aushandlung von Kompromissen möglich, so dass es hierüber zum ersten großen Konflikt zwischen den späteren Flügeln der FDP kam, da besonders die Parteirechte eine kämpferisches Eintreten für die liberale Linie, selbst um den Preis des Scheiterns, bevorzugt hätte. Dennoch gelang es den Liberalen, im Parlamentarischen Rat durch ihr Taktieren sowohl den Klerikalismus, den ein Teil der Christdemokraten befürworteten, als auch den Sozialismus der Sozialdemokraten in seine Schranken zu verweisen und einen relativ gut ausbalancierten Verfassungsentwurf mitzuerarbeiten. Der relative große Erfolg der FDP bei der ersten Bundestagswahl ermöglichte eine bürgerliche Koalition in der die Liberalen ihre Vorstellungen mit einbringen konnten. Da eine Koalition von CDU/CSU und SPD vermieden werden konnte, die eine stärkere Sozialisierung bzw. Verstaatlichung der Wirtschaft zur Folge gehabt hätte, gelang es den Liberalen z.B. ihre marktwirtschaftlichen Vorstellungen in der Bundesrepublik durchzusetzen. Die soziale Marktwirtschaft von Ludwig Erhard wäre ohne die FDP nicht möglich gewesen. Dadurch, dass sie die Kräfte der Liberalen bündelte, gelang es der FDP sowohl den sozialistischen Vorstellungen der SPD und des linken Flügels der CDU, als auch dem Klerikalismus den Teile der CDU befürworteten wirksam entgegen zu treten. Bis auf die deutsche Einheit, die angesichts der weltpolitische Lage nicht möglich war, hatten also die westdeutschen Liberalen die meisten gesellschaftspolitischen Ziele erreicht. Selbst die Einigung der liberalen Kräfte war ihnen gelungen. Diese Einigkeit muss allerdings als äußerst fragil angesehen werden, da aufgrund der heftigen Flügelkämpfe die Partei mehrfach kurz vor der Spaltung stand. Jedoch wurde diese stets vermieden, trotz aller Differenzen wollte niemand eine Auseinanderbrechen der FDP riskieren. Diese Flügelkämpfe erreichten ihren Höhepunkt 1952, als jedes Lager mit dem „deutschen Programm“ und dem „Liberalen Manifest“ jeweils ein eigenes Programm für die Gesamtpartei vorlegten. Nur die Tatsache, dass beide Lager im Laufe der nächsten Monate durch Südwest-Staat-Krise bzw. Naumann-Affäre geschwächte, waren bewarte die FDP vor einem existenzbedrohenden finalen Flügelkampf. 107 Dennoch zeigen auch diese Flügelkämpfe wie wichtig allen Liberalen der Erhalt der Einheit ihrer Partei war. Selbst 1952/53, auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen zwischen linkem und rechtem Flügel, forderte niemand die Abspaltung. Das äußerste Maximum ist der während der Südwest-Staat-Krise aufkommende Vorschlag der DVP einen ähnlichen Status zuzugestehen wie der CSU innerhalb der Christdemokratie. Man war zwar bereit, sich von den Stuttgartern zu distanzieren und verlangte z.T. auch Parteistrafmaßnahmen gegen führende Köpfe der Südwest-Liberalen, aber eine endgültig Separation wurde weder gefordert noch erwünscht. Immer wenn sich die innerparteilichen Konflikte extrem zuspitzten, suchten selbst so kämpferische Exponenten wie Euler und Maier lieber durch Kompromisse, Proporzregelungen und Absprachen die Situation zu entschärfen, als es auf die Existenz der FDP gefährdende Kampfabstimmungen ankommen zu lassen. Um die Einheit der Liberalen zu erhalten war man bereit, sehr weit zu gehen und die z.T. beträchtliche Unterschiede zwischen rechtem und linkem Flügel zu tolerieren. Diese Handhabung verlangte allerdings auch eine gewisse programmatische Unschärfe, um den „Burgfrieden“ zwischen den beiden innerparteilichen Kontrahenten zu bewahren, so musste z.B. auf ein Parteiprogramm der FDP verzichtet werden. Die zeitgenössische Einschätzung, dass sich unter dem Dach der BundesFDP nicht nur zwei Flügel, sondern Anfang der 50er Jahre sogar zwei ideologisch selbständige Parteien gegenüberstanden, mag angesichts des „Deutschen Programms“ und des „Liberalen Manifests“ durchaus zutreffend sein, aber viel wichtiger war, daß diese beiden Lager unter diesem einen Dach blieben. Nicht die Frage, ob die FDP der Gründerjahre der Bundesrepublik nur teilweise eine liberale Partei war ist hierbei entscheidend, sondern die Tatsache, dass es sich im Gegensatz zur Weimarer Republik und zum Kaiserreich um eine Partei handelte. Denn dieser Punkt erst ermöglichte es den Liberalen in diesen Jahren eine entscheidende Rolle bei der Wiederbegründung eines demokratischen Parteiensystems in Deutschland zu spielen. Um sich in dieser Rolle allerdings weiterhin behaupten zu können, mussten, wie die Bundestagswahl 1953 deutlich zeigte, gänzlich neue Wege beschritten werden. 108 13. Literatur- und Quellenverzeichnis Adam, Uwe Dietrich: Politischer Liberalismus im deutschen Südwesten 1945-1978, in: Rothmund, Paul/ Wiehn, Erhard R. (Hg.): Die F.D.P./DVP in Baden-Württemberg und ihre Geschichte: Liberalismus als politische Gestaltungskraft im deutschen Südwesten, Stuttgart, S. 220-253. Agsten, Rudolf/Bogisch, Manfred: LDPD auf dem Weg in die DDR. Zur Geschichte der LDPD in den Jahren 1946-1949, Berlin (Ost), 1977. Agsten, Rudolf: Liberaldemokrat seit 1945. Erinnerungen ohne Nostalgie, in: Mayer, Herbert: Hefte zur DDR-Geschichte 93, Berlin, 2005. Albertin, Lothar: Liberalismus und Demokratie am Anfang der Weimarer Republik, Düsseldorf, 1972. Albertin, Lothar (Hg.): Politischer Liberalismus in der Bundsrepublik, Göttingen, 1980. Berger, Dietrich: Das Erbe der Väter. Für Demokratie und freie Wirtschaftsordnung, in: Rothmund, Paul/ Wiehn, Erhard R. (Hg.): Die F.D.P./DVP in Baden-Württemberg und ihre Geschichte: Liberalismus als politische Gestaltungskraft im deutschen Südwesten, Stuttgart, 1979, S. 181-200. Dahrendorf, Ralf: Liberale und andere, Stuttgart, 1994. Dittberner, Jürgen: Die FDP – Geschichte, Personen. Organisation, Perspektiven. Eine Einführung, Potsdam, 2005. Fliszar, Fritz: Mit der FDP regieren – Ein Gespräch mit Erich Mende (7. Juni 1988), in: Mischnick, Wolfgang (Hg.): Verantwortung für die Freiheit, 40 Jahre F.D.P., Stuttgart, 1989, S. 125-155. Frölich, Jürgen: Zur Verfolgung von Liberaldemokraten in der SBZ und DDR bis 1961, in: Jahrbuch zur Liberalismus-Forschung 12 (2000), Baden-Baden, S. 215-228. 109 Frölich, Jürgen: Liberaldemokratische Partei Deutschlands (LDPD). In: Stephan, GerdRüdiger (Hg.): Die Parteien und Organisationen der DDR. Ein Handbuch, Berlin, 2002, S. 3681. Gerlach, Manfred: Mitverantwortlich. Als Liberaler im SED-Staat, Berlin, 1991. Gerlach, Manfred: Liberale in der DDR und Deutschlandpolitik in der LDPD – Fragen und Anmerkungen. In: Hübsch, Reinhard/Frölich, Jürgen (Hg.): Deutsch-deutscher Liberalismus im Kalten Krieg. Zur Deutschlandpolitik der Liberalen 1945-1970, Potsdam, 1997, S. 167185. Görtemaker, Manfred: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Von der Gründung bis zur Gegenwart, München, 1999. Grundmann, Karl-Heinz: Zwischen Verständigungsbereitschaft, Anpassung und Widerstand: Die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands in Berlin und der Sowjetischen Besatzungszone 1945-1949, Bonn, 1978. Gutscher, Jörg Michael: Die Entwicklung der FDP von ihren Anfängen bis 1961, Meisenheim am Glan, 1967. Hein, Dieter: Zwischen liberaler Milieupartei und nationaler Sammlungsbewegung. Gründung, Entwicklung und Struktur der Freien Demokratischen Partei 1945-1949, Düsseldorf, 1985. Hein, Dieter: Der Weg nach Heppenheim 1945-1948, in: Mischnick, Wolfgang (Hg.): Verantwortung für die Freiheit, 40 Jahre F.D.P., Stuttgart, 1989, S. 48-65. Heuss, Theodor: Friedrich Naumann. Der Mann – das Werk – die Zeit, Gütersloh, 1968 (3. Auflage). Hofmann, Wilhelm: Die Zeit der Regierungsbeteiligung, in: Rothmund, Paul/ Wiehn, Erhard R. (Hg.): Die F.D.P./DVP in Baden-Württemberg und ihre Geschichte: Liberalismus als politische Gestaltungskraft im deutschen Südwesten, Stuttgart, 1979, S. 255-280. 110 Jansen, Christian: Einheit, Macht und Freiheit. Die paulskirchenlinke und die deutsche Politik in der nachrevolutionären Epoche 1849-1867, Düsseldorf, 2005. Jansen, Hans-Heinrich: Dritte Kraft oder Partei der Mitte? Die Auseinandersetzungen über die Stellung der FDP im deutschen Parteiensystem zu Beginn der fünfziger Jahre, in: Jahrbuch für Liberalismusforschung 2001, S. 200-208. Kaack, Heino: Geschichte und Struktur des deutschen Parteiensystem, Obladen, 1971. Kaack, Heino: Die Liberalen. Die FDP im Parteiensystem der Bundesrepublik, in: Löwenthal, Richard/Schwarz, Hans-Peter (Hg.), Die zweite Republik, 25 Jahre Bundesrepublik – eine Bilanz, Stuttgart, 1974, S. 408-432. Kaack, Heino: Die FDP im politischen System der Bundesrepublik Deutschland, in: Mischnick, Wolfgang (Hg.): Verantwortung für die Freiheit, 40 Jahre F.D.P., Stuttgart, 1989, S. 19-45. Kowalczuk, Ilko-Sascha: Opfer der eigenen Politik? Zu den Hintergründen der Verurteilung von Minister Karl Hamann (LDPD), in: Jahrbuch zur Liberalismus-Forschung 15 (2003), Baden-Baden, S. 221-272. Krieg, Harald: Die Rolle „nichtsozialistischer Parteien“ in der SBZ bzw. „DDR von 19481958, Bonn, 1961. Krippendorff, Ekkehart: Die Liberal-Demokratische Partei Deutschland in der Sowjetischen Besatzungszone 1945/48 – Entstehung, Struktur, Politik. Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Band 21, Düsseldorf, 1961. Lapp, Peter Joachim: Die "befreundeten Parteien" der SED. DDR-Blockparteien heute, Köln,1988. Lukemeyer, Ludwig: Liberale in Hessen 1848-1980. Festschrift anlässlich des 60. Geburtstags von Heinz Herbert Karry, Frankfurt am Main, 1980. 111 Mählert, Ulrich: Liberale Jugendarbeit in der SBZ und DDR von 1945 bis 1952, in: Steinborn, Tom/Klatte, Ivo: Liberale Jugend in Ostdeutschland, Dresden, 1994. Malycha, Andreas: Die SED. Geschichte ihrer Stalinisierung 1946-1953, Paderborn, 2000. Marcowitz, Reiner: Manfred Gerlach – ein „Liberaler im SED-Staat“? Individuelles und Typisches seiner Biographie, in: Jahrbuch zur Liberalismus-Forschung 15 (2003), BadenBaden, S. 243-264. Maier, Reinhold: Ende und Wende, Das Schwäbische Schicksal 1944 bis 1946, Stuttgart/Tübingen, 1948. Maier, Reinhold: Ein Grundstein wird gelegt, die Jahre 1945 bis 1947, Tübingen 1964. Mende, Erich: Die FDP. Daten, Fakten, Hintergründe, Stuttgart, 1972. Michel, Marco: Die Bundestagswahlkämpfe der FDP 1949-2002, Wiesbaden, 2005. Mitzel, Alf: Besatzungspolitik und Entwicklung der bürgerlichen Parteien in den Westzonen (1945-1949), in: Staritz, Dietrich (Hg.), Das Parteiensystem der Bundesrepublik. Geschichte – Entstehung – Entwicklung. Eine Einführung, Obladen, 1976, S. 73-89. Morlok, Jürgen (Hg.): Liberale Profile: Freiheit und Verantwortung, Stuttgart, 1983. Mensing, Hans-Peter (Hg.): Adenauer – Heuss. Unserem Vaterland zugute, der Briefwechsel 1949-1963, Berlin, 1989. Mensing, Hans-Peter (Hg.): Adenauer – Heuss. Unter vier Augen, Gespräche aus den Gründerjahren 1949-1959, Berlin, 1997 Naumann, Friedrich : Das Blaue Buch von Vaterland und Freiheit, Leipzig, 1913. Oppelland, Torsten (Hg.): Deutsche Politiker 1949-1969, Darmstadt, 1999. 112 Papke, Gerhard: Die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR 1945-1952. In: Frölich, Jürgen (Hg.): Bürgerliche Parteien in der SBZ/DDR. Zur Geschichte von LDP(D), DBD und NDPD 1945 bis 1953, Köln, 1994, S.25-45. Papke, Gerhard: Zur Nachkriegspolitik von Wilhelm Külz, in: Wilhelm-Külz-Stiftung (Hg.), Wilhelm Külz – ein sächsischer Liberaler, Dresden, 1999, S. 46-74. Raico, Ralph: Die Partei der Freiheit. Studien zur Geschichte des deutschen Liberalismus, Stuttgart, 1999. Rawls, John: Die Idee des politischen Liberalismus, Frankfurt am Main, 1994. Reutimann, Hans: Theodor Heuss – Humanismus in der Bewährung, Braunschweig, 1964. Richter, Ludwig: Die Deutsche Volkspartei 1918-1933, Düsseldorf, 2002. Rothmund, Paul: Badens liberale Ära, in: Rothmund, Paul/ Wiehn, Erhard R. (Hg.): Die F.D.P./DVP in Baden-Württemberg und ihre Geschichte: Liberalismus als politische Gestaltungskraft im deutschen Südwesten, Stuttgart, 1979, S. 79-96. Rothmund, Paul: Kampf um die Macht – Die Blockpolitik in Baden, in: Rothmund, Paul/ Wiehn, Erhard R. (Hg.): Die F.D.P./DVP in Baden-Württemberg und ihre Geschichte: Liberalismus als politische Gestaltungskraft im deutschen Südwesten, Stuttgart, 1979, S. 116130. Rothmund, Paul: Liberalismus am Ende? – Weimarer Zwischenspiel, in: Rothmund, Paul/ Wiehn, Erhard R. (Hg.): Die F.D.P./DVP in Baden-Württemberg und ihre Geschichte: Liberalismus als politische Gestaltungskraft im deutschen Südwesten, Stuttgart, 1979, S. 165180. Rothmund, Paul: Demokratie im Stammland, in: Rothmund, Paul/ Wiehn, Erhard R. (Hg.): Die F.D.P./DVP in Baden-Württemberg und ihre Geschichte: Liberalismus als politische Gestaltungskraft im deutschen Südwesten, Stuttgart, 1979, S. 201-220. 113 Rütten, Theo: Der deutsche Liberalismus 1945 bis 1955: Deutschland- und Gesellschaftspolitik der ost- und westdeutschen Liberalen in der Entstehungsphase der beiden deutschen Staaten, Baden-Baden, 1984. Rütten, Theo: Von der Plattform-Partei zur Partei des liberalen Programmes 1949-1957, in: Mischnick, Wolfgang (Hg.): Verantwortung für die Freiheit, 40 Jahre F.D.P., Stuttgart, 1989, S. 66-80. Schollwer, Wolfgang: Potsdamer Tagebuch 1948-1950: liberale Politik unter sowjetischer Besatzung, München, 1988. Schollwer, Wolfgang: Liberale Führungspersonen – die Parteivorsitzenden, in: Mischnick, Wolfgang (Hg.): Verantwortung für die Freiheit, 40 Jahre F.D.P., Stuttgart, 1989, S. 440-463. Schollwer, Wolfgang: „Gesamtdeutschland ist uns Verpflichtung“. Aufzeichnungen aus dem FDP-Ostbüro 1951-1957, Bremen, 2004. Sommer, Ulf: Die Entwicklung der LDPD in den fünfziger Jahren. In: Frölich, Jürgen (Hg.): „Bürgerliche Parteien in der SBZ/DDR. Zur Geschichte von LDP(D), DBD und NDPD 1945 bis 1953, Köln, 1994, S. 197-206. Sommer, Ulf: Die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands. Eine Blockpartei unter Führung der SED, Münster, 1996 Staudt, Wolfgang: Liberale in Hessen seit 1945: Materialien zum 50jährigen Bestehen der F.D.P. in Hessen, Sankt Augustin, 1996. Stephan, Gerd-Rüdiger (Hg.): Die Parteien und Organisationen der DDR. Ein Handbuch, Berlin, 2002. Stephan, Werner: Aufstieg und Verfall des Linksliberalismus 1918-1933. Geschichte der Deutschen Demokratischen Partei, Göttingen, 1973. 114 Suckut, Siegfried: In Erwartung besserer Zeiten. DDR-CDU und LDPD zwischen HalbstaatsRaison und gesamtdeutschen Hoffnungen (1949-1961), in: Schönhoven, Klaus/Staritz, Dietrich (Hg.): Sozialismus und Kommunismus im Wandel, Köln, 1993, S. 415-435. Suckut, Siegfried: Ost-CDU und LDPD aus einer internen Sicht von SED und MfS. In: Frölich, Jürgen (Hg.): Bürgerliche Parteien in der SBZ/DDR. Zur Geschichte von LDP(D), DBD und NDPD 1945 bis 1953, Köln, 1994, S. 103-120. Suckut, Siegfried: Die LDP(D) in der DDR. Eine zeitgeschichtliche Skizze in: Aus Politik und Zeitgeschichte vom 12. April 1996. Suckut, Siegfried: Parteien in der SBZ/DDR 1945-1952, Bonn, 2000. Vietzen, Hermann: Chronik der Stadt Stuttgart 1945-1948, in: Veröffentlichungen des Archivs der Stadt Stuttgart, Band 25, Stuttgart 1972. Vogelsang, Thilo: Koblenz, Berlin und Rüdesheim. Die Option für den westdeutschen Staat im Juli 1948, in: Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, Festschrift für Hermann Heimpel zum 70. Geburtstag am 19. September 1971, Göttingen, Erster Band, S. 161-179. Walter, Michael: National-Demokratische Partei Deutschlands (NDPD). In: Stephan, Gerd Rüdiger (Hg.): Die Parteien und Organisationen der DDR. Ein Handbuch, Berlin, 2002, S. 366-401. Wieck, Hans Georg: Die Entstehung der CDU und die Wiedergründung des Zentrums im Jahre 1945, Düsseldorf, 1953. Wieck, Hans Georg: Christliche und Freie Demokraten in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden und Württemberg 1945/46. Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Band 10, Düsseldorf, 1958. Zundel, Rolf: Die Erben des Liberalismus, Freudenstadt, 1971. 115 14. Internet-Quellen (Stand 20.12.2006) „Deutsches Programm“, in: Virtuelle Akademie der Friedrich-Naumann-Stiftung: http://www.politik-fuer-die-freiheit.de/files/77/Deutsche_Programm.pdf Eisenacher Programm der LDP(D) (27.02.1949), in: Virtuelle Akademie der FriedrichNaumann-Stiftung: http://www.politik-fuer-diefreiheit.de/files/77/Eisenacher_Programm_der_LDPD_1.pdf Gründungsaufruf der LDP(D), in: Virtuelle Akademie der Friedrich-Naumann-Stiftung: http://www.politik-fuer-die-freiheit.de/files/77/1945_Gruendungsaufruf_LDPD.pdf Heppenheimer Proklamation der FDP, in Virtuelle Akademie der Friedrich-Naumann-Stiftung: http://www.politik-fuer-die-freiheit.de/files/77/Heppenheimer_Proklamation_1.pdf „Liberales Manifest“, in: Virtuelle Akademie der Friedrich-Naumann-Stiftung: http://www.politik-fuer-die-freiheit.de/files/77/Das_liberale_Manifest.pdf Neumayer, Fritz/ Dehler, Thomas/ Onnen, Alfred: Bericht der Untersuchungskommission zur „Naumannaffäre: http://www.kokhavivpublications.com/kuckuck/archiv/karc0007.html Schollwer, Wolfgang: Tagebucheintrag von zur Verhaftung Karl Hamanns, in: Virtuellen Akademie der Friedrich-Naumann-Stiftung:http://www.politik-fuer-diefreiheit.de/files/77/Schollwer-Hamann-Verhaftung.pdf Schollwer, Wolfgang: Tagebucheintrag zum 17.06.1953, in: Virtuelle Akademie der FriedrichNaumann-Stiftung:http://www.politik-fuer-diefreiheit.de/files/77/SchollwerZum17.Juni1953_1.pdf Wagner, Ruth: Rede „60 Jahre FDP-Hessen“ am 08.01.2006 in der Paulskirche zu Frankfurt am Main: http://www.fdp-hessen.de/item?page=1136909399&pkey=downloadList&item=1 Wahlergebnisse von 1946-1953 in: Wahlen in Deutschland: www.election.de 116 15. Ehrenwörtliche Erklärung Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne unerlaubte Hilfe Dritter verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Die Passagen, die aus Veröffentlichungen stammen, sind kenntlich gemacht. Diese Arbeit lag in gleicher oder ähnlicher Weise noch keiner Prüfungsbehörde vor und wurde bisher noch nicht veröffentlicht. Marco Kirchhof, im Januar 2007 117 16. Danksagung Hinweise, Ratschläge und offene Ohren – all das hat zur Entstehung dieser Arbeit beigetragen. Aus diesem Grund möchte ich mich bei allen, die mir geholfen haben, an dieser Stelle herzlich bedanken: bei Herrn Professor Dr. Jürgen Dittberner für die ausgezeichnete Betreuung bei meinen Eltern, die mich während des gesamten Studiums unterstützt haben bei Lisa Teichmann, für die Korrektur am Rohmanuskript sowie ihren ideellen Beistand bei den Teilnehmern von Professor Dittberners Diplomkolloquium für ihre Ratschläge Marco Kirchhof