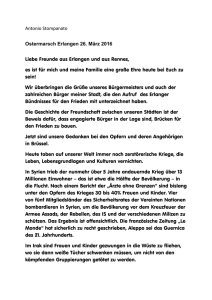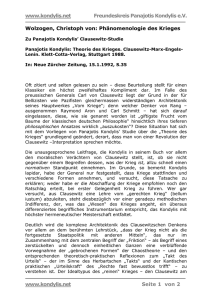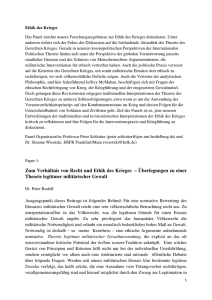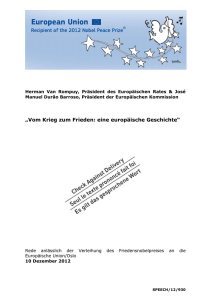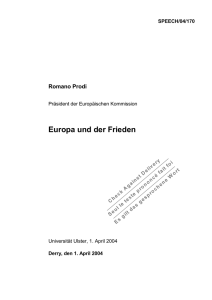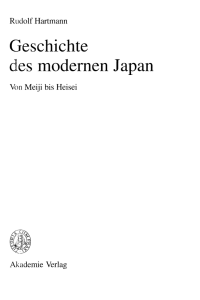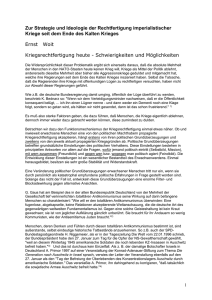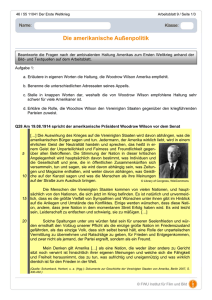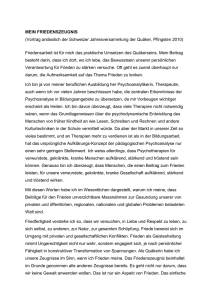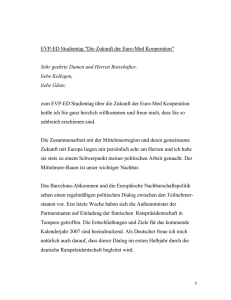Krieg und Frieden Handbuch
Werbung

Krieg und Frieden 1.Einleitung Im Gegensatz zum Krieg scheint sich der Frieden derzeit angesichts krisenhafter Entwicklungen des Weltfinanzsystems, angesichts von Umwelt- und Naturkatastrophen vor der Haustür der USA wie im fernen Südostasien, schließlich angesichts fortdauernder „robuster“ Friedenserzwingungs- und Friedensstabilisierungseinsätze in Subsahara-Afrika, im Irak oder in Afghanistan nur verhaltener Konjunktur zu erfreuen – zumindest wenn man die Nennungen der Begriffe von Krieg und Frieden im Internet oder in neueren politikwissenschaftlichen Handbüchern und Lexika verfolgt. Der Krieg genießt deutlich mehr Aufmerksamkeit als sein Gegenpart – 591 Mio. Einträge bei Google (26.09.10, 02.20) für „war“ gegen 212 Mio. für „peace“ bzw. 13,2 Mio. für „Krieg“ gegen 6,4 Mio. für „Frieden“; 18 Spalten für „war“ in Martin Griffith’s Encyclopedia of international relations and global politics (2005) gegen keine für „peace“; 29 Ausdruckseiten für „war“ gegen keine für „peace“ in der Internet-Ausgabe der Stanford Encyclopedia of Philosophy (rev. 2005); kein Artikel zu „peace“ in der immerhin von der ISA verantworteten International Studies Encyclopedia Online (2009/2010); 25 Registereintragungen für „war“ gegen eine für „peace“ im Oxford Handbook of International Relations (2010); 64 Spalten für das Begriffsfeld „Krieg“ gegen 48 Spalten für das Begriffsfeld „Friede“ in den einschlägigen Bänden von Friedrich Jaeger’s Enzyklopädie der Neuzeit (2006 bzw. 2008) – das zeigt schon deutliche Tendenzen ! Geschickte Ausnahme: Carlsnaes/Risse/Simmons’ Handbook of International Relations (2002) mit 38 Spalten für den Eintrag „war and peace“ – aber das scheint schon fast eine ältere Abschichtung der Diskussionsentwicklung zu repräsentieren. 1.1 Entwicklungsdynamik Nicht erst seit der terroristischen Attacke islamischer Fundamentalisten auf New York und Washington am 11. September 2001, sondern schon seit den (Bürger-)Kriegen im ehemaligen Jugoslawien der 90er Jahre sehen sich politische Entscheidungsträger mit der ernüchternden Einsicht konfrontiert, dass der klassische Krieg zwischen Staaten zwar langsam ausstirbt (Konfliktbarometer 2009: 2), dass aber gleichwohl die Weltpolitik auch weiterhin gekennzeichnet ist durch den Einsatz organisierter militärischer Gewalt zur Durchsetzung politischer, ökonomischer und ideologischer Interessen. Während des OstWest-Konflikts hatten mögliche Großkriege zwischen nuklear bewaffneten, zweitschlagsbefähigten Militärblöcken unser Konflikt-Denken ebenso wie die Militärplanung von NATO und Warschauer Pakt mit Beschlag belegt und für andere, außerhalb des Ost-West-Gegensatzes sich entwickelnde Konfliktformen desensibilisiert. Blockantagonistische Großkriege sind nach dem Ende des Kalten Krieges obsolet geworden. Was bleibt, ist eine Vielzahl regionaler und lokaler Waffengänge. Keiner der 2009 weltweit sieben Kriege wird zwischen Staaten ausgetragen; 31 hochgewaltsame und 112 krisenhafte innerstaatliche und transnationale Konflikte (Konfliktbarometer 2009: 1ff) beanspruchen unsere 275 Aufmerksamkeit. Gut zwei Drittel bis knapp drei Viertel aller im letzten Jahrhundert weltweit geführten Kriege waren keine Staaten-, sondern innerstaatliche oder transnationale Kriege: der klassische Staatenkrieg wird seit Ende des Zweiten Weltkriegs zu einem historischen Auslaufmodell. Seit dem Westfälischen Frieden 1648 innerhalb ihres Territoriums Inhaber des Monopols legitimer physischer Gewaltsamkeit, dem Anspruch nach Alleinvertreter („gate-keeper“) ihrer Bürger und deren gesellschaftlicher Zusammenschlüsse gegenüber der Außenwelt, müssen sich die Staaten in zunehmendem Maße parastaatlicher, gesellschaftlicher, privater Gewalt-Konkurrenz erwehren. Lokale Warlords, Rebellen- und Guerillagruppen, Befreiungsarmeen, internationale Terrornetzwerke. privatwirtschaftliche Söldnerfirmen betätigen sich je länger desto mehr als Kriegsunternehmer, treiben die Entstaatlichung und Privatisierung des Krieges und die (Re-)Vergesellschaftung organisierter militärischer Gewalt voran. Ein Blick zurück in die (eurozentrische) Geschichte der Neuzeit macht dagegen deutlich, dass unter dem Phänomen des Krieges (Gesamtübersicht Etzersdorfer 2007) traditionellerweise der Krieg zwischen Staaten bzw. ihren regulären Streitkräften verstanden wird – im Sinne des Generals v. Clausewitz die Fortsetzung des diplomatischen Verkehrs unter Einmischung anderer Mittel, geführt um der Durchsetzung staatlicher Territorial- oder Machtansprüche willen, gestützt durch eine Produzenten und Produktivkräfte mobilisierende, allumfassende Kriegswirtschaft. Ex negatione ist der Friede klassischerweise ein völkerrechtlich garantierter Zustand des Nicht-Krieges zwischen Staaten. Das Gewaltverbot des Art. 2 (4) der UNO-Charta ist eine Fundamentalnorm des Völker- (oder präziser: des zwischenstaatlichen) Rechts. Dieser Staatenzentrismus hat bis in die Gegenwart das Bild des Krieges wie auch des Friedens (Wolfrum 2003) in Politik, Streitkräften und Öffentlichkeit geprägt. Auch die Friedenswissenschaft hat ihre zentralen Untersuchungsgegenstände weitgehend über das Verhalten von Staaten definiert und erklärt (Chojnacki 2008). Eine wesentliche Dimension der neueren Entwicklung ließ sie dabei lange außer Acht: den bereits angedeuteten Strukturwandel bewaffneter Konflikte (Sheehan 2008) und seine möglichen Rückwirkungen auf Stabilität und Struktur der internationalen Ordnung. Seit der Auflösung der Kolonialreiche in den 50er und 60er Jahren des 20. Jhs. tritt mehr und mehr an die Stelle des klassischen zwischenstaatlichen Krieges als zeitlich begrenzter Eruption organisierter Gewalt, nach Clausewitz gipfelnd in der Entscheidungsschlacht zur Niederringung des Gegners, der langdauernde Bürgerkrieg in der Form des low intensity conflict oder low intensity warfare. Aus einem Instrument der Durchsetzung staatlichen politischen Willens, der Realisierung staatlicher politischer, territorialer, ökonomischer, weltanschaulicher Interessen wird der Krieg zu einer Form privatwirtschaftlicher Einkommensaneignung und Vermögensakkumulation (Wulf 2005), zu einem Mittel klientelistischer Herrschaftssicherung und semi-privater Besetzung und Behauptung von nur unter den besonderen Bedingungen einer spezifischen Kriegsökonomie überlebensfähigen Territorien, Enklaven, Korridoren, Kontrollpunkten. In einer Gemengelage von privaten Bereicherungs- und persönlichen 276 Machtbestrebungen, Interventionen Dritter zur Verteidigung bestimmter Werte, aber auch zur Durchsetzung je eigener Herrschafts- und Ausbeutungsinteressen, der gegenseitigen Durchdringung und Vermischung kriegerischer Gewalt und organisiertem Verbrechen verliert der klassische Staatenkrieg seine überkommenen Konturen (Münkler 2002: Kap.10). Partisanen- und Guerillaaktionen, Selbstmordattentate, terroristische Gewaltexzesse unterlaufen die Trennung von Schlachtfeld und Hinterland, von zivilen und militärischen Zielen. Die Ausbildung eines „Lumpenmilitariats“ („tagsüber Soldaten, in der Nacht Gangster“ – Ayissi 2003) durchdringt die Trennlinie zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten. Das Nacheinander bewaffneter Kämpfe, fragiler Kompromisse und Waffenstillstände, und erneuter bewaffneter Auseinandersetzungen hebt die zeitliche Unterscheidung von Krieg und NichtKrieg auf. Das genuin Neue an dieser Welt reprivatisierter Gewaltanwendung ist allerdings nicht so sehr das Aufeinandertreffen staatlicher und nichtstaatlicher, gesellschaftlicher Gewaltakteure im selben Raumund Zeithorizont, die Asymmetrie des Akteursverhältnisses. Charakteristisch scheint vielmehr die Fähigkeit lokal agierender Rebellen, Condottiere, Warlords, Kriegsunternehmer, ihr Handeln durch effiziente Nutzung globalisierter Relationen und Prozesse zu optimieren (Kurtenbach/Lock 2004) und entweder Formhülsen der Staatsgewalt wie moderne Freibeuter zu kapern oder staatsfreie Räume einzurichten und zu behaupten, die einer informellen Ökonomie und der organisierten Kriminalität den zur Finanzierung des Krieges notwendigen Freiraum verschaffen (Bakonyi/Hensell/Siegelberg 2006). In Abwandlung jenes berühmten Zitats des Generals von Clausewitz: der Krieg erscheint nicht länger mehr als Fortsetzung des politischen Verkehrs, sondern als Fortsetzung des Beutemachens unter Einmischung anderer Mittel! Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach dem Umgang mit militärischer Gewalt wie der Bearbeitung kriegerischer Konflikte im internationalen System neu. Im Spannungsbogen der klassischen zwischenstaatlichen und der post-nationalstaatlichen, „Neuen“ Kriege (Kaldor 2000) entwickelt sich – vor der Kulisse einer auf immer modernere, präzisere und schnellere konventionelle Militärtechnologien rekurrierenden Revolution in Military Affairs (http://www.comw.org/rma/index.html sowie Freedman 2006) – der hochtechnisierte, computergestützte, gleichsam auf virtuelle Schlachtfelder ausgreifende postmoderne Cyberwar einerseits, der weitgehend in prämodernen Formen verharrende oder zu ihnen zurückkehrende Kleine Krieg andererseits (Daase 1999). Das klassische Milieu zwischenstaatlicher Politik – der nullsummenspielartige anarchische Naturzustand – wird zumindest in schwachen und zerfallenden Staaten gespiegelt durch einen innerstaatlichen oder besser: innergesellschaftlichen Naturzustand, dessen Akteure in zunehmendem Maße substaatliche und transnational organisierte gesellschaftliche Gruppen sind. Dies hat vor allem Konsequenzen für die Ziele, Motive und das Handlungsumfeld der Konfliktakteure. So wie sich mit fortschreitender Globalisierung, mit der Kommerzialisierung und Übernahme vormals staatlicher Handlungsfelder durch Transnationale Unternehmen und nichtgouvernementale Organisationen die Weltpolitik zunehmend entstaatlicht und privatisiert (Gesamtüberblick Baylis/Smith/Owens 2008), so 277 entmonopolisiert, dereguliert, privatisiert sich auch die Anwendung militärischer Gewalt (Wulf 2005). Damit aber wird der Prozess der rechtlichen Einhegung und Verstaatlichung des Krieges, der die Geschichte Europas von der Frühen Neuzeit bis zum Zweiten Weltkrieg (Übersicht: Wolfrum 2003; Meyers 2004) gekennzeichnet hat, wenigstens teilweise rückgängig gemacht. 1.2 Komplexität der Gegenstände Gilt es also, angesichts der aufscheinenden Komplexität der Kriege (Jäger 2010; sehr prägnante Diskussion einschlägiger Thesen Münklers in EWE 2008) – und, so wird noch zu zeigen sein, auch angesichts der Komplexität des Friedens – Krieg und Frieden je zeitbezogen und je kontextadäquat zu überdenken (Geis 2006) ? Oder wird die Weltpolitik von einer dauerhaften Konfliktlogik durchzogen (Nye 2007), die es erlaubt, auf der Grundlage extensiver empirischer Studien (Holsti 1991; Vasquez 2009) vergleichend Prozesse und Entwicklungen zu identifizieren, die über Zeit zu Verhaltensregelmäßigkeiten, Strukturen und Regimen gerinnen? Regeln und Strukturen, die nicht nur die Drohung mit oder Anwendung von organisierter militärischer Gewalt ordnen und einhegen, sondern auch der zarten Pflanze des Friedens ein Klettergerüst bieten, an dem sie sich zur vollen Pracht emporranken kann ? Die nähere Beschäftigung mit Ergebnissen der historischen Friedensforschung (exemplarisch Wegner 2002; Wegner 2003; Beyrau u.a. 2007) – so verblüffend ihre Erkenntnisse im Einzelfall auch sein können (z.B. Langewiesche 2006) – induziert in diesem Kontext ein gesundes Maß an Skepsis: die Bildung von Idealtypen – im Sinne der Zusammenfassung von Gemeinsamkeiten und Differenzen der unendlichen Vielfalt historisch-politischer Phänomene zu vergleichsfördernden Merkmalsbündeln – scheint zwar möglich, die Formulierung von Gesetzmäßigkeiten mit überzeitlichem Gültigkeitsanspruch aber schon des Prinzips der historischen Kontingenz wegen durchaus vermessen. Hypothesenbildung hat nicht nur mit dem hermeneutischen Zirkel zu kämpfen, sondern auch mit dem Dilemma des Reduktionismus: die Vereinfachung komplexer politischer und sozioökonomischer Zusammenhänge durch einerseits Hervorhebung, andererseits Ausblendung von Aspekten der Realität beinhaltet immer einen erkenntnisinteressenabhängigen Selektionsprozess (Habermas), dem letztlich eine politische oder gesellschaftliche Realitätsdeutung zugrunde liegt. Krieg und Frieden sind zunächst einmal soziale Phänomene, konstitutive Teile des Bedingungs-, Problem- und Prozesshaushaltes je konkreter menschlicher Gesellschaften. Sie lassen jeweils deren unterschiedliche Werte, Konflikte, Verhaltensmuster, Agenden erkennen, werden gestaltet durch deren politisches, gesellschaftliches, ökonomisches Umfeld, wirken in der Art eines dialektischen double bind aber auch auf deren weitere Entwicklungen ein. Hinzu kommt im konkreten Einzelfall die Überformung politischer oder gesellschaftlicher Prozesse und Strukturen mit individuellen Erfahrungen, Seinsdeutungen, Bedürfnisinterpretationen, Sehnsüchten wenn nicht des einfachen universal soldier Donovan’schen Zuschnitts, so doch der militärischen und politischen Entscheidungsträger: Die damit ins Blickfeld rückende Wechselwirkung zwischen politisch- 278 gesellschaftlicher Strukturbildung und individuellen, subjektiven Erfahrungsprozessen macht die Analyse von Krieg und Frieden eher (noch) vielschichtiger und komplexer, als es dem nomothetisch prädizierten Sozialwissenschaftler lieb sein kann. Insofern wäre in mehr als einer Hinsicht der klassischen Position des Generals v.Clausewitz zu folgen, der gemäß der Krieg (und incidenter auch der Friede) immer und zu jeder Zeit ein Ausfluss der Politik ist, die ihn hervorbringt (Wegner 2002: VIIf). Das heißt aber auch, dass Krieg und Frieden nur aus den jeweiligen politischen, gesellschaftlichen, ökonomischen Verhältnissen verstanden werden können, die sie zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort entstehen lassen. Zwar hat es in der Geschichte der intellektuellen Auseinandersetzung mit Krieg und Frieden immer wieder Versuche gegeben, deren Komplexität auf eineindeutige und einfache Zusammenhänge zu reduzieren: Zu erinnern wäre hier einerseits an die Entwicklung normativer Friedensvorstellungen seit der frühen Neuzeit, insbesondere aber seit der Aufklärung, denen zufolge der Friede zunächst nur innerhalb der christlichen Staatenwelt, dann innerhalb der (Völkerrechts-)Gemeinschaft der zivilisierten Nationen als verbindliche Handlungsschnur der Staatenlenker und als Normalzustand der internationalen Beziehungen anzusehen war. Ein Normalzustand, der allenfalls unter besonderen Bedingungen für kurze Zeit zur Wiederherstellung eines von Friedensstörern verletzten Zustands des gerechten Friedens durch den Krieg unterbrochen werden durfte (Kampmann 2006: Sp.5f). Die so konstatierte Auffassung vom Frieden als des historischen Normalzustandes (die den Krieg als erklärungsbedürftigen Sonderfall gesellschaftlichen und/oder zwischenstaatlichen Verhaltens einschließt) korrespondiert nicht nur keineswegs mit dem historischen Befund, sondern steht auch im Widerspruch zu einer ebenso wirkmächtigen ideengeschichtlichen Tradition, derzufolge der Krieg neben Hunger, Pest und Tod als einer der vier apokalyptischen Reiter erschien, als unabänderliches, gleichsam naturhaftes Verhängnis (Wegner 2003:11), das seinen symbolhaften Ausdruck etwa auch im Hobbes’schen Naturzustand des Krieges aller gegen alle fand (Leviathan I, Kap.13; Übersicht Meyers 1992). Nicht der Krieg wird als Bruch des Friedens, sondern der Friede als Unterbrechung des Krieges begriffen… Aber – von der Konstituierung des Naturzustandes als denknotwendiger Grundlage neuzeitlicher Staatsphilosophie zur systematischen Legitimierung gesellschaftsvertraglicher Konstruktionen einmal abgesehen: ob man sich für die Vorherrschaft des Krieges oder die des Friedens im Faktorenhaushalt der Entwicklung der Menschheit entscheidet, beruht letzten Endes ebenso auf der Wahl nicht weiter hintergehbarer Prämissen wie die Antwort auf jene anthropologische Grundfrage, ob der Mensch von Natur aus vernunftbegabt und gut, einsichtig in die Notwendigkeiten und Konsequenzen seines gesellschaftlichen Handelns, damit aber auch überzeug-, lenk- und berechenbar sei, oder ob er unvernünftig und schlecht, irritierend sprunghaft und eigensüchtig sei, damit aber auch im Sinne der Hobbes’schen Sozialphilosophie der Drohung mit dem Schwert bedürfe, um zumindest ein Mindestmaß an Frieden zu halten, Recht und Gesetz zu respektieren. Die individuelle Wahl zwischen diesen Grundpositionen ist erkenntnisinteressenabhängig – und sie kann zudem überlagert werden durch Komplexe ethisch-moralischer 279 Einstellungen zur Legitimation der Anwendung militärischer Gewalt, die zumindest ex negatione auch die Einstellungen gegenüber dem Frieden beeinflussen (Rengger/Kennedy-Pipe 2008). Wir nennen - die heroische Sicht des Krieges, derzufolge der Krieg als ritterliches Duell tapferer und ebenbürtiger Gegner erscheint, als kunstvoller Fechtkampf, dessen meisterliche Beherrschung seit der Renaissance ein Gutteil dessen ausmacht, was der Adel Europas mit dem Begriff der (Standes-)Ehre verknüpft: individuelle Ehre des tugendhaften Kriegers zunächst, dann in der Übertragung auf größere gesellschaftlich-politische Einheiten auch die Ehre von Staaten, Nationen usw. - die realpolitische Sicht des Krieges, die den Krieg primär begreift als Instrument zur Verwirklichung der Interessen der Herrschenden – legitimiert erst durch die Staatsraison, später das nationale Interesse, noch später ethnische, völkische, rassische und rassistische Überlegungen – oder modern gesprochen: der Versuch, im Sinne der klassischen Politik-Definition von Harold Lasswell die Frage Who gets what, when, and how mit der Keule zu entscheiden: Krieg ist „…the intentional use of mass force to resolve disputes over governance …governance by bludgeon…it is about which group of people gets to say what goes on in a given territory…“ (Orend 2005) - die mitleidige oder einfühlsame Sicht des Krieges, die vor dem Hintergrund christlich-pazifistischer Grundüberzeugungen die Anwendung militärischer Gewalt grundsätzlich verwirft, den Heroismus des Kriegers als schal und inhaltsleer verurteilt und einen Grundzug der friedenspolitischen Diskussion beschreibt, der vom Renaissancewerk der Querela pacis des Erasmus v. Rotterdam über die Friedenskirchen des 17. und 18. Jahrhunderts – Quäker, Mennoniten, Anabaptisten – bis in das Zeitalter der Aufklärung mit seinen Projekten zum Ewigen Frieden reicht (Übersicht v. Raumer 1953; immer noch glänzende Darstellung Hinsley 1967). 2 Grundkonstanten der Diskussion: dialektische Entwicklung der Begriffe von Krieg und Frieden ? Bei der Klassifizierung von Kriegen - und durchaus auch von Frieden - wird gern mit binären Codierungen gearbeitet – Angriffs-/Verteidigungskrieg, Staaten-/Bürgerkrieg, gerechter/ungerechter Krieg, traditioneller/Neuer Krieg, Kleiner/Großer Krieg, innerer/äußerer Friede, Verhandlungsfriede/Diktatfriede, negativer/positiver Friede usw. – eine heuristische Hilfskonstruktion, die unsere Tatbestände näherungsweise eingrenzt, dabei aber vermeidet, Aussagen über „das“ Wesen „des“ Krieges oder Friedens machen zu müssen, die angesichts der Geschichtlichkeit sowie des beständigen Gestalt- und Formwandels der unter die Begriffe subsumierten Phänomene sehr schnell Schiffbruch erleiden müssten (Geis 2006: 14ff). Selbstverständlich erfreuen wir uns auch formalisierterer Kategorisierungssysteme, die bei der inhaltlichen Bestimmung der Begriffe helfen sollen – so z.B. die Kriege und Konflikte anhand einer vertikalen AkteursAchse (von der Dorfgemeinschaft bis zur Supermacht) und einer horizontalen Gewaltsamkeits-Achse (vom sichtbaren Interessenkonflikt bis zum globalen Nuklearkrieg) ordnende Ruloff/Schubiger (2007: 10 – 17; hilfreich dort v.a. das Schema Klassifizierung von auf S.11). Aber der 280 politikwissenschaftlichen Forschung ermangelt es doch eineindeutiger einheitlicher Begriffe der zu untersuchenden Tatbestände (Rudolf 2010: 526) – der Krieg (und incidenter auch der Friede) ist frei nach Friedrich dem Großen ein launisches Luder (Kluss 2008), das in der Clausewitz’schen Perspektive auftritt wie ein wahres Chamäleon, weil er in jedem konkreten Fall seine Natur etwas ändere (Ruloff/Schubiger 2007: 11). Schon diese Beobachtung legt eher einen historisch-hermeneutischen denn einen sozialwissenschaftlich-nomothetischen Zugriff auf unsere Gegenstände nahe – und unterstützt wird dies durch eine Einsicht aus der historischen Friedensforschung (Wegner 2002: XVIff), derzufolge sich zwischen den Begriffen von Krieg und Frieden kein Komplementärverhältnis, sondern eines der Asymmetrie entwickelt habe: gegenüber der Naturzuständlichkeit des Krieges sei der Friede ein äusserst komplexes und instabiles Kunstprodukt, eine menschliche Kulturleistung, die der aktiven Stiftung bedarf und sich als menschliche Sehnsucht ebenso wie als politisches Ziel erst als Reflex auf die Erfahrungen des Krieges entwickelt habe. Dies gelte nicht nur jeweils für fast alle großen Friedensentwürfe der Neuzeit von Crucé, Sully und Penn bis zu Woodrow Wilson, sondern auch für die damit befasste Wissenschaft: so wie die Lehre von den Internationalen Beziehungen ein Kind der Erfahrungen des Ersten Weltkriegs ist (Meyers 1981), ist die Friedens- und Konfliktforschung ein Kind der Erfahrungen des MAD-basierten Systems organisierter Friedlosigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg (Meyers 1994). Dass traditionellerweise Krieg und Frieden begrifflich als zwei klar voneinander unterscheidbare, sich gegenseitig ausschließende politische Zustände gelten, ist Ergebnis einer spezifisch frühneuzeitlichen Argumentation: Angesichts der Situation des konfessionellen Bürgerkrieges in Europa konstituiert vor allem Thomas Hobbes den Staat als einen öffentliche Ruhe und innere (Rechts-)Sicherheit garantierenden unbedingten Friedensverband, der auf gesellschaftsvertraglicher Grundlage den Naturzustand des bellum omnium contra omnes durch Setzung eines rechtlich geordnete Machtverhältnisse im Staatsinnern schützenden Gewaltmonopols aufhebt. Gedanklich wird damit der Weg frei, den Krieg auf das Binnenverhältnis der Souveräne, den internationalen Naturzustand, zu beschränken und ihn als rechtlich geregelte Form bewaffneter Konfliktaustragung zwischen Staaten zu begreifen. Zugleich ermöglicht diese Operation die Definition des Friedens als Nicht-Krieg (Schwerdtfeger 2001: S. 89ff) – und liefert damit eine politisch-juristische Konstruktion, mittels derer die Vielfalt sozialer und politischer Konfliktlagen begrifflich eindeutig bestimmbar scheint. Allerdings weist die real- und ideengeschichtliche Analyse (Gesamtüberblick Vasquez 2009) auf, dass die so gewonnenen Begriffe von Krieg und Frieden mit der Ontologie des klassischen staatenzentrischen Systems internationaler Politik – dem gern auch mit Blick auf die Friedensregelung von 1648 so bezeichneten Westfälischen System - aufs engste verknüpft sind. Veränderungen der realhistorischen Randbedingungen internationaler Politik ziehen Veränderungen im Gebrauch wie im Gehalt der Begriffe von Krieg und Frieden unmittelbar nach sich. Seit der frühen Neuzeit setzt sich in der europäischen 281 Geschichte der Staat als Schutzverband und territorial fassbarer internationaler Akteur (Übersicht Schulze 2004) vornehmlich deshalb durch, weil er seine Tätigkeit über die erfolgreiche Produktion von Sicherheit legitimiert: von Verkehrswege- und Rechts-, später dann auch wirtschaftlicher und sozialer Sicherheit im Binnenverhältnis, von nationaler Sicherheit im Außenverhältnis zu anderen vergleichbaren Akteuren, von internationaler Sicherheit in der durch die Prozesse von Konkurrenz und Konflikt ebenso wie von Kooperation und Friedensbewahrung strukturierten Staatengesellschaft. In dieser Entwicklung erscheinen Sicherheit und Territorialität als notwendige Korrelate: je mehr sich der frühneuzeitliche Staat territorial verfestigt, seine Herrschaft im Binnenverhältnis unwidersprochen durchsetzen und behaupten kann, desto erfolgreicher vermag er sein Schutzversprechen seinen Bürgern gegenüber im Inneren wie auch in der sich herausbildenden Staatenwelt nach außen einzulösen. Und: begriffsgeschichtliches Ergebnis des sich ausbildenden und intensivierenden Konnexes zwischen staatlicher Herrschaft – Ausübung von Macht durch zentrale politische Institutionen – und Kriegführung war, dass Frieden und Sicherheit über Jahrhunderte hinweg in politisch-militärischen Kategorien bestimmt, vom Staat als ihrem Produzenten und Garanten her gedacht wurden, dass sie sich auf den Schutz des Individuums ebenso wie auf den Schutz der schützenden Institution bezogen. Schließlich: Sicherheit und Schutzgewährung als Voraussetzung einer erfolgreichen Politik der Herstellung und Bewahrung von Frieden kristallisieren sich in der Verteidigung der Integrität des staatlichen Territoriums ebenso wie in der Behauptung der Freiheit der politisch-gesellschaftlichen Eigenentwicklung. Von zentraler Bedeutung in diesem Kontext ist die Annahme, dass zum einen die Entwicklung des Kriegsbildes und der Kriegsformen Resultat der Entwicklung der Produktivkräfte und der Destruktionsmittel ist, zum anderen aber auch die Existenz, physisch-territoriale Gestalt, politische Struktur und politisch-gesellschaftliche Funktion des Staates mit der Ausdifferenzierung und dem Wandel der Ziele, Formen und Prozesse der Kriegführung aufs engste verknüpft sind (Übersicht Metz 2006: Teil III). Dabei stellt schon der die Entwicklung der Destruktionsmittel antreibende technische Fortschritt das klassische Symbol der erfolgreichen Umsetzung staatlicher Schutzversprechen – nämlich die militärischpolitisch-rechtlich abgestützte Undurchdringbarkeit staatlicher Grenzen für Außeneinflüsse (Herz 1974) – sukzessive in Frage und hebt sie schliesslich auf. Die insbesondere durch die Entwicklung der Luftkriegführung und der ballistischen Trägerwaffen im 20. Jh. bewirkte prinzipielle Durchdringbarkeit der harten Schale des nationalen Akteurs wird intensiviert durch die moderne industriewirtschaftliche Entwicklung und die Folgen einer immer weiter voranschreitenden internationalen Arbeitsteilung (Übersicht Dicken 2007), in deren Konsequenz der nationale Akteur unter Globalisierungsdruck gerät. Die Ressourcen, deren er auch weiterhin nicht nur zur Produktion von Sicherheit, sondern mehr noch angesichts seiner Wandlung vom liberalen Nachtwächterstaat der ersten Hälfte des 19. zum Daseinsvorsorgestaat der zweiten Hälfte des 20. Jhs. zur Erfüllung seiner sozialen Staatsaufgaben bedarf, 282 werden bedroht, geschmälert, in Frage gestellt. Die Entgrenzung der Staatengesellschaft als Folge von Prozessen der Verregelung, Institutionalisierung und formalen Organisation internationaler Beziehungen, der Ausbildung transnationaler Interessenkoalitionen in einer Situation des Regierens ohne Staat (Neyer 2004), der Entwicklung inter- und transgouvernementaler Politikverflechtungen und von Mehrebenensystemen des Regierens in staatenüberwölbenden (Integrations-) Zusammenhängen (Schuppert 2005; Botzem u.a. 2009) überdeckeln, unterlaufen oder ignorieren seine überkommenen Handlungsspielräume. Der Informalisierung des internationalen Systems korrespondiert die Informalisierung der innerstaatlichen Politik – fallen doch nicht nur die räumlichen und zeitlichen Reichweiten ökonomischer Prozesse und (formeller) politischer Entscheidungen auseinander, sondern gehen auch im Zuge von Globalisierung, Deregulierung und Privatisierung öffentlicher Aufgaben Teilbereiche staatlicher Souveränität an private ökonomische Akteure über. Damit aber wird die Leistungsfähigkeit des Staates als Garant von Daseinsvorsorge wie als Ordnungsmacht gesellschaftlichen Zusammenlebens im binnen- wie im zwischenstaatlichen Handlungsbereich weiter ausgehöhlt. Der noch von Max Weber als unhinterfragter alleiniger Inhaber des Monopols legitimer physischer Gewaltanwendung in einem angebbaren Territorium beschriebene nationale Akteur hat in weiten Teilen der Welt bereits zugunsten anderer Gewaltakteure abgedankt (gute Übersicht Bonacker/Weller 2006). In Angola, Somalia, Sierra Leone, Liberia oder dem Kongo ist er den Parteien, Handlangern und Profiteuren des Neuen Krieges, den kleptokratischen Eliten, den Patronen neo-patrimonialer Herrschaftsstrukturen und politischer Netzwerke, den Diamantensuchern und den jeglicher sozialen Bindung entfremdeten Jugendbanden (Bakonyi/Hensell/Siegelberg 2006) längst zum Opfer gefallen. In Teilen des Balkans und des ehemaligen Sowjetimperiums ist immerhin noch seine Hülle begehrt, weil diese wie ein Theatermantel mafiösen Unternehmungen einen Rest von Legitimität und Respekt zu verschaffen scheint, wenn nicht gar ihre Durchführung mit Blick auf Usurpation und Kontrolle staatlicher Rest-Machtmittel entschieden erleichtert. In beiden Fällen aber wird die klassische neuzeitliche Legitimationsgrundlage staatlicher Existenz und staatlichen Handelns insgesamt deutlich in Frage gestellt: Nämlich die Überwindung des von Hobbes postulierten vorgesellschaftlichen Naturzustands des bellum omnium contra omnes durch die Garantie von Sicherheit und Rechtsfrieden im Binnen- wie Schutz vor militärischen Angriffen im Aussenverhältnis. Die herkömmliche Legitimation des Krieges als Ausdruck des Rechtes der Staaten auf Inanspruchnahme des Instituts der Selbsthilfe zur Verteidigung eigener Interessen in einer anarchischen Staatenwelt ruht eben auf der Erfüllung dieses Schutzversprechens: seiner Durchsetzung dienen Monopolisierung der Gewaltanwendung und Verstaatlichung des Krieges. Erst als sich der Staat als Kriegsmonopolist durchgesetzt hatte, konnten Kombattanten und Nichtkombattanten, konnten Erwerbsleben und Kriegführung, konnten letztlich auch Krieg und Frieden begrifflich als zwei klar voneinander unterscheidbare, sich gegenseitig ausschließende politische Sphären voneinander getrennt werden. (Münkler 2006: Kap.1). 283 2.1 Krieg - klassisch Altertum, Mittelalter und Neuzeit gleichermaßen galt der Krieg als Grundtatbestand menschlichen Konfliktverhaltens, als „... Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen...“. Carl v. Clausewitz (1973: 191ff.) prägte die klassisch-instrumentelle Sicht: „Der Krieg ist nichts als ein erweiterter Zweikampf. Wollen wir uns die Unzahl der einzelnen Zweikämpfe, aus denen er besteht, als Einheit denken, so tun wir besser, uns zwei Ringende vorzustellen. Jeder sucht den anderen durch physische Gewalt zur Erfüllung seines Willens zu zwingen; sein nächster Zweck ist, den Gegner niederzuwerfen und dadurch zu jedem ferneren Widerstand unfähig zu machen. ... Die Gewalt rüstet sich mit den Erfindungen der Künste und Wissenschaften aus, um der Gewalt zu begegnen. ... Gewalt, d.h. die physische Gewalt (denn eine moralische gibt es außer dem Begriff des Staates und Gesetzes nicht), ist also das Mittel, dem Feinde unseren Willen aufzudringen, der Zweck. Um diesen Zweck sicher zu erreichen, müssen wir den Feind wehrlos machen, und dies ist dem Begriff nach das eigentliche Ziel der kriegerischen Handlung...“ In seiner vollen Ausformung seit der Entstehung gesellschaftlicher Großorganisationen, d.h. seit der Bildung der ersten Hochkulturen der Frühgeschichte bekannt, läßt sich der Krieg als der Versuch von Staaten, staatsähnlichen Machtgebilden oder gesellschaftlichen Großgruppen begreifen, ihre machtpolitischen, wirtschaftlichen oder weltanschaulichen Ziele mittels organisierter bewaffneter Gewalt durchzusetzen. Allerdings war in der Geschichte auch immer wieder umstritten, wann eine bewaffnete Auseinandersetzung als Krieg zu bezeichnen sei. Im Laufe der Entwicklung können wir eine Einengung des vorzugsweise auf die gewaltsame Auseinandersetzung (bis hin zum Duell zwischen Individuen) abhebenden Begriffs konstatieren. Mit der Ausbildung des souveränen Territorialstaates und in seiner Folge des als Gemeinschaft souveräner Nationen begriffenen internationalen Staatensystems seit dem 17. Jh. galt eine gewaltsame Auseinandersetzung nur dann als Krieg, wenn daran geschlossene Gruppen bewaffneter Streitkräfte beteiligt waren und es sich zumindest bei einer dieser Gruppen um eine reguläre Armee oder sonstige Regierungstruppen handelte, wenn die Tätigkeit dieser Gruppen sich in organisierter, zentral gelenkter Form entfaltete, und wenn diese Tätigkeit nicht aus gelegentlichen, spontanen Zusammenstößen bestand, sondern über einen längeren Zeitraum unter regelmäßiger, strategischer Leitung anhielt. Der neuzeitliche Kriegsbegriff stellt darüber hinaus darauf ab, daß die am Krieg beteiligten Gruppen in aller Regel als souveräne Körperschaften gleichen Ranges sind und untereinander ihre Individualität vermittels ihrer Feindschaft gegenüber anderen derartigen Gruppen ausweisen. Indem dieser Kriegsbegriff einen (völkerrechtlichen) Rechtszustand bezeichnet, der zwei oder mehreren Gruppen einen Konflikt mit Waffengewalt auszutragen erlaubt, schließt er Aufstände, Überfälle oder andere Formen gewaltsamer Auseinandersetzung zwischen rechtlich Ungleichen aus, vermag damit aber solche Tatbestände wie Bürgerkrieg, Befreiungskrieg und Akte des Terrorismus nicht oder nur ungenügend abzudecken. Da die Abgrenzung des Krieges gegen andere gewaltsame Aktionen (bewaffnete Intervention, militärische 284 Repressalie, Blockade) in der Praxis der Staaten oft verhüllt wurde, war der Kriegsbegriff im Völkerrecht lange umstritten. Erst die Genfer Fünf-Mächte-Vereinbarung vom 12.12.1932 ersetzte den ursprünglichen Ausdruck „Krieg“ durch den eindeutigeren der „Anwendung bewaffneter Gewalt“ (Art. III). Die Charta der Vereinten Nationen folgte dieser Tendenz, indem sie die Anwendung von oder Drohung mit Gewalt in internationalen Beziehungen grundsätzlich verbot (Art. 2, Ziff. 4) und nur als vom Sicherheitsrat beschlossene Sanktionsmaßnahme (Art. 42) oder als Akt individueller oder kollektiver Selbstverteidigung (Art. 51) erlaubte. Trotz aller völkerrechtlichen Klärungsversuche: in politischer Hinsicht bleibt die Ungewissheit darüber, was das Wesen des Krieges ausmacht und wo er seine Grenzen findet, bestehen. Zwar hat Clausewitz die lange Zeit gültige Auffassung vom Kriege als eines funktionalen Mittels der Politik entwickelt, als einer spezifischen Form des Verkehrs der Staaten untereinander, die zwar ihre eigene Logik hat, grundsätzlich aber den Primat der Politik gelten lässt: Der Krieg hat keinen Eigenwert, sondern gewinnt seine Berechtigung allein in einem von der Politik geprägten, der Durchsetzung der Interessen der Staaten nach außen dienenden Ziel-Mittel-Verhältnis. Aber: was diese Auffassung nicht erfaßt, ist die Wandlung des Krieges von einer – für die Zeit Clausewitz` noch typischen – Auseinandersetzung zwischen Souveränen und ihren Armeen – wie sie am deutlichsten in der Form der mit begrenzter Zielsetzung und unter weitgehender Schonung von Non-Kombattanten und produktiven Sachwerten geführten Kabinettskriege des 18. Jh.s aufscheint – zu einer Auseinandersetzung zwischen hochindustrialisierten Massengesellschaften, die als Totaler Krieg bezeichnet wird. Ausgehend von der levèe en masse der französischen Revolutionskriege, erstmals deutlich manifest im Amerikanischen Bürgerkrieg 1861-1865, erreicht sie im Ersten und im Zweiten Weltkrieg ihre Höhepunkte. Mobilmachung aller militärischen, wirtschaftlichen und geistig-weltanschaulichen Ressourcen für die Kriegführung; Missachtung der völkerrechtlichen Unterscheidung zwischen kriegführenden Streitkräften (Kombattanten) und nichtkämpfender Zivilbevölkerung; Zerstörung kriegs- und lebenswichtiger Anlagen im Hinterland des Gegners; Mobilisierung gewaltiger Propagandamittel, um die eigene Wehrbereitschaft zu steigern und die des Gegners zu zersetzen – all diese Elemente haben nur ein Ziel: die völlige Vernichtung des zum absoluten Feind erklärten Gegners. Der Totale Krieg kehrt das Clausewitz‘sche Zweck-Mittel-Verhältnis von Politik und Krieg nachgeradezu um, setzt – im Sinne der These Ludendorffs vom Krieg als der höchsten Äußerung völkischen Lebenswillens – die äußerste militärische Anstrengung absolut. Damit aber wird der Krieg der politischen Operationalisierbarkeit beraubt, werden Staat und Politik zum Mittel des Krieges erklärt, wird der Krieg stilisiert zum Medium der Selbststeigerung und Überhöhung: des Kriegers sowohl als auch der kriegführenden Nation. Mit der Entwicklung nuklearer Massenvernichtungswaffen stellt sich die Frage nach der politischen Instrumentalität des Krieges vor dem Hintergrund des thermonuklearen Holocausts erneut. Der Clausewitz‘schen Lehre von der politischen Zweckrationalität des Krieges ist im Zeitalter der auf 285 gesicherte Zweitschlagspotentiale der Supermächte gestützten gegenseitigen Totalzerstörungsoption („mutual assured destruction“ - MAD) der Grundsatz entgegenzuhalten, daß Krieg kein Mittel der Politik mehr sein darf. Denn: sein Charakter hat einen qualitativen, irreparablen Bruch erfahren: das Katastrophale, Eigendynamische organisierter militärischer Gewaltanwendung ist auf in der Geschichte bis zum Jahre 1945 nie dagewesene Weise gesteigert worden. Es gilt die treffende Bemerkung des Psychologen Alexander Mitscherlich (1970: 16): Die Atombombe verändere den Charakter des Krieges „... von einer Streitgemeinschaft zu einer vom Menschen ausgelösten Naturkatastrophe...“. Oder anders: wo das Mittel den Zweck, dem es dienen soll, im Falle seines Einsatzes obsolet macht, führt es sich selber ad absurdum. Damit aber wäre auch die hergebrachte Unterscheidung von Krieg und Frieden fragwürdig. Ihre Grenzen verschwimmen spätestens da, wo in der Politik der Abschreckung die Vorbereitung auf den Krieg zur Dauermaxime politischen Handelns wird. Die spezifischen Konturen von Krieg und Frieden als trennbare gesellschaftliche Größen gehen verloren: „Mit der Entwicklung des Kalten Krieges nach dem Zweiten Weltkrieg und der Tendenz zur Totalisierung politischer Ziele und technologischer Zerstörungspotentiale wurde überkommenen begrifflichen Differenzierungen endgültig der Boden entzogen. Dem Begriff des Krieges und dem Begriff des Friedens entsprechen in Politik und Gesellschaft heute keine eindeutigen Sachverhalte mehr“ (Senghaas 1969: 5). Die Entwicklung der Destruktionsmittel (Übersicht Metz 2006: Teil III) hat Schutzversprechen und Sphärentrennung schon zu Beginn des 20. Jhs. mittels des Luftkrieges ernsthaft hinterfragt, und in der Mitte des 20. Jhs. durch die Entwicklung nuklearer Massenvernichtungswaffen potentiell aufgehoben. Aber erst die Entwicklung des Neuen Krieges setzt solchem Denken tatsächlich ein Ende. Die charakteristischen Elemente jener Schönen Neuen Welt der privatisierten Gewalt (Mair 2003) – nämlich – die Verwicklung der Staaten in unkonventionelle Prozesse und Formen der Kriegführung zwischen staatlichen und sub- oder nichtstaatlichen Akteuren, – die Vergesellschaftung des Gewaltmonopols, – die Aufhebung der Unterscheidung zwischen Armee und Zivilbevölkerung, die Zivilisten übergangslos zu Kombattanten werden, Wohnviertel und Schlachtfeld in eins fallen lässt, – die die Brutalität der eingesetzten Mittel steigernde quantitative wie qualitative, zeitliche wie räumliche Entgrenzung eines Konflikts zwischen sich gegenseitig als illegitim bezeichnenden Einheiten, – schließlich die Abwanderung all dieser Auseinandersetzungen aus der Zuständigkeit des Völker- oder besser: zwischenstaatlichen Rechts in die normative Grauzone zwischen innerstaatlichem und zwischenstaatlichem Recht beschwören letztlich die Auflösung des überkommenen staatenzentrischen Kriegsbildes. Militärische Gewaltanwendung wendet sich aus dem zwischenstaatlichen Bereich in den innergesellschaftlichen, aus der Sphäre zwischen den handelnden Subjekten der internationalen Politik in die innergesellschaftliche Sphäre sich zersetzender und zerfallender staatlicher Handlungseinheiten. Mit diesen Veränderungen in 286 Kriegsbild und Kriegführung aber ist militärische Gewaltanwendung heute von einem überwiegend zwischenstaatlichen zu einem überwiegend innergesellschaftlichen Problem geworden ! Und: diese Entwicklung unterläuft auch eine der herausragenden Leistungen der politisch-philosophischen Ausdifferenzierung des Friedensgedankens seit der Frühen Neuzeit: die Aufspaltung des Friedensproblems in die Stiftung oder Herstellung des inneren, innergesellschaftlichen und des äusseren, zwischenstaatlichen Friedens: zumindest der binnenstaatliche Zustand einer pax civilis stand im Westfälischen System seit der 2.Hälfte des 17. Jhs. ernsthaft nicht mehr in Frage. 2.2 Krieg – postmodern Wenn der Begriff der Postmoderne in den krisenhaften Entwicklungen des internationalen Systems während des ersten Jahrzehnts des neuen Jahrtausends nicht selbst etwas außer Gebrauch und Geltung gekommen wäre, wäre man versucht, die Entwicklung des Neuen Krieges als ein typisches Moment der Postmoderne (generelle Übersicht Rosenau 1992) zu fassen: Auflösung und Dezentrierung des herkömmlich handelnden Subjekts, Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigkeiten: Skepsis gegenüber einer immer stärker technisierten und industrialisierten Form der Kriegführung („cyber warfare“), Suche nach oder Rückbesinnung auf alternative („low-tech“) Handlungsempfehlungen in Strategie und Taktik, Pluralisierung der militärischen Einsatzdoktrinen und Denkstile, Überschreitung, wenn nicht bewusste Missachtung angestammter Grenzen klassischer Politik- und Gesellschaftsbereiche, Skepsis gegenüber, wenn nicht gar entschiedene Ablehnung des herausragenden Projekts der Moderne: der geschichtsphilosophisch-rational begründeten Hoffnung auf die endliche Perfektibilität der Gattung Mensch, greifbar in der Zivilisierung des Austrags von Konflikten durch deren Verrechtlichung ebenso wie in der ethisch-rationalen Neufundierung der internationalen Politik als Friedenspolitik (Küng/Senghaas 2003). Begleitet werden diese Entwicklungen im Zeichen der Globalisierung von der Ausbildung einer postnationalen Konstellation: Verwischung ehemals klar gezogener Grenzen zwischen Innen und Außen, zwischen Innenpolitik und internationaler Politik, zwischen Krieg und Frieden. Phänomene der Denationalisierung (Zürn 1998) – Ausweitung gesellschaftlicher Interaktionen über die Grenzen des Nationalstaats hinaus – sind für die Politikwissenschaft zwar nichts Neues: die anachronistische Souveränität war schon 1970 Thema des ersten PVS-Sonderheftes. Aber: Mit der Infragestellung des nationalen Akteurs als klassischer Kriegführungsmacht – schlimmstenfalls mit seiner Degeneration zum schwachen oder gar gescheiterten Staat (Schneckener 2006) – wird auch der zwischenstaatliche Krieg als alleinige oder hauptsächliche Austragungsform internationaler Konflikte zum Anachronismus. An die Stelle organisierter zwischenstaatlicher Gewaltanwendung tritt ein neuer Kriegstyp, in dem sich Momente des klassischen Krieges, des Guerillakrieges, des bandenmäßig organisierten Verbrechens, des transnationalen Terrorismus und der weitreichenden Verletzung der Menschenrechte miteinander verbinden (Übersicht: Frech/Trummer 2005). Seine asymmetrische Struktur (Münkler 2006: Teil II) zwischen regulären und 287 irregulären Kampfeinheiten impliziert seine sowohl zeitliche als auch räumliche Entgrenzung: die Heckenschützen Sarajevos kämpften weder entlang einer zentralen Frontlinie noch innerhalb eines durch Kriegserklärung formal begonnenen und durch Kapitulation oder Friedensvertrag formal geschlossenen Zeitraums. Sie sind aber ein gutes Beispiel für ein weiteres Kennzeichen Neuer Kriege: der sukzessiven Verselbständigung und Autonomisierung ehedem militärisch eingebundener Gewaltformen wie Gewaltakteure (Münkler 2003). Die regulären Armeen verlieren die Kontrolle über das Kriegsgeschehen – sowohl räumlich als auch zeitlich. Während nach Clausewitz im herkömmlichen Krieg zwischen Staaten die Niederwerfung des Gegners in der nach Konzentration der Kräfte angestrebten Entscheidungsschlacht das oberste Ziel der Kriegsparteien ist, besteht die Besonderheit des Neuen Krieges in einer Strategie des sich lang hinziehenden Konflikts, in dem der Gegner vorgeführt, ermüdet, moralisch und physisch zermürbt, durch punktuelle Aktionen räumlich gebunden, schließlich durch Schnelligkeit und Bewegung ausmanövriert und durch geschickte, gelegentlich durchaus auch eigene Opfer kostende Aktionen in den Augen einer internationalen Öffentlichkeit diskreditiert, moralisch erniedrigt und so bei möglichen Waffenstillstands- oder Friedensverhandlungen unter Vermittlung mächtigerer Dritter ins Unrecht gesetzt und zumindest teilweise um die Früchte seiner Anstrengungen gebracht wird. Eine solche Veränderung der Kriegsziele zieht notwendigerweise auch eine Veränderung in der Art der Kriegführung nach sich: die großen, statischen Abnutzungsschlachten regulärer Armeen aus der Zeit des Ersten, die schnelle, raumgreifende Bewegung gepanzerter Verbände aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs weichen Konfrontationen zwischen kleinen, regulären und/oder irregulären Verbänden, in denen klare Fronten ebenso selten sind wie große Entscheidungsschlachten. Was zählt, ist nicht der militärische Sieg über den Gegner, sondern die Kontrolle über seine Auslandsverbindungen, seine Transportwege, seine Rohstoffvorkommen, über die Moral und Informationslage seiner Zivilbevölkerung. Das bevorzugte Mittel der Auseinandersetzung sind Kleinwaffen, automatische Gewehre, Granatwerfer: die effektivsten Kampfmaschinen des Kalaschnikow-Zeitalters (Kongo, Liberia) sind Sturmgewehr-bewaffnete, bekiffte, zugedröhnte männliche Jugendliche, die außerhalb ihrer als Miliz firmierenden Räuberbande weder die Mittel zum Lebensunterhalt noch gesellschaftliche Anerkennung oder Respekt für ihr Tun erwarten können. Insofern ginge man auch zu kurz, den Neuen Krieg als einen „bloßen“ ethnonationalistischen Bürgerkrieg zu begreifen, in dem die Gewaltanwendung zur Durchsetzung von Volksgruppen-Zielen gleichsam privatisiert wird. Er ist ein genuin politisches Phänomen, an dem externe und interne, regierungsamtliche wie nichtregierungsamtliche Akteure gleicherweise teilhaben. In ihm geht es weniger um klassische machtpolitische und/oder territoriale Ziele, wie sie etwa die „Kanonenbootpolitik“ des 19. Jhs. kennzeichneten, sondern um (auch bewaffneten Zwang als Mittel der Überzeugung oder Verdrängung Andersdenkender einsetzende) Identitätsstiftung. In Abwandlung des klassischen Diktums von Carl Schmitt – dass nämlich souverän sei, wer über den Ausnahmezustand bestimme – ist der eigentliche Souverän des Neuen Krieges derjenige, der Konflikte der Perzeption des Anderen durch die eigenen Kampfgenossen, 288 der Interpretation historischer und politischer Tatsachen auf der innergesellschaftlichen wie internationalen Referenzebene und der Sinnstiftung auf der Ebene der Weltanschauung, der Religion oder der Ideologie zu seinen Gunsten entscheiden kann. Vom Totalitätsanspruch der Sinnstiftung ist es in aller Regel nur ein kleiner Schritt zum Totalitätsanspruch der Kriegführung. Die Bezeichnung der Neuen Kriege als Kleine Kriege ist ein gutes Stück euphemistischen Orwell’schen New Speak: weder in Dauer, Intensität noch Zerstörungskraft sind die Kleinen Kriege tatsächlich klein. Vielmehr zeichnen sie sich durch extraordinäre Langlebigkeit (z.B. Sudan, Angola, Kongo, Kolumbien) aus – vor allem, wenn Kriegsparteien in der Peripherie von (Rest-) Staaten agieren, Zugang zu wertvollen Ressourcen (Öl, Diamanten) haben und mit Blick auf einen ungewissen Frieden es vorziehen, ökonomische Gewinne durch dauerhafte Gewaltstrategien zu realisieren. Was sie prinzipiell kennzeichnet, ist ihre Durchbrechung, wenn nicht gar Außerkraftsetzung verbindlicher Regeln für die Kriegführung: die Kriegsakteure bestreiten die Geltung des Kriegsvölkerrechts, weil es sich um ein zwischenstaatliches Rechtssystem handelt, sie sich aber gerade nicht als staatliche Akteure begreifen, die den das ius in bello kodifizierenden und einhegenden Konventionen unterworfen sind. Am augenfälligsten wird diese Entwicklung in der Aufhebung der Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten: im Kleinen Krieg kommen paradoxerweise alle Mittel zum Einsatz, so dass er in seiner charakteristischen Brutalität Züge annimmt, die sonst nur mit dem Phänomen des totalen Kriegs in Zusammenhang gebracht werden. „Die Gesamtheit des Gegners, und nicht nur dessen Kombattanten, wird als Feind angesehen und bekämpft. Die Symmetrie, also die Beschränkung des Kampfes auf die Kombattanten, kennzeichnet den großen Krieg; für den kleinen Krieg hingegen ist die bewusst angestrebte Asymmetrie im Kampf gegen die verwundbarste Stelle des Gegners, eben die Nichtkombattanten, charakteristisch. Daher rührt der hohe Anteil von Zivilisten unter den Opfern kleiner Kriege. Auch reguläre Streitkräfte, die in einem kleinen Krieg gegen irreguläre Kräfte eingesetzt werden, tendieren dazu, sich die regellose Kampfesweise des Gegners zu eigen zu machen...“ (Hoch 2001: 19). Mit den überkommenen Kategorien des Generals von Clausewitz ist das Kriegsbild der Neuen Kriege (Kaldor 2000; Forschungsüberblick Daase 2003) nicht länger zu fassen. Denn: – Die Fragmentierung der staatlichen Handlungssubjekte, die Privatisierung des staatlichen Gewaltmonopols durch die Akteure informeller Raubökonomien stellt die These von der politischen Zweckrationalität des Krieges aus der Perspektive einer Vielzahl von Mikro-Ebenen radikal in Frage (Übersichten: Voigt 2002). Die Ebene der Gewaltanwendung verschiebt sich „nach unten“, die über Jahrhunderte erarbeiteten Regeln der zwischenstaatlichen Kriegführung verlieren sich immer mehr zwischen den Fronten nichtstaatlicher Kriegs- oder Konfliktparteien (Daase 1999). – Im Kontext der Neuen Kriege lösen sich die herkömmlichen, dem Primat der Politik unterstellten und dem Prinzip von strategischer Rationalität, einheitlicher Führung, Befehl und Gehorsam verpflichteten militärischen Großverbände als Hauptträger der Kriegführung auf. An ihre Stelle treten die Privatarmeen ethnisch-nationaler Gruppen, Partisanenverbände, unabhängig operierende Heckenschützen, 289 marodierende Banden, Mafiagangs: „What are called armies are often horizontal coalitions of local militia, break away units from disintegrating states, paramilitary and organized crime groups“ (Kaldor 1997: 16). Dabei schwindet nicht nur die klassische Unterscheidung von Kombattanten und Zivilisten – die Schlachtfelder des Neuen Krieges werden bevölkert von Figuren, die Europa seit dem Absolutismus aus der Kriegführung verbannt hatte: – dem Warlord, einem lokalen oder regionalen Kriegsherrn, der seine Anhängerschaft unmittelbar aus dem Krieg, der Kriegsbeute und den Einkünften des von ihm eroberten Territoriums finanziert (Rich 1999; Reno 1999; Azzellini/Kanzleiter 2003); – dem Söldner, einem Glücksritter, der in möglichst kurzer Zeit mit möglichst geringem Einsatz möglichst viel Geld zu verdienen trachtet (www.kriegsreisende.de) – dem Kindersoldaten, dessen Beeinflussbarkeit und Folgebereitschaft ihn zu einem gefügigen Instrument des bewaffneten Terrors macht (www.kindersoldaten.de) (Gesamtüberblick Förster/Jansen/Kronenbitter 2010). – Angesichts der so fassbaren Entgrenzung der Kriegsakteure – verstanden nicht nur als die Verwischung der Differenz von Regularität und Irregularität, sondern auch als Wandel von ehedem regional oder national verankerten Akteuren zu transnationalen Einheiten – die etwa in einem Staat kämpfen, aber in einem benachbarten ihre Rückzugs- und Ruheräume (teils auch gegen Widerstreben der dortigen Autoritäten) besetzen – wundert es nicht, dass militärische Gewalt sich immer seltener nach außen richtet, in den Bereich zwischen den Staaten. Vielmehr kehrt sich ihre Stoßrichtung um, in die Innensphäre der zerfallenden einzelstaatlichen Subjekte hinein. Ihr übergeordneter Zweck ist nicht mehr die Fortsetzung des politischen Verkehrs unter Einmischung anderer Mittel, sondern die Sicherung des innergesellschaftlichen Machterhalts von Interessengruppen, Clans, Warlords, Kriminellen; die Garantie von Beute und schnellem Profit; die Erzwingung und Erhaltung von klientelistischen und persönlichen Abhängigkeiten, die Etablierung und der Ausbau von Formen quasi-privatwirtschaftlich organisierter Einkommenserzielung. Schon wird der low intensity conflict als Fortsetzung der Ökonomie mit anderen Mitteln bezeichnet: eher als im zwischenstaatlichen Krieg geht es in ihm um handfeste materielle Interessen, um die Verteilung wirtschaftlicher Ressourcen und Chancen, in welcher ethnischen, religiösen oder ideologischen Verkleidung die Konfliktparteien auch auftreten. – Damit aber verändert sich auch die Ökonomie des Krieges: rekurrierte der klassische Staatenkrieg noch auf die Ressourcenmobilisierung durch den Staat (Steuern, Anleihen, Subsidien, totale Kriegswirtschaft), passte er die Wirtschaft als Kriegswirtschaft an den Ausnahmezustand an, ordnete er das, was sonst dem Markt überlassen blieb, planwirtschaftlich den Anforderungen des Krieges und der Kriegsziele unter (Ehrke 2002), so finanzieren sich die Guerrilla- und low intensity-warfare-Konflikte der Gegenwart aus Kriegsökonomien, die durch die Gleichzeitigkeit von (nationaler) Dezentralisierung und globaler Verflechtung gekennzeichnet sind (Ballentine/Sherman 2003). Offizielle Machthaber, 290 Interventionsarmeen, Kriegsherren, Warlords und Rebellen organisieren von einander getrennte Wirtschaftsräume, die aber mit den Wirtschaften anderer Staaten und/oder der globalen Weltwirtschaft vernetzt sind. Die nationale Ökonomie informalisiert sich. Die Wirtschaften des Bürgerkrieges, des Neuen Krieges sind Ökonomien mit ungeschützten Märkten, die ihre Akteure vor andere Handlungsnotwendigkeiten stellen als jene, in denen der sich ausbildende Zentralstaat Rechtssicherheit und Verkehrswegesicherheit ebenso garantiert wie Eigentum und Besitzverhältnisse. In einer solcherart dezentralisierten Wirtschaft haben die illegale Aneignung von Gold und Edelsteinen, der Menschen- und Rauschgifthandel, der Zigaretten- und Treibstoffschmuggel Hochkonjunktur (Jean/Rufin 1999) – und das nicht nur während der Phase militärischer Auseinandersetzungen, sondern gerade auch in den Zwischenzeiten, in denen Fronten begradigt, Kräfte gesammelt, Waffenarsenale neu aufgefüllt werden. Trennende Kulturen und Religionen liefern der Ökonomie des Neuen Krieges allenfalls den Vorhang, hinter dem Akteure mit klaren wirtschaftlichen Interessen zu erkennen sind – die Kriegsherren, die auf den sich entwickelnden Gewaltmärkten Gewalt als effektives und effizientes Mittel wirtschaftlichen Erwerbsstrebens einsetzen. Die politische Ökonomie dieser Konflikte ist nicht mehr staatszentriert: vielmehr sind die Kriegsökonomien in regionale und globale, sich der staatlichen Kontrolle entziehende mafiöse und/oder parasitäre Transaktionsnetze eingebunden. – Und: wie erfolgreiche transnationale Konzerne geben die Akteure des Neuen Krieges in ihrer Organisationsstruktur das herkömmliche Prinzip einer pyramidal-vertikalen Kommandohierarchie auf, nähern sich den komplexen horizontalen Netzwerken und flachen Hierarchien, die die Führungsstrukturen moderner Wirtschaftsunternehmen kennzeichnen. Zu einem Gutteil ist selbst ihre Kriegführung transnational: sie werden finanziert durch Spenden oder „Abgaben“ in der Diaspora lebender Volksangehöriger oder ihren Zielen geneigter Drittstaaten (Tanter 1999); sie greifen logistisch auf einen globalisierten Waffenmarkt zu; sie rekrutieren ihre Kämpfer aus Angehörigen (fundamentalistisch-) weltanschaulich gleichgerichteter Drittgesellschaften; sie nutzen die Dienste weltweit operierender kommerzieller Anbieter militärischer Beratungs-, Trainings- und Kampfleistungen (Shearer 1998; aktuelle Übersicht Michels/Teutmeyer 2010); und sie beschränken ihre Aktionen nicht auf das angestammte Territorium oder regionale Kriegsschauplätze, sondern tragen ihren Kampf mittels spektakulär-terroristischer Akte an solche Orte, an denen ihnen die Aufmerksamkeit einer multimedial rund um den Globus vernetzten Weltöffentlichkeit sicher sein kann. – Schliesslich: Der wichtigste Unterschied zwischen klassischen und Neuen Kriegen betrifft die überkommene begriffliche wie faktische Trennung von Krieg und Frieden: im Neuen Krieg werden Krieg und Frieden zu nur noch relativen gesellschaftlichen Zuständen. Der Neue Krieg wird nicht erklärt und nicht beendet: vielmehr wechseln in ihm Phasen intensiver und weniger intensiver Kampfhandlungen, in denen Sieger und Besiegte nur schwer ausgemacht werden können. Entscheidungsschlachten werden 291 nicht mehr geschlagen; Gewaltanwendung diffundiert als bevorzugtes Mittel der Konfliktbearbeitung in alle gesellschaftlichen Lebensbereiche. Halten wir fest – trotz aller Diskussion und teils entschiedenem Widerspruch im Einzelnen (locus classicus jetzt die Diskussion der Münkler’schen Thesen in EWE 19: 2008): mit dem eingangs skizzierten Konzept des heroischen Krieges ist die Entgrenzung – oder noch besser: Ausfransung und Molekularisierung – klassischer zwischenstaatlicher Formen der Kriegführung nicht zu fassen. Und die realpolitisch-instrumentelle Sicht eines Phänomens, das wie in Afghanistan bei näherem Hinsehen in Hunderte von Klein- und Kleinstkriege zerfällt, an denen sich rivalisierende Clans und Warlords, religiöse Fanatiker, ausländische Soldaten und lokale Straßenräuber (Voigt 2002: 323) beteiligen, reduziert sich nicht immer, aber immer öfter, auf die gewaltsamen Kontexte von greed, corruption, and dominance. Selbstverständlich kann man in der Diskussion eine Volte zu Grimmelshausens Simplicius Simplicissimus schlagen und behaupten, seit dem Dreißigjährigen Krieg hätten sich die Formen kleinteiliger Gewaltsamkeit nur unwesentlich verändert, seien zwischen dem als Schwedentrunk bekannten Folterinstrument nicht nur der schwedischen Soldateska jener Zeit und der Praxis des Waterboarding nur graduelle Unterschiede geltend zu machen. Aber dieses Argument ignoriert doch wenigstens einen entscheidenden Hintergrundfaktor in der Entwicklung der Kriegführung: den Fortschritt nicht nur der Produktiv-, sondern vor allem auch der Destruktivkräfte mitsamt ihren kontingenten Konsequenzen für den politisch-gesellschaftlichen Überbau von Krieg und Frieden. Wir werden an Schluss des Beitrages auf diesen Punkt noch einmal zurückkommen. 3.1 Friede – klassisch Wollte man versuchen, das Grundmuster der Entwicklung von Krieg und Frieden seit dem ausgehenden europäischen Mittelalter (Altertum und außereuropäische Kulturen können hier aus Platzgründen nicht behandelt werden; Übersicht bei Huber/Reuter 1990; umfassend auch Adolf 2009; immer noch lesenswert Janssen 1975) mit wenigen groben Pinselstrichen zu charakterisieren, müsste man sich erneut einer binären Codierung bedienen: Fehde als bellum privatum und Krieg (gegen den äußeren Feind) als bellum publicum treten seit dem 13. Jh. im Zuge der Diskussion der Lehre vom Gerechten Krieg und der langsamen Ausbildung herrschaftlicher Gewaltmonopole ebenso auseinander (Übersicht: Kroener 2008) wie die Konzepte des inneren und des äußeren Friedens. Im letzteren Kontext ist zudem vor dem Hintergrund einer weithin als friedlos erfahrenen Welt eine Auflösung der mittelalterlichen engen Verbindung von weltlichem Frieden (pax temporalis), religiöser Eintracht (concordia) und Gerechtigkeit (iustitia) zu konstatieren. Das normative Duopol des Mittelalters – die Formel von pax et iustitia – verliert angesichts konfessioneller Streitigkeiten und Glaubenskämpfen an Kraft; der innere (erst eher weltliche, dann säkularisierte) Friede gewinnt, ausgehend vom Gottesfrieden, Gestalt in der Form des Fehdeverbots, der Landfriedenseinungen, des Ausbaus des herrschaftlichen Gerichtswesens, der Garantie von Vertrags- 292 und Verkehrswegesicherheit durch die aufblühenden Territorialgewalten, kurz: in der Intensivierung der Erwartungsverlässlichkeit des herrschaftlichen Akteurshandelns - durchaus übrigens im Interesse des Fernhandels und des beginnenden Verlags- und Manufakturwesens. Spätestens seit Naturrecht und Vertragstheorie bezieht politische Herrschaft ihre Legitimation aus der Garantie des den Naturzustand überwindenden status civilis als eines Zustandes der Sicherheit im Binnenverhältnis eines Gemeinwesens ebenso wie eines Zustandes des durch die Abwesenheit organisierter militärischer Gewaltanwendung zwischen gesellschaftlichen Großgruppen gekennzeichneten negativen Friedens im Außenverhältnis der Gesellschaften. Und: Mit der Konstituierung des Staatsfriedens – pax civilis – als Zustand der öffentlichen Ruhe und Sicherheit am Ausgang der frühen Neuzeit, mit der Etablierung des Staates als eines unbedingten Friedensverbandes wird nun auch der Weg frei zu einer tiefgreifenden Bedeutungsverschiebung der Begriffe von Krieg und Frieden: von der innerstaatlichen Ordnung zur Ordnung der internationalen Beziehungen. Gleichzeitig mit der Ausbildung des Territorialstaates hatte das ius ad bellum, das Recht auf bewaffnete Selbsthilfe durch Fehde und Krieg hinsichtlich des Kreises der zur Ausübung dieses Rechtes Befugten eine kontinuierliche Einschränkung erfahren. In der Verfestigung des souveränen Staates – nach innen konstituiert durch die suprema potestas imperandi et judicandi: die oberste Befehls- und Rechtsprechungsgewalt, nach außen konstituiert durch die potestas bellandi: das Recht zur Kriegführung – hat dieser Prozeß sein Ende gefunden. Der Krieg ist hinfort allein zu begreifen als gewaltsame Auseinandersetzung zwischen souveränen Staaten, die im Binnenverhältnis Fehde, Feindschaft und (religiös motivierten) Bürgerkrieg durch die Etablierung einer effektiven Staatsgewalt (als summa potestas jurisdictionis: oberste rechtsetzende Gewalt) überwunden haben. Die Grenze des Staates trennt nun einen Bereich des (inneren) Friedens und der Sicherheit von einem Bereich des (zwischenstaatlichen) Krieges und der Unsicherheit. Der Naturzustand der Gesellschaftsvertragstheorien hat sich gleichsam von der Ebene der zwischenmenschlichen auf die Ebene der zwischenstaatlichen Beziehungen verlagert. Thomas Hobbes wird mit seiner politischen Philosophie zur entscheidenden Schlüsselfigur dieser Entwicklung. Friede und Staat bedingen sich in seiner Sicht gegenseitig: nur der Leviathan, der Staat, kann seinen Bürgern den Frieden garantieren, und nur das Gemeinwesen kann tatsächlich als Staat gelten, das den Frieden wirksam sichert. Er begreift das Wesen des Friedens als securitas pacis, als Sicherheit im doppelten Sinne des faktisch-politischen Sicherheitszustandes und des subjektiven Sicherheitsgefühls. Der Gegenbegriff zum Frieden ist nicht der Krieg, sondern die Unsicherheit, die Furcht: Aus den in der menschlichen Natur liegenden hauptsächlichen Konfliktursachen – Konkurrenz, Misstrauen, Ruhmsucht „ergibt sich klar, dass die Menschen während der Zeit, in der sie ohne eine allgemeine, sie alle im Zaum haltende Macht leben, sich in einem Zustand befinden, der Krieg genannt wird, und zwar in einem Krieg eines jeden gegen jeden. Denn Krieg besteht nicht nur in Schlachten oder Kampfhandlungen, sondern in einem Zeitraum, in dem der Wille zum Kampf genügend bekannt ist. Und deshalb gehört zum Wesen des Krieges der Begriff Zeit, wie zum Wesen des Wetters. Denn wie das Wesen des schlechten Wetters nicht in ein oder zwei Regenschauern liegt, sondern in einer Neigung hierzu während mehrerer Tage, so besteht 293 das Wesen des Krieges nicht in tatsächlichen Kampfhandlungen, sondern in der bekannten Bereitschaft dazu während der ganzen Zeit, in der man sich des Gegenteils nicht sicher sein kann. Jede andere Zeit ist Frieden.“ (Th. Hobbes: Leviathan, Buch I, Kap. 13). Hobbes begreift also den Frieden aus der Negation des Krieges, als absentia belli. Der Inhalt seines Friedensbegriffs wird konstituiert durch Sicherheit, Ruhe und (öffentliche) Ordnung – securitas und tranquillitas pacis. Allein der Staat kann diese Werte autoritär erzwingen und garantieren: und diese friedensstiftende Funktion des Staates wird legitimiert durch den Vertragsgedanken. Sicherheit und Friede sind nur erreichbar, wenn alle Individuen auf ihr naturzuständliches Recht zur bewaffneten Selbsthilfe verzichten, indem sie jeder mit jedem anderen einen Gesellschaftsvertrag abschließen, durch den der Staat gleichsam als eine zu einer (fiktiven Staats-)Person vereinte Menge entsteht. Der Gesellschaftsvertrag fällt bei Hobbes mit einem Unterwerfungsvertrag zusammen: der endgültigen, unwiderruflichen Übertragung des Selbsthilferechtes seitens jedes einzelnen auf einen Souverän, der dadurch die Gewalt aller Menschen in der Form ihres Beistandes zu seinen Handlungen in seiner Hand vereinigt. Seine Aufgabe ist es, das Chaos des Krieges aller gegen alle zu bändigen und mittels des von ihm nun wahrgenommenen Gewaltmonopols Sicherheit und Verlässlichkeit gegenwärtiger und zukünftiger menschlicher Bedürfnisbefriedigung zu garantieren. Denn: Hobbes legt dar, dass ein bloßer Gesellschaftsvertrag solange wertlos ist, wie niemand eine Garantie dafür besitzt, dass die anderen sich gleichfalls an das von ihm gegebene Versprechen halten. Nur der Staat schützt die Einhaltung des Gesellschaftsvertrages – sind doch „die natürlichen Gesetze ... (ebenso wie) ... das Gesetz, andere so zu behandeln wie wir selbst behandelt werden wollen ... an sich, ohne die Furcht vor einer Macht, die ihre Befolgung veranlasst, unseren natürlichen Leidenschaften entgegengesetzt ... Und Verträge ohne das Schwert sind bloße Worte und besitzen nicht die Kraft, einem Menschen auch nur die geringste Sicherheit zu bieten“ (Th. Hobbes, Leviathan, Buch II, Kap. 17). Die nullsummenspielartige Konkurrenzordnung der staatenzentrischen internationalen Beziehungen – repräsentiert seit 1648 durch das Westfälische System - birgt eine spezifische Vorstellung vom äußeren Frieden in sich: die eines labilen, durch völkerrechtlichen Vertrag begründeten und abgesicherten Zustandes ruhender Gewalttätigkeit. Seit der Einführung des Gleichgewichtskonzepts in den machtpolitisch-diplomatischen Kontext Europas durch den Frieden von Utrecht 1713 wird dieser labile Friedenszustand im Grunde durch ein System bündnisbasierter Abschreckung gestützt: dass die Koalitionen des Systems wechseln, und im Zuge dieser Wechsel Krieg zur (Wieder-)Herstellung des Gleichgewichts geführt wird, ist nicht zuletzt Konsequenz eines bestimmten Entwicklungsstandes der Destruktivkräfte, die im Gegensatz zur MAD-Zeit des Ost-West-Konflikts den Krieg eben nicht als eine Naturkatastrophe, sondern im Sinne des Generals v. Clausewitz als Instrument zur Fortsetzung des diplomatischen Verkehrs unter Einmischung anderer Mittel erscheinen lassen. Die mit dem Ausbau des frühneuzeitlichen Staates einhergehende Besetzung des Friedensbegriffes für die pax civilis – für öffentliche Sicherheit und Ordnung innerhalb des Staates – hatte die Idee vom äußeren Frieden zwischen 294 den Staaten ebenso prekär werden lassen wie die Gesellschaftsvertragstheorie: indem sie den Naturzustand des Krieges aller gegen alle zwischen den Individuen aufhob, setzte sie den Begriff frei zur Beschreibung des Verhältnisses zwischen den Völkerrechtssubjekten, den Staaten. Der Friede ist zunächst der Nicht-Krieg: pax absentia belli. Damit dieser Zustand jene Sicherheit erhielt, die im Begriff der pax civilis zum Konstitutionsmerkmal von Frieden überhaupt geworden war, musste ein Vertrag zwischen den Völkerrechtssubjekten hinzukommen. Friede und Friedensvertrag werden hinfort terminologisch gleichgesetzt; Friede wird in immer weiterem Maße zu einem juristisch-völkerrechtlichen Begriff, der einen bestimmten Zustand der Machtverteilung zwischen den Staaten festschreibt. Was dieser Definition abgeht, ist die – in der mittelalterlichen Formel von pax et iustitia noch greifbare – Verbindung von Frieden und sozialer Gerechtigkeit: Die definitorischen Probleme der Gegenwart haben hier ihren Ursprung. Es ist ein Kennzeichen des quasi-naturzuständlichen Staatensystems, dass ihm eine den Staaten übergeordnete Gewalt, ein überstaatlicher Leviathan, fehlt. Bei Streitfällen über die Auslegung (friedens-) vertraglicher Regelungen haben die souveränen Kontrahenten selbst über die Rechtmäßigkeit ihrer Sache zu urteilen und ihren Spruch im Wege der Selbsthilfe zu vollstrecken – durch Krieg. „Ubi iudicia deficiunt, incipit bellum“ – wo es an rechtlichen Entscheidungen fehlt, bricht der Krieg aus: Mit diesem Satz hat Hugo Grotius in seinen Drei Büchern vom Recht des Krieges und des Friedens (Paris 1625) das Binnenverhältnis der quasi-naturzuständlichen Staatengesellschaft adäquat beschrieben (Zweites Buch, 1. Kapitel Abschn. II). 3.2 Friede - modern Wenn es zutrifft, dass das, was die Friedensforschung am Kriege interessiert, der Friede ist – der Friede als Beendigung des Krieges, als Transformation kriegsträchtiger Entwicklungen und Konstellationen, als Aufhebung des Krieges als sozialer Institution (Brock 2002) – dann wird sie ihren auf die Neuen Kriege bezogenen Begriff vom Frieden erst noch formulieren müssen. Bislang waren ihre Friedenskonzepte eher auf den klassischen zwischenstaatlichen Krieg bezogen, gingen freilich oft, wie die griffige Kurzformel „Frieden ist mehr als kein Krieg“ (Rittberger 1985: 1139) verdeutlicht, über dessen bloße Negation hinaus. Die Richtung allerdings, in der dieses „Mehr“ aufzusuchen sei, blieb seltsam diffus (Czempiel 2002): Wenn man mit Georg Picht dem Frieden nicht ohnehin unterstellt, dass es in seinem Wesen läge, dass er überhaupt nicht definiert werden könne, erweist sich die von Johan Galtung 1975 getroffene Unterscheidung von personaler, direkter und struktureller, indirekter Gewalt und die darauf aufbauende Formulierung zweier Friedensbegriffe – nämlich des negativen Friedens als Abwesenheit organisierter militärischer Gewaltanwendung, des positiven Friedens als Abwesenheit struktureller Gewalt – für mehr als 30 Jahre als diskursprägend; zumindest auf den negativen Frieden als Grundvoraussetzung des Weltund Gattungs-Überlebens konnten sich Wissenschaften und Wissenschaftler im Konsensverfahren einigen (exzellente Übersicht Müller 2003). 295 Die Kontrastierung von negativem und positivem Frieden gewinnt ihre Bedeutung in und aus der Zeit des Kalten Krieges. Angesichts der möglichen Eskalation der Auseinandersetzung zwischen den Supermächten zu einem nuklearen Weltkonflikt fasst die in den späten 50er Jahren aufkommende Friedensforschung Frieden in einer Minimaldefinition als Abwesenheit von Krieg – oder genauer: als Abwesenheit organisierter militärischer Gewaltanwendung zwischen gesellschaftlichen Großgruppen, gleichgültig, ob ein legaler Kriegsstatus zwischen den betroffenen Staaten und/oder Parteien besteht oder nicht. Analog dem Begriff der Gesundheit in der Medizin wird Frieden folglich definiert ex negatione, als Abwesenheit bestimmter Störfaktoren. Eine Definition, die noch am ehesten verständlich wird vor dem Hintergrund jenes grundsätzlich-qualitativen Wandels, den die Kriegführung seit 1945 mit der Entwicklung und Dislozierung thermonuklearer Massenvernichtungswaffen erfahren hat. Das Überleben der Menschheit hängt von der Verhinderung des nuklearen Holocausts ab. Und die Chance einer solchen Verhinderung steigt in dem Maße, in dem das politisch-militärische Konfliktverhältnis zwischen den Supermächten stabilisiert wird. Die Bedingung einer solchen Stabilisierung ist die Regulierung der Gewaltanwendung im bestehenden internationalen System. Eine Regulierung, die durch Maßnahmen der Rüstungskontrolle, der Vertrauensbildung und der Schaffung eines beiderseitigen Zustandes struktureller Angriffsunfähigkeit die Eskalation an sich nachrangiger Konflikte zur direkten Konfrontation zwischen den Blöcken verhindert. Diese Ausrichtung des negativen Friedensbegriffes auf die Konfrontation der Supermächte und ihrer jeweiligen Blockklientel bot den Ansatzpunkt weiterführender Kritik: Denn das Konzept des negativen Friedens basiert auf dem Gedanken einer klaren, potentiell gewaltsamen Subjekt-Objekt-Beziehung: einer Beziehung zwischen potentiellem Täter und potentiellem Opfer, wie sie für die Bedrohungslage des Kalten Krieges, die Politik der Abschreckung und der kollektiven Verteidigung kennzeichnend war. Was das Konzept aber nicht erfasst, ist der Aspekt der strukturellen, akteurslosen Gewalt, wie er die Verhältnisse der Ausbeutung und Abhängigkeit innerhalb der Dritten Welt ebenso kennzeichnet wie den Konflikt zwischen den Staaten des Südens und denen des Nordens. Der negative Friede eröffnet keinen Ausblick auf weiterreichende, den Zustand des Nicht-Krieges überwindende Ziele. Vermutlich sind hier höchst ambivalente Gefühle mit im Spiel: man wünscht zwar den Frieden bewusst herbei, als Weltordnung aber – und das heißt zunächst einmal mit Mitscherlich (1970: 126) als „permanenter Verzicht auf Aggressionsäußerungen zum Selbstschutz“ scheint man ihn auch zu fürchten. „Das Gefühl, der Möglichkeit kollektiver aggressiver Äußerungen beraubt zu sein, wird unbewusst als äußerst bedrohlicher, schutzloser Zustand aufgefasst; das reflektiert sich auch in der vagen Unlust, mehr als deklamatorisch sich mit dem Frieden zu befassen...“. Und: es reflektiert sich auch im Unvermögen, im Unwillen, die Existenzbedingungen einer friedlichen Welt als Maßstab künftigen politischen Handelns zu entwerfen. Ein solcher Unwillen lässt sich nun den Vertretern eines positiven Friedensbegriffs i.d.R. nicht nachsagen. Versuchen sie doch, über die bloße Auffassung des Friedens als Abwesenheit organisierter 296 Gewaltanwendung hinauszugehen und ihn als Muster der Kooperation und Integration größerer menschlicher Gruppen zu begreifen (generelle Übersicht Cortright 2008). Sie verknüpfen mit ihm das Fehlen von Ausbeutung, wirtschaftliche und soziale Entwicklung, Pluralismus, Gerechtigkeit und Freiheit, die Verwirklichung der Menschenrechte und die jedem Individuum einzuräumende Möglichkeit, sich gemäß seinen Anlagen und Fähigkeiten selbst zu entfalten. Friedlichere Verhältnisse könnten sich auf drei spezifischen Wegen erreichen lassen: durch die Pazifizierung patriarchalischer Geschlechtsgewalt, durch die partizipative Verbesserung und räumliche Ausweitung demokratischer Herrschaftsverhältnisse und durch eine dem Friedensziel angemessenere Organisation des Weltstaatensystems (Galtung 2007). In diesem Kontext ist es von Bedeutung, dass seit einiger Zeit das Duo personale Gewalt – strukturelle Gewalt als Ursache von Unfrieden um das Konzept der kulturellen Gewalt zu einer konflikterklärenden Dreieckskonstruktion ausgeweitet wird. Als kulturelle Gewalt bezeichnet Johan Galtung jene Aspekte unserer symbolischen Weltsphäre, die dazu genutzt werden können, direkte oder strukturelle Gewalt zu rechtfertigen. Voraussetzung friedlicherer Verhältnisse ist folglich auch die Überwindung internalisierter individueller oder gesellschaftlicher Einstellungen, Glaubensmuster, Verhaltensweisen, die die Anwendung von Gewalt in allen menschlichen Tätigkeitsfeldern potentiell oder aktuell legitimieren. Damit allerdings wird die Aufgabe der inhaltlichen Bestimmung des Friedensbegriffes, seine politischgesellschaftlich-ontologische Fixierung, derart umfassend und anspruchsvoll, dass die Wissenschaft an ihr schier verzweifeln könnte. Diesem Dilemma sucht sie dadurch zu entgehen, dass sie den Frieden weniger als einen (idealistischen End-?)Zustand, sondern als einen historischen Prozess begreift, als dessen Ziel freilich die Eliminierung des Krieges – als Austragungsmodus inner- und zwischenstaatlicher Konflikte – der Verwirklichung durch schrittweise Annäherung aufgegeben bleibt (Brock 1990: 73ff.). Dabei geht es – entgegen manch landläufiger Ansicht – nicht um die Abschaffung des Konflikts als eines sozialen Verhaltenstypus an sich. Vielmehr soll seine Austragungsweise durch zunehmende Verrechtlichung zivilisiert (Näheres www.berghof-handbook.net; Küng/Senghaas 2003; Lederach 2004) – und damit die Chance zur Transformation des gewaltsamen Charakters von Konflikten in Richtung auf zunehmende Gewaltfreiheit ihres Austrags eröffnet werden (generelle Übersichten Crocker/Hampson/Aall 2007: Bercovitch/Jackson 2009). Ungeachtet dieser generellen Zielsetzung jedoch ist die Diskussion des Friedensbegriffs seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts durch eine derart extensive Ausdehnung des Begriffsumfangs und Ausdifferenzierung, wenn nicht gar Ausfransung des Begriffsinhalts geprägt worden, dass wir diese hier aus Platzgründen nur noch schematisch darstellen können: [ hier versagen leider meine Textbearbeitungskünste: die Abb. 1 – Ausdifferenzierung des Friedensbegriffs - kann ich nicht von Hand einfügen – vgl. Anhang zum Text ] 4 Ausblick: Neuer Krieg – aber kein Neuer Friede ? Was tun ? 297 Genauso problematisch wie die Ausfransung des Friedensbegriffs scheint, dass die Friedenswissenschaft die oben beschriebenen Veränderungen des Kriegsbildes, die notwendigerweise auch die Politik der Friedensschaffung und Friedensbewahrung beeinflussen müssen, bislang kaum nachvollzogen hat. Sie blieb einerseits gefangen im Vorstellungskreis der organisierten Friedlosigkeit, des Abschreckungsfriedens, den es zu stabilisieren und zu perfektionieren galt, um einen nuklear entfachten Weltbrand zu verhindern. Sie blieb andererseits befangen in der antiimperialistischen Optik einer auf Befreiung der Dritten Welt von weltmarktvermittelten Dependenzverhältnissen gerichteten Analyse struktureller, seit neuerem auch kultureller Gewalt. Die neue Qualität der „kleinen Kriege“ (Daase 1999), der militärischen Auseinandersetzungen der dritten Art, blieben ihr weitgehend verborgen. So verwundert es nicht, dass ihr begriffliches und praktisch-politisches Instrumentarium der Konfliktbearbeitung und Konfliktlösung – von der Phase der Prävention über die Phase des Peacemaking und Peacebuilding bis zur Phase des Peacekeeping (Bellamy/Williams 2010) – ganz überwiegend noch der Sphäre der zwischenstaatlichen Auseinandersetzungen verhaftet bleibt. Es rekurriert in je unterschiedlicher Weise auf die friedensschaffenden Leitprinzipien klassischer politischer Großtheorien, die ihrerseits selbst wieder den Gestaltungsprinzipien der Staatenwelt verpflichtet sind bzw. diese prägen. Eine Definition des Friedensbegriffs, die die Verhältnisse der Gesellschaftswelt erfasst, und die aus der Analyse dieser Verhältnisse Maximen zum Umgang mit den neuen Formen des Krieges ableiten könnte, steht noch aus (erste Ansätze im D@dalos-Projekt der UNESCO – http:// www.dadalos-d.org/frieden/; Philpott/Powers 2010). Um dieses Unternehmen zu fundieren, bedarf es nicht nur einer Aufarbeitung des ideengeschichtlichen Befundes (hierzu jetzt nachgeradezu exemplarisch Nitz 2010; allerdings dürfte die Bearbeitung der Zeit ab 1830 noch ein Weilchen auf sich warten lassen). Vielmehr wäre eine historisch-materielle Formenlehre von Krieg und Frieden vonnöten (erste Ansätze in Beyrau u.a. 2007), die vor dem Hintergrund von politischherrschaftlicher Organisation und sozioökonomischer Struktur einer bestimmten Gesellschaft oder einer bestimmten Epoche die Entwicklung beider Phänomene aufeinander bezieht, nach ihren gegenseitigen Abhängigkeiten und formenden Einflüssen aufeinander fragt und das Ganze nicht nur auf den politischgesellschaftlichen Überbau bezieht, sondern vor allem auch in Relation zur Entwicklung der Produktiv- und Destruktivkräfte setzt. Denn: die Bestimmung jenes Mehr, das (im Sinne Rittbergers) den Friedensbegriff über den Nicht-Krieg hinaustreibt, kann vollzogen werden nur im Blick auf den historischgesellschaftlichen Kontext einer je konkreten historischen Epoche. Der Diskurs über „den“ Krieg und „den“ Frieden bleibt notwendigerweise formal: inhaltliche Klarheit gewinnen wir erst dann, wenn wir Begriffe und materielle Phänomene zurückholen in ein jeweils ganz bestimmtes Koordinatensystem von Raum, Zeit, gesellschaftlich-politischer, sozioökonomischer und technologischer Verortung. Für die Entwicklungsgeschichte des Krieges ist diese Forderung teilweise erfüllt – sowohl was die Verschränkung seiner politischen, ökonomischen und sozialen Randbedingungen und Triebkräfte (McNeill 1984; Porter 298 1994; Luard 1986) als auch was die gleichsam schon dialektische Abhängigkeit zwischen waffentechnologischer und Kriegsformen-Entwicklung (O‘Connell 1989) angeht. Für die genetische Bestimmung des Verhältnisses der Formen von Krieg und Frieden steht die Erfüllung dieser Forderung allerdings noch weitgehend aus; wir geben erste formale Hinweise: Abb. 2 Elemente einer historischen Formenlehre von Krieg und Frieden [Abb. 2 hier einfügen – gleiches Problem wie bei Abb. 1 – ich kriegs nicht gebacken] Weiterführende Literatur: Imbusch, Peter/Zoll, Ralf (Hrsg.): Friedens- und Konfliktforschung. Eine Einführung. 4., überarb. Aufl. Wiesbaden 2006. Webel, Charles/Galtung, Johan (Hrsg.): Handbook of Peace and Conflict Studies. Abingdon, Oxon. 2009. Keegan, John: Die Kultur des Krieges. Reinbek b. Hamburg 1997. Etzersdorfer, Irene: Krieg. Eine Einführung in die Theorien bewaffneter Konflikte. Wien u. Köln 2007. Wolfrum, Edgar: Krieg und Frieden in der Neuzeit. Vom Westfälischen Frieden bis zum Zweiten Weltkrieg. Darmstadt 2003. Adolf, Antony: Peace. A World History. Cambridge 2009. Cortright, David: Peace. A History of Movements and Ideas. Cambridge 2008. Weiterführende Internetquellen: http://www.berghof-conflictresearch.org / sowie http://www.berghof-handbook.net/ http://www.peacedocs.com/Site/Welcome.html http://www.crinfo.org/ sowie http://www.beyondintractability.org/ (University of Colorado) http://inef.uni-due.de/cms/ http://www.friedenspaedagogik.de/ Literaturverzeichnis Azellini, Dario/Kanzleiter, Boris (Hrsg.): Das Unternehmen Krieg. Paramilitärs, Warlords und Privatarmeen als Akteure der Neuen Kriegsordnung. Berlin 2003. Ayissi, Anatole: Der Aufstieg des Lumpenmilitariats. Militärmacht und politische Ohnmacht in Afrika, in: Le Monde Diplomatique, Januar 2003, S.18ff. 299 Bakonyi, Jutta/Hensell, Stephan/Siegelberg, Jens (Hrsg.): Gewaltordnungen bewaffneter Gruppen. Ökonomie und Herrschaft nichtstaatlicher Akteure in den Kriegen der Gegenwart. Baden-Baden 2006. Ballentine, Karen/Sherman, Jake (Hrsg.): The Political Economy of Armed Conflict. Beyond Greed and Grievance. Boulder, CO 2003. Baylis, John/Smith, Steve/Owens, Patricia (Hrsg.): The Globalization of World Politics. An introduction to international relations. 4.Aufl. Oxford 2008. Bellamy, Alex J./Williams, Paul D.: Understanding Peacekeeping. 2.Aufl. Oxford 2010. Bercovitch, Jacob/Jackson, Richard: Conflict Resolution in the Twenty-first Century. Principles, Methods, and Approaches. Ann Arbor 2009. Beyrau, Dietrich/Hochgeschwender, Michael/Langewiesche, Dieter (Hrsg.): Formen des Krieges. Von der Antike bis zur Gegenwart. Paderborn 2007. Bonacker, Thorsten/Weller, Christoph (Hrsg.): Konflikte der Weltgesellschaft. Akteure – Strukturen – Dynamiken. Frankfurt/M. 2006. Botzem, Sebastian u.a. (Hrsg.): Governance als Prozess. Koordinationsformen im Wandel. Baden-Baden 2009. Brock, Lothar: „Frieden“. Überlegungen zur Theoriebildung, in: Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft 21 (1990), S. 71-89 Brock, Lothar: Was ist das „Mehr“ in der Rede, Friede sei mehr als die Abwesenheit von Krieg?, in: Sahm u.a. 2002, S. 95-114. Chojnacki, Sven: Zum Formwandel bewaffneter Konflikte, in: Münkler, Herfried/Malowitz, Karsten (Hrsg.): Humanitäre Intervention. Ein Instrument außenpolitischer Konfliktbearbeitung. Wiesbaden 2008, S. 177 – 202. Clausewitz, Carl von: Hinterlassenes Werk vom Kriege. 18. Aufl., Hrsg. Hahlweg, Werner. Bonn 1973. Cortright, David: Peace. A History of Movements and Ideas. Cambridge 2008. Crocker, Chester A./Hampson, Fen Osler/Aall, Pamela: Leashing the Dogs of War. Conflict Management in a Divided World. Washington, D.C. 2007. Czempiel, Ernst-Otto: Der Friedensbegriff der Friedensforschung, in: Sahm u.a. 2002, S. 83-93. Daase, Christopher: Kleine Kriege – Große Wirkung. Wie unkonventionelle Kriegführung die internationale Politik verändert. Baden-Baden 1999. Daase, Christopher: Krieg und politische Gewalt: Konzeptionelle Innovation und theoretischer Fortschritt, in: Hellmann/Wolf/Zürn 2003, S.161-208. Dicken, Peter: Global Shift. Mapping the Changing Contours of the World Economy. 5. Aufl., London 2007. Ehrke, Michael: Zur politischen Ökonomie post-nationalstaatlicher Konflikte, in: Internationale Politik und Gesellschaft 3/2002, S. 135-163. 300 Etzersdorfer, Irene: Krieg. Eine Einführung in die Theorien bewaffneter Konflikte. Wien 2007. Förster, Stig/Jansen, Christian/Kronenbitter, Günther (Hrsg.): Rückkehr der Condottieri? Krieg und Militär zwischen staatlichem Monopol und Privatisierung. Von der Antike bis zur Gegenwart. Paderborn 2010. Frech, Siegfried/Trummer, Peter I. (Hrsg.): Neue Kriege. Akteure, Gewaltmärkte, Ökonomie. Schwalbach/Ts. 2005. Freedman, Lawrence: The Transformation of Strategic Affairs. [Adelphi Paper 379]. Abingdon/Oxon. 2006. Galtung, Johan: Konflikte und Konfliktlösungen: die Transcend-Methode und ihre Anwendung. Berlin 2007. Geis, Anna (Hrsg.): Den Krieg überdenken. Kriegsbegriffe und Kriegstheorien in der Kontroverse. BadenBaden 2006. Hellmann, Gunther/Wolf, Klaus Dieter/Zürn, Michael (Hrsg.): Die neuen Internationalen Beziehungen. Forschungsstand und Perspektiven in Deutschland. Baden-Baden 2003. Herz, John H.: Staatenwelt und Weltpolitik. Aufsätze zur internationalen Politik im Nuklearzeitalter. Hamburg 1974. Hinsley, F.H: Power and the Pursuit of Peace. Theory and Practice in the History of Relations between States. Cambridge 1967. Hoch, Martin: Krieg und Politik im 21.Jahrhundert, in: Aus Politik und Zeitgeschichte. B 20 (2001), S. 17-25. Holsti, Kalevi J.: Peace and war: armed conflicts and international order 1648 – 1989. Cambridge 1991. Huber, Wolfgang/Reuter, Hans-Richard: Friedensethik. Stuttgart 1990. Jäger, Thomas (Hrsg.): Die Komplexität der Kriege. Wiesbaden 2010. Janssen, Wilhelm: Friede, in: Brunner, Otto/Conze, Werner/Koselleck, Reinhart (Hrsg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 2, Stuttgart 1975, S.543 – 591. Jean, Francois/Rufin, Jean-Christophe (Hrsg.): Ökonomie der Bürgerkriege. Hamburg 1999. Kaldor, Mary: New and Old Wars. Organized Violence in a Global Era. Cambridge 1997. Kaldor, Mary: Neue und alte Kriege. Organisierte Gewalt im Zeitalter der Globalisierung. Frankfurt/M. 2000. Kampmann, Christoph: Friede, in: Jaeger, Friedrich (Hrsg.): Enzyklopädie der Neuzeit. Bd. 4, Darmstadt 2006, Sp. 1 – 22. Keegan, John: Die Kultur des Krieges. Berlin 1995. Kluss, Heinz: Krieg ist ein launisches Luder, in: Erwägen, Wissen, Ethik 19(2008), H.1, S. 87 – 89. 301 Kroener, Bernhard: Krieg, in: Jaeger, Friedrich (Hrsg.): Enzyklopädie der Neuzeit. Bd. 7, Darmstadt 2008, Sp. 138 – 162. Küng, Hans/Senghaas, Dieter (Hrsg.): Friedenspolitik. Ethische Grundlagen internationaler Beziehungen. München 2003. Konfliktbarometer 2009: Krisen, Kriege, Putsche, Verhandlungen, Vermittlungen, Friedensschlüsse. Hrsg. Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung e.V., Heidelberg 2010 (http://hiik.de/de/konfliktbarometer/), Kurtenbach, Sabine/Lock, Peter (Hrsg.): Kriege als (Über-)Lebenswelten. Schattenglobalisierung, Kriegsökonomien und Inseln der Zivilität. Bonn 2004. Langewiesche, Dieter: Eskalierte die Kriegsgewalt im Laufe der Geschichte ?, in: Baberowski, Jörg (Hrsg.): Moderne Zeiten. Krieg, Revolution und Gewalt im 20. Jahrhundert. Göttingen 2006, S. 12 – 36. Lederach, John Paul: Building Peace. Sustainable Reconciliation in Divided Societies. 6. Aufl. Washington, D.C. 2004. Luard, E van: War in International Society. A Study in International Sociology. London 1986. Mair, Stefan: The New World of Privatized Violence, in: Internationale Politik und Gesellschaft 2/2003, S. 11-28. McNeill, William N.: Krieg und Macht. Militär, Wirtschaft und Gesellschaft vom Altertum bis heute. München 1984. Metz, Karl H.: Ursprünge der Zukunft. Die Geschichte der Technik in der westlichen Zivilisation. Paderborn 2006. Meyers, Reinhard: Die Lehre von den Internationalen Beziehungen. Ein entwicklungsgeschichtlicher Überblick. 2.Aufl. Königstein/Ts. 1981. Meyers, Reinhard: Die Signatur der Neuzeit. Machiavelli, Hobbes und die legitimatorische Begründung des modernen Staates als Ordnungsmacht, in: Konegen, Norbert (Hrsg.): Politikwissenschaft IV. Politische Philosophie und Erkenntnistheorie. Münster 1992, S. 77 – 118. Meyers, Reinhard: Begriff und Probleme des Friedens. Opladen 1994. Meyers, Reinhard: Von der Globalisierung zur Fragmentierung? Skizzen zum Wandel des Sicherheitsbegriffs und des Kriegsbildes in der Weltübergangsgesellschaft, in: Kevenhörster, Paul/Woyke, Wichard (Hrsg.): Internationale Politik nach dem Ost-West-Konflikt. Globale und regionale Herausforderungen. Münster 1995, S. 33-82. Meyers, Reinhard: Begriffe II. Der Wandel des Kriegsbildes, in: Rinke, Bernhard/Woyke, Wichard (Hrsg.): Frieden und Sicherheit im 21. Jahrhundert. Eine Einführung. Opladen 2004, S. 25-49. Michels, Carsten/Teutmeyer, Benjamin: Private Militärfirmen in der internationalen Sicherheitspolitik: Ansätze einer Einordnung, in: Jäger 2010, S. 97 – 124. Mitscherlich, Alexander: Die Idee des Friedens und die menschliche Aggressivität. Frankfurt a.M. 1970. 302 Müller, Harald: Begriff, Theorien und Praxis des Friedens, in: Hellmann/ Wolf/Zürn 2003, S. 209-250. Müller, Harald: Frieden zwischen den Nationen. Der Beitrag der Theorien von den Internationalen Beziehungen zum Wissen über den Frieden, in: Albert, Mathias/Moltmann, Bernhard/Schoch, Bruno (Hrsg.): Die Entgrenzung der Politik. Internationale Beziehungen und Friedensforschung. Frankfurt/M. 2004, S. 40-64. Münkler, Herfried: Über den Krieg. Stationen der Kriegsgeschichte im Spiegel ihrer theoretischen Reflexionen. Weilerswist 2002. Münkler, Herfried: Die neuen Kriege. Reinbek b. Hamburg 2003. Münkler, Herfried: Der Wandel des Krieges. Von der Symmetrie zur Asymmetrie. Weilerswist 2006. Münkler, Herfried: Neues vom Chamäleon Krieg, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 16 – 17 (2007), S. 3 – 9. Münkler, Herfried: Krieg, in: Erwägen, Wissen, Ethik 19 (2008), H. 1, S.27 – 43. Münkler, Herfried: Replik. Wie lässt sich eine Theorie des Krieges entwickeln und eine Geschichte des Krieges schreiben, in: ebd., S. 126 – 142. Neyer, Jürgen: Postnationale politische Herrschaft. Vergesellschaftung und Verrechtlichung jenseits des Staates. Baden-Baden 2004. Nitz, Stephan: Theorien des Friedens und des Krieges. Kommentierte Bibliographie zur Theoriegeschichte. Bd.I: Altertum bis 1830. Baden-Baden 2010. Nye, Joseph S., Jr.: Understanding International Conflicts. An Introduction to Theory and History. 6.Aufl. New York 2007. O’Connell, Robert L. : Of Arms and Men. A History of War, Weapons, and Aggression. Oxford 1989. Orend, Brian: War, in: Stanford Encyclopedia of Philosophy (rev. 2005), abger. 22.09.2010, http://plato.stanford.edu/entries/war. Philpott, Daniel/Powers, Gerard F. (Hrsg.): Strategies of Peace. Transforming Conflict in a Violent World. Oxford 2010. Porter, Bruce D.: War and the Rise of the State. The Military Foundation of Modern Politics. New Yyork 1994. Raumer, Kurt von: Ewiger Friede. Friedensrufe und Friedenspläne seit der Renaissance. Freiburg 1953. Rengger, Nicholas/Kennedy-Pipe, Caroline: The state of war, in: International Affairs (84) 2008, S.891 – 901. Reno, William: Warlord Politics and African States. Boulder, Colorado 1999. Rich, Paul B. (Hrsg.): Warlords in International Relations. Basingstoke 1999. Rittberger, Volker: Ist Frieden möglich, in: Universitas 40(1985) S. 1139 - 1149. Rosenau, Pauline Marie: Post-Modernism and the Social Sciences. Insights, Inroads, and Intrusions. Princeton, N.J. 1992. 303 Rudolf, Peter: Krieg, in: Dieter Nohlen/Rainer-Olaf Schulze (Hrsg.): Lexikon der Politikwissenschaft. Bd. I, 4.erw.Aufl. München 2010, S.526. Ruloff, Dieter/Schubiger, Livia: Kriegerische Konflikte. Eine Übersicht, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 16 – 17 (2007), S. 10 – 17. Sahm, Astrid/Sapper, Manfred/Weichsel, Volker (Hrsg.): Die Zukunft des Friedens. Eine Bilanz der Friedens- und Konfliktforschung, Wiesbaden 2002. Schneckener, Ulrich (Hrsg.): Fragile Staatlichkeit. „States at Risk“ zwischen Stabilität und Scheitern. Baden-Baden 2006. Schulze, Hagen: Staat und Nation in der europäischen Geschichte. 2.Aufl. München 2004. Schuppert, Gunnar Folke (Hrsg.): Governance-Forschung. Vergewisserung über Stand und Entwicklungslinien. Baden-Baden 2005. Schwerdtfeger, Johannes: Begriffsbildung und Theoriestatus in der Friedensforschung. Opladen 2001. Senghaas, Dieter: Abschreckung und Frieden. Studien zur Kritik organisierter Friedlosigkeit. Frankfurt a.M. 1969. Shearer, David: Private Armies and Military Intervention. [Adelphi Paper 316]. London 1998. Sheehan, Mike: The changing character of war, in: Baylis/Smith/Owen 2008, S. 210 – 225. Tanter, Raymond: Rogue Regimes. Terrorism and Proliferation. Basingstoke 1999. Vasquez, John A.: The War Puzzle Revisited. Cambridge 2009. Voigt, Rüdiger (Hrsg.): Krieg – Instrument der Politik? Bewaffnete Konflikte im Übergang vom 20. zum 21. Jahrhundert. Baden-Baden 2002. Wegner, Bernd (Hrsg.): Wie Kriege enden. Wege zum Frieden von der Antike bis zur Gegenwart. Paderborn 2002. Wegner, Bernd (Hrsg.): Wie Kriege entstehen. Zum historischen Hintergrund von Staatenkonflikten. 2.Aufl. Paderborn 2003. Wolfrum, Edgar: Krieg und Frieden in der Neuzeit. Vom Westfälischen Frieden bis zum Zweiten Weltkrieg. Darmstadt 2003. Wulf, Herbert: Internationalisierung und Privatisierung von Krieg und Frieden. Baden-Baden 2005. Zürn, Michael: Regieren jenseits des Nationalstaates. Globalisierung und Denationalisierung als Chance. Frankfurt/Main 1998. Reinhard Meyers 304