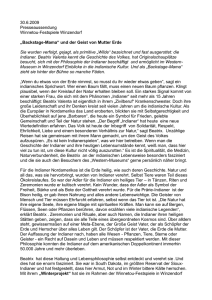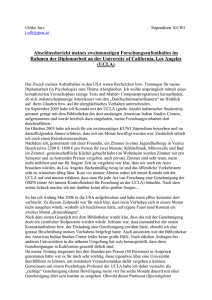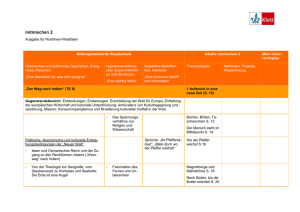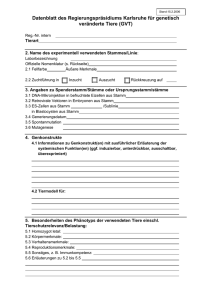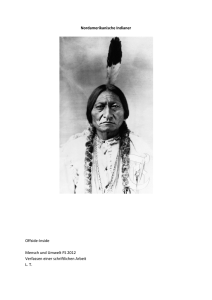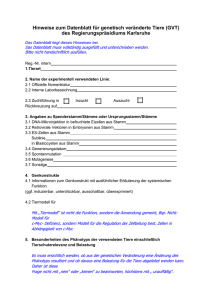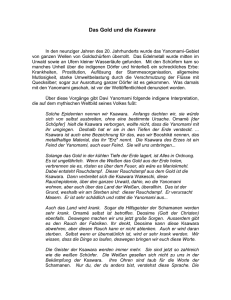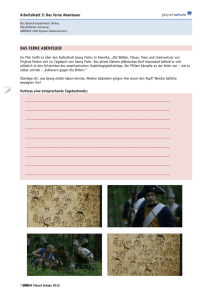Kapitel 14 - Forsthaus Droste
Werbung
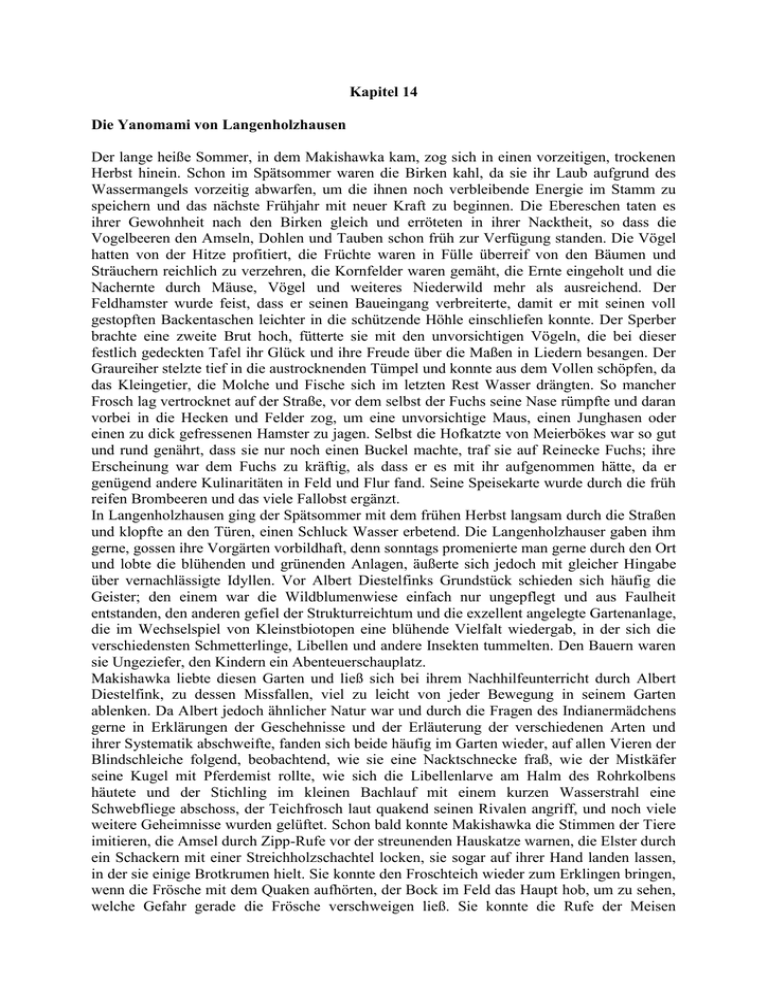
Kapitel 14 Die Yanomami von Langenholzhausen Der lange heiße Sommer, in dem Makishawka kam, zog sich in einen vorzeitigen, trockenen Herbst hinein. Schon im Spätsommer waren die Birken kahl, da sie ihr Laub aufgrund des Wassermangels vorzeitig abwarfen, um die ihnen noch verbleibende Energie im Stamm zu speichern und das nächste Frühjahr mit neuer Kraft zu beginnen. Die Ebereschen taten es ihrer Gewohnheit nach den Birken gleich und erröteten in ihrer Nacktheit, so dass die Vogelbeeren den Amseln, Dohlen und Tauben schon früh zur Verfügung standen. Die Vögel hatten von der Hitze profitiert, die Früchte waren in Fülle überreif von den Bäumen und Sträuchern reichlich zu verzehren, die Kornfelder waren gemäht, die Ernte eingeholt und die Nachernte durch Mäuse, Vögel und weiteres Niederwild mehr als ausreichend. Der Feldhamster wurde feist, dass er seinen Baueingang verbreiterte, damit er mit seinen voll gestopften Backentaschen leichter in die schützende Höhle einschliefen konnte. Der Sperber brachte eine zweite Brut hoch, fütterte sie mit den unvorsichtigen Vögeln, die bei dieser festlich gedeckten Tafel ihr Glück und ihre Freude über die Maßen in Liedern besangen. Der Graureiher stelzte tief in die austrocknenden Tümpel und konnte aus dem Vollen schöpfen, da das Kleingetier, die Molche und Fische sich im letzten Rest Wasser drängten. So mancher Frosch lag vertrocknet auf der Straße, vor dem selbst der Fuchs seine Nase rümpfte und daran vorbei in die Hecken und Felder zog, um eine unvorsichtige Maus, einen Junghasen oder einen zu dick gefressenen Hamster zu jagen. Selbst die Hofkatzte von Meierbökes war so gut und rund genährt, dass sie nur noch einen Buckel machte, traf sie auf Reinecke Fuchs; ihre Erscheinung war dem Fuchs zu kräftig, als dass er es mit ihr aufgenommen hätte, da er genügend andere Kulinaritäten in Feld und Flur fand. Seine Speisekarte wurde durch die früh reifen Brombeeren und das viele Fallobst ergänzt. In Langenholzhausen ging der Spätsommer mit dem frühen Herbst langsam durch die Straßen und klopfte an den Türen, einen Schluck Wasser erbetend. Die Langenholzhauser gaben ihm gerne, gossen ihre Vorgärten vorbildhaft, denn sonntags promenierte man gerne durch den Ort und lobte die blühenden und grünenden Anlagen, äußerte sich jedoch mit gleicher Hingabe über vernachlässigte Idyllen. Vor Albert Diestelfinks Grundstück schieden sich häufig die Geister; den einem war die Wildblumenwiese einfach nur ungepflegt und aus Faulheit entstanden, den anderen gefiel der Strukturreichtum und die exzellent angelegte Gartenanlage, die im Wechselspiel von Kleinstbiotopen eine blühende Vielfalt wiedergab, in der sich die verschiedensten Schmetterlinge, Libellen und andere Insekten tummelten. Den Bauern waren sie Ungeziefer, den Kindern ein Abenteuerschauplatz. Makishawka liebte diesen Garten und ließ sich bei ihrem Nachhilfeunterricht durch Albert Diestelfink, zu dessen Missfallen, viel zu leicht von jeder Bewegung in seinem Garten ablenken. Da Albert jedoch ähnlicher Natur war und durch die Fragen des Indianermädchens gerne in Erklärungen der Geschehnisse und der Erläuterung der verschiedenen Arten und ihrer Systematik abschweifte, fanden sich beide häufig im Garten wieder, auf allen Vieren der Blindschleiche folgend, beobachtend, wie sie eine Nacktschnecke fraß, wie der Mistkäfer seine Kugel mit Pferdemist rollte, wie sich die Libellenlarve am Halm des Rohrkolbens häutete und der Stichling im kleinen Bachlauf mit einem kurzen Wasserstrahl eine Schwebfliege abschoss, der Teichfrosch laut quakend seinen Rivalen angriff, und noch viele weitere Geheimnisse wurden gelüftet. Schon bald konnte Makishawka die Stimmen der Tiere imitieren, die Amsel durch Zipp-Rufe vor der streunenden Hauskatze warnen, die Elster durch ein Schackern mit einer Streichholzschachtel locken, sie sogar auf ihrer Hand landen lassen, in der sie einige Brotkrumen hielt. Sie konnte den Froschteich wieder zum Erklingen bringen, wenn die Frösche mit dem Quaken aufhörten, der Bock im Feld das Haupt hob, um zu sehen, welche Gefahr gerade die Frösche verschweigen ließ. Sie konnte die Rufe der Meisen imitieren, die verärgert über diesen Rivalen schimpfend bis vor ihre Füße flogen, sich aufblähten, die Flügel etwas hängend spreizten und sich umsahen, wo dieser fremde Eindringling sich versteckte. Makishawka liebte dieses Schauspiel und vertrieb sich die Zeit des Öfteren auf diese Weise in der Schule, die ihr sehr lästig war. Sie verstand nicht, dass man dieses unnütze Zeug lernen musste, dass niemandem half, sich in der Natur zurechtzufinden, etwas Essbares von dem Giftigen zu unterscheiden; sie verstand nicht, dass man so viel abstrakte Dinge lernen musste, wie den Dreisatz und die Mengenlehre, die selbst Eusebia Eulenbrink nicht mehr verstand, wozu man die Daten der Kriege Friedrich des Großen und die Lebensdaten eines Mozarts lernen sollte, wozu so langweilige Bücher lesen und Schillers Glocke herunterbeten können. Sie erfand einfach neue und abenteuerlichere Geschichten dazu, dachte sich einfach neue Worte aus, um einen wunderbaren Rhythmus fortzusetzen, zum großen Verdruss der Deutschlehrerin. Manchmal, wenn die Lehrerin nicht guckte, ließ sie sich vom Stuhl gleiten und sprang aus dem offenen Fenster, leise, lautlos, gewandt wie ein Jaguar, sprang in die Esche und glitt am Stamm hinunter. Manche Kinder glaubten, Makishawka hätte Zauberkräfte und könnte sich unsichtbar machen, manche Mädchen fürchteten sich vor ihr, auch einige Jungs, die meinten, sie wie andere Mädchen auch necken zu können, indem sie sie in den Haaren zogen oder schubsten. Makishawka hatte zuhause im Regenwald oft mit den jungen Kriegern gespielt und war schnell, wendig und kräftig. Der schlimmste Flegel, der Stiefsohn des Frisörs, Jochen Schnülte, kam einmal zu dieser bitteren Erkenntnis, als er das Indianermädchen mit viel Schwung schubste. Sie drehte sich blitzartig und griff den Arm Jochens, schleuderte ihn durch die Wucht der Beschleunigung an sich vorbei, so dass Jochen vor den Pfeiler am Vordach des Schulhofes stürzte; er musste mit einer schweren Gehirnerschütterung und einer blutenden Kopfplatzwunde bei Dr. Kober genäht werden und drei Tage mit Übelkeit und Erbrechen das Bett hüten. Danach ließ Jochen von Makishawka eine Zeit lang ab, versuchte dann später mit hinterhältigen Boshaftigkeiten, seine „Ehre“ zurück zu erlangen, was ihm nie gelang. Je gemeiner er wurde, desto härter viel die Antwort Makishawkas aus. Das ganze eskalierte, als Jochen Schnülte von einer Kreuzotter in seinem Ranzen in die Hand gebissen wurde. Es wurde offiziell nie bekannt, wie das Tier dort hinein kam. Jeder kannte die inoffizielle Antwort. Jochen Schnülte lag ein halbes Jahr krank im Bett, wurde bleich und schwach und kam nie wieder zu den Kräften, über die er einst verfügte; nur seine Bosheit steigerte sich; er suchte sich nun andere, schwächere, nicht so wehrhafte Kinder und kam schnell zu dem Ruf des gemeinsten und hinterhältigsten Prüglers an der Schule. Nur Makishawka ging er aus dem Weg; wenn er sie sah, bekam er Kopfschmerzen, sein rechter Arm fing an zu schmerzen, so dass er ihr nicht ein mal einen Stein nachwerfen konnte. Das Erscheinen Makishawkas führte bei den langenholzhauser Kindern dazu, dass die Mädchen beim Cowboy und Indianer spielen alle Indianer sein wollten. Das Reiten und die Pferdepflege bekamen einen nie da gewesenen Zulauf. Die Indianerstämme wurden so mächtig, dass die Cowboys schon bald „konvertierten“ und in den zwei großen Stämmen aufgingen. Die Feindseligkeiten fanden nur noch unter den Stämmen statt, bis das Kriegsbeil begraben wurde und die Kinder den ersten Yanomami-Stamm in Deutschland gründeten, mit Makishawka als Häuptlingin. Heinz Meierböke war der wichtigste Bauer und die wichtigste Anlaufstation für die Kinder, der seine Ponnyzucht ausweitete, da er zuverlässige Pflegerinnen und auch Pfleger fand, die sich aufopfernd auf dem Hof einsetzten. Auch seine Tochter Sabine und sein jüngster Sohn Stefan wurden zu einflussreichen und wichtigen Unterhäuptlingen im Stamm der Langenholzhauser Yanomami. Makishawkas Vater wäre stolz auf seine Tochter gewesen, die sich als ihrer Herkunft würdig erwies und die alten Stammestraditionen und Bräuche mit in das fremde Land genommen hatte, um auch hier eine Heimat zu schaffen. Sie träumte davon, eines Tages zurück in ihre Heimat zu gehen, mit einem mächtigen Stamm von Kriegern, um die schrecklichen, von Zerstörungswut beseelten, Menschen aus dem Regenwald zu treiben. Noch brauchten sie Makishawka nicht zu fürchten, umso mehr die langenholzhauser Waldarbeiter. Allen voran schimpfte der alte Haumeister Frido Frerichs über diesen neuen Indianerstamm, der die Wälder unsicher machte. Es kam zu einem ernsten Konflikt, als die Waldarbeiter zur Holzernte in den Habichtsberg zogen, um in die Eiche zu gehen, da der Eichenpreis und der Markt für EichenMassivholzmöbel gerade im Aufschwung waren. Dort oben hatte der große Stamm der Yanomami sein Hauptlager aufgeschlagen. Das Zentrum bildete eine alte, von innen hohle Eiche, die einen Durchmesser von knapp 1,7 m hatte. Diese alte Eiche stand auf einer kleinen Wiese frei und musste vor ca. 800 Jahren vom langenholzhauser Müller gepflanzt worden sein, der damals eine Tochter der Hildebrandts geheiratet hatte. Von den 12 Eichen, die laut gräflichem Forstordnungsedikts bei Hochzeiten zu pflanzen waren, blieb nur noch die alte Müllereiche erhalten. Die anderen Bäume sind den Jahrhunderten zum Opfer gefallen. Als die Waldarbeiter in den Eichenkamp zogen, um die besten Eichen herauszuschlagen, stießen sie auf Widerstand der Indianer. Wenn die Waldarbeiter mit ihren schweren Motorsägen in den Wald kamen, wurden sie ein mal durch eine auf sie zu galoppierende Horde bunt bemalter und reich befederter Indianer zum fluchtartigen verlassen des Waldweges genötigt, wobei die Thermosflasche Fridos zerbrach und er einen Tag ohne Tee im Schlag zubringen musste, was ihn sehr verärgerte. Ein anderes Mal hatten die Kinder die Farbe von den Bäumen geschrubbt, die Förster Zernikow angebracht hatte, um die zu fällenden Bäume zu markieren. Das missfiel dann auch diesem, obwohl Hermann Zernikow größtes Verständnis für die Kinder aufbrachte und sie in seiner Revierförsterei gewähren ließ. Er handelte mit den Häuptlingen die Wege aus, die sie bereiten durften und konnte sich mit ihnen auch auf die Wildeinstandsgebiete einigen, die nicht beunruhigt werden sollten; das waren dann die heiligen Haine, die von den Indianern besonders geehrt und gemieden wurden, da dort die Geister der Toten umhergingen und, hätte man diesen Waldteil betreten, einige Widergänger erweckt worden wären. Nun gingen die Indianer jedoch zu weit. Als sich die Waldarbeiter beschwerten und Förster Zernikow in die Abteilung zurück musste, um den Bestand ein zweites Mal auszuzeichnen, wurden sofortige Verhandlungen eingeleitet. Hermann Zernikow mochte die Kinder und erfreute sich ihrem Naturinteresse; er sagte, „nur wer die Natur versteht, versteht auch zu leben, nur wer die Natur kennt, der kennt auch das wahre Leben, nur aus solchen können anständige Menschen werden.“ Die Stadtmenschen verachtete er. Zu oft hatte er sich verlaufene Städter, die Urlaub im schönen Kalletal machten, in seinem Käfer aus den entferntesten Waldteilen und aus verwachsenen Wildeinstandsgebieten wieder herausfahren müssen. Wurde ihm dabei solch ein Stadtmensch zu pampig, setzte er ihn auch mal am Waldrand zu einem Nachbardorf aus und erklärte diesem den Weg durch den Erlengrund, der im Sommer von Massen an Bremsen und Pferdefliegen bevölkert war. Diese Fremden wurden meist kein zweites Mal im Kalletal gesehen. Der Förster bezeichnete es als Heimatschutz, eine Bezeichnung, die nach dem Kriege eher als entartetes Wort aus dem allgemeinen Sprachgebrauch gestrichen war; aber da Hermann Zernikow erfolgreich entnazifiziert war, kümmerte ihn diese Unart des neuen deutschen Sprachtums nicht sonderlich, gerade wenn es um Begriffe wie Heimat und Vaterlandsliebe ging, die eine Naturverbundenheit und eine Kenntnis dieser voraussetzten. Die Verhandlungen mit den Indianern verliefen erfolgreich. Das Areal um die alte Müllereiche wurde unter Schutz gestellt und die Holzernte auf den Baubestand darum begrenzt. Förster Zernikow hatte noch andere gute Eichenabteilungen in seinem Revier, auf die er zurückgreifen konnte. Zum Zeichen des Friedens wurde mit den Waldarbeitern eine Friedenspfeife geraucht, die Frido Frerichs geschnitzt hatte. Frido kam ursprünglich aus Ostfriesland. Da sein Hof dort nach dem Krieg in Flammen aufging, verkaufte er in seiner Not das übrige Land und baute sich ein kleines Häuschen in Langenholzhausen davon, um Abstand zum Grauen des Krieges zu gewinnen. Er hatte zu viel verloren, jedoch nicht seinen friesischen Humor, für den er bekannt war und von den Kollegen geschätzt wurde. Frido brachte nun diese Friedenspfeife mit, stopfte sie mit Tabak, rauchte einen guten Zug auf Lunge, zeigte den Indianern, wie das nach gutem Indianerbrauch zu geschehen hatte und reichte die Pfeife weiter, wobei er sie am Kopf fasste und von den Kindern unbemerkt ein kleines Knäuel Pferdehaar hinein drückte. Er verbrannte sich zwar den Finger dabei, aber das war es ihm wert. Am nächsten Tag fehlten die Kinder vom Yanomamistamm in der Schule, aufgrund einer plötzlichen, starken Diarrhö. Frido erkundigte sich später bei Albert Diestelfink über die Reaktionen bei den Kindern, bei denen das Symptom zuerst in der Schule einsetzte und lachte innerlich in sich hinein. Die Waldarbeiter hatten am nächsten Tag ihren Spaß, den ausschmückenden Worten ihres Haumeisters zu folgen. Als die Indianer von dieser Hinterlist erfuhren, holten sie zum Gegenschlag aus. Sabine Meierböke fragte ihren Vater, was sie machen könnten, wenn eines ihrer Pferde Verstopfung hätte. Heinz Meierböke sagte, dass er im Stall im Medizinspint, ein gutes Mittel habe und wollte wissen, um welches Pferd es sich handelte. Sabine sagte, dass es sich um die Stute von Hildebrandts handelte, worauf ihr Vater meinte, dass sie selber sicherlich wüssten, was zu tun wäre und dass sie das dem Bauern selbst überlassen sollte. Sabine Meierböke hatte ihre Information erhalten und bediente sich einer ausreichenden Menge, die dem ausgewachsenen Pferde bei einer massiven Verstopfung helfen würde. Die Indianer hielten Kriegsrat und verständigten sich darauf, die besten Anschleicher zu diesem Gegenschlag auszusenden. Sie machten den Waldarbeiter-Bauwagen ausfindig und schlichen, als die Motorsägen heulten und die Bäume fielen in den Wagen, öffneten die Thermosflasche von Frido Frerichs und die seiner Mitstreiter und gossen in jede einen guten Schluck des Pferdeabführmittels ein; dann zogen sie sich mit den anderen Indianern des Stamms auf einen Beobachtungspunkt zurück und warteten die Pause ab. Nach der Mittagspause hörten sie die Sägen wieder brüllen und der erste Baum fiel auch schon. Nach einer halben Stunde wurden die Indianer unruhig, da sich keine Reaktion als Folge ihres Anschlags zeigte. Dann schien jedoch die Unruhe auf die Waldarbeiter zu überspringen. Einer nach dem anderen warf die Säge weg, rannte hinter den nächsten Busch und riss sich die Schnittschutzhose herunter. Einige Indianer hatten einen guten Platz und eine gute Sicht. Sie mussten später im Indianerlager auf dem Heuboden bei Meierbökes ihre Beobachtungen immer wieder schildern, was für größtes Gelächter unter ihnen gesorgt hatte. Ihr Lachen und ihr ausgelassenes Feiern wurden durch die milde Sommerluft noch weit hinaus getragen. Die vorbei fließende Kalle nahm es mit sich und flüsterte diese Anekdote noch im Nachbarort Kalldorf beim Durchfließen, so dass dieses Gerücht vom Gegenschlag der langenholzhauser Yanomami auch noch später, an den langen Winterabenden im Dorfkrug für Erheiterung sorgte; jedes Mal, wenn Frido Frerichs von seinem Schelmenstreich erzählte, kam früher oder später auch die Geschichte von den Waldarbeitern mit den fliegenden Motorsägen und den heruntergerissenen Schnittschutzhosen auf den Tisch, was Frido die Erzähllust schnell verdarb. Mit den Indianern musste man vorsichtig sein, und das wurde schnell in Langenholzhausen bekannt, und das weiß man auch noch bis zum heutigen Tag dort.