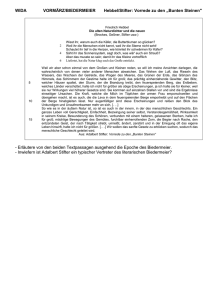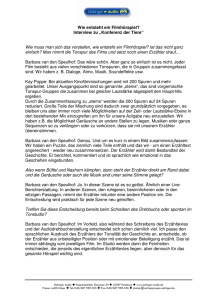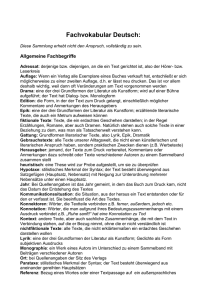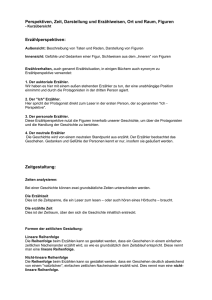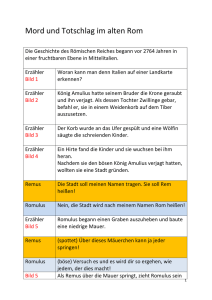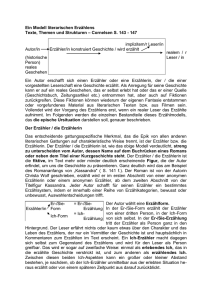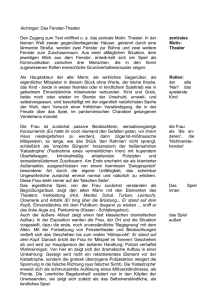1 Adalbert Stifter: Der Kondor Man hat dem 19. Jahrhundert vieles
Werbung

Adalbert Stifter: Der Kondor Man hat dem 19. Jahrhundert vieles nachgesagt: Es atme den Staub aus Bibliotheken, es sei nostalgisch und verkitscht, baue die ‚Klassiker‘ zu Bronze- und Marmorskulpturen auf oder miefe vor lauter Historismus. Dabei gibt es das schlechthinnige 19. Jahrhundert überhaupt nicht. Oder es ist anders – und sogar länger als man denkt: Die Historiker fassen es nicht von 1800 bis 1900, sondern siedeln es zwischen zwei Großereignissen an – 1789, dem Beginn der Französischen Revolution, und 1918, dem Ende des Ersten Weltkriegs, und nennen es das ‚lange 19. Jahrhundert‘. Nicht nur finden dort eine Reihe einschneidender sozialer und politischer Veränderungen statt, auch sind sehr unterschiedliche ästhetische Orientierungen zu erkennen. Novalis behauptete bereits 1800: „Wir sind aus der Zeit der allgemein geltenden Formen heraus“ (Fragment Nr. 2167). Damit eine Entwicklung vorweggenommen, die von der Romantik über das Biedermeier, den Vormärz, Realismus, Naturalismus, Symbolismus und Expressionismus sehr unterschiedliche Stile, Formen und ‚Ismen‘ hervorbringen wird. Regelpoetiken werden endgültig verabschiedet – man könnte vielmehr von Ästhetiken sprechen, durchaus im Plural. Stichworte zur Sozialgeschichte: Folie 9 Zum Autor: Adalbert Stifter wurde 1805 in (Böhmen) geboren und starb 1868 in Linz Nach Beginn eines Jurastudiums in Wien 1826 acht Studienjahre: humanistische, naturwissenschaft. und künstler. Fächer Betätigung als Maler Zunächst möchte Stifter Landschaftsmaler werden und verdient sich seinen Lebensunterhalt damit, adeligen Sprößlingen Privatunterricht zu erteilen (pikanterweise auch dem Sohn des reaktionären Fürsten Metternich). Zunehmend beschäftigt er sich damit, Erzählungen zu schreiben, so auch den Kondor, der aus Skizzen um 1834 hervorgegangen ist. Dass Stifter gesellschaftliches Denken fremd gewesen wäre, kann man jedoch nicht sagen. In der Zeit vor 1848 gilt er als Liberaler. Er strebt danach, Bildung öffentlich zugänglich zu machen, auch z.B. dadurch, dass Frauen an der Wiener Universität zum Studium zugelassen werden sollten (insbesondere: 1847 zu seinen eigenen Vorlesungen). Stifter setzt sich dafür ein, soziale Differenzen auszugleichen, er ist auch publizistisch tätig und gilt insgesamt als Verfechter der neuen, revolutionären Impulse von 1848. In diesem Jahr wird er auch zum Vertreter in der Frankfurter Nationalversammlung gewählt, 1849 ernennt man ihn zum Schulrat bzw. Inspektor der oberösterreichischen Volksschulen auf Zeit und verbeamtet ihn in dieser Stellung 1853, die er in Linz wahrnimmt, wo er 1868 stirbt. So interessant Stifters Werdegang ist – wichtig ist für uns aber vor allem das Exemplarische: Es ist ein möglicher, vielleicht typischer Lebenslauf eines Autors des 19. Jhs., der einiges über die Entstehungsbedingungen von Literatur zeigt. Es ist konsequent, dass Stifter seine ersten Prosatexte als Studien bezeichnet, zu deren Kreis auch Der Condor zählt. Diese Erzählungen verstehen sich als experimentelle Entwürfe und vereinen die wissenschaftlichen und die bildkünstlerischen Interessen Stifters. Es handelt sich um Skizzen einer Welt, die in Wahrnehmungsimpressionen erfasst wird. Diese sollen in der erzählerischen Ordnung ihre Rahmung bekommen. Handlung/Diegese: raumzeitliche Welt der Erzählung Die Handlung ist schnell erzählt: zwei Hauptfiguren 5 Abteilungen, malerisch benannt 2 1. Ein Nachtstück: Ein junger Mann schaut von einer städtischen Dachstube aus in die Juninacht, was er bis zum Anbruch des Morgens tut. Er sieht dann wie angekündigt einen Heißluftballon aufsteigen, dessen Erkundungsfahrt in die Troposphäre geschildert wird. 2. Tagstück: Die männliche Besatzung wird begleitet von einer wissenschaftlich ambitionierten jungen Frau namens Cornelia, der auf zeittypische Art die Sinne schwinden – und das zwingt die Expedition zum Abbruch. 3. Blumenstück: Die dritte Szene bringt wenig später Gustav und Cornelia zusammen: Er fungiert als ihr Kunstlehrer, man malt zusammen, er ist verärgert über den weiblichen Ehrgeiz, sie bereut ihr Wagnis, es kommt zur Berührung. Mehr aber nicht: Gustav schreckt zurück und tritt auf der Stelle eine weite Reise an. 4. Fruchtstück: Das Schlusskapitel, das mehrere Jahre später datiert ist, hat zwei Lösungsäste: Die Trennung ist dauerhaft, Gustav, der als Maler bekannt geworden ist, stellt in der Kunsthauptstadt Paris aus, hält sich aber in den amerikanischen Kordilleren auf. Von Cornelia erfährt man, dass sie zu den bekanntesten Salondamen in Paris gehört und die „gefeiertste Schönheit“ sei, mehr noch, „die Schönheit, welche tausend Herzen entzündete und mit Tausenden spielte“ (30). Die Ausdehnung der erzählten Zeit ist insgesamt überschaubar, doch ist der Bruch auch durch den zeitlichen Abstand von den ersten drei zur vierten Szene deutlich Das Verhältnis von erzählter und Erzählzeit ist in den Kapiteln unterschiedlich, d.h. mehr oder weniger raffend. In den kurzen Dialogteilen ist es annähernd zeitdeckend. 5. Anmerkungen zu dem Condor Zeit Verhältnis Erzählzeit – erzählte Zeit, hier: brüchig, Schnitt zwischen ersten drei Kapiteln und dem vierten Mehr oder weniger raffend, in kurzen Dialogteilen annähernd zeitdeckend, auch in atmosphärischen Schilderungen Langsames Tempo Etwas mühsam Rückwendungn, um Zeit zu überbrücken: „Ich weiß nicht, wieviel Zeit seit der Luftfahrt vergangen war“ (17); „Manches Jahr war seit dem obigen verflossen“ (27) Räume, die in der Narration aufgebaut werden: Gegensätzen von klein und groß, geschlossen und offen, schrumpfend und expandierend dargestellt. Eine weitere Opposition ergibt sich durch die Blickrichtungen von oben und von unten. Die Dachstube ist ein gesicherter Sehstandpunkt – und bildet damit einen Topos in der Erzählliteratur des 19. Jhs.; von dort aus werden Blicke herunter in die Stadt, aber vor allem hinauf in den Himmel geworfen (ein vermittelnder Raum). Der Blick öffnet sich mit der Ballonfahrt in die Vertikale, also in die Troposphäre hinein, und horizontal geht er drei Tagesreisen entfernt nieder. Dann wird der Raum wieder verkleinert auf die Wohnung Cornelias, und nach der Trennung zerstreuen sich die Wege, sie nehmen interkontinentale Ausmaße an: Paris ist der Lebens- und Ausstellungsort, und Gustav verschlägt es in die Kordilleren, jenem größten Faltengebirge der Welt, dass sich am Westrand Amerikas zwischen Alaska und Feuerland erstreckt (das Alexander von Humboldt bereiste). Perspektive: Interessanter noch ist die Frage, durch welche Blickwinkel diese Handlungzeiten und -räume vermittelt werden. Ein Kernproblem der erzählenden Gattung ist die Frage der Perspektive bzw. der Übermittlungswege von Handlung und Wissen, insofern sich daran gut zeigen lässt, dass Wahrheiten und Erkenntnisse durch die eingenommene Sichtweise bedingt sind. Typische Fragen, die man an Prosatexte richten sollte, sind: • Welche Instanz, welcher Sprecher übermittelt wem was auf welche Weise? 3 • Welche Wahrnehmungen und Werthaltungen des Erzählers werden deutlich? • Wer spricht? • Ist der Erzähler Teil der erzählten Welt oder an der Handlung beteiligt? • Warum dürfen Erzähler und Autor nicht vertauscht werden? Das erste Kapitel, das eine Juninacht umfasst, gehört Gustav als Erzähler, genauer: er vertraut seine Beobachtung einem Tagebuch an, jenem Medium von Innerlichkeit und Selbstbesinnung, das seit dem 18. Jahrhundert einen enormen Aufschwung genommen hat → Ich-Erzähler / interne Fokalisierung. Autodiegetischer Erzähler (Ich ist nicht nur Teil, sondern Hauptfigur der Diegese). Im zweiten Kapitel bestimmt ein auktorialer Erzähler die Sicht auf die Ereignisse, die sich unmittelbar an die Juninacht anschließen. Zunächst enthüllt er uns, dass er in das erste Kapitel die Tagebucheinträge Gustavs geschaltet habe – man nennt das Herausgeberfiktion. (Dies wird bereits im 18. Jahrhundert zu einer literarischen Standardsituation, vor allem in der Gattung des Briefromans: Der Autor schaltet einen selbst schon erdachten Herausgeber ein, der angeblich gefundene oder nachgelassene Papiere, Briefe o.Ä. ediert und mit Kommentaren versieht.) Der Erzähler lässt nun seine Blicke von der Nähe in die Ferne schweifen, von Gustav in der Dachstube weg zu einer ‚anderen Szene‘ (10), wo nämlich der Ballon aufsteigt. Wenn die Crew dies an einem verborgenen Ort tut, um „jeder unberufenen Beobachtung zu entgehen“ (11), so darf das Auge des Erzählers mit auf die Höhe von fast 5000 Metern steigen. Er fährt geradezu mit im Ballon und berichtet Details aus der Troposphäre. Und dennoch (oder gerade: deshalb) verhält sich der auktoriale Erzähler durchaus nicht immer souverän, sondern lässt sich von den Ereignissen mitreißen. Man erkennt dies an seiner Sprechweise, die eben von den Wahrnehmungen der Figuren geprägt wird – der Erzähler steht nicht nur über ihnen, sondern lässt sich in den entscheidenden Momenten von ihnen affizieren. Dass dieser Erzähler auch den Leser adressiert, indem er ihn mit einem ‚wir‘ einbezieht und an die Handlungsstationen erinnert (S. 13f), zeigt, dass er u.a. als Umschaltstation (Relais) fungiert. → Wechsel zwischen interner und externer Fokalisierung. Heterodiegetischer Erzähler. Das dritte Kapitel ist von einem Ich-Erzähler geprägt, der vielleicht eine Fortsetzung des auktorialen Erzählers ist, doch sind beide hinreichend unterschieden. Dieses Ich lässt den Zeitpunkt der Szene im Unklaren – jedenfalls spielt sie nicht zu weit entfernt von der Ballonfahrt ‚eines Morgens‘. Denn die Ereignisse scheinen noch frisch zu sein und wirkungsvoll, sie werden nun zwischen Gustav und Cornelia ausgehandelt oder besser: erlebt. Der Ich-Erzähler ist für die Figuren unmerklich anwesend und registriert nicht nur das, was die beiden sagen, sondern hat intensiven Anteil an ihren Gefühlsregungen. Mehr noch: Er nimmt Dinge wahr, die es empirisch nicht gibt (z.B. Funken zwischen den beiden während ihrer Umarmung). Zwischendurch streut er allgemeine Beobachtungen ein, um sich schließlich mit väterlichen Ratschlägen ihrer anzunehmen und sie wenigstens imaginär anzureden: „Ach, ihr Armen, kennt ihr denn die Herrlichkeit, und kennt ihr denn die Tücke des menschlichen Herzens? (27) Insgesamt tritt das erzählende Ich aber hinter den Dialogen und Empfindungen der Figuren zurück. → Wechsel zwischen interner und externer Fokalisierung. Heterodiegetischer Erzähler. Das vierte Kapitel wird von einem Ich-Erzähler fortgesetzt, der vielleicht mit dem vorherigen Ich-Erzähler identisch ist. Er muss dies allerdings nicht sein – denn dieses Ich ist nicht nur geisterhaft präsent, sondern nun ein sichtbarer Teil der Welt in Paris (→ homodiegetischer Erzähler). Der Faden zur Vergangenheit scheint gerissen, denn sogleich weist das Ich auf die Lückenhaftigkeit seines Wissens hin: Von den Jahren, „die seit dem obigen verflossen“, liege nichts Zuverlässiges vor (27). Ein „ganz kleines Bild“ sei aber noch zu geben. (Damit geht, nebenbei bemerkt, der Erzähler auf eine Darstellungsweise des 18. Jahrhunderts zurück, die vom kleinen Bild, vom Ereignis, von der Fabel oder anderen Miniaturen geprägt ist, auch 4 wenn aus einer Ansammlung dieser Kleinbilder große Romane geworden sind.) Dieses kleine Bild des Erzählers zeigt nebenbei seine Selbstbescheidung: Irgendwie gelingt ihm das Panorama nicht – er weiß eben nicht alles. Er ist aber vertraut genug mit Gustav, um sich Jahre später durch jene Mondbilder angezogen zu fühlen, die dieser in Paris ausgestellt hat – und ein Katalogeintrag bestätigt dann auch, dass es sich um Gustav handelt. Einfühlsam verhält sich dieser Ich-Erzähler dann vor allem Cornelia gegenüber: Allein er weiß, dass Cornelia nach der Bildbetrachtung „in ihrem verdunkelten Zimmer“ „hilflos siedende Tränen über ihre Wangen rollen lasse“ (30), und so viel Herzensströme rühren ihn zu erneut veränderter Sprechweise: So schreibt er von „Tränen, die ihr fast das lechzende Herz zerdrücken wollten; – aber es war vergebens, vergebens! Gelassen und kalt stand die Macht des Geschehenen vor ihrer Seele…“ (30). Man könnte hier von einem empfindsamen IchErzähler sprechen, der sich empathisch verhält. Und hier ist er dann wieder unsichtbarer Teil der erzählten Welt. Und fünftens schließlich die ‚Anmerkungen‘: Ein wissenschaftlicher Nachsatz nicht mehr des Erzählers, sondern des Autors (Text als Erläuterung des Textes: ‚Paratext‘). Warum nun teilt Stifter, der als Autor über allen Erzählinstanzen die Fäden zieht, die Blickwinkel der Szenen auf? Wir bemerken zunächst, dass die Perspektive dem jeweiligen Ereignis angepasst ist: Gustav könnte keine Details von der Ballonfahrt erfassen, auch nicht durch das Fernrohr, dafür muss der auktoriale Erzähler auftreten und zum fliegenden Auge werden. Und der Ich-Erzähler spielt im dritten Kapitel seine Rolle als Voyeur, der sich zu verbergen weiß und nahe am intimen Geschehen ist, äußerst überzeugend. Ein ähnlicher oder derselbe Erzähler kann dann auch den Schluss so diskret wie einfühlsam darstellen. Es bleibt eine Standardfrage, die an Erzähltexte überhaupt zu richten ist: Durch welchen Blickwinkel bekommen wir welche Aspekte der fiktiven Welt mitgeteilt? Welche Fokalisierung liegt vor? Es handelt sich hier um pendelnde Fokalisierungen, also wechselnde Blickpunkte. Mit dieser Aufsplitterung der Perspektive (Polyperspektive) wird eine grundlegende Erkenntnis dargestellt: Wahrheit ist nicht losgelöst, nicht absolut, sondern sie ist höchst relativ. Mit anderen Worten: Sie ist perspektivisch bedingt. Es gibt nicht mehr eine einzige, privilegierte Perspektive, mit der man sich im Besitz der Wahrheit wähnen kann, sondern erst die vielfältige Ansicht bietet eine Annäherung, und zwar an vorläufige Wahrheiten. Damit erfüllt Stifter auch ein Wissenschaftsideal: einen Gegenstand aus möglichst vielen Perspektiven zu untersuchen und zu schauen, welche Wahrheitsaspekte er enthält. Eine Sicht auf eine Oberfläche reicht nicht aus, erst die Kombination mehrerer Perspektiven gibt einen adäquaten Eindruck. Folie 3 – Wiederholung ‚Novelle‘ Folie 4-5 von Fortsetzungserzählung in der Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode zu Buchfassungen 1844/47 Folie 6-7 Folie 9: sozialgeschichtliche Umgebung Folie 10-13 Wissenschaft I: Optik Welche Anhaltspunkte lassen sich dafür geben, dass die Erzählung auch wissenschaftliche Vermittlungsarbeit leistet? Am Schluss stoßen wir auf etwas Merkwürdiges. In seinen Anmerkungen erläutert der Autor (nicht mehr also der Erzähler, sondern eine weitere Instanz), welche optischen Erscheinungen die Luftschiffer erleben, wenn sie die Erde von oben beschauen und sie von dort aus golden erscheint, wenn Sterne sichtbar werden und der Ballon im schwarzen Raum zu hängen scheint. Drei Gesetze des Sehens erläutert Stifter nun den Nichtphysikern unter seinen Lesern (S. 30): 1. Da das von der beleuchteten Erde allseitig in die Luft geworfene Licht blau reflektiert wird, so ist das hinausgehende (nach der Optik) das komplementäre 5 Orange, daher die Erde, von außen gesehen, golden erscheint wie die anderen Sterne. [„in einem goldenen Rauche lodernd“, S. 15] 2. Das Licht selbst ist nicht sichtbar, sondern nur die von ihm getroffenen Flächen, daher der gegenstandlose Raum schwarz ist. Das Licht ist nur auf den Welten, nicht zwischen denselben erkennbar. Wäre unsere Erde von keiner Luft umgeben, so stände die Sonne als scharfe Scheibe in völligem Schwarz. [die Sonne als „scharfgeschnittene Scheibe“, S. 15] 3. Daß wir am Tage keine Sterne sehen, rührt von dem Lichtglanze, den alle Objekte ins Auge senden; wo dieser abgehalten wird, wie z.B. in tiefen Brunnen, erscheinen uns auch die Sterne am Tag. [„wie zum Hohne wurden alle Sterne sichtbar“, S. 15] Es ist zweifellos eine sonderbare Geste, in einer Erzählung über physiologische Optik zu dozieren. Dies hat mit dem Selbstverständnis des Autors zu tun, der seine geologischen, biologischen oder physikalischen Studien hier in die Troposphäre hinein fortsetzt. Das bedeutet aber nicht, dass es um das reine Messen von Fakten geht, auch wenn die Ballonfahrer vor allem Daten sammeln wollen. Vielmehr gerät beim Erzählen die Sehwahrnehmung selbst in den Blick. Und damit zeigt Stifter, dass er auf der Höhe der Augenarztkunde bzw. der physiologischen Forschung seiner Zeit ist, denn was er behauptet, trifft durchaus zu. Zwei Grundsätze lassen sich aus den zeitgenössischen Erforschungen des Sehens zusammenfassen: • Die Farben bestimmen sich wechselseitig, sie können die Wahrnehmung täuschen; vielmehr ist Sehen ein vollständig relativer Prozess. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass, wie Stifter ganz richtig schreibt, das Blau ein Orange im Auge hervorruft. Man bezeichnet dies als Komplementärkontrast. • Sehen ist keine reproduktive Arbeit, sondern eine konstruktive Leistung: Im Sehprozess werden nicht einfach die Dinge der Welt abgebildet, sondern die Gegenstände mit hervorgebracht. Das ist zwar stark vereinfacht dargestellt. Grundsätzlich aber ist festzuhalten: Man ist um 1800 nicht nur am Auge als einem sezierbaren Organ, sondern als einem lebendigen, produktiven Wahrnehmungskörper interessiert. Dazu dient zum Beispiel folgendes Instrument: Es handelt sich um einen Augenspiegel, den Johan Purkinye entwarf und den Hermann von Helmholtz weiterentwickelte. Dieses Gerät ermöglicht die genaue Beobachtung des Augeninneren am lebendigen Organ, und zwar ohne operative Eingriffe. Inspiriert sind solche Forschungen zweifellos von Goethes Farbenlehre, die aus verstreuten Beobachtungen um 1800 entsteht. Wiederum sehr kurz ist zu sagen, dass es Goethe nicht um objektiv messbare Lichtimpulse geht – wie etwa vorher noch Newton, der Sonnenlicht durch ein Prisma in eine Dunkelkammer lenkte und es dort in ein Spektrum aufgliederte. All das seien nur Täuschungen, sagt Goethe. Und nun bastelt er selbst seine Instrumente, um mit Gläsern, Spiegeln, Röhren, Pappen und Farbtönen viele eigene Sehversuche zu unternehmen. 6 (Umschlagzeichnung Goethes zu seinen Beiträgen zur Optik (1791) Dabei gibt er vor allem darauf acht, was er selbst wahrnimmt – und schreibt dies auf, liefert also Wahrnehmungsprotokolle. Dieser Schwenk ist entscheidend für die ganze physiologische Forschung des 19. Jahrhunderts: Man erforscht die Leistungen des subjektiven Auges. Darunter fallen dann Beobachtungen von Kontrastwirkungen oder von Komplementärfarben: Das Rot fordert das Grün, und schaut man auf eine blaue Fläche, stellt sich eben, wie bei Stifter bemerkt, der Eindruck eines orangefarbenen (oder goldenen) Tones her. Solche Effekte haben die Maler interessiert – und umgekehrt haben die Physiologen ihr Wissen gerne der Kunst zur Verfügung gestellt. So schreibt Helmholtz einmal: „Wo einzelne Sonnenstrahlen, durch das grüne Laubdach eines Waldes dringend, den Boden treffen, erscheinen sie dem gegen das herrschende Grün ermüdeten Auge rosenroth gefärbt, und dem rothgelben Kerzenlicht gegenüber erscheint das durch eine Spalte einfallende weisse Tageslicht blau. So malt sie in der That auch der Maler, da die Farben seines Gemäldes nicht leuchtend genug sind, um ohne solche Nachhilfe den Contrast hervorzubringen.“ (II, 123) Diese Erkenntnisse, die die Malerei bis zum Impressionismus genutzt hat, haben nun auch Stifter als gelehrten Autor interessiert: Das Sehen mit seinen Effekten hat er aufgeschrieben und erzählerisch gestaltet. Besonders der weite Blick wird mit seinen Wirkungen folgenreich sein für Künste und Wissenschaften im 19. Jahrhundert. Die Literatur durchzieht er seit 1800 mit den unterschiedlichsten Wahrnehmungseffekten. Folie 14-23: Wissenschaft II Höhenerfahrung um 1800 – der aviatische Blick Man tut um 1800 vieles, um eine erhöhte Perspektive einnehmen zu können, steigt auf Türme oder gar auf Berge wie den Montblanc, man setzt sich dem Schwindel und dem Anflug des Erhabenen aus. Der Montblanc-Erstbesteiger Horace-Bénédict de Saussure schreibt in seiner Voyage dans les Alpes (1776), er wolle „die gebahnten Wege verlassen und Höhen ersteigen, von welchen das Auge eine Menge von Gegenständen mit einem Blick umschließen kann“, um in seinen Studien den Aufbau der Erde und die „Triebräder“, die den „Erdball in Bewegung setzen“, zu analysieren. Dass man den Überblick über das große Ganze haben will, die weite Raumschau, die umfassende Optik gewinnen möchte, ist für das 19. Jh. eine leitende Sehtechnik geworden: Man will die Welt aufzeichnen, sie kartografieren und aufteilen. Bereits im 18. Jh. passieren zwei entscheidende Dinge, die diesen Willen zum Sehen befördern: Die Erfindung des Panoramas und der erste bemannte Flug. Beides ist für Stifters Kondor sehr einflussreich geworden. Fliegen: Mit der Aeronautik wird dann ein alter Traum realisiert: Am 19. September 1783 steigt der erste Heißluftballon in die Höhe. Es waren die Gebrüder Montgolfier, die als Papierfabrikanten mit fliegenden Tüten experimentierten, deren Auftriebverhalten bei Wärmezufuhr beobachteten und verbesserten, bis daraus im Riesenmaßstab ein fliegender, tragfähiger Ballon gefertigt werden konnte. In diesem Pilotversuch mit einer Mannschaft aus Tieren besetzt, wird der erste bemannte Flug am 15. Oktober 1783 unter viel beachtetem Erfolg durchgeführt. Die Berichte der Aeronauten wurden schnell zur viel gelesenen Literatur, weil sie Nachricht von einer bislang nicht gekannten Vogelperspektive gaben. 7 Aufstieg des Wärmeballons am 19.9.1783 (anonymer zeitgenössischer Kupferstich) So heißt es in einer Notiz von Jacques-Alexandre César Charles, der am 1. Dezember 1783 in die Luft steigt: „Die Zeit war uns auf Erden lang [...] Nichts wird jemals dem Augenblick der Frömmigkeit zu vergleichen sein, die mein ganzes Wesen durchdrang, als ich empfand, daß ich der Erde entfloh; es war kein Vergnügen, es war Glückseligkeit. Den abscheulichen Qualen der Verfolgung und Verleumdung entgangen, empfand ich, daß ich alles beantwortete, indem ich mich über alles erhob. Diesem moralischen Gefühl folgte bald noch eine lebhaftere Empfindung: Die Bewunderung des majestätischen Schauspiels, welches sich uns zeigte; allenthalben, wohin wir nur unsere Blicke fallen ließen, waren nichts als Köpfe zu sehen; über uns sahen wir einen Himmel ohne Wolken und in der Entfernung den anmutigsten Anblick.“ Die Szenerie deutet nicht nur die Emphase des Höhenblicks, die Hingabe an das „Schauspiel des riesigen Horizonts“ und damit eine empfindungsreiche Wissenschaft an. Geschildert wird die Höhensicht vielmehr mit kunstgemäßen Begriffen. Charles beschreibt in Anspielung auf den Sonnenkönig oder andere Herrscher, in deren Reich die Sonne nie untergehen sollte, nun die Freude, sie zweimal an einem Tage untergehen zu sehen, verbunden mit optischen Effekten: „Ich betrachtete einen Augenblick den unermeßlichen Umkreis der Luft und die irdischen Dünste, die aus dem Schoße der Täler und aus den Flüssen aufstiegen. Die Wolken schienen aus der Erde zu kommen und sich mit Beibehaltung ihrer gewöhnlichen Gestalt übereinander zu häufen. Ihre Farbe war blaßgräulich und einförmig, welches eine natürliche Wirkung des wenigen in der Atmosphäre verbreiteten Lichtes war. Sie wurden allein vom Mond beleuchtet.“ Wiederum wird die Erscheinung vom Faktum getrennt: Die Lichtverhältnisse erzeugen den Eindruck von dynamischen Wolken, Farben werden als Helligkeitswirkung erklärt. Ähnliche Eindrücke werden auch von Höhenbergsteigern dieser Zeit berichtet (so Saussure auf dem Weg zum Montblanc). Die Ballonflüge machen die umfassende Sicht aus der Höhe zum Leitprinzip des Sehens; insbesondere in der Literatur zeigt sich nun in technischer Rückverstärkung, dass mit dieser Perspektive eine zentrale Sehtechnik zum Einsatz kommt. Das Ballonfliegen spornt aber auch die Einbildungskraft an. Das erkennt man etwa an Betrachtungen des Aufklärers Wieland, die unmittelbar nach diesen Ereignissen niedergeschrieben sind. Schauder ergreift die Phantasie: „Die Einbildungskraft selbst wagte es nicht, sich einen mit diesem Ballon aufsteigenden Menschen zu denken.“ Dieser Reiz wird für einige Autoren zu Literatur. So schreibt Jean Paul 1800 in einem Anhang zu seinem umfangreichen Bildungsroman Titan über den Luftschiffer Giannozzo, der mit einem Fernrohr auf die Erde blickt, und so gesehen erscheint das aus der Höhe betrachtete Erdengeschehen als „Welttheater“ (I/3 959). Landschaft wird dabei zum malerischen Arrangement von Farbflecken, wenn der Erzähler hier versucht, viele Detailansichten in langen Sätzen zu schildern, die mit Gedankenstrichen die Aspekte wiedergeben (I/3 959f) Jean Paul findet zu kühnen Vergleichsstrukturen: Landschaft beschreibt er dort als stürmendes Meer mit schwimmenden Bergen, und das erweiterte Sehen regt zu Neologismen oder Synästhesien wie „Schneenebel“ und „Lichtduft“ an (I/3 967). Und allgemein wirkt die Annäherung von heterogenen Dingen, die der große Blick zusammenbringt, geradezu stilbildend für sein Schreiben. Das technische Naturerlebnis lässt den Erzähler ins empfindsame Stammeln geraten, in das stoßweise Aneinanderreihen von Parataxen, die durch 8 Gedankenstriche voneinander getrennt sind. Giannozzos Luftschifferlebnis ist elektrisch aufgeladen, wenn immer wieder Blitze durch den Himmel zucken; das Nervensystem ist hineingespannt und ausgedehnt in die Natur. Darüber wird die Dichtung selbst zum Energiestrom, zum Gedankenstrom des Bewusstseins, sie sei, so Jean Paul, „der elektrische Kondensator der Philosophie, jene verdichtet erst das elektrische Spinngewebe [...] zu Blitzen, die erschüttern und heilen.“ (I/4 563) Folie 24-26 Wissenschaft III: Das Panorama Der Höhenblick korrespondiert nun einem weiteren Medium, das im 19. Jahrhundert populär werden sollte: dem Kunstpanorama. Es handelt sich dabei um große runde Holzhäuser bzw. Rotunden, die mit einem riesigen Umblick in der 360-Grad-Totalen Geschichts- oder Gegenwartslandschaften, Schlachten- oder sonstige Historienbilder boten. Panorama im Aufriss Innenansicht einer Panoramarotunde beim Bau Damit ermöglichten sie, dass ein breites Publikum auf virtuelle Art Fernreisen unternahm: Nicht nur in die Geschichte, sondern in Gegenwartslandschaften aus aller Welt, und dies gegen ein kleines Eintrittsgeld. 1787 erwarb der Schotte Robert Barker für das Panorama ein Patent – was zeigt, dass das Kunstmedium auch als technische Erfindung geschützt werden sollte. Er stellte es unter das Leitmotiv der nature à coup d’oeil – mit einem Blick sollte eine großformatige Landschaft erfasst werden können. Für den Luftschiffer Giannozzo ist nun der Fesselballon, wie er sagt, „meine Rotunde“ (I/3 960). Möglich wird es damit, schier unendlich viele Sinneseindrücke auf einmal zu gewinnen. Dass das Panorama den Nerv der Zeit traf, zeigt sich darin, dass es schnell seinen Triumphzug durch das bildungsbürgerliche Europa antrat. Das zeitgenössische Journal des Luxus und der Moden, spricht von „malerischen Zaubereyen“, die das neue, technische Kunstmedium verbreitet. In der Tat war das Panorama im 19. Jh. so populär wie das Kino heute, von dem es dann um 1900 verdrängt wurde. Stifter kann sich also bereits auf eine Tradition der Luftfahrt, eine technische sowie eine literarische, stützen. Die Draufsicht auf die Welt beim Flug mit dem ‚Kondor‘ soll wissenschaftlichen Zwecken dienen, und dies wird in großer Ausführlichkeit geschildert: „So schwebten sie höher und höher, immer mehr und mehr an Rundsicht gewinnend. Zwei Herzen, und vielleicht auch das dritte alte, pochten der Größe des Augenblicks entgegen. – Die Erhabenheit begann nun allgemach ihre Pergamente auseinanderzurollen – und der Begriff des Raumes fing an mit seiner Urgewalt zu wirken. Die Schiffenden stiegen eben einem Archipel von Wolken entgegen, die der Erde in demselben Augenblicke ihre Morgenrosen sandten, hier oben aber weiß schimmernde Eisländer waren, in den furchtbar blauen Bächen der Luft schwimmend und mit Schlünden und Spalten dem Schiffe 9 entgegenstarrend. Und wie sie näher kamen, regten und rührten sich die Eisländer als weiße, wallende Nebel. In diesem Augenblicke ging auf der Erde die Sonne auf, und diese Erde wurde wieder weithin sichtbar.“ (S. 12 f) Das Phänomen begegnete schon bei Jean Paul: Die Himmelserscheinungen treten als Meeresgebilde auf und zeigen damit ihre Beweglichkeit – oder sie sind Erdgestalte, Spalten und können damit bedrohlich werden und Schauder auslösen. Das kennzeichnet die Erfahrung des Erhabenen: Das Gefühl einer übermächtigen Natur, die das Individuum gnadenlos übertrifft. Was Kant in der Kritik der Urteilskraft das dynamisch Erhabene der Natur nennt, deren unendliche, unabsehbare Kräfte, die jeden bekannten Horizont überragen, taugt noch fünfzig Jahre später dazu, das Gefühl von Verzweiflung und Verlorenheit auszulösen. Das am Erdboden Verschwindende ist dann nur noch ein „kleines Fleckchen“, „das wir Heimat nennen“ (S. 13) – so aber nicht mehr fühlen. Und auch der Blick Cornelias zeigt die Erde nicht mehr als das „wohlbekannte Vaterhaus“ (S. 15), sondern als ein Unbekanntes. Es folgt eine Schilderung von optischen Ereignissen: „in einem fremden, goldnen Rauche lodernd, taumelte sie gleichsam zurück, an ihrer äußersten Stirn das Mittelmeer wie ein schmales, gleißendes Goldband tragend, überschwimmend in unbekannte, phantastische Massen. [...] Zu diesem Himmel floh nun ihr Blick – aber siehe, er war gar nicht mehr da: das ganze Himmelsgewölbe, die schöne blaue Glocke unserer Erde, war ein ganz schwarzer Abgrund geworden, ohne Maß und Grenze in die Tiefe gehend“. (S. 15) Auch hieran wird deutlich: Der neue Blick auf das Bekannte wird gesucht, er soll das Gewohnte in neuer Ansicht bieten. Wenn man von unten, von der Erde aus, Wölkchen sieht als „Silberschäfchen des Himmels“, erscheinen diese von oben als „dehnende und regende Leichentücher“ (S. 15). Idylle und Bedrohung stehen hier direkt nebeneinander – allein der Blickwinkel oder die Beleuchtung macht die Bewertung ein- und desselben Dinges aus. Sehen und Sprechen Der erhabene Schauder wird aber auch sprachlich ausgelöst. Die Nervenreize werden beträchtlich stimuliert. Sie wirken auch auf den Erzähler und lassen ihn eigenwillige Bilder hervorbringen – so ist vom entfernt auftauchenden Mittelmeer die Rede, das Cornelia wie ein Band um den Kopf drapiert scheint. Bemerkenswert ist auch die Häufung der Gedankenstriche. Sie verleihen den langen Sätzen einen eigenen Takt. Außerdem gibt es gerade an den Stellen, wo der Blick den Erzähler und die Figuren übermannt, eine auffällige Häufung an Alliterationen. Um nur einige zu nennen: die ‚blauen Bäche‘ der Luft, „schwimmend und mit Schlünden und Spalten dem Schiffe entgegenstarrend“, „weiße wallende Nebel“ oder Wolken „wie wimmelnde Wogen“. Ähnliches gilt für den Blick von unten in den Himmel. Für Gustav ist das in der Nacht auftauchende Luftschiff eine Sensation – ein Anlass zum Malen und zum Tagebuchschreiben. Nicht selten wechselt die souveräne Beobachtersprache mit einer Sprache des Protokolls, womit Wahrnehmungsdaten wiedergegeben werden. Dies gilt auch für die Sicht von unten nach oben, die Gustav einnimmt (S. 6): „So schön das alles war, so wurden doch die Stunden eine nach der anderen länger – die Schatten der Schornsteine hatten sich längst umgekehrt, die silberne Mondkugel rollte schon bergab auf der zweiten Hälfte ihres dunklen Bogens – es war die tödlichste Stille – nur ich und jenes Lämpchen wachten.“ Wiederum zertrennen drei Gedankenstriche den Satz in kleine Parataxen. Mehr noch: Sie bringen das Standbild in Bewegung, für das Bewusstsein kehren sich die Schatten um, die Mondkugel rollt. Ein Signal der Plötzlichkeit durchbricht Gustavs ruhiges, ‚einförmiges‘ Schauen: „Da auf einmal“ heißt es, was seit 1800 eine Formel der Überraschung darstellt und Aufmerksamkeit fordert: 10 „Da auf einmal, in einem lichten Gürtel des Himmels, den zwei lange Wolkenbänder zwischen sich ließen, war mir’s, als schwebe langsam eine dunkle Scheibe – ich griff rasch um das Fernrohr und schwang es gegen jene Stelle des Firmaments – Sterne, Wolken, Himmelsglanz flatterten durch das Objektiv – ich achtete ihrer nicht, sondern suchte angstvoll mit dem Glase, bis ich plötzlich eine große schwarze Kugel erfasste und festhielt. – Also ist es richtig, eine Voraussage trifft ein: gegen den zarten weißen Frühhimmel, so schwach rot erst wie eine Pfirsichblüte, zeichnete sich eine bedeutend große, dunkle Kugel, unmerklich emporschwebend – und unter ihr an unsichtbaren Fäden hängend, im Glase des Rohres zitternd und schwankend, klein wie ein Gedankenstrich am Himmel – das Schiffchen, ein gebogenes Kartenblatt, das drei Menschenleben trägt und sie noch vor dem Frührote herabschütteln kann, so naturgemäß wie aus der Wolke daneben ein Morgentropfen fällt.“ (14f) Folie 27 Immer wieder wird angstvoll-schaudernd, aber auch lustvoll zum Fernrohr gegriffen – es ist wohl eines der Lieblingsspielzeuge von Männern im 19. Jh. Grandville: Neugierige beim Opernbesuch (1843) Auch hier ist der künstlerische Blick technisch inspiriert, und wiederum sind die Satzlängen bemerkenswert: Sie übertreffen diejenigen in den anderen Textteilen bei weitem, eine Aneinanderreihung von Parataxen, die sich durch Gedankenstriche und Zusätze erweitern lässt. Offenbar werden dadurch auch Vergleichsstrukturen angeregt: Die Bezeichnung des Luftschiffs als „Gedankenstrich am Himmel“ zeigt dieses selbst als Kunstprodukt, das vieldeutig orakelt, als Hieroglyphe, die an das Firmament gepinselt ist. Ferner ist es ein „gebogenes Kartenblatt“, wiederum also ein Schriftträger oder Spielobjekt, und ein dritter Vergleich auf engstem Raum folgt: es könnte aus dem Luftschiff ein Pflanzenblatt werden, aus dem „naturgemäß wie aus der Wolke“ ein Morgentropfen fällt, so fragil wirkt das ganze für den Künstlerblick. Die Sicht von oben aus gleichsam olympischer Höhe wurde insgesamt zu einer Sehweise, die das 19. Jahrhundert und auch die Literatur tief geprägt hat. Es ließen sich zahllose Stellen aus romantischen, aber auch späteren Erzähltexten anführen, die die Perspektive in die Weite strecken, traumverloren, aber auch ehrgeizig, alles beherrschen und wissen wollend. Und dieser Blick geht auch vom ‚Kondor‘ herunter. Allerdings hat er auch, bei allem emsigen Bemühen der Wissenschaftler im Ballon, eine Kehrseite: nämlich den Schwindel, die Ohnmacht und die Resignation, die in diesem Fall in der Beschränkung endet. Geschlechterfragen/Frauenrolle: Dass Cornelia sich in die Lüfte schwingt, scheint für Zeitgenossen höchst erstaunlich, ja ungehörig. So erklärt der Erzähler einmal (S. 11) Cornelia über ihre römische Namensschwester zum Inbegriff des weiblichen Heldenmuts – als Befreiung von den „willkürlichen Grenzen, die der harte Mann seit Jahrtausenden um sie gezogen hatte“. Doch ist nicht klar, ob es sich vielleicht nur um Rollenprosa handelt – d.h. ob der Erzähler hier für ein paar Sekunden aus der Perspektive der Frau spricht. Oben in den Lüften ist nun auf einmal alles anderes, der Mut schwindet, das Bewusstsein auch, und diese Ohnmacht wird der Grund für das Scheitern des ganzen Projektes sein. Zwar befindet sich, was Schwindel und Ohnmacht angeht, Cornelia in bester Männergesellschaft. Das Motiv ist seit dem späteren 18. Jahrhundert geläufig für all jene Erfahrungen, die das wahrnehmende 11 Subjekt übertreffen: Die Sinne schwinden, sie schwinden den Italienreisenden, die von Bergeshöhen herunterschauen, sie schwinden den Figuren Kleists aus vielerlei Gründen, sie schwinden auch dem jungen Goethe. Der berichtet im Rückblick von Dichtung und Wahrheit, dass er 1770 in Straßburg, dem Zentrum des entstehenden Sturm und Drang, die Aussichtskanzel des Münsters erklommen habe – jedoch unter erheblichen Gewöhnungsproblemen bzw. psychomotorischen Schwierigkeiten. Ihn, den jungen, ungeübten Betrachter befällt beim neuen Sehen Höhenangst. Doch diese kann wegtrainiert werden – die kleinen Schocks werden erzählerisch kontrolliert, der Schauder wird dann in einen interessanten Reiz umgewandelt. Auf Geschlechterrollen verteilt lässt sich sagen, dass den schreibenden Männern die Höhensicht durch Gewöhnung und eben auch durch Aufschreiben gelingt, die Frauen hierin aber ungeübt bleiben. Cornelia bekommt keine zweite Chance: Sie hat versagt und muss allen zukünftigen Experimenten fernbleiben. Der alte Lord im Ballon hatte schon gemahnt: „Das Weib erträgt den Himmel nicht“ (16). Und im Rückblick wird Cornelia die Sprache des Mannes übernehmen und sagen: „ach, ich bin doch nur ein armes, schwaches Weib, wie schwach, wie arm selbst gegen jenen greisen, hinfälligen Mann – – sie erträgt den Himmel nicht! – –“ (S. 23). Und gesteht ein, dass sie sich „verblendet über mein Geschlecht erheben wollte“ (24). Besinnt sich Cornelia also dergestalt auf ihre Grenzen, so wird sie nun eine „aufgeblühte, volle Blume“ (25). Das wird als ein fassliches Ergebnis des ‚Blumenstücks‘, erzählt – und im Gegenzug reift der knabenhafte Gustav zum Mann. So kuschelig diese Klischees sind, so gesellschaftsfähig sind sie auch. Denn Gustav ist, als er Cornelia aufsucht zur Malstunde, sichtlich enttäuscht über ihren Versuch, den Lebens- und Erkenntniskreis zu erweitern. Reumütig zeigt sie sich wegen der Grenzüberschreitung – und fügt sich in das Bild, was aber bei Gustav nur kurz wirkt. Auch dies hat sich Stifter nicht ausgedacht, vielmehr schreibt er seine Figuren einer Rollentradition ein. Cornelia will womöglich Schiller gehorchen, der in der Glocke schrieb: „Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau / die Mutter der Kinder / und herrschet weise / im häuslichen Kreise / und lehret die Mädchen / und wehret den Knaben / und reget ohn‘ Ende / die fleißigen Hände / und mehret den Gewinn / mit äußerem Sinn.“ Folie 29: Hans Kaufmann: Illustration zu Schillers Glocke Darin sucht Cornelia das, was in der Epoche als geflügeltes Wort umgeht, nämlich das ‚Glück der Beschränkung‘, das immerhin für eine Salonkarriere reicht. Der Mann dagegen will sich im weiten Wirkungskreis entfalten. Und so betätigt sich Gustav als Fernreisender, als Bergsteiger und Forscher. Auch das findet sich bereits in Schillers Glocke formuliert: „Der Mann muß hinaus /ins feindliche Leben, / muß wirken und streben /und pflanzen und schaffen, / erlisten, erraffen, / muß wetten und wagen, / das Glück zu erjagen.“ Und so hält es Gustav: Er entspricht ganz dem entsagungsvollen, faustischen Typus, auch ist er Alexander von Humboldt nachempfunden, dem berühmtesten zeitgenössischen Südamerikafahrer. Jedenfalls wird er geschildert als „starker, verachtender Mensch“, der auszieht, „um dort neue Himmel für sein wallendes, schaffendes, dürstendes, schuldlos gebliebenes Herz zu suchen“ (30), eine Mischung aus Wissenschaftler und Künstler also. Zumindest hat er seine Karriere als Maler gemacht und es in die Salons geschafft. Ein wenig Emanzipation rettet aber Stifter wohl doch, wenn auch nur in der Kunst. Denn die von Gustav 12 ausgestellten Bilder zeigen nämlich eine, wie es heißt, Flusspartie „in einer schwülen, elektrischen, wolkigen Sommermondnacht“, das andere gibt eine große Stadt in der Draufsicht (30). Dieses könnte durchaus von Cornelia stammen, die anders als Gustav die Höhenansicht kennt. Was das sexuelle Geschlechterverhältnis angeht, wird eine Rollenübertretung offenbar als hinderlich wahrgenommen. Das heißt nicht, dass die Spannung fehlen würde, im Gegenteil. Gerade im Hindernis scheint sich eine schwüle, angedeutete Erotik zu entfalten. In der Atelierszene schauen Gustav und Cornelia sich an, ihre Augen werden metaphorisiert zu „Sonnen“, mehr noch: „diese demütigen Sonnen hafteten beide auf ihm und so weich, so liebreich wie nie – – hingegeben, hilflos, willenlos – sie sahen sich sprachlos an – die heiße Lohe des Gefühls wehte – das Herz war ohnmächtig – ein leises Ansichziehen – ein sanftes Folgen – und die Lippen schmolzen heiß zusammen, nur noch ein unbestimmter Laut der Stimme – und der seligste Augenblick zweier Menschenleben war gekommen und – vorüber.“ (23f) Für diesen Moment der – wahrscheinlich nur – Umarmung reicht hier nicht mehr ein Gedankenstrich, es müssen zwei her, insgesamt sind es zehn in diesem Satz, und ein paar Zeilen später springt ein Funke, dann ein Blitz – was die Kommunikation der Geschlechter seit der Romantik markiert. Auch das gehört zum Sensationellen der Novelle, aber die erotische Welt der Romane lässt sich damit genauso ausstaffieren: Der elektrische Funke fliegt bei den Physikern und Medizinern, er durchzuckt seit Galvani, seit 1780 erst die Frosch, dann die Menschenmuskeln. Von dieser Stromkommunikation hat Stifter wiederum gelernt, von E.T.A. Hoffmann genauso wie von Jean Paul. Folie 31: Ein aufgeladener Kondensator lässt Funken zwischen den Lippen sprühen (Radierung um 1800) Publikationsort: Erschienen ist der Text 1840 in der Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode, Untertitel: Tagsblatt für die gebildete Lesewelt, und zwar in getrennten Lieferungen der Hefte 53-57, worauf die einzelnen Kapitel und die Nachbemerkungen aufgeteilt waren. Es handelte sich hierbei um ein recht angesehenes Journal, das die Wiener Biedermeierkultur mit prägte und so unterschiedliche Dinge wie Reiseberichte, Mode- bzw. Kleiderentwürfe, Abbildungen zeitgenössischer Kunst, Musikkritiken und kleinere literarische Texte enthielt, gelegentlich durften auch Theaterkritiken erscheinen. Kurzum: Es handelte sich um einen Gemischtwarenladen für schöne Dinge, die aber auch von der Zensur der Metternichschen Behörden mit Argusaugen bewacht wurden. Man darf sich dieses Aufpasser- und Spitzelwesen als durchaus bedrohlich vorstellen – in solche Zeitschriften konnte nur gelangen, was unverdächtig war, also eben der reaktionären Politik seit den Wiener Kongressen als zumindest ungefährlich erschien. In dieser Mixtur, mit Abbildungen hübsch garniert, auch mit manchem lehrreichen Beitrag, wird das populäre Zeitschriftenwesen sich auch nach 1848 fortsetzen, zum Beispiel mit der Gartenlaube. Das ‚Format‘ des Kondors, wie wir heute modisch sagen, ist also im mehrlei Hinsicht vorgegeben: Der Text darf nicht aufrührerisch oder sensationell sein, er soll bequem zu goutieren sein, zugleich geht er auf das Sentiment. Und schließlich hält Stifter den wissenschaftlichen Passus am Schluss für die Bildungshungrigen parat – auch insofern ist das angehängte Stückchen durchaus passend. Für die Komposition gilt, dass sie klare Abteilungen braucht, die zugleich am jeweiligen Ende die Spannung auf die Fortsetzung hält. Die Kapitelbezeichnungen entsprechen der Formatvorgabe: ‚Nachtstück‘, ‚Tagstück‘, ‚Blumenstück‘ und Fruchtstück‘ – das sind Genrebezeichnungen der Malerei, und solche Kombinationen von Bild und Text finden sich seit der Romantik in der Literatur wie auch in Kalendern und Almanachen, die zu dieser Zeit eine große Konjunktur entwickeln, zuhauf. Nachtstücke finden sich bei E.T.A. 13 Hoffmann, Blumen-, Frucht- und Dornenstücke in Jean Pauls Roman Siebenkäs. Der Kondor ist also eine Erzählung in Fortsetzungen, sie hat aber auch Merkmale der Novelle. Gattung/Novellistik: Der Begriff der Novelle stammt aus dem Italienischen, wo ‚novella‘ soviel wie ‚Neuigkeit‘ bedeutet. Und aus dem italienischen Sprachraum stammt die Gattung auch – mit Boccaccios Decamerone hat sie im 14. Jahrhundert ein viel zitiertes Vorbild. Als Literaturgattung verbreitet sie sich dort, wo sie sich mit dem Postwesen verbindet. Postkutschen, die seit 1500 durch Westeuropa rollen, befördern Menschen, Güter und – Nachrichten. Diese werden wiederum an Poststationen, den Relais, gesammelt, auf Blätter gedruckt und im weiteren zu kleinen Zeitungen gebündelt. Hieraus entstehen erste Periodika, seit dem 17. Jahrhundert Wochenschriften, dann moralische Wochenschriften. Erzählerisch ausgestaltet kann daraus Literatur werden, und zwar an einem Punkt, wo sich zwei Leserwünsche kreuzen: zum einen das Interesse an den vorgefallen, geschehenen Dingen, also Faktischen Ereignissen. Zum anderen der Wunsch, Sensationelles, Reizvolles, Interessantes oder Nervenaufreibendes zu lesen. Beides ist im späten 18. Jahrhundert der Fall, und beide grundlegenden Tendenzen der Novelle hat Goethe 1827 in einem Gespräch mit seinem Sekretär Eckermann zusammengefasst: Die Novelle schildere eine „sich ereignete unerhörte Begebenheit“ (SW 39, 221). Dies wird die Novelle das 19. Jahrhundert hindurch bestimmen: Meistens haben wir einen Erzähler, der das Authentische seiner Geschichte reklamiert oder versucht, dies durch Zeitbelege, Ortsangaben oder sonstige Hinweise zu beglaubigen. Dies stimmt beileibe nicht immer, aber jedenfalls wird der Anspruch aufrechterhalten. Andererseits nennt Goethe das Unerhörte, das noch nicht Gehörte, das Neue und auch Sensationelle, was etliche Autoren dazu gebracht hat, die Darstellungsweisen zu verfeinern, um damit die Nervenreize zu stimulieren. Diese Tradition ist Stifter bestens bekannt, und er wirkt seinerseits in sie hinein, indem er gesellschaftlich-zeitgenössische Themen erzählerisch einkleidet. Dass Stifter nun seinen Kondor in einer Zeitschrift veröffentlicht, erinnert noch einmal an die journalistische Tradition der Novelle. Die Gattungsgrenzen sind allerdings nicht mehr normativ gezogen. Der bloße Textumfang unterscheidet die Novelle vom größeren Roman, der auch mehrere Handlungsebenen entfalten kann, während die Novelle eine oder zwei Hauptfiguren besitzt und deren Entwicklung in den Blick nimmt. (Die Kurzgeschichte, die als Gattung in Deutschland ja erst im 20. Jh. etabliert wird, ist wiederum auf einen kurzen Zeitraum beschränkt und bleibt in der Figurendarstellung bewusst oberflächlich.) Verunsicherungen des Lebens/die Ordnung der Erzählung Zweifellos handelt es sich auch um einen Versuch, für eine fragil gewordene Welt einen Zusammenhang zu suchen, ja die Welt im Wortsinn erzählerisch ‚auf die Reihe zu bringen‘. Mindestens zwei Krisenherde werden mit der Novelle offenkundig. Mit der Aeronautik und der Sicht auf die Erde von oben vollzieht Stifter noch einmal nach, dass religiöse Gewissheiten unsicher geworden sind. Hatte Kopernikus bereits im 16. Jahrhundert die zentrale Stellung der Erde im Weltall durch das heliozentrische Sonnensystem ersetzt, so zögerte die katholische Kirche aber bis 1822, diese Wende zu akzeptieren und zu autorisieren. Als sie dies tat, löste das bei Stifter nachhaltige religiöse Verlusterfahrungen aus. Und noch etwas deutet sich bei Stifter an: Die erste Hochphase der Industrialisierung ist vollzogen. Nur einmal wird dies angemerkt, aber bereits mit kritischen Untertönen: „Unten in den Gassen lärmte bereits die Industrie einer großen Hauptstadt, sorgend für den heutigen Hunger und für die heutige Üppigkeit“ (10) Mehr erfahren wir zwar nicht, aber diesen Hinweis gibt Stifter immerhin. Und damit sei noch einmal gezeigt, dass Literatur nicht in einsamen Dachstuben durch Musen geflüstert wird, sondern dass sie welthaltig ist, dass sie von gesellschaftlichen Vorstellungen durchzogen ist, dass sie diese aber auch formen, pointieren und zur Diskussion stellen kann. Das sozialpolitische Thema werden andere aufbauen: Die Autoren des Vormärz, die eher journalistisch orientiert sind, viel später dann 14 die Naturalisten, noch später die Expressionisten mit ihrer Großstadtklage. Stifter jedoch dient das Erzählen als Medium, um eine ganzheitlich-christliche Perspektive zu bewahren und Natur, Subjekt und Gesellschaft als versöhnt zu denken. Darin nimmt er die Haltung der verwandten poetischen Realisten an. Folie 33 Fontane etwa hat die Variante gewählt, einen humoristischen und milden Glanz über die Dinge zu breiten – und bezeichnete diesen Realismus als „schöne Verklärung des Wirklichen“. Ob Stifters Versuch einer Versöhnung gelingt oder nicht, ist allerdings strittig – das Ende bleibt ja auch skeptisch und lässt die Erfolgsgeschichte brüchig erscheinen. Der Kondor lässt sich damit insgesamt als Knotenpunkt zentraler Entwicklungen von Literatur, Wissenschaft und Leben im 19. Jahrhundert lesen.