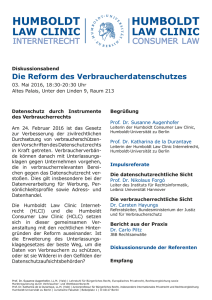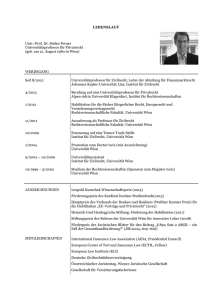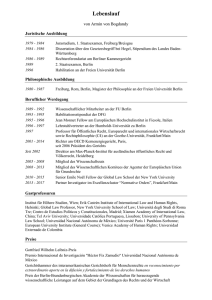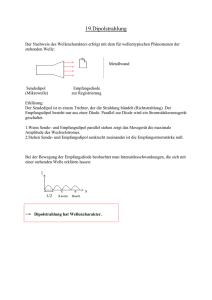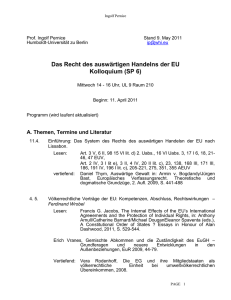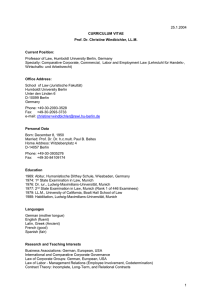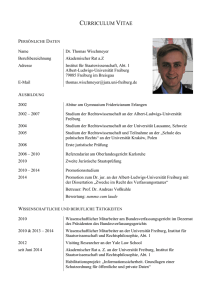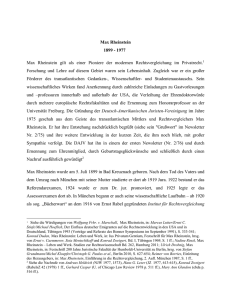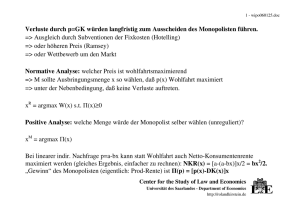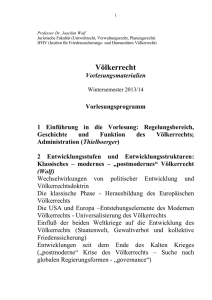Document
Werbung
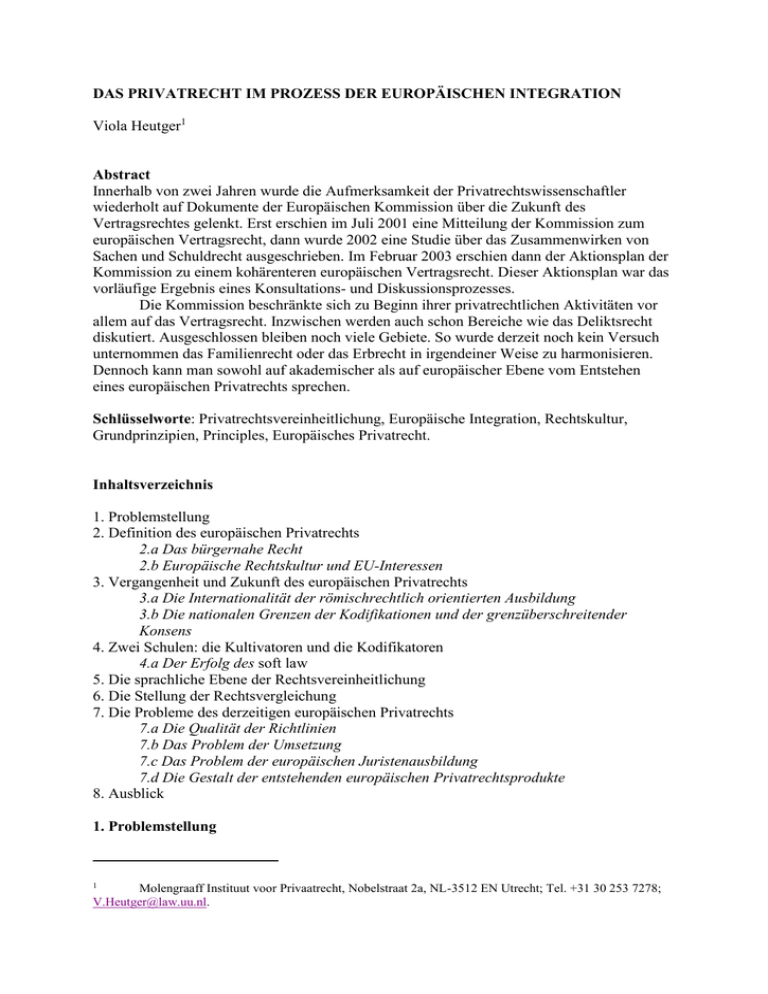
DAS PRIVATRECHT IM PROZESS DER EUROPÄISCHEN INTEGRATION Viola Heutger1 Abstract Innerhalb von zwei Jahren wurde die Aufmerksamkeit der Privatrechtswissenschaftler wiederholt auf Dokumente der Europäischen Kommission über die Zukunft des Vertragsrechtes gelenkt. Erst erschien im Juli 2001 eine Mitteilung der Kommission zum europäischen Vertragsrecht, dann wurde 2002 eine Studie über das Zusammenwirken von Sachen und Schuldrecht ausgeschrieben. Im Februar 2003 erschien dann der Aktionsplan der Kommission zu einem kohärenteren europäischen Vertragsrecht. Dieser Aktionsplan war das vorläufige Ergebnis eines Konsultations- und Diskussionsprozesses. Die Kommission beschränkte sich zu Beginn ihrer privatrechtlichen Aktivitäten vor allem auf das Vertragsrecht. Inzwischen werden auch schon Bereiche wie das Deliktsrecht diskutiert. Ausgeschlossen bleiben noch viele Gebiete. So wurde derzeit noch kein Versuch unternommen das Familienrecht oder das Erbrecht in irgendeiner Weise zu harmonisieren. Dennoch kann man sowohl auf akademischer als auf europäischer Ebene vom Entstehen eines europäischen Privatrechts sprechen. Schlüsselworte: Privatrechtsvereinheitlichung, Europäische Integration, Rechtskultur, Grundprinzipien, Principles, Europäisches Privatrecht. Inhaltsverzeichnis 1. Problemstellung 2. Definition des europäischen Privatrechts 2.a Das bürgernahe Recht 2.b Europäische Rechtskultur und EU-Interessen 3. Vergangenheit und Zukunft des europäischen Privatrechts 3.a Die Internationalität der römischrechtlich orientierten Ausbildung 3.b Die nationalen Grenzen der Kodifikationen und der grenzüberschreitender Konsens 4. Zwei Schulen: die Kultivatoren und die Kodifikatoren 4.a Der Erfolg des soft law 5. Die sprachliche Ebene der Rechtsvereinheitlichung 6. Die Stellung der Rechtsvergleichung 7. Die Probleme des derzeitigen europäischen Privatrechts 7.a Die Qualität der Richtlinien 7.b Das Problem der Umsetzung 7.c Das Problem der europäischen Juristenausbildung 7.d Die Gestalt der entstehenden europäischen Privatrechtsprodukte 8. Ausblick 1. Problemstellung 1 Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Nobelstraat 2a, NL-3512 EN Utrecht; Tel. +31 30 253 7278; [email protected]. Es soll untersucht werden, inwieweit das Privatrecht zur europäischen Integration beiträgt, und ob es eine besondere integrative Qualität aufweist. Darüber hinaus soll eine Antwort auf die Frage gefunden werden, ob die Inhalte des europäischen Privatrechts sich mit denen der nationalen Privatrechte der EU-Mitgliedstaaten decken. Darüber hinaus sollen die zur Verfügung stehenden Umsetzungsinstrumente erläutert werden, durch die eine weitere Europäisierung des Privatrechts erreicht werden kann. Der Beitrag möchte auch den status quo der Stellung des Privatrechts in Europa beschreiben. 2. Definition des europäischen Privatrechts Seit einigen Jahren ist in den Vorlesungsverzeichnissen zahlreicher juristischer Fakultäten ein Unterrichtsfach mit dem Namen Europäisches Privatrecht oder als englischsprachige Vorlesungsveranstaltung European Private Law zu finden. Dahinter verbirgt sich meist ein Fach, in dem europäische Fragestellungen des Privatrechts behandelt werden. So werden verschiedene Richtlinien der EU vor allem zum Verbraucherrecht behandelt und die dazu gehörige Rechtsprechung verschiedener nationaler Gerichte und des Europäischen Gerichtshofs bearbeitet. Darüber hinaus werden Einblicke in verschiedene nationale Rechtssysteme gewährt. Europäisches Privatrecht ist ein junger Zweig der Rechtswissenschaft, der langsam einen eigenen Platz einnimmt. Europäisches Privatrecht ist, anders als Internationales Privatrecht, keine Verweisungslehre, die hilft, das anzuwendende Recht eines Nationalstaates ausfindig zu machen. Vielmehr etabliert sich diese Disziplin als ein interdisziplinärer Forschungsbereich, der Zusammenarbeit auf europäischer Ebene fördert und den Blick des Juristen auf innereuropäische Zusammenhänge ausweitet. Allerdings ist der Anwendungsbereich des europäischen Privatrechts mit dem des nationalen Privatrechts zu vergleichen. Wie auch in den Nationalstaaten bildet das europäische Privatrecht einen Ausschnitt aus der Gesamtheit der in einem politischen Gemeinwesen geltenden Rechtsnormen. In diesem Fall ist der Anwendungsbereich derzeit noch spezieller als in den nationalen Rechtsordnungen und meistens auf das Vertragsrecht beschränkt.2 Vor allem im nationalen Bereich konkurrieren aber im Privatrecht verschiedene Termini. So findet man den Begriff Zivilrecht, der teils als synonym für Privatrecht genutzt wird. Allerdings wird Privatrecht auch oft als Oberbegriff verstanden. Daneben steht auch noch die längere Umschreibung ‘bürgerliches Recht’, welches im deutschen Sprachraum als Privatrecht, ohne die Sonderprivatrechtsbereiche, wie das Arbeits- und Handelsrecht angesehen wird.3 Auf europäischer Ebene ist dagegen eine einheitlichere Begriffswahl in vielen Sprachen vorfindbar. Hier herrscht eindeutig eine klare Wahl für den Terminus Privatrecht vor. Das verdeutlichen zahlreiche Zeitschriften mit Titeln wie Zeitschrift für europäisches Privatrecht (ZEuP), European Review for Private Law (ERPL), Europa e diritto privato, sowie eines der bekanntesten Lehrbücher zur Rechtsvergleichung mit dem Titel Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts von Zweigert und Kötz.4 2 So auch die Kommission in ihrer Mitteilung zum europäischen Vertragsrecht; http://www.europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/contract_law/cont_law_02_en.pdf. 3 Diese künstliche Trennung der Materien wird nun wieder unterlassen. Moderne Kodifikationen, wie das niederländische Zivilgesetzbuch haben von der Trennung der Materien abgesehen. 4 3. Auflage, Mohr, Tübingen 1996. Eine englische Version erschien als K. Zweigert/H. Kötz, An Introduction to Comparative Law, Clarendon Press, Oxford 1992. Für die Wahl des Begriffs Privatrecht sprechen vor allem zwei Gründe: zum einen kann Privatrecht als Oberbegriff genutzt werden und zum anderen wird somit die Trennung von common law und civil law nicht terminologisch als Abgrenzung und Ausgrenzung genutzt. Durch den Gebrauch des Wortes Privatrecht werden die bestehenden Unterschiede zwischen beiden Systemen nicht noch weiter unterstrichen und den Engländern wird die Möglichkeit zur Integration unter einen gemeineuropäischen Oberbegriff gegeben. In Privatrecht, Private Law, können sich alle wiederfinden. Auch auf Weltebene wurde die Begriffswahl anerkannt und das Institut UNIDROIT5 nennt sich International Institute for the Unification of Private Law. Auch die neu gegründete European Research Group on Existing Community Private Law (Acquis Group) benützt den Ausdruck Privatrecht.6 Allerdings nennt sich die von Professor Christian v. Bar gegründete Gruppe Study Group on a European Civil Code (SGECC). a. Das bürgernahe Recht Im System des Rechts kommt dem Privatrecht eine besondere Stellung zu. Durch die herrschende Privatautonomie hat der Bürger den größten Gestaltungsraum. Er ist autonom in seiner Entscheidung mit wem er z.B. einen Kaufvertrag abschließt und er kann auch wählen, wo er das tut. So kann ein Bücherliebhaber heutzutage seine Bücher in seinem Heimatort beim Buchhändler kaufen, er kann sie auch beim Verlag direkt anfordern oder sie in einem ganz anderen Land per Internet bestellen und zuhause auf die Postsendung warten. Andere Bereiche des Rechts, vor allem außerhalb des Privatrechts, lassen sich nicht so autonom durch den Bürger selber beeinflussen. So ist es nicht möglich bei einem Einbruch das Recht der Wahl des Delinquenten anzuwenden oder ein Fahrzeug irgendwo in der europäischen Union anzumelden, wenn der Wohnsitz des Eigentümers in einem bestimmten Land liegt. Seit dem 1. Januar 2001 wird der Konsument nun auf Schritt und Tritt bei jedem Einkauf in den Ländern der Währungsunion mit der gemeinsamen Währung, dem Euro konfrontiert. Alle Preisangaben waren neben dem Euro auch noch in der heimatlichen Währung zu finden. Direkte Preisvergleiche wurden möglich.7 Seit dem 1. Januar 2002 fällt das lästige Umrechnen des Kurses und die Wechselgebühren bei Besuchen in Ländern der Währungsunion weg und der EURO ist das allgemeine einheitliche Zahlungsmittel in den Ländern des Währungsbündnisses. Zwar darf der Kunde mit Euro bezahlen, aber dennoch werden alle Kaufverträge weiter nach nationalem Recht abgewickelt. Die Europäische Union hat in den letzten Jahren wiederholt Richtlinien zum Konsumentenschutz erlassen. Dem Konsumenten kommt im Gegensatz zu den vergangenen Jahrzehnten nun eine ganz veränderte Gesetzeslage zu. Seine Rechte und Pflichten füllen inzwischen Bücher und eigene Gesetze zu seinem Schutz wurden erlassen. Der Bürger selber weiß allerdings meist nicht um seinen europaweiten Schutz, den er als Verbraucher genießt. Sehr einheitlich ist dieser Schutz auch nicht. 5 Siehe http://www.unidroit.org. 6 Für eine kurze Beschreibung der Gruppe siehe Newsletter European Private Law, 5(1), September 2002, S. 8 f., unter www.jura.uni-freiburg.de/newsletter/NEPL. 7 Zur Legitimation dieser zunächst umstrittenen Währungsunions, siehe Christian Joerges, Das Recht im Prozess der europäischen Integration, EUI Working Paper Law, No. 95/1, S. 33. Seiner Ansicht nach war die europäische Währungsunion ein zum Erfolg verpflichtetes Projekt und ist auch daher legitimierbar. So kann es zum Beispiel im Bereich der Gewährleistung nach Kauf einer mangelhaften Ware in den verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten noch zu unterschiedlichen Lösungen kommen, und dies trotz der Richtlinien. Die Richtlinien zum Verbraucherkauf sollten Mindeststandards setzen. Die unterschiedlichen Implementierungen in die nationalen Rechtsordnungen führten aber wieder zu Unterschieden. Der Gedanke liegt daher nahe auch das Vertragsrecht, besonders das Kaufrecht zu vereinheitlichen. Ein gemeineuropäisches Recht könnte bei den Europäischen Unionsbürgern ein einheitliches europäisches Rechtsgefühl fördern.8 Auch andere Bereiche des Privatrechts haben eine europäische Dimension. Schadenersatzregelungen sind derzeit europaweit sehr unterschiedlich gestaltet. Vor allem die Zuerkennung von Schmerzensgeld und Schadenersatz nach einem Unfall ist derzeit in Europa noch sehr unterschiedlich. Ein gemeineuropäisches Deliktsrecht würde einen bedeutenden Beitrag zum Vertrauen der Bürger in die Rechtsprechung leisten.9 Die zunehmende Mobilität der Bürger innerhalb der Europäischen Union führt auch zu Veränderungen in Bereichen, die früher als an eine bestimmte Staatsbürgerschaft oder einen bestimmten Wohnort gebunden angesehen wurden. So werden zunehmend mehr Ehen unter Partnern verschiedener Staatsbürgerschaft geschlossen. Im Fall einer Scheidung von Partnern unterschiedlicher Nationalität ist es ein bürokratischer Grossakt, die richtige Rechtslage heraus zu arbeiten. Ein gemeineuropäisches Scheidungs- und Unterhaltsrecht wäre wünschenswert.10 b. Europäische Rechtskultur und EU-Interessen Durch die Europäische Union kam es seit 1957 zu einer neuen Strömung: man strebte nach Harmonisierung, Annäherung und Rechtsvereinheitlichung. Nicht allein das nationale Recht war zu kennen, sondern auch die supranationalen Strukturen des europäischen Rechts, die den Juristen und Bürger umgeben. Als Vision kam auch die Idee eines Europäischen Zivilgesetzbuches in die Köpfe einiger Juristen.11 Jede rechtliche Entscheidung ist aber von öffentlichen Belangen abhängig. Lobbygruppen beeinflussen den Harmonisierungsprozess einschneidend. Juristen müssen im europäischen Einigungsprozess lernen, aus den Schneckenhäusern ihres Heimatrechtes wieder herauszutreten und sich einer gemeinsamen Dimension zu öffnen. Die Globalisierungsbestrebungen griffen auch auf das Privatrecht über. In verschiedenen Formen wurde diesem Wunsch Nachdruck verliehen. Zum einen erstellten UNIDROIT und UNCITRAL Model Laws, Konventionen und Prinzipien und zum anderen wurde wiederholt ein Global Commercial Code gefordert.12 Eine Europäisierung des 8 Fraglich ist allerdings, ob die Rechtsvereinheitlichung auch die Rechtskenntnis der Bürger steigert. Eine verbesserte Bekanntmachung der Konsumentenrechte ist innerhalb des Eu nötig. 9 Eine Bestandaufnahme von Christian v. Bar vorgenommen in Gemeineuropäiches Deliktsrecht, Band 2, Beck, München 1999. 10 Im Sinne der zunehmenden Rechtsvereinheitlichung hat sich die Commission on European Family Law 2001 gegründet. Diese europäische Arbeitsgruppe erstellt derzeit eine rechtsvergleichende Studie zum Scheidungsrecht (http://www.law.uu.nl/priv/cefl/). 11 Umfassend dazu A. Hartkamp/M. Hesselink/E. Hondius u.a. (Hrsg.), Towards a European Civil Code, 2. Auflage, Kluwer Law International, The Hague [etc.], 1998; G. Alpa/E. Buccico, Il Codice Civile Europeo, Giuffrè, Milano 2001, und die Arbeiten der Study Group on a European Civil Code, siehe www.sgecc.net. 12 Weitere Nachweise zu dieser Forderung bei M. Bonell, Do We Need a Global Commercial Code?, in Uniform Law Review, 2000, 5(3), S. 469 ff. Neuestens wurde die Frage nach der Notwendigkeit eines Global Commercial Code von Arthur Hartkamp und Michael Joachim Bonell gestellt auf dem Kongress anlässlich der Privatrechts ist somit nur eine regionale Forderung, die vor allem die wirtschaftliche Integration fördert. Zu einer Rechtskultur gehört auch, dass diese auf Forderungen des Marktes reagiert. Ein reiner Beitrag zur Dogmatik reicht nicht aus, um einen Kulturbeitrag zu leisten. Daher müssen das Handels- und das Zivilrecht Instrumente sein, die auf wirtschaftliche Bedürfnisse reagieren. Ein reiner Selbstzweck liegt in diesen Instrumenten nicht. Ändern sich die Umstände, so müssen Regeln auch wieder ersetzt werden. Die schnelle Reaktion auf sich ändernde Umstände liegt Juristen keineswegs im Blut. Unter dem Postulat der Rechtssicherheit erwartet der Bürger eine gewisse Kontinuität der Rechtsregeln. Die Europäische Union und auch der Erweiterungsprozess fordern ein ständiges Reagieren und Korrigieren des eingeschlagenen Kurses. Die europäische Rechtskultur ändert sich ständig.13 3. Vergangenheit und Zukunft des europäischen Privatrechts Die Privatrechtskultur befindet sich im Umbruch. War man in Deutschland nach der Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches, wie auch in anderen Ländern, überzeugt, dass Privatrecht eine nationalstaatliche Materie ist, so muss man nun wieder umlernen. Das Richtlinienrecht aus Brüssel, die Rechtsprechung des EuGH in Luxemburg, die von international zusammengesetzten Kommissionen und Gruppierungen der akademischen Welt entwickelten Restatements und Principles von Teilen des europäischen Privatrechts und die wachsende Literatur zum europäischen Privatrecht tragen dazu bei, dass ein europäisches Privatrecht und eine europäische Privatrechtswissenschaft entstehen.14 Das europäische Privatrecht ist im Entstehen, daher fehlen noch eine ausgereifte Dogmatik und eine allgemeine Theorie oder gar ein System des europäischen Privatrechts. a. Die Internationalität der römischrechtlich orientierten Ausbildung Allerdings kann die Privatrechtswissenschaft sich der Rechtsgeschichte zuwenden, da diese Rechtssparte wie keine andere eine gemeinsame Rechtswurzel bereithält, nämlich das römische Recht.15 Schon in der Zeit der XII Tafeln, also 450 vor Christus betätigten sich die Römer bereits als Rechtsvergleicher. Livius überliefert uns die Entstehungsgeschichte dieses umfassenden Gesetzes.16 Demnach soll eine Kommission nach Griechenland entsandt worden sein, um in Athen die Solonischen Gesetze abzuschreiben und sich auch sonst über das 75. Jahrfeier von UNIDROIT am 27. und 28. September 2002 in Rom. Siehe Viola Heutger, Worldwide Harmonisation of Private Law and Regional Economic Integration - 75 Jahre UNIDROIT - Rom 27.-28. September 2002, European Review of Private Law, 2002, 10(6), S. 858. 13 Eingehend mit der europäischen Rechtskultur beschäftigt sich Martijn Hesselink in The New European Legal Culture, Kluwer, Deventer, 2001. Auf die Änderung der nationalen Rechtssysteme bezogen siehe S. 78 ff. 14 Vgl. Etwa die Beiträge von Thomas G. Watkin (Hrsg.), The Europeanisation of Law, UKNCCL, London 1998; Peter-Christian Müller-Graff (Hrsg.), Gemeinsames Privatrecht in der Europäischen Gemeinschaft, 2. Aufl., Baden-Baden, Nomos 1999; Filippo Ranieri, Europäisches Obligationenrecht, Springer, Wien 1999; Christian v. Bar, Die Study Group on a European Civil Code, in P. Gottwald/E. Jayme/D. Schwab (Hrsg.), Festschrift für Dieter Henrich, Gieseking, Bielefeld 2000, S. 1 ff. 15 Siehe dazu Heinrich Honsell, Die Bedeutung des römischen Rechts für die moderne Zivilrechtsdogmatik, in Jörn Eckert (Hrsg.), Festschrift Hattenhauer, C.F. Müller, Heidelberg 2003, S. 245 ff. 16 Livius 3, 31, 8. griechische Recht zu informieren.17 Diese Internationalität des römischen Rechts hat sich bis heute gehalten. Paul Koschaker schrieb bereits vor über 50 Jahren: ‘Keine andere Sparte der Rechtswissenschaft trägt einen so europäischen Charakter wie die Privatrechtswissenschaft.’18 Über Jahrhunderte hatten europäische Juristen eine gemeineuropäische Ausbildung. Das gemeineuropäische Erlernen des römischen Rechts war das verbindende Element. Die Privatrechtswissenschaft war sozusagen, europäisches Gemeingut, modern gesprochen acquis communautaire. Bis zu den Zeiten des usus modernuns pandectarum im 17. und 18. Jahrhundert formte das gebildete Europa eine undifferenzierte Einheit in kultureller, wie auch rechtlicher Hinsicht. Juristen, die ihre Ausbildung in einem Land erhalten hatten, konnten in einem anderen Land später als Rechtslehrer tätig sein. Der deutsche Naturrechtslehrer Samuel Pufendorf (1632-1694) lehrte in Lund und der Italiener Alberico Gentili (1552-1608) in Oxford.19 Sprache und verschiedene Herkunft formten kein Hindernis. Die Werke großer Juristen, wie z.B. von Hugo Grotius (1583-1645) wurden in verschiedene Sprachen übersetzt und studiert. Deutsche Studenten besuchten die Rechtsschulen in Italien und Frankreich und ungarische und schottische Juristen ließen sich in Leiden und Utrecht ausbilden.20 Der Wissenschaftstransfer war gut geregelt und der Mobilität war schon damals kaum eine Grenze gesetzt. Die europäische Rechtswissenschaft bildete trotz ihrer Unterschiede im Detail eine einheitliche intellektuelle Welt. Gemeinsame Ausbildung und wissenschaftliche Tradition verband die Juristen in Europa. Dieses gelehrte Recht war aber keineswegs nur das Kennen der Rechtssentenzen eines Paulus, Gaius oder Papinian, sondern es war das Erlernen juristischer Dimensionen eines Zeitraumes von etwa tausend Jahren. In der Form einer Kompilation stand den Rechtsstudenten ein Rechtsbuch, das Corpus Iuris Civilis, zur Verfügung, das Rechtsfälle und ihre Lösungen enthielt, wie auch Kommentierungen, rechtliche Meinungen und Regeln. Wenn man die letzten 850 Jahre betrachtet und überlegt, was das integrative Grundelement der europäischen Juristen war, so kommt man unweigerlich auf das römische Recht zu sprechen. Juristen aller Kulturnationen kannten es und die meisten wendeten es auch an. Europa und das römische Recht war ein Programm, dass Jahrhunderte überdauerte. Durch die Kodifizierungsbewegungen21 der Nationalstaaten wurde das römische Recht in den 17 Vgl. auch Pomp. D. 1,2,2,4. 18 Mit dieser Aussage leitet Paul Koschaker sein richtungsweisendes Werk ein. Europa und das römische Recht erschien 1947 in der 1. Auflage; 4. unveränderte Aufl., Beck, München [etc.] 1966, Fußn. 1, S. 1. Eine rezente Übersetzung ins Niederländische mit Stichwortregister und dem Original gleicher Seitenzahl erschien 2000 bei Tjeenk Willink in Deventer; die Edierung besorgte Theo Veen. In abgewandelter Form ist der Titel häufig wiederzufinden, so bei Peter Stein, Römisches Recht und Europa, Fischer, Frankfurt am Main 1996. 19 Reinhard Zimmermann, Roman Law and European Legal Unity, in Hartkamp/Hesselink/Hondius, Towards a European Civil Code, S. 27 f. 20 Siehe z.B. John Cairns, Legal Study in Utrecht in the Late 1740s: The Education of Sir David Dalrymple, Lord Hailes, Fundamina, 8, 2002, S. 30-74. 21 Ein Überblick über die Kodifikationsbewegungen ist zu finden in Franz Bydlinski/Theo MayerMaly/Johannes W. Pichler (Hrsg.), Renaissance der Idee der Kodifikation. Das Neue Niederländische Bürgerliche Gesetzbuch 1992, Böhlau, Wien 1992. letzten 150 Jahren vielfach verdrängt und aus politischen Gründen zeitweilig auch verdammt.22 b. Die nationalen Grenzen der Kodifikationen und der grenzüberschreitender Konsens Lange Zeit waren Kodifikationen und Kompilationen gleichbedeutend mit bestimmten Territorien. Sprach man vom Code Civil, so hatte man sofort Frankreich vor Augen, das BGB wird unweigerlich mit Deutschland verbunden. Vor der großen Kodifikationswelle, die vor zweihundert Jahren einsetzte, war das noch anders, eine Nation war nicht identisch mit ihrem Gesetzbuch. Eine einheitliche Juristenausbildung auf dem kontinentalen Europa sorgte für Einheit und Verbundenheit. Ein gemeinsames Rechtsdenken bestand auf dem Kontinent. Die Rechtsgeschichte lehrt uns, dass Recht keine Folklore ist, sonder eine Frage der Ethik, der Wirtschaft und technischer Überlegungen.23 Daher schloss die Zeit des Transfers an das Kodifikationszeitalter an. So inspirierte der Code Civil viele andere Rechtsordnungen und auch die französische Rechtsprechung wurde später noch, z.B. in den Niederlanden mit großem Interesse verfolgt. Das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch schuf eine eigene Dogmatik, die wiederum andere Länder zur Übernahme inspirierte.24 Diese Vorbildwirkung von Kodifikationen findet man auch heute. So sei hier das Pavia Projekt von Gandolfi genannt, welches auf dem italienischen Codice Civile aufbaut. Auch ist bekannt, dass die Kommission zur Schaffung eines polnischen Zivilgesetzbuches intensiv nach der modernen niederländischen Kodifikation von 1992 schaut. Sowohl auf akademischer als auch auf staatlicher Ebene bleiben Kodifikationen grenzüberschreitend inspirierend. Aber auch außerhalb von Kodifikationen ist es möglich einen Konsens zu erreichen: ein guter Beweis dafür ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).25 4. Zwei Schulen: die Kultivatoren und die Kodifikatoren26 Der Weg des römischen Rechtes kann ein Vorbild für die Zukunft der europäischen Privatrechtswissenschaft sein. Allerdings wird man eine eigene neue Methode finden müssen, da die Grundbedingungen anders sind als vor einigen hundert Jahren. Ein europäisches Vertragsrecht könnte auf zwei verschiedenen Wegen zustande kommen, zum einen durch langsames Wachstum und zum anderen durch eine neue Kodifikation. Ziel beider Wege ist die Harmonisierung oder Vereinheitlichung des europäischen Vertragsrechtes. Das Einheitsrecht könnte den europäischen Bürgern als Kodifikation dargeboten werden, oder es 22 So das Parteiprogramm der Nationalsozialistischen Partei, Punkt 19 des NSDAP-Parteiprogrammes von 1920. 23 Ole Lando, Optional or Mandatory Europeanisation of Contract Law, in Evolutionary Perspectives and Projects on Harmonisation of Private Law in the EU, EUI Working Papers, Law No. 99/7, S. 13. 24 Z.B. Griechenland und Japan. Die Einteilung in fünf Bücher inspirierte die österreichischen Lehrbuchautoren zur Einteilung des Stoffes des ABGB, welches eine Dreiteilung kennt, auch auf die fünf Gebiete des allgemeinen Teils, des Schuldrechts, des Sachenrechts, des Familien- und Erbrechts. 25 26 Vom 11. April 1980 (BGBI. 1989 II S. 588). Derzeit haben 62 Länder bereits die CISG unterzeichnet. Diese Einteilung schlug Ole Lando vor in Evolutionary Perspectives and Projects on Harmonisation of Private Law in the EU, EUI Working Papers, Law No. 99/7, S. 22 ff. könnte durch langdauernde Pflege und Kultivierung entstehen.27 Die Kultivatoren sagen, dass ein Europäisches Vertragsrecht langsam und organisch wachsen sollte. Dieser Prozess sollte begleitet werden von Wissenschaftlern, die durch ihre Schriften das Recht festigen sollten. Auf diese Weise bilde sich dann eine eigene Dogmatik heran. Gemeinsame Grundsätze lassen sich aus dieser europäischen Dogmatik ableiten. So werden der internationalen Wirtschaftsgemeinschaft Regeln zur Verfügung gestellt, die sowohl Praxis als auch Gewohnheit sind. In diesem neuen europäischen Recht sollen anschließend die Jurastudenten unterrichtet werden, die es dann, sollten sie einmal Richter werden, in ihren Entscheidungen auch anwenden. Über die Wissenschaft als Vermittlerin soll so langsam ein europäisches Vertragsrecht gefestigt werden. In den letzten Jahrzehnten wurde dieser Weg bereits eingeschlagen und von Juristen betrieben, deren Kenntnisse weit über das Recht ihres Heimatlandes hinausgingen.28 Diese Juristen werden auch gebraucht, wenn es zur Durchsetzung der Idee der Kodifikatoren kommt. Einige Wissenschaftler in dieser Gruppe möchten ein europäisches Zivilgesetzbuch. Dieses Gesetzbuch kann aber in vielerlei Gestalt in Erscheinung treten. Es besteht zum einen die Möglichkeit, ein verbindliches Gesetzbuch für alle zu schreiben, oder zum anderen ein soft law zu entwickeln, das Grundsätze (Principles) darlegt. Die meisten Juristen sind derzeit mehr für den soft law-Weg, wie ihn auch die UNIDROIT Principles gegangen sind.29 Darüber hinaus werden aber auch Lehrbücher, Materialsammlungen und Aufsätze benötigt, die die Diskussion unter den Juristen fördern, und für den Rechtsunterricht an den Universitäten eingesetzt werden können. Sollte man beide Wege bewerten, so hat die kultivatorische Linie Vorteile. Die Juristen gewöhnen sich leichter an langsame Entwicklungen.30 Allerdings wird es sehr lange dauern, auf diesem Wege eine Europäisierung zu erreichen. In der Europäischen Union gibt es derzeit 16 Rechtssysteme und 11 Sprachen. Ab dem 1. Mai 2004 werden es noch mehr Rechtssysteme und Sprachen sein. Wenn keine kodifizierende Maßnahme ergriffen wird, werden die Menschen der Union wohl weiterhin verschiedene bürgerliche Rechtssysteme haben. Diejenigen, die ein Bedürfnis nach Rechtsharmonisierung durch natürliches Wachstum haben, werden große Geduld haben müssen. Jegliche Erweiterung der europäischen Union wird diesen Prozess noch weiter verzögern. a. Der Erfolg des soft law Seit einigen Jahrzehnten sind die Juristen um eine neue Kategorie von Rechtsregeln bereichert worden. Das sogenannte soft law, womit Rechtsregeln gemeint sind, die nicht bindendes Recht sind. Dem Beispiel der amerikanischen Restatements folgend, wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Grundprinzipien entworfen. Auf internationaler Ebene 27 Ole Lando in Evolutionary Perspectives and Projects on Harmonisation of Private Law in the EU, EUI Working Papers, Law No. 99/7, S. 22 ff. 28 Z.B. Hein Kötz, Europäisches Vertragsrecht, Mohr, Tübingen 1996; Christian v. Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht, Beck, München 1999 und die Reihe der Jus Commune Case Books der Universitäten Maastricht und Leuven, Hrsg. Walter van Gerven). Dazu Pierre Larouche, Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe, EUI Working Papers, Law No. 99/7, S. 87 ff. 29 Mit weiteren Nachweisen: Ole Lando in Evolutionary Perspectives and Projects on Harmonisation of Private Law in the EU, EUI Working Papers, Law No. 99/7, S. 24. 30 In den Niederlanden legten nach der Einführung des neuen Zivilgesetzbuches einige Notare ihr Amt nieder, da sie kein Interesse am Umlernen auf ein neues Gesetzbuch hatten. nahmen die UNIDROIT Principles31 eine Vorreiterstellung ein. Zeitgleich nahm auch die Kommission für europäisches Vertragsrecht unter der Leitung von Ole Lando ihre Arbeit auf und präsentierte die Principles of European Contract Law.32 Die Principles of European Trust Law33 und Principles of European Tort Law34 wurden auch alle um die Jahrtausendwende bekannt gemacht. Auf der Grundlage der Principles of European Contract Law arbeitet derzeit die Study Group on a European Civil Code35 an weiteren Grundprinzipien für den europäischen Binnenmarkt. Die geplanten Bereiche umfassen die unerlaubte Handlung, die Geschäftsführung ohne Auftrag, das Recht der Dienstleistungen, das Kaufrecht, Langzeitverträge, Bürgschaftsrecht und den Übergang von Eigentum. Diese Grundprinzipien sind nicht Recht im eigentlichen Sinn. Ihr Erfolg hängt von der Qualität und der Autorität der sie erlassenden Gruppierungen ab. Erst die Annahme der Regeln durch Vertragsparteien verleiht diesen Bestimmungen Geltung. Die Regeln wurden mit dem Ziel entworfen, den gemeinsamen Markt durch ein transparenteres System besser funktionieren zu lassen. Anders als die amerikanischen Restatements sind sie nicht eine Kompilation bestehenden Rechts. Die Grundprinzipien sind ein Rechtsharmonisierungsversuch, der sowohl Bedacht nimmt auf die Lösungen der verschiedenen Rechtssysteme innerhalb der Nationalstaaten, aber eben auch auf internationale Konventionen und europäische Richtlinien. All diese Faktoren, wie auch Policyentscheidungen, fließen mit ein in die Regelgebung. 5. Die sprachliche Ebene der Rechtsvereinheitlichung Die Europäische Union steht immer wieder vor Sprachproblemen und die anstehende Osterweiterung wird dieses Problem wieder verstärken. Recht ist ganz besonders auch von Sprache betroffen. In der Zeit des ius commune galt das Lateinische als die Juristensprache. Diese Zeiten sind vorbei. Unterschiedliche Sprachen werden in den Unionsmitgliedstaaten gesprochen und auch auf lange Sicht ist keine gemeinsame juristische Fachsprache in Europa zu erwarten, da solch eine Entscheidung neben sprachlichen vor allem rechtspolitische Probleme aufwirft.36 Jedes Unionsland hat seine spezifische Rechtssprache, deren Begriffe ohne eine Bedeutungsverschiebung nicht einheitlich übersetzbar sind. Selbst innerhalb derselben Sprache werden nicht alle Begriffe einheitlich gebraucht. So wird deutsch in Rechtstexten der Schweiz, Liechtensteins, Österreichs, Deutschlands und in einer deutschen Übersetzung des 31 Vgl. Database http://www.unilex.info. 32 Teil I und II sind bereits erschienen. Teil 3 wird gegen Ende des Jahres 2002 erwartet. Ole Lando/Hugh Beale, Principles of European Contract Law, Parts I and II, Kluwer Law International, The Hague, 2000. 33 D. Hayton/S. Kortmann/H. Verhagen (Hrsg.), Principles of European Trust Law, Kluwer Law International, The Hague 1999. 34 Jaap Spier (Hrsg.), The Limits of Liability, Kluwer, The Hague 1995, The Limits of Expanding Liability, Kluwer, The Hague 1998, Unification of Tort Law: Causation, Kluwer, The Hague 2000; und Helmut Koziol (Hrsg.), Unification of Tort Law: Wrongfulness, Kluwer, The Hague 1998; Ulrich Magnus (Hrsg.), Unification of Tort Law: Damages, Kluwer, The Hague 2001; sowie Bernhard A. Koch/Helmut Koziol (Hrsg.), Unification of Tort Law: Strict Liability, Kluwer, The Hague 2002. 35 36 http://www.sgecc.net. Weiterführend zu diesem Problem Viola Heutger, Law and Language in the European Union, Global Jurist, 3(1), 2003, Article 3, S. 2 f. Codice Civile für Südtirol gebraucht. So kann es kommen, dass zwei Gesetzbücher verschiedener Länder, aber gleicher Sprache, gleichlautende Wörter mit verschiedenen Bedeutungen gebrauchen können. Den Wörtern kommen keine absolute und dauerhafte Bedeutung zu. Dem Problem von Übersetzung und Begriff entkommt man schon in ein und derselben Sprache nicht. Begriffe wie z.B. ‘Besitz’ können im grenzüberschreitenden Verkehr schon Probleme verursachen. So versteht der Deutsche darunter etwas anderes als der Österreicher, der darunter die tatsächliche Sachherrschaft mit dem animus domini versteht. Der Deutsche dagegen versteht unter Besitz die bloße Sachherrschaft, diese bezeichnet der Österreicher wiederum mit Innehabung. Seit Jahren haben es Juristen gelernt mit Übersetzungen zu arbeiten. Diese Übersetzungen unterscheiden sich aber sehr. So gibt es neben der traditionellen Übersetzung, in der ein Text in einer anderen Sprache verfasst wird, auch die zweisprachige Abfassung eines Textes, die dann später beide als authentisch bei der Auslegung angesehen werden können. Die Europäische Union steht nicht alleine da mit ihren Übersetzungsproblemen. Andere Länder stehen auch ständig im Prozess gleiches in verschiedenen Sprachen ausdrücken zu müssen. Gesetze werden von Juristen aus Belgien, der Schweiz und aus Québec in zwei, drei oder sogar vier Sprachen verfasst. Das Sprachproblem steht der Rechtsvereinheitlichung und Europäisierung des Rechts also nicht entgegen. Der Europäisierung des Rechts stehen verschiedene Methoden zur Verfügung. Zum einen könnten die einzelnen Staaten Begriffe implementieren. So könnte man auch in Deutschland von einer Direktive sprechen und so den Begriff Richtlinie vermeiden und die sprachliche Angleichung durch Spezialbegriffe fördern. Eine andere Möglichkeit ist das simultane Abfassen eines Textes in allen EU-Mitgliedstaaten. Diese Lösung wird aber sehr teuer und sicher auch zeitverzögernd sein und ist allein daher schon abzulehnen. Eine weitere Möglichkeit ist die Einigung auf eine gemeinsame Verkehrssprache, wie dem ‘kontinentalen englisch’.37 Diese letzte Möglichkeit ist nun schon auf akademischer Ebene akzeptiert worden und namhafte Gruppen arbeiten vorwiegend in englisch.38 Aber auch eine andere Sprache, wie z.B. französisch wäre denkbar.39 6. Die Stellung der Rechtsvergleichung Rechtsvergleichung war jahrelang an den Rand eines jeden Studienplanes gedrängt worden. Die Stellung der Rechtsvergleichung ist mit dem früher vorherrschenden Konzept, eines geschlossenen nationalen Rechtssystems, zu erklären, dass die Rechtsvergleichung als ein bloßes Randgebiet mit eigener Methodik und einer Bedeutung nur für Spezialisten ansah. Den Begriff ‘continental English’ prägte Hugh Beale für die Arbeitssprache der Commission on European Contract Law und der Study Group on a European Civil Code. 37 38 Z.B. die Commission on European Contract Law, die Study Group on a European Civil Code und das Common Core Projekt. Die Ergebnisse der Commission on European Contract Law wurden 1999 als Principles of European Contract Law, Part I and II bei Kluwer Law International in Den Haag veröffentlicht; eine reine Text Version ist unter http://www.ufsia.ac.be/~estorme/PECL.html zu finden. In dieser Sprache arbeitet die ‘Gandolfi-Gruppe’, auch Accademia die Giusprivatisti Europei genannt, die in Italien angesiedelt ist, aber französisch arbeitet. Giuseppe Gandolfi ist der Leiter der Pavia Gruppe. Ausgehend vom italienischen Zivilgesetzbuch und dem MacGregor Code wurde ein europäisches Vertragsgesetzbuch entworfen. Der Allgemeine Teil wurde im vergangenen Jahr veröffentlicht: Code européen des contrats/Avant-projet, Livre premier, Giuffrè, Milano 2001. 39 Innerhalb der Europäischen Union kommt der Rechtsvergleichung nun eine neue Stellung zu. Die Rechtsvergleichung als Wissenschaft ist unparteiisch. Durch die Rechtsvergleichung, die die Kenntnis fremder Rechtsregeln voraussetzt, kommt der Jurist dazu, über die Vielgestaltigkeit der Rechtsmodelle nachzudenken. Das führt zu einer Anerkennung des natürlichen und legitimen Charakters des kulturellen und rechtlichen Pluralismus. Es hilft den Juristen von dem Verhalten zu heilen, das Universum im Licht der zentralen Stellung der eigenen Kultur zu interpretieren.40 Die Rechtsvergleichung ist daher eine integrative Wissenschaft. Die primäre Funktion der Rechtsvergleichung ist Erkenntnis. Der praktische Einfluss hat sich in den letzten Jahren jedoch deutlich verstärkt. Das sieht man in ihren vier praxisbezogenen Funktionen. So dient die Rechtsvergleichung als Hilfsmittel für den Gesetzgeber,41 als Auslegungsinstrument, als Unterrichtsfach in den Universitäten und als Grundlage für die supranationale Vereinheitlichung des Rechts.42 Soziale Werte und ein unterschiedlicher kultureller Hintergrund haben in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Rechtsordnungen entstehen lassen, die oft nur bei einer näheren Beschäftigung mit dem jeweiligen Land erklärbar sind. Im Rahmen der wachsenden Europäischen Union, kann man nicht mehr nach getrennten, sondern nur noch nach integrierten Lösungen suchen. Rechtsharmonisierung kann nicht durch Aufzeigen von unterschiedlichen Lösungen der verschiedenen Mitgliedsstaaten der EU und der Wahl der häufigst angewandten Lösung betrieben werden. Rechtsharmonisierung durch funktionale Rechtsvergleichung zielt auf effiziente Problemlösungen, ohne einer bestimmten Rechtsdogmatik von vorneherein den Vorzug zu geben. Diesen Weg beschreiten auch Arbeitsgruppen, wie zum Beispiel die Study Group on a European Civil Code. Durch diese Entwicklungen wird auch der Rechtsvergleichung ein anderer Stellenwert beigemessen. Aus dem Vergleichen verschiedener Rechtssysteme wird nun ein Suchen nach integrierten Lösungsansätzen. Die Rechtsvergleichung dient als Grundlage für ein modernes, zeitgemäßes Recht. Bislang wurde Rechtsvergleichung in der Lehre meist angesehen als der Vergleich von Rechtsfamilien und nationalen Rechtssystemen. Diese eingeschränkte Funktion der Rechtsvergleichung wurde aber in den letzten Jahren überwunden und in die Vergleichung fließen nun auch internationale Übereinkommen und europäische Richtlinien mit ein. 7. Die Probleme des derzeitigen europäischen Privatrechts a. Die Qualität der Richtlinien 40 Rodolfo Sacco, Einführung in die Rechtsvergleichung, Nomos, Baden-Baden 2001, S. 15. 41 Der Gesetzgeber des niederländischen bürgerlichen Gesetzbuches zog entscheidende Erkenntnisse aus der Rechtsvergleichung. Dazu Martijn Hesselink, Il codice civile olandese de 1992: un esempio per un codice civile europeo?, in Guido Alpa/Emilio Nicola Buccico (Hrsg.), La Riforma dei Codici in Europa e il Progetto di Codice Civile Europeo, Giuffrè, Milano 2002, S. 71-82. Bei der deutschen Schuldrechtsmodernisierung kamen die Juristen erst spät auf den Wert der Rechtsvergleichung für das Entwerfen neuer Gesetzestexte. So wurde sich am Haager und Wiener Kaufrecht orientiert. Ein Textteil des neuen Leistungsstörungsrechtes ist stark beeinflusst worden durch Artikel 4:102 der Principles of European Contract Law. Vgl. Reinhard Zimmermann, ‘... ut sit finis litium’, JZ, 2000, 55(18), S. 853, 857 ff. und Grundregeln eines Europäischen Verjährungsrechts und die deutsche Reformdebatte, ZEuP 2001, 2, S. 217 und Ewoud Hondius, De herziening van het Duitse verbintenissenrecht, NJB, 2002, 77(28), S. 1351. 42 Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, Mohr, Tübingen 1996, S. 14. Die Europäische Gemeinschaft erhielt zu Beginn nur soweit eine funktionale Ermächtigung einzelne Bereiche des Privatrechts zu regeln, in so fern diese zum Aufbau und Funktionieren des Binnenmarktes beitrugen (z.B. Art. 100, 100a; 54 III, lit. g EGV). Handeln durfte die Gemeinschaft nur, wenn eine Notwendigkeit bestand.43 Aus dieser Haltung heraus entstanden so zunächst jene verbraucherpolitischen Programme, die in den Jahren 1971 und 197544 in privatrechtliche Richtlinien umgesetzt wurden. Daraus entstand eine Richtliniengeneration, die sich mit konsensfähigen Minimalstandards zufrieden gab und nicht erheblich in das nationale Recht der Mitgliedstaaten eingriff. Einige Jahre später änderte sich dieser Kurs und Richtlinien entstanden, die zum großen Teil den Verbraucher zum Ziel hatten, diesen aber nie einheitlich definieren45 und so den Nationalstaaten bei der Implementation viel Kopfzerbrechen bescherten. Diese Probleme sind bis heute noch nicht gelöst. Vor allem wird die ‘pointillistische’46 Zugriffsweise beklagt, die dazu führt, dass das Gemeinschaftsrecht zu Systembrüchen in den nationalen Privatrechtsordnungen führt. Bekannte Richtlinien, wie jene zum Verbraucherkredit,47 missbräuchlichen Vertragsklauseln und Verbrauchergarantien sind keineswegs nur hilfreich auf dem Weg zur Rechtsvereinheitlichung. Vielmehr führte die Art, wie sie entworfen wurden zu Problemen. So wurde schnell deutlich, dass der den internen Markt unterstützende Effekt sehr eingeschränkt ist, da es sich um häppchenweise Gesetzgebung handelt, die nur Teilausschnitte behandelt. Daher haben die Richtlinien zum Teil sogar einen desintegrierenden Effekt, weil die Regelungsbereiche Konflikte nationaler Rechtssysteme mit supra- und internationalen Rechtsquellen herausfordern. Diese Situationen sind häufig nur schwer regulierbar.48 Die Vielfalt der Regeln auf den verschiedenen Gesetzgebungsebenen erschwert die Vereinheitlichung und auch jede geeignete Harmonisierung. Mit Spannung darf man hier die Ergebnisse der Acquis Gruppe erwarten. Diese Gruppe hat es sich zum Ziel gesetzt Principles of Existing European Community Private Law herauszuarbeiten. Ausgehend vom bestehenden Acquis Communautaire, also dem bestehenden Gemeinschaftsrecht, versucht die Gruppe gemeinsame Elemente und Strukturen herauszuarbeiten. Anhand dieser Konturen sollen dann gemeineuropäische Grundsätze herausgearbeitet werden. Diese Grundsätze, Principles, sollen die gemeinsamen europäischen Grundkonzepte widerspiegeln. Ausgangspunkt der Arbeiten der Gruppe soll das Gemeinschaftsrecht sein und keineswegs die verschiedenen nationalen Rechtssysteme der Mitgliedstaaten. b. Das Problem der Umsetzung 43 Siehe Peter-Christian Mueller-Graff, EC Directives as a Means of Private Law Unification, in Hartkamp/Hesseling/Hondius, Towards a European Civil Code, S. 73 f. 44 Abl. C 92/1975, 1 und C 133/1981, 1. 45 Einen Vergleich der verschiedenen Definitionen des Verbrauchers im europäischen Richtlinienrecht nahmen Alpa, Herre und Hondius für die Study Group on a European Civil Code vor. Siehe www.sgecc.net. 46 Hein Kötz, Gemeineuropäisches Privatrecht, in Festschrift Konrad Zweigert, Mohr, Tübingen 1981, S. 481 ff., 483. 47 48 Diese Richtlinie soll demnächst erneut modifiziert werden. Sonja Feiden und Christoph U. Schmid in Evolutionary Perspectives and Projects on Harmonisation of Private Law in the EU, EUI Working Papers, Law No. 99/7, S. 5. Gegen eine Europäisierung des Privatrechts wird oft das Argument angeführt, dass weder der Vertrag von Amsterdam noch der von Maastricht ein klares Mandat vorsehen zur Schaffung eines europäischen Privatrechts. Es wird in den Verträgen noch nicht einmal erörtert, ob solch eine Option überhaupt bestehen sollte.49 Erst langsam hat sich Brüssel mit dem Gedanken eines europäischen Privatrechts anfreunden müssen. Eine umfassende Regelung des Privatrechtes auf europäischer Ebene wurde nur in einer Entschließung des Europäischen Parlaments in Betracht gezogen. Bisher wurde alle Aufmerksamkeit der Kommission auf das Vertragsrecht beschränkt. In ihrem Aktionsplan wird auch die Option eines freiwilligen Rechtsinstrumentes diskutiert.50 1985 veröffentlichte die Kommission ein Weissbuch.51 Viele dort genannte Aspekte tauchen später nie wieder auf.52 Im Juli 2001 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung zum europäischen Vertragsrecht.53 Die Kommission hatte in ihrer Mitteilung eine Reihe von Lösungsvorschlägen präsentiert. Vier Optionen wurden in der Mitteilung vorgeschlagen: I. Keine weitere Ausarbeitung von EG-Massnahmen. Das heißt, dass die weitere Entwicklung ganz dem freien Markt überlassen würde. II. Förderung der Ausarbeitung gemeinsamer Grundsätze des Vertragsrechts, die zu einer Annäherung der nationalen Rechtsordnungen führen. III. Verbesserung der Qualität bereits geltender Rechtsvorschriften. IV. Erlass neuer umfassender Rechtsvorschriften auf EG-Ebene.54 Grundlage für das Dokument der Kommission ist eine Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. März 2000. Dort wurde vermerkt, dass eine verstärkte Harmonisierung des bürgerlichen Rechts innerhalb des Binnenmarktes unerlässlich geworden sei. Bis Oktober 2001 reagierten auf die Mitteilung mehr als 160 Einzelpersonen, Gruppierungen und Regierungen aus verschiedenen Ländern. Die Mehrheit der Reagierenden äußert sich zurückhaltend und vorsichtig. Aber viele verlangen dennoch nach einem Europäischen Vertragsrecht, ohne jedoch die zukünftige Gestalt genau zu umschreiben. Allerdings wird auch immer wieder gefordert, das ein europäisches Privatrecht nicht aus Brüssel kommen soll, sondern vom Volk verfasst werden sollte. So sollten die Menschen der Wirtschaft fordern, dass ein einheitliches Privatrecht angewandt wird, welches die Kosten und Risiken vermeidet bei jedem grenzüberschreitenden Verkehr über Grenzen, die schon lange keine echten Grenzen mehr sind.55 Die Internationalisierung der Wirtschaft erfordert 49 Ole Lando in Evolutionary Perspectives and Projects on Harmonisation of Private Law in the EU, EUI Working Papers, Law No. 99/7, S. 11. 50 Aktionsplan (2003/C 63/01), Randzeichen 89 ff. 51 Abl. L 210/1985, 29. 52 So fand sich im Weissbuch eine seitenlange Abhandlung über Garantien; an diese Ausarbeitungen wollte die Kommission beim Abfassen der Richtlinie zu Verbrauchergarantien aber nicht mehr erinnert werden. Nun finden sich in der Richtlinie halbherzige Minimalforderungen zu Garantien, die weit entfernt von den Ausarbeitungen des Weissbuches sind. 53 http://www.europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/contract_law/cont_law_02_en.pdf 54 Weiterführend Dirk Staudenmayer, Die Mitteilung der Kommission zum Europäischen Vertragsrecht, Zeitschrift für Europäisches Wirtschaftsrecht (EuZW), 2001, 12(16), S. 485. 55 So Ole Lando, in Evolutionary Perspectives and Projects on Harmonisation of Private Law in the EU, EUI Working Papers, Law No. 99/7, S. 13 und 40. eine Anpassung auch in Europa. In einigen Bereichen ist das Vertragsrecht auf Weltebene bereits weiter entwickelt als auf der Ebene der Europäischen Union. Als Beispiele sollen hier nur die INCOTERMS, die Hague-Visby-Rules und die CISG angeführt werden. Das Welttransportrecht hat Europa überholt. Ähnliches wird auch bald mit dem Sicherungsrecht geschehen.56 Es werden aber auch immer wieder Stimmen laut, die fordern, dass ein Europäisches Privatrecht von einem europäischen Gesetzgeber erlassen werden muss.57 Wer genau dieser Gesetzgeber sein soll, wird aber nie definiert. Um einer Idee Kraft zu verleihen sind Institutionen belangreich, die den Legitimationsprozess unterstützen. So wurde wiederholt gefordert, ein European Law Institute einzurichten.58 Ähnlich UNCITRAL könnten Gesetzesvorschläge dann von diesem Institut kommen. Die europäische Union steht vor dem komplexen Problem der Mehrschichtigkeit der Rechtssysteme. Nicht nur alleine auf der Ebene der EU sind verschiedene Formen, wie Verträge, Richtlinien und Verordnungen zu finden, sondern dazu kommen noch all die Rechtsinstrumente der Mitgliedstaaten. Mit den kommenden Jahren wird die Unübersichtlichkeit nur noch steigen. Initiativen zu ergreifen wäre daher sinnvoll. Ein European Law Institute, getragen von allen EU-Mitgliedstaaten, wäre dem Integrationsprozess von großem Nutzen. Die Kommission erkannte nun auch, dass ihre Bemühungen um das Vertragsrecht aus einem zu kleinen Blickwinkel gestartet wurden. Nun ist auch schon eine Studie betreffend das Sachenrecht und das außervertragliche Haftungsrecht in Zusammenhang mit dem Vertragsrecht im Vergabestadium. Es ist zu hoffen, dass die Europäische Union ihre Aktivitäten im Bereich des Privatrechts weiter verstärkt.59 Das sechste Forschungsrahmenprogramm der europäischen Union wird sich auch mit der Definition des europäischen Vertragsrechts und seiner Zukunft auseinander setzen. Einer der Programmpunkte des Forschungsrahmenprogramms lautet daher Towards a European Contract Law.60 Die europäische Gesellschaft verlangte nach der Bearbeitung dieses Gebietes, wie es aus den eingelangten Expressions of Interest aus dem Jahr 2002 deutlich wurde.61 Im Februar 2003 erschien als Reaktion auf die erste Mitteilung erneut ein Dokument von der Kommission. Dieses Dokument der Kommission, der sogenannte Aktionsplan zur 56 UNIDROIT Convention on International Interests in Mobile Equipment, signed at Cape Town on 16 November 2001. 24 Staaten habe diese neue Konvention schon unterzeichnet. Auch die Europäische Union erwägt einen Beitritt. 57 So z.B. Reiner Schulze, Auf dem Weg zu einem europäischen Zivilgesetzbuch?, NJW, 1997, 50(41), S. 2742 ff. 58 Als Vorbild dient hier das American Law Institute. Ole Lando in Evolutionary Perspectives and Projects on Harmonisation of Private Law in the EU, EUI Working Papers, Law No. 99/7, S. 50 und Pierre Larouche, Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe, EUI Working Papers, Law No. 99/7, S. 120 f. 59 Auf der europäischen Agenda steht derzeit auch eine Erneuerung des Konsumentenkreditrichtlinie 87/102 EEC. Siehe EU Institutions press releases, Consumer credit rules for the 21 st century, IP/02/1289 vom 11/09/2002. 60 Siehe www.cordis.lu. 61 Diese Expressions of Interest sind auch über die Website www.cordis.lu abrufbar. Schaffung eines kohärenteren europäischen Vertragsrechts,62 wird derzeit in ganz Europa diskutiert.63 Er sieht eine Ausarbeitung eines Gemeinsamen Referenzrahmens innerhalb des 6. Forschungsrahmenprogramms vor.64 c. Das Problem der europäischen Juristenausbildung Auf vielen Ebenen findet die Forschung zu einem europäischen Privatrecht statt. Daher ist vor allem auch eine Reform der Juristenausbildung nötig, um so eine verstärkte internationale Ausrichtung zu ermöglichen. Es ist offensichtlich, dass in den meisten Universitätsstudienfächern eine internationale Ausrichtung vorhanden ist, so in Fächern wie Archäologie, Kunstgeschichte, Philosophie, Chemie bis hin zu Medizin. In der Rechtswissenschaft ist das nicht so. Erst langsam ist sie im Begriff einen Internationalisierungsprozess durchzuführen, den ihre Grundlagenfächer und sozialwissenschaftlichen Nachbardisziplinen bereits hinter sich gebracht haben.65 Außerdem ist die juristische Ausbildung weitgehend positivistischer Natur.66 Diese Einschränkung erschwert eine interdisziplinäre Zugänglichkeit der Materie. Innerhalb der Rechtswissenschaft liegt im Internationalisierungsprozess eine große Chance für die Rechtsvergleichung. Die Rechtsvergleichung darf keine Minderwertigkeitskomplexe gegenüber denjenigen Wissenschaften haben, die schon immer die Vergleichung praktizierten. Vielmehr sollte die Rechtsvergleichung interdisziplinär von den Erfahrungen anderer Wissenschaften profitieren.67 In den letzten zweihundert Jahren gab es im Prinzip genauso viele Rechtssysteme in Europa wie es auch Nationalstaaten gab. Die Grenzen juristischer Ausbildung waren identisch mit jenen der politischen Außengrenzen. Die Österreicher benutzten ihr Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, während dagegen die Italiener auf ihren Codice Civile angewiesen waren. In England wandte man sich dagegen dem guten alten common law zu. Die verschiedenen Rechtssysteme brachten auch verschiedene Ausbildungen mit sich und unterschiedliche Anforderungen zum Berufseintritt.68 So kommt es, dass ein österreichischer Magister iuris mit acht Semestern Studium einem deutschen Volljuristen gleichgestellt ist, 62 Eine Besprechung erfolgte durch Viola Heutger, Ein kohärenteres europäisches Vertragsrecht, Jusletter, 17. Februar 2003, www.jusletter.ch. 63 So fanden im April 2003 eine Tagung in der Europäischen Rechtsakademie (siehe www.era.de) statt. Im Juni 2003 lud die Europäische Kommission zu zwei Workshops nach Brüssel ein, um mit Stakeholdern, Vertretern von Regierungen und Vertretern von verschiedenen Interessengemeinschaften, sowie Wissenschaftlern die Inhalte des Aktionsplanes zu besprechen. Im Mittelpunkt der Aktivitäten steht derzeit die Füllung eines gemeinsamen Referenzrahmens, der den Weg zu einem kohärenteren Vertragsrecht weisen soll. 64 Zur Vorbereitung fand ein Workshop bei der Kommission statt. http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/workshop_en.htm 65 Christian Joerges, Die Wissenschaft vom Privatrecht und der Nationalstaat, EUI Working Papers, Law, No. 98/4, S. 124. 66 Martijn Hesselink, The New European Legal Culture, Kluwer, Deventer 2001, S. 17. 67 Rodolfo Sacco, Einführung in die Rechtsvergleichung, Nomos, Baden-Baden 2001, S. 21. 68 Reinhard Zimmermann, Roman Law and European Legal Unity, in Hartkamp/Hesselink/Hondius, Towards a European Civil Code, S. 24. der auch noch ein zweijähriges Referendariat69 absolvieren musste, wenn es zu europäischen Ausschreibungen kommt.70 Inhaltlich sind die Ausbildungen auch sehr unterschiedlich. Während Österreich und die romanischen Länder noch eine profunde rechtshistorische Ausbildung voraussetzen, gilt diese z.B. in Deutschland als unmodern und überflüssig. Das Europarecht hat sich überall seinen Platz mühevoll erkämpfen müssen. Allerdings wird in der Lehre mehr auf die Vertragsstruktur und die Institutionen wert gelegt, als auf den Inhalt der Richtlinien. Formmässig werden nun viele europäischen Studiengänge in die Gestalt von Bachelor und Masterphasen gesteckt, inhaltliche Unterschiede bleiben aber weiter bestehen.71 Zwar unterrichten an fast allen europäischen Fakultäten nun auch ausländische Gastprofessoren, allerdings handelt es sich dabei meist nicht um prüfungsrelevante Fächer und von einer europäischen Dimension des Jurastudiums kann man nicht überall sprechen. Hier besteht Handlungsbedarf. Der fremdsprachliche Unterricht an den Universitäten sollte erweitert und verbessert werden und auch ein gemeinsames Studium von europäischer Rechtsliteratur wäre sinnvoll. Werke wie die Principles of European Contract Law verstärken das Rechtsverständnis des europäischen Vertragsrechts und sollten mehr in die Lehre eingebunden werden. d. Die Gestalt der entstehenden europäischen Privatrechtsprodukte Noch fehlen dem Europäischen Privatrecht die gewachsenen Wurzeln einer eigenen Rechtskultur. Das wird deutlich, wenn man die verschiedenen Gruppierungen betrachtet, die an einer Rechtsvereinheitlichung arbeiten. Das Spektrum ist sehr weit gefächert von der Forderung nach einem Zivilgesetzbuch, wie es die Study Group on a European civil Code für die Zukunft verlangt, bis hin zu einem Forum, das nur Diskussionsanstöße geben will, wie die SECOLA72. Einen eigenen Weg geht Gerrit de Geest, der eine umfassende Kompilation aller Normen in Europa als Cyber Code will, mit einer opting out Möglichkeit der einzelnen Staaten.73 Eine Mindermeinung unter den europäischen Privatrechtswissenschaftlern spricht sich gegen eine zukünftige europäische Rechtsvereinheitlichung aus. Diese Gruppe wird angeführt von Legrand und ihm folgt Smits. Beide verfolgen den Ansatz, dass eine Rechtsvereinheitlichung praktisch nicht durchführbar sei und darüber hinaus auch kulturell nicht wünschenswert sei.74 69 Das Referendariat gilt bereits als Berufserfahrung. 70 Dieses Beispiel wurde von einer Ausschreibung zum Übersetzer von Rechtstexten des Europäischen Gerichtshofes in Luxemburg übernommen. Als Anstellungserfordernis wurde dort der österreichische Magister Iuris erwartet und äquivalent für Deutschland das 2. Staatsexamen. 71 Fast alle Länder ziehen mit, nur Deutschland will hier wieder einmal einen Sonderweg gehen und hält am Staatsexamen fest. 72 Secola ist die Abkürzung für Society of European Contract Law. Eine Übersicht über den Stand der Diskussion für und gegen ein Europäisches Zivilgesetzbuch in S. Grundmann/J. Stuyck (Hrsg.), An Academic Green Paper on European Contract Law, Kluwer Law International, The Hague, 2002. 73 Gerrit de Geest, Comparative Law and Economics and the Design of Optimal Doctrines, in Bruno Deffains/Thierry Kirat (Hrsg.), Law and Economics in Civil Law Countries, JAI (Elsevier), New York 2001, S. 107-124. Weitere Argumente bei Vincenzo Zeno-Zencovich, The ‘European Civil Code’: European Legal Traditions and Neo-Positivism, in Alpa/Buccico, Il Codice Civile Europeo, S. 375 ff. 74 Es ist auch festzustellen, dass die verbraucherpolitisch motivierten Sondergesetze als Bedrohung der Einheit des Privatrechts angesehen werden75 und zu einer Rechtszersplitterung führen. Häufig überstürzt wurden Verbrauchergesetze erlassen. Für diese war systematisch gesehen kein Raum in den nationalen Gesetzen. Auf europäischer Ebene wurde das Verbraucherproblem nicht besser gelöst und eine Vielzahl von Richtlinien wurde erlassen, die keine Einheitlichkeit erkennen ließen. Die derzeitige Vielgestaltigkeit und Rechtszersplitterung ist auf lange Zeit gesehen nicht wünschenswert. Rechtssicherheit ist nur durch Deutlichkeit und gute Zugänglichkeit zu den Rechtsquellen garantierbar. Daran sollte gearbeitet werden, auf diesem Weg könnte ein European Law Institute hilfreich sein, um den Bestand zu sichten, Vorschläge auszuarbeiten und Informationen zu geben. 8. Ausblick Juristen leben mit ständigen Veränderungen. Die Europäische Union führt in keiner Weise zu einer Vereinfachung des Rechtslebens. Es wird immer kompakter und vielschichtiger. Handlungsbedarf ist gegeben. Juristen aller EU-Mitgliedstaaten sollte die Gelegenheit gegeben werden, gestalterisch an einer Rechtsharmonisierung in Europa mitzuwirken. Die Vereinheitlichung des Rechts hat ihren Preis. Ein Gesetzbuch oder ein freiwilliges Rechtsinstrument, dass entwickelt würde, um ein einheitliches Recht zu schaffen, muss zwischen vielen bestehenden Rechtssystemen auswählen, dabei Regeln sowohl beseitigen als auch neu schaffen. Hierbei sollte man auch nicht davor zurückschrecken der akademischen Welt einen neuen Platz einzuräumen. Auf akademische Initiative hin ausgearbeitete Grundsätze sollten nicht gleich wegen fehlender Legitimation verdammt werden.76 Rodolfo Sacco schuf aus seinen Erfahrungen als Rechtsvergleicher drei Schlussfolgerungen: Juristen müssen jegliche Vorstellung, das Recht sei unveränderlich, ad acta legen. Der Glaube an die Verschiedenheit hindert nicht daran, zugleich auch an die Einheitlichkeit zu glauben. Der Glaube an die Einheitlichkeit verlangt nicht, um der Einheitlichkeit willen auf den Fortschritt, d.h. die Veränderung zu verzichten.77 Die Durchsetzung von Rechten würde darüber hinaus noch weiter erleichtert werden, wenn die Juristenausbildung den Gebrauch eines gemeinsamen europäischen Rechtsvokabulars fördern würde. Dies könnte erreicht werden, wenn das Recht eines Landes sowohl für einheimische Jurastudenten, als auch für Gaststudenten in mindestens zwei Sprachen, z.B. der Sprache des Gastlandes und englisch, gelehrt würde. Eine europäische Instanz, wie z.B. ein European Law Institute, könnte die Integrationsarbeit erheblich unterstützen. Solch eine Einrichtung könnte eine Fülle von Aufgaben verrichten, von Sichtung und Sammlung des bisherigen Bestandes von EUGesetzgebung und nationaler Rechtslage, bis hin zur Entwicklung von Modellrechten, sprachlicher Mitprägung des europäischen Rechtsvokabulars und Verbreitung von Informationen. Eine eventuelle spätere Rechtsvereinheitlichung könnte im Rahmen eines Institutes vereinfacht werden und der Vorgang selber würde dadurch transparenter. Vor allem durch die Richtlinien zum Verbraucherschutz wurde in den letzten Jahren 75 Weitere Nachweise bei Christian Joerges, Die Wissenschaft vom Privatrecht und der Nationalstaat, EUI Working Papers, Law. No. 98/4, S. 111. 76 Siehe z.B. Yves Lequette, Quelques remarques à propos du projet de code civil européen de M. von Bar, Le Dalloz, 2002, Nr. 28, S. 2202-2214. 77 Sacco, Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 161. europäische Integrationsarbeit im Bereich des Privatrechts geleistet.78 Einheitliche Vertragsrechtsgrundsätze (Principles), die europaweit anerkannt werden, würden die bisherige Integrationsleistung noch erheblich erhöhen. Die Nähe des Privatrechts zum Bürger und dessen ständige Konfrontation damit macht das Privatrecht besonders geeignet einen gemeineuropäischen Weg zu beschreiten. Jeder Käufer hat nun die Wahl seine Waren im Inland zu kaufen, diese im Ausland zu erwerben oder im Internet, meist grenzüberschreitend, zu bestellen. Gleiches gilt auch immer häufiger für Dienstleistungen. Identifikation durch ein gemeinsames Recht scheint möglich. Ein Unionsbürger, der mit Euro zahlt, sollte auch gleiche Gewährleistungsrechte für die gekaufte Ware in den Unionsländern erwarten können und somit ein einheitliches europäisches Kaufrecht.79 Ein gemeineuropäisches Privatrecht sollte nicht auf Konsumentenschutz beschränkt bleiben, sondern weit über das gesamte Vertragsrecht ausgeweitet werden und eventuell später auch noch Teile des Familienrechtes einbeziehen. Durch seine Nähe zum Bürger kann das Privatrecht besonders im Rahmen der Europäischen Integration als Instrument der Einigung eingesetzt werden. Mit kaum einem anderen Rechtsbereich kommt der europäische Bürger so oft in Berührung. Außerhalb des Gesetzgebers gibt es auch Raum zur Partizipation aller Interessierten. Der derzeitige acquis communautaire ist noch weiter ausbaubar und keinesfalls abgeschlossen. Der Entstehungsprozess eines europäischen Privatrechtes sollte durch eine Institution begleitet werden und akademische Gruppierungen, Verbraucherverbände und Wirtschaftsverbände sollten an der Diskussion beteiligt werden.80 Das wachsende europäische Privatrecht begegnet dem Bürger auch in Alltagsgeschäften und ist für ihn nichts Fernes aus Brüssel. Auf akademischer Ebene arbeiten verschiedene Gruppierungen an seiner Vereinheitlichung und wollen durch Partizipation am Entstehungsprozess teilhaben. Wie kein anderes Rechtsgebiet lädt das Privatrecht die Bürger Europas zu seiner Gestaltung ein. Diese Entwicklungen sollte die Europäische Kommission auf eine positive Weise unterstützen. Durch die lange Erfahrung des Privatrechts als Lehrgegenstand, bereits im Mittelalter in Form des gemeineuropäischen Studiums der Privatrechtskasuistik des Corpus Iuris, kann das Privatrecht auf eine lange Tradition in Anwendung und Ausbildung zurückblicken, die anderen Gebieten verschlossen bleibt. Ein europäisches Privatrecht ist im höchsten Masse wünschenswert und sollte die Zukunft Europas mit prägen. 78 Einen Überblick über bestehende Projekte und Entwicklungen bietet Brigitta Lurger in ihrem Buch Grundfragen der Vereinheitlichung des Vertragsrechts in der Europäischen Union, Springer, Wien/New York, 2002. 79 Die Study Group on a European Civil Code arbeitet an einem europäischen Kaufrecht; siehe Viola Heutger, Konturen des Kaufrechtskonzeptes der Study Group on a European Civil Code. Ein Werkstattbericht, European Review of Private Law (ERPL) 2003, Nr. 2, S. 155-173. 80 Diese Forderung wurde auch vom europäischen Parlament teilweise ausgesprochen. (COM(2001) 398 C5-0471/2001 - 2001/2187(COS)).