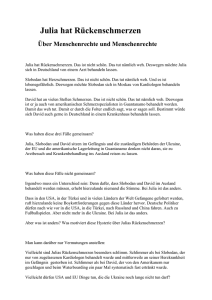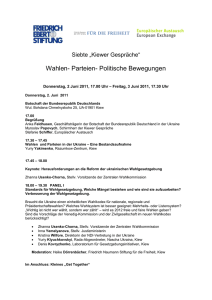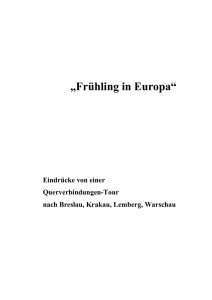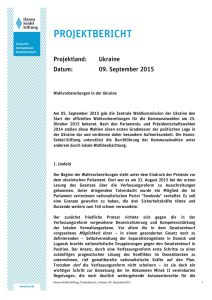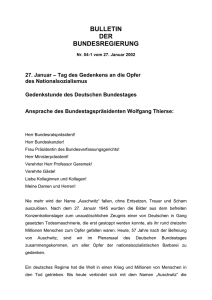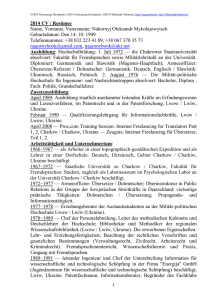DIE ERFAHRUNG EUROPAS Zweitausend Kilometer in zehn Tagen
Werbung
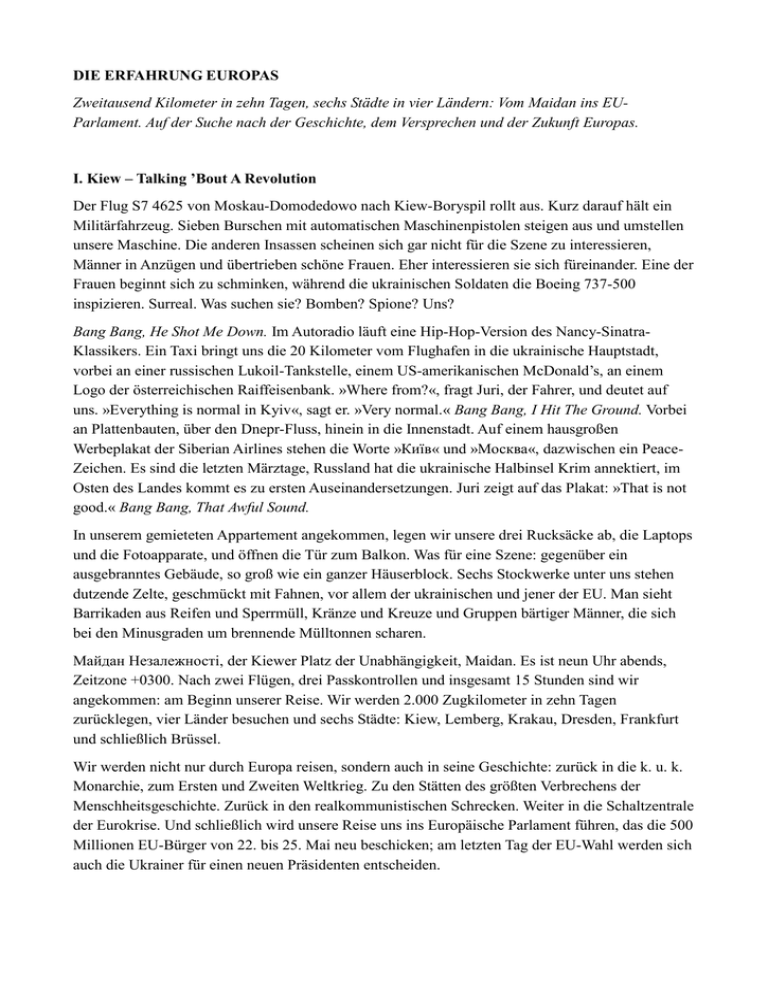
DIE ERFAHRUNG EUROPAS Zweitausend Kilometer in zehn Tagen, sechs Städte in vier Ländern: Vom Maidan ins EUParlament. Auf der Suche nach der Geschichte, dem Versprechen und der Zukunft Europas. I. Kiew – Talking ’Bout A Revolution Der Flug S7 4625 von Moskau-Domodedowo nach Kiew-Boryspil rollt aus. Kurz darauf hält ein Militärfahrzeug. Sieben Burschen mit automatischen Maschinenpistolen steigen aus und umstellen unsere Maschine. Die anderen Insassen scheinen sich gar nicht für die Szene zu interessieren, Männer in Anzügen und übertrieben schöne Frauen. Eher interessieren sie sich füreinander. Eine der Frauen beginnt sich zu schminken, während die ukrainischen Soldaten die Boeing 737-500 inspizieren. Surreal. Was suchen sie? Bomben? Spione? Uns? Bang Bang, He Shot Me Down. Im Autoradio läuft eine Hip-Hop-Version des Nancy-SinatraKlassikers. Ein Taxi bringt uns die 20 Kilometer vom Flughafen in die ukrainische Hauptstadt, vorbei an einer russischen Lukoil-Tankstelle, einem US-amerikanischen McDonald’s, an einem Logo der österreichischen Raiffeisenbank. »Where from?«, fragt Juri, der Fahrer, und deutet auf uns. »Everything is normal in Kyiv«, sagt er. »Very normal.« Bang Bang, I Hit The Ground. Vorbei an Plattenbauten, über den Dnepr-Fluss, hinein in die Innenstadt. Auf einem hausgroßen Werbeplakat der Siberian Airlines stehen die Worte »Київ« und »Москва«, dazwischen ein PeaceZeichen. Es sind die letzten Märztage, Russland hat die ukrainische Halbinsel Krim annektiert, im Osten des Landes kommt es zu ersten Auseinandersetzungen. Juri zeigt auf das Plakat: »That is not good.« Bang Bang, That Awful Sound. In unserem gemieteten Appartement angekommen, legen wir unsere drei Rucksäcke ab, die Laptops und die Fotoapparate, und öffnen die Tür zum Balkon. Was für eine Szene: gegenüber ein ausgebranntes Gebäude, so groß wie ein ganzer Häuserblock. Sechs Stockwerke unter uns stehen dutzende Zelte, geschmückt mit Fahnen, vor allem der ukrainischen und jener der EU. Man sieht Barrikaden aus Reifen und Sperrmüll, Kränze und Kreuze und Gruppen bärtiger Männer, die sich bei den Minusgraden um brennende Mülltonnen scharen. Mайдан Незалежності, der Kiewer Platz der Unabhängigkeit, Maidan. Es ist neun Uhr abends, Zeitzone +0300. Nach zwei Flügen, drei Passkontrollen und insgesamt 15 Stunden sind wir angekommen: am Beginn unserer Reise. Wir werden 2.000 Zugkilometer in zehn Tagen zurücklegen, vier Länder besuchen und sechs Städte: Kiew, Lemberg, Krakau, Dresden, Frankfurt und schließlich Brüssel. Wir werden nicht nur durch Europa reisen, sondern auch in seine Geschichte: zurück in die k. u. k. Monarchie, zum Ersten und Zweiten Weltkrieg. Zu den Stätten des größten Verbrechens der Menschheitsgeschichte. Zurück in den realkommunistischen Schrecken. Weiter in die Schaltzentrale der Eurokrise. Und schließlich wird unsere Reise uns ins Europäische Parlament führen, das die 500 Millionen EU-Bürger von 22. bis 25. Mai neu beschicken; am letzten Tag der EU-Wahl werden sich auch die Ukrainer für einen neuen Präsidenten entscheiden. Eine solche Geschichte über Europa, die auch die Geschichte Europas erzählen will, kann im Frühjahr 2014 nur hier beginnen, am Maidan. An jenem Ort, an dem die EU vor wenigen Monaten eine Kettenreaktion mitangestoßen hat. Seither definiert sich ihr Verhältnis zu Russland neu – aber auch jenes von Europa zu sich selbst. Am Morgen nach unserer Ankunft spazieren wir über den Maidan, vorbei an Männern in Tarnkleidung, die eine Barrikade bewachen. Ausdruckslose Gesichter, dampfende Kessel und raue Hände, die Erdäpfel schälen. Es seien nur noch die hier, die kein Zuhause haben, in das sie zurückkehren können, erzählt uns ein Freund, der die vergangenen Monate hier verbracht hat. Er beschreibt die Atmosphäre am Maidan so: Vor zwei Monaten seien die Menschen todernst gewesen, vor einem Monat stolz, jetzt seien sie planlos. Es fehlt ihnen der Boden unter den Füßen, buchstäblich. »Unter dem Pflaster liegt der Strand«, haben die Pariser Revolutionäre 1968 skandiert. Realität sieht anders aus: Unter dem Pflaster liegt nackte Erde. Der ganze Maidan sowie angrenzende Straßen wurden während der Revolution gerodet. Alte Frauen haben ihren Beitrag geleistet, indem sie die Pflastersteine mit Meißel und Hammer herausstemmten. Wie man bei einem Brand Kübel voll Wasser von Hand zu Hand reicht, haben damals die Kiewer einander Pflastersteine gereicht, bis vor zur Front; Stein für Stein, um Stück für Stück ihr Land zurückzuerobern. Damals, das war Ende Februar. Am 18. Februar eskalierte die Situation, Scharfschützen löschten in einer Nacht dutzende Menschenleben aus. Drei Monate dauerte die Revolution zu diesem Zeitpunkt schon an, drei Tage später hatte sie ihr erstes Ziel erreicht, Präsident Wiktor Janukowitsch floh aus Kiew. Der Weihnachtsbaum steht noch immer auf dem Platz, haushoch, und ganz oben hängt eine Fotomontage: Sie zeigt Wladimir Putin, den Präsidenten Russlands, mit Hitlerscheitel und Hitlerbärtchen. »Putler« nennen sie ihn hier. Alle paar Meter stapeln sich Blumen, Kerzen und Stofftiere, als Gedenken an die Toten, deren Fotos überall hängen: »Die himmlischen hundert«. Es ist seltsam, wenn Legenden noch jung sind. Man beweint die Toten als mythische Figuren – aber die Erde auf ihren Gräbern ist noch frisch. »Slawa Ukraini«, tönt es von der Bühne des Maidan, »Herojam Slawa«, antworten die uniformierten Männer, die in einer Reihe davor stehen, einfache Leute, die zu Helden wurden. »Ehre der Ukraine – Ehre ihren Helden«, das ist der Slogan dieser Revolution und der Trinkspruch in jedem Kiewer Beisl. Orthodoxe Priester lesen hier Fürbitten, alle paar Tage tritt die ukrainische Sängerin Ruslana auf, die vor zehn Jahren den Eurovision Song Contest gewann, und immer wieder die Nationalhymne: »Noch ist die Ukraine nicht verloren!« Noch nicht. Ukraine, das bedeutet »Grenzland«. Meistens war sie ein Land, auf dessen Boden die Grenzen fremder Mächte verschoben wurden, zwischen polnischen, russischen und österreichischen Herrschern. Die Ukrainer waren ein Volk ohne Staat, bis sie sich 1991 von der Sowjetunion loslösten. Aber Grenzland-Bewohner sind sie immer noch, gerade jetzt zwischen der EU und Russland. Wladimir Putin will die Ukraine nicht ziehen lassen; einen knappen Monat nach dem Sturz Janukowitschs annektierte Russland die Krim, ließ Truppen an der Grenze zur Ostukraine aufmarschieren. In ein paar Wochen werden prorussische Gruppen Regierungsgebäude in ostukrainischen Städten besetzen. Dabei haben die Ukrainer ihre Wahl getroffen, sagt Interimsaußenminister Andri Deschtschyzja: »Die Wahl des ukrainischen Volkes ist die EU.« Er ist müde, seine Augen sind rot, gerade ist er aus New York zurückgekehrt. Deschtschyzja war Botschafter seines Landes in Finnland und Island, nicht einmal besonders bedeutende Länder. Jetzt aber, jetzt telefoniert er mit US-Außenminister John Kerry, er war in Wien, als die OSZE beschloss, eine Beobachtermission in die Ukraine zu entsenden, und hat in Brüssel die EU-Außenminister getroffen. Der ehemalige Diplomat wurde unvermittelt auf die Weltbühne gestoßen, er wirkt bemüht, angestrengt, überfordert. Er steht im dritten Stock des Hotels Ukraine mit Blick über den Maidan, dessen Lobby während der Revolution als Lazarett diente. Jetzt ist hier das »Ukraine Crisis Media Center« eingerichtet, stündlich werden Pressekonferenzen abgehalten. Eine Übergangsregierung wurde eingesetzt, um die Zeit bis zur Präsidentschaftswahl Ende Mai zu überbrücken; ihre Mitglieder sind alte Kader aus den Oppositionsparteien und politisch unerfahrene Veteranen vom Maidan, nicht gewählt und nicht zu beneiden: Sie müssen unangenehme Reformen durchsetzen, sich mit dem Verlust der Krim und den Reibereien im Osten des Landes herumschlagen. Und vermutlich werden sie nach der Wahl abgesetzt und ausgetauscht. Die Zukunft der Ukraine, auch das ist ein Problem, gehört denselben wie die Vergangenheit. Vor der prächtigen Kulisse der Sofienkathedrale, unweit des Maidan, startet Julia Timoschenko in ihren Präsidentschaftswahlkampf. Sie wirkt angeschlagen, auf der Bühne stehen mehr als ein dutzend Menschen, dafür ist es davor erstaunlich leer. Der Platz ist nicht einmal halb gefüllt, etwa tausend Menschen sind gekommen. Die »Julia, Julia«-Rufe ertönen zaghaft, ein paar alte Frauen, sie stellen die Mehrheit hier, rufen »Julia, die Frauen sind mit dir«. Euphorie hört sich anders an. Julia Timoschenko war die Heldin der Orangen Revolution 2004. Damals stand die Zivilgesellschaft nach gefälschten Wahlen zum ersten Mal am Maidan und jagte Präsident Wiktor Janukowitsch zum ersten Mal aus dem Amt. Aber heute ist Timoschenkos Glanz verblasst, dabei wäre sie so gerne eine Märtyrerin. Janukowitsch warf sie 2011 ins Gefängnis, am 22. Februar kam sie frei, demselben Tag, an dem er abgesetzt wurde. Das politische System der Ukraine erinnert an eine Dailysoap im Nachmittagsprogramm. Die Akteure bleiben stets dieselben, ebenso ihre Motive: Macht, Reichtum, Rache. Sie wechseln Seiten und Allianzen, spinnen Intrigen, tauchen plötzlich aus dem Nichts wieder auf – und das ukrainische Volk muss zusehen, an den Fernsehsessel gefesselt, die Fernbedienung außer Reichweite. Daran hat auch die Revolution nichts geändert, und Timoschenko ist nur ein Beispiel dafür. Pedro Poroschenko, in den Umfragen vor Timoschenko Favorit für die Präsidentschaftswahl, ist ein anderes, vielleicht noch besseres: Der als »Schokoladenkönig« bezeichnete Oligarch soll über ein Privatvermögen von mehr als 1,6 Milliarden Dollar verfügen; seine »Roschen«-Schokolade liegt in allen Supermärkten, er besitzt ein Medienimperium und ein Rüstungsunternehmen. 2001 war er stellvertretender Vorsitzender der »Partei der Regionen« des soeben gestürzten prorussischen Wiktor Janukowitsch, 2004 aber unterstützte er die Orange Revolution gegen ihn und wurde in der Folge Vorsitzender des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats, bis er sich mit der damaligen Premierministerin Timoschenko zerstritt, um 2009 dennoch unter ihr Außenminister zu werden. Bereits ein halbes Jahr später trat er wieder ab, nur um 2012 unter Janukowitsch ein Comeback als Wirtschaftsminister zu feiern. Er blieb wiederum nur kurz, dann schlug er sich auf die Seite der Maidan-Bewegung; der ehemalige Boxweltmeister Witali Klitschko verzichtete gar auf eine eigene Kandidatur bei der Präsidentenwahl, um Poroschenko zu unterstützen. Aber zahlt es sich aus, für Leute wie Timoschenko und Poroschenko auf die Straße zu gehen; ist es hundert Tote wert, nur dass am Ende wieder dieselben Namen auf den Stimmzetteln stehen werden? »Wir sollten zuerst mit ein paar Missverständnissen aufräumen«, sagt Natalja Gumenjuk. 13 Stockwerke über Kiew, es ist spätabends, die Autobahnen ziehen leuchtende Furchen durch die Stadt. Gumenjuk, 28, ist leitende Redakteurin bei Hromadske TV, dem Fernsehsender der Revolution. Eine Handvoll Journalisten schloss sich Mitte des Vorjahrs zusammen, um Hromadske TV zu gründen, weil es im bestehenden Angebot nur zwei Möglichkeiten gegeben habe, sagt Gumenjuk: direkte Propaganda zu betreiben oder über unwichtige Dinge zu berichten. Seit dem Sturz Janukowitschs sendet Hromadske mehrere Stunden pro Tag auf den Frequenzen des Staatssenders. Ein großes Missverständnis, sagt Gumenjuk: »Wir haben nicht für die EU demonstriert, sondern für unsere Freiheit. Meinungsfreiheit, Sicherheit, Selbstbestimmung sind nicht exklusiv europäische, das sind humanistische Werte.« In den ersten Wochen habe man sich am Euro-Maidan, wie er anfangs genannt wurde, noch viel erhofft von der EU. Heute spricht man nur mehr vom Maidan und über die Union nicht mehr sehr gut. »Wie viele Tote braucht es denn, bis die EU einschreitet?«, fragt Gumenjuk. »Mussten es wirklich hundert sein?« Die Tür geht auf, es ist Mustafa Najem, Chefredakteur des Senders. Er gilt auch als der Mann, der die Revolution auslöste: Als am 21. November des Vorjahrs bekannt wurde, dass Janukowitsch das Assoziierungsabkommen mit der EU nicht unterschreiben würde, rief Najem auf Facebook dazu auf, am Maidan zu protestieren, hunderte folgten seinem Aufruf. Einen Tag später, am 22. November, ging Hromadske TV im Internet auf Sendung, es sollte der Kanal dieser Revolution werden. »Am zweiten Tag der Aufzeichnungen haben uns 700.000 gesehen«, sagt Najem. Die Grenzen zwischen Journalismus und Aktivismus verschwimmen hier bei Hromadske TV. Abermals geht die Tür auf, Nadeschda Tolokonnikowa und Maria Aljochina setzen sich zu uns. Die beiden russischen Punkmusikerinnen sind bekannt unter dem Namen Pussy Riot und hier, um die Lektionen einer Revolution zu lernen, sagen sie. Hörnchennudeln und gegrilltes Hühnerfleisch werden angerichtet. Vieles von dem, was bei den Gesprächen derzeit gesagt wird, hat man schon nach der Revolution von 2004 gehört – was ist eigentlich der Unterschied zwischen damals und heute? »Damals hat uns die Hoffnung getrieben, dass es besser wird. Diesmal ist es die Angst, es könnte noch schlechter werden«, sagt die Journalistin Natalja Gumenjuk. Ist sie zuversichtlich? »It’s now or never«, sagt sie. »Jetzt oder nie.« Im Kern bestehen die Revolutionäre vom Maidan aus drei Gruppen: Da war der sogenannte Rechte Sektor, also Vertreter nationalistischer Splittergruppen. Dann gab es dieses Heer rauer Männer, sie trugen Bärte, selbst gemachte Tarnuniformen und Baseballschläger. Und dann gab es eben solche wie Gumenjuk: junge Ukrainer, meist Studenten, mehrsprachig, mit Umhängetaschen, Smartphones und Twitter-Accounts ausgerüstet. Die Gespräche mit ihnen sind auch deshalb von solch beiderseitiger Empathie getragen, weil wir schnell auf Gemeinsamkeiten stoßen: Wir lesen mitunter dieselben Bücher, von Kafka bis Andruchowytsch, auch hier hören sie gerne Bob Dylan und streamen Jon Stewart. Doch bald darauf stoßen wir auf den großen Unterschied, auf das, was wir Mitteleuropäer haben und sie wollen: Sicherheit. Die Sicherheit, seine Meinung frei äußern und seine Sexualität frei ausleben zu können. Die Sicherheit, dass man auch morgen noch im selben Land mit denselben Grenzen leben wird. Und die Sicherheit vor den Heckenschützen Janukowitschs und den Panzern Putins. Dinge, die ihre jetzige Regierung, die EU, die USA, die niemand gewährleisten kann. In der Ukraine scheint derzeit nur eines sicher: Nichts ist sicher. Die Ukraine, sie ist nicht nur das Grenzland zwischen der EU und Russland, am Kiewer Hauptbahnhof trifft auch sowjetische Bürokratie auf digitalisierte Dienstleistungsgesellschaft. Am Eingang steht »24/7« geöffnet, also rund um die Uhr, darunter der Zusatz: »Break: 0.00–6.00«. Wir haben unsere Zugtickets online bestellt. Das geht seit 2012, wegen der Fußball-Europameisterschaft ließ Wiktor Janukowitsch die Infrastruktur an westliche Standards anpassen. Wir zeigen der älteren Dame am Schalter – blondiertes hochgestecktes Haar, weiße Spitzenbluse, auf einem Schild vor ihr steht: »A cashier shall not give information« – unsere Reservierungsbestätigung: auf einem iPad. Es ist ein magischer Moment, das zeigt ihr Blick. Unser Zug stammt aus Sowjetzeiten und besteht nur aus zwei Waggons, von Gleis 1 fährt er auf die Minute genau um 22.50 Uhr los und wird sieben Stunden und 36 Minuten später genauso pünktlich in Lemberg einfahren. Er ist gut erhalten, die dicken Teppiche verleihen ihm Wohnzimmeratmosphäre, und für umgerechnet ein paar Cent gibt es ein großes Häferl Tee, grün oder schwarz. Wir wundern uns etwas über die dicken Decken, aber Anastasja, eine Ukrainerin Ende 20 mit offenem Gesicht, interveniert charmant, als wir uns unter die Matratzenauflagen legen. Westler! Uns ist es unangenehm, dass wir so ratlos sind im Umgang mit den lokalen Gegebenheiten. Ihr ist es unangenehm, dass sie kein Smartphone besitzt. Ostler! Zuletzt war sie vor fünf Jahren in der Hauptstadt Kiew. Jetzt fährt Anastasja im Viererabteil mit uns zurück nach Hause in den scheinbar fernen Westen, nach Lwiw, zu Deutsch Lemberg. Diese Gegend der Ukraine ist ukrainisch geprägt, Anastasjas Muttersprache allerdings ist Russisch. Sie sagt, sie fühle sich als Ukrainerin, ihr Vater aber sei Russe. Hat die Ukraine in lediglich einer Generation tatsächlich einen erfolgreichen Nation-BuildingProzess hinter sich gebracht? Ist sie ein Land, in dem sich die Tochter eines Mannes, der sich als Russe sieht, ohne weiteres als Ukrainerin fühlen kann? Oder erzählt Anastasja uns nur das, was solche wie wir gern hören wollen? Zerreißt es die Ukraine gerade entlang von sozialen und geografischen Linien, oder ist es eine Frage des Ethnischen und Nationalen? Vielleicht finden wir in Lemberg Antworten. II. Lemberg – Go West Im Morgengrauen erreichen wir eine andere Welt im selben Land. Lemberg, das klingt schon so, nach Monarchie, nach Joseph Roth und der »Welt von Gestern«, der Stefan Zweig in seinen Memoiren nachtrauert. Und es sieht auch so aus mit seinen kleinen, alten Straßenbahnen, dem Friedhof am Rande der Stadt, auf dessen Grabsteinen noch deutsche Namen zu lesen sind, und dem schummrigen jüdischen Lokal nahe der zerstörten Synagoge, in dem wir mit dem Kellner um den Preis des Essens verhandeln müssen. Die 750.000-Einwohner-Stadt war vor hundert Jahren noch die Hauptstadt Galiziens, Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie; die das Leben, das Denken und die Architektur mitprägte. Heute ist Lemberg eine beschauliche Stadt. Es hat etwas Provinzielles, wie manche Männer ihre Schritte in den spitzen Lackschuhen setzen. Es hat aber auch etwas Elegantes, wie die Lembergerinnen ihre großen Taschen im Armgelenk und ihre feinen Mäntel am belebten Korso präsentieren. Ihre Garderobe ist nicht von der Stange, hier bemüht sich jeder um besondere Stücke. Im ukrainischen Lwiw geht es ums Sehen und Gesehenwerden. Wir spazieren über Kopfsteinpflaster, an etlichen Fassaden hängen EU-Flaggen, als habe sich die Stadt für eine Parade herausgeputzt: Die Blaue mit den gelben Sternen weht von Amtsgebäuden wie dem Lemberger Rathaus, neben Souvenirshops und über Lokaleingängen wie jenem des »Strudel House«. Hier ertönen Walzerklänge, hier werden hervorragender Kaffee und altösterreichische Mehlspeisen serviert. Aber das »Strudel House« ist Folklore und Nostalgie, selbst die Juden im koscheren Restaurant sind gar keine, wir sind auf ein umstrittenes Themenrestaurant hereingefallen. Die Welt von gestern gibt es tatsächlich nicht mehr. Sie ist dem Ersten Weltkrieg zum Opfer gefallen, in dem sich mit dem Zerfall der Donaumonarchie auch die Wege Wiens und Lembergs trennen sollten. Im Großen Krieg starben 17 Millionen Menschen. Es war der bis dahin blutigste Krieg der Weltgeschichte, er nahm vor genau hundert Jahren seinen Anfang. Viele Historiker sehen in ihm den Beginn einer Epoche, die bis zum Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989 andauerte und »das kurze 20. Jahrhundert« markiert: Denn in diesen 75 Jahren verdichtete sich die Geschichte in Europa wie niemals zuvor. Es passierten bis dahin unvorstellbare Gräuel, nicht nur Europa, die gesamte Welt wurde neu geordnet. Lemberg ist das Zentrum des ukrainischen Nationalgefühls. Die oft als rechtsextrem bezeichnete Swoboda-Partei wurde nicht nur hier gegründet, sie hat auch die Mehrheit im Stadtparlament. Aber »prowestlich« und »nationalistisch« ist in der Ukraine nur auf den ersten Blick ein Widerspruch. Patriotismus bedeutet hier Emanzipation von der Übermacht Russlands. Das Verständnis von Nation ist eine der Ungleichzeitigkeiten, die zwischen den Staaten des ehemaligen Ostblocks und Westeuropas geblieben sind. Während in der Europäischen Union viele bereits davon träumen, den Nationalstaat zu überwinden, muss er in der Ukraine erst entstehen; irgendwo zwischen Donezk und Lemberg. »Der Nationalismus in anderen europäischen Ländern ist ein offensiver. Der ukrainische Nationalismus ist ein defensiver, er richtet sich gegen Putin«, sagt die Buchhändlerin Halja Schyjan. Wir flanieren mit ihr und ihrer zehn Monate alten Tochter Theodora durch Lembergs Altstadt, während sie erklärt, warum hier alles so kompliziert ist. In ihrem alten sowjetischen Pass wurde zwischen Staatsbürgerschaft und Volkszugehörigkeit unterschieden; da waren alle sowjetische Staatsbürger, aber sie gehörten zum Volk der Russen, der Polen, waren Juden oder Ukrainer. Jetzt haben sie alle einen ukrainischen Pass, aber eine Nation müssen sie erst werden. Am Kinderwagen Theodoras hängt ein kleiner Stoffvogel in Blau-Gelb, den Farben der ukrainischen Flagge, die gleich daneben festgeknüpft ist. Die polnische Grenze und damit die EU ist nur noch 80 Kilometer entfernt. Das polnische Krakau, gut 350 Kilometer in Richtung Westen, kennt Halja Schyjan besser als Kiew, das im Osten gut 200 Kilometer weiter weg liegt. Vielen ihrer östlichen Mitbürger gegenüber haben die Lemberger einen entscheidenden Vorteil: Weil sie nahe der Grenze wohnen, können sie sogenannte Shopping-Visa in Polen beantragen — und sich von dort aus frei in der Schengen-EU bewegen. »Ich mag Kiew nicht, es ist stressig und fühlt sich fast ein wenig asiatisch an«, sagt Schyjan. Die europäischen Städte hätten eine viel entspanntere Atmosphäre. »Wir waren nie Russen, wir waren immer Teil Europas, Teil der europäischen Kultur«, sagt auch Serhi Kiral, der für den einflussreichen Lemberger Bürgermeister Andri Sadowi arbeitet; »Chief Investment Officer« steht auf seiner Visitenkarte. Er scheint so westlich zu denken, wie sein Titel klingt, trägt helles Hemd und erzählt uns seine Version der Ereignisse der vergangenen Wochen nicht einfach, er verkauft sie uns. Seine Botschaft: Alles wird gut. Die Wunden am Maidan sind noch längst nicht verheilt, die Krim ist gerade erst verloren gegangen, aber Kiral träumt trotzdem bereits von einer rosigen Zukunft seiner Stadt. Eine Konferenzstadt soll sie werden, ein großes Messezentrum will er bauen lassen, ein neues Hotel internationalen Standards wünscht er sich. »Wir sind bereit«, sagt er. Bereit für den Westen, für Investoren, für Liberalisierung. Das soeben unterzeichnete Assoziierungsabkommen reicht ihm längst nicht aus, er will noch mehr. Ein bereits im Vorjahr verhandeltes Luftfahrtabkommen zwischen der EU und der Ukraine soll den Himmel über seinem Land liberalisieren, die Flugpreise drücken und die Auslastung des Lemberger Flughafens steigern, die derzeit bei fünf bis zehn Prozent liegt. Die Erwartungen an die EU, sagt er, seien »extrem hoch«. Der Zug, der uns in diese EU bringen soll, über die Grenze in das vom »Chief Investment Officer« gelobte Land, ist der schönste, in den wir auf dieser Reise steigen werden – sogar die Liegen sind schon überzogen, mit gebügelter Bettwäsche. Zunächst bringt ein Mann in hellblauem Hemd ungefragt drei Halbliterflaschen Wasser herein, nach wenigen Minuten klopft der Nächste an der Tür, er hält in Zellophan verschweißte Croissants in den Händen. Manche von uns schlafen, egal wo sie sind, andere können auch hier nicht loslassen. Zu viele Fragen schwirren im Kopf herum, zu große: Wie ließe sich die Sicherheit, die sie sich hier in der Ukraine so sehr ersehnen, herstellen? Mit Finanzhilfen oder Assoziierungsabkommen alleine ist sie nicht zu erreichen. Wollte die Union der Ukraine Sicherheit gegenüber Russland garantieren, sie müsste ihr wohl den Beitritt anbieten. Die Sicherheit Europas insgesamt würde das aber eher nicht erhöhen. Ein paar Wochen später, zu dem Zeitpunkt sitzen wir längst wieder in unserer Wiener Redaktion, wird Putin die Ukraine vor einem Bürgerkrieg warnen, im Osten werden Kämpfe ausgetragen. Es ist scheinbar verdammter Boden, auf dem wir da unterwegs sind. »Bloodlands« hat sie der Historiker Timothy Snyder genannt, zwischen 1932 und 1945 wurden auf dem Gebiet der Ukraine, Polens und des Baltikums 14 Millionen Menschen ermordet. Lernen wir aus den Gräueln der Geschichte? Kehrt der Kalte Krieg zurück? Kehrt ein Kalter Frieden ein? Gegen Mitternacht klopft es an der Tür. Es klingt nicht nach dem Pochen des Croissant-Mannes, es ist das Hämmern der Staatsgewalt. EU-Außengrenze, Schengen. Eine dicke Frau mit runden Augenbrauen und blonden Stirnfransen steht in Uniform vor dem Abteil, sie will unsere Pässe. Es werden weitere von ihrer Sorte kommen, insgesamt fünf, zuerst Ukrainer, dann Polen, sie bleibt die einzige Frau. Zwei unserer Pässe sind österreichisch, einer kroatisch. Der ist es auch, der die Beamten aufmerksam werden lässt – obwohl seit rund einem Jahr ein EU-Pass. Sie mustern ihn skeptisch, wenden ihn, halten ihn gegen das Kabinenlicht, ziehen ihn durch einen Handscanner. Gehört er einem Eindringling? Ist er überhaupt echt? Fragt man die Grenzbeamten, warum sie so viel über den Zweck der Reise wissen wollen, entschuldigen sie sich freundlich. Sie hätten ihre Anweisungen. Rucksack auf! Sie wühlen darin herum. Sicher ist sicher. Willkommen in EU-Land. III. Krakau – Why Does My Heart Feel So Bad? Wir gehen erst einmal frühstücken. Am Plac Szczepański nahe der Krakauer Innenstadt nehmen wir in der Sonne Platz, die Nacht im Zug fällt von uns ab. Der Kellner trägt ein weißes T-Shirt und Bart; er bringt Kaffee, den flaumiger Milchschaum bedeckt, dunkle Ränder formen ein Herz. Wir kennen derlei Verzierungen aus Kiew und Lemberg, der Kaffee dort schmeckt ebenso hervorragend wie hier. Wir werden noch oft daran denken müssen – denn von Krakau bis Brüssel wird es diesbezüglich nur noch bergab gehen. Krakau ist nach Kiew und Lemberg die erste Erasmus-Stadt unserer Reise, hier leben junge Menschen von überall. Viele Touristen, eine Gruppe Italiener in bunten Turnschuhen, auf der Straße fahren Menschen mit dem Rad – auch das gab es bisher noch nicht. Mit 760.000 Einwohnern ist Krakau nach Warschau Polens zweitgrößte Stadt und historisch von großer Bedeutung. Als es noch Hauptstadt war, bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, galt Polen als mächtiger als Russland. Außerdem wirkte hier 40 Jahre lang Karol Józef Wojtyła, der spätere Papst Johannes Paul II. Ende April wurde er heiliggesprochen, ein wichtiges Ereignis für das katholische Land. Vor zehn Jahren trat Polen der EU bei, seine Entwicklung gilt seither als Erfolgsgeschichte. Das Wirtschaftswachstum liegt weit über dem europäischen Schnitt, Polens Bruttoinlandsprodukt wuchs im Vorjahr viermal so stark wie jenes Deutschlands, sagt Eurostat. Die wirtschaftliche Verflechtung mit dem Nachbarland trägt wesentlich zum Erfolg bei – ähnlich wie bei Österreich. Laut dem nationalen Statistikamt ging im Vorjahr ein Viertel der polnischen Exporte nach Deutschland. Und dennoch gibt es Vorbehalte gegenüber der EU, Umfragen zufolge wenden sich zwei Drittel der Polen gegen die Einführung des Euro. Was jedoch eher auf die derzeitige Eurokrise zurückzuführen ist als auf eine allgemeine EU-Skepsis. Unweit des Wawel, einer Anhöhe inmitten der Stadt, die einst den polnischen Königen als Residenz diente, landen wir im Café Szafe. Es liegt ein wenig versteckt abseits der touristischen Hotspots und wurde von einem Künstlerehepaar gegründet – er schreibt Kinderbücher, sie illustriert sie. Es ist eine kleine Welt für sich, Kleiderkästen sind hier zu Sitzplätzen umfunktioniert, überall stehen Fabelwesen aus Holz herum, und abends hat es geöffnet, »bis die hölzerne Ziege zu Boden gerungen ist«.Chris, der Kellner, spricht seinen Namen auf Englisch aus, das macht er wahrscheinlich immer, wenn »Internationals« am Tresen Platz nehmen. Wir fragen ihn, was das für eine Stadt sei, in die es uns hier verschlagen hat. Zunächst einmal: Es ist immer noch eine Kleinstadt, in der man »an jeder Ecke über eine Ex-Freundin stolpern kann«. Die Vorstellung der Krakauer von Unterhaltung sei es, ein Buch zu lesen und vielleicht abends bei Kerzenschein einem Bluesgitarristen zu lauschen. Viele Briten würden hierherkommen auf der Suche nach der Natürlichkeit des Lebens im Osten, sagt Chris und grinst. An langen Nachmittagen unterhält er hier selbst ernannte Intellektuelle und Künstler, Feingeister und Alkoholiker. Trotzdem, Polen habe sich in den vergangenen Jahren radikal gewandelt. »Mein Vater hat immer gescherzt, dass wir in Polen wohl erst neue Fußballstadien bekommen werden, wenn ich ein alter Mann bin.« Jetzt ist Chris gerade einmal 26, und dank der Fußball-Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine hat das Land vier der modernsten Stadien des Kontinents. Mittlerweile ist Polen schon so sehr Teil der EU, dass die Wahl auch hier kaum mehr jemanden interessiert, sagt Chris, »viele versuchen, die Politik zu ignorieren«. Auf unserer gesamten Reise haben die Menschen kaum Interesse an Europapolitik, von selbst kommen sie nie darauf zu sprechen, und wenn wir sie ansprechen, kommen meist nicht mehr als Allgemeinplätze – oder Ärger und Unverständnis, wie bei Chris. Der ehemalige Kapitän des Fußballnationalteams, Maciej Żurawski, sei jetzt Kandidat für die EU-Wahl, erzählt er. »Er war mein Kindheitsidol, ein intelligenter Fußballer. Aber von Politik hat er keine Ahnung.« Auch er fragt sich, wen er wählen soll, wählen kann. »Ich weiß es noch nicht. Die Leute hier entscheiden sich oft nicht für eine Partei, sondern gegen eine.« Aber die Geschichte habe aus den einst religiös und ethnisch gemischten Gebieten, die heute zu Polen gehören, »einen kulturellen Monolithen gemacht« – so wie nahezu überall in Europa. »Heute leben in Polen 90 Prozent Katholiken, 100 Prozent Polen. Das ist schrecklich«, sagt Chris. Daran habe auch der EU-Beitritt nichts geändert. Es weht hie und da Klezmermusik durch die Gassen, Folklore für die Touristen. Das aktive jüdische Leben ist nahezu vollständig erloschen. Vor der Shoa war jeder vierte Krakauer Jude, ihr Viertel war Kazimierz. Von hier kamen bedeutende Rabbis. Bis heute stehen ihre Synagogen hier, zumindest sie haben die großen Katastrophen überdauert. Wer Kazimierz in südlicher Richtung verlässt und die Weichsel überquert, kommt in den Stadtteil Podgórze, in den die Nazis die Juden gepfercht hatten, um sie von hier aus in den Tod zu schicken. Der Filmregisseur Roman Polanski hatte dieses Krakauer Ghetto als Kind überlebt, seine schwangere Mutter starb in Auschwitz. Und bis heute steht hier auch jene Emailfabrik, die einst dem Deutschen Oskar Schindler gehörte. Er rettete rund 1.200 jüdischen Zwangsarbeitern das Leben, seine Geschichte kennt dank Steven Spielberg die Welt. Das ukrainische Lemberg und das polnische Krakau sind einander optisch und ideell so ähnlich wie Cousinen mit gleicher Frisur. Sie sind miteinander verbunden, in Historie und Schicksal: Lemberg wird zwar oft als k. u. k. Stadt betrachtet, stand aber mit 432 Jahren bis 1772 nahezu dreimal so lang unter polnischer Herrschaft wie unter der Krone der Habsburger. Nach dem Ersten Weltkrieg fiel es zudem wieder an Polen, bis Stalin Lemberg im Zweiten Weltkrieg in die Sowjetunion holte. Die beiden Städte haben nicht nur die gleiche Frisur, sie teilen auch die hässliche Narbe im Gesicht, die ihnen der Zweite Weltkrieg und der Holocaust zugefügt haben. 1939 marschierten NaziDeutschland und die Sowjetunion beinahe gleichzeitig in Polen ein, der Staat hörte auf zu existieren. An den Folgen hat Polen, hat Europa noch immer zu leiden. Das vergangene Jahrhundert schaffte im einst durchmischten Europa ethnisch gesäuberte Landstriche. Es hat die nationale, religiöse und sprachliche Diversität, die autochthone Vielfalt dahingerafft. Komplexe Identitäten, in denen sich unterschiedliche Kulturen in einer Person vereinen, waren einst nichts Außergewöhnliches. Beispielsweise jonglierten die Juden in diesem Teil Europas im Alltag für gewöhnlich mit mehreren Sprachen, Jiddisch, Deutsch, Polnisch und Ukrainisch. Nur musste all das der Gleichförmigkeit und dem Streben nach klarer Dominanz einer Gruppe weichen. In diesem Fall den Deutschen. Deutschland über alles. Wake Me Up Before You Go Go. Im Bus nach Oświęcim dröhnen Wham!. Die Musik erscheint unpassend laut, unpassend fröhlich, und wenn einer der Fahrgäste in einem Gespräch auflacht, will man ihn giftig ansehen. You Put The Boom-Boom Into My Heart. Oświęcim, zu Deutsch Auschwitz, liegt 80 Kilometer westlich von Krakau. Die Fahrt mit dem öffentlichen Kleinbus dauert 100 Minuten, drin sitzen jene, die von Krakau nach Czułówek müssen, von Babice nach Bradlo, die jeden Tag in diesem Bus sitzen. Sie wirken beschwingt oder müde, amüsiert oder unbeschwert, wie Fahrgäste eben so wirken in einem vollbesetzten Bus an einem Dienstag im April. Und dann sind da die anderen, mit schwermütigem Blick, angespannt, andächtig. Es sind die Amerikaner, die Spanier, wir. Zwischen den kleinen Ortschaften mit Einfamilienhäusern ziehen Mischwälder an den Fenstern vorüber, Felder, Bäche und Birkenhaine. Die Sonne scheint matt durch den weiten bedeckten Himmel. Rauchende Fabriksschlote, überwachsene Geleise, und immer wieder Birken. Birkenau. Kreuze am Straßenrand markieren Unfallorte, sie sind geschmückt mit Blumen. Wie viele Blumensträuße bräuchte es für die Ermordeten von Auschwitz? Wenn wir jeden Tag nur eines von ihnen gedenken würden, es wären mehr als dreitausend Jahre. Dreitausend Jahre. Auschwitz. In Auschwitz starben nicht nur 1.300.000 Menschen. Hier starb auch etwas, das Goethe die Idee vom Göttlichen im Menschen genannt hatte. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. AuschwitzBirkenau. Jedes Bild, jeder Gedanke erscheint unpassend. Der Baumarkt von OBI, der Diskonter Netto, die Fastfood-Kette KFC; das Plakat vom Zirkus »Arena«, der hier bald seine Zelte aufschlagen wird, und vor allem die Werbung der Stadtverwaltung: i♥ oswiecimonline.pl. Wir haben in den vergangenen Tagen viel geredet über diesen Besuch in Auschwitz, wie es sein wird, übermüdet nach zwei durchwachten Nächten in Zügen. Und jetzt sitzen wir da und schweigen so laut. Was soll die Erwartung, man würde es den Menschen ansehen, was hier geschehen ist? Der Art, wie sie sich bewegen, wenn sie aus einem Auto steigen oder sich eine Zigarette anzünden? Ist sie selbstgerecht, kindisch? Ist sie menschlich? Die Irritation, als der Bus hält, der Fahrer »Auschwitz« ruft und das Erste, was wir hören, Kinderlachen ist. Die Gaskammern. Die Öfen. Die Folterkeller. Die Menschenställe. Das Haar von 40.000 Frauen. Die Bilder zweigdürrer Körper, übereinandergeworfen wie Abfall. 1,3 Millionen Morde. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Man müsse nach vorne schauen, man muss in der Gegenwart leben, sagt Martha Galiewicz. Sie ist wenige Kilometer von hier geboren, ihren echten Namen will sie nicht in der Zeitung lesen. Martha leitet unsere Führung durch das ehemalige KZ Auschwitz und das angrenzende Vernichtungslager Birkenau. Es sei ihre Pflicht, die Botschaft von Auschwitz weiterzugeben. Das Hauptareal des Konzentrationslagers diente zunächst der polnischen Armee als Kaserne, die Siedlungen des Ortes reichen nahezu an dessen Zäune heran. An diesem warmen Abend drehen vorpubertäre Buben in Trainingsanzügen vor dem Tor ihre Runden auf dem Rad. Es wird unser letztes Bild von Auschwitz. Die Zeit nivelliert alles, ihr ist es egal, was mit den Menschen passiert, die in ihr leben. Jene, die nun hier in den Siedlungen rund um das ehemalige KZ wohnen, haben ihren eigenen Alltag, ihre eigenen Sorgen. Und auch jene, die in Auschwitz dem Tod entgingen, mussten danach irgendwie weitermachen. Sie mussten ihre schmutzige Wäsche waschen, Geld auf die Seite legen und ihre Kinder bei Liebeskummer trösten. Das Leben geht weiter, mit oder ohne uns. Dennoch ist das, was den Opfern in Auschwitz widerfahren ist, nicht verloren. Es wirkt immer noch nach, nicht nur als Warnung. Es reicht auch physisch in das Heute hinein. Auschwitz ist auch ein organischer Ort. Die Erde ist die gleiche wie einst, die Natur ist immer noch dieselbe, die Menschen, die dort starben, sind auf eine Weise dort geblieben. Ihre Asche ruht in einem stillen Teich. Viele ihrer Tagebücher, vermuten Wissenschaftler, liegen noch unter der Erde vergraben. Was wir in den Stunden im Konzentrationslager gesehen haben, verwandelt den überstaatlichen Imperativ »Niemals wieder« in den lebendigen Sinn des vereinten Europa und dessen Aufgabe als Garant für Frieden. Wie sehr dieser auf dem Kontinent gefährdet ist, beweist nicht nur Auschwitz. Die derzeitigen Unruhen im Osten der Ukraine könnten jederzeit in Krieg abgleiten. Wie schnell das geht, lehrt die jüngere Geschichte Europas, etwa der Genozid im bosnischen Srebrenica Mitte der Neunzigerjahre. Bis heute werden dort nahezu täglich menschliche Überreste geborgen. In Kazimierz sind die Lokale an diesem Abend voll, dennoch fühlt sich das ehemalige jüdische Viertel von Krakau nach der Rückkehr aus Auschwitz eigenartig verlassen an. Nicht unwahrscheinlich, dass das Hostel Panda am Plac Nowy, in dem heute Backpacker aus aller Welt zur Musik von Moby tanzen und trinken, einst das Haus frommer Juden war; und dass in jener Dachstube, in der unsere Betten stehen, eine Familie lebte, die in Auschwitz ausgelöscht wurde. Wir müssen an Wien und an unsere eigenen Wohnungen denken. Unter den Koffern, die wir in Auschwitz sahen, fanden sich viele mit Adressen aus unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Lagen auf dem Haufen womöglich auch welche mit unserer Anschrift? IV. Dresden – With God On Our Side Wir kommen ungefähr an der Mitte unseres Weges von Kiew nach Brüssel an und stellen fest: Der Osten Europas ist nirgendwo so ostig wie in Dresden. Hier haben sich Rituale erhalten, die wir in anderen Städten unserer Reise nicht erlebt haben. Zum Beispiel der freitägliche Wochenmarkt vor dem Deutschen Hygienemuseum in der Lingnerallee: Seit der deutschen Wiedervereinigung gibt es diesen Markt, angeboten werden vor allem Produkte, die einst in der DDR zu kaufen waren. Seifen mit dem Namen Atlantik, Gläser mit eingelegten Spreewaldgurken, Hauspatschen und Unterhosen in Dreierpackungen (fünf Prozent Elastan und 95 Prozent Baumwolle). Wer hier durchgeht, fühlt sich wie in einem ausgebleichten Postkartenpanorama, auf dem sich nur noch das Gelb des Löwenzahns wacker hält. Heimeligkeit herrscht in Dresden, freundliches Tratschen scheint jederzeit möglich, Fremde sehen einander länger in die Augen. In Dresden entspinnen sich zufällige Gespräche leichter als anderswo, sei es am Markt oder in den Straßenbahnen. Wir glauben, diese Zugänglichkeit hat etwas mit der Solidarität zu tun, die die DDR ihren Bürgern notgedrungen abverlangt hatte. Womit auch immer es zusammenhängt: In Frankfurt jedenfalls werden wir diese Art von Zuvorkommenheit nicht mehr erleben. Er sei in Breslau geboren und als Kind von dort geflohen, sagt ein Mann mit altmodischer Schiebermütze, der sich zu uns auf die Busbank setzt. Jetzt, wo er alt ist, tun ihm die Füße weh. In der DDR hätten die Leute weniger verdient, sagt er, »aber es war auch alles billiger als heute«. Einst war Breslau deutsches Schlesien, berühmt für seine Kohlegrubenreviere und den besonderen Dialekt, heute ist es Teil von Polen. Samt der Familie sei er damals gegen Kriegsende die mehr als 200 Kilometer mit dem Zug gekommen, sagt der Mann, geradewegs Richtung Westen. Durch die Gitterfenster sah er Leichen, die man in Gruben warf. Er möchte, dass wir sein Alter schätzen, wir spielen auf Zeit, wollen nichts Falsches sagen, denn er sieht dürr und schwach aus. 77, sagt er schließlich. Gut, dass wir gewartet haben. In den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs zerbombten die Alliierten Dresden, da war er noch ein Kind. 25.000 Menschen starben, tagelang brannte die Stadt, sogar die Elbe stand in Flammen. Und doch sieht man heute, wenn man die Brücke über den Fluss überquert und zur Innenstadt blickt, noch Elemente des alten Dresden. Seit dem Wiederaufbau nach der Wende ragt auch wieder die Kuppel der Frauenkirche wie ein gigantischer Schnuller in den diesigen Himmel. Rund 230 Jahre zuvor hatte Friedrich Schiller denselben Blick gewagt und daraufhin, so will es die Erzählung, seine Ode An die Freude verfasst, die wiederum Ludwig van Beethoven in seiner 9. Sinfonie vertonte. Mitte der Achtzigerjahre hat die damalige Europäische Gemeinschaft sie zur Europahymne gemacht. Schiller beflügelte das »Elbflorenz«, wie Johann Gottfried Herder das barocke Dresden nannte. Freude, schöner Götterfunken. Es muss prächtig gewesen sein. Prächtig war auch die Idee von August dem Starken, als er die Frauenkirche im 18. Jahrhundert erbauen ließ: Der protestantische Kurfürst Sachsens konvertierte zum Katholizismus, um sich vom polnischen Adel zu dessen König wählen zu lassen. Es gleicht geradezu einer Staffel: Lemberg unterstand einst Krakau, dieses wiederum Dresden. Es sind Überlappungen von Einflusssphären, Kulturräumen und gemeinsamer Geschichte, die aus der Summe der europäischen Teile ein Ganzes machen. Dass Dresden in der DDR lag und von dieser wiederaufgebaut wurde, kann es bis heute nicht verheimlichen; auch wenn sich die Menschen schon damals die steife Umgebung der Plattenbauten mit illegalen Pfaden durch Wiesen nach ihren Bedürfnissen zurechtbogen, die Fassaden mittlerweile renoviert sind, die meisten Wohnungen über Balkone verfügen und die Flächen dazwischen mit großzügigen Spielplätzen ausgestattet sind. Aber es gibt auch Jahrhundertwende-Viertel wie Neustadt, wo die Soja-Latte-Fraktion ihre Nachmittage verbringt und die genau so auch in Berlin stehen könnten. Der Eindruck vom schönen Nebeneinander unterschiedlicher Wirklichkeiten, die scheinbar unbeeinflusst parallel existieren, verflüchtigt sich jedoch, sobald man sich in den Nordosten der Stadt aufmacht und dem ehemaligen Stasi-Gefängnis und seinen Nebengebäuden näher kommt. Hier lag einst das Zentrum der Staatsgewalt, die Angst davor durchzog Dresden wie ein Pilz. Ein einstöckiges Objekt in der Angelikastraße 4, nur einen Steinwurf vom Stasi-Gebäude entfernt, diente einst dem sowjetischen KGB als Quartier. Hier ging Wladimir Wladimirowitsch Putin fünf Jahre lang ein und aus, damals in der zweiten Hälfte der Achtzigerjahre, als er Agent in Dresden war. Heute ist hier unter anderem die Anthroposophische Gesellschaft Dresden beheimatet und bietet allerlei Selbstfindungsseminare an. Und was aus dem einstigen Agenten Putin wurde – nun, das ist bekannt. Die Freiheit und Sicherheit, die heute im vereinten Deutschland und in Europa so selbstverständlich erscheinen: Ende der Achtzigerjahre waren sie schiere Utopie. Es war der 5. Dezember 1989, an dem sich das Leben von Herbert Wagner verdichtete wie wohl an keinem anderen Tag. Wäre an diesem Tag etwas schiefgegangen, dann hätte es Tote gegeben, oder er selbst wäre ins Gefängnis gewandert, sagt er. Wenn er von diesem Dienstag erzählt, scheint in seiner Erinnerung ein Film abzulaufen, in dem er vor- und zurückspulen und auf Pause drücken kann. Jeden Augenblick hat sein Gedächtnis gescannt und gesichert. »Heute weiß ich, wie es ausgegangen ist«, sagt Wagner. »Doch am Morgen hätte ich nie zu träumen gewagt, was bis zum Ende des Tages noch passieren würde.« In diesen Stunden besetzten in Dresden 5.000 Bürger die Untersuchungshaftanstalt der DDRStaatssicherheit in der Bautzner Straße. Schon lange waren zu diesem Zeitpunkt die Proteste gegen das Regime durch die DDR gegangen; und es war auch schon knapp einen Monat her, dass die Menschen in Berlin über jene Mauer geklettert waren, die Deutschland für 28 Jahre entzweit hatte. Trotzdem traute man sich nicht an die Stasi heran – sie schürte zwar immer die größte Wut, aber auch die größte Angst. Erst am 15. Jänner 1990 sollten ihre Räume in der Hauptstadt Ostberlin okkupiert werden, mehr als einen Monat nach Dresden. Dass am 5. Dezember 1989 Demonstranten die bis dahin gut bewachte und gefürchtete Dresdner Stasi-Zentrale besetzten, dass sich dabei kein einziger Schuss löste, nennt Wagner heute »ein Wunder«. Gekämmte Haare, dunkle Jacke, weißes Hemd: Herbert Wagner scheint ein zurückhaltender Mensch zu sein, nicht nur, was seine Garderobe angeht. Dennoch hat er eine unumstößliche Haltung. Als praktizierender Katholik galt er in der DDR als »religiös gebunden«, wie man das damals ausdrückte. Aber gerade christlicher Aktivismus war für die Wende prägend, Kirchen dienten als Orte politischer Versammlungen und des Widerstands. Wagner organisierte mit anderen die Dresdner Montagsdemonstrationen und wurde Mitglied der »Gruppe der 20«, jener Schlüsselakteure, die mit dem damaligen Regime in Dialog traten. Die Dynamik der Wende war unvorhersehbar – und dass sie aus Herbert Wagner eine Führungsfigur machen würde, wohl ebenso. Nach dem Umbruch sollte er mehr als zehn Jahre lang bis 2001 für die CDU Oberbürgermeister von Dresden sein. Auch Verwandte seiner Frau hielt die Stasi an diesem Ort, in jenen Zellen der Untersuchungshaftanstalt gefangen. Die Schlüssel dafür trägt er heute in seinen Taschen, Wagner engagiert sich mittlerweile ehrenamtlich in der Gedenkstätte. Im ehemaligen Hauptgebäude, einem kantigen Kasten, ist vieles noch so, wie es früher war: zwei Haftanstalten mit Zellentrakten in den Kellergeschoßen, Verhörräume und Büros in den oberen Stockwerken, in der Mitte ein Festsaal samt Bühne mit zwei grauen Röhrenfernsehern an den Wänden, rundherum steife Vorhänge in trübem Orange. Manchmal würden auch jene diesen Ort besuchen, die hier einmal hauptamtlich für die Stasi gearbeitet haben, »um nachzuspüren, ob uns die kleinste Unkorrektheit unterläuft, und uns dann der Geschichtsfälschung in einem ›Gruselkabinett‹ zu bezichtigen«, sagt Wagner. »Und natürlich haben sie keine Lust auf unangenehme Fragen von Freunden und Familie, um sich dann für ihr Tun in der Diktatur rechtfertigen zu müssen.« Bekennen und Bereuen einer Schuld, das sei einem im gesellschaftlichen Klima nach der Wende auch nicht leicht gemacht worden, sagt Wagner. Viele, die dem Regime folgten, steckten nach dessen Untergang den Kopf in den Sand und hofften, dass der Kelch an ihnen vorübergehen möge. Nicht zuletzt, weil die Menschen sahen, was mit Leuten passierte, deren DDR-Verflechtungen öffentlich wurden: Im neuen gemeinsamen Deutschland wurden sie durchs Dorf getrieben. »Da hätte ich mir mehr Aussprache und Versöhnung gewünscht«, sagt Herbert Wagner. »Wir alle müssen einander mehr Chancen geben.« V. Frankfurt – Dance The EZB Die große Erzählung der Wiedervereinigung endet aber nicht in Dresden, sondern in Frankfurt. Und sie geht weit über Deutschland hinaus, sie sollte ganz Europa verändern. Nicht nur der Sozialismus, die Mauer und der Eiserne Vorhang sind Geschichte, sondern in 18 EU-Ländern auch nationale Währungen. Die Einführung des Euro ist eng verknüpft mit der Wiedervereinigung. Sie ist das Ergebnis von Verhandlungen zwischen Frankreich und Deutschland, den beiden großen Mächten Europas, den ehemals erbitterten Feinden – vor allem von François Mitterrand und Helmut Kohl, den historischen Figuren dahinter. Man hat das Bild vor sich: zwei ältere Männer, Hand in Hand, im Regen von Verdun. Frankreich unterstützte Deutschland bei der Wiedervereinigung; Deutschland gab dafür seine harte Währung auf, die Deutsche Mark. In Frankfurt am Main, auch das war Teil des Paktes, sollte die Europäische Zentralbank stehen, hier sollte über die Geldpolitik der EU entschieden werden. Es war nicht Kommissionspräsident José Manuel Barroso, auch nicht Ratspräsident Herman Van Rompuy, sondern EZB-Chef Mario Draghi, der am 26. Juli 2012, dem Höhepunkt der Krise, verkündete, es werde »alles Notwendige« getan, um den Euro zu retten. Frankfurt ist die vielleicht wichtigste Schaltzentrale in der europäischen Krise, seine Institutionen sind der Garant für die finanzielle Sicherheit Europas. Keine zehn Jahre nachdem der Euro im Jahr 2002 eingeführt wurde, drohte er die Union zu zerreißen. 2010, zwei Jahre nachdem in den USA die Immobilienblase geplatzt war und die Finanzwelt in eine Krise taumelte, war Griechenland pleite, wenig später stürzten auch Spanien, Portugal und Italien in die Krise. Die Sicherheit, der Wohlstand, sogar der soziale Frieden – plötzlich schien alles in Gefahr. Wie konnte der reichste Wirtschaftsraum der Welt so unvermittelt in den Abgrund blicken? Standen wir wirklich vor einer Hyperinflation, müssen wir eine Deflation fürchten? All die Vergleiche mit der Zwischenkriegszeit, mit der dunklen Vergangenheit, durch die wir in den vergangenen Tagen gefahren sind, waren sie berechtigt? Frankfurt ist der Ort, an dem Europa abstrakt und unverständlich wird. Konkret sind nur der beißende Uringestank am Bahnhof und der unrasierte Mann, der um die 1,80 Euro bettelt, die ihm angeblich noch für sein Ticket fehlen. Nirgendwo sonst auf unserer Reise ist die Armut so sichtbar wie hier; auch deshalb, weil die Schere zwischen Arm und Reich nirgendwo sonst so weit auseinanderklafft. Vom Bahnhof führt die Kaiserstraße direkt zum EZB-Tower, vorbei am Rotlichtviertel der sie querenden Moselstraße, vorbei an zwei verwirrten Menschen, die mit der Luft schimpfen, vorbei an einem Juweliergeschäft, vor dessen Eingang ein Drogensüchtiger auf dem Boden liegt und ihn blockiert, weshalb ihn zwei Polizisten mit babyblauen Handschuhen weg von der Tür und vor eine Auslage ziehen. Der in den Himmel ragende Euro-Tower mit dem überdimensionalen Eurozeichen davor ist zum Symbol für das Europa des Finanzkapitals geworden, ein 148 Meter hoher Reibebaum für alle Linken und Globalisierungskritiker. Im Gegensatz zu rechtspopulistischen Parteien lehnen sie nicht den Euro prinzipiell ab, sondern die Geldpolitik in der Union. In einer Krise, die in abstrakten Sphären begann, bevor sie reale Auswirkungen hatte, in der mit unvorstellbaren Zahlen und virtuellem Geld hantiert wird, ist die EZB ein konkreter, greifbarer Feind. Sie versorge Banken mit billigem Geld, während sie durch ihre Geldpolitik die Südländer zu drastischen Sparmaßnahmen zwinge, sei also aufseiten der Banken, nicht der Menschen. Im Gegensatz zu den Rechten findet der linke Protest auf der Straße statt, nicht im Parlament. Vor dem Eingang der EZB haben Aktivisten der Plattform »Blockupy« mit Kreide »€mpört €uch« geschrieben, daneben rufen sie zu Aktionen ab dem 15. Mai auf, gerade rechtzeitig zur EU-Wahl. »Unser Kampf ist wie jener der Atomkraftgegner«, sagt Sybille von Foelkersamb, pensionierte Journalistin und eines von fünf Mitgliedern des Organisationskomitees von Attac in Frankfurt. Sie hatten gewarnt vor der großen Katastrophe, und niemand hörte auf sie. Dann kam die Krise, aus dem Nichts, so wie 1986 plötzlich ein Atomreaktor in Tschernobyl explodierte. Und da wie dort sind die Gefahren unsichtbar, nicht greifbar; aber ihre Auswirkungen sind es. Plötzlich wurde auch Attac ernst genommen und gehört, Vertreter der Organisation durften in keiner Debatte fehlen. Aber jetzt stehen Wahlen an, und über die Krise will niemand mehr sprechen – Attac lädt auch niemand mehr ein. Die von Attac geforderte Finanztransaktionssteuer ist zwar im politischen Mainstream angekommen, aber das, was einige EU-Staaten unter dem Titel einführen wollen, »hat nichts mehr mit der ursprünglichen Idee der Steuer zu tun«, sagt von Foelkersamb. Am Höhepunkt der Krise gab es nicht nur an der Wall Street in New York, sondern auch vor der EZB ein Occupy-Camp mit Aktivisten. »Das Lustige war, dass sie von allen willkommen geheißen wurden. Die Stadt Frankfurt hat sie vor Weihnachten sogar gefragt, ob sie einen Christbaum für ihr Camp haben wollen«, sagt Michael Ziegelwagner, Redakteur des in Frankfurt angesiedelten Satiremagazins Titanic. Auch er war Teil von Occupy, allerdings kein besonders gern gesehener: Die Titanic machte sich damals auf, den antikapitalistischen Protest zu vermarkten, Ziegelwagner verkaufte Kaffeebecher mit dem »Occupy Frankfurt«-Logo und T-Shirts mit Aufschriften wie »Ich habe einen Banker nachdenklich gemacht«. Ziegelwagner lebt seit 2009 in Frankfurt, die Stadt sei »sehr grün, das ist das Positive«. Ansonsten sei es eine »provinzielle Stadt, die sich nur wegen der Hochhäuser großstädtisch anfühlt«. Und es ist eine Stadt, in der sich jene, die nicht in diesen Hochhäusern arbeiten und von dort über die Stadt blicken, die Wohnungen unten nicht leisten können. Frankfurt ist nach München die Stadt mit den höchsten Mietpreisen Deutschlands, überall werden neue Häuser und Viertel aus dem Boden gestampft – und alle sind nach Europa benannt. Aber Europa entsteht hier nicht, Europa wird hier verordnet und gebaut, in einem platten Stil, der fast an ästhetische Gewalt grenzt. Die neuen Straßen heißen Europa-Allee, Brüsseler Straße oder Den-Haager-Straße. Aber sie sind nicht für die Durchschnittsbürger der Union gedacht; hier leben und arbeiten jene, die für das Europa des Kapitals stehen. Rund um den EZB-Neubau soll ein ganzer Stadtteil entstehen, das sogenannte Europaviertel zwischen Messe und Bahnhof am anderen Ende der Stadt ist schon beinahe fertiggestellt. Durch den EZB-Neubau werden nur alle paar Wochen Journalisten geführt, das aktuelle EZB- Gebäude selbst ist nicht zu besichtigen. Allein das »Euro Information Centre« neben dem Haupteingang hat offen. Es ist lediglich ein Souvenirshop, in dem Euro-Memorabilia und Münzen aus allen Euroländern zu kaufen sind. Die Krise ging auch am Geschäft des Euroshops nicht spurlos vorüber, die Euromünzen aus den Ländern wurden weniger gekauft, dafür Euro-Gold- und Silbermünzen, die hier ebenfalls angeboten werden, sagt die Verkäuferin. Es ist ein schönes Bild, fast schon ein subversiver Akt: Direkt im Gebäude der EZB kauften jene, die nicht mehr an die Währung glaubten, Euromünzen. Nicht wegen ihres nominellen Werts, sondern wegen des Rohstoffs, aus dem sie geprägt sind. Das alles ist nicht einmal zwei Jahre her, aber irgendwann in dieser kurzen Zeit scheint die Krise, diese existenzielle Krise, plötzlich sanft entschlummert und aus der medialen Wahrnehmung verschwunden zu sein. Dafür ist der Uringestank am Bahnhof immer noch da, die gehetzten Menschen im Anzug auch; und den besten Kaffee, der hier zu bekommen ist, gibt es bei Starbucks, Vanilla Flavored. Wir besteigen den ICE nach Brüssel. Ein Sitzplatz für die 400 Kilometer kostet 116 Euro, das Doppelte dessen, was wir für die beiden komfortablen Nachtzüge und die 900 Kilometer von Kiew nach Lemberg und von Lemberg nach Krakau bezahlt haben. Wenige Stunden noch, dann erreichen wir das Ziel unserer Reise. Schauen wir zurück auf die Geschichte, die Europa geprägt hat und deren Orte wir bereist haben, erscheint es nicht übertrieben zu sagen: Die großen Versprechen des gemeinsamen Europa stehen auf dem Spiel, nämlich die ökonomische und die physische Sicherheit seiner Bürger. Mit einer Jugendarbeitslosigkeit von bis zu 60 Prozent und der Kürzung von Staatsausgaben allenthalben lässt sich nur schwerlich von ökonomischer Sicherheit für alle sprechen. Und mit einem Russland, das scheinbar nach Belieben europäische Nachbarländer filetiert und seine Truppen immer näher hin zu Europas Grenzen bewegt, ist auch die Sicherheit vor militärischen Auseinandersetzungen nicht mehr gegeben. Aber was ist Europa ohne diese Versprechen? Und was ist mit der Ukraine? Soll, kann Europa ihr dieses Versprechen auch geben? VI. Brüssel – Safe European Home Brüssel-Midi, der zentrale Bahnhof der Stadt, der letzte unserer Reise. Europa ist hier eine Stadt in der Stadt. Der Bus vom Midi führt vorbei an eleganten Art-nouveau-Vierteln direkt vor das EUParlament, in das soziale Zentrum der Blase, die Place Luxembourg, in deren Cafés sich zu Mittag und nach Feierabend tausende Europaarbeiter versammeln. Das soziale Miteinander im Europaviertel ist streng codiert, vom Outfit bis zum Design der Visitenkarte. Männer tragen Anzug, Damen Hosenanzug oder Kostüm, die Straßenszene gleicht bis hin zu Schuhen und Trolleys all den anderen entörtlichten, also globalisierten Businessorten, der Londoner City etwa oder dem Financial District New Yorks. 40.000 EU-Beamte arbeiten in Brüssels Europaviertel, 2.500 Diplomaten, dutzendtausende Lobbyisten und Journalisten, Militärs und NGO-Aktivisten. Armani-Träger? Muss ein Lobbyist sein. Keine Krawatte? Ein Journalist. Längeres Haar? Ein Praktikant. In der Mitte der Place Luxembourg, zwischen den Europaarbeitern, versammeln sich jeden Tag ein paar dutzend Menschen mit Transparenten. Richtig, es müssen Demonstranten sein. Heute protestieren hier afrikanische Homosexuelle und Transsexuelle. Sie sagen, dass Europa nicht genug tue für die Rechte Homosexueller und Transsexueller in Afrika. Morgen werden Frauen hier stehen, sie werden sagen, dass Europa nicht genug tue für die Rechte von Frauen. Es ist das hiesige Ritual der Zivilgesellschaft, und es gehört zum Ritual des europäischen Apparats ebenso dazu wie die Abstimmung, die gerade hundert Meter entfernt von hier stattfindet, im Sitzungssaal des Parlaments. European Police College. Dafür. Dagegen. Enthaltung. Angenommen. Entschließung insgesamt. Angenommen. Namentliche Abstimmung eröffnet. Beendet. Angenommen. European Aviation Safety Agency. Dafür. Dagegen. Enthaltung. Angenommen. Entschließung insgesamt. Angenommen. Namentliche Abstimmung eröffnet. Beendet. Angenommen. So geht das stundenlang. Die Vorsitzende verliest die Abstimmungsthemen, die Abgeordneten drücken auf Knöpfe, im Namen von 500 Millionen Bürgern. Es ist der Höhepunkt der europäischen Demokratie, und er ist unsagbar langweilig. Was auf der Hinterbühne geschieht, das Ringen um Positionen, der Erwerb und Austausch von Expertise, die mitunter jahrelangen Verhandlungen, bleibt dieser Szene verborgen. Demokratie besteht aus Ritualen. Rituale bedeuten Berechenbarkeit, Vorhersehbarkeit, Sicherheit. Und das bedeutet: Langeweile. Sieht man von Wahlen ab, gehört sie zur Demokratie dazu; wenn man so will, ist sie sogar ein Maßstab für Stabilität. In Teheran, in Moskau, in Kiew ist es nicht so langweilig wie in Brüssel. Aber selbst das werfen die Bürger Brüssel vor. Die Abstimmung ist vorbei, vor dem Sitzungssaal warten Journalisten und Kameras, Aktivisten für ein alternatives Handelsmandat und deutsche Schüler mit einem einen Kilometer langen Brief im Namen rumänischer Straßenhunde. Neben ihnen lacht ein orthodoxer Jude in einem Gespräch laut auf: »Sie sind ein weiser Mann«, sagt er auf Französisch. Hinter ihm deklariert ein Inder in geschliffenem Englisch in eine Fernsehkamera: »We need to get involved!« Anders als die Kommission und der Rat, wo es jeweils kaum externe Besucher gibt und die Atmosphäre in den Gängen an Finanzämter erinnert, ist das EU-Parlament fernab des Abstimmungsprozederes bunt, vielsprachig, elektrisierend, mitunter schwindelerregend. Wer zu Mittag die hauseigene Kantine besucht, denkt an Babylon: Da essen und tratschen und lachen und telefonieren und schmatzen gleichzeitig tausend Menschen aus ganz Europa, aus der ganzen Welt. Für einen Politiker, dessen Job es ist, »das Schlimmste zu verhindern«, wie er selbst sagt, sieht Jörg Leichtfried zufrieden aus. Der Steirer leitet die fünfköpfige SPÖ-Delegation im EU-Parlament, seit zehn Jahren arbeitet er schon hier. Und bisher habe sein Job vor allem darin bestanden, Entscheidungen der konservativen Parlamentsmehrheit zu verwässern. Jetzt sagt Leichtfried: »Diese Wahl ist eine Richtungswahl.« Brüssel ist eine Stadt der Meetings, ein Termin dauert meist 20 Minuten und wird Wochen vorab vereinbart. Spontan ist woanders, Brüssel ist eine Terminplanstadt. Die meisten Abgeordneten, die wir spontan anfragen, haben keine Zeit. Leichtfried hat zehn Minuten. Eine Richtungswahl also. Das sagen alle Parteien bei allen EU-Wahlen. Warum diesmal wieder? Derzeit sitzen im Parlament 274 Konservative, 194 Sozialdemokraten, 85 Liberale, 58 Grüne, 57 Reformisten, 35 von den Vereinigten Linken, 34 Europaskeptische sowie 32 Fraktionslose. Laut europaweiten Umfragen, sagt Leichtfried, stünden Konservative und Sozialdemokraten gleichauf. Es ist die achte Wahl des Parlaments, und nicht nur wächst bei jedem Mal sein Gewicht im europäischen Triumvirat von Kommission (Exekutive), Parlament (Legislative) und Rat (Regierungschefs, die alle großen Entscheidungen selbst treffen). Diesmal haben die politischen Lager erstmals europaweite Spitzenkandidaten: Der Kandidat der Siegerpartei, also entweder der konservative Luxemburger Jean-Claude Juncker oder der sozialdemokratische Deutsche Martin Schulz, wird auch der nächsten Kommission vorstehen. Was genau das realpolitisch bedeuten wird, kann heute niemand sagen. An der Undurchsichtigkeit, die europäischen Entscheidungsprozessen anhaftet, wird jedenfalls auch diese Wahl nichts ändern. Auf dem Platz vor dem Parlament steht der österreichische Abgeordnete Martin Ehrenhauser, Anzug, Vollbart, Trolley, und tippt in eines seiner Smartphones. Er ist glücklich und nervös; glücklich, weil das EU-Parlament soeben für die Netzneutralität, also die Gleichbehandlung aller Internetnutzer vor dem Gesetz, gestimmt hat; und nervös, weil der Check-in am Flughafen in 30 Minuten schließt. Wir steigen kurzerhand mit ins Taxi. »Die Netzneutralität ist ein persönlicher Erfolg«, sagt Ehrenhauser. Genau das behaupten derzeit wohl mehrere hundert Abgeordnete. Parlamentsarbeit ist ein Teamsport, wahrscheinlich haben sie also alle ein bisschen recht mit dem persönlichen Erfolg. Denn anders als im österreichischen Parlament herrscht hier kein Klubzwang, also eine parteilich vorgegebene Abstimmungsdisziplin. In Brüssel und Straßburg, dem zweiten Tagungsort des Parlaments, gilt das freie Spiel der Kräfte. Mitunter finden sich bei jeder Frage unterschiedliche Mehrheiten, über Partei-, Länder-, Sozialgrenzen hinweg. Ehrenhauser trat vor fünf Jahren für die Liste Hans-Peter Martin an. Sie haben sich längst zerstritten, werfen einander Korruption, Bespitzelung und einen schlechten Charakter vor. Was er gelernt hat in fünf Jahren EU-Parlament? »Politik ist mühsamste Kleinstarbeit«, er spricht von Ausdauer und Durchhaltevermögen. Ehrenhauser wird diesmal für »Europa anders« antreten, eine Plattform aus Kommunisten, Piraten und Der Wandel, als Kandidat der Freibeuter. Die öffentliche Aufmerksamkeitsspanne für EU-Abgeordnete beträgt wenige Wochen alle fünf Jahre. Viel mehr als eine einzelne Zuschreibung ist da für die jeweiligen EU-Kandidaten nicht drinnen: Othmar Karas, der Langeweiler; Eugen Freund, der Tollpatsch; Ulrike Lunacek, die Grüne. Martin Ehrenhauser wird nach seiner Rückkehr nach Wien für ein paar Nächte im Schlafsack am Ballhausplatz vor dem Bundeskanzleramt campieren, aus Protest gegen die Hypo-Politik der Regierung. Ehrenhauser, der Aufmüpfige. Die Abgeordneten, die man hier trifft, ihre Mitarbeiter sowie Kommissionsbeamte, Diplomaten und Thinktanker – auf die Frage, wer über die Zukunft des gemeinsamen Europa entscheidet, antworten sie alle gleich: Es sind die Staats- und Regierungschefs, die den Weg vorgeben, das EU-Parlament darf, um in diesem Bild zu bleiben, lediglich über Verkehrsregeln und Straßenrandgestaltung mitbestimmen. Noch zehn Minuten, ehe der Check-in-Schalter schließt. Der Fahrer überholt einen Krankenwagen, der mit Blaulicht fährt. Brüssels Taxler wissen, was hier alle Kellner und Concierges wissen: Wer einen Anzug trägt, der zahlt die Rechnung nicht selbst, ergo ist das Trinkgeld umso höher. Das ist auch einer der Hauptgründe dafür, dass Restaurants, Hotelzimmer und Mieten überteuert sind. Wir kommen in einem Hostel unter. Das Internet ist langsam, das Duschwasser kalt, zum Frühstück gibt es Nescafé. 24,50 Euro kostet ein Bett in einem Zimmer für vier Personen. Hunderte Schüler wohnen hier, mehr als hunderttausend sollen es sein, die Brüssel jährlich besuchen. Für sie ist es wie ein Skikurs ohne Sport, ohne Natur, ohne Vergnügen, denn sie sehen nur Hostels und fensterlose Besprechungsräume mit Teppichböden und Anzugträgern. Es ist ein Bärendienst, den man Europa mit den Klassenfahrten erweist. Natürlich, man kann die Schüler nicht so einfach nach Kiew schicken. Aber dort, wo Europa und vor allem die Sicherheit, die es gewährleistet, abwesend sind, lernt man es wenigstens zu schätzen. Das Brüssel fernab der Europablase, fernab von Muscheln und Schokolade, ist eine andere, verfallende Welt, die vom Wohlstand von vorgestern zehrt und die kaum ein Besucher zu Gesicht bekommt. Die vielsprachige Einwanderungsstadt, in der die Hälfte der ansässigen Bevölkerung Migrationshintergrund hat, ist heute sozial und ethnisch getrennt; da haben die Kongolesen ihr Viertel und die Marokkaner, die Albaner und die Reichen. Auf den Rückseiten der Polizeiuniformen stehen »Police« und »Politie« untereinander, weil Brüssel gleichzeitig der einzige offiziell französisch- und niederländischsprachige Ort Belgiens ist, und nachts brennen schon einmal Diplomatenautos. Bis heute lässt die Stadtverwaltung ganze Art-nouveau-Häuserreihen planieren, um Platz für Beton, Stahl und Return on Investment zu schaffen. Hundert Meter von der touristenüberfüllten Grand Place entfernt stehen Abbruchhäuser, es riecht nach Urin, Kot und Verfall. »Bruxellisation«, dieses Wort beschreibt im Französischen eine für die Bürger negative Stadtentwicklung. Das Taxi hält vor einer ehemaligen Fabrikshalle im Südwesten der Stadt. Es ist eine heruntergekommene Gegend, die Einrichtung im Café Caracas ist staubbedeckt, Taxifahrer halten hier nur ungern. Das Gebäude aber hat man zum hippen Veranstaltungsort umfunktioniert. Mehr als hundert Personen treffen sich heute hier, laut dem veranstaltenden Centre for European Policy Studies die hellsten Köpfe Europas. Beim »CEPS Laboratory«, einer Art Zukunftswerkstatt, sollen Politiker und Beamte, Lobbyisten und Wissenschaftler die Szenarien für ein gemeinsames Morgen ausloten. Die Plätze sind seit Wochen vergeben, Außenstehenden ist der Eintritt verwehrt. Die Dame am Empfang sieht uns schief an, wir tragen keinen Anzug und ziehen keinen Trolley. Auf Englisch ausgesprochen hört sich »Datum Magazine« aber wichtig an, irgendwie bekannt: Deitem Megesin. Es klappt, wir dürfen hinein. An den Wänden hängen bunte Luftballons, die Stapel von Büchern sind gratis, der Kaffee in der »Einstein Bar« auch. Wegtafeln weisen zu den Themengruppen: nach links zu »Europe in the world«, nach rechts zu »Social Europe«. Auf eine Frau kommen fünf Männer, Typ: Krawattenträger 50-plus. Es ist das Klischeebild von Politik und Zukunft: rüstige Herren vor buntem Hintergrund. Die Gespräche hier dürfen zitiert werden, aber ohne Namen: »Denn ich würde keinem EU-Akteur raten, öffentlich so zu sprechen«, sagt einer. Man erfährt etwa, dass die EU die Ukraine aufgeben werde, wenn es hart auf hart kommt: Sie sei »nicht von vitalem Interesse für uns«. Für uns. Das Europa der Werte. Die rote Linie verlaufe entlang den EU-Grenzen: Hier werde man eine Einmischung Russlands nicht dulden, Brüssel nicht und vor allem Berlin nicht. Die östliche Partnerschaft und die südliche seien jedenfalls gescheitert, die Nachbarschaftspolitik überhaupt. Schlüsselländer wie die Türkei, die in einen neoosmanischen Autoritarismus abdrifte, und die Ukraine seien als zuverlässige, berechenbare Partner verloren. Wobei die Union daran Mitschuld trägt, vor allem ihre Staats- und Regierungschefs. Europas Macht hängt nach wie vor maßgeblich von deren Gunst ab. So agieren sie bei der Bildung gemeinsamer Positionen zwar strategisch – aber das gebietet ihnen das jeweilige nationale Interesse. Das Ergebnis ist ein meist schwaches Handlungsmandat, das die EU als zögerlich und inkonsistent auftreten lässt. In der Ukraine war es just das Assoziierungsabkommen mit der EU, das zunächst eine Revolution und schließlich Russlands Intervention auslöste. Und was haben die 28 Staats- und Regierungschefs getan? Was haben sie zu Wiktor Janukowitsch gesagt, ehe er auf seine Bürger schießen ließ? Was zu Wladimir Putin, ehe er sich die Krim holte? Und was seither? Genug? Nein, nicht genug, haben sie uns in der Ukraine gesagt. »Europa muss davon abkommen, sich als die Goethe’sche Kraft zu sehen, die Gutes schaffen will«, sagt der Deutsche Josef Janning, einer der wenigen Teilnehmer des CEPS-Labors, die sich zitieren lassen. Janning ist ein einflussreicher Stratege auf dem europäischen Parkett, Mitglied des European Council on Foreign Relations, so etwas wie einer offziellen europäischen Denkfabrik. Derzeit eröffne man Erwartungsräume, die Enttäuschung vorprogrammieren würden und Europa als doppelzüngige Veranstaltung dastehen ließen: »Wir müssen realistischer auftreten und endlich einsehen, dass alliierte politische Gruppen nicht notwendigerweise siegen müssen. Das gilt eben auch für die Ukraine.« Der Konflikt mit Russland habe aber auch seine positive Seite, hört man hier: Letztlich werde er die innere Integration befördern. So werde sich, darüber sind sich alle Gesprächspartner einig, die Konzentration der EU zunehmend auf die Probleme innerhalb der eigenen Grenzen richten: die Renationalisierung und das Erstarken der Rechten; Demokraturen, also Mischungen aus Demokratie und Diktatur wie in Ungarn; die regionalen Unabhängigkeitsbestrebungen im Baskenland und in Schottland; und das soziale und ökonomische Wegdriften der südlichen Krisenländer. Ob das alles schon in Brüssel angekommen sei? »Es kommt gerade an«, sagt der deutsche Stratege Janning, »nämlich hier und heute.« Hier und heute also. Das letzte Interview, die letzten Worte. Wir fahren zurück in die Brüsseler Innenstadt. In einer Bar nahe der Börse trinken wir Cognac und belgisches Bier. Szenen der Reise rauschen an uns vorüber. Der Sonnenaufgang über dem Maidan, der Strudel in Lemberg, das Pärchen, das sich in Krakau im Nebenzimmer liebte, als wir von Auschwitz zurückkehrten. Es beginnt zu regnen. Wo steht die Ukraine morgen, wo im Sommer, wo in einem Jahr? Und wo Europa? Und wen interessiert das überhaupt, also wirklich? Mit jeder Antwort tauchen fünf weitere Fragen auf. Ein letztes Glas noch. Wir schließen unsere Notizbücher und mischen uns unter die Touristen, so schwindlig, so müde. Wir kaufen Schokolade für unsere Kollegen, Kühlschrankmagneten für unsere Eltern. Dann steigen wir ins Taxi. Es hat aufgehört zu regnen. Der Weg zum Flughafen führt am Hauptquartier der NATO vorbei. Sie haben uns erzählt, dass hier die Sektkorken geknallt hätten, als Putin sich die Krim holte. Endlich hat das Militärbündnis seinen alten Existenzgrund zurück: das Muskelspiel mit Moskau. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite bauen sie an einem neuen Hauptquartier. Es soll doppelt so groß werden wie das alte. Im Autoradio läuft keine Musik, der Fahrer will auch nicht wissen, woher wir kommen, wohin wir gehen.