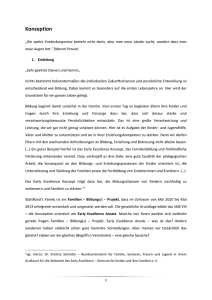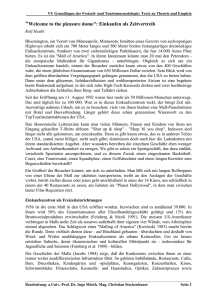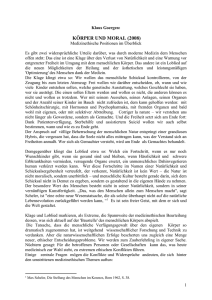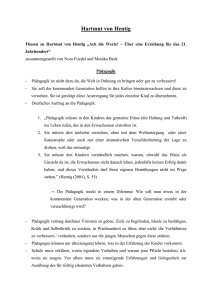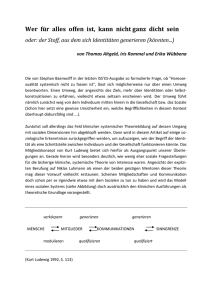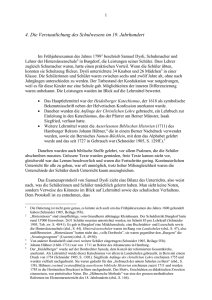SITTLICHKEIT DER TRAUM VOM BESSEREN MENSCHEN ODER
Werbung

SITTLICHKEIT DER TRAUM VOM BESSEREN MENSCHEN ODER KÖNNEN PÄDAGOGEN DIE WELT VERÄNDERN? Magisterarbeit im Hauptfach Erziehungswissenschaft Teilgebiet Allgemeine Pädagogik an der FernUniversität Hagen Prüfer: Prof. Dr. Horst Dichanz und Dr. Klaus-Dieter Eubel vorgelegt von Doris Silligmann im 12. Fachsemester am 30. April 1997 Datum der Themenstellung: 20. Januar 1997 Motto Wenn die Menschen plötzlich tugendhaft würden, so müßten viele Tausende verhungern. Lichtenberg INHALTSVERZEICHNIS 1 Einleitung: Über das Verhältnis von Utopie und Wirklichkeit 2 Sittlichkeit - Grundlagen und Entwicklung des Begriffs 2.1 Philosophische Grundlegung in der griechischen Antike 2.1.1 Platons Erziehungslehre 2.1.2 Aristoteles: Die Nikomachische Ethik 2.2 Theologische Grundlegung 2.2.1 Die Goldene Regel - Sittliche Grundformel der Menschheit? 2.2.2 Thomas von Aquin: Über die Sittlichkeit der Handlung 2.2.3 Luthers theologischer Rigorismus 2.3 Aufklärung: Toleranz - Inbegriff der Tugend 2.3.1 Rousseaus Gesellschaftskritik und die gute Natur des Menschen 2.3.2 Kant: Das radikal Böse in der menschlichen Natur 2.4 Fazit: Von der Sehnsucht nach Gerechtigkeit zur Pervertierung der Tugend 3 Bestimmung des gegenwärtigen Sittlichkeitsbegriffs 3.1 Philosophische Diskussionstendenzen 3.2 Kurzbeschreibung des Sittenbegriffs 3.3 Sittlichkeit als pädagogischer Begriff 3.4 Fazit: Vom Ethos zur Ethik 4 Theorie und Praxis pädagogischer Sittlichkeitskonzepte 4.1 Johann Amos Comenius: Theologe, Pansoph, Didaktiker 4.2 Joachim Heinrich Campe: Aufklärer, Philanthrop, Publizist 4.3 Wilhelm v. Humboldt: Neuhumanist, Bildungstheoretiker, Schulreformer 4.4 Paul Natorp: Neukantianer, Sozialist, Demokrat 4.5 Fazit: Von der Didaktik zur Sozialpädagogik 5 Sittlichkeit nach 1945 - ernüchterte Einsichten, pragmatische Aussichten 5.1 Theodor Wilhelm: Sittlichkeit durch politische Schulbildung 5.2 Skizzierung zwei sozialpsychologischer Entwicklungstheorien 5.2.1 Jean Piaget: Das moralische Urteil beim Kinde 5.2.2 Lawrence Kohlberg: Entwicklungsstufen der Gerechtigkeit 5.3 Fazit Vom moralischen Desaster zu den Stufen der Gerechtigkeit 6 Schluß: Über das Verhältnis von Sittlichkeit und Macht Literaturverzeichnis 1 Einleitung: Über das Verhältnis von Utopie und Wirklichkeit Oelkers charakterisiert die moderne Pädagogik als ein "im Kern hochambitioniertes soziales Programm [...], das schon mit seinen ersten Entwürfen Mitte des 18. Jahrhunderts Abwehr hervorrief und Satiren provozierte (Oelkers 1990, S. 1). Als Grund für diese Reaktion nennt er die selbstsichere Verknüpfung von Theorie und Moral, die nur utopisch zustande kommen konnte und doch nie so gesehen wurde. In der pädagogischen Reflexion ging es zwar um die Wirklichkeit von Erziehung, aber die Sichtweise war an Utopien der Gesellschaft ausgerichtet. Die Verpflichtung des Denkens auf Zukunft verdeckte diese Diskrepanz, und es schien so, "als sei von einer bestimmten Gegenwart aus möglich, was in aller Vergangenheit aus unmöglich war, wenn nur vom Nullpunkt des radikal Neuen an mit der richtigen Erziehung begonnen werden würde" (ebd.). Oelkers beschreibt das klassische Verhältnis von Utopie und Wirklichkeit in der Pädagogik folgendermaßen: "Die Verbesserung der Welt wird abhängig gemacht von der richtigen Erziehung. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, die richtige Erziehung führt zum Guten, die falsche stabilisiert das Böse, konkret die gesellschaftliche Entfremdung und damit im Prinzip jedes Übel, das sich der Gesellschaft zurechnen läßt. Die Utopie entwirft ein Gegenbild, in das alle möglichen Zukunftshoffnungen hineinprojiziert werden können. Die Attribuierung ist nicht limitierbar, jede neue Idee des Guten kann zum Gegenstand pädagogischer Erwartungen gemacht und es muß nur vorausgesetzt werden, die richtige Erziehung sei möglich und sie sei das Transportband des Guten" (ebd. S. 2). Öffentliche Annahmen über Erziehung werden auch heute noch von solch einsinnigen und naiven Hoffnungen beherrscht; sie finden sich nicht nur in der pädagogischen Alltagskommunikation, sondern auch in der politischen Utopie. Das Ziel der Gesellschaft ist nach Oelkers seit der französischen Revolution immer mit der Erziehung des neuen Menschen begründet worden: "Das europäische Projekt der Moderne ist aus diesem Grunde im Kern seiner Selbstlegitimation ein eminent pädagogisches gewesen" (ebd. S. 2). Heute, zweihundert Jahre später, sieht es so aus, als sei der intellektuelle Diskurs, der durch diese Vision genährt wurde, beendet, die pädagogische Aspiration der Moderne zerfallen. Diese Aspiration wurde seit dem Ende des 18. Jahrhunderts in zwei Bereichen in soziale Realität umgesetzt, im nationalstaatlichen Bereich und in dem der politischen Theorie: "Die nationalstaatliche Schule zähmte die pädagogische Aspiration in dem Sinne, daß sie ihr feste Institutionen aufnötigte, gegen die immer wieder Protest möglich war, ohne sie wirklich zu verändern. Die politische Theorie, mit Hilfe der Erziehung die Gesellschaft zu verändern, radikalisierte dagegen die Aspiration. Sie wuchs über sich hinaus und verwies direkt auf einen Erziehungsstaat. Doch überall, wo es Erziehungsstaaten gegeben hat, sind sie im 20. Jahrhundert diktatorisch geworden und es ist nicht zu zuviel gesagt, daß die pädagogische Aspiration sich dafür mißbrauchen ließ. Wenigstens konnten freiheitliche und humanistische Theoreme für diesen Zweck in Anspruch genommen werden und mußten herhalten, eine ganz andersartige Erziehungspraxis zu begründen, nämlich die des totalitären Staates. Das gehört zu den Katastrophen des 20. Jahrhunderts und ist nicht harmlos-befeuernd, wie die rhetorischen Formeln klingen, die dafür erfunden wurden" (Oelkers 1990, S. 2). Als Beispiel für das Scheitern einer politisch motivierten Erziehungsideologie benennt Oelkers den Sozialismus. Der Sozialismus war die zentrale Gesellschaftsutopie des 19. Jahrhunderts und beinhaltete in allen seinen Varianten starke Erziehungsprogramme. Aber gerade dort, wo die pädagogischen Institutionen vollständig auf die Ziele der Staatsmacht verpflichtet werden konnten, versagten sie. Oelkers sieht eine der Voraussetzungen des Zusammenbruchs des sowjetischen Sozialismus in der Unfähigkeit der Bildungsinstitutionen, den eigenen Zielsetzungen gemäß zu operieren, denn Ideologie erzeugt offenbar nicht das richtige Bewußtsein, und massenhafte Indoktrination ist unwirksam, weil sie mit der Wirklichkeit nicht einmal annähernd übereinstimmt: "Die Doktrinen andererseits sind nicht korrigierbar, es sei denn durch einen theoretischen Umbau. Der aber ist nur glaubwürdig, wenn er das heilige Zentrum der Dogmen berührt" (ebd. S. 3). Es stellt sich also die Frage, ob die pädagogische Utopie angesichts ihrer Unwirksamkeit nicht nur im Kontext des Sozialismus überhaupt noch aufrechterhalten werden kann. Gleichzeitig stellt sich andererseits die Frage, ob wir die Utopie der Erziehung trotz unseres Wissens um die Unmöglichkeit dieses Programms einfach aufgeben können und dürfen. Die sozialistische Desillusionierung ist vornehmlich eine pädagogische: "Warum haben die langen Jahrzehnte des Aufbaus einer Gesellschaftsordnung mit perfekter pädagogischer Versorgung nicht zu jener allseits entwickelten Persönlichkeit geführt, die die Theorie vorsah? Warum war nicht einmal das Krisenmanagement erfolgreich?" (ebd.). Die westliche Desillusionierung ist allerdings gleichermaßen zu berücksichtigen. Auch die hier entstandenen neuen Wirklichkeiten lassen pädagogische Heilserwartungen naiv erscheinen: "Die hochkomplexen und zugleich stark segregierten Gesellschaften des ausgehenden 20. Jahrhunderts sind nicht länger so zu begreifen, daß sie einem Heilsplan folgen und ausgerechnet die Pädagogen ihn exekutieren können. Wo dies versucht wurde, war der Preis sehr oft Unfreiheit und Diktatur. Wenn aber kein Heilsplan der gesellschaftlichen Entwicklung zugrunde gelegt werden kann, was wird dann aus dem Gedanken der richtigen Erziehung?" (Oelkers 1990, S. 3). Die Utopien der bürgerlichen Gesellschaft zur Beseitigung ihrer Übel konnten sich auf eine überlegene Moral stützen, die uns heute nicht mehr zur Verfügung steht. Moral ist kein effektives Mittel gegen das Ozonloch, die Wohlstandskorruption und den Drogenhandel. "Die Erfahrungen mit diesen modernen Übeln wirken auf ihre Art 'erzieherisch', nämlich bringen Dispositionen hervor und beeinflussen moralische Überzeugungen. Aber dagegen selbst gibt es kein direktes pädagogisches Mittel, weil jede Moral limitiert ist und entsprechend jede Erziehung Grenzen hat. Die klassische Utopie aber braucht das unbegrenzte Mittel und phantasiert eine allseits wirksame Erziehung" (ebd. S. 4). Grenzen der Erziehung anzuerkennen bedeutet also in diesem Zusammenhang zu begreifen, daß Erziehung gegen die Übel dieser Welt nicht hilft und deshalb die Welt auch nicht zum Guten führen kann. Gleichzeitig kann aber die Erziehung nicht von ihrer sozialen Verantwortung und ihren sozialen Zielen freigesprochen werden, sonst wäre sie einfach nur "zerfließende Theorie" (ebd.). Stellt sich damit also doch wieder die Forderung nach pädagogischen Utopien ? Der Glaube an die richtige Erziehung beinhaltet die Überzeugung von der Allmacht pädagogischen Wirkens. Doch Pädagogen, die die Welt verbessern wollen, können dieses Ziel immer nur mittelbar über die Erziehung des einzelnen Menschen und über die Veränderung der jeweiligen gesellschaftlichen Erziehungs- und Bildungsbedingungen anstreben. Auch hier sind ihrem Wirken Grenzen gesetzt, denn sie können zwar unter günstigen gesellschaftlichen Konstellationen Einfluß auf die Bildungs-, Jugend- und Familienpolitik nehmen, aber finanzielle, bürokratische und machtpolitische Interessen haben im Konfliktfall häufig genug die "stärkeren" Argumente, und der elterlichen, in der Regel gesellschaftskonformen und erfahrungsgeleiteten Erziehung können höchstens Ratschläge erteilt werden. Eine direkte und garantierte Beeinflussung der erzieherischen Praxis im Sinne selbst so geschätzter Pädagogen wie Pestalozzi ist nur dort möglich, wo sie persönlich wirken; ansonsten sind sie auf das Verständnis, die Einsicht und die "richtige" Interpretation und Rezeption ihrer Lehre durch Schüler und Schülerinnen, Zeitgenossen und nachfolgende Generationen angewiesen. Und nicht zuletzt kann sich der Zögling selbst als widerständig erweisen. So erweist sich die Allmacht der Erziehung vielleicht eher als deren Ohnmacht? Die Sollensanforderungen, die sich aus den kritisierten gesellschaftlichen Mißständen und menschlichen Problemen ergeben und mit dem Begriff Sittlichkeit bezeichnet werden, sowie die Vorstellungen vom besseren Menschen verbunden mit der Hoffnung auf eine bessere Welt sind immer vor einem anthropologischen, philosophischen und theologischen Hintergrund zu sehen. Diese Arbeit wird sich in ihrem ersten Teil mit den Grundlagen der Sittlichkeit beschäftigen, die entweder implizit in pädagogischen Konzepten enthalten sind oder auf die Pädagogen explizit zurückgegriffen und mit denen sie sich auseinandergesetzt haben. Platon, der als erster eine systematische Philosophie entwickelte, erarbeitete auch ein Erziehungsprogramm mit dem Ziel der Herstellung eines idealen Staates. Es war das erste Konzept einer staatlichen Erziehung überhaupt. Aus diesem Grund soll Platons Erziehungsphilosophie am Anfang des Grundlagenteils dieser Arbeit stehen. Mit Rousseau und Kant soll der erste Teil enden, da mit der Aufklärung eine neue, moderne Weltordnung anbrach, Rousseaus Gedankengut zur Entwicklung einer eigenständigen wissenschaftlichen Fachrichtung Pädagogik führte und Kants deduktiver Beweis der Freiheit und Autonomie des Menschen diesen unwiderruflich in die Selbstverantwortlichkeit stellte. Im zweiten Teil wird die sich an Kant anschließende Entwicklung des Sittlichkeitsbegriffs und der gegenwärtige philosophische Diskussionsstand skizziert sowie, zur engeren Abgrenzung, eine Kurzbeschreibung des Sittenbegriffs versucht und eine Definition von Sittlichkeit aus pädagogischer Sicht vorgenommen. Der dritte Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit Theorie und Praxis von Sittlichkeitskonzeptionen zeitgenössisch repräsentativer, gesellschaftskritischer und politisch ambitionierter Pädagogen, angefangen mit Comenius und endend mit Natorp. Es sollen dabei auch kurz Erfolg und Mißerfolg ihres Wirkens beleuchtet werden. Der vierte Teil beginnt mit der Zeit nach 1945 und setzt sich zunächst mit Wilhelms Sittlichkeitskonzept auseinander. Die Weimarer Zeit und die Zeit des Nationalsozialismus können in dieser, vom Umfang her begrenzten Arbeit nur gestreift werden. Es soll aber deutlich werden, daß gerade der Nationalsozialismus und der Holocaust unübersehbare und unübergehbare Konsequenzen für die Pädagogik und ihre Sittlichkeitskonzeptionen hat. Aus diesem Grunde werden zwei sozialpsychologische Entwicklungstheorien vorgestellt, Piagets Untersuchungsergebnisse zum moralischen Urteil beim Kind und Kohlbergs "Stufen der Gerechtigkeit", die inzwischen auch von Erziehungswissenschaft und Pädagogik aufgegriffen wurden. Das Schlußkapitel wird dann der Frage nachgehen, ob sich Sittlichkeit und Macht bzw. Gewalt vereinbaren lassen, sich mit dem Befehlsnotstand, dem Arendtschen Problem der Banalität des Bösen, Canettis kategorischem Imperativ "Weiterleben, ohne Sieger zu sein" und dem Dilemma beschäftigen, das sich aus den erkannten Grenzen der Erziehung einerseits und der möglichen Notwenigkeit von Utopien andererseits für die Erziehungswissenschaft und die Pädagogik ergibt. 2 Sittlichkeit - Grundlagen und Bestimmung des Begriffs 2.1 Philosophische Grundlegung in der griechischen und römischen Antike 2.1.1 Platons Erziehungslehre Platon (427-347 v. Chr.) schrieb die Politeia aus dem Willen heraus, die Gegebenheiten der griechischen Welt zu erneuern. In seiner Jugend erlebte er den Peloponnesischen Krieg, die "Selbstzerfleischung des Mutterlandes Hellas" (Hildebrand 1973, S. IX), im Alter von 24 Jahren den Zusammenbruch Athens und des attischen Seebundes, danach die Vertreibung der dreißig von Sparta eingesetzten Tyrannen, zu denen zwei seiner Verwandten gehörten, und schließlich die Hinrichtung seines Lehrers Sokrates durch die Demokratie, die Platon für ihre Mäßigung rühmte. Platon wollte handeln, aber er erkannte, daß er dies Chaos nicht neu gestalten konnte, ohne vorher den neuen Menschen zu schaffen. Er unternahm weite Reisen, um mit den einzelnen Fürsten über seine Idee der Gerechtigkeit und sein Polisideal zu sprechen und sie von der Notwendigkeit zur Veränderung der politischen Verhältnisse zu überzeugen. Er konnte sich aber als Staatsmann nicht durchsetzen und kehrte nach Athen zurück, um eine Akademie zu gründen, in der die Staatsmänner erzogen werden sollten, die Hellas brauchte. Dort verfaßte er die Politeia, die Reichsidee von einem idealen Staat, in dem Athen geistige Autorität in Gerechtigkeit ausübt und dessen Hegemonie von den übrigen Provinzen freiwillig anerkannt wird. Platon dachte sie sich als eine Herrschaft der rechten und wahren Philosophen. Er lehnte jede demagogische Parteiwirkung ab und setzte auf den großen Dialog von der Gerechtigkeit, aber er konnte die Athener nicht überzeugen. Schließlich zog er sich vollständig in seine Akademie zurück, um der nachwachsenden Jugend sein politisches Werk zu überlassen. Durch seinen Schüler Aristoteles ging etwas von dem Platonischen Geist auf Alexander über, aber dessen Reich war dennoch ein Bruch mit der Reichsidee Platons (vgl. Hildebrandt 1973, S. VII - XVII): "Athen und der Geist republikanischer, staatsformender Philosophie war ausgeschaltet. Der Sinn, aus dem Platons Werke geschrieben wurden, die Gründung des geistigen Reiches der abendländischen Idee, aus dem sich auch das staatliche Leben erneuern sollte, war seit Alexanders Reichgründung nicht mehr lebendig, nicht mehr verständlich: Philosophie wurde reine Wissenschaft und wurde Ersatz für Religion, aber ohne das Königsrecht echter geistiger Macht. Mit Platons Werk verglichen ist seitdem ein Zug von Resignation in der antiken Philosophie nicht zu verkennen: ihre Zeit des großen geistigen Schöpfertums ist vorbei" (ebd. S. XII). Platon wendet sich mit seinen Dialogen nicht an die Gelehrten seiner Zeit, sondern an die Jugend: "Nur aus dem Eros der Jugend können ihm die Genossen erwachsen, die das neue Volk erwecken" (ebd. S. XVII). Und er beschäftigt sich mit dem Problem der neuen wahren Erzieher, die es nach Sokrates nicht gibt und nicht geben kann, denn nur der kann sich als Erzieher bewähren, der sich wiederum auf seinen eigenen Erzieher oder aber seinen Zögling berufen kann. Platons Lösung dieses Problems ist geschickt: Er ist der Autor der von Sokrates geführten Gespräche, durch ihn als Zögling hat sich Sokrates bewährt, während sich Platon wiederum so auf seinen Lehrer und Erzieher berufen kann. Gleichzeitig weist Platon durch seine adlige Herkunft und edle Verwandtschaft mit dem Dichter und weisen Gesetzgeber Solon seine eigene Befähigung für das Amt der staatlichen Erneuerung nach. Der Prozeß des Erziehens wird nicht durch wissenschaftliche Belehrung oder politische Taktik, sondern durch die Erweckung der Leidenschaft des Blutes und der Liebe zur Schönheit vollzogen. "Einmal erweckt, muß das neue Leben mit ungestümer Kraft sich ausbreiten. Platon entzündet in den Jünglingen den Eros zu ihm selber, aber die Jünglinge müssen das Feuer weitertragen und wieder in dem Knaben den Eros zu ihnen selber entzünden. Das ist das Platonische Geheimnis" (Hildebrandt 1973, S. XVIII). Auch hierin war Sokrates sein Lehrer und Vorbild (vgl. ebd. S. XVIIIf). Platon hat als erster im europäisch-abendländischen Kulturbereich eine systematisch und philosophisch konzipierte Erziehungslehre entworfen, eine Theorie der Erziehung und Bildung, der Paideia. Ausarbeitungen finden sich sowohl in der Politeia als auch in seinem Spätwerk über die Gesetze, dem Nomoi, in dem der zweitbeste mögliche Staat empirischer und realistischer dargestellt wird als das staatliche Idealbild (vgl. Hager 1981, S. 34 - 36). Platon hatte erkannt, daß die zentrale Erkenntnis, die die Arete, d.h. zentrale sittliche Vortrefflichkeit, des Menschen begründen sollte, nicht naturgegeben sei oder von allein im Menschen wachse, sondern nur durch eine spezifische Erziehung und Bildung zu erreichen sei. Die besondere Bedeutung der Paideia lag gerade darin, die jungen Menschen auf die spätere Herrschaft als Philosophen vorzubereiten, sie betrifft Kindheit, Jugend und die jungen Erwachsenen. "Der platonische Idealstaat ist also wesentlich ein Staat der Erziehung und Bildung, sein kulturelles Leben ist grundsätzlich der Paideia geweiht" (ebd. S. 38). Die Bildung des neuen Menschen als vollkommenen Wächter und Bürger der idealen Polis und die Entstehung des idealen Staates verlaufen parallel. Platon zeigt in der Politeia, wie Gerechtigkeit bzw. Ungerechtigkeit sowohl im Staat als auch in der Seele des Menschen entsteht und unter welchen Bedingungen Gerechtigkeit garantiert und wie die Verirrung in die Ungerechtigkeit möglich ist (vgl. ebd. S. 39ff). Er geht zunächst von den Problemen des Glücks oder Unglücks der Seele aus, um dann zu denselben Problemen im größeren Staatszusammenhang zu gelangen. Platon stellt der sophistischen These, wonach der Ungerechte, der zügellos nach Genuß und Macht strebt, der Glückliche sei, die These des Sokrates gegenüber, wonach nur der Gerechte glücklich und der Ungerechte nur unglücklich sein kann. Bevor dies Problem entschieden werden kann, muß zunächst nach dem Wesen der Gerechtigkeit und ihrem Gegenbild wie auch nach ihrem Entstehen im Staatsganzen gefragt werden, und damit stellt sich die Frage nach den Grundbedingungen für die Entstehung des besten nur möglichen Staates, der Kallipolis, in dem die Idee der Gerechtigkeit verwirklicht ist. Es geht Platon bei seiner Erziehungskonzeption und seiner Staatslehre nicht nur um eine zeitgebundene politische Reform und die Stabilisierung eines effizienten totalitären und autoritären Staatswesens, sondern seine Philosophie soll "auch einer durch Erziehung allein zu vermittelnden Erneuerung des Menschen aus metaphysischem Grunde" (Hager 1981, S. 41) dienen. Es soll nicht nur eine durch Selektion bestimmte Elite zu möglichst vollkommenen Wächtern des besten Staates ausgebildet werden, sondern jeder einzelne Mensch soll durch denselben exemplarischen Bildungsgang seiner sittlichen Vollendung zugeführt werden. Auf diese Weise kann sowohl im Staat als auch in der einzelnen Seele Gerechtigkeit im Sinne einer Gesamttugend entstehen und Ungerechtigkeit durch Erziehung unterbunden werden (vgl. ebd. S. 41f). Sittliche Vortrefflichkeit zeichnet sowohl den guten Wächter als auch den zu wahrer, vollendeter Humanität entwickelten Menschen aus. Sie wird von Platon durch das System der vier Kardinaltugenden umschrieben, der Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit und Gerechtigkeit. Dieses System wiederum ist am Aufbau und der Grundstruktur der menschlichen Seele wie auch des Staates orientiert, denn Seele und Staat sind nach Platon analog aufgebaut: Den drei Schichten der Seele, Vernunft, Wille und Begierden entsprechen auf der Ebene des Staates drei Stände, Philosophen als Regenten und vollumfängliche Wächter, Krieger als Hilfswächter und Bauern und Handwerker als verantwortlich für den wirtschaftlichen Erhalt des Staates (vgl. ebd.). "Die Weisheit ist die Vortrefflichkeit oder Arete des obersten Standes des Staates und des obersten Teils der Seele, sie ist die für die Vernunft des Menschen und für die philosophischen Regenten des Staates spezifische Arete, die Tapferkeit dagegen ist die Arete des mittleren Teils der Seele und des mittleren Standes des Staates, d.h. sie ist die die Krieger und den Willen auszeichnende Vortrefflichkeit. Besonnenheit wird bei Platon als die Übereinstimmung zwischen herrschenden und beherrschten Schichten des Staates und der Seele darüber, wer zu herrschen habe, definiert, nämlich die Vernunft in der Seele und die Philosophen im Staate, und die Gerechtigkeit als die zentrale Vortrefflichkeit der Seele, bzw. des Staates insgesamt erscheint bei Platon als das Tun des Seinigen, d.h. sie ist dann gegeben, wenn im Staate jeder der drei Stände und in der Seele jeder der drei Teile genau die ihm wesenseigene Funktion erfüllt" (Hager 1981, S. 42). Hier wird deutlich, daß der Mensch nach Platons Bild wesentlich durch die Vernunft als menschliches Spezifikum gekennzeicht ist. Der Vernunft sind Wille und Begierden untergeordnet. Nur in Übereinstimmung mit der Vernunft, unterstützt durch den Willen können auch die Begierden zu einem geordneten leibseelischen Ganzen beitragen. "Die Gerechtigkeit schliesslich bezeichnet jenen Zustand der Ordnung zwischen den Seelenteilen, welcher sich in der sittlichen Beschränkung der Schicht auf ihre wesenseigene Stellung äussert" (Hager 1981, S. 43). Angewendet auf das Staatsganze entsteht Gerechtigkeit dann, wenn alle Stände des Idealstaates nur die ihnen zukommenden Tätigkeiten ausüben. Jede staatliche Aufgabe darf nur von den eigens hierfür ausgebildeten Fachleuten ausgeführt werden. Platon kritisiert hiermit die Herrschaft der Vielgeschäftigkeit und der Inkompetenz in der zerfallenden athenischen Demokratie (vgl. ebd.). Die Zugehörigkeit zu den Ständen sieht er zwangsläufig nicht als erblich an, sondern sie wird "durch Selektion nach Kriterien der Bewährung auf den Stufen der Ausbildung vom Staate her bestimmt" (ebd. S. 101). Platon macht bei der Verteilung der staatlichen Aufgaben keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Verschiedenheit ergibt sich lediglich aus individuellen Fähigkeiten: "Stellt sich aber heraus, daß die Verschiedenheit darin besteht, daß das Weib gebiert, der Mann befruchtet, so ist unserer Meinung nach damit eine Verschiedenheit hinsichtlich der beruflichen Tätigkeiten noch lange nicht dargetan. Wir werden dabei bleiben, daß unseren Wächtern und ihren Frauen die gleichen Aufgaben zufallen" (Platon 1973, S. 154). Sämtliche Aspekte der Gesamtarete haben ihre ontologisch-metaphysische Begründung in der Vernunft, denn alle stützen sich auf Wissen und Einsicht. Platon sieht die Vernunft wesentlich als das Organ des Menschen, das das wahre Wesen aller Dinge in den Ideen, "den ewigen Urbildern alles vergänglichen und einzelnen Seienden" (Hager 1981, S. 44) zu erkennen in der Lage ist. Nur sie kann sich über den physischen und psychischen Bereich erheben und Erkenntnis des "wahren, allgemeinen Wesens, welches ewig in sich ruht und sich niemals ändert" (ebd.) erlangen. Alle Phänomene des wahrnehmbaren und erlebbaren Werdens haben "vollkommene Urbilder und Vorbilder im Bereich des ewigen, wahrhaft Seienden, eben den Ideen, in welchen sich ihr wahres und eigentliches Wesen anschauen läßt" (ebd.). In diesen Ideen ist nicht nur die allgemeine Grundstruktur aller Dinge auf ewig vorgezeichnet, sondern auch die wahre ewige Bestimmung aller Dinge, insbesondere des Menschen und seines Staates, ebenso, wie alle Dinge ihrem ursprünglichen Wesen nach sein sollen. Die Vernunft ist der wahre Führer des Menschen, "sie ist dazu ausersehen, die Herrschaft im Menschen wie eben auch im Staate zu übernehmen, sie ist der Ursprung aller sittlichen Vortrefflichkeit des Menschen, denn sie hat Zugang zu objektiven Normen und Werten sowie zum wahren Wesen und eigentlichen Sein aller Dinge" (ebd.). Wenn nun auch der innerste Kern des Menschen, seine Geist-Seele göttlich und ewig ist, hat sie doch die Erkenntnis von der unbedingten Wahrheit der Ideen in ihrer irdischen Existenz nicht jederzeit gegenwärtig. Als Grund nennt Platon die Gebundenheit der unsterblichen Geist-Seele an einen sterblichen Körper. Die Seele hat ihr ursprüngliches Wissen bei der Einkörperung vergessen, und es muß in einem Lernprozess wieder angeeignet werden. Grundsätzlich und ständig ist der Erdenmensch von der Gefahr des Wahrheitsverlustes bedroht. Platon hat für diesen Zustand des Erdenmenschen und den Prozeß der Bildung das Gleichnis von einem Gefangenen in einer Höhle gewählt, von seiner Befreiung und dem schrittweisen Weg vom Dunkel zum Licht. Aus diesen anthropologischen Voraussetzungen ergibt sich einerseits die Möglichkeit der Paideia, andererseits ihre Notwendigkeit (vgl. Hager 1981, S. 45f). Platons Erziehungskonzept mit dem Ziel der Hinführung zur Erkenntnis der unbedingten Wahrheit soll den Menschen ein Leben lang erfassen. Die Ausbildung der Philosophen als staatstragender Schicht ist erst mit etwa 50 Jahren abgeschlossen. Erst in diesem Alter kann der Mensch zur Erfassung des höchsten Lehrgegenstandes, der Idee des Guten gelangen. Die Erkenntnis der Idee des Guten ist das letzte und höchste Ziel der platonischen Paideia (vgl. ebd. S. 45 und 108). "Unter der Idee des Guten denke dir nun das, was den erkennbaren Gegenständen Wahrheit und der erkennenden Seele Erkenntniskraft verleiht. Setze sie als Ursache unseres Wissens und als Ursache der Wahrheit, die wir erkennen. Aber du wirst recht tun, sie für etwas anderes und etwas noch Höheres als die beiden hohen Dinge, Erkenntnis und Wahrheit, zu halten. Ebenso wie wir dort vernünftigerweise das Licht und den Gesichtssinn zwar für sonnenähnlich, aber nicht für die Sonne selber erklärten, so haben wir auch hier recht, jene beiden Dinge, Wissen und Wahrheit, für dem Guten ähnlich zu erklären, aber nicht eins davon für das Gute selber zu halten. Das Gute muß noch über sie gestellt werden" (Platon 1973, S. 221f). Doch Platon hat seine besondere Aufmerksamkeit gerade der Kindheit und Jugendzeit gewidmet, es gibt sogar eine Anweisung für werdende Mütter und Bemerkungen zum Embryo im Mutterleib (vgl. Hager 1981, S. 46f). Platon gliedert den Bildungsgang den Altersstufen und Begabungen der Zöglinge entsprechend in drei Stufen: Die unterste Stufe ist eine gymnastische und musische Elementarbildung, die für alle Kinder und Jugendlichen gedacht ist. Die höhere, rein intellektuelle Bildung beginnt als mathematische etwa mit dem 20. Lebensjahr, geht dann über in die dialektische Bildung und endet mit dem 35. Lebensjahr (vgl. ebd. S. 48). Die pädagogische Aufgabe der musisch-gymnastischen Bildung ist die Schulung der Vernunft zwecks Beherrschung der übrigen irrationalen Seelenbereiche und "die Hinführung des vernünftigen Seelenteils zu seiner vollendeten Vortrefflichkeit, zur Areté der Weisheit" (Hager 1981, S. 50). Dabei ist die anthropologische Gegebenheit zu berücksichtigen, daß Körper, Seele und Vernunft im Wachstum begriffen sind und Zeit zur Entwicklung benötigen, wobei der Erfolg von günstigen Erziehungsmaßnahmen abhängt. Körperlich ist der Unerwachsene durch einen ungezügelten Bewegungsdrang gekennzeichnet, seelisch durch emotionales Reagieren anstelle einer kritischen Reflexion und intellektuell durch Unfertigkeit in Bezug auf alle Fähigkeiten des vernünftigen Vermögens (vgl. Hager 1981, S. 50f). Dem Bewegungsdrang begegnet Platon mit Gymnastik, Tanz und Gesang, wobei Form und Gehalt dieser künstlerischen Übungen genau festgelegt sind und auf die Bildung eines harmonisch, melodisch und rhythmisch wohlgeordneten Chorreigens zielen. Bestimmende Merkmale der kindlichen Seele sind unvernünftige Regungen wie Lust, Unlust und Schmerz. Durch diese kindgemäßen Regungen können Tugend und Laster Einzug in die kindliche Seele halten. Hier gilt es dafür zu sorgen, "daß das Kind von Anfang an das erstrebt und liebt, was es erstreben und lieben soll und umgekehrt das hasst und meidet, was es hassen und meiden soll, nämlich die Tugend, bzw. das Laster" (ebd. S. 53). Noch bevor Vernunft und Affekte durch die eigene Vernunft zur Übereinstimmung gebracht werden, was Voraussetzung zur Erreichung der Arete ist, sollen "die Affekte die rechte sittliche Orientierung erhalten und auf die Herrschaft der Vernunft in der Seele vorbereitet werden" (ebd.). Die musische Bildung durch Tonkunst, Tanzkunst, bildende Künste, Dichtung und Mythos soll die sich entwickelnde Vernunfttätigkeit selbst ansprechen; daher dürfen dem Kind nur vorbildliche Gestalten von hoher Sittlichkeit durch die Dichtung vor Augen geführt werden. Das Kind soll in jedem Bereich Harmonie und Ordnung als beispielhaft und nachahmenswert kennenlernen. Der leichten Verführbarkeit von Kindern sucht Platon durch ständige Überwachung, Lenkung und Prüfung bereits im Kindergartenalter entgegenzuwirken. Das Kind muß erst für die Gemeinschaft erzogen werden, denn ohne Anleitung könnten asoziale Züge wie die Neigung zum Stehlen die Oberhand gewinnen. Aus den genannten Gründen lehnt Platon eine nachgiebige, verwöhnende Erziehung ab, wie er auch der Ansicht ist, daß eine Demokratie durch ein Übermaß an Freiheit zugrundegeht, indem sie allmählich der Gewaltherrschaft anheimfällt (vgl. ebd. S. 53 - 55). Dennoch ist nach Hager Platons Erziehung nicht als autoritär zu bezeichnen. Das Kind ist in vollem Sinne wesenhaft Mensch, ihm stehen Würde sowie alle Rechte und Pflichten zu, die das "Mensch-Sein" kennzeichnen. Die Erziehungsmaßnahmen haben in erster Linie einen behütenden und bewahrenden Charakter, der der Schwachheit des Kindes, seiner instabilen inneren Ordnung, dem affektgeleiteten Handeln sowie der noch unfertigen Vernunft Rechnung tragen und es vor schädlichen Einflüssen beschützen soll. Die intensive pädagogische Betreuung hat das Ziel, den Menschen innerlich zu festigen und auf diese Weise geistig zur Selbstverantwortung zu befreien. Aus diesem Grund widmet sich Platon besonders dem Entstehen und Überwiegen von Furcht im Kind (vgl. Hager 1981, S. 56 - 60). Das Kind ist bei Platon vollständig geistige und moralische Persönlichkeit, "nur eben durch die Schwachheit seiner psycho-physischen Kondition daran gehindert, zum innersten geistigen und sittlichen Kern seiner Person vorzudringen und sich jederzeit mit Festigkeit darin zu behaupten" (ebd. S. 59/60). 2.1.2 Aristoteles: Die Nikomachische Ethik Aristoteles (384-322 v. Chr.), Schüler Platons, widersprach der platonischen Lehre vom Guten. Es ist ihm wohl nicht leicht gefallen, die Lehre seine Freundes anzugreifen, und es gibt im Dialog "Über die Philosophie" einige Worte der Entschuldigung für seine Kritik an Platons Ideenlehre. Aber er bewertete die Wahrheit höher als die Freundschaft (vgl. Gigon 1995, S. 22 - 24). Die Nikomachische Ethik ist die "repräsentativste Zusammenfassung und Weiterbildung der philosophischen Ethik, so wie sie bei den Griechen durch die sogenannte Sophistik und durch die Sokratik aufs reichste entwickelt worden ist" (ebd. S. 53). In ihr setzt sich Aristoteles mit den vier Grundtypen philosophischer Ethik auseinander, mit der Ethik der Lust sowie der Ethik des Machtwillens und mit der Ethik der reinen Erkenntnis und der Ethik der Tugend. Die beiden erstgenannten Ethiken will Aristoteles weniger widerlegen als sie beherrschbar machen: "Der Machtethik sucht er die Spitze abzubrechen durch seine Theorie der proportionalen Gerechtigkeit, der Lustethik dadurch, daß er zwar die Lust als physischen Genuß ablehnt, aber die Lust an der Tugend für einen notwendigen Teil des tugendhaften Lebens erklärt" (Gigon 1995, S. 65). Bezogen auf die Ethik der Erkenntnis bemüht sich Aristoteles zu zeigen, daß das Kind und der primitivste Mensch dem reinen Erkennen zustreben: "Das Kind freut sich am Anschaun schöner Gegenstände, und jeder Mensch liebt das Bekannte und fürchtet das Unbekannte" (ebd. S. 67). Die Tugendethik verweist den Menschen auf seine Innerlichkeit und erhält dadurch einen paradoxen Charakter, denn nicht äußere Güter, Ansehen und gesichertes Leben sind erstrebenswert, sondern nur das Bewußtsein von der eigenen Tugendhaftigkeit. Nur sie garantiert Glückseligkeit: "Das Bewußtsein der Gerechtigkeit genügt zum Leben und macht völlig gleichgültig gegen den Tod" (ebd. S. 68). Diese Lehre konnte als Schlußfolgerung aus dem Schicksal des Sokrates gezogen (vgl. ebd. S. 67/68). Aristoteles hat als Ziel des menschlichen Lebens das reine Erkennen bestimmt, denn diese Fähigkeit unterscheidet den Menschen vom Tier. Nur die reine Erkenntnis bringt den Menschen jener Welt nahe, aus der seine Seele stammt und in die sie wieder zurückkehren wird. Das reine Erkennen ist die einzige Tätigkeit, die der Götter würdig ist und die den Menschen götterähnlich werden läßt. Aber dieses Lebensideal des Verzichts, das natürlich auch Verzicht auf politisches Handeln beinhaltete, stand im Widerspruch zur athenischen Tradition, die gerade politisches Handeln philosophisch begründete. Diese Zwiespältigkeit der Philosophie findet sich bei Platon wie auch im aristotelischen Werk (vgl. Gigon 1995, S. 9092): "Wohl übernimmt die Philosophie die Aufgabe, den Menschen zum tüchtigen Bürger heranzubilden, eine politische Wissenschaft zu schaffen und die Frage nach dem vollkommenen Staate zu beantworten. Dennoch strebt sie insgeheim, wie alle Philosophie, aus der menschlichen Gemeinschaft heraus in eine Autarkie, in welcher der einzelne Mensch souverän mit der Welt fertig wird und an seinem Geiste genug hat" (ebd. S. 91). Aristoteles beschreibt einerseits als Lebensziel die Erkenntnis als die vollkommene Tätigkeit der Seele; sie stellt die Gesamtheit der Tugenden dar. Andererseits endet seine Nikomachische Ethik mit der Anknüpfung an die Politik, die er für die umfassendste aller Wissenschaften hält, "da sie das gesamte Leben der umfassendsten Gemeinschaft, des Staates, zu organisieren hat. Der Einzelne verhält sich zur Gemeinschaft wie der Teil zum Ganzen. So ist denn auch das Ziel des Ganzen höher als das Ziel des Teiles" (ebd. S. 92). Das Ideal der Autarkie scheint im Widerspruch zum Leben des Menschen in einer Gemeinschaft zu stehen, denn Autarkie bedeutet, sein Leben ohne fremde Hilfe aufzubauen und selbstzugestalten, wie auch die Gottheit, der der Mensch gleichen soll, als sich selbst genügend gesehen wird. Aristoteles erklärt nun den Sinn der menschlichen Gemeinschaft nicht wie die Sophisten aus der Not des Menschen heraus, nur gemeinsam den Gefahren der Natur trotzen zu können, sondern er sucht den Grund in der menschlichen Natur selbst, er möchte die Gemeinschaft als ein Werk der Vollkommenheit erklären und argumentiert folgendermaßen (vgl. ebd. S. 92f): "Die vollkommenste Tätigkeit, die es gibt, ist die Reflexion des Geistes auf sich selbst. Darin ist das delphische Gebot 'Erkenne dich selbst' erfüllt und darin auch die spekulative These, daß der Geist kein höheres Objekt besitzen könne als sich selbst. Die Gottheit vermag diese Reflexion ununterbrochen und ohne jegliche Mühe zu vollziehen. Der Mensch vermag es nicht, weil er nicht nur Geist ist. Doch es bleibt ihm ein Ausweg. Er vermag sich selbst zu erkennen im Spiegel des ihm gleichartigen Freundes" (Gigon 1995, S. 93). So begründet er die Freundschaft und damit die menschliche Gemeinschaft überhaupt, allerdings ist es auch in dieser Form eine Begründung aus Mangel und nicht aus Vollkommenheit (vgl. ebd.). Die Nikomachische Ethik soll nicht bloß theoretische Kenntnisse vermitteln, sondern zum praktischen Handeln anleiten; es geht um das Gute, das der Mensch tatsächlich verwirklichen kann. Dabei greift Aristoteles auf traditionelle Anschauungen und Sitten zurück, denn nach seiner Auffassung kann eine Meinung, die seit jeher von allen Völkers geteilt worden ist, nicht ganz falsch sein. Es liegt ihm hierbei aber nicht an einer Auseinandersetzung mit älteren Theoretikern; er möchte vielmehr eine Ethik der Anständigkeit skizzieren, wie sie durch die Tradition vorgezeichnet ist und wie sie verwirklicht werden kann (vgl. ebd. S. 95/96). Die Glückseligkeit, nach der alle Menschen streben, ist nach Aristoteles allein vom Menschen und seinem Tun abhängig, sie ist das Ergebnis eines tugendhaften Lebens, und dieses kann erlernt und geübt werden (vgl. Gigon 1995, S. 97/98 u. Aristoteles 1995, S. 121). Das geistige Werden des Menschen wird bestimmt durch Anlage (Natur), Gewöhnung und Belehrung. Da aber nur die Menschen, die von ihrer Anlage her bereits zur Tugend neigen, auf Belehrungen überhaupt hören werden, während diejenigen, die gemäß den Leidenschaften leben, sie nicht einmal verstehen, bedarf es einer strengen Erziehung von Geburt an wie auch entsprechender Gesetze für die Erwachsenen (vgl. Aristoteles 1995 S. 353): "Denn die meisten gehorchen eher dem Zwang als der Rede und Strafen eher als dem Edlen. [...) Denn der Tugendhafte und der auf das Edle hin lebt, werde der Rede gehorchen, der Schlechte aber, der nach der Lust verlangt, würde durch Schmerzen gezüchtigt wie ein Zugtier. Darum sagt man auch, daß die Schmerzen den erstrebten Lüsten möglichst entgegengesetzt sein müßten" (Aristoteles 1995, S. 354). Aus diesem Grund konzipiert Aristoteles den Tugend-Staat als einen Erziehungsstaat. Die Erziehung muß vollständig in der Hand des Staates liegen, denn die heranwachsende Generation kann nur mittels Erziehung in das allgemeinverbindende Lebensgepräge hineinwachsen (vgl. Fink 1970, S. 281f). Aristoteles beschreibt drei Lebenformen, zwischen denen der Mensch wählen kann: das Leben der Ehre, das Leben des Genusses und das Leben der Erkenntnis (vgl. Aristoteles 1995, S. 109). Die Mehrzahl der Menschen wird des Leben des Genusses wählen. Aristoteles bezeichnet die große Menge als "völlig sklavenartig, da sie das Leben des Viehs vorzieht" (Aristoteles 1995, S. 109). Die Ehrsüchtigen hingegen bevorzugen die politische Betätigung, es handelt sich hier um die gebildeten und energischen Menschen. Sie wünschen aufgrund ihrer eigenen Tüchtigkeit Anerkennung und Ehre auch, um sich selbst zu überzeugen, daß sie gut seien. Das Leben der Erkenntnis ist die betrachtende Lebensform (vgl. ebd. S. 109f). Diesen drei Lebensformen entsprechen drei für erstrebenswert gehaltene Güter: Die körperlichen, die äußeren und die seelischen Güter, von denen die letzteren die eigentlichen und hervorragendsten Güter sind (vgl. ebd. S. 118). Aristoteles definiert Tugend als eine Eigenschaft, die sich weder durch Übermaß noch durch Mangel auszeichnet (vgl. ebd.S. 139). Sie ist nicht nur ein Besitz, sondern zeigt und übt sich in tugendgemäßer Tätigkeit, "denn ein Zustand kann bestehen, auch ohne daß er etwas Gutes vollbringt" (ebd. S. 119). "Die Tugend ist also ein Verhalten der Entscheidung, begründet in der Mitte im Bezug auf uns, einer Mitte, die durch Vernunft bestimmt wird und danach, wie sie der Verständige bestimmen würde. Die Mitte liegt aber zwischen zwei Schlechtigkeiten, dem Übermaß und dem Mangel. Während die Schlechtigkeiten in den Leidenschaften und Handlungen hinter dem Gesollten zurückbleiben oder über es hinausgehen, besteht die Tugend darin, die Mitte zu finden und zu wählen. Darum ist die Tugend hinsichtlich ihres Wesens und der Bestimmung ihres Was-Seins eine Mitte, nach der Vorzüglichkeit und Vollkommenheit aber das Höchste" (Aristoteles 1995, S. 141). Es gibt also drei Verhaltensweisen, "zwei Schlechtigkeiten je aus Übermaß oder Mangel und eine Tugend, die der Mitte" (Aristoteles 1995, S. 145), und alle stehen in gewisser Weise zu allen im Gegensatz. Nach diesem Prinzip ordnet, beschreibt und begründet Aristoteles detailliert alle Tugenden, so daß deutlich wird, welches Verhalten als tugendhaft zu bezeichnen ist und welches als schlecht (vgl. ebd. 163 - 230). Dabei gibt es Verhaltensweisen, die grundsätzlich schlecht sind wie Schadenfreude, Neid und Mord (vgl. ebd. S. 141) sowie solche, die je nach Umstand im einen Fall gut, im anderen schlecht sind: Zorn beispielsweise kann, wenn er angebracht ist und nicht von der Leidenschaft beherrscht wird, lobenswert sein, im gegensätzlichen Fall ist er jedoch zu tadeln. Zorn im Affekt ist demnach das Übermaß, Sanftmut die Mitte und Zornlosigkeit der Mangel (vgl. ebd. S. 193). Da diese Sachverhalte schwierig zu katalogisieren und auseinanderzudividieren sind, muß Aristoteles oft feststellen, daß ihm die Begriffe fehlen oder daß eine Reihung nicht vollständig möglich ist. Schließlich sind auch die persönlichen Anlagen und Neigungen des Einzelnen zu berücksichtigen (vgl. Gigon 1995, S. 100). Aristoteles unterscheidet Handlungen und Verhaltensweisen danach, ob sie freiwillig oder unfreiwillig begangen werden. Erstere sind lobens- oder tadelnswert, letztere erlangen Verzeihung, wenn nicht sogar Mitleid (vgl. Gigon 1995, S. 149 - 153). Unfreiwillig ist, "was gewaltsam und aus Unwissenheit geschieht", freiwillig ist dasjenige, "dessen Ursprung im Handelnden selbst ist, sofern er alles Einzelne kennt im Bezug auf den Bereich der Handlung" (ebd. S. 153). Er fragt aber, ob aus Leidenschaft begangene Handlungen nicht doch freiwillig ausgeführt werden und kommt schließlich zu dem Ergebnis, daß es widersinnig sei, durch Zorn oder Begierde ausgelöste Handlungen als unfreiwillig begangen zu bezeichnen (vgl. ebd.). In diesem Zusammenhang untersucht Aristoteles die Entscheidung, die zur Freiwilligkeit gehört, aber dennoch nicht dasselbe ist. Plötzliche Handlungen können freiwillig sein, müssen aber nicht von einer Entscheidung ausgehen (vgl. ebd. S. 153 - 159). Die Entscheidung "scheint freiwillig zu sein, aber das Freiwillige ist nicht immer ein Gegenstand der Entscheidung" (ebd. S. 155). Entscheidungen hängen mit Denken, Überlegungen und der Wahl zwischen mindestens zwei Alternativen zusammen. Die Entscheidung bezieht sich auf das überlegende Streben nach Dingen, die in unserer Gewalt stehen, sie hat die Wege zum Ziel im Auge. Das Wollen hingegen ist auf das Ziel selbst gerichtet (vgl. 155 - 159). Aristoteles kommt nun zu folgender Schlußfolgerung: "Da nun das Ziel Gegenstand des Wollens ist und die Dinge, für die man sich als Mittel zum Ziele entscheidet, Gegenstand des Überlegens, so erfolgen die entsprechenden Taten durch Entscheidung und freiwillig. Und darauf beziehen sich die Tätigkeiten der Tugenden. Also ist die Tugend in unserer Macht und ebenso die Schlechtigkeit. Denn wo das Tun in unserer Macht steht, da gilt dies auch für das Nichttun, und wo das Nein bei uns steht, da steht auch das Ja bei uns. Wenn also das Handeln als etwas Schönes in unserer Macht ist, so ist es auch das Nichthandeln als etwas Schändliches, und wenn umgekehrt das Nichthandeln als etwas Schönes bei uns steht, so steht auch das Handeln als etwas Schändliches bei uns. Wenn es also an uns ist, das Schöne und das Schändliche zu tun und ebenso auch wieder nicht zu tun, und wenn eben darin das Gut- und Schlechtsein besteht, so ergibt sich, daß es bei uns steht, anständig oder gemein zu sein" (Aristoteles 1995, S. 159). Aristoteles versucht, immer zwischen rigorosen und radikalen Standpunkten zu vermitteln (vgl. Gigon 1995, S. 100 - 102). Glückseligkeit ist seiner Meinung nach auch gebunden an ein Minimum von Bedingungen wie beispielsweise Gesundheit und einen Mindestlebensstandard, durch Tugend allein trotz widriger Umstände ist sie nicht realisierbar. Er sieht sich nicht als einzigen im Besitz der Wahrheit; was frühere Generationen geleistet haben, ist Vorbereitung für seine eigene Philosophie und was andere Menschen und Völker denken und glauben, ist eine Ahnung des Richtigen. Seine Ethik konnte ihre Wirkung in einer Zeit relativer Sicherheit tun. "Daß sie versagte, wo Pathos verlangt wurde und wo die Menschen Pathos brauchten, um schwierige Situationen zu bewältigen, liegt auf der Hand. Denn die unerfüllbaren Forderungen haben die Menschen seit jeher ganz anders zum Handeln getrieben als die erfüllbaren" (Gigon 1995, S. 102). 2.2 Theologische Grundlegung 2.2.1 Die "Goldene Regel" - sittliche Grundformel der Menschheit Ungefähr seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ist mit der goldenen Regel eine sittliche Anweisung gemeint, die in dem deutschen Sprichwort "Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu!" ihren Niederschlag gefunden hat (vgl. Reiner 1974, S. 349ff). Es gibt sie aber in ähnlicher Verlautbarung bereits im Alten Testament, im Buch Tobit, 4, 15 (16): "Was du nicht leiden magst (wenn es dir von einem andern geschieht), das tu auch keinem (andern) an!" (zit.n. Reiner 1974, S. 349) und in einer positiven Fassung als Forderung Jesu im Neuen Testament (Matth. 7,12; Luc. 6, 31): "(Alles) was ihr wollt, daß euch die Leute tun, also tuet ihr auch ihnen!" (zit. n. Reiner ebd.). Diese Grundregel des Verhaltens beansprucht, die Gesamtheit der sittlichen Forderungen zu enthalten. Dieser Anspruch stützt sich weniger auf die Autorität Jesu, als vielmehr darauf, daß diese Regel jedermann einleuchtend sei hinsichtlich ihres Inhalts wie auch des umfassenden Charakters ihrer Forderung. "Sie bietet sich deshalb auch der natürlichen sittlichen Einsicht geradezu als eine Grundregel für das sittliche Verhalten der Menschen zueinander an" (Reiner 1974 ebd.). Aus diesem Grunde ist es nicht verwunderlich, daß diese Regel zunächst in der christlichen Tradition, dann aber darüber hinaus in der ganzen abendländischen Welt Verbreitung gefunden hat. Reiner weist aber nach, daß diese Regel bereits im Altertum in Indien und China wie auch im Islam von Bedeutung war (vgl. ebd. S. 349). Vermutlich stammt der Name aus dem Angelsächsischen, erstmals 1776 in einer Londoner Ausgabe als "golden rule" gebraucht (vgl. ebd.). Diese Regel löste sich schon im christlichen Altertum aus dem rein religiösen Zusammenhang: Aus dem Gesetz des Alten Testaments, dessen gesamten Inhalt diese Regel nach Matth. 7,12 umfassen soll, wurde das natürliche Sittengesetz. Im 2. Jahrhundert beschreibt dann Justinus die goldene Regel als die auf natürlicher Einsicht beruhende und allen Völkern bekannte Grundlage der Sittlichkeit, und Augustinus bezeichnet dann diese Regel wiederholt ausdrücklich als eine Forderung des natürlichen Sittengesetzes. Diese Forderung wird von der Frühscholastik übernommen, die Bedeutung noch genauer gefaßt und zugleich gesteigert, "indem durch ein Zusammennehmen ihrer positiven und negativen Formel der Gesamtgehalt des natürlichen Sittengesetzes als zum Ausdruck gebracht angesehen wird. Damit ist die Übertragung des Anspruchs von Matth. 7, 12 'Dies ist das Gesetz und die Propheten', auf das natürliche Sittengesetz vollzogen" (Reiner 1974, S. 351). Dieser Auffassung schließt sich die gesamte Augustinische Schule des Mittelalters an. Während Thomas von Aquin in dieser Regel noch eine zum Naturgesetz gehörige Forderung sieht, bricht die Reformation mit dieser Tradition. Lediglich die Lehre vom natürlichen Sittengesetz wird von den Reformatoren beibehalten, wenn auch unter Zurückdrängung seiner Bedeutung. Hobbes und Locke greifen sie wieder auf und in der philosophischen Ethik und Rechtslehre des Thomasius erreicht sie ihren Höhepunkt, als Prinzip des Ehrbaren, des Schicklichen und des Rechten. Kant erkannte und formulierte die innere Problematik dieser Regel, sie könne kein allgemeines Gesetz sein, da sie nicht den Grund der Pflichten gegen sich selbst, den der Liebespflichten gegen andere und nicht der schuldigen Pflichten gegeneinander enthalte, und ersetzte sie durch seinen kategorischen Imperativ. Seitdem ist sie, zumindest in Deutschland, weitgehend verstummt und wird auch von der heutigen philosophischen Ethik nicht zur Kenntnis genommen (vgl. 350 - 353). Das Prinzip aller Formen der goldenen Regel ist, "daß ein außerhalb der fraglichen eigenen Verhaltung gegebenes eigenes Wollen zum Maßstab für die Entscheidung dieses Verhaltens gemacht wird" (ebd. S. 355). Hierbei sind drei verschiedene Wesensformen zu unterscheiden: Die Einfühlungsregel sagt, daß wir andern nicht antun sollen, was wir selbst nicht erleiden wollen; die Autonomieregel fordert, das nicht zu tun, was man an anderen tadelt, und die Klugheitsregel des sozialen Verhalten rät, dem anderen nicht anzutun, was einem selbst nicht angetan werden soll, damit auch der andere es einem nicht antut (vgl. ebd. S. 353 - 376). 2.2.2 Thomas von Aquin: Über die Sittlichkeit der Handlung Für Thomas (1225-1274), Lehrer, großartigster Systematiker der Scholastik und herausragender Denker des Hochmittelalters war das Lehren eine der elementarsten Weisen geistigen Seins (vgl. März 1982, S. 48). Er war der Überzeugung, daß der Mensch durch seine Vernunft teil hat an der göttlichen Vernunft, dem Urgrund der Wahrheit. In der Sinneserfahrung, im Denken und im Sprechen gewinnt der Mensch Wirklichkeit. In Bezug auf sein umfangreiches Werk ist Thomas sowohl Theologe als auch Philosoph. Seine "Summa Theologica" ist ein "Lehrbuch für Anfänger". Geschrieben in der Gesprächsform, wendet sich dieses Buch direkt an den Lernenden und Leser; es wurde vom Publikum mit Begeisterung aufgenommen, denn es will nicht belehren, sondern zum Staunen und Fragen herausfordern (vgl. März 1982, S. 49). Thomas, der sich intensiv mit Platon und Aristoteles beschäftigt hat, verfügt ebensowenig wie sie über ein genaues Begriffssystem des Guten und des Bösen. Auch nimmt er nicht die Perspektive dessen ein, der für das Wohl des Weltganzen verantwortlich ist, denn Gott allein bleibt es vorbehalten, das Wohl des Universums zu erkennen und alles auf dieses Wohl hin zu ordnen (vgl. Spaemann 1990, S. VII - XVI). Eine beste Welt kann es nach Thomas nicht geben, weil wir nicht wissen, was für die Welt das Beste ist, denn "die Erfassung des Geschöpfes geht seiner Natur gemäß auf ein besonderes Gut, wie es seinem Wesen entspricht" (Thomas zit. ebd., S. IX). Dieses besondere Gut definiert die Verantwortung des Handelnden durch die jeweilige Stellung des Menschen im gesellschaftlichen Zusammenhang. So ist es beispielsweise die Pflicht des Sohnes, den kriminell gewordenen Vater nach Möglichkeit dem Gericht zu entziehen, um die Familie nicht zu gefährden. Der Richter hingegen, verantwortlich für das Wohl des politischen Gemeinwesens, muß darauf bedacht sein, den Verbrecher zu inhaftieren (vgl. Spaemann 1990, S. IX). Platons Ansicht, daß der Gerechte seine Angehörigen vor den Richter bringen muß, um ihr Seelenheil zu retten, ist für Thomas nicht akzeptabel, weil dieser Gedanke zu universalistisch ist: "Nicht was Gott will, sollen wir wollen, sondern das, wovon Gott will, daß wir es wollen. Was Gott will, erfahren wir immer erst nachträglich, belehrt durch den Gang der Ereignisse. Wovon er will, daß wir es wollen, das lehren uns Natur und 'gute Sitten' " (ebd.). Sittlichkeit wird hier nicht vom Gedanken der Vernunftautonomie her gedacht, sondern als das der spezifisch menschlichen Natur und Lebenssituation Gemäße. Nun geschieht dieses Menschengemäße nicht von selbst, sondern aus Vernunft und "in Gehorsam gegen den Willen Gottes, des Urhebers jener Natur, deren Gesetze wir zu erkennen im Stande sind" (ebd. S. X). Die Erkenntnis dieser Gesetze beruht auf regelutilitaristischen Erwägungen, d.h. bestimmte Handlungsweisen dienen normalerweise dem Erhalt der Gattung oder sind einem guten Leben entweder zuträglich oder abträglich. Verhält es sich im Einzelfall anders, "darf sich der Mensch gleichwohl nicht von der Regel dispensieren, falls diese ihre Geltung nicht einem irdischen Gesetzgeber verdankt, sondern der Wesensnatur des Menschen eingeschrieben ist. In diesem Fall nämlich begründet sie so etwas wie eine 'innere Richtigkeit', oder 'innere Falschheit', bestimmter 'Handlungsarten' " (Spaemann 1990, S. X). Für Thomas hat der Mensch als Natur eine spirituelle und als Person eine natürliche Dimension. Die menschliche Natur ist immer vernünftige, personale und sittliche Natur. Andererseits ist der Mensch nicht nur Vernunftwesen, sondern Person einer bestimmten Art: "Seine spezifische Natürlichkeit, seine organische Verfassung, seine Sexualität sind nicht nur Instrumente eines Subjektes in der Objektwelt, sondern sie qualifizieren sein Personsein als spezifisch menschliches" (Spaemann 1990, S. XI). Moralität ist die Sphäre der natürlichen, vernünftigen Person. Und aus diesem Grund ist der moralische Standpunkt für Thomas nicht der höchste, denn er ist nicht der Gottesstandpunkt, sondern ein bestimmtes Verhältnis zu diesem. Diese Relativität der für den Menschen unbedingt geltenden sittlichen Ordnung hat zur Konsequenz, dasjenige gelassen hinzunehmen, "was sich am Ende als Resultat unserer Bemühungen und vielleicht als deren Scheitern herausstellt" (ebd.). "Das Gesetz, das uns so und so zu handeln gebietet, gebietet unbedingt. Aber der Wille, der diesem Gesetz unbedingt folgt, will, was er will, nicht unbedingt, sondern 'wenn Gott will' [...].Die Einsicht in die Existenz Gottes ist so für diese Ethik tatsächlich konstitutiv. Denn es ist dieselbe Instanz, die die Unbedingtheit der Verpflichtung begründet, von der Uferlosigkeit einer alle Moral korrumpierenden positiven Verantwortung für die Unendlichkeit des Weltprozesses entlastet und schließlich durch Verzeihung jeder bereuten Schuld ständigen sittlichen Neubeginn möglich macht" (ebd. S. XI/XII). Für Thomas kann menschliche Glückseligkeit auch nicht in der Übung der Tugenden bestehen, denn diese sind eine ordnende Modifikation der Leidenschaften. Das Ziel der Leidenschaften aber ist die Erfüllung des fundamentalen Begehrens des Menschen und kann aus diesem Grund nicht die Tugend sein (vgl. ebd. S. XII). Da der Mensch Person einer bestimmten natürlichen Art ist, lassen sich seine Handlungen ebenfalls nach Arten unterscheiden. Kriterium hierfür ist "die Einheit bestimmter 'Objekte' der Handlung" (ebd.). Handlungsarten sind nicht nur "neutrales Material einer sittlichen Überformung durch die gute Absicht, sondern schlechte Handlungen unterscheiden sich von guten spezifisch" (ebd.). Tötung in Notwehr ist eine andere Handlung als Mord, sakrilegischer Raub unterscheidet sich von gewöhnlichem Raub. Handlungsart, nähere Umstände und letzte Absicht stehen in einem asymmetrischen Verhältnis zueinander, d.h., "die sittliche Güte einer Handlung ist letztlich eine Eigenschaft der hier und jetzt handelnden Person" (Spaemann 1990, S. XIII). Konkrete Handlungen stehen in der Lebenspraxis der Person und sind die Folge einer guten oder schlechten Vorentscheidung dieser Person, d.h. die konkrete Handlung ist Ausdruck der sittlichen Qualität der Person und ihrer Praxis. Es gibt also sittlich indifferente Handlungsarten, aber keine indifferenten konkreten Handlungen. Diese Indifferenz gilt aber nicht für alle Handlungsarten. Es gibt ihrer Natur nach gute und ihrer Natur nach böse Handlungen. "Die Asymmetrie liegt nun darin, daß ihrer Natur nach gute Handlungen durch die besonderen Umstände oder durch die schlechte Absicht des Handelnden verdorben werden, ihrer Natur nach schlechte Handlungen [...] aber nicht durch Absicht und Umstände in gute Handlungen verwandelt werden können" (ebd.). Eine gute Absicht, die für einen guten Zweck ein verwerfliches Mittel einsetzt, kann aus diesem Grund keine gute Absicht mehr sein, d.h. also, der Zweck heiligt nicht die Mittel, und durch die Umstände kann eine an sich gute Handlungsart in eine schlechte Handlung verwandelt werden. "Denn die gute Absicht besteht nicht darin, irgendein Optimum herbeizuführen, sondern seine durch Menschennatur und ordo amoris vorgezeichnete konkrete Verantwortung wahrzunehmen" (ebd.). Handlungen sind dann gut, wenn sie im Rahmen einer sittlichen Lebenspraxis vorgenommen werden. Nun können ihrem Wesen nach gute Handlungen aber auch durch besondere Umstände wie Ungerechtigkeit des Krieges oder durch die innere Haltung einer Person, z.B. Eitelkeit Elemente einer unsittlichen Praxis werden. Handlungen sind also nicht naturalistisch definierte Einheiten, die erst durch die sittliche Absicht überformt werden, sondern die handlungskonstituierenden Objekte selbst sind bereits rationaler und sittlicher Natur (vgl. ebd. S. XIIIf). Sittliche Qualität gewinnt eine Handlung durch Übereinstimmung mit dem Gewissen, das für Thomas deshalb geltende Regel sein kann,"weil es die subjektive Erscheinungsweise der an sich geltenden sittlichen Ordnung ist. Seine Urteile entspringen nicht einer irrationalen Tiefe des Gemütes, sondern sie sind Urteile der praktischen Vernunft" (ebd. S. XV). Nun kann es sein, daß eine Person in ihrem Urteil irrt, weil ihr bestimmte sittlich relevante Tatsachen nicht bekannt sind. Trotz der objektiven Falschheit dieses Tatsachenirrtums ist die daraus resultierende Handlung dem Gewissen nach gut. Irrt aber das Gewissen hinsichtlich der sittlichen Ordnung selbst, ist dieser Gewissensirrtum im Gegensatz zum Tatsachenirrtum immer mehr oder weniger schuldhaft, denn "zur Normalverfassusng der Vernunft gehört die Kenntnis unserer Pflichten. Die Geltung bestimmter, jedermann bekannter sittlicher Einzelnormen gilt ihm offenbar für gewisser als philosophische Prinzipienüberlegungen. Diese werden an jenen gemessen, nicht umgekehrt" (Spaemann 1990, S. XV). Wer seinem irrenden Gewissen zuwiderhandelt, sündigt, weil er das tut, was er selbst für unsittlich hält; wer ihm folgt, sündigt ebenfalls. "Man muß also festhalten, daß an sich jeder Wille, der von der Vernunft abweicht, sei diese eine rechte oder eine irrige, immer böse ist" (Thomas 1990, S. 91). Das normative Gewissen ist Ausdruck des geltenden Sittengesetzes, so daß ein normativ irrendes Gewissen also auf eine sittliche Unordnung in der Verfassung eines Menschen schließen läßt. Einziger Ausweg ist es, diese Unordnung zu beseitigen, doch "je weiter sich jemand von der Wahrheit entfernt hat, desto schwieriger wird freilich dieser Ausweg sein. Der, dessen Gewissen aufgrund von Gewöhnung an eine schlechte Handlungsweise gar nicht mehr schlägt, ist schlechter als der, der noch im Streit mit seinem Gewissen liegt" (Spaemann 1990, S. XV/XVI). Die Beurteilung der objektiven Richtigkeit einer Tat kann sich also nicht allein auf das Gewissen stützen; die öffentliche Gewalt bestraft den Mörder, auch wenn er sich auf sein Gewissen beruft. Eine Ausnahme wäre nur dann möglich, wenn die urteilende Instanz das Urteil des Täters von der objektiven Richtigkeit der Tat, z.B. im Fall eines Tyrannenmordes, teilt (vgl. ebd. S. XVI). 2.2.3 Luthers theologischer Rigorismus Luther (1483-1546) beschäftigte sich mit der für ihn zentralen Frage, ob der Mensch in der Lage sei, Gott aus reinem Herzen, d.h. aus freiem Willen zu dienen, oder ob sich nicht doch die Selbstliebe in des Menschen Gedanken und Handlungen als leitendes Motiv einschleiche (vgl. Niethammer 1980, S. 16). Er analysierte alle denkbaren menschlichen Verhaltensformen unter dieser Fragestellung und kam zu dem Ergebnis, "daß keine menschliche Regung ganz frei sei von den Triebfedern der Selbstliebe" (ebd.). Luthers rigoroses Postulat besagt, daß reine Gottesliebe auch nicht die geringste Beimengung einer Triebfeder aus der Selbstliebe dulde. Dieser Standpunkt entlarvt selbst die vermeintlich guten Werke als solche, "die als Ausfluß der 'begehrlichen Gottesliebe' zu verstehen sind" (ebd.). Der Mensch beispielsweise, der Gott aus Furcht vor der Hölle dient, ist nicht um Gottes Willen, sondern vielmehr um seiner selbst willen fromm, und die angebliche Gottesliebe entlarvt sich als Selbstliebe. Niethammer bezeichnet Luthers ethischen Ansatz als "Demaskierung des frommen Scheines (Scheinheiligkeit)" (ebd.). Dieses Anliegen Luthers, das sein gesamtes Werk durchzieht, ließ eine ganz andere Fragestellung nicht zu, nämlich, ob der Mensch, der in der Selbstliebe befangen ist, diese möglicherweise in Richtung auf die reine Gottesliebe umformen könnte (vgl. ebd.). Luther unterteilt die Menschheit in den "alten" Menschen, d.h. den ungebildeten natürlichen (erster Zustand) sowie den gebildeten gesellschaftlichen (zweiter Zustand), und den "neuen" christlichen Menschen, die sich voneinander grundsätzlich unterscheiden. Der "alte" Mensch lebt nach dem Prinzip der Erhaltung und Steigerung des physischen Wohlseins. Nach Luthers Formel sucht der "alte" Mensch fleischliche Lust, ein Streben, das sowohl die reichen als auch die armen Menschen kennzeichnet. Zu den "alten" Menschen zählt Luther auch die falschen Weisen, womit die Philosophen gemeint sind, und die falschen Klugen, die Juristen, die beide an die gute Natur des Menschen und an eingeborene Ideen der Gerechtigkeit, des Mitleids und der Vernunft glauben. Luther kritisiert, daß die Philosophie die menschliche Vernunft autonom setzt, sie aber nicht in ihrer Geschaffenheit, d.h. Beschränktheit und Endlichkeit, und in ihrer sündhaften Verstrickung sieht, und daß die Juristen seiner Meinung nach fälschlich das Gewissen als Richtschnur für gerechtes Handeln nehmen, während doch Gottes Handeln weder menschlicher Vernunft noch menschlichem Gewissen folgt. Eine dritte Kategorie des "alten" Menschen stellen die falschen Heiligen, die nur nach außen Gutes tun, innerlich aber selbstgerecht und hoffärtig sind. Sie alle streben nach physischer oder geistiger Lust, stehen im Bann der Selbstliebe und sind darum allesamt Sünder. (vgl. Niethammer 1980, S. 29 - 45). Ein so gearteter Mensch betrachtet sich "als Werk seiner selbst, d.h. er betrachtet sich streng genommen als Schöpfer seiner selbst, er macht sich zum Götzen seiner selbst" (ebd. S. 45) und entthront und leugnet auf diese Weise Gott (vgl. ebd. S. 49). Der "neue", christliche Mensch hingegen begreift seine leibliche Existenz als Geschenk Gottes und versteht sich vor allem als Erhalter und Diener seines Leibes. Daraus leitet sich ein besonderer Umgang mit dem Körper ab: Beherrschung, Arbeiten, Fasten, Übungen also, die der "maßhaltenden Zucht" (Luther zit.ebd. S. 58) dienen. Weisheit und Klugheit stellt der "neue" Mensch nicht in den Dienst der Selbsterhöhung, sondern in den Dienst des Nächsten. Er ist sich ständig seines Mangels an Einsicht bewußt, tut gute Werke ohne sich dessen zu rühmen und bleibt sich dabei des unerreichbaren Fernzieles des rechten inneren Wollens, der reinen Gottes- und Nächstenliebe, bewußt. Er kann sich zwar nicht von der Selbstliebe befreien, aber er kann sie zum Gegenstand des Hasses machen (vgl. Niethammer 1980, S. 58 63). "Recht leben heißt: den alten Menschen töten, nach dem neuen verlangen" (ebd. S. 59). Nun steht dieser Wandel der Gesinnung weder in der Macht des einzelnen Menschen selbst noch in der des Erziehers. Er ist vielmehr ein Werk Gottes am Menschen. Im dritten Zustand, dem der Rechtfertigung, gehorcht der Mensch aus freiem Antrieb dem Gesetz. In diesen Zustand wird der Mensch allein durch die Pädagogie Gottes versetzt. In diesem Sinne hat der Erzieher nur Hilfsdienste zu leisten insofern, als er das Wort Gottes an die Mitmenschen weitergibt. Auf die Wirkung der Belehrung selbst hat er keinen Einfluß. Dennoch hat der Erzieher die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß in den weltlichen Dingen Vernunft und Recht das Regiment führen. "Vernunft und Recht sollen der Unkultur, der Barbarei und dem 'Kampf aller gegen alle' Schranken auferlegen. 'Seid untertan der Obrigkeit' heißt also in diesem Zusammenhang: gehorcht der Vernunft und gehorcht dem Recht, denn Vernunft und Recht streiten wider Unvernunft und Unrecht" (Niethammer 1980, S. 72). Somit sind Wissenschaft und Sozialverhalten Hauptgegenstände der Erziehung. Die Erziehung hat die Aufgabe, den rohen Menschen aus dem ersten Zustand in den zweiten Zustand, den des äußeren Rechts, zu versetzen. Alles weitere steht außerhalb ihrer Verfügungsmacht (vgl. Niethammer 1980, S. 72/73). Um den Ichwillen des Menschen zu brechen, sendet Gott nach Luthers Ansicht dem Menschen Strafen, einmal als Strafworte, gemeint ist hiermit das Drohen und Schelten im Alten Testament, und dann als Strafwerke, worunter Luther körperliche Leiden und den Verlust des Ansehens und der Ehre versteht, was Spott, Verfolgung und Einsamkeit nach sich zieht (vgl. ebd. S. 51). Innerhalb der Pädagogie Gottes definiert Luther auch die familiäre Erziehung und das Verhältnis von Eltern und Kindern. Erziehen ist für Eltern als Laienerzieher vernünftige Arbeit und bewußte Führung, für die Kinder Wachsen und Gehorchen; Impuls und Erfolg jedoch werden durch die Pädagogie Gottes bestimmt (vgl. Petzold 1969, S. 90). Nach Petzold ist dieser Sachverhalt eine "unmißverständliche Absage an das uralte, autoritäre Hineinformen des wehrlosen Kindes in ein vom Erzieher diktiertes Menschenideal [...]. Von Gottes Plan mit dem Kind her - nicht einfach vom Kind her - wird das erzieherische Planen dem Kinde zugut begrenzt. Vom Kinde her wird es insofern begrenzt, als in ihm Christus begegnet, der den sich selbst manifestieren wollenden Erzieher auf die in der Taufe begründete Würde des Kindes hinweist und mit seiner Liebe (als Gabe und Beispiel) zu einer angemessenen erzieherischen Liebe befreit, die liebt und doch führt, aber in diesem Führen auch dient, weil sie frei ist" (ebd.). Das Eigenrecht der Eltern im Sinne Luthers ist demnach im Grunde ein Dienstrecht aufgrund der ihnen durch das "neu geschenkte Evangelium verliehenen Freiheit von bloß vorfindlichen Motivationen zugunsten einer Freiheit für Gottes Liebe zum Kind" (Petzold 1969, S. 90). 2.3 Aufklärung: Toleranz - Inbegriff der Tugend Toleranz bedeutet Gelassenheit gegen fremde Meinungen und den damit verbundenen Widerspruch, d.h. das Ertragen der Schwächen anderer und die Respektierung fremder religiöser Ansichten. Obwohl nun das Christentum in seiner Entstehungszeit selbst um Anerkennung und Toleranz zu kämpfen hatte, ging die römisch-katholische Kirche auf dem Weg zur Macht schonungslos gegen Heiden und Häretiker vor. Die Einheit des Reiches und die Einheit des Glaubens wurden gleichgesetzt; das Bündnis von Staat und Kirche funktionierte in dieser Hinsicht reibungslos: Staatsgefährdung und Gottlosigkeit bildeten jeweils die Hauptgründe für die Verweigerung von Toleranz. So ging die doppelte Aufgabe des Christentums, Toleranz zu erzwingen, aber auch zu gewähren, früh verloren und die Toleranzidee des Neuen Testamentes, daß man sogar seinen Feind lieben solle, blieb historisch-politisch unwirksam. Nächstenliebe wurde eine Sache des einzelnen, der sich dafür selbst vor Gott verantworten mußte, und betraf nicht die Handlungen von Institutionen und Völkern (vgl. Frenzel 1974, S. 9 - 11). Erst die Freisetzung des Individuums in der Renaissance und die Reformationskämpfe konnten dem Toleranzprinzip wieder Geltung verschaffen. Es gab eine Reihe von Toleranzedikten, die mehr oder weniger erfolgreich waren. Aber erst durch die Krise des spätscholastischen Katholizismus, der mit Denkern wie Descartes, Spinoza, Kepler, Galilei und Leibniz nicht mehr fertig wurde, konnte jenes theistische Klima entstehen, in dem die Toleranzidee gewissermaßen neu entdeckt wurde: Voltaires Toleranztraktat wurde 1763 veröffentlicht und seit Lessing war Tugend nicht mehr bloß eine Frage opportuner politischer Maßnahmen, sondern ein sittlicher Wert an sich. Seither ist Toleranz die Anerkennung des Rechts eines jeden Menschen, seine Überzeugungen in Sachen der Vernunft und des Glaubens frei zu äußern und nach ihnen zu handeln. Toleranz wurde zum regulativen Prinzip der mündigen, frei operierenden Vernunft (vgl. ebd. S. 12 - 14). 2.3.1 Rousseaus Gesellschaftskritik und die gute Natur des Menschen Rousseaus (1712-1778) realpolitisches Interesse ist nach Bolles (1995) Untersuchung Motiv und Ausgangspunkt für seine Anthropologie und Gesellschaftskritik. Die kritische Auseinandersetzung mit der französischen Gesellschaft nahm Rousseau mit Blick auf die politische und kulturelle Entwicklung in Genf vor. Er hielt Paris für ebenso sittlich dekadent wie das antike Rom und befürchtete einen ähnlichen Verfall für Genf, das Paris in jeder Hinsicht nacheiferte. In dieser Konstellation liegt für Bolle der Grund seines leidenschaftlichen Eintretens für eine positive Anthropologie und seine heftige Kritik an Hobbes. Rousseaus Naturbegriff nimmt Elemente aus allen Epochen auf, löst sie aus ihren ursprünglichen Kontexten und fügt sie neu zusammen zu einem sowohl gesellschaftskritischen als auch praktisch konstruktiven Begriff (vgl. Bolle 1995, S. 64f). In Genf, einer Stadt mit ökonomischem Schwerpunkt im Bereich Handwerk, Handel, Bankwesen, wurden die damit einhergehenden weitreichenden ökonomischen und politischen Freiheiten der Bürger durch die Machtansprüche der Genfer Regierung bedroht: Aus politischer Bequemlichkeit und um der öffentlichen Ruhe willen waren die Bürger versucht, ihre politischen Freiheiten aufs Spiel zu setzen (vgl. Bolle 1995, S. 66f). Rousseau sah nach Bolle hierin nicht nur ein aktuelles, sondern ein strukturelles Problem moderner Gesellschaften: gewonnene Freiheiten drohen unter der entpolitisierenden Wirkung der Eigendynamik ökonomischen Handelns zu zerrinnen. Dieser Widerspruch von Ökonomie und Politik hieß für Rousseau: "Preisgabe der Idee einer reinen Demokratie, - nicht aber: Preisgabe der bürgerlichen Freiheit" (ebd. S. 67). Dieses Problem der Bedrohung und möglichen Preisgabe von Freiheiten war einerseits eine Frage der Güterabwägung, aber darüberhinaus von grundsätzlicher, anthropologischer Bedeutung: Rousseau mußte statt der Hobbesschen negativen Menschenatur einen alternativen Naturbegriff entwickeln, "der den natürlichen Hang zur Freiheit bestätigt, einen natürlichen Hang zur Herrschaft jedoch bestreitet und zugleich in Aufarbeitung der beschriebenen Widersprüchlichkeit der bourgeoisen Lebenssituation die Preisgabe der Freiheit als Selbstentfremdung herausstellt" (ebd.). Dies ist das Anliegen des 2. Diskurses, das im Emile unter pädagogischer Fragestellung fortgeführt wird. Insofern ist der Emile mehr als eine Erziehungstheorie. Rousseau will im Emile "eines der entscheidenden ethischen Grundprobleme seiner Zeit behandeln, nämlich die anthropologische Frage nach dem Übergang des Menschen von ursprünglicher Güte zu der - auch von Hobbes konstatierten - Lasterhaftigkeit" (ebd. S. 68). Rousseau will belegen, daß der Mensch von Natur aus gut und frei ist und keiner Einschränkung seiner politischen Freiheit bedarf; also muß er zeigen, wie der Mensch durch gesellschaftliche Bedingungen einerseits und individuelle Widerstände als erziehungsbedingtes Ergebnis der Wechselwirkung von Individuum und Gesellschaft andererseits verdorben wird und wie man dem pädagogisch begegnen kann (vgl. Bolle 1995, S. 68). Rousseau löst sich also vom aristotelischen Axiom einer naturgegebenen Gesellschaftlichkeit und weist diese als ein künstliches Produkt menschlicher Geschichte aus. Der Mensch ist ursprünglich gut, weil er ein Geschöpf Gottes ist, das seinen festen Platz wie jede andere Kreatur in einer guten Schöpfungsordnung hat; der Mensch wird erst durch das Machwerk der Menschen schlecht. (vgl. ebd. S. 69 - 72). Innerhalb dieses Legitimationsrahmens der biblischen Schöpfungstheologie entwickelt Rousseau seine positive Anthropologie, das Bild des nach Freiheit, Glück und Vervollkommnung strebenden Menschen (vgl. Bolle 1995, S. 162) Seine Freiheitsphilosophie stellt den Menschen vollständig in die Verantwortung für sein eigenes Handeln und begrenzt damit die Verantwortung Gottes für das individuelle Schicksal. So löst er das Problem der Theodizee und den Widerspruch zwischen seinem religionsphilosophischen Optimismus und seiner pessimistischen Gesellschaftsdiagnose. Da er den Zustand der Gesellschaft nicht als unabänderlich betrachtet, hat seine Philosophie den Zweck, radikal aufzuklären und Freiheit zu provozieren (vgl. ebd. S. 169f). Rousseau widerspricht der Erbsündenlehre und erklärt Sünde und Schuld des Menschen zu einem individuellen Problem reiner Weltlichkeit: es gibt für ihn nur die geschichtlich erworbene persönliche Schuld des einzelnen. Den entscheidenden Sündenfall der Menschheitsgeschichte sieht er in der willkürlichen Einführung des Privateigentums, was zu gesellschaftlicher Ungleichheit, Ungerechtigkeit und sozialer Abhängigkeit geführt und Lasterhaftigkeit begünstigt hat. Das Drama dieses Sündenfalls besteht nun darin, daß er sich in jedem einzelnen Menschen bei seiner Sozialisation wiederholt. Rousseau glaubt, im Emile eine Antwort auf die Frage gefunden zu haben, wie man diesen individuellen Sündenfall durch die richtige Erziehung vermeiden kann (vgl. ebd. S. 175). Obwohl Rousseau sich darüber im klaren ist, daß der Endzweck des Daseins sich dem Erkenntnisvermögen der menschlichen Vernunft entzieht, ist er davon überzeugt, daß der Endzweck das Glück des Menschen sei und nicht das Leid, daß es aber ohne das Leid keine Erfahrung des Glücks geben kann. Die grundsätzliche Möglichkeit von Glück und Leid ist für ihn in der Vorsehung angelegt, konkretes Leid und Glück hingegen fällt als Bestandteil seiner Freiheit in die Verantwortung des Menschen (vgl. ebd. S. 171). Rousseaus Vernunftreligion soll den Glauben nicht der Vernunft unterordnen; "Vielmehr ist Rousseaus Einsicht in die Grenzen der Vernunft getragen von der Achtung vor den Möglichkeiten und Grenzen religiöser Erfahrung anderer im Bewußtsein der eigenen Grenzen" (Bolle 1995, S. 168). Vernunft und Glauben stehen gleichberechtigt nebeneinander. Die Verletzung dieses Grundsatzes führt zu Intoleranz, religiöser Knechtschaft und Verachtung der Menschlichkeit (vgl. ebd.). Glück ist für Rousseau ein unter bestimmten Lebensumständen dauerhaftes subjektives Gefühl, das sich erst aus der produktiven Spannung zwischen dem Besitz eines begehrten äußeren Gegenstandes und dem Bewußtsein eines reinen Herzens ergibt (vgl. Bolle 1995, S. 143ff). Ursprung des echten Glücks ist zwar die Reinheit des Herzens, die mit der ursprünglichen Güte des Menschen identisch ist, aber in der Künstlichkeit des gesellschaftlichen Lebens, in der es ein natürliches Sein nicht gibt, strebt der Mensch, fixiert allein auf sein sinnlich-materielles Wohl, einem falschen Glück nach. Nach Rousseaus Ansicht besitzt der Mensch sowohl ein sinnlich-materielles als auch ein rein geistigmoralisches Interesse an seinem eigenen seelischen Wohlergehen. Das physische Interesse dient der lebensnotwendigen Selbsterhaltung und verbleibt noch ganz außerhalb von Moralität und Tugend; dies Glück ist ein flüchtiges, rein äußerliches. Das Glück der Seele resultiert hingegen allein aus dem geistig-moralischen Interesse. Dies natürliche Streben nach Glück ist zugleich die Bedingung seiner Tugend. Wahres Glück unter gesellschaftlichen Bedingungen wird erst durch die Ausübung der Tugend möglich. Sie ist die notwendige Verstärkung der menschlichen Natur. Die Tugend ist kein Selbstzweck und an sich zum menschlichen Glück nicht nötig. Aber unter den gegebenen gesellschaftlichen Voraussetzungen ist die Tugend unentbehrliche Bedingung zum wahren Glück: "Die Grundlage des wahren Glücks ist das gute Gewissen des Tugendhaften" (Rousseau zit. ebd. S. 144). Überschreitet die Selbstliebe allerdings das Lebensnotwendige, verwandelt sie sich in Eigenliebe und steht der Tugend und damit dem wahren Glück im Weg (vgl. ebd. S. 146). Da der Mensch von Natur aus gut ist, sind auch seine ursprünglichen Empfindungen gut. Der Mensch kann zwar aus seinen Gefühlen falsche Schlüsse ziehen, aber dies ist lediglich ein Werk der Vernunft. Vernunft kann irren, das Gefühl nicht. Für Rousseau ist das Gewissen nicht Bestandteil der Vernunft, sondern "Ausdruck eines eigenständigen, unmittelbaren und daher der Vernunft vorgeordneten Gefühls für das Gute, welches sich zur Liebe zum Guten herausbilden läßt" (Bolle 1995, S. 176). Das Gewissen ist zwar vernunftbezogen, aber dennoch ein von ihr unabhängiges, allgemeingültiges Prinzip, "ein Prinzip ursprünglicher Übereinstimmung aller Menschen" (ebd. S. 178). Das Gewissen wird aus den zwei Prinzipien der menschlichen Seele gebildet, der Selbstliebe, d.h. der Sorge um die Selbsterhaltung, und dem Mitleid, einem natürlichen Widerwillen, empfindende Wesen leiden zu sehen, und wird so zur Basis menschlicher Identität. Dem Gewissen zu trotzen heißt, der eigenen Natur zu widersprechen. Rousseaus Ethik ist eine Moralität im ureigenen Interesse des Subjekts. Im Konfliktfall zwischen Leidenschaften und Gewissen ist es die Vernunft, die entweder Partei für das Gewissen ergreift oder, von den Leidenschaften korrumpiert, das Gewissen zum Schweigen bringt. Das Gewissen kann nicht irren, es ist der eigentliche Ort der Freiheit (vgl. Bolle 1995, S. 178). Rousseau unterscheidet vier Arten der Freiheit: Unter physischer Freiheit versteht er das außerhalb der Moral liegende Streben nach Selbsterhaltung, unter gedanklicher Freiheit die Spontaneität des Geistes als Folge eines Lernprozesses, unter politischer Freiheit die Souveränität der Bürger auf sozialer (=ökonomischer), theoretischer (=Unterscheidung von Gesamtwohl und Gesamtheit der Einzelwillen) und moralischer (=Gemeinwohl vor Eigennutz) Basis und unter sittlich-moralischer Freiheit die Tugend, d.h. das Beachten der Gesetze und des Gesamtwohles. Politischer und moralischer Allgemeinwille sind dann identisch, wenn sich der eigene Wille am allgemeinen Willen orientiert. Während aber politische Freiheit nur in einer Republik bestehen kann, die bürgerliche Autonomie garantiert, ist der Bezugsrahmen der moralischen Freiheit nicht das politische Gemeinwesen, sondern die Menschheit selbst (vgl. ebd. S. 84 - 92). Herrschaft und Zwang sind die Feinde der Freiheit. Sie sind die maßgeblichen Mechanismen, "die die natürliche Güte des Menschen behindern und die Herausbildung einer sittlichen Freiheit verhindern. Herrschaft und Zwang sind nicht teleologisch zu rechtfertigen als Bestandteil der menschlichen Natur, sondern sind ein zufälliges und willkürliches Produkt der menschlichen Geschichte" (Bolle 1995, S. 82). Freiheit ist die aktive Bedingung des Glücks. Sie ist gebunden an die Möglichkeit der selbstverantwortlichen Nutzung der eigenen geistigen, seelischen und körperlichen Kräfte, die im neugeborenen Menschen zwar angelegt sind, aber durch Erziehung erst ausgebildet und vervollkommnet werden müssen. Die Diskrepanz zwischen Wollen und Können soll durch die Ausbildung aller Kräfte minimiert werden, der Mensch gleichzeitig aber seine eigenen Grenzen erkennen und akzeptieren lernen. Denn erst die harmonische Übereinstimmung von physischen und geistig-seelischen Kräften führt zur Tugend. Der Heranwachsende wird als Subjekt seines eigenen Bildungsprozesses ernstgenommen, so daß der Erziehung lediglich eine Begleitfunktion zukommt (vgl. ebd. S. 154f). Das Kind ist unentwickelt und unvernünftig und daher zur Moralität noch nicht fähig. Es unterscheidet sich von den pädagogischen Möglichkeiten her also wesentlich vom Erwachsenen. Ferner sind die individuellen natürlichen Anlagen und der daraus resultierende spezifische Umgang mit den verschiedenen sinnlichen Eindrücken zu berücksichtigen. Erziehung kann also nicht darin bestehen, einen Bildungsprozess und ein konkretes Bildungsziel im voraus zu konzipieren, sondern das Kind durch Beobachtung kennen und verstehen zu lernen. So ergibt sich für Rousseau als pädagogische Konsequenz ein Methodenwechsel von negativer zu positiver Erziehung, der Unterscheidung von natürlicher und sittlicher Lebensordnung entsprechend (vgl. Bolle 1995, S. 260 - 263). Erziehungsmittel sind in erster Linie die altersgemäßen Erfahrungen und Einsichten des Heranwachsenden, pädagogisch legitim ist seitens des Erziehers lediglich die Verhinderung einer "möglichen Eskalation der Diskrepanz zwischen entwickelten Bedürfnissen und Möglichkeiten ihrer Befriedigung sowie die stete Kontrolle jedweder 'positiven' pädagogischen Maßnahme durch die erziehungsvertragliche Grundlegung eines zwar ungleichen, aber nicht-hierarchischen dialogischen Verhältnisses" (ebd. S. 320). 2.3.2 Kant: Das radikal Böse in der menschlichen Natur Kants (1724-1804) Abhandlung "Über das radikale Böse in der menschlichen Natur", 1792 erstmals veröffentlicht und sofort von der preußischen Zensur verboten, entstand im Zusammenhang mit drei weiteren, ebenfalls inkriminierten Schriften über eine Vernunftreligion mit moralischer Absicht. Kant hielt an seinem Veröffentlichungsrecht fest, denn Aufklärung erforderte seiner Ansicht nach einen freien, öffentlichen Gebrauch der Vernunft. Erst eine Kabinettsorder des Königs konnte ihn 1894 an weiteren Publikationen hindern, allerdings nur bis zum Tode Friedrich Wilhelm II im Jahre 1897. Im Streit der Fakultäten 1897 äußert er sich wieder zu Vernunft- und Offenbarungsreligion und rechnet mit der ganzen Zensuraffäre ab (vgl. Schulte 1988, S. 13 - 15). Kant bekennt sich als moralischer Theist, "weil der durch die Kritik der reinen Vernunft gegangenen traditionellen Metaphysik die Mittel fehlen, auch nur die oberste aller religiös-metaphysischen Wahrheiten, die Existenz Gottes, zu beweisen" (ebd. S. 18). Metaphysik ist für Kant nur noch spekulative Vernunft. Einen Ausweg bietet der moralische Theismus der praktischen Vernunft, der trotz seines Wissens um die Unzulänglichkeit der Gottesbeweise an der Überzeugung von der Existenz eines Gottes festhält. Das Fundament dieses Glaubens ist die Moral, "das ganze System seiner Pflichten, welches durch die reine Vernunft a priori apodiktisch gewiß erkannt wird" (Kant zit. ebd. S. 19). Das bedeutet eine Umkehrung des Primates der Metaphysik vor der Ethik; denn nunmehr geht die Religion nicht mehr aus der Erkenntnis des Göttlichen, sondern Religion wird Paraphrase des Moralischen. Das Moralisch-Praktische ist das Wesentliche einer Religion innerhalb der Vernunft, die Basis, von der aus der moralische Theist sich einen präzisen Begriff von Gott machen kann. (vgl. ebd. S. 19 - 23). Die moralische Dogmatik Kantischer Philosophie beschäftigt sich vornehmlich mit den Pflichten der "selbstgegebenen Vorschriften zum Guten" (Kant zit.n. Schulte 1988, S. 28) und thematisiert dabei kaum die Frage nach dem Bösen. Kant setzt freies, moralisches, also sittlich gutes Handeln mit Autonomie gleich, folglich wäre dann nicht-moralisches Handeln nicht-frei und nicht-autonom. Diese einfache Negation aber wäre absurd (vgl. ebd. S. 29): "Deshalb ist es unmöglich, aus der Freiheit die Gültigkeit des Sittengesetzes zu beweisen" (Reiner 1974, S. 69). Es geht nun darum, die Freiheit der Willkür zum Bösen, d.h. die Annehmung sittengesetzwidriger Maximen thematisieren zu müssen, um Abweichungen vom Sittengesetz erklären und dem Menschen zurechnen zu können. Die Zurechenbarkeit des moralisch Bösen ist das Leitmotiv der Abhandlung über das radikale Böse, die als einzige Schrift Kantischer Autonomiephilosophie diesem Problem gewidmet ist (vgl. Schulte 1988, S. 28 - 30). In Kants Moralphilosophie sind Gut und Böse nicht durch Tugendlehren, göttliche Gebote und andere Wertsetzungen bestimmt, sondern jedes Individuum soll sich durch die richtige Form seines Wollens dem kategorischen Imperativ entsprechend das moralische Gesetz seines Handelns selbst geben; danach erst wird die Handlung als gut oder böse beurteilt: "Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne" (Kant zit. ebd. S. 33). Hier geht es nicht um moralisch qualifizierte Zwecke, wie Glückseligkeit, Gottes Wille, Lust oder Unlust, sondern es geht formal um die Verallgemeinerungsfähigkeit von selbstbestimmten, individuellen Handlungsmaximen. An diesem Formalprinzip gewinnt Kants Autonomiephilosophie einen Begriff und ein Kriterium für Gut und Böse. Erst wenn nicht mehr der Erfolg oder der Zweck einer Handlung, sondern die zugrundeliegende Gesinnung über die Moralität der Handlungen entscheidet, ist Moralität kein aristokratisches Privileg mehr wie noch bei Aristoteles, sondern Sache aller. Hier spiegelt sich die Idee der Republik wider, vor deren Sittengesetz alle gleich sind (vgl. ebd. 34f). Wenn Kant vom Guten und vom Bösen spricht, ist allein das Moralisch-Gute und das Moralisch-Böse gemeint. Er unterscheidet Moralisches von Physischem bzw. Moralisierung von Kultivierung oder Zivilisierung, denn das eine muß nicht zwangsläufig mit dem anderen einhergehen. Moralische Übeltäter können "kerngesund, höflich und hochkultiviert sein; der Fortschritt von Kultur und Wissenschaft hat nicht zwingend einen Fortschritt der Moral zur Folge. Ganz im Gegenteil kann die Menschheit alle Höhen der Zivilisierung erreichen und zugleich sogar moralisch regredieren" (Schulte 1988, S. 40). Auch kann Erfahrung kein Kriterium für eine Prognose über einen geschichtlichen Fort- oder Rückschritt der Moralität sein, denn da für Kant die Freiheit das Fundament aller Moralität ist, wäre jederzeit die Umkehr der jeweiligen geschichtlichen Tendenz möglich. Freihandelnden Personen, so Kant, könne man zwar vorschreiben, was sie tun sollen, aber es lasse sich nicht vorhersagen, was sie tun werden. Auch bleibt Erfahrung stets äußerlich und kann deshalb über die einer Handlung zugrundeliegende Absicht täuschen. Entscheidend für die Beurteilung der Moralität von Handlungen ist nach Kant die zugrundeliegende Gesinnung. Handlungen lassen sich zwar beobachten, nicht aber die ihnen zugrundeliegenden Maximen. Kant unterscheidet hier zwischen Legalität und Moralität: Der sittliche Wert einer Handlung bestimmt sich gerade nicht über den Handlungserfolg oder die Übereinstimmung mit allgemeinen Gesetzen, sondern durch den guten Willen und die moralische Absicht. Furcht vor Sanktionen kann einen Menschen zwar pflichtgemäß, also legal handeln lassen; eine Handlung ist aber nur dann moralisch, wenn sie ausschließlich auf dem gewollten Guten beruht. Über die Maxime seines Handeln kann nur der Mensch selbst Auskunft geben, sie lassen sich nicht von außen durch Erfahrung erschließen. "Seine Pflicht tun" heißt also, sein Wollen bewußt und freiwillig in Einklang mit allgemeinen Gesetzen zu bringen (vgl. 39 - 43). Um aber den Menschen böse nennen zu können, muß das Böse dem Menschen zurechenbar und deshalb auf seine Freiheit zurückführbar sein. Der erste subjektive Grund des Bösen, d.h. tatsächlich zurechenbare böse Handlungen, kann folglich nur eine Maxime des Willens sein. Hätte der erste Grund des Bösen hingegen eine naturgegebene Ursache, wäre das Böse nicht zurechenbar, weil es "dem Menschen durch seinen Status als Naturwesen aufgenötigt würde" (ebd. S. 44). Moralisch zurechenbar ist nur Böses oder Gutes, das dem freien Gebrauch der Willkür zuzuschreiben ist, denn nur die Willkür ist frei von aller Nötigung durch Naturkausalität: "Die Freiheit, von Naturkausalität ungenötigt eine Handlung spontan, 'von selbst', anzufangen, ist Bedingung der Zurechenbarkeit von Handlungen und damit auch oberste Bedingung aller Autonomie in der Kantischen Moralphilosophie" (Schulte 1988, S. 45). Diese Bedingung gilt nun auch im Fall des Mißbrauchs der Willkür zum Bösen: Die freie Annehmung von Maximen durch die Willkür garantiert die volle moralische Zurechenbarkeit guter wie auch böser Handlungen; "die Annehmung der Maximen ist der Ortz der Entscheidung zwischen Gut und Böse" (Schulte 1988, S. 46). Maxime, die dem kategorischen Imperativ widerstreiten, weil sie nicht widerspruchslos verallgemeinerbar sind, gelten Kant als böse. Der Mensch als moralisches Subjekt gebraucht oder mißbraucht seine Willkür immer in Ansehung des sittlichen Gesetzes (vgl. ebd. S. 47). Die Frage nach dem Grund oder der Triebfeder für die Annehmung böser statt guter Maximen beantwortet Kant in den Anmerkungen zu seiner Abhandlung: Es bedarf der immer schon guten Gesinnung des moralischen Subjektes, "damit nur moralisch gute Maximen angenommen werden, in die das moralische Gesetz als alleinige Triebfeder aufgenommen wird" (ebd. S. 67). Der erste subjektive Grund der Annehmung guter Maximen ist demnach die gute Gesinnung; auf diese Weise schließt Kant andere Gründe und Triebfedern aus, die bei Handlungen oder auch bei Maximen noch eine Rolle spielen können, z.B. Gesetzeskonformität. Die Gesinnung angesichts des Gesetzes erlaubt keine Indifferenz mehr: "Entweder ist jemand prinzipiell gewillt, das Gesetz zur alleinigen Triebfeder der Maximen seines Handeln zu machen und somit moralisch gut zu handeln, oder er ist es nicht. Dann ist er seiner Gesinnung nach prinzipiell gewillt, unter Umständen auch nicht-moralisch zu handeln" (ebd. S 68). Nur eine ausschließlich nach Naturgesetzen vollzogene Handlung könnte moralisch indifferent sein, weil sie mit dem sittlichen Gesetz als dem Gesetz der Freiheit in keiner Beziehung steht. Die Gesinnung wird von Kant immer mit Bezug auf das Sittengesetz betrachtet; sie ist das innere Prinzip der Maximen und somit die einzige Grundlage, auf der eine Beurteilung der Moralität der Handlung vorgenommen werden darf: "Denn selbst eine zum allgemeinen Gesetz taugliche, d.h. gesetzeskonforme Handlungsmaxime ist erst dann moralisch gut, wenn sie allein umwillen ihrer Moralität, in guter Gesinnung angenommen wird, weil nur das Sittengesetz, nicht andere Zwecke, die alleinige Triebfeder ihrer Annehmung ist" (ebd. 69/70). Kant setzt Gesinnung mit Denkungsart gleich und schreibt beide einem Akt der Freiheit zu, d.h. beide sind nicht indifferent, aber sehr wohl veränderlich. Die Frage nach dem ersten Grund der Zuziehung einer guten oder bösen Gesinnung führt allerdings in einen infiniten Regress: "Der allererste Grund der Wahl einer Gesinnung muß unerforschlich bleiben, denn 'von dieser Annehmung kann nun nicht wieder der subjektive Grund, oder die Ursache, erkannt werden (obwohl danach zu fragen unvermeidlich ist; weil sonst wiederum eine Maxime angeführt werden müßte, in welche diese Gesinnung aufgenommen worden, die eben so wiederum ihren Grund haben muß)' " (Schulte 1988, S. 70/71). Hier zeigt sich eine Grenze Kantischer Moralphilosophie, denn die moralische Grundhaltung, die die einzelnen Handlungen bestimmt, muß zwar als frei gewählt und von selbst angenommen betrachtet werden, da sie sich einem ersten Willkürakt verdankt und nicht angeboren ist, sie wird aber von Kant nicht material begründet. Es bleibt offen, warum letztlich jemand eine moralisch gute Gesinnung haben soll. Kant setzt voraus, daß "ein Individuum seiner Gesinnung nach immer schon moralisch handeln will" (Schulte 1988, S. 72). An der Möglichkeit der freien Wahl auch böser Maximen zerbricht allerdings die von Kant vorgenommene Identifikation von Freiheit und Autonomie (gleichbedeutend mit Sittlichkeit) (vgl. ebd.). Kant nimmt nun einen "in dem Subjekt allgemein liegenden Grund aller besondern moralisch-bösen Maximen" an, einen "Hang zum Bösen in der menschlichen Natur" (Kant zit. ebd. S. 79). Er definiert "Hang", indem er ihn von der "Anlage" unterscheidet: Hang kann zwar angeboren sein, darf aber doch nicht als angeboren gedacht werden, "sondern auch (wenn er gut ist) als erworben, oder (wenn er böse ist) als von dem Menschen selbst sich zugezogen" (Kant zit. ebd.), denn sonst wäre er nicht zurechenbar, während "Anlage" immer als angeboren gilt. Hang setzt an bei der bösen Gesinnung und wird von Kant in drei Stufen der Verderbnis der Gesinnung beschrieben: Die erste Stufe ist die Gebrechlichkeit des Willens, d.h. dem Willen, das Gesetz in die Maxime aufzunehmen, steht eine andere Neigung entgegen, an der der schwache Wille bei an sich guter Gesinnung scheitert. Die zweite Stufe äußert sich in der Gesinnung der Unlauterkeit; hier reicht das Gesetz als Triebfeder allein nicht aus, sondern es bedarf noch anderer Triebfedern. Diese Gesinnung ist nicht rein moralisch, denn sie erlaubt auch pflichtmäßige Handlungen. Die dritte, zentrale Stufe, ist die Verderbtheit oder Bösartigkeit der Gesinnung, die das moralische Gesetz als Triebfeder anderen, nicht-moralischen Triebfedern nachordnet. Hier wird die sittliche Ordnung der Triebfedern pervertiert, die Denkungsart ist radikal verdorben. Ein solcher Mensch kann bei lauter guten Handlungen dennoch böse sein. Willensschwäche und Unlauterkeit stuft Kant als unvorsätzlich, aber schuldhaft ein, während die falsche Ordnung der Triebfedern eine vorsätzliche, schuldhafte Tat ist, denn das überordnende Aufnehmen anderer Triebfedern als der des Sittengesetzes ist ein vorsätzlicher, zurechenbarer und darum schuldhafter Akt (vgl. Schulte 1988, S. 78 - 83). Das Böse in der menschlichen Natur kann nur gattungsspezifisch nachgewiesen werden. Daraus ergäbe sich dann der Widerspruch zwischen Allgemeinheit des Bösen und Freiheit zum Bösen, wie auch beim Hang zum Bösen ein Widerspruch zwischen angeboren und selbst zugezogen bleibt. Dieser Widerspruch läßt sich nicht lösen, wenn Kant an Freiheit und Zurechenbarkeit festhalten will. So gelingt Kant der Nachweis von der bösen menschlichen Natur nicht, sondern er kann lediglich in der Möglichkeit des radikalen, die Gesinnung eines Menschen verderbenden Bösen den obersten Grund der Annehmung einzelner gesetzwidriger, moralisch böser Maximen finden. Gleiches gilt natürlich umgekehrt auch für den Nachweis, daß der Mensch von Natur aus gut sei (vgl. Schulte 1988, S. 85 - 88). Es bleibt die Erkenntnis, daß vernünftiges Verhalten nicht zwangsläufig moralisch gutes Handeln ist; und Kant bleibt die Erklärung schuldig, warum der Mensch letztlich moralisch gut handeln soll. Daß dazu die Möglichkeit besteht, ist allein noch kein ausreichender Grund, und die Selbstbesserung bleibt angesichts der Möglichkeit einer radikalen Verderbnis eine moral-praktische und eine moral-theoretische Zumutung. Das Attribut "radikal" weist nicht auf einzelne böse Handlungen hin, sondern macht die für die Moralität gänzlich verdorbene Gesinnung deutlich (vgl. ebd. S. 112 - 119). Aus diesem Sachverhalt ergeben sich für Kant Konsequenzen für die Erbsündenlehre und für die Theodizee: Der Freiheitsgebrauch des ersten Menschenpaares hat keine genetischen Folgen, sondern nimmt die Freiheits- und Vernunftsituation aller späteren Menschen nur vorweg. Damit hat sich die kirchliche Erbsündenlehre für Kant erledigt (vgl. ebd. S. 143). Die Theodizee mißlingt für Kant u.a., "weil das Mißverhältnis von Moralisch-Bösem und physischem Übel in der Welt sogar den Vorwurf der Ungerechtigkeit gegen Gott rechtfertigt" (ebd. S. 149). "Erst dieses vom Theodizee-Zwang befreite, radikale, nicht von der Natur aufgezwungene, ererbte oder von Gott im Schöpfungsplan vorgesehene Böse fällt voll und ganz in die Verantwortung des Menschen" (ebd. S. 154). 2.4 Fazit: Von der Sehnsucht nach Gerechtigkeit zur Pervertierung der Tugend Wie die geschichtliche Auseinandersetzung mit dem Sittlichkeitsbegriff zeigt, entstanden die jeweiligen Sollensanforderungen vor einem konkreten gesellschaftspolitischen Hintergrund. Platon und Rousseau sehnten sich nach Gerechtigkeit und Freiheit und wollten politschen Einfluß ausüben, um die gesellschaftlichen Gegebenheiten entsprechend ihren idealen Vorstellungen zu verändern; sie hielten den Menschen grundsätzlich für gut, wenn auch als zeitweilig verirrt oder verdorben durch falsche Leitbilder, aber Besserung war durch die Erneuerung des Menschen möglich. Aristoteles und Thomas von Aquin lebten hingegen in eher ruhigen, geordneten Zeiten; sie hatten an tradiertem Wissen, Sitten und Gesetzen wenig auszusetzen, vielmehr ging es ihnen um Definitionen und Feinabstufungen ihrer Bewertungskriterien und um praktische Handlungsanleitung. Ihre nüchterne Betrachtungsweise des Menschen erkannte die Bedeutung von Gewohnheiten für Verhalten, Einstellungen und Lebensweisen. Luther und Kant, beide Revolutionäre des Denkens und heftige Gegner von Intoleranz und Ignoranz, konzipierten den bösen Menschen. Luther setzte als Pessimist seine ganze Hoffnung auf Gottes Gnade, von der allein er den neuen, christlichen Menschen abhängig sah; Kant konnte die Richtigkeit seiner Ausgangshypothese nicht deduktiv beweisen, so daß er sein Postulat vom radikal bösen Menschen aufgeben mußte, obwohl doch alle Erfahrung eigentlich dafür spricht. Und Vernunft ist, wie Kant zeigt, zwar Bedingung für selbstverantwortliches Handeln, aber nicht automatisch identisch mit Sittlichkeit. Rousseaus Gedankengut führte zur blutigen Umwälzung des feudalistischen französischen Gesellschaftssystems. Im Bann von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit fegte der Sturm der vom Verlangen nach Gerechtigkeit entfesselten Emotionen zuerst die adligen Unterdrücker, dann die angeblichen Feinde der Republik hinweg. Die revolutionäre Gewalt hatte sich verselbständigt, und aus Robespierres Tugend des Mitleidens mit den Armen war die Schreckensherrschaft der Wohlfahrtsausschüsse und der Guillotine geworden (vgl. Arendt 1994, S. 111ff u. Arasse 1988, S. 97ff): "Tout est permis pour ceux, agissent dans le sens de la revolution" (Saint-Just zit.n. Arendt 1988, S. 117, 372). Insgesamt betrachtet kann man wohl sagen, daß sich zwar allen philosophisch-religiösen Erklärungs- und Anleitungsversuchen zum Trotz der Mensch nicht dauerhaft gebessert hat; er befreite sich aber von dem Glauben an die Gerechtigkeit Gottes sowie an göttliche Einwirkung und Vorsehung, um sich auf seine eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten zu besinnen und so autonom und selbstverantwortlich zu werden. 3 Bestimmung des gegenwärtigen Sittlichkeitsbegriffs 3.1 Philosphische Diskussionstendenzen Nach Kants moralphilosophischer Konzipierung der Sittlichkeit wird mit Hegels Kritik an der Gleichsetzung von Moral und Sittlichkeit eine Sittlichkeits - Moralitäts - Kontroverse eingeleitet, die auf der einen Seite ein institutionalistisches Ethikkonzept, auf der anderen Seite ein reflexionsmoralisches Ethikverständnis entfaltet. "Dieser Sittlichkeits - Moralitäts Opposition liegt eine Problemstellung zugrunde, die die neuzeitliche Moralphilosophie seit Hegels Tagen durchgängig prägt und ein helles Licht auch auf die zeitgenössischen Kontroversen zwischen den Diskursethikern und den Hermeneutikern einerseits und den konstruktivistischen Liberalen und den Kommunitaristen andererseits wirft" (Kersting 1995a, S. 908). Die Kritik Hegels an Kant richtete sich gegen die Kantische Zergliederung der Sittlichkeit in einzelne sittliche Handlungen und gegen die damit verbundene Herauslösung des Individuums aus dem sittlichen Kosmos der Gemeinschaft. Hegel konzipiert ein rechtsphilosophisches Sittlichkeitssystem, "das im Staat zugleich die sittliche Mitte und den umfassendsten institutionellen Rahmen erblickt, das die moralische Subjektivität auf ein Moment im Stufenbau der Sittlichkeit herabstuft und das institutionelle Geflecht sittlicher Beziehungen: Sitte, Gewohnheit und die gesellschaftlichen und politischen Institutionen als Wirklichkeit des subjektiven moralischen Willens und seines angestrebten Guten begreift" (Kersting 1995a, S. 910). In diesem Rahmen manifestiert sich Sittlichkeit auf der Seite der Subjekte als Tugend, Rechtschaffenheit, Gewohnheit und Sitte, letzteres hier gemeint als das "Wirklichsein der Sittlichkeit in den festen Einstellungen und Handlungsmustern der Individuen" (ebd. S. 912), auf der gesellschaftlichen Seite "in einer Hierarchie von Institutionen, die von der Familie über die moderne, marktförmig organisierte Gesellschaft mit ihren beiden vormodernen Schutzinstitutionen Polizei und Korporation bis zum Staat reicht" (ebd.). Das der Sittlichkeit "zugrundeliegende Verhältnis von Besonderheit und Allgemeinheit findet nach Hegels Überzeugung im modernen, auf privatisierte Familie und Marktgesellschaft sich stützenden staatlichen Gemeinwesen seine zugleich umfassendste und höchste Ausprägung" (ebd.). Der in der Tradition des Hegelianismus stehende Sittlichkeitspositivismus lehrt die Sittlichkeit der Sitte und lehnt jede moralische Geltungsüberprüfung ab; die in der Tradition des Kantianismus stehende Moralphilosophie hingegen geht von einem Spannungsverhältnis zwischen Sitte und Sittlichkeit aus: Wahre Sittlichkeit muß sich kritisch über die Sitte erheben, wenn die Sitte sich als unvernünftig erweist; die Verbindlichkeit der Sitte wird zwar anerkannt, aber nicht als grenzenlos und unbedingt angesehen; die letzten Entscheidungen sucht und findet das sittliche Bewußtsein in sich selber (vgl. ebd. S. 919). Die gegenwärtigen Bemühungen philosophischer Selbstverständigung in Ethik und politischer Philosophie finden innerhalb dieser Moralitäts Sittlichkeits - Opposition statt: Die Moralitätsfraktion, gebildet von den Anhängern der Diskursethik, versteht sich als kommunikationstheoretische Kantianer, teilt Kants Ethikverständnis und reformuliert "seinen Moral- und Rechtsuniversalismus als Verfahrensethik der moralischen Argumentation" (Kersting 1995a, S. 920). Die Sittlichkeitsfraktion geht von einem "geschichtlich konkreten, lebensweltlich fundierten oder praxisbegründeten Konzept sittlicher Vernunft" (ebd.). aus, u.a. auf der Grundlage immer schon geltender Normen und aus geschichtlichen Lebensformen gewonnener sittlicher Rationalität (vgl. ebd.). Die Anhänger des Sittlichkeitskonzeptes werfen den Moralitätsethikern vor, daß ihre Universalismusansprüche illusionär und der Letzbegründungsanspruch gescheitert seien. Die Anhänger des Moralitätskonzeptes meinen hingegen, daß die aristotelischen und hegelianisierenden Sittlichkeitsmodelle den modernen Denk- und Lebensverhältnissen nicht gewachsen seien und deren Komplexität, Wandlungstempo, Pluralisierungs- und Individualisierungstendenzen nicht gerecht würden. Da beide Seiten gute Argumente gegeneinander vortragen, kristallisieren sich vermittelnde Positionen mit unterschiedlichen Akzenten heraus: Honneth beispielsweise skizziert 1992 ein formales Sittlichkeitskonzept, "das keinesfalls den Universalismus der Moral- und Rechtsnormen zugunsten eines eingelebten partikularen Ethos aufkündigen will, jedoch den von den Moralitätsethiken vernachlässigten Gedanken der notwendigen institutionellen Bedingungen eines autonomen Lebens aufgreift und Sittlichkeit begreift als 'das Insgesamt an intersubjektiven Bedingungen, von denen sich nachweisen läßt, daß sie der individuellen Selbstverwirklichung als notwendige Voraussetzungen dienen'; zu diesem 'intersubjektiven Netzwerk einer posttraditionalen Sittlichkeit' gehören Rechtsverhältnisse, aber auch geteilte Wertvorstellungen, die eine 'solidarisierende Kraft der kollektiven Identitätsbildung' entfalten" (Kersting 1995a, S. 921). 3.2 Kurzbeschreibung des Sittenbegriffs Sitte bezeichnet ursprünglich den Zusammenhang von Wohnort und dort vorherrschenden Gewohnheiten und Lebensweisen: "Sie ist eine vorgefundene Lebensform, die Handlungsund Beurteilungsgewohnheiten, Sichtweisen und Interpretationsmuster umfaßt und fraglose Verbindlichkeit besitzt. Als 'mos maiorum' beansprucht es Geltung, weil es immer schon in Geltung gestanden und präreflexive Anerkennung gefunden hat" (Kersting 1995b S. 897). Die Zugehörigkeit zu einer Lebensgemeinschaft konstituiert sich durch die Teilnahme an deren Ethos. Zuziehende und Heranwachsende werden durch Aneignung des Ethos Mitglieder der jeweiligen Lebensgemeinschaft. Die Ethos-Ordnung eines Gemeinwesens ist jedoch im Gegensatz zur politischen Ordnung menschlicher Willkür entzogen und unverfügbar. Im engeren Sinne ist Sitte eine ethische Bestimmung und Bestandteil des Ethos ebenso wie 1. Brauch und Konvention, 2. richtige und anerkannte Verhaltensweisen und 3. soziale und politische Institutionen. Dieses Ethos-Verständnis liegt Aristoteles praktischer Philosophie zugrunde (vgl. Kersting 1995b, S. 898). Die genaue semantische und systematische Abgrenzung von Sitte, Sittlichkeit und Recht wird erst Anfang des 20. Jahrhunderts im Rückgriff auf Hegels Unterscheidung von Sittlichkeit und Moralität vorgenommen. Sitte wird dann als gemeinschaftsgebundene Tatsache, Sittlichkeit hingegen als etwas allgemein Menschliches und als Idee definiert. Dagegen steht die Differenzierungsthese, die Sitte als gemeinsame Vorform betrachtet, in der Recht und Moral noch ungeschieden enthalten sind. Die fortschreitende Differenzierung der Funktionen des Gemeinschaftslebens ist als Rationalisierungs-, Emanzipations- und Individualisierungprozess sowohl Bedingung wie auch Ausdruck der modernen, freiheitlichen Gesellschaft (vgl. Kersting 1995b, S. 904f). Die normentheoretische Differenzierung unterscheidet die drei Bereiche nach den Gesichtspunkten "der Erzwingbarkeit, des Sanktionscharakters und der Gesinnungs- und Handlungsbezogenheit" (ebd. S. 905). Obwohl die praktische Philosophie der Gegenwart bemüht ist, "den aristotelisch-hegelschen Standpunkt der Sittlichkeit wieder zur Geltung zu bringen" (ebd.), genießt der Sittenbegriff in den Auseinandersetzungen der Hermeneutiker und Diskursethiker keine besondere konzeptuelle Bedeutung (vgl. ebd.). 3.3 Sittlichkeit als pädagogischer Begriff Reiner (1974) definiert Sittlichkeit (1972 gleichlautend in Herders Lexikon der Pädagogik, Bd. 4 veröffentlicht) als den "Grundcharakter des Verhaltens (Handlungen, Unterlassungen, Wollungen, Strebungen, Gesinnungen) freier Wesen, sofern es unter dem Gegensatz von Gut und Böse und der (damit zusammenhängenden) Norm eines schlechthin fordernden Sollens steht" (ebd. S. 485). Sittlichkeit ist entstanden aus dem Verantwortungsgefühl für den Mitmenschen, dem Ehrgefühl für die eigene Person und dem Autoritätsgefühl gegenüber "verehrungswürdigen Personen von überlegener Einsicht" (ebd. S. 486). Sie beruht auf Werten und Unwerten, für die oder gegen die sich der Mensch aufgrund von Macht und Freiheit einsetzen kann. Es gibt absolute, in sich ruhende Werte, z.B. das Leben an sich oder das Recht, und relative Werte wie z.B. Ansehen oder Angenehmes. Relative Werte sind " 'eigenrelativ', wenn sie mir selbst, 'fremdrelativ', wenn sie andern zugute kommen. Absolute und fremdrelative Werte sind objektiv bedeutsam, eigenrelative nur subjektiv bedeutsam. Erstere stellen sich unabhängig von meinen Interessen als seinsollend dar, letztere als nur mich befriedigend" (Reiner 1974, S. 486). Der Bestand objektiv bedeutsamer Werte soll geachtet werden und Vorrang vor den subjektiv bedeutsamen Werten und deren Begehrlichkeit haben. "Wer dieser Forderung entspricht, handelt sittlich gut, wer ihr entgegenhandelt, in grundsätzlichem (weitestem) Sinn böse" (ebd.). Ist zwischen mehreren objektiv bedeutsamen Werten zu wählen, stellt sich nicht die Frage nach Gut und Böse, sondern nach dem sittlich Richtigen. "Dieses bestimmt sich teils aus allgemeinen Gesichtspunkten (Werthöhe, -dringlichkeit, menge), teils aus individuellen (persönliche Befähigung, konkrete Erfolgsaussichten). Das so sittlich richtig Erscheinende tut jeder von selbst, solange dabei nicht auch subjektiv bedeutsame Werte auf dem Spiel stehen. Zu entscheiden aber, was objektiv sittlich richtig ist, bedarf oft der Klugheit und der Erfahrung" (ebd. S. 487). In vielen Fragen ist dabei die Hilfe der Einzelwissenschaften und ihrer speziellen Ethikbereiche nötig. Da die bei der Beantwortung vorausgesetzten Zusammenhänge geschichtlich wandelbar sind, bedürfen diese von Zeit zu Zeit der Überprüfung und Erneuerung. "Auch so bleibt in den individuellen Faktoren des sittlich Richtigen ein nicht allgemein faßbarer Rest, der einer Situationsethik ihr (begrenztes) Recht gibt" (ebd.). Ist bei der Wahl zwischen mehreren objektiv bedeutsamen Werten mit einem davon ein subjektiv bedeutsamer Wert verbunden, so ist die Handlung nur dann sittlich gut, wenn ihr nur der objektiv bedeutsame Wert zugrundeliegt; sittlich wertlos, aber doch sittlich richtig und nicht böse, ist die Handlung, wenn sie nur wegen des subjektiv bedeutsamen Wertes erfolgt. "Steht dagegen der subjektiv bedeutsame Wert auf seiten des als nachzusetzend gegebenen objektiv bedeutsamen, dann ist die auf ihn abzielende Handlung nicht nur sittlich falsch, sondern auch böse" (ebd.). Die Freiheit der Gesinnungen, denen das sittliche Handeln entspringt, ist nach Reiner keine schöpferische. Die Gesinnungen bilden sich unter dem Einfluß von Anlagen, Umwelt und Willen; sie sind keine Folge eines Entschlusses und können stärker oder schwächer ausgeprägt sein, unterdrückt oder gestärkt werden. Für Reiner wird von hier aus "die Möglichkeit besonderer göttlicher Einwirkung" (ebd.). verstehbar, wie er hier auch die Möglichkeiten der Erziehung sieht: nämlich durch die Darbietung guter und der Eindämmung der verführerischen Wirkung schlechter Vorbilder (durch tägliches Vorleben, Kunst, Erzählung und Dichtung). "Das Böse ist dabei in seinem Unwert fühlbar zu machen" (Reiner 1974, S. 488). Da das Kind in ein Verständnis der Werte erst hineinwächst und der erste sich ihm erschließende objektiv bedeutsame Wert der Personwert von Mutter und Vater ist, "ist die Sittlichkeit anfangs autoritativ bestimmt" (ebd.). Fängt das Kind nun an, Fragen zu stellen, "muß möglichst auch das Verständnis für die Gründe der elterlichen Gebote, und d.h. für die dabei jeweils zugrunde liegenden Werte, geweckt und gepflegt werden" (ebd.), denn das Ziel der Erziehung muß Selbstverantwortlichkeit sein (vgl. ebd.). 3.4 Fazit: Vom Ethos zur Ethik Die ursprünglich im Ethos-Begriff enthaltenen Einzelvorstellungen von Sitte, Moral, Sittlichkeit und Recht haben sich in wechselseitigen Wirkungen mit den rationaler und komplexer werdenen Gesellschaften ausdifferenziert. Das Recht ist, zumindest in den meisten europäischen Staaten, inzwischen juristisch und konstitutionell verankert. Eine Verletzung der Rechtsordnung durch strafbare Handlungen zieht in der Regel eine Anklage und eine gerichtliche Untersuchung nach sich. Sittlichkeit und Moral hingegen unterstehen nicht der Rechtsprechung. Sie sind inhaltlich nicht eindeutig definiert und stellen dennoch Beurteilungskriterien für eigenes Handeln und Wollen und für das Verhalten anderer dar, wenn auch ohne rechtliche Konsequenzen. Das heißt also, daß doch nicht automatisch alles erlaubt ist, was nicht ausdrücklich verboten ist. Ethische Fragen spielen in allen wissenschaftlichen Disziplinen und gesellschaftlichen Bereichen eine wichtige Rolle. Sie werden u.U. öffentlich kontrovers diskutiert und können über politische Gremien und verfassungsrechtliche Verfahren Auswirkungen auf die Gesetzgebung und die Rechtsprechung haben. 4 Theorie und Praxis pädagogischer Sittlichkeitskonzepte 4.1 Johann Amos Comenius: Theologe, Pansoph und Didaktiker Comenius (1592-1670), eigentlich tschechisch Komensky, Theologe, Lehrer, Sekretär und letzter Bischof der böhmisch-mährischen Brüderunität, erlebte die Zeit der Religionskriege als Flüchtling auf lebenslanger, leidvoller Wanderschaft. Sein umfangreiches Werk umfaßt systematische Lehrbücher, religiöse Trostschriften, mystische Prophetien und friedenspolitische Vorschläge und war weltweit verbreitet. Comenius genoß zu Lebzeiten hohes internationales Ansehen, und sein Rat wurde von einflußreichen Politikern und Wissenschaftlern geschätzt. Seine beiden Hauptwerke waren die "Didactica Magna" und das zu seinen Lebzeiten unveröffentliche siebenbändige Alterswerk "Consultatio Catholica", dessen Manuskript erst 1934 wiederentdeckt wurde, sein berühmtestes Werk der "Orbis sensualium pictus", ein bebildertes Realienbuch (vgl. Scheuerl 1992, S. 22 u. März 1982, S. 89f). Comenius Lebenswerk ist an einem historischen Wendepunkt entstanden, zwar nicht mehr mittelalterlich, aber trotz der Erkenntnisse des Kopernikus noch dem Ptolemäischen Weltbild verhaftet. Comenius nimmt die Renaissance-Lehre vom neuen Adam auf, "der durch Christus erlöst und damit freigegeben ist zur Verwirklichung seiner guten Natur" (Scheuerl 1979, S. 67), und setzt sie in pädagogische Planungen um, "ohne von der Skepsis und den Subjektivismen der anhebenden Neuzeit im geringsten berührt zu sein" (ebd.). Obwohl seine Reformen zukunftsweisend sind, bleibt Comenius eingebunden in die ständischen Vorstellungen seiner Zeit. Ihn charakterisieren soziales Engagement, weltläufige Toleranz und geistige Offenheit auch entgegengesetzten Positionen gegenüber. Er hat sich selbst immer als Theologen betrachtet. Seine reformerischen Ideen und deren didaktische Umsetzungen stehen im Dienst seiner zentralen Bemühung, "an der Verbesserung von Gottes Schöpfungswerk mitzuwirken, weil dieses auf den 'Synergismus' des Menschen angewiesen ist. Es geht ihm um die 'Restitutio Christi' inmitten einer offenkundig defekten Wirklichkeit" (ebd. S. 68). Comenius Denken und Wirken ist im Zusammenhang mit der pädagogischen Reformbewegung des 17. Jahrhunderts zu sehen, die wiederum auf Reformbestrebungen des Humanismus aus der Zeit vor der Reformation zurückgriff (vgl. Flitner 1960, S. 226ff). Den Humanisten ist es zwar nicht gelungen, das gesamte Schulwesen zu reformieren, aber es gibt Schriften, methodische Überlegungen und gute Lateinschulen, an die Comenius und seine Zeitgenossen anknüpfen können. Auch in seiner Anthropologie steht Comenius den Humanisten näher als Luther. Er übernimmt die humanistischen Prinzipien einer natürlichen Pädagogik, "alles fließe von selbst und ohne Zwang" (Comenius zit.n. Flitner 1960, S. 227), wobei Natur zum einen als Gesamtschöpfung und Absicht des Schöpfers begriffen wird, zum anderen als besondere Anlage der Einzelperson und Vermögen der jeweiligen Altersstufe, denen die Erziehung und Bildung genauestens folgen sollen. Diese Prinzipien werden in ihren Anwendungen durchdacht und auf das Praktisch-Didaktische hin systematisiert (vgl. ebd. S. 228). Für Comenius ist die Welt ein rationales, göttliches Ordnungswerk, in das Lernen und Wissen eingefügt sind. Gott hat den Menschen mit einer eigenen rationalen Kraft ausgestattet, damit er erkennend und tätig an dem göttlichen Werk mitarbeite. "Der kleinste Körper spiegelt als Mikrokosmos die Gesetzlichkeit des Ganzen wider" (ebd. S. 228). Aus dieser naturrechtlichen Gleichheit aller Menschen vor Gott resultiert die Forderung nach gleichen Möglichkeiten und gleicher Bildung für alle Kinder. Dieser Grundgedanke von Comenius pansophischem Lebenswerk erneuert die neuplatonische Lehre der Entsprechung von Mikro- und Makrokosmos und wendet sie auf die Erziehung an. Das Kind soll durch Glauben, Wissen und Können in die göttlich-rationale Ordnung eingeführt werden, d.h., das Kind ist dem Zufall zu entziehen und einer rechten Ordnung seines inneren und äußeren Lebens zuzuwenden. Ein hierauf abzielendes pädagogisches System erfordert für das didaktische Vorgehen ein unablässiges Zusammenwirken von sprachlichem und sachlichem Erfassen der Welt sowie eine stufenweise, altersgemäße Bildung, die aber "auf jeder Stufe ein ganzes sein und alle Bereiche des Wissens und des Seins schon umfassen" muß (ebd. S. 230). So wird die Erziehung der ein- bis sechsjährigen bereits einem wissenschaftlichen Schema zugeordnet, z.B. gehören erste Sprechübungen zu Grammatik und Rhetorik, sind Essen und Trinken Übungen in den Naturwissenschaften; die innere Verschiedenheit von kindlichem und rational-wissenschaftlichem Denken wird nicht erkannt (vgl. ebd.). Comenius Pansophie entsteht aus der Kritik an dem alten Wissen der heidnischen Philosophie wie auch an dem des scholastischen Mittelalters und ist gedacht als eine Antwort auf die geschichtliche Situation seiner Zeit (vgl. Rüsen 1967, S. 2f u. Schaller 1967, S. 22f). Wahres Wissen konnte es bis zu Comenius nicht geben, weil seiner Ansicht nach nicht alle Quellen des Wissens vollständig genutzt wurden (vgl. Schaller 1967, S. 23f). Die drei Quellen der wahren Erkenntnis aller Dinge sind die Welt der sichtbaren Dinge, die Heilige Schrift als Offenbarung Gottes und das Gemüt oder der Geist, in den Gott die gemeinsamen Wahrheiten gelegt hat. Alle bisherige Philosphie mußte an der Ausweglosigkeit ihres Wissens scheitern, weil sie sich auf jeweils nur eine Quelle gestützt hat. Die Pansophie hingegen nutzt alle drei Wissensquellen und kann sich somit direkt auf Offenbarung und die zeitlose, göttliche Wahrheit berufen. Die Pansophie ist "ein Spiegel(bild) der Sachenwelt, ein Spiegel(bild) des Makrokosmos" (ebd. S. 24), sie bietet vollkommene Kenntnis der Ideenwelt Gottes, der sichtbaren Natur und der Schaffenskraft des Menschen, der Kunst (vgl. ebd. S. 26). Gott ist die Lichtquelle alles gespiegelten Seins und aller Erkenntnis (vgl. 47); erst die göttliche Erleuchtung macht Wissen vollkommen, so daß es vom menschlichen Geist wiedergespiegelt werden kann (=chresis) (vgl. Schaller 1967, S. 65-67). Comenius Pädagogik ist nur im Zusammenhang mit der Pansophie zu verstehen; Pädagogik ist das Mittel, um das Ziel der Pansophie, die Verbesserung der Welt, zu erreichen (vgl. ebd. S. 156ff). Der Sündenfall der Stammeltern hat den Menschen in einen Zustand der Schuld und der Untüchtigkeit gestellt und die Welt dem Verfall preisgegeben. Von der rechten Instandsetzung des Menschen hängt nun die Erneuerung der ursprünglichen göttlichen Welt ab. Die Instandsetzung ist der theologische Auftrag, der von der Pädagogik praktisch umgesetzt werden soll, d.h., Theologen sind gleichzeitig Pädagogen, denn Pädagogik ist praktische Theologie. Letztes Ziel ist aber nicht der Mensch und die Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern die Ausrichtung des Menschen auf Gott und das ewige Leben. Die Pädagogik soll den Menschen nun von ihm selbst und von dieser irdischen Welt hinwegführen. Erst dadurch gibt sie ihm Raum als Mensch, auch auf dieser Welt. "Die Pädagogik ist ihrem Wesen nach paradox. Erst das Absehen vom Menschen in seinem reflexiven Selbstverständnis gibt den Menschen als Menschen sich selbst und seinen Aufgaben frei, die ihm in Mitmensch und Sache begegnen" (ebd. S. 157). Diese Abwendung von der Welt bedeutet nicht mönchische Weltflucht, sondern Gewinnung von Abstand und Übersicht, um kooperativ als Werkzeug Gottes in der Welt dienen zu können, eine "Hinwendung an das konkrete Dasein des Ewigen in der Zeit" (ebd. S. 384). Dennoch ist es nicht der Bildungsvorgang selbst, der den wahren Menschen hervorbringt, sondern Gott, "der dem Menschen, der auf seinen Wesensort zurückgefunden hat, die Menschlichkeit schenkt" (ebd. S. 159). Bildung und Humanismus haben bei Comenius noch eine ganz andere Bedeutung als in der modernen Pädagogik; es ist eine Pädagogik im Dienste Gottes und nicht im Dienst des Menschen. "Sie ist immer nur möglich in der Bezogenheit auf einen außer ihr selbst liegenden Zweck" (vgl. ebd. S. 161). Da Staat und Kirche auch nur Stationen auf dem Weg der Rückkehr zu Gott sind, ist die Pädagogik "eine Funktion Gottes" (Schaller 1967 S. 162) d.h., sie ist dem Zugriff von Staat und Kirche zur Verwirklichung eigener Zwecke immer schon entzogen. Für die Pampaedia, Herzstück der Consultatio Catholica, greift Comenius auf die Paideia Platons zurück und wandelt sie seinen Vorstellungen entsprechend um: Paideia bedeutet nun Umkehr und Buße, sie ist ein Rückweg zur wahren Natur des Menschen, aber nicht aus eigener Kraft, sondern mittels "Weg-Führung durch Gott zu Gott" (ebd. S. 165). Erster Zugriff Gottes ist die Taufe, sie ist der göttliche Ursprung der Paideia. Dieses eindeutige Führungsverhältnis nennt Comenius Pan-Paideia oder Pampaedia. Pan- soll verdeutlichen, daß Gott der aktive Teil, der Mensch lediglich passiv beteiligt ist, d.h., der Eigenwille des Menschen wird dem Willen Gottes untergeordnet. Führen ist der Grundgedanke von Comenius Pädagogik, auch Lehren ist Führen, und Erziehen meint Herausführen aus dem Stand der Verkehrtheit. Der Mensch ist hier lediglich Gehilfe Gottes. Eine solche Führung ist ohne Gehorsam des Lernenden nicht denkbar: "So gelangen der Lehrende und die Lehre nicht recht an den Lernenden, wenn die Furcht und Ehrerbietung fehlen, welche die Gemüter zur Aufmerksamkeit und Sorgfalt gleichsam zusammenhalten" (Comenius zit. ebd. S. 168). Die Disziplin ist der Zwang, der den Menschen in das rettende Führungsverhältnis hineintreibt. Der Widerspruch zwischen dem Grundsatz der Gewaltlosigkeit und dem Zwang der Disziplin ist nur ein scheinbarer, denn die Gewaltlosigkeit des freiwilligen Einordnens in die göttliche Ordnung bezieht sich einzig auf den wiederherzustellenden wahren Naturzustand des Menschen, während die Unterordnung des Eigenwillens der verkehrten Natur nur zwangsweise geschehen kann. Der Unterricht (institutio) hat die Aufgabe, den Menschen durch gute Führung und Unterweisung in den Stand seiner ursprünglichen Natur hineinzuführen (introductio), Paideia ist somit Herausführung und gleichzeitig Einführung (vgl. ebd. S. 167 - 171). Pan- ist ein Methodenbegriff, der im Zusammenhang mit der Paideia darauf hinweist, "daß der Weg der Pampaedia nicht frei zu erfinden, sondern aus dem All selbst abzulesen und herzuleiten ist. Nur eine Methode, in der nach Anweisung des Pan- das Ganze des Seienden maßgeblich wird, ist voll pädagogischer Energie" (ebd. S. 178). Die natürliche Methode eines leichten, schnellen und gründlichen Lehrens und Lernens ist die Begehung eines längst gebahnten Weges, sie ist nicht aposteriorisch, sondern apriorisch gewonnen, aus dem ureigenen, unveränderlichen Wesen der Dinge, und sie repräsentiert die Ordnung des Seienden im Ganzen, d.h., sie überläßt Gott die Führung (vgl. ebd. S. 179f). Auch die Schulen und die "realia" (ebd. S. 182) haben keinen Selbstzweck, sondern stehen in unlöslichem Bezug zum Ganzen und sind Mittler zwischen Gott und Mensch. Die Leichtigkeit der Pampaedia ergibt sich aus der Zugehörigkeit des Menschen zur Ordnung des Ganzen und seinem daraus resultierenden und wieder dorthin zielenden natürlichen Streben, wenn er nicht durch Mängel der Schulen, der Bücher, der Lehrer und der Lehre daran gehindert wird (vgl. ebd. S. 221f). Der Grundsatz der Pampaedia, "alle alles allumfassend" (Comenius 1991, S. 11) zu lehren, ist schon Ziel der Grossen Didaktik, wenn auch der Schwerpunkt hier mehr auf einer zeitgemäß entwickelten und gerechtfertigten Kunst des Lehrens lag. Die drei im Grundsatz der Pampaedia enthaltenen Prinzipien hingegen sind eine entschiedene und polemische Infragestellung der damals praktizierten Erziehungslehren (vgl. Schaller 1967, S. 222-225). 1. Omnes bedeutet auf der einen Seite eine generelle Nivellierung aller Menschen, da Gott alle Menschen mit dem gleichen Wesen ausgestattet hat und alle das gleiche Ziel anstreben, aber auf der anderen Seite wiederum eine Differenzierung, da der Mensch zu Gott und zur Welt in einem individuellen Verhältnis steht. Die Unterschiede ergeben sich aus der individuellen Begabung, dem Geschlecht und den übertragenen weltlichen Aufgaben und bedingen folglich unterschiedliche göttliche Führungsansprüche, d.h., jeder Mensch soll seinen gesellschaftlichen Stand im Angesicht Gottes beziehen und in der Erfüllung seiner Aufgaben seine Menschlichkeit verwirklichen. Comenius war folglich kein Sozialreformer (vgl. ebd. S. 225-243). 2. Omnia bezieht sich auf Gott und sein Schöpfungswerk. Gott, Welt und Mensch sind ein Ganzes und der wahre Mensch ist ein Spiegelbild des Ganzen. Zu seiner Ganzheitlichkeit gehören auch die angeborenen Bedürfnisse und zum Wissen vom Ganzen prinzipiell auch das Böse, denn gründliche Kenntnis des Bösen schreckt zwar ab, sie kann aber den in Verderbnis lebenden Menschen zusätzlich gefährden. Die Lehre legt zunächst ein Fundament des Allgemeinen, die jeder Einzelheit ihren Ort zuweist, und geht dann erst zum Spezialwissen über, das nichts Neues, sondern lediglich eine schwerpunktmäßige Anreicherung des Allgemeinwissens ist. Alle Schulen lehren dasselbe auf verschiedene Weise. Die Altersstufen sind nicht als Entwicklungsstufen gedacht, sondern symbolisieren die fortschreitende Annäherung an den Ort der Wesensvollendung. Dem altersgemäßen Hineinführen in das Ganze folgt zwangsläufig das Begreifen seitens des Geführten. Comenius vergleicht diesen Vorgang mit einem Gefäß, das sich soweit füllt, wie es ins Meer getaucht wird. Im einzelnen soll die Schule Lesen und Schreiben, Sprachen, nützliche Fertigkeiten, Sittsamkeit und Frömmigkeit lehren (Schaller 1967, S. 243-262). 3. Omnino bedeutet gründlich und vollständig, d.h. die rechte, der Wahrheit gemäße Vervollkommnung der Menschlichkeit. Vollständiges Wissen wird erreicht durch das "Zusammenwirken von Theoria, Praxis und Chresis" (ebd. S. 263). Diesem entspricht ein methodisches Vorgehen durch Beispiele, Regeln und Übung. Angestrebt wird zwar die subjektive, vollständige Weisheit, Beredsamkeit, Kunstfertigkeit, anständige Sittsamkeit und Frömmigkeit, aber eigentliches Ziel der Pampaedia ist die "gründliche und vollständige Veredelung des Menschengeschlechts" (ebd. S. 265). Comenius konnte seine Aufgabe nicht vollenden; seine Schulbücher und seine Didaktik wurden aus dem pansophischen Zusammenhang gelöst und über die Jahrhunderte hinweg beliebig und verkehrend in Anspruch genommen (vgl.Schaller 1967, S. 9ff). 4.2 Joachim Heinrich Campe: Aufklärer, Philanthrop, Publizist Die Philanthropen hatten begeistert Rousseaus "Emile" gelesen und glaubten an die Vervollkommnung und Versittlichung des Menschen durch die Allmacht der Erziehung. Sie waren zuversichtlich, mit der Erneuerung des Menschen eine gesellschaftspolitische Reform bewirken zu können. Es ging um die Bildung des "aufgeklärt-vernunftgeleiteten, industriösfleißigen, am Gemeinwohl orientierten Bürgers" (Herrmann 1979, S. 135). Anstelle von Geburts- und Standesprivilegien sollten in der neuen Gesellschaftsordnung individuelles Leistungsstreben und die Rationalität von ausgehandelten Herrschafts- und Eigentumsverträgen gelten. Es waren "bürgerliche" Träume von allgemeinen Menschenrechten, Wohlfahrt, Glück, Toleranz und Freiheit, die durch allgemeine Aufklärung, d.h. allgemeine Erziehung und Bildung Realität werden sollten. Erziehung und Bildung mußten durchdacht und neu gestaltet und Eltern und Lehrer auf ihre neue Aufgabe vorbereitet werden. So entstand eine breite pädagogische Publizistik in Form von Jugendschriften, Lehrbüchern, Unterrichtshilfen, Zeitschriften, Periodika und Programmschriften, und "Pädagogik" bürgerte sich als wissenschaftlicher Fachbegriff ein; 1779 wurde Trapp auf den ersten Lehrstuhl für Pädagogik in Halle berufen (vgl. Herrmann 1979, S. 135f). Bevölkerungswachstum, Krieg und Mißernten, sinkende Einkommen und steigende Agrarpreise führten zur Verarmung weiter Teile der Bevölkerung, "Pauperismus war das ordnungspolitische Problem am Vorabend der Französischen Revolution!" (ebd. S. 137), dem eine gezielte Gewerbe- und Agrarpolitik sowie eine reformorientierte Pädagogik und Schulpolitik abhelfen sollte. Bahrdt beschrieb 1789 den zwingenden Zusammenhang von Gesellschaftsreform und Reformpädagogik: "Wenn wir es dahin bringen, daß nach und nach die Menschen in moralischen und ökonomischen Wahrheiten zu eignem und freien Gebrauche ihrer Vernunft gewöhnt, von Herkommen, Vorurtheilen, Aberglauben und Schwärmerei entfesselt werden, und so zu einer gewissen Freiheit und vermehrten Thätigkeit des Geistes gelangen, so wandeln wir die Welt in ein Paradieß" (zit.ebd. S. 140). Aufklärung sei für das Individuum wie für den Staat gleichermaßen nützlich, denn ein aufgeklärter Unertan lasse sich leichter regieren, weil er aus Einsicht die Gesetze befolgt (vgl. ebd.). Unter den zahlreichen philanthropischen Erziehern gelten vier als besondern herausragend: Basedow als Bahnbrecher der Reformbewegung und Gründer des Philanthropinums in Dessau, Trapp als Theoretiker, Salzmann als Praktiker und Gründer der Landerziehungsanstalt Schnepfenthal und als Fachmann für Eltern- und Familienbildung und nicht zuletzt Campe, Jugendschriftsteller und Verfasser der ersten umfassenden deutschen Enzyklopädie der Pädagogik (vgl. ebd. S. 141). Campes (1746-1818) schriftstellerischer Tätigkeit ist es zu verdanken, daß die philanthropische Reformbewegung ins Bewußtsein der Öffentlichkeit dringen konnte und ihre Anschauungen und Methoden in den Erziehungsalltag des gebildeten Bürgertums übernommen wurden. Er selbst sammelte Erfahrungen als Erzieher und Lehrer, u.a. im Hause Humboldt, am Philanthropinum in Dessau und in Hamburg. In Hamburg hatte Campe Kontakt zu den Aufklärern um Lessing; hier erschienen auch seine grundlegenden pädagogischen Schriften. Nach Basedows Tod 1790 galt Campe als der führende Kopf der philanthropischen Reformbewegung. Erst unter dem Druck der politischen Reaktion, die ihn als Vorkämpfer der Revolution in Deutschland denunzierte, zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück (vgl. ebd. 146-148). Auch in der Aufklärung spielte die Berufung auf den göttlichen Weltplan noch eine Rolle sowohl als Legitimierungsmittel wie auch als Impulsgeber von Veränderungen, allerdings hatte sich das Gewicht von der Offenbarungsreligion hin zur Vernunftreligion verschoben (vgl. Fertig 1977, S. 69ff). Dieser Umschlag läßt sich auch an Campes Werdegang nachvollziehen. Ursprünglich offenbarungsgläubiger protestantischer Theologe bekennt er sich mehr und mehr zur Aufklärungstheologie, die die sittliche Verantwortung des Menschen und seine Freiheit gegenüber gnadenbedürftiger Schuldverstrickung betonte und für die deshalb der Prozeß der Erziehung selbst einen immer wieder neuen Antrieb zur Herstellung eines gott- und vernunftgewollten Zustandes darstellte. Campe betont die Notwendigkeit, Glaubenssätze zu leben und in diesem Leben schon Glück herzustellen wie er auch die Geistlichen mehr als Pädagogen denn als spitzfindige, gelehrte Theologen sieht. Bildung von Tugend durch Übung und Gewohnheit ist nicht nur eine Parteinahme für Aristoteles gegen Platon, sondern auch für Selbsttätigkeit gegen bloße Belehrung und Rezeptivität. Charakter ist nicht angelegt, sondern durch Lernprozesse in der Entwicklung des Menschen zu erwerben. Die Wahrheit kann nach sokratischer Methode Schritt für Schritt durch vernünftige Untersuchung gewonnen werden. Campe setzt dabei auf die natürliche Neugier der Kinder. Um ihnen die Unsterblichkeit der Seele zu beweisen, bemüht Campe nicht Christus, sondern Sokrates als Beispiel: Der ungerechte Tod könne von einem gerechten Gott nur dann wiedergutgemacht werden, wenn Sokrates eine unsterbliche Seele habe. Herstellung von Glückseligkeit ist göttlicher Auftrag; der Mensch soll gottgleich werden, Gottes Stellvertreter auf der Erde; religiös sein heißt also, vernünftig wirken, und religiöse Erziehung ist Humanitätsbildung, Menschenbildung als Vervollkommnung seiner selbst. Campes Verständnis der Theodizee erlaubt, auch die Revolution als gottgewollt, wirklich und somit vernünftig zu interpretieren; sie beweist, "daß kein von der Vorsehung zugelassenes Uebel so groß und fürchterlich war, daß ihre weise Güte nicht wohlthätige Folgen für die Menschheit daraus herzuleiten wüßte" (Campe zit.n. Fertig 1977, S. 79). Erziehung ist für Campe allerdings keine konfessionelle Erziehung; "wie ein roter Faden durchzieht Campes Schriften die Mahnung zu Toleranz" (ebd.), denn seiner Meinung nach kann nur Gott allein Wahrheit von Irrtum unterscheiden. Eine neue Erziehung, die sich auf die ursprünglich gute Natur beruft und das Kind als Träger des gesellschaftlichen Neubeginns entdeckt, hat stets den Charakter des Oppositionellen; insofern ist auch die frühkindliche Erziehung schon politische Bildung. Campes Forderung nach einer kindgemäßen, natürlichen Erziehung ist eine gesellschaftskritische Polemik gegen die widernatürliche Erziehung zum Affektierten, die sich am überfeinerten Geschmack der höfischen Gesellschaftsschicht orientiert. Bezugspunkt dabei ist seine eigene ungekünstelte Bürgerlichkeit. Pädagogik soll den Gang der Natur, der sich durch Selbsttätigkeit auszeichnet, durch Gewährenlassen lediglich unterstützen. Die Natur läßt Ideen, Einsichten und Fähigkeiten im Lernenden von selbst wachsen. Folglich kann ein Unterricht, der auf individuelle Erkenntnisse eingeht, sich nicht auf Belehrung nach einem Leitfaden und einem Stundenplan, gültig für alle Kinder, stützen. Natürliche Erziehung heißt letztlich häusliche Erziehung und somit Familien-und Standeserziehung (vgl. Fertig 1977, S. 80 - 86). Die philanthropische Erziehung bricht mit der reformatorischen Auffassung, daß Erziehung das Kind durch drakonische Maßnahmen vor dem angeborenen Bösen zu retten habe und Lernen in erster Linie beschwerlich und mühsam sei, indem sie behauptet, Lernen und Freude sei gerade die Vorbedingung für gescheites Lernen (vgl. ebd. S. 87ff). Diese These Basedows greift Campe auf und ersinnt eine Reihe von Spielen, mit denen sich Kinder Kenntnisse auf allen Gebieten, selbst Latein, zwanglos aneignen können; sie sollen sich austoben und lustig sein, eben Kinder sein und keine kleinen Erwachsenen. Damit stößt Campe auf heftige Kritik bei seinen Zeitgenossen, die eine Erziehung zu Unordnung und Oberflächlichkeit befürchten, letztlich genau die Punkte, an denen Campe die Gründe für die Lasterhaftigkeit der höfischen Kultur festmacht. Campe hat große Mühe, seine induktive Methode gegen den Vorwurf des Unsystematischen zu verteidigen. Er begründet das spielerische Lernen mit der Bedeutung, die Geselligkeit für den Lernprozeß hat. Lehren heißt für ihn, "Gewährung einer Situation, in der der Lernende bestimmte Erfahrungen durch die Einwirkung verschiedener Umstände machen kann" (ebd. S. 90). Zu diesen Umständen gehören auch die Mitlernenden, denn nach Campe ist der Mensch ein Produkt seines Umgangs, und die individuelle Reifung bedarf der Tätigkeit und der Geselligkeit. Er warnt an verschiedenen Stellen "vor eigenbrötlerischer Passivität, vor gelehrt-unproduktivem Monadendasein" (Fertig 1977, S. 91). Die Erkenntnis von der Bedeutung der Lebensumstände für die Entwicklung der Kinder führt zu der Forderung, das Verhalten von Kindern schon in den ersten Lebensmonaten exakt zu beobachten. Damit tritt frühkindliche Erziehung überhaupt erst als Problem ins pädagogische Bewußtsein. Campe warnt die Eltern vor den ersten negativen Einflüssen durch Einschüchterung, beispielsweise durch Schauergeschichten, denn früheste Eindrücke und Erfahrungen bleiben seiner Ansicht nach nicht folgenlos, vielmehr können die zurückbleibenden Spuren zu gegebener Zeit wieder ins Bewußtsein treten (vgl. Fertig 1977, S. 91f). In diesem Zusammenhang macht sich Campe Gedanken über Strafen und körperliche Züchtigung, die er für "das schreckliche non plus ultra der Disciplin" (Campe zit. ebd. S. 92) hält. Das Strafen ist keine reine Privatangelegenheit der Erzieher, sondern hat auch einen menschenrechtlichen Aspekt: Kinder sind wirkliche Menschen, die "wie wir ihre unverletzlichen Rechte der Menschheit haben" (Campe zit. ebd. S. 93). Er wendet sich ab von der damals praktizierten Gleichsetzung von Erziehung mit Strafe, hält aber auch natürliche Konsequenzen einer Tat nicht für ausreichend und distanziert sich ebenso von der im Dessauer Philanthropin üblichen Anstachelung des Ehrgeizes durch öffentliche Belobigungen, die nur dazu führen, daß der Sieger sich durch Eitelkeit aufbläht, während die Unterlegenen Neid und Zorn empfinden. Alle erzieherischen Maßnahmen haben nicht Einzelkorrekturen des Verhaltens zum Ziel, sondern die schrittweise Vervollkommnung des ganzen Menschen, sie sollen zur Charakterbildung beitragen. Von diesem Standpunkt aus kann Erziehung eher durch Belohnungen als durch Strafen zur Tugendhaftigkeit führen. Insgesamt gilt aber die Aufforderung, maßzuhalten und anstelle von Einzelaspekten die Harmonie aller menschlichen Kräfte und Fähigkeiten im Auge zu behalten. Bildung des Intellekts, der Empfindungen und des Körpers sollen in einem harmonischen Gleichgewicht stehen; hier polemisiert Campe gegen die "Empfindsamkeitswelle" (Campe zit. ebd. S. 94), die von Goethes "Werther" ausgelöst wurde, und gegen die die Jugend zu immunisieren sei. "Orientierungspunkt ist eben nicht allein subjektive harmonische Menschenbildung, sondern vor allem auch die Bewährung in der menschlichen Gesellschaft. Empfindsamkeit ist Antrieb für ein glückliches Vorwärtskommen, nicht Selbstzweck" (Fertig 1977, S. 96). Campe konzipiert die allgemeine harmonische Menschbildung zunächst ohne Berücksichtigung der individuellen Lage des Zöglings und seiner späteren beruflich-gesellschaftlichen Situation. Er betont, daß "er nur von einer Harmonie der ursprünglichen Kräfte, nicht der abgeleiteten gesprochen habe" (ebd. S. 97). Aber er behält dennoch die Nützlichkeit im Blick: "Je mehr die ursprünglichen Kräfte eines Menschen sich dem Ebenmaße nähern, desto größer und ausgebreiteter ist seine Brauchbarkeit im bürgerlichen Leben" (Campe zit.n. Fertig 1977, S. 99). Die von Rousseau vorgenommene Trennung von Mensch und Bürger wird von den Philanthropen mit dem Argument zurückgewiesen, daß die Vorsehung den Menschen dazu bestimmt habe, sowohl glücklich als auch nützlich zu sein, und daß die Erziehung diesen zweifachen Endzweck sehr wohl anstreben könne. Die Philanthropen legen einen vernünftigen und planvollen Geschichtsverlauf der Menschheit zugrunde und glauben an eine prinzipiell wohlgeordnete und legitime Gesellschaftsstruktur, wenn auch die Lebensführung im einzelnen scharf kritisiert wird. Für Campes Idee von einem tätigen Christentum gitb es keine Entgegensetzung von Gesellschaftlichkeit und Individualität, "sein bürgerlicher Tätigkeitstrieb (verträgt) sich nicht mit kontemplativer Selbstbespiegelung" (ebd. S. 101). Campe versucht, den Widerspruch zwischen ganzer, harmonischer Menschenbildung und arbeitsteiliger Funktionalisierung des Menschen zu glätten, indem er den Gleichklang der Kräfte zur Grundlage aller Berufe erklärt, allerdings müsse die natürliche Erziehung von einem bestimmten Zeitpunkt an zugunsten einer bürgerlichen Brauchbarkeitserziehung aufgegeben werden (vgl. ebd. S. 102ff). Campe nennt hier standes- und berufsabhängige Altersangaben zwischen neun Jahren für die Kinder der Armen und zwölf Jahren für die künftigen Gelehrten. Campe lag nichts daran, Kinder durch Erziehung über ihren Stand zu erheben. Ein weiterer Grund ergibt sich aus seiner Erziehungskonzeption selbst: eine häuslich-unverschulte Erziehung setzt einen Mindestlebensstandard und ein intaktes bürgerliches Familienleben voraus; beides ist bei den ungebildeten Ständen in der Regel nicht gegeben, so daß sich hier eine Erziehung zur "Indüstrie" (Campe zit. ebd. S. 107) durch die Institution Schule anbiete, die Arbeiten und Lernen zu einem produktiven, kräfteschulenden Lernvorgang vereinigt (vgl. Fertig 1977, S. 159-165). Campe beschreibt im vielgelesenen "Theophron" seine bürgerlichen Moralvorstellungen und grenzt sich durch die Darstellung der Lebenssituation eines angehenden, geschäftigen Bürgers beim Übertritt ins Berufleben gegen die Bedürfnisse der niederen Stände wie auch gegen die adligen Lebensgewohnheiten ab (vgl. ebd. S. 109ff). Er stellt höfischer Herrschsucht, Lasterhaftigkeit und Sinnleere bürgerliche Tugenden gegenüber und vollzieht hier den Umschlag von Menschenbildung in reine Bürgerbildung: Selbsttätiges Lernen weicht der moralischen Belehrung, sittliche Integrität wird bewahrt durch Zügelung der menschlichen "Natur"; Mädchen werden zur treusorgenden Gattin und Mutter, Jungen zum versorgenden Hausherrn, Vater und pflichtbewußten Bürger erzogen. Nützlichkeit ist hier auch ein Kriterium für die aufgaben- und berufsbezogene Beschränkung des Wissen. Campes Ideal ist die intakte bürgerliche Familie, in der beide Elternteile erzieherische Aufgaben wahrnehmen. Er befürchtet eine Entfremdung zwischen Eltern und Kindern durch eine zunehmende aushäusige Tätigkeit der Eltern und eine Verstaatlichung der Erziehung. Auch Waisenkinder möchte er lieber in Familien untergebracht sehen. Er kennt aber auch die Mängel der herkömmlichen Hofmeistererziehung, wie ungeeignete Lehrer und zuwenig Geselligkeit und entwickelt eine ganze Reihe von Vorschlägen zu ihrer Verbesserung (vgl. Fertig 1977, S. 115 - 117). Campes politisches und pädagogisches Engagement ist in sich widersprüchlich durch ein Nebeneinander von hergebrachtem und aufklärerischem Gedankengut. Der Balanceakt zwischen aufklärerischem Anspruch und Arrangement mit politischer Herrschaft muß zwangsläufig mißlingen: "Er durchlebt und antizipiert die Situation des politisch bewußten Intellektuellen im konservativ gestimmten Deutschland, der erfährt, daß liberales Gedankengut hier allenfalls durch Import verwirklicht wird, daß seine Durchsetzung nicht Produkt deutscher Entwicklung ist" (Fertig 1977, S. 197). 4.3 Wilhelm von Humboldt: Neuhumanist, Bildungsthoretiker, Schulreformer Humboldts (1767-1835) Leben, Denken und Wirken ist vor einem historischen Hintergrund zu betrachten, den Meyer (1979) kennzeichnet als "Situation zwischen Spätaufklärung und Romantik, zwischen der Französischen Revolution und den napoleonischen Kriegen, zwischen dem Merkantilismus und dem Beginn einer liberalen Gesellschafts- und Wirtschaftsverfassung" (ebd. S. 198). Seine Schriften und Studien lassen sich keinem philosophischen oder wissenschaftlichen Gesamtsystem zuordnen, aber Humboldts Denken war dennoch systematisch, strebte jedoch kein abschließbares System an (vgl. Benner 1990, S. 14). Die Einheit seines Werkes ergibt sich aus dem Grundthema "Mensch" und dem Ziel, eine Theorie der Menschenkenntnis und der Menschenbildung zu konzipieren (vgl. Menze 1965, S. 33). Humboldt wendet sich gegen die aufklärungspädagogische Einengung der Bildung des Menschen auf dessen Brauchbarkeit, aber er weiß um die Notwendigkeit und Wichtigkeit einer beruflichen Bildungslehre, die er keinesfalls herabsetzt, denn der Mensch lebt nicht bloß beschaulich, sondern gesellschaftlich tätig (vgl. Meyer 1979, S. 209). Er wendet sich auch "gegen die Konstruktion eines reinen Vernunftstaates in Ablösung der vorhandenen historisch gewachsenen Realität, [...] gegen die Ideenproduzenten und Projektemacher, die im Namen der Freiheit und Würde des Menschen den vorhandenen und gewiß abzulehnenden Staat bekämpfen, sich selbst als die legitimen Vollstrecker der Vernunft ausgeben und danach trachten, Freiheit, Gleichheit und Selbstbestimmung wie aus einem Mechanismus hervorgehen zu lassen" (Meyer 1979, S. 210). Da jeder tätige Mensch auch politisch wirken kann, ist Politik für Humboldt untrennbar verbunden mit Pädagogik. Jedes Verhalten hat einen innerindividuellen Ursprung, wenngleich er zugibt, daß Verhaltensweisen durch äußere Umstände gleichförmig ausfallen können. Humboldt sieht zwei Formen der Unterdrückung: Beschränkung der individuellen Handlungsfreiheit durch Mangel an Gelegenheit und die willkürliche Veränderung der Umwelt durch geplante Regelungen, die keine Handlungsalternativen offenlassen. Humboldt verkennt allerdings auch nicht den entlastenden und motivierenden Charakter institutioneller Einrichtungen, nur verlangt er für die Besetzung der Staatsämter den Nachweis bildungsgebundener Qualifikationen und Mehrheitsbeschlüsse, die aber wiederum den einzelnen nicht von seiner persönlichen Verantwortung befreien (vgl. ebd.). Humboldts Staatsidee knüpft an Rousseaus "Contrat social" an und modifiziert das dort entwickelte Verhältnis von Regierung und allgemeinem Willen (vgl. Benner 1990, S. 42f). Die absolutistische Gesellschaftsordnung soll in eine republikanische überführt werden, obwohl für Humboldt "die Regierungsform im Vergleich zur Identität der Staatsbürger nur von zweitrangiger Bedeutung ist" (ebd.). Ziel ist die Selbstbestimmung und Selbstbildung des bisher untertänigen Volkes zur Nation, aber nicht als Ergebnis einer Revolution, sondern als Ergebnis eines von den Fürsten ausgehenden Prozesses der Befreiung von Standesfesseln. Das Mittel für diese Befreiung sieht er in der Herstellung der Mannigfaltigkeit der Lebenssituationen, im freien, nicht durch Standesgrenzen gebundenen Verkehr der Menschen untereinander. Ohne diese Mannigfaltigkeit der Situationen ist politische Freiheit nicht möglich, die politische Freilassung der Menschen nicht ohne Bildung. Bildung und Politik treten damit in ein neues, dialektisches Verhältnis (vgl. Benner 1990, S. 43ff). Fortschritt kann vom Staat nur durch die Gewährung von Freiheit ausgehen, die Verwirklichung der Freiheit hingegen ist die ureigene Aufgabe des handelnden Menschen selbst. Eine freisetzende Politik und die Selbstbildung der einzelnen haben ein gemeinsames Ziel, die Bildung einer Nation, und ein gemeinsames Mittel, die Gewährung mannigfaltiger Situationen. Der Fortbestand des Staates wird erst möglich durch eine öffentliche Politik, basierend auf einer öffentlichen Bildung der Bürger. Mensch und Bürger werden so identisch, und das noch bei Rousseau antinomische Verhältnis von Pädagogik und Politik wird in eine offene, geschichtliche Wechselwirkung von Bildung und Politik gewandelt. Nun läßt sich aber auch die Bestimmung des Menschen nicht mehr wie im antiken Staat aus einer gesamtgesellschaftlichen Ordnung oder wie bei Rousseau aus einem übergeordneten "Allgemeinen Willen" ableiten. Humboldt unterscheidet Staat und Gesellschaft (Nation) und versucht dadurch, "die Möglichkeit einer Identität des neuzeitlichen Menschen aufzuzeigen, die nicht mehr in der Identität von Mensch und Bürger aufgeht, sondern als Vermittlung zwischen der individuellen und der gesellschaftlichen Daseinsweise des Menschen gedacht wird" (ebd. S. 47). Humboldt bestimmt als den Zweck des modernen Staates die Befreiung der Bürger zu selbsttätigen Menschen; die Verwirklichung ist jedoch nur unter der Bedingung möglich, daß die staatliche Wirksamkeit begrenzt wird (vgl. ebd. S. 55-67). Humboldts Kritik an der Bevormundung und Entmündigung der Bürger durch das Wirtschaftssystem des absolutistischen Staates gipfelt in der Aussage, "daß produktiv in einem spontanen und schöpferischen, der Bildsamkeit des Menschen angemessenen Sinne nur die Tätigkeit der Menschen selbst genannt werden kann" (ebd. S. 60). Der Staat selbst ist nicht produktiv, sondern immer auf die Resultate der Tätigkeit seiner Bürger angewiesen; folglich kann sein Interesse nur auf den daraus zu ziehenden Nutzen und die Steigerung seiner Einnahmen gerichtet sein, d.h., der Mensch ist, gemessen am kategorischen Imperativ der Menschheitsformel Kants, für den Staat bloß Mittel und kein Zweck, der Staat also prinzipiell unfähig, "positive Sorgfalt für das Gemeinwohl zu tragen und Regeln aufzustellen, die der Vervollkommnung produktiv tätiger Staatsbürger dienen könnten" (ebd. S. 61). Das beschränkte staatliche Interesse richtet "nirgends grösseren Schaden an, als wo der wahre Zweck des Menschen völlig moralisch oder intellektuell ist" (Humboldt zit.n. Benner ebd.). Diesem "negativen" Staat stellt Humboldt nach Benners Interpretation aber die mögliche "Positivität" der Nation gegenüber, in der die Sorge um das Wohl der menschlichen Gesamtpraxis durch die Herstellung einer verantwortlichen Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Von hier erhält auch die öffentliche Erziehung ihre Begründung und ihren Zweck (vgl. Benner 1990, S. 61-67). Humboldt formuliert den Zweck des Menschen wie folgt: "Der wahre Zwek des Menschen - nicht der, welchen die wechselnde Neigung, sondern welchen die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt - ist die höchste und proportionirlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit die erste, und unerlassliche Bedingung. Allein ausser der Freiheit erfordert die Entwikkelung der menschlichen Kräfte noch etwas andres, obgleich mit der Freiheit eng verbundenes, Mannigfaltigkeit der Situationen. Auch der freieste und unabhängigste Mensch, in einförmige Lagen versezt, bildet sich minder aus" (Humboldt zit.n. Benner 1990, S. 48). Gemeint ist hier keine harmonische Menschenbildung, denn höchste und proportionierlichste Bildung stehen in einem Widerspruch zueinander: Je höher der individuelle Bildungsgrad in einem Bereich, umso geringer sind die anderen Bereiche entfaltet; umgekehrt gilt, je gleichmäßiger die individuelle Bildung in allen Bereichen, umso geringer ist die Höhe ihrer Ausprägung. Die Auflösung dieses Widerspruchs ergibt sich aus dem zweiten Teil der Humboldtschen Formel, die den Menschen aus der Einseitigkeit der ständischen Situation und Bildung in mannigfaltige Situationen und wechselnde Tätigkeitsanforderungen stellt. Dabei ist die menschliche Kraft die vermittelnde Instanz, die sicherstellt, daß sich der Mensch, statt zu einem bloßen Aggregat unterschiedlicher Einseitigkeiten, zu einem Ganzen bildet. Unter dieser Kraft versteht Humboldt die Kompetenz des Menschen, "mehr als eine bloße Summe möglicher individueller oder gesellschaftlich vorgegebener Einseitigkeiten zu sein" (Benner 1990, S. 51). Sie ist eine Art energetische Struktur, die sich aus dem Spannungsverhältnis zwischen der Ich-Identität und der Mannigfaltigkeit interaktiver Situationen speist und "die Arbeit an der eigenen Identität nicht auf Einseitigkeit, sondern auf Vielseitigkeit hin" ausrichtet (ebd. S. 52). Diesen Prozeß der Arbeit an der eigenen Bestimmung hält Humboldt für eine lebenslang unabschließbare Aufgabe, weil der Mensch nie endgültig mit sich selbst identisch ist, d.h., aus der nicht teleologisch bestimmten Kraft resultiert die unbestimmte Bildsamkeit des Menschen, sein Recht auf Selbstbildung und -bestimmung und sein Streben nach einer eigenen Originalität, für die es kein Vor-Bild gibt (vgl. 52f). Von diesem Standpunkt aus muß Humboldt eine rein materiale Bildungstheorie ablehnen und statt dessen nach einem Korrektiv suchen, das die einzelnen Fächer und Gebiete soweit entgrenzt, daß sie ihren Beitrag zu einer ganzen Menschenbildung leisten können. In der herkömmlichen standesspezifischen Ausbildung wurden pragmatische und moralische Kompetenz noch dadurch vermittelt, daß Herstellung, Gebrauch und Beurteilung eines Produkts in einem für alle einsichtigen Zusammenhang standen. In der neuzeitlichen Gesellschaft aber sind spezielle Kenntnisse "einer 'unmittelbaren' Beförderung nützlicher 'Gesinnungen' [...] nicht unmittelbar zweckdienlich" (Benner 1990, S. 95). Vielmehr steht im Mittelpunkt neuzeitlichen Handelns der moderne Mensch selbst, der auf eine Welt außer sich angewiesen ist, will er seine Bestimmung selber suchen und finden. Diese Konstellation legitimiert nun keine willkürliche Herrschaft des Menschen über die Welt, denn er unterscheidet sich durch das bloße Angewiesensein auf die äußere Welt noch nicht von anderen Lebewesen, sondern nur durch sein Bewußtsein von einer Welt außer sich und durch die spezifisch humane Notwendigkeit der eigenen Bestimmungssuche (vgl. Benner 1990, S. 92-98). Humboldt modifiziert Fichtes "Ich - Nicht-Ich" Konstruktion in den Ich-Menschen, dem die Welt als etwas bereits Vorausgesetztes, als Nicht-Mensch gegenübersteht. Das bildende Moment ergibt sich nun aus der wechselseitigen Verknüpfung von Ich-Mensch und Nicht- Mensch. Humboldt erkennt somit der Welt ein Eigengewicht im Selbstbestimmungsprozeß des Menschen zu, auf das der Mensch nicht nur willkürlich einwirken kann. Die bildende Wechselwirkung ergibt sich gerade aus der dem Menschen eigenen Notwendigkeit, in der Welt handeln zu müssen, und der Notwendigkeit einer Welt, die sich menschlicher Herrschaft nie vollständig fügt. "Der der Wechselwirkung mit der Welt bedürftige Mensch kann seine Identität weder in sich selbst finden noch aus einer bloßen Transformation der Welt in eine ihm bekannte Welt gelangen" (ebd. S. 103). Der Zweck aller Bildung ist also mehr als Anpassung an eine vorgegebene Ordnung und liegt "jenseits einer bloßen Steigerung menschlicher Macht und Herrschaft" (ebd. S. 104). Bildsamkeit ist die Fähigkeit, mehr als uns schon Bekanntes in der Welt zu erblicken. Bildende Wechselwirkung unterscheidet sich von einer beliebigen durch den Vorgang der Entfremdung, der eintritt, wenn die Welt zunächst als etwas Fremdes, Unbekanntes erfahren wird, aus der dann eine Rückkehr möglich wird, die durch ein von der Welt ausgehendes, erhellendes Licht bereichert ist. Dieses Weltverhältnis ist vielperspektivisch, die Welt wird wahrgenommen als Begriff des Verstandes, als Bild der Vorstellungskraft und als Gegenstand sinnlicher Anschauung. Humboldt faßt Bildung auf als Dialektik von Entfremdung und Rückkehr aus der Entfremdung Hier wird Humboldts bildungstheoretische These verständlich, daß nicht der Inhalt einer Tätigkeit den Menschen adelt, sondern nur die Art und Weise des Handelns. Nur die Tätigkeiten wirken bildend, die eine Hinwendung zu noch Unbekanntem so gestatten, "daß wir uns selber fremd werden und Neues so lernen, daß von dem Neu-Erfahrenen Anregungen zu fortschreitender Entfremdung und Weltaneignung ausgehen können, [...] daß wir der Welt als 'Stoff die Gestalt (unseres) Geistes aufdrücken' " (Benner 1990, S. 107). Als Humboldt zum Chef der neugegründeten Sektion für Kultus und Unterricht ernannt wird, hofft er, seine reformerischen Pläne in die Tat umsetzen zu können. Die allgemeine Reformeuphorie auf allen Gebieten des durch die Kriegsniederlage vernichteten preußischen Staates ist zunächst vielversprechend. Humboldt versucht in den 16 Monaten seiner Amtszeit, ein einheitliches, öffentliches Schulwesen aufzubauen, das seinen Ideen einer allgemeinen Menschenbildung entspricht, das sich auf das "Lernen des Lernens" und auf die Prinzipien der alten Sprachen, Mathematik, Naturwissenschaften konzentriert; er führt die Elementarmethode Pestalozzis zur Entfaltung der menschlichen Kräfte ein, plant Lehrerbildungsinstitute und richtet wissenschaftliche Deputationen ein, um Selbstverwaltung und Eigeninitiativen im Bildungswesen zu stärken. Bei der Gründung der Berliner Universität kann er seine Bildungskonzeption am reinsten durchsetzen (vgl. Scheuerl 1992, S. 139 u. Meyer 1979, S. 211-216). Die Bildungsidee Humboldts gipfelt in der Autonomie der Individualität und ihrer Verwirklichung in dieser Welt; sie schließt zunächst jedes religiöse Moment aus (vgl. Menze 1965, S. 265ff). In seiner Spätzeit wendet sich Humboldt mehr einem platonisch verstandenen Ideenbegriff zu, der der menschlichen Erfahrungswelt eine transzendente Welt gegenüberstellt. Die Einsicht in die Ohnmacht und die Hinfälligkeit des individuellen Menschen verändern Humboldts Menschenbild, und das Gebäude der eigenständigen, sich selbst vollendenden Individualität zerbricht. Er fragt nach dem Sinn des Todes, "und mit dem Tod wird für ihn der Bereich des Transzendenten zu einer neuen Wirklichkeit, die ihn in seinem Ich aufwühlt, quält, beunruhigt und die er doch nicht festhalten kann, sondern wieder verwerfen muß. Dieses qualvolle Hin und Her zeichnet seine letzten Jahre und zerstört die autonome Sicherheit des Menschen, der sich selbst bestimmen will. Zu einer neuen Sicherheit gelangt er nicht" (Menze 1979, S. 268). 4.4 Paul Natorp: Neukantianer, Sozialist, Demokrat Jegelka (1992) sieht in dem Werk des Marburger Philosophen und Pädagogen Natorp (18541924) eine der "eigenständigsten und wirkungsreichsten Leistungen des Neukantianismus" (ebd. S. 9). Natorp beschäftigt sich mit der Frage nach einer gerechten Ordnung der Welt, mit den Problemen und Perspektiven des schöpferisch Individuellen im wachsenden Chaos des Relativen und mit der Möglichkeit, "Geschichte als dynamische Aktualität der Selbstschöpfung gestaltbar werden zu lassen, gestaltbar in Wirtschaft, Politik und Kultur, in Dimensionen, in denen Handeln sich schöpferisch konkretisiert, in denen Autopoiesis bloße Theorie und Praxis überwindet" (ebd.). Natorp sah sich als Ideologen und Utopier, der sich mit seinem Werk an den sozialen Bewegungen und politischen Ereignissen seiner Epoche beteiligte und im öffentlichen Diskurs gegen kirchliche und staatliche Reaktion intervenierte. Er war überzeugt, daß nur eine sozialistische Gesellschaftsreform die wirtschaftlichen und politischen Mißstände seiner Zeit beheben konnte. Seine Zeitgenossen rechneten ihn ebenso zweifelsfrei und selbstverständlich dem Sozialismus zu, wie er selbst öffentlich bekannte: "Ich bin Sozialist und Demokrat" (Natorp zit.n. ebd.), was seine politischen Aktivitäten spätestens in den Ministerien scheitern ließ. Sein politisches Ideal war die soziale Demokratie, und er engagierte sich als Pazifist für den Erhalt des Friedens. Nach seinem Tod sind sowohl seine politische Arbeit als auch sein Werk verzerrt und entstellt worden bis hin zu der Frage, ob seine Sozialpädagogik überhaupt neukantianisch sei oder eher nicht (vgl. Jegelka 1992, S. 9-12 u. Niemeyer 1989, S. 241-243). Niemeyer kommt nach seiner Untersuchung des ideengeschichtlichen Hintergrundes zu dem Ergebnis, daß dem Denken Natorps eine Systematik zugrundeliegt, "die seine Sozialpädagogik insoweit als eine neukantianische bestimmbar werden läßt, als ihr eine Umformung der praktischen Philosophie KANTS zugrunde liegt, deren erziehungsmethodische Pointe NATORP insbesondere infolge der genauen Kenntnis des Werkes PESTALOZZIS deutlich vor Augen stand" (ebd. S. 256). Natorps Neukantianismus besteht, entsprechend den drei Kritiken Kants, auf der Einheit der Philosophie, d.h., es muß nicht nur eine Logik der Erkenntnis, sondern auch eine Logik des Sollens begründet werden, und eine Philosophie der reinen Methode kann auch in der Ethik "zu nichts anderem (führen) als zu einer bloßen Methodik reiner Gesetzlichkeit" (Natorp zit. n. Niemeyer 1989, S. 244). Natorps Sozialpädagogik bezieht sich aber nicht nur auf Kants praktische Philosophie, Erziehungstheorie und Rechtsphilosophie, sondern insbesondere auch auf Platon, Locke, Rousseau, Pestalozzi, Tönnies und grenzt sich von Hobbes Sozialstaatsgedanken ab, um eine Antwort auf die sozialen Probleme des ausgehenden 19. Jahrhunderts zu finden (vgl. Niemeyer 1989, S. 244-246). Natorp geht es um den "Rückgewinn der vor-staatlichen Gesellschaftsformen in der Variante der Gemeinschaft", um "lebensweltliche Verständigungs- und Hilfeformen" (ebd. S. 246). Seine sozialpädagogische Programmatik zielt einerseits auf das Einleben in die sittlichen Lebensordnungen, andererseits auf die "umfassende Sicherstellung der Autonomie des einzelnen im Kontext einer als Bildungsapriori tauglichen 'Bildung aller' " (ebd. S. 249). Er wollte zeigen, "daß HEGELS Konzept der Sittlichkeit aus Kants Konzept der Moralität in sozialpädagogisch belangvoller Weise herausgearbeitet werden kann" (Niemeyer 1989, S. 249). Kants These "Der Mensch kann nur Mensch werden durch Erziehung" (zit.n. ebd. S. 253) stellt Natorp die These entgegen, daß jede menschliche Fähigkeit, auch der von Kant attestierte freie sittliche Wille und die freie Selbstbestimmung, sich allein in und durch die menschliche Gemeinschaft entwickelt und gestaltet: "Der Mensch wird zum Menschen allein durch menschliche Gemeinschaft" (Natorp zit. ebd.). Natorp ergänzt seine These durch den Zusatz, daß die Erfahrung zeigt, daß "alle Einwirkung des Einzelnen auf den Einzelnen so gut wie ohnmächtig bleibt gegen die Massenwirkung der Vielen, der sozialen Umwelt" (zit. ebd.). Damit bestimmt Natorp eindeutig die Gemeinschaft als erziehenden Faktor. Allerdings unterscheidet Natorp zwischen einem "Gesetz in der eigenen Brust" und einem "Gesetz in der Gemeinschaft" (zit. ebd.), wobei er mit letzterem die Autorität des Erziehers begründet, und nähert sich so Kants Theorie vom intelligiblen und empirischen Charakter des Subjektes und dessen These, daß sich Erziehung nur an das empirische Subjekt wendet. Letztlich geht es Natorp darum, durch sein Konzept von der erziehenden Gemeinschaft konzeptionelle Schwächen des kategorischen Imperativs zu kompensieren und den Blick von einem bloß dyadisch definierten pädagogischen Bezug auf nicht-intendierte, sozialisatorische Effekte zu richten. Mit dem Gemeinschaftsbegriff kann er auch eine andere Rolle des Erziehers ins Auge fassen, nämlich "die des Organisators von Umständen, die den einzelnen zunächst einmal, und sei es eben in der Variante der Gemeinschaft, 'machen' (i.S. PESTALOZZIS) und die es pädagogisch zu gestalten gilt, wenn der Educand sichergehen will, daß seine ihm als intelligibles Subjekt zuzugestehende Selbstbestimmung ihm auch empirisch möglich wird, also nicht an heteronomen Umständen scheitert" (Niemeyer 1989, S. 254). Diesen sozialpädagogischen Prozeß nennt Natorp mit Bezug auf Pestalozzi "Hilfe zur Selbsthilfe" (Natorp zit.ebd.). Natorp sieht wie Aristoteles und Hume den sozialen Ursprung der Begriffe des Sittlichen und enthält sich wie sie mit radikaler Skepsis jeder Metaphysik im Ethischen (vgl. Jegelka 1992, S. 14ff). Die aus dem Prinzip der Gerechtigkeit abgeleiteten Folgerungen weisen nach Natorp als umfassende, besondere Werte der Gemeinsamkeit ideeller Interessen weit über den begrenzten individualistischen Standpunkt hinaus. "Auf dem Boden der Überzeugung, daß die Begründung der Sittlichkeit nur universell, sozial und in eindeutiger Negation der genetisch-psychologischen Methode gelingen könne, wird mit klaren Linien ein sozialer Standpunkt der Ethik aufgerissen, demzufolge dem Individualismus, ohne seine relative Berechtigung zu schmälern, die 'Gemeinsamkeit ideeller Interessen' entgegengesetzt wird, um den 'Kampf ums Dasein' durch Vermittlung und Ausgleich in Gemeinschaft zu befrieden" (ebd. S. 15). Natorps ethischer Sozialismus berücksichtigt materielle und ideelle Interessen, er fragt sowohl nach der Freiheit wie nach der Aufhebbarkeit des Eigentums. Gemeinschaft ist für Natorp das Synonym des sozialen Ideals, und er wendet sich gegen die Zuweisung von Bildungsrechten entsprechend der Klassenzugehörigkeit. Sein Leitmotiv ist die "Idee des Menschentums", die das individuelle Recht auf Selbsterkenntnis, Selbstbildung und Selbstbestimmung anerkennt und einen umfassenden und idealen Begriff dessen entwirft, was der Mensch unter realen, gesellschaftlichen Bedingungen sein und werden kann. Ziel der Pädagogik ist es, "die Idee der Menschheit in jedem Individuum zur Wirkung zu bringen und durch das Gewährenlassen der Individuen in Freiheit und Selbstbildung der gesellschaftlichen Freiheit den Boden zu bereiten" (ebd. S. 21). Bildung nach der Idee des Menschentums unter zu verändernden sozialen und politischen Bedingungen heißt "Gemeinschaft der Bildung" und "Freiheit der Bildung" (Natorp zit.n. Jegelka 1992, S. 21), die durch eine klassenspezifische Bildungsschranken durchbrechende "Politik der Bildung" ermöglicht werden sollten. Den Staat bestimmt Natorp als Erziehungsanstalt; er hat für die Bedingungen zur Selbstbildung Sorge zu tragen. Sein "Sozialismus der Bildung" und seine Auseinandersetzung mit der sittlichen Frage als einer sozialen Frage lassen Natorp eine Sozialpädagogik konzipieren, die Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaft, politische Pädagogik und sozialistische Gesellschaftstheorie miteinander verbindet; ihr Fundament ist zwar der ökonomische Sozialismus, aber sie betrachtet Gesellschaft, Wirtschaft und Staat als ein Ganzes (vgl. Jegelka 1992, S. 23f). Für Natorp ist menschliche Bildung in menschlicher Gemeinschaft Willenssache; die Bildung des Willens muß im Mittelpunkt der Bildung stehen (vgl. ebd. S. 73ff). In seinem Werk "Sozialpädagogik" entwickelt er eine Theorie der Willenserziehung auf der Grundlage der Gemeinschaft. Bildung ist Gestaltung und Formung nach einem Sollen, einer Idee. Da Idee und Bildung aufeinander bezogen sind, ist es die Aufgabe der Pädagogik, "die Geltung der Idee zu erforschen und die Begründung des Sollens eingehend zu erörtern - Pädagogik ruht so auf kritischer Erkenntnistheorie, Ethik und Gesellschaftstheorie" (ebd. S. 73). Die Idee ist "der letzte, zugespitzteste Blickpunkt der Erkenntnis" (ebd. S. 74), die das Mannigfaltige der Erscheinungen als Einheit denkbar macht; sie ist Ausgangspunkt der Einheitsbildung, ist Prinzip. Das Prinzip der Erfahrung ist das Gesollte, das des unbedingt Gesetzlichen ist die Einheit des Sollens, die das Wollen bestimmt. Erkenntnis ist nur möglich durch Verstandesbildung, die wiederum auf den Grundfunktionen des Bewußtseins, des Denkens und Verstehens fußt. Die Erkenntnis, aufgefaßt als Hypothese, kann einen Gegenstand nie endgültig bestimmen und ist somit ein unabschließbarer Prozeß. Verstandesunterricht soll nicht bloß Anschauung, sondern sichere Erkenntnis aufbauen, d.h. das Prinzip der Einheitsbildung bestimmt somit auch die Methode der Verstandesbildung. Wie die Verstandesbildung bezieht sich auch die Willensbildung auf die Idee, das Prinzip der Einheitsbildung. Da die theoretische Erkenntnis das Bedingte in all seinen Relationen nie endgültig klären kann, bleibt in der denkenden Rückbindung an empirische Kausalität eine Determinierungslücke, in der für Natorp "die Wurzel der Bedeutung wollender Zielsetzung, des Gewollten" (Jegelka 1992, S. 76) liegt. Die Verwirklichung des Gewollten "erfolgt in der Form der Handhabung, der Herrschaft durch Technik" (ebd. S. 76). Menschliches Handeln unterliegt den Gesetzen der Naturkausalität, physikalisch-chemisch, psychologisch oder soziologisch. Der Mensch bleibt auch in seiner gesellschaftlichen Existenz seiner Naturgrundlage fest verbunden. Dies gilt allerdings nicht für die Willensbildung. "Nicht anders wie die Erfahrung der Idee sich fügen muß, fügt sich die theoretische der praktischen Erkenntnis, fügt sich der Verstand dem Willen" (Jegelka 1992, S. 76). Aber ohne die Hilfe des Verstandes kann der Wille nicht wirksam werden. "Nur gibt der Verstand die Mittel, nachdem der Wille den Zweck bestimmt hat" (ebd.). Die radikalere Frage ist die nach dem Warum des Zwecks. Auch für den Endzweck des Wollens gilt des Prinzip der gesetzmäßigen Einheitsbildung, d.h., er liegt "allein in der Idee, d.h. in derjenigen formalen Einheit, in der alle besonderen Zwecke sich vereinigen" (Natorp zit. ebd.). Alle Willensbildung gründet auf der Willensfreiheit, die die Naturkausalität weder einschränkt, noch ihr unterliegt, denn Willensfreiheit betrifft nicht das Handlungsgeschehen, sondern das Bewußtsein des Wollenden, "den Gesichtspunkt, unter dem er sich urteilend für die Handlung entschied" (Jegelka 1992 ebd.). Verstand und Wille unterstehen beide der Idee und sind ineinander verschränkt. Die mögliche Freiheit des Urteils des Wollenden "beruht allein auf dem Prinzip der gesetzmäßigen Einheit, das es mit Blick auf die Idee gewinnt, auf die es sich ausrichtet der durch die Naturkausalität nicht verhinderte 'Ausblick ins Unendliche' bezeichnet ihm den Weg" (ebd.). Nach Natorp ist es die Erkenntniskritik, die das Gesetz der Idee logisch begründet; sie begründet auch eine kritische Ethik, "auf welche allein eine Pädagogik des Willens sich stützen kann" (Jegelka 1992, S. 76). Alle Stufen des Erfahrungsprozesses, die Aktivität des Bewußtseins und der Wirkungsbereich des Willens streben in Richtung auf ein "Seinsollendes, eine Idee, die vom Bewußtsein gesetzt ist" (ebd. S. 77). Natorp unterscheidet nach dem Grad der Bewußtheit der aufgewiesenen Tendenz drei Stufen menschlicher Aktivität, den Trieb, den Willen und die Vernunft. "Der Trieb ist vorrangig auf das Nächstgegebene gerichtet, leicht gefangen von der Unmittelbarkeit des sinnlichen Objekts, dann passives Getriebenwerden. Doch ist schon in ihm ein entwicklungsfähiges Streben über bloßen Genuß hinaus, schon Triebtätigkeit ist ein 'Arbeiten', das sich selbst und seinen Gegenstand fort und fort erzeugt" (ebd.). Es ist für die Pädagogik der physischen Erziehung von Bedeutung, das schon das ursprüngliche Streben sinnliche Hingabe an das Objekt und Arbeit vereint. Aber schon auf der nächsten Aktivitätsstufe wird die Beziehung zum Objekt bewußter, denn die triebhafte Fixierung auf ein bestimmtes Objekt löst sich als Folge der Wirkung der Urteilsfreiheit des Willens. Wille ist zwar nicht Trieb, aber Wille ist auch nicht nur verstandesmäßige Einsicht, "jedes Wollen bedarf der aktiven Energie. Sie entstammt seiner Fähigkeit zur Konzentration des Trieblebens durch Regelsetzung" (Jegelka 1992, S. 77). Dieses Regelsetzen ist die besondere Eigenheit des Willens. Sie überwindet die triebhafte Objektfixierung zugunsten einer freien praktischen Objektsetzung. Die Maxime des Willens entsprechen nun aber nicht immer dem Kategorischen Imperativ, sondern können auch Böses wollen. Erst auf der nächsten Stufe, im Vernunftwillen, gelangt das Bewußtsein zur Erkenntnis der Idee des Unbedingten. "Hieß Trieb die blinde, unbewußte Fixierung der Tendenz, Wille die Bewußtheit der Möglichkeit praktischer Objektsetzung, so bezieht die Vernunft zuletzt den Willen auf den 'Standpunkt des unbedingt Gesetzlichen' " (ebd.). Das rein formale praktische Gesetz der Vernunft leitet den Vernunftwillen; "weder ist dieses selbst empirisch, noch findet es in der empirischen Tat uneingeschränkt Ausprägung. Doch es wird als der unerbittliche Richter über die Tat gesehen" (ebd. S. 78). Dieses formale Gesetz legitimiert "als oberstes Bewußtseinsgesetz Einstimmigkeit und Einheit der Richtung des Wollens" (ebd.). Nach dem Warum zu fragen, ist nach Natorp widersinnig, denn ein Satz, der selbst Voraussetzung jeder Begründung ist, kann nicht mehr begründet werden. Jede Aktivitätsstufe bringt die "Einheit von theoretischem und praktischem Bewußtsein zu einem relativen Ausdruck" (ebd.). Diese Einheit findet ihren höchsten Grad der Vollendung im Bewußtsein von der eigenen tendenzbestimmenden Gesetzlichkeit. "Dieser Gesetzlichkeit sind Theorie und Praxis, naturwissenschaftliche und sozialwissenschaftliche Technik in unauflöslicher Verknüpfung unterworfen, Objekt der konkreten Ethik müssen deshalb Wille und Gesetz sein, durch technische Gestaltung auf die theoretische Erkenntnis zurückgebunden. Technik ist Formung durch Sittlichkeit, Sittlichkeit kann nur in Gestaltung, Handhabung und Technik konkret werden" (Jegelka 1992, S. 78). Das Selbstbewußtsein des Menschen bildet sich nach Natorp "in einem 'Wechselverhältnis' zwischen Bewußtsein und Bewußtsein, also in 'Gemeinschaft' heraus" (ebd.). Da der Mensch nicht isoliert heranwächst, kann der Prozeß der Menschenwerdung und der Menschenbildung sich auch nur in der menschlichen Gemeinschaft vollziehen. Jede Bewußtwerdung vollzieht sich nach demselben formalen Gesetz, d.h. "aller echte Bildungsinhalt ist an sich Gemeingut" (Natorp zit.ebd. S. 79). Der einzelne Mensch sieht allerdings immer nur einen begrenzten Ausschnitt dieses unermeßlichen Bildungsinhaltes, "der allen offensteht und niemandem gehört" (Jegelka 1992, S. 79). Der Gemeinsamkeit des Bildungsinhaltes entspricht die Gemeinsamkeit der bildenden Tätigkeit. Für beide gilt dieselbe Gesetzmäßigkeit der Formung und Gestaltung. Formung durch Bildung intensiviert die Selbsttätigkeit, und selbsttätige Gestaltung wiederum formt und wirkt anregend auf den anderen. Es gibt keine Hierarchie zwischen Lehrenden und Lernenden; beide sind autonom, und ihre Tätigkeit ist immer Selbsttätigkeit und freies Handeln, das aber wieder wechselseitig anregt, weil es sich immer in einer Relation zum anderen vollzieht. Die Herausbildung des Selbstbewußtseins ist so eine gemeinsame Tat und das Ergebnis der Beziehung zu anderen in freier und autonomer Bindung. "Gerade das Selbstbewußtsein also, und mithin das selbstbewußte Wollen, entwickelt sich allein in und mit der Gemeinschaft von Bewußtsein und Bewußtsein, die in erster Linie Willengemeinschaft ist. Gerade in der tiefsten Einigkeit mit dem Anderen unterscheide ich mich von ihm und finde mich selbst. In jedem ist ein Unendliches; dessen werde ich mir selbst erst inne, indem ich die Unendlichkeit im Andern ahne" (Natorp zit.n. Jegelka 1992, S. 79). Nach Natorp ist es die Aufgabe der Sozialpädagogik, diese Einsicht in Erziehung umzusetzen. Die Erziehung des Individuum untersteht sozialen Bedingungen, und das soziale Leben ist auf eine ihm gemäße Erziehung der Individuen angewiesen, d.h. Erziehungslehre und Gesellschaftslehre bedingen einander und unterstehen demselben letzten Gesetz (vgl. Jegelka 1992, S. 80). Natorp geht von einer parallelen Bestimmung des konkret Sittlichen für das Individuum und die Gemeinschaft aus, die sich in ein System von Tugenden überführen läßt, "in dem die Sittlichkeit, als Tugend überhaupt, in ihre einzelnen Richtungen auseinandergelegt wird" (ebd.). Natorp bestimmt die Tugenden in Anlehnung an Platon und legt als Einteilungsraster seine Stufenfolge der Aktivitäten zugrunde, so daß Tugend und Tätigkeit direkt miteinander verschränkt werden. Daneben gliedert er die Grundfunktionen des individualen und sozialen Lebens nach ihrem Bezug auf die Grundgesetzlichkeit des Bewußtseins und stellt ihre vielfache innere Verbindung zu den Tugenden und den Aktivitätsstufen her. Die erste individuelle und oberste zentrale Tugend ist die Vernunft, die als Wahrheit das oberste Gesetz des Bewußtseins darstellt. Die Wahrheit der Vernunft erfordert die Übereinstimmung von Wollen und eigenem inneren Gesetz. Hier gibt es zwar eine Ähnlichkeit zum Begriff des Gewissens, die Betonung liegt aber allein auf der reinen Bewußtheit der Vernunft, während Gewissen eher religiös bestimmt ist und auch das Gefühl berücksichtigt. Vernunft bezieht sich auf das Selbst, den Trieb und den Willen wie auch auf die Handlung. In der Tat und Arbeit wird Wahrheit als Sachlichkeit, Aufrichtigkeit und Kritik gegen öffentliche Mißstände wirksam, deren Äußerung geradezu eine Pflicht ist. Die zweite individuelle Tugend ist die Tapferkeit, die als Selbstzucht auch die Tatkraft des Sittlichen ausmacht. "Sittliche Tapferkeit besteht im unbedingten Einsatz der Kräfte für das unbedingte Gute. An der Idee des Guten orientiert, stellt sie das Aktivitätspotential des Triebes in den Dienst des sittlichen Willens" (Jegelka 1992, S. 81). Sie soll sich auf alles menschliche Handeln erstrecken. Tapferkeit und Wahrhaftigkeit zusammen bilden die Treue. Die dritte individuelle Tugend ist das Maß bezogen auf das Triebleben. "Das ausgeglichene, maßvolle Harmonisieren des Trieblebens mit dem Ordnungsprinzip des Sittlichen ist Sinn dieser Tugend, mit ihr vollendet sich die persönliche Sittlichkeit" (ebd.). Gefordert ist hier keine Negation oder Unterdrückung. Diese Tugend ist auf vernünftige Einsicht und Festigkeit des Willens angewiesen. Diese drei individuellen Tugenden faßt Natorp nun für die Gemeinschaft unter dem Begriff "Gerechtigkeit" zu einer einzigen zusammen. Gerechtigkeit verdeutlicht so den sozialen Sinn der individuellen Tugenden. Inhaltlich ist sie nicht eigenständig definiert, ihr Sinn liegt in der Beziehung der individuellen Tugenden auf die Gemeinschaft. Die soziale Gerechtigkeit ist aber auch insofern eine individuelle Tugend, als ihre Verwirklichung von individuellen Eigenschaften und willentlichen Handlungen abhängt. Ihre Gültigkeit gründet in der Allgemeingültigkeit des Sittlichen überhaupt, d.h. jeder einzelnen Person ist die Fähigkeit zur Sittlichkeit zu unterstellen; sie kann unter keinen Umständen abgesprochen werden, andererseits kann sich keiner vollständig tugendhaft wähnen. Unter dieser Voraussetzung sind alle Menschen als gleich zu betrachten. Jeder dient nach seinen Fähigkeiten der Gemeinschaft, und jeder erhält nach seinem Bedarf, gemessen an den Fähigkeiten, d.h., es ergibt sich ein umgekehrt proportionales Verhältnis: Dem Stärkeren und Gesünderen steht weniger, dem Schwachen und Kranken mehr zu. "Gleichheit äußert sich somit empirisch als eine durchaus unterschiedliche Inanspruchnahme der öffentlichen Güter. Auf dem Boden solcher Gleichheit muß Gemeinschaft sich erheben, will sie sittlich sein, das Individuum erhält dann mehr, als es gibt, da seine Möglichkeit zur freien Entfaltung nur noch wächst. Die Gerechtigkeit, als Wahrheit des auf Gleichheit gestellten Gemeinschaftslebens, fordert Tribut von Trieb, Wille und Vernunft. Sie drängt vor allem darauf, das Spiel von Sympathie und Antipathie, von blinder Liebe und blindem Haß zu zügeln" (Jegelka 1992, S. 82). Gerade im Rassen-, National- und Klassenhaß sieht Natorp die Gefahr des systematischen Untergrabens "jedes Gerechtigkeitssinnes und damit jeder Möglichkeit sittlicher Gemeinschaft" (Natorp zit.ebd.). Natorp engagierte sich seit den neunziger Jahren intensiv in der Volksbildungsarbeit und der Reformpädagogik, er galt als einer der bedeutendsten und meist gelesenen Pädagogen seiner Zeit. Sein pädagogisches Denken hatte Einfluß auf die Lehrerschaft, die sozialdemokratische Partei und die Bildungspolitik. Er war ein Gegner des Faschismus, der völkischen Rechten und der Nationalsozialisten. Seine Philosophie der Selbstschöpfung war ein Gegenentwurf zum Kulturpessimismus seiner Zeit. Auch in seinem Spätwerk vollzog er, wie Jegelka nachweist, keine Wende zur Metaphysik; er vertrat den Grundgedanken eines Monismus unendlicher Relationen und Korrelationen und sah die Wahrheitssuche immer als selbstbezügliches Denken (vgl. Jegelka 1992, S. 266f). 4.5 Fazit: Von der Didaktik zur Sozialpädagogik Leitgedanke ist die Erkenntnis, daß die Übel der Welt, gemessen am Maßstab der Gerechtigkeit und der prinzipiellen Gleichheit aller Menschen, durch den Menschen selbst verursacht sind. Der Rückgriff auf Platon ermöglicht es, den Menschen dennoch nur als verirrt bei Comenius, verdorben bei Campe oder durch soziale Verhältnisse gehindert bei Humboldt und Natorp zu sehen, den man aber durch Aufklärung, Erziehung und Bildung aus seinen gesellschaftlichen Verstrickungen befreien kann; Ziel ist die Besserung des Menschen und die Besserung der Gesellschaft, wodurch die Erziehung eine politische Dimension bekommt. Aus der Erziehungs- und Lehrkunst, die bei Comenius noch ganz im "Dienste Gottes" steht, wird die Pädagogik, d.h. die richtige Methode einer wissenschaftlich begründeten Erziehung. Auf sie setzen die Philanthropen die vielversprechende Hoffnung, daß die Kinder die Fähigkeit erwerben, alle gegenwärtigen Probleme der Erwachsenengeneration mit Sicherheit zukünftig lösen zu können. Der Wirkungsprozeß der Erziehung auf den gesellschaftlichen Zustand wird hier als einseitig angenommen. Humboldt hingegen berücksichtigt die wechselseitigen und hier besonders die nachteiligen Wirkungen der Lebensbedingungen auf Erziehungs- und Bildungsprozesse. Sein Konzept setzt an beiden Punkten an, der privaten Erziehung und der ständigen Reproduktion von gleichen Lebenssituationen in einer ständischen Gesellschaft. Das individuelle Recht auf Bildung und Selbstbestimmung für alle kann nur in einem öffentlichen und institutionellen Rahmen gewährleistet werden, dessen Voraussetzung wiederum das Zulassen des Überschreitens von Standesgrenzen ist. Die Veränderung von gesellschaftlichen Gegebenheiten ist hier Bedingung und Ziel von Bildungsprozessen. Auch Natorp sieht die sozialen Verflechtungen der an sich freien und gleichen Individuen. Sein sozialistischer Ansatz richtet sich gegen gesellschaftliche Beschränkungen und betont die soziale und ethische Verantwortung des Staates, gleiche Bildungsbedingungen zum Zweck der Selbstverwirklichung für alle zu schaffen. Der Mensch benötigt Willensstärke, um sich über beengende soziale Verhältnisse hinwegsetzen zu können, und er braucht das Ideal der Gemeinschaft, das seinem individualistischen Streben Richtung gibt und gleichzeitig einen ausufernden Individualismus begrenzt. Die zunehmende Erkenntnis von den sozialen Beschränkungen des Individuums läßt die These von der Freiheit und Selbstverantwortlichkeit des Menschen wieder fraglich werden. Sie gipfelt in der auch heute noch geführten psychologischen Diskussion über die Determiniertheit des Menschen durch Anlage und/oder Umwelt, die der Selbstbestimmung, dem freien Willen und damit der Selbstverantwortlichkeit keinen, in Prozenten benennbaren Spielraum mehr läßt. 5 Sittlichkeit und Moral nach 1945 5.1 Theodor Wilhelm: Sittlichkeit durch politische Schulbildung Wilhelm lebte zur Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland. Nach 1945 setzte er sich zunächst unter dem Pseudonym "Friedrich Oetinger" mit seiner eigenen Schuld und den Bedingungen auseinander, die dem Nationalsozialismus besonders im Bereich der Erziehung in der Zeit vor 1933 förderlich gewesen sind. Er kritisierte den Rückgriff auf diese Erziehungs- und Bildungstraditionen und plädierte stattdessen für eine Erziehung zur Demokratie im Sinne Deweys und für einen wirklichen Neubeginn: "Es gibt heute in Deutschland nur eine Schuld, die unverzeihlich ist: aus dem Erlebten und Erfahrenen nicht gelernt zu haben" (Oetinger 1955, S. V). Wilhelm veröffentlicht 1979 den Band "Sittliche Erziehung durch politische Bildung, in dem es ihm um die Möglichkeiten sittlicher Erziehung geht, "die sich Eltern, Lehrern, Politikern, Journalisten und ganz gewiß auch der Selbsterziehung der Jungen eröffnen, ohne daß unsere ganze gesellschaftliche Ordnung auf den Kopf gestellt zu werden braucht" (ebd. S. 7). Er betrachtet die Schule als den spezifischen Ort moralischer Produktivität. Er beschreitet bei seinem Entwurf den politologischen Weg, ohne dabei auf die Unterstützung durch die Philosophie vollständig zu verzichten. Ein rein philosophierender Ethik-Unterricht allerdings läßt seiner Ansicht nach die politischen Bezüge außer Acht, während der Religionsunterricht zuwenig die rationale Seite der sittlichen Bildung berücksichtigt. Wilhelm stellt seine Überlegungen an vor dem geschichtlichen Erfahrungshintergrund des Nationalsozialismus, den er politisch charakterisiert durch die Formel "Mehr Macht als Verantwortung" (Wilhelm 1979, S. 8) und im Hinblick auf die terroristische Gewalt der siebziger Jahre und auf eine Politik, die er angesichts "neuartige(r) Menschheitsprobleme" (ebd.) mit der Formel "Mehr Verantwortung als Macht" (ebd.) kennzeichnet. Er grenzt sich ab von dem totalitären und missionarischen Anspruch der marxistisch-leninistischen Ideologie, die glaubt, im Besitz der Wahrheit zu sein (vgl. ebd. S. 14-18). Wilhelm wählt als Grundkategorie sittlich-moralischer Überlegungen das Prinzip der Gerechtigkeit, in deren Idee Politik und Moral zusammentreffen (vgl. S. 86-105). Dabei geht es um Gerechtigkeit als Leitbild, der sich die Politik bloß nähern kann und eine moralische Reflexion auf der Ebene des Sozialen. Wilhelm beschränkt sich hier auf das der Vernunft zugängliche und deshalb Lehr- und Lernbare, um "die wichigen sozialen Primärerfahrungen rational aufzuarbeiten und politische Information und gesellschaftliche Aufklärung als Hilfsmittel der sittlichen Bewußtseinsbildung einzusetzen" (ebd. S. 9). Wilhelm analysiert die bisherigen Begründungen und Tendenzen der sittlichen Erziehung in Deutschland seit Kant und kommt zu dem Ergebnis, daß sich Theorie und Praxis der sittlichen Erziehung "zwischen den Extremen des übermäßig aufgeblähten und des bis zur Bewegungslosigkeit geknebelten Individuums" (ebd. S. 24) bewegen. Die jeweilige Übertonung eines Einzelfaktors machten sie entweder zu idealistischen und unrealistischen oder zu subjektfeindlichen Systemen. Er selbst hält an der Autonomie des Subjekts fest, stellt sie aber in den Zusammenhang soziokultureller und biogenetischer Gegebenheiten: "Auch wenn die sozialen und biographischen Mächtigkeiten auf das Schicksal eines jungen Menschen noch so bestimmend übergreifen, das Prinzip der Verantwortung und der persönlichen Zurechenbarkeit bleibt in Geltung, und nur die Strategie unserer pädagogischen Hilfen variiert nach den gegebenen Voraussetzungen. Die Autonomie besteht in der Ausgestaltung eines fast beängstigend kleinen Raumes persönlicher Willensentscheidung. Auf diesen kleinen Raum jedoch kommt es an" (ebd. S. 25). Wilhelm sucht nun einen mittleren Weg zur Förderung des persönlichen sittlichen Bewußtseins zwischen einem autoritären und einem freizügigen System (vgl. ebd.). Dabei geht er dem Problem der "sozialen Instinkte" (ebd. S. 28) des Menschen nach, zu denen er das Urvertrauen und den Spieltrieb des Kindes rechnet, aber auch instinktnahe Verhaltensmuster wie Anpassungsbereitschaft und Rollendisposition, Frustration und Aggression zählt. Aggression definiert er nach Mitscherlich als den "Zorn des Menschen über die Widerstände, die sich der Erfüllung seiner spontanen Wünsche und Begierden immer wieder in den Weg stellen" (Wilhelm 1979, S. 29). Die Instinktausstattung des Menschen enthält einen hohen Unsicherheitsfaktor, sie ist nicht verhaltensbestimmend, sondern eher ein Antriebspotential, das erst "durch Erfahrung und Lernen zu einer leitenden Führungskraft entwickelt werden kann" (ebd. S. 30). Die biologischen und sozialen Bereitschaften des Menschen bedürfen einer Disziplinierung durch eine reflektierte Lebenssteuerung, der Erziehung (vgl. Wilhelm 1979, S. 31). Es gibt vier moralisch und sittlich relevante Grundsituationen, die, je nachdem wie sie erlebt und bewältigt werden, zu unterschiedlichen Einstellungen und Verhaltensweisen führen. Erstens sind "Konflikte mit Stärkeren" (ebd.). und daraus resultierende soziale Spannungen quasi alltäglicher Bestandteil sozialer Situationen. Stärke wird nicht nur als Hilfe erlebt, sondern auch als Überlegenheit und Übermacht. "Die Situation ist moralisch geladen. Weder Subalternität [...] ist moralisch wünschenswert noch eine durch Hilflosigkeit und Frustration motivierte aggressive Einstellung, die sich leicht zu perseverierender sozialer Verschlossenheit auswächst" (ebd. S. 31/32). Speziell der Schule fällt hier die Aufgabe zu, ein normenfixiertes, repressives Familienklima aufzufangen und auszugleichen. Wird aber Schule hauptsächlich als Übermacht erlebt, verlagert sich die Suche nach Befreiung aus der Unterlegenheit auf außerschulische Gebiete. Unterlegenheits- und Versagenserfahrungen lassen sich nicht vermeiden, aber sie werden relativiert durch das Wissen, "daß andere die gleichen Schwierigkeiten haben" (Wilhelm 1979, S. 32). Zweitens wecken "Begegnungen mit Schwächeren" (ebd.) das soziale Gewissen. Mitleid ist die Grundlage des nicht-rationalen sittlichen Verhaltens sowohl im privaten wie im öffentlichen Bereich. Die Problematik der Chancengleichheit bringt schichtenspezifische Benachteiligungen ins Bewußtsein; darüberhinaus geht es aber auch um physische Schwächen bei Statusplazierungen (vgl. ebd. S. 32/33). Drittens gehört auch das "Verhalten zum anderen Geschlecht" (ebd. S. 33) zu den sittlich relevanten Sozialsituationen. Enthemmung führt nach Wilhelm nicht nur zu sexueller Freiheit, sondern auch zur "Dominanz der stärksten Vitalkräfte und damit eher zu sexueller Brutalität" (ebd. S.34). Er legt den Schwerpunkt hier eher auf humane Grunderfahrungen wie Zuwendung, Zärtlichkeit, Distanz und Ritterlichkeit, ein vernächlässigtes Zwischenfeld der Sublimierung zwischen plumper Triebbefriedigung und verklemmter Prüderie (vgl. ebd.). Viertens gehört die "Gruppe" (Wilhelm 1979, S. 34), speziell die Kleingruppe, zu den Sozialsituationen mit hoher moralischer Valenz. Die Gruppensituation selbst ist ambivalent, sie kann befreiend wirken und Sicherheit geben, aber auch selbständiges Verhalten durch übermäßigen Gruppendruck erschweren und die Risikobereitschaft steigern. Sie schafft günstige Voraussetzungen für sittliches Verhalten, "wenn eine entsprechende Selbststeuerung hinzukommt" (ebd. S. 35). Die Vorzüge der Gruppenarbeit sind u.a. Kooperation und Teamarbeit, Arbeitsteilung, Helfen und sich Helfen lassen (vgl. Wilhelm 1979, S. 35). Das beherrschende soziale Phänomen der Schule ist für Wilhelm die Situation der Konkurrenz. Er definiert schulisches Lernen als "Konkurrenzlernen" (ebd. S. 36) nach dem Wettbewerbsprinzip. Aber dieses Konkurrenzlernen ist zwiespältig, denn es bedeutet nicht nur Hoffnung auf Erfolg, sondern auch Angst vor Mißerfolg und damit eine Blockierung der Lernmotivation. Die Zensurenauslese widerspricht letztlich dem Prinzip der Chancengleichheit und der Kooperation und darf deshalb nicht alleiniger Maßstab des schulischen Lernens sein. Solidarität als Gruppeneffekt und Lernziel in der Schule lehnt Wilhelm ab, da Solidarität für ihn weder ein gesellschaftlicher noch ein moralischer Wert ist und immer nur über besondere Inhalte hergestellt wird, gegen oder für die man sich solidarisiert. Er hält an der sozial-homogenen Jahrgangsklasse fest, weil "moralische Bewährung" (ebd. S. 40) dort am ehesten möglich ist und die Kinder nur dort lernen, "den gegebenen Sozialrahmen auszufüllen und mit der Unveränderlichkeit der gegebenen Situation fertig zu werden" (ebd.). Wilhelm möchte in den Kindern keine Hoffnungen wecken, die dann doch nicht erfüllt werden können, denn die Schule kann das soziale Gefälle der Herkunft "nicht aus der Welt schaffen" (ebd. S. 41), was sich auch durch die Zusammensetzung der Leistungskurse an den Gesamtschulen zu bestätigen scheint. " 'Soziale Integration' ist gewiß ein hohes Ziel der Zukunftsschule und ein pädagogisches Feld, das für die Schulung des sozialen Gewissens von großer Bedeutung ist. Aber am Ende ist das Zusammenholen aller Sozialschichten im selben Unterrichtsraum mit ungewollten Nebenwirkungen verbunden, die ins Gegenteil dessen ausschlagen, was beabsichtigt war" (Wilhelm 1979, S. 42). Wilhelm mißt der Rolle des Lehrers und der Lehrerin nicht nur als Vermittler von Lerninhalten eine Funktion zu, sondern er sieht gerade in ihrer Person eine nicht zu unterschätzende Wirkung durch das Vorbild, über das inhaltliches und soziales Lernen initiiert und gesteuert wird (vgl. Wilhelm 1979, S. 42-47. Lerneffekte bleiben, wie Erfahrungsberichte zeigen, auch in der Erinnerung immer mit einer Person und ihrem speziellen Verhalten verbunden. Ein besonderes Aufgabenfeld stellt für den Lehrer der Übergang der Kinder aus der Familie in die Schule dar und hier besonders die persönliche Zuwendung der betreuenden Lehrperson "vor allem für Kinder, die in der Familie lieblos und ohne Führung aufgewachsen sind" (ebd. S. 45). Über die Lehrer und Lehrerinnen bildet sich ein grundlegendes Verhältnis zur Institution Schule: "Das Vorbild des Lehrers erzeugt also keineswegs nur ein individuelles Meister-Jünger-Verhältnis; vielmehr wirkt sich die Kraft der Lehrerpersönlichkeit weitgehend 'unpersönlich' aus - in der Erzeugung eines sozialen Musters, das den Namen Schule und Klassengemeinschaft trägt und dem eine ganz bestimmte moralische Signatur eigen ist" (ebd. S. 45/46). Sittliches Verhalten kann durch Vorbildwirkung zunächst ohne Worte initiiert werden, später muß dieser Prozeß dann allerdings auf der Reflexionsstufe durch sprachliche Kommunikation und die "Kreativität der sprachlichen Selbstäußerung" (ebd. S. 47) weitergeführt werden. Den Vorgang der Selbstfindung verortet Wilhelm in einer deutlichen Grenzziehung zwischen dem Subjekt und dem anderen (vgl. ebd. S. 47-56). Es geht darum zu lernen, den anderen in seinem Anderssein "auszuhalten und von diesem Anderssein zu lernen" (ebd. S. 49). Toleranz bedeutet nicht nur gewähren lassen, sondern "den anderen so ernst zu nehmen, daß man gegebenenfalls bereit ist, in der Auseinandersetzung mit ihm die eigene Meinung zu ändern" (ebd. S. 50). Selbstvertrauen entsteht durch das "Zusammenspiel von sozialer Erfahrung und Erfahrung der eigenen Subjektivität" (ebd.). Wilhelm bezieht sich hier besonders auf Dewey und Piaget, die die Bedeutung der Offenheit des Ich gegenüber der Außenwelt für die Bildung der kognitiven Qualitäten, Spontaneität, Kreativität, Emotionalität und Empathie betonen. Die besonderen Aufgaben der Schule liegen hier in der gedanklichen Klärung emotional begründeter Einstellungen und Verhaltensweisen mit dem Ziel einer moralischen Motivation, im Organisieren von Lernvorgängen, die nicht nur den Verstand, sondern auch das Gefühl ansprechen, und in der Gestaltung eines Schullebens, das den Zusammenhang von Lebenswirklichkeit und Lernen für Kinder erlebbar und erfahrbar macht (vgl. Wilhelm 1979, S. 52-56). Für Wilhelm bezieht Demokratie "ihre Legitimität aus den organisierten Bemühungen um Gerechtigkeit" (ebd. S. 62). Auch die Legitimität des politischen Unterrichts leitet er aus dieser Gerechtigkeitsnorm her. "Sie ist es, die zu den rationalen Prozessen der Aufklärung das unverzichtbare emotionale Moment hinzufügt, und nur die Kombination beider Faktoren befähigt den Schüler zur Umsetzung des Gelernten in lebenspraktische Motivation" (Wilhelm 1979, S. 62). Wilhelm stellt für den politischen Unterricht einen Lernzielkatalog auf, in dem eine unsystematische und unvollständige Reihe von politischen Themen und deren moralischer Reflexion beispielhaft vorgestellt werden; Schwerpunkte legt er auf das Thema "Ziel-Mittel-Relation" (ebd. S. 63), das darauf abzielt, Ziele, Mittel und ihre Folgen als eine untrennbare Einheit zu betrachten (vgl. ebd. s. 76-81), und auf die Problematik des Kompromisses, der unter Partnern ein öffentliches Zeichen des guten Willens darstellt; im Aushandeln eines Kompromisses "entsteht eine neue moralische Plattform für die Begründung des gesamten Handlungsgeschehens" (ebd. S. 85). Für Wilhelm haben die platonischen Kardinaltugenden als politische Tugenden in einem demokratischen Rechtsstaat eine handlungsrelevante Bedeutung, denn "ohne individuelle moralische Bereitschaften und Dispositionen bleibt das rechtsstaatliche System ein hölzernes Gerüst" (Wilhelm 1979, S. 99). 5.2 Skizzierung zwei sozialpsychologischer Entwicklingstheorien 5.2 1 Jean Piaget: "Das moralische Urteil beim Kinde" Piaget definiert Moral in Anlehnung an Kant und Durkheim: "Jede Moral ist ein System von Regeln, und der Kern jeder Sittlichkeit besteht in der Achtung, welche das Individuum für diese Regeln empfindet" (Piaget zit.n. Garz 1989, S. 88). Diesen Regeln, insbesondere den von den Kindern selbstgeschaffenen Regeln und Regelvorstellungen versucht Piaget auf die Spur zu kommen. Sie finden sich bei einfachen Gesellschaftsspielen, die ein Mindestmaß an Kooperation voraussetzen und die in der späten Kindheit enden. Es geht Piaget hier zunächst um das moralische Urteil, das er von Verhalten oder moralischen Gefühlen unterscheidet; andererseits ist er sich des Zusammenhangs von Denken und Handeln bewußt: "Tatsächlich ist das Denken gegenüber dem Handeln immer verspätet, und die Zusammenarbeit muß schon lange in der Praxis existieren, bevor das Denken ihre Folgen ins volle Licht rücken kann" (Piaget zit.n. Garz 1989, S. 89). Die Entwicklung des moralischen Urteils spiegelt nach Aebli die Entwicklung des moralischen Verhaltens. Es geht also um das Entstehen der kindlichen Moral und der Regeln partnerschaftlichen Handelns, "um das Bewußtsein der Normen, die es regeln, und um seine Einstellung zu ihnen" (Aebli 1983, S. 14). Piaget arbeitete rein empirisch mit naturalistischen Beobachtungen und klinischen Befragungen (vgl. Garz 1989, S. 89). Piaget wählte das Murmelspiel für seine Beobachtungen aus, weil dessen Regeln von den Jungen, die es damals hauptsächlich spielten, ohne Eingriffe Erwachsener weitergegeben wurden (vgl. ebd. S. 15). Er unterscheidet vier Stadien des Praktizierens der Spielregeln, vom "individuellen, bloß motorischen Spiel (bis zwei Jahre) über das egozentrische Spielen für sich (drei bis sechs Jahre) zum kooperativen Spiel (von sieben Jahren an) und zur Kodifikation der Regeln (von elf Jahren an)" (ebd.). Diesen vier Stadien entspricht jeweils ein anderes Regelbewußtsein der Kinder: Im bloß motorischen Spiel gibt es noch keine verpflichtenden Regeln. Für Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren gelten die Regeln als fraglos zwingend und unveränderlich, "von den Erwachsenen kraft ihrer Autorität festgesetzt" (ebd. S. 16). Im Alter von etwa zehn Jahren beginnt das Kind, mit den Regeln rationaler umzugehen: Regeln werden durch freien Entschluß abgemacht, und sie sind durch gemeinsamen Beschluß veränderbar. Während Piaget mit dem Murmelspiel die praktische Moral der Kinder untersucht, behandelt er eine theoretisch verstandene Moral unter dem Aspekt der Verantwortlichkeit des Kindes gegenüber den Ansprüchen der moralischen Normen und der Gerechtigkeit. Hier arbeitet Piaget mit der Methode der Befragung. Piaget unterscheidet drei große Stadien der moralischen Entwicklung. Die erste reicht bis zum Alter von etwa acht Jahren und ist gekennzeichnet durch einen moralischen Realismus, der den Erwachsenen vollkommene Gerechtigkeit und das Vorrrecht des Regelsetzens und den Gehorsam der Kinderseite zuschreibt. Hier glaubt das Kind an immanente Sanktionen und gerechte und notwendige Vergeltungsstrafen. Autorität hat Vorrang vor Gerechtigkeit und Gleichheit. Es handelt sich um eine heteronome Autoritätsmoral, die auf einseitigem Respekt vor dem Erwachsenen basiert. Zwangsregeln werden weder verinnerlicht noch gerechtfertigt und nicht immer eingehalten (vgl. Aebli 1983, S. 17f). Vom neunten Lebensjahr an wandelt sich die heteronome Moral in eine autonome Moral der gegenseitigen Achtung und der Glaube an eine immanente Gerechtigkeit verliert sich. Egalitäre Prinzipien stellen die Autorität der Erwachsenen in Frage und legen die Basis für eine partnerschaftliche Kooperation. Die Vergeltungsstrafe wird als unzureichend erkannt und durch Wiedergutmachung oder Gemeinschaftsausschluß ersetzt. "Prinzipien der Reziprozität führen zu einem neuen, rationalen Verständnis von Regel und Gerechtigkeit" (ebd. S. 18). Vom elften Lebensjahr an tritt an die Stelle eines starren Egalitarismus die Idee der Angemessenheit: "Die Idee der Gleichheit der Rechte und der Sanktionen (bei gleichem Vergehen) wird auf die individuelle Situation und die Umstände bezogen" (Aebli 1983, S. 18). Für Piaget steht am Anfang der moralischen Entwicklung die Weisung des Erziehers, zu dem das Kind eine "Mischung von Ehrfurcht und Liebe" (ebd. S. 20) empfinden soll. "Daraus entsteht eine heteronome Moral, die durch rationale Interpretation zur Autonomie gelangt" (ebd.). Piaget vertritt die Auffassung, daß normative Geltung von Prinzipien und deren Akzeptanz durch die Logik der Vernunft aus der gleichberechtigten Interaktion der Kinder untereinander erwachsen; sie sind eine Folge der Kooperation (vgl. ebd.). Es handelt sich also um eine Selbstgesetzgebung, die sich in einer selbstorganisierten, partnerschaftlichen Interaktion entwickelt, wobei die vertragschließende Gruppe die peer-group ist. Daraus ergibt sich für die Schule die Forderung nach Gruppenarbeit und Schülerselbstverwaltung (vgl. Aebli 1983, S. 21). 5.2.2 Lawrence Kohlbergs Moraltheorie: Entwicklungsstufen der Gerechtigkeit Nach Kohlberg stellt die Moralisation oder sittliche Beeinflussung des Individuums durch die Gesellschaft bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts das grundlegende Problem der Sozialpsychologie dar. Es ist nötig und gleichzeitig schwierig, die moralische Entwicklung von der Sozialisation abzugrenzen, weil es in beiden Fällen immer auch um eine "allmähliche Anpassung an kulturell tradierte Normen" (Kohlberg 1996, S. 7) geht. Es geht auch nicht darum, moralisches oder unmoralisches Verhalten auf interindividuelle Unterschiede des moralischen Charakters zurückzuführen. "Moralisches Verhalten, das die Befolgung sozialer Regeln beinhaltet, muß im großen und ganzen als das Resultat der gleichen situativen Kräfte, Ich-Variablen und Sozialisationsfaktoren erklärt werden, die auch Verhaltensweisen bestimmen, welche nicht unmittelbar moralisch bedeutsam sind" (Kohlberg 1996, S. 17). Tatsächliches Verhalten wird für die Forschung erst dann relevant, wenn sich "Bindeglieder zwischen dem Verhalten des Menschen und der Entwicklung seiner moralischen Wertvorstellungen und Gefühle" (ebd.) aufweisen lassen. Kohlberg verfolgt mit seinem Forschungsprogramm vier Ziele: Die Isolierung moralischer Stufen im Sinne einer Entwicklungslogik, die Untersuchung des Verhältnisses von moralischem Urteil und Handeln, die Erforschung kultureller Unterschiede in der moralischen Entwicklung und die Aufdeckung der entwicklungsfördernden bzw. -hemmenden sozialen Faktoren (vgl. Garz 1989, S. 154). Er verbindet im Sinne der Komplementaritätsthese empirisch-analytische Methoden mit phänomenologisch-hermeneutischen und logisch-deduktiven und gibt dabei bewußt die Position der Wertneutralität zugunsten einer normativen Interpretation und Theorie auf, denn Methode und Theorie setzen gerade voraus, "daß die zu interpretierenden moralischen Urteile in unterschiedlichem Maße moralisch rational sind" (Kohlberg 1996, S. 233). Kohlbergs theoretische Position ist nach Habermas die des "hermeneutischen Rekonstruktivismus" (ebd. S. 235), in deren Mittelpunkt die Entwicklungsstufen des Gerechtigkeitsdenkens stehen (vgl. ebd. S. 226-239). Gerechtigkeit ist für Kohlberg in Übereinstimmung mit Platon, Aristoteles, Kant und Piaget die wichtigste Tugend einer Gesellschaft wie auch jedes einzelnen (vgl. ebd. S. 239-243). Kohlberg identifiziert Moral mit Gerechtigkeit, weil seiner Ansicht nach "die wesentlichste Struktur von Moral eine Gerechtigkeitsstruktur ist" (ebd. S. 144). In moralischen Situationen geraten Interessen in einen Widerstreit; "Gerechtigkeitsprinzipien sind Lösungskonzepte für diese Konflikte, sie dienen dazu, jedem das Seine zu geben" (ebd.). Mittels hypothetischer Dilemmata, die Menschen in verzwickte Interessen- und Verantwortungskonflikte zwischen Recht und Anspruch stellen und von denen das "Heinz-Dilemma" am bekanntesten ist, erforscht er in Interviews das Gerechtigkeitsdenken der Versuchspersonen (vgl. ebd. S. 495-508). Kohlberg fand heraus, daß sich die moralische Entwicklung auf drei Ebenen (Basis der Wertung) mit jeweils zwei aufeinander aufbauenden Stufen (Erkenntnisstand, Begründung, soziale Perspektive) vollzieht, die jeder Mensch sequenzartig in gleicher Reihenfolge, aber in individuell unterschiedlichen Zeiträumen durchläuft (vgl. Garz 1989, S. 155ff). Die Entwicklungsstufen entsprechen keinen Altersstufen und keinem Reifungsprozeß, obwohl man den Stufen ein ungefähres Alter ganz allgemein zuordnen kann. So urteilen Kinder bis zum Alter von etwa 13 Jahren auf der präkonventionellen Ebene aus einer "konkretistischindividuelle(n) sozio-moralische(n) Perspektive" (ebd. S. 155). Das Kind orientiert sich hier auf Stufe 1 unmittelbar an Strafe und Gehorsam, ohne nach dem Sinn zu fragen. Auf Stufe 2 wird dann die egozentrische Perspektive zugunsten einer zweck- und austauschinteressierten aufgegeben. Die konventionelle Ebene umfaßt die Perspektive eines Gesellschaftsmitgliedes; Stufe 3 ist charakterisiert durch interpersonale vertrauens- und respektvolle Beziehungen und das Erfüllen von Erwartungen mittels Konformität. Auf Stufe 4 setzt sich der Mensch in ein bewußtes Verhältnis zur sozialen Ordnung und tritt für sie ein. Frühestens im Alter von 20 Jahren urteilt der Mensch auf der postkonventionellen Ebene, die durch eine aufgeklärte, prinzipiengeleitete Perspektive gekennzeichnet ist. Stufe 5 ist die Stufe des Sozialvertrages; Freiheitsrechte aller und freie Verträge relativieren gesellschaftspezifische Normen. Auf Stufe 6 orientiert sich der Mensch an universalen ethischen Prinzipien, aus denen Gesetzes- und Vertragsansprüche abgeleitet werden können (vgl. Kohlberg 1996, S. 127-132 u. Garz 1989, S. 156-163). Die kognitiv-entwicklungsorientierte Theorie des Moralerwerbs geht davon aus, daß Moralentwicklung eine grundlegende moralische Urteilskomponente enthält und Moralität auf einer generalisierten motivationalen Basis wie Anerkennung, Kompetenz, Selbstwertgefühl beruht; die Befriedigung biologischer Bedürfnisse und die Reduktion von Angst spielen hier keine Rolle (vgl. ebd. S. 162f). Diejenigen Aspekte der Moralentwicklung, die sich auf soziale Interaktion, Rollenübernahme und soziale Konflikte beziehen, sind kulturübergreifend. Moralische Normen und Prinzipien werden aus Erfahrungen in sozialer Interaktion aufgebaut und sind keine Internalisierung von Regeln. Die Moralstufen werden durch Strukturen der Interaktion zwischen dem Selbst und den anderen definiert. "Einflüsse der Umwelt auf die Moralentwicklung vollziehen sich eher über die allgemeine Qualität und das Ausmaß kognitiver und sozialer Anregung im Verlauf der Entwicklung des Kindes als über spezifische Erfahrungen mit den Eltern oder Erlebnisse von Disziplinierung, Bestrafung und Belohnung" (ebd. S. 163). Moralentwicklung hängt von kognitiver und sozialer Stimulierung ab. Eine rein kognitive Anregung ist zwar der notwendige Hintergrund der Moralentwicklung, bringt diese jedoch nicht selbst hervor. Moralische Urteilsfähigkeit setzt die Fähigkeit zur Rollenübernahme voraus, und sie entwickelt sich entsprechend der moralischen Atmosphäre des Umfeldes, die Kohlberg als Gerechtigkeitsstruktur bezeichnet, nämlich die Art, wie Grundrechte und -pflichten und die Früchte der gemeinschaftlichen Zusammenarbeit verteilt werden. Ferner müssen moralisch-kognitive Konflikte als Widersprüche innerhalb der augenblicklichen Stufenstruktur wahrgenommen werden, um eine Weiterentwicklung zu provozieren, u.z. entweder durch Erfahrungen in realen Entscheidungssituationen oder durch die Konfrontation des eigenen Denkens mit dem Denken bedeutsamer Bezugspersonen (Kohlberg 1996, S. 164-172). Moralentwicklung ist nicht nur eine Facette der Ich-Entwicklung, denn das Selbst und die Moral entwickeln sich nicht zwangsläufig parallel (vgl. ebd. S. 172f). Moralische Stufen bilden nach Kohlberg einen Filter, "durch den (a) eine moralische Situation und die durch sie ausgelösten Emotionen wahrgenommen und (b) die für die Person möglichen Handlungsweisen festgelegt werden" (ebd. S. 284). Das Bindeglied zwischen moralischem Urteil und Handeln ist das Verantwortlichkeitsurteil, d.h. das Urteil über die Verantwortlichkeit des Selbst, moralisch richtig zu handeln. Zwischen Moralstufe und Handeln besteht ein gleichförmiger Zusammenhang: "Je höher die moralischen Urteile, desto wahrscheinlicher ist es, daß die Handlung mit der im Urteil geäußerten Entscheidungsrichtung übereinstimmt" (ebd.). Diese Übereinstimmung bestätigt Kohlbergs These aus "Vom Sein zu Sollen", "jede Stufe sei präskriptiver in dem Sinne, daß immer präziser zwischen moralischer Verpflichtung und Verantwortlichkeit auf der einen und außermoralischen Überlegungen auf der anderen Seite unterschieden wird" (ebd. S. 286). Eine moralische Handlung ist objektiv richtig, "wenn sie den von Personen auf Stufe 5 überstimmend verwendeten philosophischen Prinzipien entspricht", und subjektiv richtig, "wenn sie auf einem formal 'richtigen' moralischen Urteil basiert und inhaltlich der objektiv richtigen Entscheidung entspricht" (ebd. S. 287). Moralisches Handeln findet gewöhnlich in einem sozialen Kontext statt, der die moralischen Entscheidungen durch seine moralische Atmosphäre (Gemeinschaft, Solidarität, kollektive Normen) stark beeinflußt (vgl. ebd. s. 292301). Kohlberg hat Gilligans Kritik und ihr Moralkonzept der Anteilnahme und Fürsorge insoweit berücksichtigt, als er den Begriff "Moral" jetzt in zwei Bedeutungen sieht, nämlich als einen unparteilichen, gerechten, universalisierbaren moralischen Standpunkt und einen persönlichen, fürsorglichen, denen ebenfalls zwei Arten von Forschungsdilemmata und die in Amerika übliche Unterscheidung zwischen außerpersönlichen moralischen und persönlichen moralischen Konflikten entsprechen (vgl. Kohlberg 1996, S. 244-247). 5.3 Fazit: Vom moralischen Desaster zu den Stufen der Gerechtigkeit Natorps optimistischer Glaube an die Fähigkeit der Gemeinschaft, korrigierend auf Egozentrismen einzuwirken, hat sich als Irrtum herausgestellt. Ein Kollektiv, dem der einzelne Mensch sich zugehörig fühlen möchte oder das durch Gruppendruck Anpassung und Zugehörigkeit erzeugt, kann das Wir-Gefühl nur durch beständige Abgrenzung und Abwertung von "anderen" Gruppen aufrechterhalten. Die Psychologie nennt die Gefahren, die von solch einer Gruppe ausgehen "risky shift" und das "Abschieben von Verantwortung": Das selbständige und kritische Denken wird zugunsten von emotionalen Bindungen aufgegeben und die Risikobereitschaft steigt, während sich das Individuum gleichzeitig von der Last der Verantwortung für sein Handeln befreit sieht. Nach diesem Prinzip funktionierte der Nationalsozialismus mit seiner Blut- und Bodenideologie und seiner Rassentheorie. Er benutzte den Menschen als Mittel für unmenschliche Zwecke und verstieß damit gegen sämtliche menschlichen Prinzipien. Die vorsätzliche, bürokratisch verwaltete und systematisch durchgeführte Barbarei bescheinigt das Versagen jeder Erziehung und Bildung, macht aber vor allem deutlich, daß die Pädagogik nur ein Aspekt unter vielen anderen in der Gesamtkonstellation Mensch-Gesellschaft-Staat ist. Die Grenzen der Pädagogik anzuerkennen bedeutet aber nicht, ihr ein Alibi ausstellen zu wollen, sondern verlangt geradezu, über ihre Möglichkeiten nachzudenken, ohne sich im Elfenbeinturm der Theorie bequem einzurichten. Die Überlebenden des Nationalsozialismus mußten, zunächst mit Unterstützung der Sieger, dann gestützt auf eine rechtstaatliche, demokratische Verfassung, in einem zweiten mühsamen Versuch Demokratie leben lernen. Die Institution Schule und die Erwachsenenbildungseinrichtungen nahmen zwar die Herausforderung an, aber der Mangel an demokratieüberzeugtem und -erfahrenem Lehrpersonal konnte nicht ohne weiteres behoben werden. Das Vorgehen war eher pragmatisch als an pädagogischen und politischen Utopien orientiert. Erst die Nachkriegsgeneration griff den alten Menschheitstraum von Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit wieder auf, und ihre sozialistischen Ideale mußten zwangsläufig in Konflikt mit immer noch bestehenden autoritären und vorurteilsbehafteten Denkstrukturen in Gesellschaft und Politik geraten. Die Demokratisierung des Staates und der Gesellschaft ging einher mit Pluralisierungs- und Individualisierungstendenzen, die tradierte Normen und moralische Werte radikal infrage stellten. Der Begriff "Moral" wird heute mit Recht skeptisch beäugt, handelt es sich doch meist um einen konventionellen Verhaltenskodex, der zudem häufig genug Doppelmoral oder auch nur Fassade ist. Die Forderung nach einer allgemeinverbindlichen Moral und einer daraus abgeleiteten "richtigen" Erziehung widerspricht der Sichtweise vom Menschen als einem sich selbst bestimmenden Subjekt; andererseits benötigt das Individuum einen Orientierungsmaßstab für sein Denken und Handeln. In einer pluralistischen Gesellschaft bestimmt jeder seine Werte selbst; aber wie frei ist der Mensch wirklich angesichts fraglos übernommener Denkschemata? Und wie kann der Mensch wissen, was für ihn richtig ist? Beinhaltet das Recht auf Selbstbestimmung nicht konsequenterweise auch das Recht auf Fehler? In dieser Situation wartet die Entwicklungspsychologie, die der Pädagogik schon die Empirie bescherte, mit zwei Stufentheorien auf, die vom Selbstbestimmungsrecht und der Selbstverantwortlichkeit des Individuums unter Berücksichtigung der sozialen Umwelt ausgehen und die sich didaktisch im pädagogisch-institutionellen Rahmen umsetzen lassen, und zwar mit Erfolg, wie Struck in seinem Buch zum Thema "Gewalt" berichtet (vgl. Struck 1995, S. 192f). 6 Schluß: Über das Verhältnis von Sittlichkeit und Macht Spiegelt nicht die Art des Umgangs mit staatlicher Macht und Art, Häufigkeit und Dauer des Einsatzes von staatlicher Gewalt als Mittel der Herrschaftssicherung ebenso wie die kriminalstatistisch verzeichneten individuellen Gewalttaten und die rechtliche und öffentliche Wahrnehmung und Handhabung dieser Taten den sittlichen Zustand einer Gesellschaft? Werden nicht Politik und Gesetze von Menschen gemacht und sind folglich Ausdruck ihrer Auffassung von Menschlichkeit und Gerechtigkeit? Gegen Personen gerichtete Gewalt setzt, wenn auch manchmal nur zeitweilig, Überlegenheit voraus und kann sittlich nicht begründet werden, denn sie verstößt gegen grundlegende Menschenrechte. Gewalt hat nicht nur physische, sichtbare Wirkungen, sondern auch psychische, nur scheinbar unsichtbare. Nach Strucks Ansicht übt niemand Gewalt aus, "der nicht vorher schon selbst Opfer von Gewalt war" (Struck 1995, S. 207). Daß Täter gleichzeitig Opfer sind, kann ihre Taten erklären, aber nicht entschuldigen, denn es bleibt der kleine Rest an Entscheidungs- und Willensfreiheit. Die Justiz hat die schwierige Aufgabe, der Gerechtigkeit Geltung zu verschaffen, denn Würde und Ehre eines Verletzten erfordern es, "daß Straftaten nicht frei ausgehen" (Arendt 1996, S. 56). Nur, wo kein Kläger ist, kann auch kein Recht gesprochen werden, Gerichte entscheiden nicht immer nach dem Prinzip der Gerechtigkeit, und Gewalt kann im rechtsfreien Raum stattfinden oder legalisiert werden. Ein besonderes Problem sowohl in juristischer als auch in sittlicher Hinsicht ist die Anordnung und Durchführung von Gewalttaten aufgrund eines "höheren", autoritativ oder gesetzlich legitimierten Befehls. Soldaten eines Landes, Gefolgsleute eines Diktators oder seines Gegners, der amtierende Henker, die Probanden der Milgram-Experimente sollen auf Anordnung töten. Der Entscheidungskonflikt, entweder dem eigenen Denken und Empfinden oder dem Befehl zuwider zu handeln, wird ganz individuell gelöst: die einen ordnen sich der Autorität unter, indem sie die eigene Verantwortung "abgeben", die anderen verweigern die Ausführung trotz eines möglichen äußeren Risikos für sich selbst, wieder andere wählen Wege, die Konfrontationen mit dem Selbstbild und der Autorität vermeiden. Die Zwangslage, in der ein Mensch keine Handlungsalternative zu erkennen glaubt, und die Gedankenlosigkeit von Personen, die sich bloß als Glieder in einer Handlungskette sehen und sich nicht vorstellen können, wozu ihr Tun letztlich dient, sind die Bedingungen, die das Böse ermöglichen, auch wenn die Täter selbst es nicht beabsichtigen. Ausschwitz ist zum Inbegriff des Bösen geworden. Hannah Arendt demonstrierte am Beispiel Eichmanns die Banalität des Bösen: "Außer einer ganz ungewöhnlichen Beflissenheit, alles zu tun, was seinem Fortkommen dienlich sein konnte, hatte er überhaupt keine Motive; und auch diese Beflissenheit war an sich keineswegs kriminell, er hätte bestimmt niemals seinen Vorgesetzten umgebracht, um an dessen Stelle zu rücken. Er hat sich nur, um in der Alltagssprache zu bleiben, niemals vorgestellt, was er eigentlich anstellte. [...] Es war gewissermaßen schiere Gedankenlosigkeit etwas, was mit Dummheit keineswegs identisch ist -, die ihn dafür prädisponierte, zu einem der größten Verbrecher jener Zeit zu werden" (Arend 1996, S. 56/57). Situationszwang und Gedankenlosigkeit sind keine Entschuldigungen für den Täter und die Tat; jeder Funktionär, jeder Befehlsempfänger ist in erster Linie Mensch und für sein Handeln selbst verantwortlich. Arendt versuchte, den Holocaust nach dem Maßstab der Gerechtigkeit zu beurteilen (vgl. Beiner 1985, S. 126f). Dem Vorwurf der Selbstgerechtigkeit und der Forderung nach Zurückhaltung im Verurteilen begegnete sie mit dem Argument, "daß wir nur dann mit unserer Vergangenheit klarkommen werden, wenn wir damit anfangen, sie zu beurteilen und freimütig zu erörtern" (Arendt zit.n. Beiner 1985, S. 128). Das Urteilen soll dazu dienen, Ereignisse begreifbar zu machen, indem wir darüber nachdenken und eine deutliche Position dazu einnehmen. Nach Arendt "entsteht der Gedanke selbst aus Ereignissen der Lebenserfahrung und muß an sie gebunden bleiben; sie sind die alleinigen Wegweiser, an denen er sich orientiert" (Arendt zit.n. Beiner 1985, S. 125). Nur durch ständiges Urteilen vermag der Mensch, der Welt einen Sinn zu geben. Die Fähigkeit zu denken ist die Bedingung des Urteilens; das Urteilen selbst "darf nicht durch vermeintlich vorrangige Beziehungen von Liebe und Treue behindert werden" (Beiner 1985, S. 129). Aber ist ein Unrechtsstaat, der Unmenschlichkeit zu seiner Maxime und zum Gesetz erklärt, nicht radikal böse im Sinne Kants und gleichermaßen die in solch einem Staat den speziellen Gesetzen gegenüber "pflichtgemäß" handelnden Staatsbürger, die nicht aus "Pflicht" gegenüber dem vorrangigen Gesetz der Menschlichkeit den Vorhaben der Initiatoren ein klares "Nein" entgegensetzen? Oder läßt das "pflichtgemäße" Verhalten aufgrund gesetzlich verankerter Unmenschlichkeit konsequenterweise ebensowenig Rückschlüsse auf die Gesinnung zu wie das "pflichtgemäße" Handeln in Ansehung des allgemeinen Gesetzes? Traf eine moralisch radikal böse Gesinnung einer Handvoll Menschen nicht möglicherweise auf eine ebensolche Gesinnung bei vielen? Ist das Vorurteil von der eigenen Überlegenheit vereint mit dem christlich-antisemitischen Vorurteil vom jüdischen Verräter und den absurden Theorien von der jüdischen Weltverschwörung nicht bewußt geschürt und bewußt aufgegriffen worden? Liegt nicht derselbe Maßstab des vorsätzlichen rassistischen VorVerurteilens auch dem Genozid an den Sinti und Roma zugrunde wie auch der Eliminierung "unwerten" Lebens ? Und ist nicht das "Nein" der wenigen Befehlsverweigerer und Widerständler bei Gefährdung des eigenen Lebens letztlich Beweis dafür, daß es eine Alternative gab und daß man wissen konnte, wenn man wollte? Willensschwäche ist bei Kant die erste Stufe einer verdorbenen Gesinnung, zwar unvorsätzlich, aber dennoch schuldhaft. Denn auf welcher anderen rechtlichen Grundlage, wenn nicht der der grundsätzlichen Selbstverantwortlichkeit des Menschen für sein Handeln, könnte eine Anklage fußen? Canetti schreibt in seinem Essay "Macht und Überleben" (1972), "das Glücksgefühl konkreten Überlebens ist eine intensive Lust" (zit.n. Dietzsch 1996, S. 191). Dieses Gefühl verlangt nach Wiederholung, "und die Betroffenen werden auch ganz schnell unersättlich, ist doch diese Leidenschaft die der Macht" (Dietzsch ebd.). Dieser grundlegende anthropologische Dualismus von Sein und Nicht-sein gipfelt in der griffigen, politikleitenden Formel des "WerWen" (ebd.). Canetti sieht mit Büchner den "gräßlichen Fatalismus der Geschichte" (Büchner zit.n. Dietzsch ebd.) sich ständig wiederholen: "Quälen und töten, töten und quälen, und ich lese es auf tausend Arten immer wieder, immer dasselbe" (Canetti zit.n. Dietzsch ebd.). Das von Canetti beschriebene "Friedhofsgefühl" (1960, S. 316) ist das der Überlegenheit des Siegers über die Toten: "Sie können nicht voneinander fort, sie bleiben wie auf einem Haufen. Er allein kommt und geht, wie es ihm beliebt. Er allein unter den Liegenden steht aufrecht" (ebd. S. 317/318). Da der Sieger der Überlebende und die eigentliche Passion der Macht die Verfügung des Todes über andere ist, "ergibt sich für Canetti als moralisch einzig mögliche Position für den Menschen, daß er natürlich dieses oder jenes sein darf, 'aber das Einzige, was man nie sein darf, ist ein Sieger' " (Dietzsch 1996, S. 191/192). Dieser kategorische Imperativ Canettis "Weiter leben und doch nicht Sieger sein" (zit.n. Dietzsch 1996, S. 192) ist paradox und mit den Worten Canettis "die moralische Quadratur des Zirkels" (zit.ebd.). Macht manifestiert sich im Befehl, dessen Wesen die inzwischen zwar domestizierte, aber latent immer noch vorhandene Todesdrohung ist. "Im Befehl zelebriert der Machthaber seinen Wahn der Macht" (Dietzsch 1996, S. 196); Macht hat den Sinn, das Überleben zu sichern, und der Befehl erzeugt aus den vielen einzelnen eine Masse und verwandelt sie so in Macht. "In der Masse wird der Tod des Einzelnen marginal, denn er betrifft immer nur den Anderen, die Masse überlebt - 'der Augenblik des Überlebens ist der Augenblick der Macht' " (ebd.). Aus dieser Konstellation ergibt sich für Canetti die Forderung nach Beendigung des Befehlsnotstandes durch Immunisierung des einzelnen Menschen gegen ein Aufgehen im massenhaften Dasein, durch Förderung seiner Individualisierung und Mobilisierung seiner Vernunft. Canettis Vorbild für einen "herrschafts- und machtfreien, aber nicht form- oder zuchtlosen Umgang des Menschen mit dem Menschen" (ebd. S. 198) ist Konfuzius, ein Meister des Nein-Sagens und Vertreter der bewußten Erfolglosigkeit. Die Demokratie Deutschlands ist nicht das Ergebnis erzieherischer Bemühungen oder innenpolitisch-sozialer Entwicklungen; vielmehr wurde sie von den Siegermächten zwangsweise verordnet, und dies ist, abgesehen von allen Diskussionen über Recht und Unrecht des sonstigen Vorgehens der Alliierten, ein Akt der Humanität, denn es gab auch andere Pläne in Bezug auf Deutschlands Zukunft. "Demokratie beruht auf der Willensbildung eines jeden Einzelnen, wie sie sich in der Institution der repräsentativen Wahl zusammenfaßt. Soll dabei nicht Unvernunft resultieren, so sind die Fähigkeit und der Mut jedes Einzelnen, sich seines Verstandes zu bedienen, vorausgesetzt" (Adorno 1971, S. 133). Diese Worte Adornos, 1969 in einem Gespräch mit Helmut Becker geäußert, machen deutlich, worauf es in einer Erziehung nach Ausschwitz ankommt, nämlich Erziehung zur Mündigkeit, und sie wurden zur Formel der emanzipatorischen Pädagogik. Aber diese Forderung ist nicht neu; sie war schon das Ziel von Humboldts öffentlich-institutioneller Bildung, die Republik und der mündige Bürger waren seine politischen Utopien. "Pädagogisierung ist eine Reaktionsform geworden, die immer dann abgerufen wird, wenn ungelöste Probleme in zeitlicher Streckung bearbeitet werden sollen" (Oelkers 1990, S. 6). Nun ist es aber fraglich, ob die Schule die in sie gesetzten Hoffnungen wirklich erfüllen kann; die nicht abreißende Kritik an der staatlichen Institution Schule läßt da Zweifel aufkommen. "Die Zuschreibungen passen nicht auf die differente Wirklichkeit, doch das stört die pädagogische Erwartung offenbar nicht. Sie scheint beliebig steigerbar und das ist das Problem der Erziehungstheorie, nicht etwa nur der Erwartungen, die dadurch ihre Sanktionierung erfahren" (Oelkers 1990, S. 6). Ist die Schule nicht möglicherweise selbst ein Übel, "das man nur nicht abschaffen kann?" (ebd.). Die liberalisierte öffentliche Schule ist eine Chance und ein Risiko zugleich, denn Erfolg bedingt Mißerfolg, und beide sind nicht kalkulierbar. "In gewisser Weise steht das Abiturrisiko neben dem Drogenrisiko, dem Erziehungsrisiko überhaupt, vor dem die gute Absicht nicht schützt" (ebd. S. 6/7). Erziehung ist kein gerader, absehbarer Weg zu einem erkennbaren Ziel, sie ist nur ein Faktor unter vielen anderen. Wenn sich nun die Erziehungsutopie als ein wirklichkeitsferner, schöner Traum herausgestellt hat und Pädagogik wie Erziehungswissenschaft aufgrund der "Nichterfüllbarkeit ihrer Aspirationen" (Oelkers 1990, S. 11) in eine kritische Lage geraten sind, woran kann sich die Erziehungstheorie dann orientieren, will sie "nicht einfach zur bloßen Beschreibung von Wirklichkeit degenerieren" (ebd.)? Und wenn es tatsächlich so ist, daß Pädagogen die Welt nicht verändern können, wie vollzieht sich dann gesellschaftlicher Wandel? Denn daß Veränderungen ständig stattfinden, läßt sich mit Blick auf die Geschichte nicht bestreiten. Tajfel versteht unter sozialem Wandel den "Wandel in der Natur der Beziehungen zwischen großen sozialen Gruppen [...], wie z.B. zwischen sozioökonomischen, nationalen, religiösen oder ethnischen Kategorien" (Tajfel 1982, S. 89). Gemeint ist die "Anstrengung einer großen Zahl von Personen [...], die sich selbst als Gruppe definieren und von anderen auch so definiert werden, kollektiv ein Problem zu lösen, das ihnen ihrer Ansicht nach gemeinsam ist und das aus ihren Beziehungen zu anderen Gruppen resultiert" (ebd.). Sozialer Wandel kann als Folge von interpersonalem Verhalten eintreten, wenn soziale Mobilität des einzelnen möglich ist aufgrund der tatsächlich bestehenden und wahrgenommenen Durchlässigkeit der sozialen Schichtung und der Gruppengrenzen. Ausschlaggebend sind Legitimität und Stabilität einer sozialen Situation. Eine Kombination aus mangelnder Legitimität und wahrgenommener Instabilität führt zur Entwicklung sozialer Bewegungen, die wiederum sozialen Wandel herbeiführen oder verhindern wollen (vgl. ebd. S. 90f). Das hierbei erfolgreich eingesetzte Mittel ist soziale Kreativität, d.h. die Entwicklung neuer Ideologien und Einstellungen, die Schaffung oder Intensivierung einer sozialpsychologischen Gruppenmitgliedschaft und eine Bewegung weg von sozialer Mobilität des einzelnen hin zu sozialem Wandel durch Gruppenkonflikte (vgl. Tajfel 1982, S. 95f). Auch Moscovici konstatierte sozialen Wandel als Folge von Konflikten, die besonders von Minderheiten und aktiven Individuen ausgelöst werden. In der Wechselwirkung zwischen Subjekten und Umwelt funktioniert Einfluß dahingehend, daß die von einer abweichenden Minderheit geschaffenen "Fehler" nicht eliminiert, sondern in das soziale System aufgenommen werden und dort zu sozialem Wachsum durch vermehrte Differenzierung und Komplexität führen. "Die aktiven Individuen oder Gruppen sind es, die überreich an Ideen und Initiativen, neue Trends äußern oder schaffen" (Moscovici 1979, S. 258), während die Mehrheit sich eher schweigend verhält. Der Prozeß der Veränderung durch sozialen Einfluß mittels Schaffung, Verminderung und Vermeidung von Konflikten durchläuft jeweils drei aufeinanderfolgende, fortlaufende Stadien: Innovation > Konformität > Normalisierung (vgl. ebd. S. 195-230). So kann man also resümierend sagen, daß Pädagogen die Welt durch die positive "Macht" der Erziehung zwar nicht verändern können, denn eine repressionsfreie, auf Mündigkeit und Sittlichkeit zielende Erziehung einerseits und Erziehungsmacht andererseits schließen sich gegenseitig aus, daß aber Pädagogen dennoch zu Veränderungsprozessen beitragen, deren Wirkungen allerdings nicht unmittelbar eintreten und die, von einem späteren Zeitpunkt aus rückblickend betrachtet, auch nicht mehr eindeutig als pädagogisch initiiert auszumachen sind. Pädagogische Utopien resultieren aus Wunschwelten und Träumen, und sie haben ihre Berechtigung als Leitbild- und Orientierungsfunktion für Erziehungs- und Bildungsprozesse. Problematisch für die Erziehungswissenschaft und die Pädagogik hingegen ist der im öffentlichen Bewußtsein vorhandene und durch die Medien verstärkte Glaube an die Heilungskräfte "richtiger" pädagogischer Methoden. Angesichts dieser fast mythischen Erwartungshaltung muß die Pädagogik zwangsläufig als "Versager" dastehen. Sie vermag im Vergleich zum Anspruch nur wenig auszurichten und kann doch für vieles verantwortlich gemacht werden; so eignet sie sich gut als gesamtgesellschaftlicher Sündenbock, während gleichzeitig alle am Erziehungs- und Sozialisationsprozeß Beteiligten "Schuld" von sich weisen können, ohne den eigenen Anteil daran realistisch wahrnehmen zu müssen. Oelkers (1990, S. 11f) und März (1993, S. 328f) empfehlen der Pädagogik, sich mit Selbstbescheidung und Selbstkritik zunächst einmal den negativen empirischen Fakten des Seins zuzuwenden und das Sollen auf ein realistisches Maß zu reduzieren. März beschreibt mit einem Zitat Herbarts das seiner Ansicht nach angemessene pädagogische Verhalten: "Man erhalte dem Zöglinge die Kräfte, die er hat. Einen Menschen schaffen oder umschaffen kann der Erzieher nicht; aber manche Gefahren abwenden und sich eigner Mißhandlung enthalten, das kann er, und das ist von ihm zu verlangen" (ebd. S. 329). Aber mit der Wahrnehmung der negativen Tatsachen der Wirklichkeit beginnt für Oelkers das pädagogische Dilemma, denn gerade die Empirie ist "der Stein des Anstoßes für jede Utopie" (ebd. S. 12). Die Aufgabe der Pädagogik liegt für Oelkers nun darin, einen Weg zu finden zwischen opportunistisch genutzter Empirie und blinder Utopie. Die Utopie "muß zeigen können, wie trotz dieser Wirklichkeiten erzogen werden soll. Die Utopie muß Mutmachen, und das ist angesichts negativer Realitäten und des Zerfalls der Glaubwürdigkeit von Fortschrittsbehauptungen die vermutlich schwerste aller pädagogischen Aufgaben. Die Theorie muß mitten im Zerfall Optimismus sichern können, eine absurde und doch notwendige Aufgabe. Sie kann sich nicht länger auf großflächige Projektionen des Besseren verlassen und muß zugleich Hoffnung stabilisieren. Sie kann nicht wirklich für die Zukunft orientieren und muß doch behaupten, dies zu können. Sisyphos ist offenbar der Schutzpatron der Pädagogen" (ebd. S. 12). Möglicherweise kommt die Lösung dieses Problems ebenfalls der Quadratur des Kreises gleich, denn auch die Pädagogik darf und kann kein Sieger sein und will doch weiterleben. Wie kann man mit Paradoxien umgehen? Was Dietzsch der Philosophie rät, könnte auch für die Pädagogik ein Weg sein: Man kann lachen, denn "im Lachen schafft sich der Lachende die Möglichkeit der Distanz zu einer Situation, in der sein Verstand zunächst keine Antwort findet" (Dietzsch 1996, S. 200). Lachen ist das empirische Analogon der Vernunft; beide sind "Mittel gegen Borniertheit und auch gegen Selbstbornierung. [...] In unserer entzweiten und entzauberten Welt ist damit dem Lachen eine Bedeutung zugefallen, durch die es nahezu zu der philosophischen Kardinaltugend reüssiert, nämlich durch die Einsicht, 'daß in der Tat die Komödie über der Tragödie steht, der Humor der Vernunft über ihrem Pathos' (K. Marx)" (ebd.). Literaturverzeichnis ADORNO, Theodor W. (1971): Erziehung zur Mündigkeit. Vorträge und Gespräche mit Hellmut Becker 1959 - 1969. Suhrkamp, Frankfurt/M. AEBLI, Hans (1983): Zur Einführung. In: PIAGET, J.: Das moralische Urteil beim Kinde. Klett-Cotta, Stuttgart. ARASSE, Daniel (1988): Die Guillotine. Die Macht der Maschine und das Schauspiel der Gerechtigkeit. Rowohlt Taschenbuch Verlag Gmbh, Reinbek. ARENDT, Hannah (1996): Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen. Piper, München. ARENDT, Hannah (1994): Über die Revolution. 4. Aufl. Piper & Co, München. ARISTOTELES (1995): Die Nikomachische Ethik. Deutscher Taschenbuch Verlag, München. BEINER, Ronald (1985) (Hg.): Hannah Arendt über das Urteilen. Essay. In: ARENDT, H.: Das Urteilen. Texte zu Kants Politischer Philosophie. Piper, München. BENNER, Dietrich (1990): Wilhelm von Humboldts Bildungstheorie. Eine problemgeschichtliche Studie zum Begründungszusammenhang neuzeitlicher Bildungsreform. Juventa, Weinheim. BOLLE, Rainer (1995): Jean-Jacques Rousseau. Das Prinzip der Vervollkommnung des Menschen durch Erziehung und die Frage nach dem Zusammenhang von Freiheit, Glück und Identität. Waxmann, Münster. CANETTI, Elias (1960): Masse und Macht. Claassen Verlag, Hamburg. COMENIUS, Johann Amos (1991): Pampaedia. Allerziehung. In dt. Übers. hrsg. von Klaus Schaller. Academia Verlag, Sankt Augustin. DIETZSCH, Steffen (1996): Fort Denken mit Kant. Philosophische Versuche von diesseits und jenseits der Fakultät. Verlag Die Blaue Eule, Essen. FERTIG, Ludwig (1977): Campes politische Erziehung. Eine Einführung in die Pädagogik der Aufklärung. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. FINK, Eugen (1970): Metaphysik der Erziehung im Weltverständnis von Plato und Aristoteles. Klostermann, Frankfurt/Main. FLITHNER, Andreas (1960): Johann Amos Comenius. Grosse Didaktik. 2. Aufl. Küpper, Düsseldorf. FRENZEL, Ivo (1974): Das Dilemma einer Idee. In: SCHULTZ, Uwe (Hg.): Toleranz. Die Krise der demokratischen Tugend u. sechzehn Vorschläge zu ihrer Überwindung. Rowohlt Verlag Gmbh, Reinbek. GARZ, Detlef (1989): Sozialpsychologische Entwicklungstheorien. Von Mead, Piaget und Kohlberg bis zur Gegenwart. Westdt. Verlag GmbH, Opladen. GIGON, Olof (1995): Einführung. In: ARISTOTELES: Die Nikomachische Ethik. 2. Aufl. Deutscher Taschenbuch Verlag, München HAGER, Fritz-Peter (1981): Plato Paedagogus. Aufsätze zur Geschichte u. Aktualität d. päd. Platonismus. Haupt, Bern. HERRMANN, Ulrich (1979): Die Pädagogik der Philanthropen. In: SCHEUERL, H. (Hg.): Klassiker der Pädagogik. Beck, München. HILDEBRANDT, Kurt (1973): Einleitung. Zu: PLATON: Der Staat. Kröner Verlag, Stuttgart. JEGELKA, Norbert (1992): Paul Natorp. Philosophie, Pädagogik, Politik. Königshausen & Neumann GmbH, Würzburg. KERSTING, W. (1995a): Sittlichkeit; Sittenlehre. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 9. KERSTING, W. (1995b): Sitte. In: Historisches Wörterbuch d. Philosophie. Bd. 9 KOHLBERG, Lawrence (1996): Die Psychologie der Moralentwicklung. 1. Aufl. Suhrkamp, Frankfurt/M. MÄRZ, Fritz (1982): Pädagogenprofile. Miniaturen großer Erzieher und bedeutender pädagogischer Denker. Auer, Donauwörth. MÄRZ, Fritz (1993): Macht oder Ohnmacht des Erziehers? Von pädagogischen Optimisten, Pessimisten, Realisten. Klinkhardt, Bad Heilbrunn. MENZE, Clemens (1965): Wilhelm von Humboldts Lehre und Bild vom Menschen. Henn-Verlag, Ratingen. MEYER, Adolf (1979): Wilhelm von Humboldt. In: SCHEUERL, H. (Hg.).: Klassiker der Pädagogik. Beck, München. MOSCOVICI, Serge (1979): Sozialer Wandel durch Minoritäten. Urban & Schwarzenberg, München. NIEMEYER, Christian (1989): Zur Systematik und Aktualität der Sozialpädagogik Natorps vor dem Hintergrund ihrer ideengeschichtlichen Einlagerung. In: OELKERS u.a. (Hg.): Neukantianismus. Kulturtheorie, Pädagogik u. Philosophie. Dt. Studien Verlag, Weinheim. NIETHAMMER; Arnolf (1980): KantsVorlesung über Pädagogik. Freiheit und Notwendigkeit in Erziehung und Entwicklung. Lang, Frankfurt/Main. OELKERS, Jürgen (1990): Utopie und Wirklichkeit. Ein Essay über Pädagogik und Erziehungswissenschaft. In: Zeitschrift für Pädagogik, 36. Jg. Nr. 1. OETINGER, Friedrich (1955): Partnerschaft. Die Aufgabe der politischen Erziehung. 3. Auflage. Stuttgart. PETZOLD, Klaus (1969): Die Grundlagen der Erziehungslehre im Spätmittelalter und bei Luther. Quelle & Meyer, Heidelberg. PLATON (1973): Der Staat. Kröner Verlag, Stuttgart. REINER, Hans (1974): Die Grundlagen der Sittlichkeit. 2. erw. Aufl., Hain, Meisenheim am Glan RÜSEN, Jörn (1966): Die Pansophie des Johann Amos Comenius. ORA-Verlag, München. SCHALLER, Klaus (1967): Die Pädagogik des Johann Amos Comenius und die Anfänge des pädagogischen Realismus im 17. Jahrhunderts. 2. Aufl. Quelle & Meyer, Heidelberg. SCHEUERL, Hans (1979): Johann Amos Comenius. In: SCHEUERL, H. (Hg.): Klassiker der Pädagogik. Beck, München SCHEUERL, Hans (1992) (Hg.): Die Pädagogik der Moderne. Von Comenius und Rousseau bis in die Gegenwart. Ein Lesebuch. Piper, München. SCHULTE, Christoph (1988): radikal böse. Die Karriere des Bösen von Kant bis Nietzsche. Fink Verlag, München. SPAEMANN, Robert (1990): Einleitung. Zu: THOMAS von Aquin: Über die Sittlichkeit der Handlung. VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim. STRUCK, Peter (1995): Zuschlagen, Zerstören, Selbstzerstören. Wege aus der Spirale der Gewalt. Wissenschaftl. Buchgesellschaft, Darmstadt. TAJFEL, Henry (1982): Gruppenkonflikt und Vorurteil. Entstehung und Funktion sozialer Stereotypen. Bern. THOMAS von Aquin (1990): Über die Sittlichkeit der Handlung: Sum. Theol. I - II q. 18 - 21. VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim. WILHELM, Theodor (1979): Sittliche Erziehung durch politische Bildung. Über die Lernbarkeit von Moral. Edition Interfrom, Zürich.