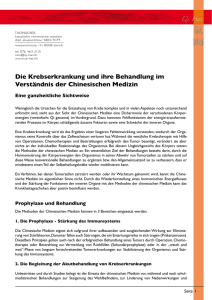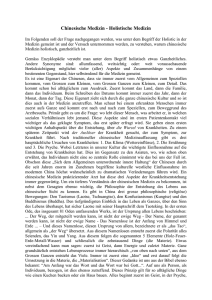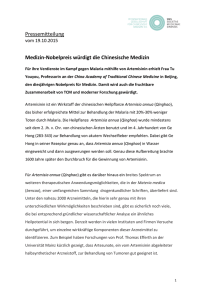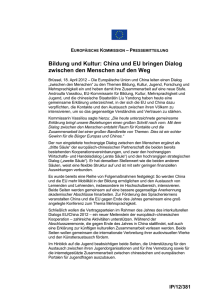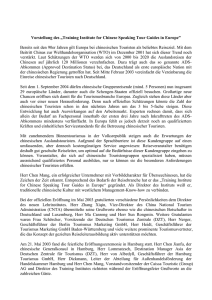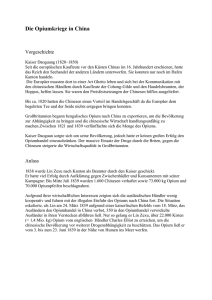Europa
Werbung

Europa Euregio: Länderübergreifende Regionen in Europa, meistens mit wirtschaftlichem Schwerpunkt fördern grenzüberschreitende Zusammenarbeit aber auch in gesellschaftlicher und kultureller Hinsicht auch nicht EU-Mitglieder (Trirhena: D,F,CH) sind mit eingebunden über regionale Behörden und auf Länderebene erfolgt Abstimmung der regionalen Entwicklungspläne (zuerst kommunale Ebene Lösungen für gemeinsame Probleme gesucht) Interreg eine Gemeinschaftsinitiative des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Regionen der Europäischen Union. die Unterstützung betrifft alle Bereiche in Wirtschaft, Handel, Verkehr, Kommunikation, Bildung und Kultur Rhein Tulla: Rheinbegradigung zur Schiffbarmachung des Rheins und zur Grenzfestlegung 1) Korrektur des Oberrheins: Durchstechen der Mäander (Flussschlingen, die sich mit geringem Gefälle und gleichzeitigem Transport von Sand, Kies und Stein bilden, wobei das kurvenäußere Ufer schneller erodiert als das kurveninnere) Ziel: Verkürzung der Flussstrecke, Flussbettverengung, Tiefenerosion, Flussbettvertiefung, Senkung des Wasserspiegels, landwirtschaftliche Nutzung der Flussauen (tiefster Bereich eines Tales, der bei Hochwasser überflutet wird) 2) Anlegung von Dammanlagen zum Schutz gegen Überschwemmungen Folgen: höhere Fließgeschwindigkeit, Hochwasser in nördlichen Gebieten Vor Tulla: wiederkehrende Hochwasser führten zu ständigen Laufveränderungen des Flusses und zu Verschiebung der Grenzen, die oft in der Flussmitte festgelegt waren Rhein als Wirtschaftsfaktor: Nutzung der Wasserkraft Elektrizitätswerke zur Energiegewinnung Staustufen (aufstauen von Wasser, verhindern Absinken des Grundwasserspiegels) mit Kraftwerken zur Energiegewinnung Kanalschlingen zur Überschwemmung der Auenlandschaften Kanalisierung Dammbauten (Schutz vor Überflutung) Weinanbau Rheinbegradigung ermöglicht die Schiffahrt Deiche: künstlich aufgeschüttet, Hochwasserschutz Rhein guter Standortfaktor für Firmenansiedlungen, günstiger Transportweg China: Bevölkerung: bevölkerungsreichste Land der Erde (1,3 Milliarden Staatsbürgern) große Bevölkerungsdichte in der Küstenregion dünn besiedelte Gebiete (4%) Tibet und Innere Mongolei um Bevölkerungswachstum einzudämmen, gilt die Ein-Kind-Politik Überbevölkerung Haupthindernis für den wirtschaftlichen Fortschritt 1960: Verbannung der Bevölkerung aufs Land, die sich nicht an Politik hielten wirtschaftliche Bedeutung: Volksrepublik China wurde bis in die 1990er Jahre als Entwicklungsland eingestuft, entwickelt sich aber seit seiner teilweisen Öffnung nach der "Kulturrevolution" (Kampf gegen chinesische Kultur, Gebildeten und Gelehrten, sowie die kulturellen Güter und Lebensweisen des Landes) zunehmend zu einer Großmacht China ist ein autoritärer Staat unter der Führung der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh). Es gibt ein Einparteiensystem und das sozialistische Wirtschafts- und Staatssystem ist in der Verfassung verankert. Mischform aus Plan- und Marktwirtschaft Zunahme privatwirtschaftlicher Sektor Bodenschätze wie Kohle, Öl können sich selbst versorgen - Atomtestgelände, Atomkraftwerke chinesisches Eisenbahnnetz größte Exportnation der Welt Anstieg BIP ausländischen Unternehmen wurde erlaubt, in China zu investieren und der Außenhandel wurde liberalisiert. institutionelle Reformen an staatlichen Investitionen oder dem Steuersystem Wasserkraftwerksprojekte (Drei-Schluchten-Staudamm) Medizinische Versorgung Abfallbeseitigungsprogramm Schifffahrtswege Touristische Infrastruktur (im Südwesten wenig ausgebaut) Regionale, miteinander konkurrierende Fluggesellschaften Zunahme Sekundär- (Industrie, Verarbeitung) und Tertiärsektor (Dienstleistung, Händler), Abnahme Primärsektor (Landwirtschaft, Fisch, Bergbau) Wirtschaftlicher Vergleich mit Amerika und Europa: Import: erst Kanada, China und dann Europa, Export: Deutschland, Amerika, China Religion: atheistischer Staat Rückbesinnung auf die klassischen Tugenden Produktionsstruktur: Kohle, Öl, Petroleum, Erdgas, Kupfer, Blei, Zinn, Eisen, Magnesium Warum hat china eine 2 stellige wachstumsrate?? -ich denke mal wegen der zunehmenden industrialisierung (Straßennetzbau für Torismus, Bau von Atomkraftwerken und so), ausländischen unternehmen, die in China invetieren aber warum machen die das -weil china viele rohstoffe hat, Deutschland hat keine Rohstoffe Amerikaner bewundern Schönheit, aber wirklich fasziniert sind sie von Grösse. Man denke nur an den Grand Canyon, die kalifornischen Redwoods, den Grand Central Terminal, an Disney World, die Luxus-Geländewagen SUV, die amerikanischen Streitkräfte, General Electric, den Double Quarter Pounder (mit Käse) und die Venti Latte (Kaffee). Europäer bevorzugen Komplexität und Nuance, die Japaner verehren das Kleine, Minimalistische. Doch die Amerikaner lieben alles, was gross, vorzugsweise gigantisch gross ist. Deshalb regt China die Fantasie der Amerikaner besonders an. Neben diesem Land sehen die Vereinigten Staaten ziemlich klein aus – 1,3 Milliarden Menschen, das ist das Vierfache der USBevölkerung. Seit mehr als hundert Jahren sind es Träume von dieser Grösse, die kleine Gruppen amerikanischer Missionare und Ge-schäftsleute fasziniert haben – eine Milliarde Seelen, die es zu retten gilt, zwei Milliarden Achseln, die ein Deodorant brauchen –, doch daraus wurde nie etwas. China war immer sehr gross, aber auch sehr arm. Das ändert sich jetzt. Die einst so attraktiven Dimensionen bekommen etwas Bedrohliches. Und die Amerikaner fragen sich, ob die «chinesische Gefahr» alptraumhaft real ist. Heutzutage wartet jeder Unternehmer mit beeindruckenden Zahlen über das Land auf. China ist inzwischen der weltweit grösste Produzent von Kohle, Stahl und Zement, der zweitgrösste Energieverbraucher und der dritt- grösste Erdölimporteur, weshalb die Benzinpreise in schwindelerregende Höhen klettern. Die chinesischen Exporte in die USA sind in den letzten fünfzehn Jahren um 1600 Prozent gestiegen, die US-Exporte nach China um 415 Prozent. Werkstatt der Welt Das erstaunlichste Beispiel für dieses Wachstum ist zweifellos Schanghai. Vor fünfzehn Jahren war Pudong, im Osten der Stadt, brachliegendes Land. Heute ist es Schanghais Finanzviertel, achtmal so gross wie Canary Wharf, das neue Londoner Finanzzentrum, und nur wenig kleiner als ganz Chicago. Apropos Venti Latte – kürzlich erklärte Starbucks-Chef Howard Schultz, dass sein Unternehmen in drei Jahren wahrscheinlich mehr Cafés in China als in den USA haben werde. Auf dem Höhepunkt der industriellen Revolution galt England als «Werkstatt der Welt». Dieser Titel gebührt heute ganz gewiss China. Das Land produziert zwei Drittel aller weltweit hergestellten Fotokopierer, Mikrowellenherde, DVD-Spieler und Schuhe. (Und Spielzeug, würde mir mein Sohn zurufen. Von allem Spielzeug auf der Welt.) Um einen Eindruck zu bekommen, wie komplett China die Niedrigkostenproduktion beherrscht, reicht ein Blick auf Wal-Mart. Wal-Mart ist das grösste Unternehmen Amerikas – und der Welt. Es erwirtschaftet achtmal so viel Gewinn wie Microsoft und repräsentiert zwei Prozent des Bruttosozialprodukts der Vereinigten Staaten. Es beschäftigt 1,4 Millionen Mitarbeiter – mehr als General Motors, Ford, General Electric und IBM zusammen. Es ist legendär für seine effizienten (manche würden sagen: knallharten) Wege, den Kunden möglichst billige Preise zu bieten. Um das zu erreichen, setzt das Unternehmen auf Technologie und unternehmerische Innovation, vor allem aber auf China. Im letzten Jahr importierte Wal-Mart Waren im Wert von achtzehn Milliarden Dollar aus China. Von den 6000 Lieferanten des Unternehmens befinden sich 5000 (d.h. 80 Prozent) in einem einzigen Land, und zwar nicht in den Vereinigten Staaten. Doch die Zahl, die alle anderen schlägt, die am deutlichsten zeigt, vor welcher Herausforderung die Vereinigten Staaten stehen, liefert die Intel Fair. Intel ist Sponsor der International Science and Engineering Fair, des weltweit grössten «Jugend forscht»-Wettbewerbs, an dem Schüler aus aller Welt teilnehmen können. Das letzte Jahr war gut für die Amerikaner – es bewarben sich 65000 Jugendliche. In China waren es sechs Millionen. Gewiss, chinesische Wettbewerbe sind nicht so gut wie amerikanische, es gelten andere Standards, und man sollte Äpfel nicht mit Birnen vergleichen, aber trotzdem: sechs Millionen Birnen! Chinas Aufstieg ist keine Prophezeiung mehr, sondern eine Tatsache. China ist schon heute das Land mit der am schnellsten wachsenden Wirtschaft, und es verfügt über die zweitgrössten Devisenreserven, hauptsächlich Dollars. Es hat die grösste Armee der Welt (2,5 Millionen Mann) und den viertgrössten Militärhaushalt, der jährlich um mehr als zehn Prozent wächst. Ganz gleich, ob China die USA wirtschaftlich überholt (was ich für eine vage Möglichkeit halte) oder nicht, es ist die neue Macht auf der globalen Bühne. Von Chinas Wachstum profitiert die ganze Welt, besonders aber Amerika. Laut einer Studie von Morgan Stanley bedeuteten billige Importe aus China eine Ersparnis von mehr als sechshundert Milliarden Dollar für die amerikanischen Verbraucher in den letzten Jahren. Die Hersteller haben noch mehr gespart. Der Economist schrieb, es sei hauptsächlich dem starken chinesischen Wachstum zu verdanken, dass die Welt – nach der geplatzten New-Economy-Blase der Jahre 2000 und 2001 – einer Rezession entgangen sei. Und weil China (ne-ben anderen asiatischen Ländern) US-Staatsanleihen kauft, können die Amerikaner und ihre Regierung weiterhin auf Pump konsumieren, und die Weltwirtschaft wächst weiter. Risse im westlichen Bündnis In den vergangenen vierhundert Jahren haben zweimal globale Machtverschiebungen stattgefunden. Die erste war der Aufstieg Europas, das im 16. Jahrhundert der reichste, aktivste und ehrgeizigste Teil der Welt war. Die zweite war der Aufstieg der Vereinigten Staaten im späten 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Die USA wurden das mächtigste Land der Welt, die politische und wirtschaftliche Führungsmacht. Seit Jahrhunderten war die ganze Welt die Bühne, auf der die grossen Nationen des Westens agiert und ihre Interessen verfolgt haben. Chinas Aufstieg (und der Aufstieg Indiens und das ungebrochene Gewicht Japans) ist die dritte grosse Verschiebung im globalen Kräftespiel – der Aufstieg Asiens. Grosse Mächte werden nicht jeden Tag geboren. Die Liste der aktuellen – die USA, Grossbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland – ist seit zwei Jahrhunderten mehr oder weniger unverändert. Das Auftauchen einer neuen Macht führt gewöhnlich zu Spannungen, wenn nicht Chaos, da der Aufsteiger seinen Platz in der bestehenden Ordnung finden will oder, wenn ihm das nicht gelingt, sie über den Haufen wirft. Man denke nur an den Aufstieg Deutschlands und Japans im frühen 20. Jahrhundert oder an den Verfall des Osmanischen Reichs in der gleichen Zeit, der zum Entstehen des modernen Orients führte. Einen Konflikt zwischen zwei Grossmächten hat die Welt seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr erlebt. Wenn es dazu wieder käme, würden all die Probleme, die uns heute beschäftigen – der Terrorismus, Iran, Nordkorea –, vergleichsweise unspektakulär wirken. Ein solcher Konflikt würde Wettrüsten, Grenzstreitigkeiten und vielleicht noch mehr bedeuten. Aber auch ohne solche düsteren Szenarien – die internationale Politik wird durch China komplizierter. Nehmen wir nur das Verhältnis zwischen den USA und Europa. Der Irak war zeitweilig ein Problem. Aber unterschiedliche Ansichten zum Aufstieg Chinas könnten zu bleibenden Rissen im westlichen Bündnis führen. Besonders gross ist die Herausforderung China natürlich für die Vereinigten Staaten. Wenn (historisch gesehen) die führende Weltmacht von einer neuen Macht herausgefordert wird, haben die beiden eine schwierige Beziehung. Zwar geben sie es nicht öffentlich zu, aber China und die Vereinigten Staaten sind besorgt und richten sich auf Probleme ein. Das heisst nicht, dass es Konflikte oder gar Krieg geben wird, sondern nur, dass mit Spannungen zwischen beiden Ländern zu rechnen ist. Wie sie damit umgehen, wird ihr zukünftiges Verhältnis bestimmen – und den Frieden auf der Welt. Wenn heute über China gesprochen wird, kommt die Rede unweigerlich auf seine einzigartige Kultur. Der Kern des chinesischen Wesens sei der Konfuzianismus, und aus dieser Tradition – Disziplin, Lerneifer und Respekt vor den Alten – erkläre sich der ungewöhnliche Erfolg des modernen China. Doch den Konfuzianismus gibt es schon seit Jahrhunderten, in denen China arm und rückständig war und stagnierte. Der deutsche Soziologe Max Weber, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts untersuchte, warum sich China nicht für den Kapitalismus eigne, verwies auf die konfuzianische Kultur. (Kulturen sind komplex, und man kann in ihnen meist alles finden, was man finden will.) Chinas Wachstum begann in den frühen 1980ern, und zwar nicht aufgrund seiner Kultur, die sich kaum verändert hat, sondern aufgrund eines tiefgreifenden politischen Wandels. Wenn Historiker auf die vergangenen Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts zu-rückblicken, könnte sich das Jahr 1979 als Wendepunkt erweisen. In diesem Jahr fand der sowjetische Einmarsch in Afghanistan statt, mit dem die Supermacht ihr eigenes Grab schaufelte. In diesem Jahr wurde in China mit Wirtschaftsreformen begonnen, die im Dezember 1978 auf der dritten Plenartagung des XI. Zentralkomitees der KP Chinas verkündet worden waren. Der neue Parteichef, Deng Xiaoping, hielt eine Rede, die die wichtigste in der Geschichte des modernen Chinas sein sollte. Er forderte, die Modernisierung voranzutreiben und den Weg nicht von Ideologie, sondern von Fakten bestimmen zu lassen. «Es ist gleich, ob die Katze schwarz oder weiss ist», lautete ein beliebter Ausspruch Dengs, «Hauptsache, sie fängt Mäuse.» Seitdem hat China genau das getan, nämlich eine strikt pragmatische und nichtideologische Modernisierung verfolgt. Die Resultate sind erstaunlich. China weist seit über fünfundzwanzig Jahren ein jährliches Wachstum von etwa neun Prozent auf – das ist die historisch höchste Wachstumsrate für ein grosses Land. Im selben Zeitraum sind dreihundert Millionen Menschen von Armut befreit worden, das chinesische Durchschnittseinkommen hat sich vervierfacht – und all das bislang ohne katastrophale soziale Unruhen. Das ist eine historische Leistung, die man der chinesischen Führung zugute halten muss. Viele Leute kritisieren den wirtschaftlichen Weg Chinas. Sie sprechen von ge-schönten Zahlen, von allgegenwärtiger Korruption, von Banken, die sich am Rand des Abgrunds bewegen, davon, dass es zu regionalen Spannungen kommen werde, dass die Ungleichheit gefährlich zunehme und sich die Lage zuspitze. Seit zehn Jahren prophezeien sie: «So kann es nicht weitergehen, China kann dieses Tempo nicht beibehalten, es wird zu einem Crash kommen.» Bislang sind all diese Voraussagen nicht eingetroffen. China hat zwar viele Probleme, aber es hat auch etwas, wonach jedes Land der Dritten Welt strebt – ein gleichbleibend hohes Wachstum. Zentralistische Planung kann nicht funktionieren. Und sie funktioniert nicht einmal in der Volksrepublik China. Die Regierung gibt deshalb den Regionen viel Macht, erlässt marktfreundliche Bestimmungen, und sie holt ausländische Investoren ins Land. China hat seine Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation (WTO) zum Anlass genommen, um weitreichende Reformen in Wirtschaft und Ge-sellschaft durchzusetzen. Auch Indien lernt das Staunen Die Fähigkeit der chinesischen Regierung, die Entwicklung des Landes zu planen und zu lenken, verdient aber grosse Anerkennung. Man nehme nur den oft bemühten Vergleich mit Indien. Auf der individuellen Ebene sind viele indische Firmen sehr viel eindrucksvoller als ihr chinesisches Pendant. Es sind echte Privatunternehmen, die Kapital effizient einsetzen und mit den besten Unternehmen der Welt konkurrieren können. Chinesische Firmen sind oft teilweise in staatlichem Besitz, arbeiten mit staatlichem Kapital oder geniessen staatliche Begünstigungen. Sie erhalten Zugang zu ausländischem Kapital, das sie ineffizient verwenden. Und viele verkaufen ihre Produkte nur auf dem heimischen Markt und könnten auf globalem Niveau nicht mithalten. Aber makroökonomisch gesehen, drängt die chinesische Regierung die Entwicklung viel nachhaltiger und wirksamer voran als die indische Regierung. Indische Politiker weisen gern darauf hin, dass ihre chinesischen Kollegen sich nicht um die Wähler kümmern müssen. «Wir müssen vieles tun, was langfristig wenig Sinn macht», meinte ein hoher indischer Beamter. «Aber Politiker sind kurzfristig auf Wählerstimmen angewiesen. China kann in langfristigen Perspektiven denken.» Natürlich gibt es viele nichtdemokratische Regierungen mit einer katastrophalen Wirtschaftspolitik – man denke nur an die Philippinen unter Marcos und Zaire unter Mobutu. Aber das macht die Leistung der chinesischen Regierung nur umso bemerkenswerter. «Ich habe mit Regierungen auf der ganzen Welt zu tun», sagt ein renommierter Investmentbanker, «aber am eindrucksvollsten sind wahrscheinlich die Chinesen.» Viele seiner Kollegen in der amerikanischen Business-Welt dürften seine Einschätzung teilen. Aber wie erklären sich dann die aussen- und innenpolitischen Entscheidungen, die diese Regierung in der letzten Zeit getroffen hat? Anti-Peking-Stimmung der Nachbarn Im April kam es, offenbar mit Unterstützung der Regierung, zu lautstarken Protesten gegen japanische Schulbücher, zu Massendemonstrationen, bei denen die japanische Botschaft mit Steinen angegriffen und zum Boykott japanischer Waren aufgerufen wurde. Im März wurde das «Anti-Sezessionsgesetz» verkündet, das Taiwan militärische Aktionen an-drohte, falls es in irgendeiner Weise den Zorn Chinas erregte. Das führte unter anderem dazu, dass die Europäische Union ihr Vorhaben, das Waffenembargo gegen China im Juni aufzuheben, erst einmal aufschob. Ebenfalls im März forderte China die australische Regierung auf, das Bündnis mit den USA zu überdenken, was in Australien für Unmut sorgte. Als Peking im Juli 2003 versuchte, für Hongkong ein «Anti-Subversions-Gesetz» zu erlassen, führte das zu den grössten Demonstrationen in der Geschichte der Stadt und zu einer starken Anti-Peking-Stimmung in dem traditionell apolitischen Territorium. All diese Aktionen führen dazu, dass Chinas mächtigste Nachbarn – Japan, Australien, Indien – innehalten. Sie bestärken all jene in Amerika, die China als Bedrohung und nicht als Chance sehen. Ist das eine kluge Politik? Im ersten Jahrzehnt nach Beginn der Wirtschaftsreformen, in den 1980er Jahren, hatte China keine Aussenpolitik, beziehungsweise sie stand unter dem Diktat einer Wachstumsstrategie. China unterstützte insgeheim die US-Politik, weil gute Beziehungen zu Amerika als das Fundament der eigenen Entwicklung angesehen wurden. Dieser nichtkonfrontative Ansatz ist noch heute zu beobachten. Mit Ausnahme von allem, was Taiwan betrifft, sind die wichtigsten aussenpolitischen Entscheidungen weitgehend Ergebnisse ökonomischer Erwägungen. Aktuell bedeutet das die unermüdliche Suche nach zuverlässigen Lieferanten von Erdöl und anderen Waren. Doch es ändert sich einiges. In seiner Studie «The Beijing Consensus», die sich auf zahlreiche Interviews mit namhaften chinesischen Politikern und Wissenschaftlern stützt, liefert Joshua Cooper Ramo ein faszinierendes Porträt der neuen chinesischen Aussenpolitik. «Statt eine Macht nach dem Modell der USA aufzubauen, die bis an die Zähne bewaffnet ist und anderen Meinungen mit Intoleranz begegnet», schreibt Ramo, «orientiert sich die neue chinesische Macht am Beispiel ihres eigenen Mo-dells, an der Stärke ihrer Wirtschaftsordnung und der strikten Verteidigung ihrer nationalen Souveränität.» China verfolgt eine ganz andere Entwicklungsstrategie als Japan. Statt ausschliesslich auf exportorientiertes Wachstum zu setzen und den Zugang zum Binnenmarkt geschlossen zu halten, hat China ausländische Investoren und Unternehmen ins Land geholt – mit dem Er-gebnis, dass ein grosser Teil der Welt inzwischen vom chinesischen Markt abhängig ist. Von den Vereinigten Staaten bis nach Deutschland und Japan gehören Exporte nach China zu den wesentlichen Wachstumsfaktoren. Für Entwicklungsländer ist China ein unersetzlicher Handelspartner. Im November letzten Jahres unternahmen George W. Bush und der chinesische Staatspräsident Hu Jintao Reisen in asiatische Länder. Ich hielt mich kurze Zeit später in der Region auf und stellte beeindruckt fest, dass fast jeder meiner Gesprächspartner den Auftritt Hus ge-lungener fand als denjenigen von Präsident Bush. Der malaysische Journalist Karim Raslan sagte: «Bush hat immer nur über den Terrorismus geredet. Er sieht uns Asiaten durch dieses eine Prisma. Natürlich bereitet uns der Terrorismus ebenfalls Sorgen, aber offen gestanden, unser Leben erschöpft sich nicht darin. Wir haben noch viele andere Probleme. Wir bringen unsere Wirtschaft wieder in Schwung, wir fragen, wie wir uns zum Aufstieg Chinas verhalten sollen, wir versuchen, Probleme der medizinischen Versorgung, soziale und Umweltprobleme zu lösen. Hu hat darüber gesprochen. Er hat über unsere Agenda gesprochen, nicht nur über seine.» Von Indonesien bis Brasilien gewinnt China neue Freunde. Manche Amerikaner, vor allem Neokonservative und Pentagon-Mitarbeiter, weisen alarmiert auf die chinesische Gefahr hin, meist aus militärischer Perspektive und meist sehr übertrieben. Die Fakten geben ihnen einfach nicht Recht. Gewiss, China baut seine Streitkräfte mit einem Budget aus, das um mindestens zehn Prozent jährlich wächst. Aber das ist noch immer nur ein Bruchteil dessen, was die Vereinigten Staaten ausgeben – höchstens zehn Prozent des Pentagon-Haushalts. Die chinesische Herausforderung oder Bedrohung wird sich nicht in der bekannten Art einer zweiten Sowjetunion zeigen, die mit den USA militärisch Schritt halten will. China, schreibt Ramo, wird eher eine «asymmetrische Supermacht» sein. Es wird seine Ziele durch wirtschaftliche Macht und geschickte Politik erreichen. China hat kein Interesse daran, Taiwan zu besetzen. Vermutlich wird es eher die taiwanesischen Unabhängigkeitsbestrebungen schwächen, den Gegner in kleinen Schritten zu zermürben suchen. «China setzt nicht auf Konflikt, sondern auf Konfliktvermeidung», schreibt Ramo. «Wahrer Erfolg in strategischen Fragen heisst, sich in Situationen so geschickt zu verhalten, dass nur ein für China günstiges Ergebnis herauskommt. Schon der alte chinesische Philosoph und Militärstratege Sun Tsu hat ja die Lehre vertreten: ‹Über Sieg oder Niederlage in einer Schlacht wird entschieden, noch bevor es zum Kampf kommt.›» So ist es zumindest geplant. Das Problem ist nur, dass China, obwohl in langfristigen Strategien denkend, oftmals kurzfristige Aktionen unternimmt, die aggressiv und feindselig erscheinen. Das könnte damit zu tun haben, dass die pragmatischen Entscheidungsprozesse, die die Wirtschaftspolitik leiten, nicht so leicht auf das Gebiet der Aussenpolitik zu übertragen sind, wo Ehre, Geschichte, Stolz und Zorn eine wichtige Rolle spielen. Etwa gegenüber Taiwan: In der letzten Woche unterstrich Peking seine langfristige Absicht, die Beziehungen zur grössten taiwanesischen Oppositionspartei zu «normalisieren» und ihr in versöhnlichem Ton zu begegnen. Doch im April hatte Peking das Anti-Sezessionsgesetz verabschiedet, das die meisten Taiwanesen aufbrachte und Amerikaner und Europäer alarmierte. Oder die Beziehungen zu Japan. Die aggressive Haltung Pekings dürfte wenig sinnvoll sein. Damit sorgt man nur für Feindseligkeit bei einem Nachbarn, der wirtschaftlich noch immer viermal stärker ist. Klüger wäre es, Japan mit wirtschaftlichen Kontakten und Kooperation entgegenzukommen und ganz allmählich eine Überlegenheit zu erreichen. Eine versöhnliche Haltung wäre ja auch nicht unbegründet. Die Japaner haben sich nicht mustergültig verhalten, aber sie haben sich wiederholt für ihr Verhalten während des Kriegs entschuldigt. Sie haben China mehr als 34 Milliarden Dollar an Entwicklungshilfe überwiesen, praktisch Reparationszahlungen geleistet, was von den Chinesen nie erwähnt wird. Und auch in der jüngsten Krise haben sich die Japaner als Erste bewegt. Nationalisten hinter der Yuppie-Fassade Doch den Chinesen kommen anscheinend ihre Emotionen in die Quere. Nachdem die KP den Kommunismus aufgegeben hat, benutzt sie den Nationalismus als Kitt, um China zusammenzuhalten. Und der moderne chinesische Nationalismus definiert sich weitgehend durch seinen Japan-Hass. Für die Chinesen ist Mao, trotz seiner unheilvollen Politik, immer noch ein Held, weil er das Land einte und gegen die Japaner kämpfte. Je stärker die chinesische Wirtschaft wird, desto stärker wird der chinesische Nationalismus. Man kratze an der Oberfläche eines Schanghaier Yuppies, und zum Vorschein kommt ein Nationalist, der aggressiv von Taiwan, Japan und Amerika spricht. Die chinesische Regierung glaubt, die Emotionen der Bevölkerung im Griff zu haben, aber das könnte ein Trugschluss sein. Schliesslich hat sie als undemokratisches Regime keine grossen Erfahrungen darin. Sie verhält sich un-sicher bei öffentlichen Unmutsäusserungen, weiss nicht recht, ob sie sie unterstützen oder niederschlagen soll, weil sie nicht einschätzen kann, wie es ausgeht. So weiss Peking nicht, wie es sich gegenüber der Patriotischen Allianz verhalten soll, einer hypernationalistischen Organisation, die die grössten Demonstrationen im Land seit sechs Jahren veranstaltet. Experten sagen, die chinesische KP diskutiere ernsthaft über politische Reformen und studiere die Entwicklung mächtiger Staatsparteien in anderen Ländern, von Schweden bis Singapur, um zu erkennen, wie man die Macht auch in einer offeneren Gesellschaft bewahren kann. «Die klügsten Köpfe in der Regierung beschäftigen sich mit diesen Fragen», erklärte mir ein gutinformierter Beobachter in Peking. Zur Politik gehört aber mehr. Wie die Pekinger Mandarine mit ihrer eigenen Bevölkerung umgehen, wird letzten Endes darüber entscheiden, wie sie dem Rest der Welt begegnen. Wie soll man sich gegenüber China verhalten? Am besten hört man auf das, was der französische Staatspräsident sagt, und tut das Gegenteil. Jacques Chirac, der erschöpfte alte Dinosaurier, der die moderne Welt offenbar immer weniger versteht, kritisierte unlängst Chinas «brutale und unakzeptable Invasion» in Europa. Das bezog sich darauf, dass seit der Abschaffung von Importbeschränkungen chinesische Textilien den europäischen (und amerikanischen) Markt überschwemmen. Leider ist nicht auszuschliessen, dass Europäer und Amerikaner der Empfehlung Chiracs folgen und diese Quoten in irgendeiner Form wieder einführen. (Das Problem Textilexporte dämpft die beginnende Liebesaffäre zwischen Europa und China.) Der Impuls ist verständlich. Seit Jahresbeginn sind die chinesischen Textilexporte nach Europa in schwindelerregende Höhen gestiegen (bei Pullovern ein Plus von 534 Prozent), aber das ist in erster Linie nicht das Ergebnis unfairer Methoden, sondern eines freien Handels. Überhaupt sind die Zölle und Handelsschranken in der globalisierten Wirtschaft kein geeigneter Weg zu Wohlstand. Nicht nur China, auch Indien, Brasilien, Südafrika und Thailand drängen geschickt auf den Weltmarkt. Die Antwort westlicher Staaten kann nicht Abschottung sein. Schliesslich profitieren sie von der Ausweitung des globalen Handels. Die Exporte der EU nach China sind in den letzten 15 Jahren um 600 Prozent gestiegen. Allgemein kann man sagen, dass Länder, die sich in der Vergangenheit vom Rest der Welt abgeschottet haben (um ihre Wirtschaft oder ihre Kultur zu schützen), stagnierten. All jene, die sich dem Wandel verschrieben, konnten florieren. China ist einfach der grösste Teil einer neuen Welt. Ihn abschalten funktioniert nicht. Man sollte sich vielleicht besser vorbereiten. Für die Amerikaner bedeutet das, sich wieder auf Fähigkeiten zu besinnen, die die amerikanische Wirtschaft vorangebracht haben: Forschung und Technik. In diesen Bereichen hat das weltweite Ranking der Vereinigten Staaten einen deutlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Forschungsinstitute werden von ausländischen Studenten und Einwanderern dominiert – aber immer mehr kehren nach Hause zurück oder kommen gar nicht erst. Ohne massive Förderung dieses Bereichs werden die USA nicht mehr imstande sein, all jene Naturwissenschaftler, Ingenieure und Techniker auszubilden, die das Fundament einer hochentwickelten Industrienation sind. China und Indien produzieren schon sehr viel mehr Ingenieure als die Vereinigten Staaten. In fünf Jahren wird es in China mehr promovierte Akademiker geben als in den USA. Sie mögen nicht so gut sein wie ihre amerikanischen Kollegen, aber es kommt auch auf die Menge an. Für die amerikanische Regierung könnte die Zeit der Sorglosigkeit bald zu Ende sein. Sie hat eine unverantwortliche Haushaltspolitik betrieben, weil sie wusste, dass ihr ausländische Regierungen und Investoren unbegrenzten Kredit einräumen. Die Kredite haben jedoch ihren Preis. Wenn China über gigantische Dollarreserven verfügt, hat es auch die Macht, der amerikanischen Wirtschaft Schaden zuzufügen. Dies würde China mindestens ebenso schaden, wenn nicht mehr, aber besser wäre es natürlich, wenn Amerika weniger verletzbar wäre. Eine verantwortungsbewusste Haushaltspolitik bedeutet mehr aussenpolitische Handlungsmöglichkeiten. Aussenpolitisch gibt es für Washington nur zwei Möglichkeiten. Die erste wäre, dass China auftrumpft, seine Nachbarn erbost und die Welt in Schrecken versetzt. In diesem Fall werden sich Russland, Japan, Indien und die Vereinigten Staaten zusammenfinden, um die Macht Chinas einzuschränken. Doch was, wenn China an seiner asymmetrischen Strategie festhält? Was, wenn es seine Wirtschaftsbeziehungen allmählich ausbaut, besonnen und massvoll agiert und seine Einflusssphäre ganz langsam erweitert – in der Hoffnung, die Geduld und Beharrlichkeit der Amerikaner zu strapazieren? Die Vereinigten Staaten werden dann entsprechend reagieren müssen, ebenfalls besonnen und umsichtig vorgehen, ebenfalls eine ausgewogene und differenzierte langfristige Politik entwickeln müssen. Dazu ist Amerika durchaus fähig. Amerika ist sehr viel geduldiger, als den meisten klar ist. Fast fünfzig Jahre lang hat es die Eindämmung der Sowjetunion verfolgt. Amerikanische Soldaten stehen noch immer am Rhein, in der demilitarisierten Zone in Korea und auf Okinawa. Ein Weltkrieg ist höchst unwahrscheinlich. Atomare Abschreckung, wirtschaftliche Interdependenz, Globalisierung – all das spricht dagegen. Aber unter dieser Oberfläche wird es wahrscheinlich einen «soften» Krieg geben, einen stillen Kampf um Macht und Einfluss auf der Welt. Amerika und China werden an einem Tag Freunde sein, am nächsten Rivalen, auf dem einen Gebiet kooperieren, auf einem anderen konkurrieren. Willkommen im 21. Jahrhundert. China gegen den Rest der Welt Das Riesenreich erobert den globalen Textilmarkt. Eine Front aus armen und reichen Staaten will neue Handelsschranken Bis zum Januar war das Leben gut für Hun Sang Heab. Monatlich 100 Dollar verdiente der 28Jährige als Buchhalter bei Universal, einer Textilfirma im Westen Phnom Penhs. An einer staubigen Schotterstraße, nur wenige hundert Meter vom Fabriktor entfernt, hatte Hun ein kleines Haus gemietet. Die Zukunft schien dem ehemaligen Bauern gesichert, der aus dem armen Norden Kambodschas in die Hauptstadt gezogen und durch seine Arbeit in der Textilfabrik zu bescheidenem Wohlstand gekommen war. Inzwischen weiß Hun nicht mehr, wie er die Miete für das Haus bezahlen und seine Familie ernähren soll. »Die internationale Lage« habe sich verändert, sagte sein Chef, als er ihn vor ein paar Wochen auf die Straße setzte. Mehr als 20.000 Beschäftigte in der kambodschanischen Textilindustrie – also fast jeder Zehnte – haben seit Jahresbeginn ihren Job verloren. Landesweit wurden 13 Fabriken geschlossen, weitere 24 haben ihre Produktion vorübergehend ausgesetzt. Das ist besonders tragisch, weil die Textilproduktion der einzig nennenswerte Wirtschaftszweig in Kambodscha ist. »Im schlechtesten Fall werden bis zu 40 Prozent aller Betriebe untergehen«, sagt Ken Loo, Generalsekretär des Branchenverbands GMAC. Er spricht für eines der ärmsten Länder in Asien. Peter Mandelson, der Handelskommissar der Europäischen Union, spricht für einen der reichsten Wirtschaftsräume der Welt – aber mit der gleichen Motivation: »Europa kann nicht tatenlos zusehen, wie seine Textilindustrie von der Bildfläche verschwindet.« Die Volksrepublik China wurde bis in die 1990er Jahre als Entwicklungsland eingestuft, entwickelt sich aber seit seiner teilweisen Öffnung nach der "Kulturrevolution" zunehmend zu einer Großmacht. Sie vertritt international die "Ein-China-Politik", deren offizielle Anerkennung sie seit Anfang der 70er Jahre auch im Westen durchsetzt. Wirtschaftlich weist China derzeit eine hohe Dynamik auf, so dass der aktuelle Fünfjahrplan bereits eine Drosselung gegen eine allfällige Überhitzung vorsieht. BIP pro Kopf ca. 1.269,8 USD pro Jahr Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und USA Anneke Maleh 1. Handelsbeziehungen China USA: Schaden chinesische Importe der US-Wirtschaft? Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen China und den USA hat seit den 90iger Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. In der letzten Dekade erhöhten sich chinesische Importe in die USA von rund 39 Milliarden Dollar (1994) auf rund 197 Milliarden Dollar (2004). China ist mittlerweile nach Kanada der zweitgrößter Importeur der USA (siehe Tab.1). Gleichzeitig gewinnt auch die Rolle Chinas als Absatzmarkt für US-amerikanische Produkte an Bedeutung: Im Zeitraum von 1994 bis 2004 stieg der Wert von U.S. Exporten nach China von rund 9 Milliarden Dollar auf rund 35 Milliarden Dollar und hat sich damit mehr als verdreifacht. Im Jahr 2003 war China sechstgrößtes Exportziel der USA und nach Japan zweitgrößter Exportmarkt in Asien (siehe Abb.1). Wie aus Tabelle 2 hervorgeht, sind U.S. Exporte nach China jedoch deutlich geringer angestiegen als die Importe aus China; dieser Trend spiegelt sich auch in der Handelsbilanz wieder. So weisen die USA im Handel mit China ein Defizit auf, das von 1994 bis 2004 von rund 29 Milliarden Dollar auf rund 162 Milliarden Dollar angestiegen ist. Tab. 1: U.S. Importe nach Region 2000 und 2003 (Millionen Dollar) 2000 2003 Kanada 230 838 224 166 China 100 018 152 379 Mexiko 135 926 138 073 Japan 146 479 118 029 Tab. 2: Handelsbeziehungen USA-China 1994-2004 (Millionen Dollar) 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 US Exporte 34 721 28 368 22 128 19 182 16 185 13 111 14 241 12 862 11 992 11 753 9 282 US Importe 196 699 152 436 125 193 102 278 100 018 81 788 71 169 62 557 51 512 45 543 38 787 Handelsbilanz -161 978 -124 068 -125 193 -83 096 -83 833 -68 677 -56 927 -49 695 -39 520 -33 789 -29 505 Quelle: http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html#2004 In den USA wurden die steigenden Importe aus China besonders im Wahljahr 2004 als bedrohlich und schädlich für die heimische Wirtschaft empfunden. Es wurde ein positiver Zusammenhang zwischen den steigenden Importen aus China und dem Verlust von Arbeitsplätzen im USamerikanischen Industriesektor vermutet. Die Befürchtung, amerikanische Arbeitsstellen würden an chinesische Billiglohnarbeiter abgetreten, wurde besonders in der Section 301[1]-Petition des Gewerkschaftsverbandes der „American Federation of Labor - Congress of Industrial Organizations“ (AFL-CIO) deutlich. Diese Petition wurde zwar kurz nach ihrer Einleitung vom US Präsidenten mit der Begründung abgelehnt, die Probleme könnten auf dem diplomatischen Wege gelöst werden. Trotzdem ist sie ein guter Indikator für die derzeit von Politikern, Ökonomen und Verbänden geführte Diskussion um die steigenden Importe aus China. Aus diesem Grund wird im Folgenden untersucht, ob die Vorwürfe der AFL-CIO aus wirtschaftlicher Sicht fundiert sind,oder ob es sich hier um den Versuch handelt, einen Sündenbock für die Verluste von amerikanischen Arbeitsplätzen zu finden. 1.1 AFL-CIO: Verletzung der Arbeitsstandards in China führen zum Anstieg der Arbeitslosigkeit in den USA In den USA wird häufig argumentiert, dass sich chinesische Importe in die USA negativ auf die Beschäftigung von amerikanischen Industriearbeitern auswirken. Dieser Vorwurf wurde sowohl von Präsidentschaftskandidat John Kerry[2] während des Wahlkampfes als auch von verschiedenen Interessenvertretern wie der „United Automobile Workers“ (UAW)[3] oder den „United Steelworkers of America“ (USWA)[4] gemacht. Am 16. März 2004 leitete der Gewerkschaftsverband AFL-CIO, der mit einer Mitgliederzahl von zwölf Millionen eineder stärksten Lobbys der US-Wirtschaft ist, eine Section 301-Petition gegen China ein. Die AFL-CIO argumentierte, dass die schlechten Arbeitsstandards in China die Löhne der chinesischen Arbeiter niedrig halten und dadurch die Importpreise drücken würden. Dies führe zu steigenden Importen in die USA, die sich negativ auf die Beschäftigung von amerikanischen Industriearbeitern auswirkten. Im Jahr 2000 waren in den USA 17,2 Millionen Arbeiter im Industriesektor beschäftigt und im Jahr 2003 erreichten die Beschäftigungszahlen mit 14,6 Millionen Arbeiternden niedrigsten Stand seit 1958.[5] Die Zahl der Arbeitsplätze, die aufgrund von chinesischen Importen verlorengegangen sind, schätzt die AFL-CIO auf 727 000.[6] Andere Schätzungen gehen von 1,5 Millionen Arbeitsplätzen aus, die zwischen 1989 und 2003 aufgrund von chinesischen Importen eingebüßt worden seien.[7] Zu den Arbeitnehmerrechten, die nach AFL-CIO missachtet werden, gehören die Nichteinhaltung des gesetzlichen Mindestlohns und die schlechten Gesundheits- und Sicherheitsstandards. Zusätzlich sieht die AFL-CIO eine weitere Verletzung in dem Verbot, unabhängige Gewerkschaften zu gründen. In China existiert derzeit nur eine staatlich kontrollierte Gewerkschaft, die „All-China Federation of Trade Unions“ (ACFTU). In der Petition wird behauptet, dass trotz des Produktivitätsanstiegs die Löhne in China stagnieren oder teilweise auch fallen würden. Die AFL-CIO fordert daher einen Lohnanstieg für chinesischen Arbeiter von 90 bis 595Prozent. Dies würde nach Ansicht des Gewerkschaftsverbandes sowohl den Arbeitern in den USA als auch denen in China zu Gute kommen.[8] 1.1.1 Sind Billiglöhne in China ein unfairer Wettbewerbsvorteil? Der Vorwurf, China würde durch die Verletzung von internationalen Arbeitsstandards ungerechtfertigt niedrige Entlohnung forcieren, die amerikanischen Arbeitnehmern schadet, wird vielfach angezweifelt. Während die AFL-CIO behauptet, dass chinesische Löhne gesunken oder zumindest stagnieren würden, finden sich in der Literatur gegenläufige Angaben.[9] Auch aus den Arbeitsmarkstatistiken der International Labor Organization (ILO) geht ein steigender Verlauf des Lohnniveaus hervor: Hiernach sind die durchschnittlichen Monatslöhne im Industriesektor im Zeitraum zwischen 1994 und 2002 von ca. 55 Dollar (458,33 Yuan) auf ca. 125 Dollar (1 035,17 Yuan) gestiegen und haben sich somit mehr als verdoppelt.[10] Trotzdem sind siemit 6 Prozent des US-Niveaus (14,96 Dollar Stundenlohn) im Vergleich immer noch sehrniedrig. Zieht man zudem Chinas wirtschaftliche Entwicklung in Betracht, so mag der Lohnanstieg bei einem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum von 8 Prozent moderat erscheinen. Jedoch ist dies weniger auf unfaire Praktikenzurückzuführen, sondern vielmehrauf den hohen Grad an Urbanisierung, der ein stetig wachsendes Arbeitsangebot zur Folge hat. Dies wirkt dem Ansteigen der Löhne in den Städten entgegen. Hinsichtlich der Arbeitsstandards muss gesagt werden, dass sie zwar niedrig sind, sich in den letzten Jahren jedoch stark verbessert haben.[11] Der Wettbewerbsvorteil, den die chinesische Industrie aufgrund ihrer relativ niedrigen Löhne hat, ist somit nicht auf unfaire Praktiken, sondern vielmehr auf wirtschaftliche Rahmenbedingungen zurückzuführen. Würde China den geforderten Lohnanstieg durchsetzen, würde dies nicht nur zum Bankrott von vielen chinesischen Firmen führen, sondern auch die Produktivität der chinesischen Arbeitskräfte weit überschreiten. Des weiteren scheint eine solch dramatische Lohnerhöhung nicht umsetzbar und würde in jedem Fall eine hohe Inflation verursachen.[12] 1.1.2 Binnenwirtschaftliche Faktoren als Grund für den Beschäftigungsrückgang? Ursachenfür den Verlust von Arbeitsstellen im Industriesektor werden oft bei den Importen aus China gesucht, deren Preise angeblich durch unlautere Wettbewerbspraktiken niedrig gehalten werden.[13] Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht den Abwärtstrend in der Industriebeschäftigung. Abb. 2: Industriebeschäftigung in den USA 1950-2004 Der starke Rückgang der Beschäftigungszahlen im amerikanischen Industriesektor ist jedoch in erster Linie auf die Wirtschaftslage in den USA zurückzuführen. So sind in der letzten Rezession im Jahr 2001 besonders viele Arbeitsplätze verloren gegangen, deren Verluste aufgrund von schwacher Nachfrage nach Industriegütern seitdem nicht wieder ausgeglichen werden konnten. Während die Beschäftigungszahlen sanken, stieg die Produktivität enorm an: Nach der Rezession hätten die Verkäufe also noch stärker ansteigen müssen, um die zahlreichen Freisetzungen zu kompensieren.[14] Ferner wird in der steigenden Arbeitslosenzahl des Sektors der Wandel zur Dienstleitungsgesellschaft offensichtlich, der mit einem anhaltenden Abwärtstrend in der Industriebeschäftigung einhergeht.[15] Ein weiterer Grund für die steigenden Arbeitslosenzahlen ist die statistische Erfassung der Arbeiter. Die Beschäftigung von Teilzeitarbeitern, die statistisch nicht erfasst werden, hat sich in den Jahren zwischen 1990 und 2000 von 1,2 Millionen auf 2,6 Millionen Beschäftigte mehr als verdoppelt. Dieser Anstieg lässt die Erwerbslosenstatistiken dramatischer erscheinen.[16] Es wird somit deutlich, dass die Ursache der schlechten Arbeitsmarktsituation des US-amerikanischen Industriesektors nicht ausschließlich auf außenwirtschaftliche Faktoren zurückzuführen ist, sondern dass binnenwirtschaftliche Ursachen eine ausschlaggebende Rolle spielen. 1.1.3 Was für einen Effekt hätte die Anhebung der Arbeitsstandards? Von der AFL-CIO wird argumentiert, dass eine Verbesserung der Arbeitsstandards in China nicht nur Arbeitsplätze in den USA sichern würde, sondern auch einen positiven Effekt auf die Arbeitsbedingungen in China hätte. Diese Argumentation ist jedoch sehr umstritten. So kann eine Verbesserung der Arbeitsstandards die Arbeitsmarktsituation in Entwicklungsländern wie China verschlimmern. Dies wäre der Fall, wenn Löhne über das Produktivitätsniveau steigen würden. Dann würden Arbeitskräfte vom formellen in den informellen Sektor abwandern, in dem die Standards weitaus schlechter sind. Es muss folglich darauf hingewiesen werden, dass eine Anhebung der Arbeitsstandards in China nicht ausschließlich positive Effekte für die chinesischen Arbeitsnehmer hätte.[17] 1.1.4 Differenzierte Betrachtung der Handelsbilanz Der dramatische Anstieg chinesischer Importe, der vor allem im bilateralen Handelsdefizit zwischen USA und China offensichtlich wird, wird u.a. von Gewerkschaften als schädlich für die Beschäftigung von amerikanischen Arbeitnehmern eingeschätzt. Bemerkenswert sind dabei zunächst die Unterschiede in der Handelsbilanz, die zwischen der statistischen Erfassung in den USA und denen in China besteht. Im Jahr 1996 berechnete das „China Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation“ (MOFTEC) einen Überschuss im Handel mit den USA von rund 16 Milliarden Dollar. Im gleichen Jahr erfasste das U.S. Department of Commerce einen Handelsüberschuss, der mit rund 39 Milliarden Dollar mehr als doppelt so hoch lag (siehe Abb.2). Gründe dieser drastischen Unterschiede liegen in der statistischen Erfassung. So werden in der Handelsbilanz der USA Importe aus Hongkong mit einbezogen. Des weiteren treten nach der „rules of origin“-Richtlinie Fertigwaren ausschließlich in der Handelsbilanz des exportierenden Landes auf, unabhängig davon, ob zu ihrer Herstellung Einzelteile importiert wurden. Zusätzlich sind eine Vielzahl von Firmen aus Hongkong, Südkorea und Taiwan nach China umgesiedelt, deren Exporte in der Handelsbilanz als chinesische Exporte erscheinen. Das Handelsdefizit zwischen China und den USA spiegelt somit nicht nur die Importe aus China wieder, sondern indirekt auch die aus anderen Ländern. Aus den genannten Gründen könnte das Handelsdefizit der USA in der amerikanischen Statistik überschätzt sein.[18] Lawrence Lau von der Stanford University argumentiert, dass chinesische Statistiken das Handelsdefizit wiederum unterschätzen, da Reexporte durch Hongkong oder andere Länder in der Statistik nicht auftauchen.[19] Dieser Ansicht ist auch Robert Feenstra von der University of California. Er führt an, dass zwischen den Jahren 1988 und 1995 durchschnittlich 2/3 der chinesischen Importe über Hongkong in die USA gelangt sind. Im Gegensatz zu den offiziellen Berechnungen, die zwischen 9 und 34 Millionen Dollar liegen, schätzt Feenstra unter Berücksichtigung der Reexporte, dass das Handelsdefizit im Jahr 1995 zwischen 16 und 22 Milliarden Dollar lag.[20] Unabhängig davon welche Zahlen man als Grundlage nimmt, die alleinige Betrachtung des Handelsdefizits mit China lässt außer acht, dass zwar die Importe aus China, nicht aber die Importe aus asiatischen Ländern insgesamt angestiegen sind. Ein Rückgang der chinesischen Importe hätte somit keine Nachfrageerhöhung nach heimischen Industriegütern zur Folge, sondern würde höchstwahrscheinlich zu einer Substitution hin zu Importen aus anderen Billiglohnländern führen.[21] 1.1.5 Die Rolle ausländischer Unternehmen Die ausschließliche Betrachtung der chinesischen Importe lässt auch die fortgeschrittene internationale Verflechtung unberücksichtigt. So waren ausländische Tochterunternehmen in China in der letzten Dekade ein dynamischer Exportmotor. Der Anteil von Gütern am gesamten Export, die von ausländischen Unternehmen in China hergestellt wurden,stieg in den Jahren von 1989 bis 2001 von 9 Prozent auf 45 Prozent. Exporte von ausländischen Unternehmen konzentrieren sich vor allem auf den Handel mit Industriegütern. Exportprodukte, die von einheimischen Unternehmen hergestellt und exportiert wurden, sind vor allen Spielzeuge, Reisetaschen, Garn und Stoffe. Dies zeigt zum einen, dass ein Rückgang der Importe nicht nur China, sondern auch Industrieländern schaden würde, die ihre Firmen in China angesiedelt haben.[22] Zum anderen wird deutlich, dass nicht nur chinesische Unternehmen in die USA importieren, sondernvor allem auch ausländische Unternehmen. Die AFL-CIO argumentiert zudem, dass die Preise chinesischer Importe nur aufgrund von ungenügenden Arbeitsstandards so niedrig sein können. Dies ist nicht überzeugend, wenn man ausländische Unternehmen in China betrachtet: Die von ausländischen Unternehmen in China gezahlten Löhne sind im Durchschnitt 30 Prozent höher als die der chinesischen Firmen. Zudem bieten ausländische Unternehmen eine bessere Sicherheits- und Gesundheitsvorsorgung an und verfügen über weitaus höhere Umweltstandards. 1.2 Zwischenbilanz Die Beschäftigungszahlen im US-amerikanischen Industriesektor sind auf ein niedriges Niveau gesunken. Ursache dieser Entwicklung sind vor allem dieÄnderung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, eine sinkende Nachfrage nach Industriegütern und statistische Erfassungsmethoden, nicht hauptsächlich das Verbot unabhängiger Gewerkschaftsbildung in China. Ausschließlich chinesische Importe und Billiglöhne für diesen Trend verantwortlich machen zu wollen, scheint aus wirtschaftlicher Sicht unbegründet. Obwohl die Arbeitsstandards in China zweifellos als niedrig und verbesserungswürdig einzustufen sind, lässt sich die Ursache für niedrige Löhne in China insbesondere in einem hohen Arbeitsangebot bei gleichzeitigem Produktivitätsanstieg finden. Ein Rückgang chinesischer Importe hätte höchstwahrscheinlich einen Anstieg von Importen aus anderen Billiglohnländer zur Folge und würde nicht zur Besserung der Situation amerikanischer Industriearbeiter führen. Abschließend soll abermals auf die Rolle von ausländischen Unternehmen in China hingewiesen werden. Diese sind nicht nur ein starker Exportmotor im Bereich von Industriegütern, sondern zahlen zudem höhere Löhne als chinesische Unternehmen. Die Anschuldigungen der AFL-CIO sind aus diesen Gründen im wesentlichen als ungerechtfertig einzustufen. Wiki: Wirtschaftsgeschichte Nachdem im Jahr 1949 die Volksrepublik China ausgerufen wurde, interessierte im Ausland vor allem die Frage, wie das Land wohl jemals seine riesige Bevölkerung ernähren wolle. Mehr als 50 Jahre später sieht sich die Welt einem Land gegenüber, das nicht nur eine Bevölkerung ernährt, die sich seither mehr als verdoppelt hat, sondern welches außerdem einen schnell wachsenden Teil davon mit Mobiltelefonen und Computern versorgt und dazu zu den größten Exportnationen der Welt gehört. Die Wirtschaftspolitik unter Mao Zedong war von der Einführung einer Planwirtschaft nach sowjetischem Vorbild geprägt. Ein Plan sollte den Markt bei der Verteilung von Ressourcen und Investitionen ersetzen. Das Ziel war, eine schnellstmögliche Industrialisierung und höchstmögliches Wirtschaftswachstum zu erreichen. Dabei wurde die Planwirtschaft in einigen Bereichen entscheidend an die chinesischen Verhältnisse adaptiert. Zum einen sah sich China nicht in der Lage, genug planerische und administrative Kräfte aufzubringen, um eine Planwirtschaft nach streng sowjetischem Vorbild einzuführen. Anstelle dessen wurden bereits in den 1950er Jahren Maßnahmen zur Dezentralisierung getroffen und den Verantwortlichen auf Provinz- und Betriebsebene mehr Freiraum zur Umsetzung der Vorgaben gegeben. Zum anderen legte Mao großen Wert auf autarke Entwicklung. Nicht nur China, sondern auch einzelne Provinzen oder Regionen sollten sich selbst versorgen können. Dadurch isolierte sich das Land vom Rest der Welt gerade in einer Zeit, als andere Entwicklungsländer durch aktive Förderung der Integration in den Weltmarkt einen wirtschaftlichen Aufholprozess erfuhren. Der dritte Unterschied zum sowjetischen Wirtschaftsmodell lag darin, dass Mao in der Wirtschaftsentwicklung auf Massenkampagnen setzte, etwa den Großen Sprung nach vorn oder die Kulturrevolution. Diese beiden vor allem politisch motivierten Bewegungen warfen das Land jedoch um viele Jahre zurück, Historiker schätzen heute, dass der Große Sprung nach vorn (1959-61) bis zu 30 Millionen Menschen das Leben gekostet hat: die meisten verhungerten, weil Maos Politik zu gewaltigen Missernten führte. Die Kulturrevolution (1966-1976) legte China für ein ganzes Jahrzehnt praktisch lahm: Schulen und Universitäten waren geschlossen, man hatte im maoistischen Slang "rot" zu sein (also politisch korrekt) und kein "Experte" (also technisch oder ökonomisch fähig). Das wirtschaftliche Erbe Maos ist somit zwiespältig: Einerseits wuchs das BIP zwischen 1952 und 1975 um jährlich durchschnittlich 6,7 %, die Möglichkeiten für Bildung (insbesondere für Frauen), medizinische Versorgung und soziale Sicherheit erreichten ein Niveau, das es in der Geschichte des Landes zuvor nie gegeben hatte und der Anteil der Industrie an der Wirtschaftskraft wurde von etwa 20 % 1952 auf 45 % 1975 gesteigert. Diese Erfolge beruhten jedoch größtenteils auf der Mobilisierung zusätzlicher Ressourcen, die Investitionen wurden zunehmend ineffizienter und das relativ hohe Wirtschafswachstum konnte nur zu einem sehr geringen Anteil in höheren Konsum der Bevölkerung umgesetzt werden. Letzten Endes musste Mao sich auch selbst eingestehen, dass sich seine von utopischen Visionen geleitete Wirtschaftspolitik in einer Sackgasse befand. Er brachte in den frühen 1970er Jahren die wirtschaftlich pragmatischen Politiker Deng Xiaoping und Zhou Enlai zurück an die Macht, obwohl sie vorher schon in Ungnade gefallen waren. Der Tod von Mao 1976 eröffnete die Möglichkeit zu Reformen. Es ist unwahrscheinlich, dass eine Fortsetzung der Wirtschaftspolitik, wie sie unter Mao gemacht wurde, noch lange möglich gewesen wäre. Deng Xiaoping ging die dringendsten Probleme daher zuerst an und erlaubte lokalen Parteiführern schrittweise, die Kollektivierung der Landwirtschaft zurückzunehmen. Die Bauern hatten von da an Eigentumsrechte an ihren Produkten, Landbesitz war jedoch weiterhin nicht möglich. Landwirtschaftliche Produkte wurden bald wieder den frei zugänglichen, ländlichen Märkten gehandelt. Ab Mitte der 1980er Jahren wurden auch nicht-staatliche Unternehmen in der Industrie zugelassen und die Staatsunternehmen mussten auf den sich entwickelnden Märkten mit Privatunternehmen konkurrieren. Später wurde es ausländischen Unternehmen erlaubt, in China zu investieren und der Außenhandel wurde liberalisiert. Auch institutionelle Reformen an staatlichen Investitionen oder dem Steuersystem wurden notwendig. An den politischen Rahmenbedingungen wurde jedoch zunächst nichts geändert, weshalb das Wirtschaftssystem als Staatskommunismus oder offiziell als „sozialistische Wirtschaft chinesischer Prägung“ bezeichnet wurde. Im Jahre 1995 wies die Wirtschaft ein stabiles hohes Wachstum auf, das vorher isolierte Land war der siebentgrößte Teilnehmer am internationalen Handel und der Lebensstandard wuchs schnell, wobei die Konsumausgaben der Haushalte zu konstanten Preise jährlich um mehr als 7 % stiegen. Seitdem stellt sich die Frage, wie lange die chinesische Wirtschaft noch in diesem Tempo wachsen kann. Mittlerweile gibt es in China kaum noch Marktsegmente, welche man leicht liberalisieren könnte, um damit ein schnelles und vor allem großes und nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu erzeugen. Dazu gibt es einige wirtschaftliche Problemfelder, zu deren Lösung es schmerzhafter Einschnitte bedarf. Dazu gehören Staatsunternehmen, die nicht privatisiert wurden und die teils hohe Verluste machen. Diesen Staatsunternehmen werden durch die Staatsbanken immer neue Kredite zur Verfügung gestellt, um sie am Leben zu halten. Dadurch haben die dominierenden staatlichen Banken hohe Summen an faulen Krediten angehäuft, wodurch das Bankensystem illiquid geworden ist. Sollten die Bankkunden plötzlich in einem Bankensturm ihre Einlagen zurückverlangen, so könnten die Forderungen nicht bedient werden. Eine Reform des staatlichen Sektors wird von der Regierung der Volksrepublik aber nur sehr zögerlich angegangen, denn es ist zu befürchten, dass eine Schließung von unrentablen Staatsunternehmen zu einer stark steigenden Arbeitslosigkeit in den Städten führen würde. Die heutige Phase wird angesichts des zunehmenden Gewichts der Privatwirtschaft in China von ausländischen Wirtschaftsführern und Politikern oft als Chinas Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft bezeichnet. Chinaexperten wie der deutsche Politikwissenschaftler Sebastian Heilmann weisen jedoch darauf hin, dass in China keineswegs die freie Marktwirtschaft regiert, vielmehr sprechen sie von einem autoritären "Kader-Kapitalismus": Wirtschaftlich erfolgreich sind meist Unternehmer mit guten Beziehungen zu den Mächtigen, Korruption ist ein großes Problem. Energiepolitik Durch die rasche Industrialisierung sowie den Anstieg des Lebensstandards stieg der Energiebedarf stark an. Im Jahr 1985 wurde etwa 13 Mal so viel Energie verbraucht wie im Jahr 1957. Der ProKopf-Verbrauch von Energie liegt jedoch im internationalen Vergleich niedrig, nämlich bei etwa der Hälfte des internationalen Schnitts und bei etwa einem Zehntel des Pro-Kopf-Verbrauches der USA. Deshalb kann ein weiteres starkes Ansteigen des Energiebedarfs prognostiziert werden. Das Jahr 1990 markierte einen ersten Wendepunkt in der Energieversorgung: China wurde zum Nettoimporteur von Energie. Ende 1993 wurde China auch zum Nettoimporteur von Rohöl. Der größte Anteil an Energie wird jedoch nach wie vor aus der Kohle gewonnen, die einen Anteil von etwa 70 % am Gesamtenergieverbrauch hat. Der massive Abbau von Kohle forderte immer wieder einen hohen Preis. Die Gruben gelten als erbärmlich ausgestattet und begraben immer wieder Kumpel unter sich. Um weitere Energiequellen zu erschließen, sind zahlreiche Atomkraftwerke in Bau, das erste in Qinshan (Provinz Zhejiang) ist seit 1991 in Betrieb. Auch die zahlreichen Wasserkraftwerksprojekte, etwa der berühmte Drei-Schluchten-Damm sind nicht zuletzt energiepolitisch motiviert. Ernste Energie-Engpässe und regelmäßige Stromausfälle bzw. geplante Stromabschaltungen sind in den großen Städten, vor allem in den Boom-Regionen, an der Tagesordnung; Bürger wie Unternehmen werden ständig zu Energiesparmaßnahmen aufgerufen. China will die Erzeugung von Atomstrom bis 2020 von momentan ca. 6,5 Gigawatt auf ca. 36 Gigawatt erhöhen. Der Anteil des Atomstroms an der chinesischen Stromerzeugung wird somit von derzeit ca. 1,2 Prozent auf etwa 4 Prozent ansteigen. Wirtschaft Europa: Im 19. Jahrhundert war Europa durch die in England beginnende und auf den ganzen Kontinent übergreifende Industrielle Revolution konkurrenzlos die führende Wirtschaftskraft. Später brachten verschiedene internationale Einrichtungen und Organisationen, wie die EFTA (Europäische Freihandelszone) und die Europäische Union einen Wachstumsschub, der in vielen Teilen Europas bis in die 70er und teilweise in die 80er anhielt. Die Versorgung der Bevölkerung Europas konnte durch die Verringerung von Handelsbeschränkungen ebenfalls weiter ausgebaut werden. Seit dem 1. Januar 1999, gilt in 12 Staaten der EU der Maastricht-Vertrag, mit dem alle 12 Länder eine Währungsunion bilden und somit ihre jeweiligen Landeswährungen abschafften und den Euro, zunächst noch als bargeldloses Zahlmittel einführten. Heute ist Europa ein wohlhabender Kontinent mit großen Industriemetropolen, gewinnbringender Landwirtschaft und einem boomenden Dienstleistungssektor. Die Industrie und die Dienstleistung konzentriert sich vor allem auf die Ballungsgebiete. In den meisten Staaten Europas ist das Problem nicht mehr der Mangel an Nahrungsmitteln, sondern die Überproduktion und die Fettleibigkeit. Ausfuhrgüter sind vor allem Maschinen, Stahl, Computerbedarf und Autos. Einfuhrgüter sind z.B. Kakao, Tee, Kautschuk, Erdöl, Erdgas und Erze. Warum ist China kein Entwicklungsland? entwicklungsländer haben eine überbevölkerung, nach der einführung der ein kind politik ist dieses problem behoben, dann herrscht in einem entwicklungsland der premiäre sektor und die wirtschaft ich schlecht, china befindet sich im tertieren sektor und die wirtschaft hat sich verbessert auch der medizinische vortschritt chinas entspricht dem einee industrielandes und guck der mal all die elekrinokgeräte an (handys und so) alles industrie und konkurrenz auf dem markt Europa ist das westliche Fünftel der eurasischen Landmasse und wird von Europäern üblicherweise als eigenständiger Kontinent betrachtet, obwohl es eigentlich ein Subkontinent ist. Insgesamt hat Europa eine Fläche von ca. 10,5 Millionen Quadratkilometern, was Europa nach Australien zum zweitkleinsten Kontinent macht. Dennoch besitzt Europa mit rund 730 Millionen Einwohnern die drittgrößte Bevölkerung aller Kontinente. Die Ausdehnung erstreckt sich von der Nordsee und dem Atlantischen Ozean im Westen bis zum Ural im Osten. Wirtschaft USA Die USA sind mit einem Bruttoinlandsprodukt von (2004) 11.728 Milliarden US-Dollar die größte Volkswirtschaft der Welt sowie 2005 das Land mit dem weltweit achthöchsten Pro-KopfBruttosozialprodukt (nach Luxemburg, Norwegen, der Schweiz, Island, Irland, Dänemark, und Schweden) mit 41.917 Dollar (34.012 Euro). Der US-Dienstleistungssektor erwirtschaftet ca. 73 % des realen Bruttoinlandsproduktes (BIP), davon etwa ein Drittel im Banken-, Versicherungs- und Immobiliengeschäft. Das verarbeitende Gewerbe trägt ca. 23 %, Landwirtschaft sowie Bergbau tragen jeweils knapp 1,6 % zum BIP bei. Die Arbeitslosenquote betrug 2003 6 %. Die USA werden von vielen für eine der am stärksten deregulierten und privatisierten Volkswirtschaften der Welt gehalten. Es gibt jedoch in vielen Wirtschaftsbereichen staatliche oder kommunale Aufsicht, beispielsweise bei der Stromversorgung (Public Utility Commission) der einzelnen Bundesstaaten, die bei der Preisbildung einen bestimmten Mindestgewinn für die Versorgungsfirma garantiert oder in Bezug auf die zivilrechtlichen Antidiskriminierungsregelungen, die seit den 1960er Jahren bestehen. Im Vergleich hierzu begnügt sich Deutschland mit dem § 33 Abs. 3 GG, der nur den Bereich des öffentlichen Rechts tangiert. Ebenfalls zu nennen ist die Fair Housing Act, sowie die vielen Regulierungen, die zwar nicht staatlich vorgeschrieben sind, sich jedoch aus Versicherungs- und Haftpflichtregelungen ergeben. Die Armutsschwelle wird bei einem Jahreseinkommen von 18.810 US-Dollar (15.550 Euro) für eine vierköpfige Familie und von 9.393 US-Dollar (7.760 Euro) für eine alleinstehende Person angesetzt. Jeder achte Einwohner der USA lebt demnach laut Angaben der US-Zensusbehörde in Armut. So stieg die Zahl der Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, im Jahr 2003 um 1,3 Millionen auf 35,9 Millionen. Dies entspricht einer Zunahme um 0,4 Prozentpunkte auf 12,5 %. Es war das dritte Jahr in Folge, dass die Armut in den USA zunahm und die höchste Armut seit 1998, als die Quote bei 12,7 % lag. (Zum Vergleich: Deutschland: 13,5 %) Außenhandel: Der Import belief sich 2004 auf Güter im Wert von 1,48 Billionen US-Dollar, der Export auf 795 Mrd. US-Dollar, womit ein hohes Handelsbilanzdefizit von 646 Mrd. US-Dollar ausgewiesen ist. Die Inflationsrate lag (1990-2001) bei 2,0 %.