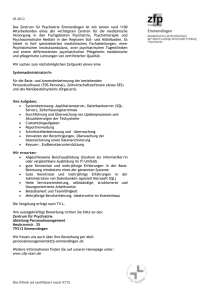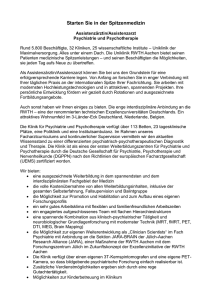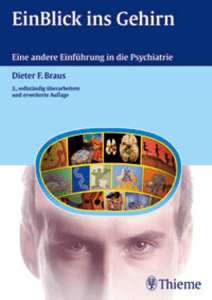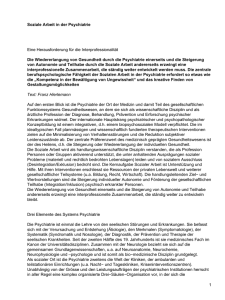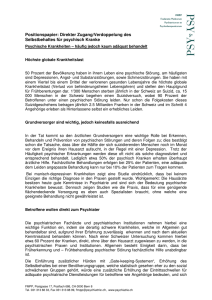Interview - Chance B
Werbung
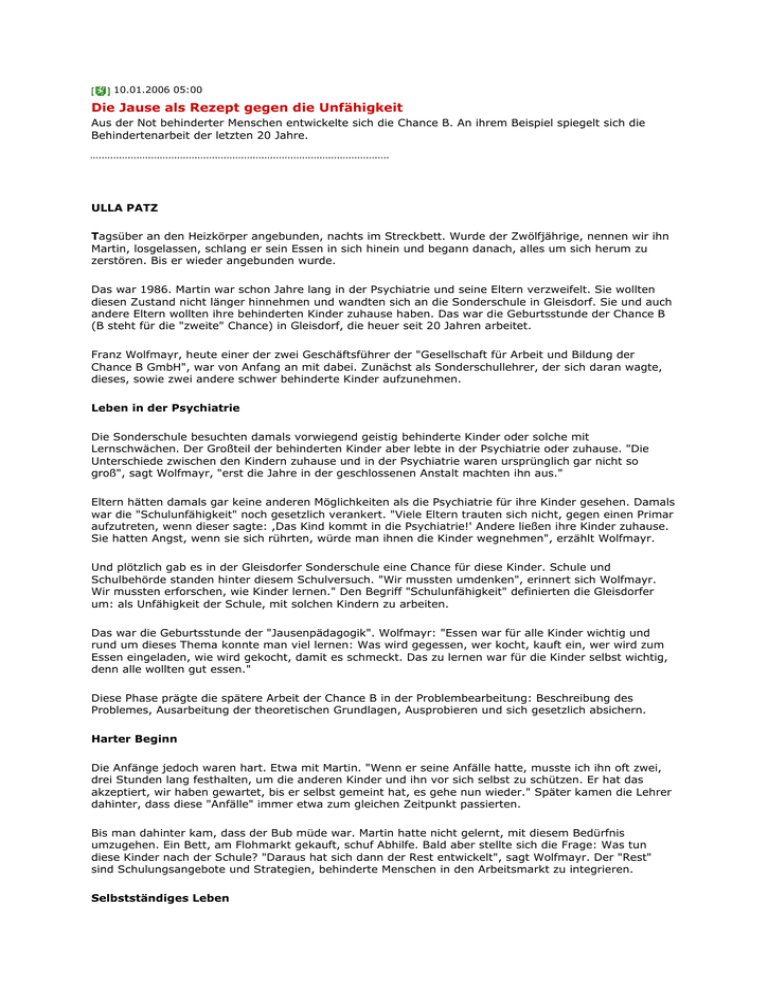
10.01.2006 05:00 Die Jause als Rezept gegen die Unfähigkeit Aus der Not behinderter Menschen entwickelte sich die Chance B. An ihrem Beispiel spiegelt sich die Behindertenarbeit der letzten 20 Jahre. ULLA PATZ Tagsüber an den Heizkörper angebunden, nachts im Streckbett. Wurde der Zwölfjährige, nennen wir ihn Martin, losgelassen, schlang er sein Essen in sich hinein und begann danach, alles um sich herum zu zerstören. Bis er wieder angebunden wurde. Das war 1986. Martin war schon Jahre lang in der Psychiatrie und seine Eltern verzweifelt. Sie wollten diesen Zustand nicht länger hinnehmen und wandten sich an die Sonderschule in Gleisdorf. Sie und auch andere Eltern wollten ihre behinderten Kinder zuhause haben. Das war die Geburtsstunde der Chance B (B steht für die "zweite" Chance) in Gleisdorf, die heuer seit 20 Jahren arbeitet. Franz Wolfmayr, heute einer der zwei Geschäftsführer der "Gesellschaft für Arbeit und Bildung der Chance B GmbH", war von Anfang an mit dabei. Zunächst als Sonderschullehrer, der sich daran wagte, dieses, sowie zwei andere schwer behinderte Kinder aufzunehmen. Leben in der Psychiatrie Die Sonderschule besuchten damals vorwiegend geistig behinderte Kinder oder solche mit Lernschwächen. Der Großteil der behinderten Kinder aber lebte in der Psychiatrie oder zuhause. "Die Unterschiede zwischen den Kindern zuhause und in der Psychiatrie waren ursprünglich gar nicht so groß", sagt Wolfmayr, "erst die Jahre in der geschlossenen Anstalt machten ihn aus." Eltern hätten damals gar keine anderen Möglichkeiten als die Psychiatrie für ihre Kinder gesehen. Damals war die "Schulunfähigkeit" noch gesetzlich verankert. "Viele Eltern trauten sich nicht, gegen einen Primar aufzutreten, wenn dieser sagte: ,Das Kind kommt in die Psychiatrie!' Andere ließen ihre Kinder zuhause. Sie hatten Angst, wenn sie sich rührten, würde man ihnen die Kinder wegnehmen", erzählt Wolfmayr. Und plötzlich gab es in der Gleisdorfer Sonderschule eine Chance für diese Kinder. Schule und Schulbehörde standen hinter diesem Schulversuch. "Wir mussten umdenken", erinnert sich Wolfmayr. Wir mussten erforschen, wie Kinder lernen." Den Begriff "Schulunfähigkeit" definierten die Gleisdorfer um: als Unfähigkeit der Schule, mit solchen Kindern zu arbeiten. Das war die Geburtsstunde der "Jausenpädagogik". Wolfmayr: "Essen war für alle Kinder wichtig und rund um dieses Thema konnte man viel lernen: Was wird gegessen, wer kocht, kauft ein, wer wird zum Essen eingeladen, wie wird gekocht, damit es schmeckt. Das zu lernen war für die Kinder selbst wichtig, denn alle wollten gut essen." Diese Phase prägte die spätere Arbeit der Chance B in der Problembearbeitung: Beschreibung des Problemes, Ausarbeitung der theoretischen Grundlagen, Ausprobieren und sich gesetzlich absichern. Harter Beginn Die Anfänge jedoch waren hart. Etwa mit Martin. "Wenn er seine Anfälle hatte, musste ich ihn oft zwei, drei Stunden lang festhalten, um die anderen Kinder und ihn vor sich selbst zu schützen. Er hat das akzeptiert, wir haben gewartet, bis er selbst gemeint hat, es gehe nun wieder." Später kamen die Lehrer dahinter, dass diese "Anfälle" immer etwa zum gleichen Zeitpunkt passierten. Bis man dahinter kam, dass der Bub müde war. Martin hatte nicht gelernt, mit diesem Bedürfnis umzugehen. Ein Bett, am Flohmarkt gekauft, schuf Abhilfe. Bald aber stellte sich die Frage: Was tun diese Kinder nach der Schule? "Daraus hat sich dann der Rest entwickelt", sagt Wolfmayr. Der "Rest" sind Schulungsangebote und Strategien, behinderte Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Selbstständiges Leben 1990 wurde eine Arbeitsassistenz geschaffen, vom Verein über Kredite finanziert. Man begann mit der mobilen Therapie, der Frühförderung. Die Philosophie dahinter war und ist, behinderten Menschen und ihren Familien die Möglichkeit zu schaffen, zuhause zu bleiben und, so möglich, selbstständig zu arbeiten und zu leben. 2005 feierte Chance B 15 volle Jahre Bestand. Denn auch wenn der Verein schon 1986 gegründet wurde, "voll gestartet sind wir erst Jahre später", sagt Wolfmayr. Heute ermöglicht die Organisation mehr als 1200 Menschen, zuhause zu leben. Für Martin kam dies allerdings zu spät. Während er auf einen Wohnplatz wartete, lebte er wieder in der Psychiatrie. Er starb an Flüssigkeitsmangel