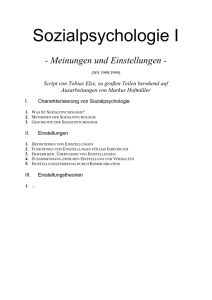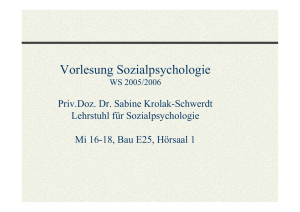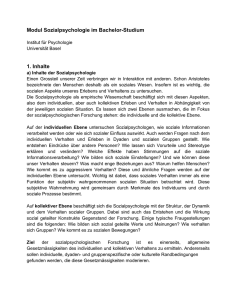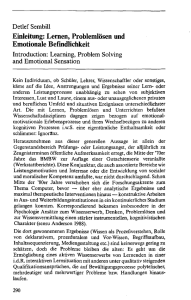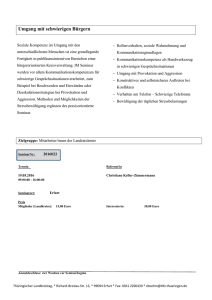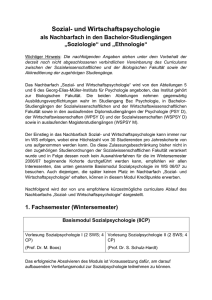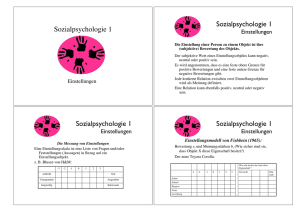soz2 - stinfwww
Werbung
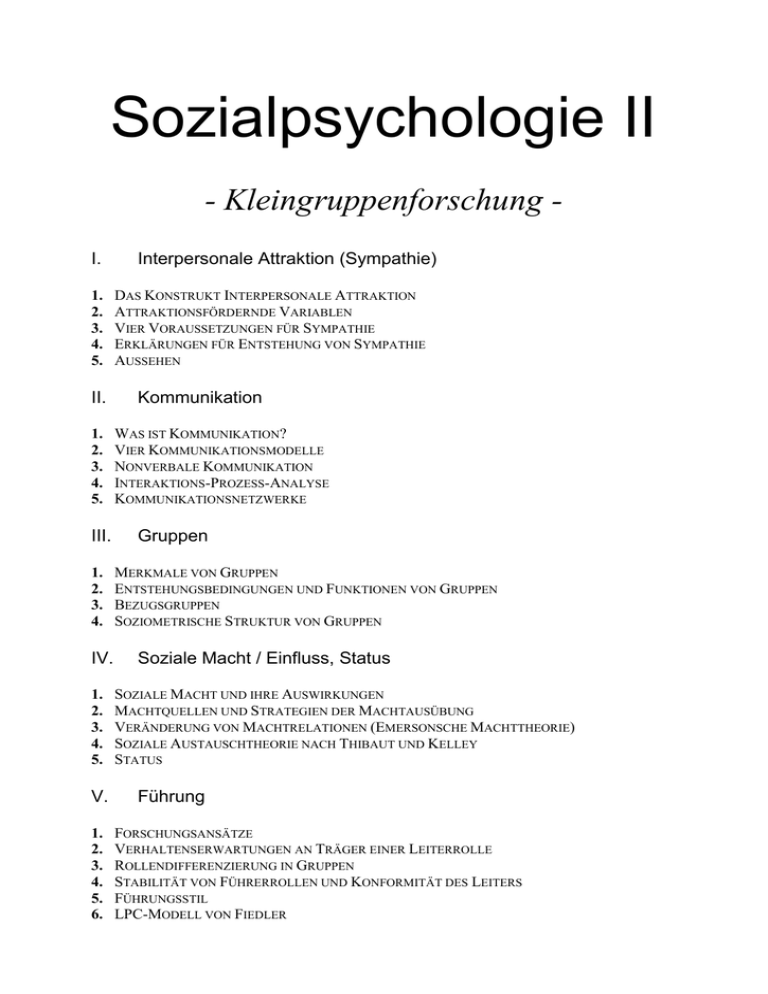
Sozialpsychologie II - Kleingruppenforschung I. 1. 2. 3. 4. 5. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2. 3. 4. IV. 1. 2. 3. 4. 5. V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Interpersonale Attraktion (Sympathie) DAS KONSTRUKT INTERPERSONALE ATTRAKTION ATTRAKTIONSFÖRDERNDE VARIABLEN VIER VORAUSSETZUNGEN FÜR SYMPATHIE ERKLÄRUNGEN FÜR ENTSTEHUNG VON SYMPATHIE AUSSEHEN Kommunikation WAS IST KOMMUNIKATION? VIER KOMMUNIKATIONSMODELLE NONVERBALE KOMMUNIKATION INTERAKTIONS-PROZESS-ANALYSE KOMMUNIKATIONSNETZWERKE Gruppen MERKMALE VON GRUPPEN ENTSTEHUNGSBEDINGUNGEN UND FUNKTIONEN VON GRUPPEN BEZUGSGRUPPEN SOZIOMETRISCHE STRUKTUR VON GRUPPEN Soziale Macht / Einfluss, Status SOZIALE MACHT UND IHRE AUSWIRKUNGEN MACHTQUELLEN UND STRATEGIEN DER MACHTAUSÜBUNG VERÄNDERUNG VON MACHTRELATIONEN (EMERSONSCHE MACHTTHEORIE) SOZIALE AUSTAUSCHTHEORIE NACH THIBAUT UND KELLEY STATUS Führung FORSCHUNGSANSÄTZE VERHALTENSERWARTUNGEN AN TRÄGER EINER LEITERROLLE ROLLENDIFFERENZIERUNG IN GRUPPEN STABILITÄT VON FÜHRERROLLEN UND KONFORMITÄT DES LEITERS FÜHRUNGSSTIL LPC-MODELL VON FIEDLER Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 VI. 1. 2. 3. 4. 5. Soziale Normen und Rollen BEGRIFFSKLÄRUNGEN FUNKTIONEN SOZIALER NORMEN SOZIALE ROLLEN ROLLENKATEGORIEN UND ROLLENKONFLIKTE ROLLENLERNEN VII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Konformität ZUM BEGRIFF DER KONFORMITÄT TECHNIKEN SOZIALER EINFLUSSNAHME KONFORMITÄTSKONTINUUM PROZESSE DER SOZIALEN ANSTECKUNG NONKONFORMITÄT EINFLUSS VON MINORITÄTEN VIII. Autoritätsgehorsam 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. X. 1. 2. 3. 4. 5. XI. DAS MILGRAM-EXPERIMENT WEITERE EXPERIMENTE ZUM MILGRAM-PARADIGMA GROUPTHINK (JANIS) KOLLEKTIVDENKEN: BEDINGUNGEN, CHARAKTER UND SYMPTOME MÄNGEL DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES BEI KOLLEKTIVDENKEN MASSNAHMEN GEGEN KOLLEKTIVDENKEN (JANIS) Aggression WAS IST AGGRESSION? AGGRESSIONSTHEORIEN GEWALTDARSTELLUNG IN MEDIEN INDIVIDUELLE FAKTOREN BEI AGGRESSION SOZIALE KONSTRUKTION VON GEWALT UND KOLLEKTIVE GEWALT WIE KANN MAN AGGRESSIONSBEREITSCHAFT VERMINDERN? Einzelleistung und Gruppenleistung TYPEN VON GRUPPENLEISTUNGEN MODELLVORSTELLUNGEN FÜR GRUPPENLEISTUNGEN SOZIALE LEISTUNGSAKTIVIERUNG ERKLÄRUNGEN FÜR ERREGUNG IN ANWESENHEIT ANDERER ANSTRENGUNGSVERMINDERUNG (SOZIALE FAULHEIT) Soziale Konflikte 1. ARTEN SOZIALER KONFLIKTE 2. EXPERIMENTELLE SPIELE 2 Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 3. PD-SPIEL 4. EINFLUSSVARIABLEN ZUR KOOPERATIONSBEREITSCHAFT 5. LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN SOZIALER DILEMMATA XII. 1. 2. 3. 4. 5. Soziale Motivation WAS IST HILFEVERHALTEN? BEREITSCHAFT ZUR INTERVENTION BEI «NOTFÄLLEN» EINFLUSSFAKTOREN FÜR HILFEHANDELN THEORIEN ALTRUISTISCHEN VERHALTENS GESELLUNGSSTREBEN (AFFILIATION) Literatur: ARONSON, E. (1994): Sozialpsychologie HERKNER, W. (1991): Sozialpsychologie MYERS, D. G. (1999): Social Psychology I. Interpersonale Attraktion (Sympathie) 1. DAS KONSTRUKT INTERPERSONALE ATTRAKTION beinhaltet: Verhaltensdispositionen (Einstellung, Gefühle gegenüber anderen etc.) tatsächliche Verhaltensweisen (Zuwendungsreaktionen, z. B. Blickkontakt; manifeste Wahlen, z. B. Einladungen) bestehende Sozialbeziehungen (z. B. Ehe) externe Merkmale (z. B. Aussehen, sozialer Status) 2. ATTRAKTIONSFÖRDERNDE VARIABLEN a) räumliche Erreichbarkeit b) soziale Erreichbarkeit (gemeinsame Herkunft, Religion, Alter, ...) c) körperliches Aussehen (Schönheit) 3. VIER VORAUSSETZUNGEN FÜR SYMPATHIE a) Räumliche Nähe Untersuchung von FESTINGER: Wie entwickeln sich Freundschaften in einem Studentenwohnheim? je größer die räumliche Nähe, desto höher die Wahrscheinlichkeit (vgl. auch MYERS, S. 429) b) Kompetenz als kompetent eingeschätzte Personen erscheinen i. a. attraktiver ARONSON, WILLERMAN & FLOYD (1966): Vpn. wurde Tonbandaufzeichnung von 4 Personen vorgespielt: (A) nahezu vollkommene Person (B) nahezu vollkommene Person, der ein Missgeschick passiert 3 Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 4 (C) durchschnittliche Person (D) durchschnittliche Person, der ein Missgeschick passiert Sympathiebeurteilungen: B > A > C > D «Missgeschickeffekt» DEAUX (1972): Effekt am stärksten bei Männern Konkurrenzdruck? ARONSON, HELMREICH & LEFAN (1970): Männer mit mittlerem Selbstwertgefühl bevorzugen B, Männer mit geringem SWG (kein Konkurrenzdruck) A (vgl. ARONSON, S. 360 f.) c) Gelegenheit zur Interaktion MONGE & KIRSTE (?) (1980): Studien in Betrieben häufigere Unterhaltung mit Menschen, die man häufiger trifft Gelegenheit, gemeinsame Einstellungen kennenzulernen (vgl. auch MYERS, S. 430) d) Antizipation von Interaktion DARLEY & BERSCHEID (1967): Vpn. wurden uneindeutige Informationen über 2 verschiedene Frauen gegeben, von denen mit einer ein persönliches Gespräch erwartet wurde letztere sympathischer eingeschätzt (vgl. MYERS, S. 430) e) Vertrautheit, Häufigkeit der Darbietung ZAJONC (1968, 1970): ließ angebliche türkische Wörter danach einschätzen, wie positiv ihre Bedeutung sei am häufigsten dargebotene sympathischer eingeschätzt zahlreiche Belege dafür aus ähnlichen Experimenten (vgl. MYERS, S. 431 ff.) aber: bei unaufhörlicher Wiederholung ohne Unterbrechung durch andere Reize gegenteiliger Effekt ebenso, wenn Reiz ursprünglich negativ statt neutral besetzt war 4. ERKLÄRUNGEN FÜR ENTSTEHUNG VON SYMPATHIE 4.1. ÄHNLICHKEIT DER EINSTELLUNGEN bei Freunden und Partnern Ähnlichkeit der Einstellung r = .20 bis .30 Feldstudie von NEWCOMB (1961) in einem Studentenwohnheim nach 13 Wochen des Zusammenlebens war die Wahrscheinlichkeit von Freundschaften am höchsten bei ähnlichen Einstellungen (MYERS, S. 443) BYRNE & NELSON (1965): Sympathieeinschätzungen von fiktiven Personen um so positiver, je größer die (manipulierte) Übereinstimmung der Einstellungen Wechselbeziehung Ähnlichkeit/Vertrautheit – Sympathie jemand ist sympathisch, weil ähnlich, dadurch wird er noch sympathischer, also noch ähnlicher etc. Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 5 Vertrautheit wahrgenommene Vertrautheit Sympathie Ähnlichkeit wahrgenommene Ähnlichkeit Erklärungsansätze: a) balancetheoretisch (HEIDER, NEWCOMB) ähnliche Einstellung A B + + X Sympathie A + B + + X b) Bestätigung durch Übereinstimmung ??? c) Antizipation von Sympathie andere Person sympathisch, wenn man glaubt, sie würde einen selbst mögen d) soziale Austauschtheorie Ähnlichkeit in Einstellung bedeutet hohe Belohnungen bei gleichzeitig geringen Kosten für die Interaktionspartner e) dissonanztheoretisch Einstellung ändern, um Dissonanzen zwischen Bewertung der Person und deren Einstellung zu vermeiden f) lerntheoretisch (assoziationistisch) Behauptung von BERSCHEID & WALSTER (1978): andere Person sympathisch, wenn ihr Verhalten belohnend ist und ihre Anwesenheit mit Belohnung assoziiert wird (auch wenn diese Anwesenheit nur zufällig ist) GRIFFITT (1970): Vpn. treffen Fremde in angenehmer vs. unangenehmer Umgebung Urteil sympathischer, wenn angenehme Umgebung LEWICKI (1985): ließ zwei Bilder von Personen nach Freundlichkeit einschätzen Ergebnis 50 : 50 Vl. in folgendem versuch ähnelt einer der beiden Personen wenn Vl. freundlich diese Person sympathischer wenn Vl. unfreundlich unsympathischer (vgl. MYERS, S. 450) Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 6 4.2. UNÄHNLICHKEIT WINCH (1958): Komplementäre Bedürfnisse von Partnern (z. B. extra- + introvertiert) ergänzen sich („Gegensätze ziehen sich an.“) sagt nichts darüber aus, welche Bedürfnisse zueinander komplementär sind konnte empirisch kaum bestätigt werden (vgl. Myers, S. 445) 5. AUSSEHEN die Rolle des Aussehens für Sympathie wird oft geleugnet aber: viele gegensätzliche Befunde WALSTER: Experiment nach einer Einführungswoche für Neustudierende sollte ein Tanzball veranstaltet werden Studierende mussten angeben, nach welchen Kriterien sie ihren Tanzpartner auswählen würden Ergebnis: nur eine Variable stellte sich als wichtig heraus: das Aussehen ANDERSON & BEM (1982): Frauen legen genauso viel Wert auf das Aussehen bei Männern wie Männer bei Frauen (geben dies aber meist nicht zu) EAGLY et al. (1991): HALO-Effekt: attraktiv intelligent, erfolgreich etc. Korrelationen zwischen Aussehen und erwünschten Charaktereigenschaften, denn attraktive Kinder werden besser behandelt Rückkopplungseffekt: höheres Selbstbewusstsein etc. Stereotype schon in früher Kindheit: gute Märchenfiguren sind immer schön Karen DION (1972): Experiment im Kindergarten Ergebnis: «Bart-Simpson-Effekt» (MYERS, S. 436): unscheinbare Kinder werden nicht so warm und entgegenkommend behandelt wie attraktive self-fulfilling prophecies FRIEZE, OLSON & RUSSELL (1991): linearer Zusammenhang zwischen Jahresverdienst und Attraktivität (bei Männern und Frauen) Attraktivität und Gerichtsverhandlungen: EFRAN (1974): simulierte Gerichtsverhandlungen je attraktiver, desto weniger häufig schuldig gesprochen (vgl. MYERS, S. 613) bei Sexualdelikten: Täter für gefährlicher gehalten, wenn sie weniger attraktiv sind DOWNS & LYONS (1991): Untersuchung von Richtersprüchen in Texas ließen zuvor Polizeieskorten Attraktivität der Angeklagten einschätzen Ergebnis: linearer Zusammenhang: je attraktiver, desto niedriger Geldstrafe (!) (vgl. MYERS, S. 614 f.) MACK & RAINEY (1990): wenn Bewerber / Prüflinge attraktiver Qualifikation als höher bewertet (vgl. MYERS, S. 434 – 438) Das Matching-Phänomen: (MYERS, S. 435 f.) Partner haben oft etwa gleiches Niveau an Attraktivität auch zwischen Hundehaltern und ihren Hunden Die soziale Austauschtheorie: länger andauernde Sozialbeziehungen haben ausgewogenes Kosten-Nutzen-Verhältnis für beide Partner, da sie von gleicher Attraktivität sind Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 7 wenn ein Partner deutlich attraktiver: Status und Geld können kompensatorisch wirken (MYERS, S. 435 f.) Bedeutsamkeit biologischer Faktoren für die Wirkung körperlicher Attraktivität: LANGLOIS et al. (1987): bereits 2-3 Monate alte Säuglinge haben Präferenz für attraktive Gesichter (längere looking-time) (MYERS, S. 436) Interindividuelle Schönheitsideale: LONGLOIS & ROGGMAN (1990): Kompositgesicher (zusammengesetzt aus vielen verschiedenen Einzelgesichtern) gelten als attraktiver als der größte Teil der einzelnen Gesichter, aus denen sie zusammengesetzt sind kulturvergleichende Studien: schönstes weibliches Gesicht in Asien und Europa fast gleich, doch nicht männliches Durchschnittsgesicht [habe ich in dieser Form leider nirgends gefunden...] (MYERS, S. 438 f.) «Soziobiologische» Schönheitsideale: Frauen: Gesundheit, Fruchtbarkeit Männer: Status, Einfluss, Stärke; Fleiß und Ehrgeiz II. Reproduktionsfähigkeit garantiert Überleben der Familie garantiert Kommunikation 1. WAS IST KOMMUNIKATION? Kommunikation ist der Austausch von Informationen mit Hilfe eines Zeichensystems (z. B. Sprache, aber auch nonverbale Zeichensysteme). Sie stellt die wichtigste Form menschlicher Interaktion dar. Auffassung von WATZLAWICK: jegliches Verhalten ist Kommunikation, also alle Wechselbeziehungen zwischen Organismen Gleichsetzung von Kommunikation und Verhalten; jede Kommunikation beeinflusst Verhalten 2. VIER KOMMUNIKATIONSMODELLE a) Traditionelles Kommunikationsmodell nach SHANNON & WEAVER (1949) Signal Informationsquelle Transmitter Empfänger aus Nachrichtentechnik Rauschquelle Bestimmungsort Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 8 Sender und Empfänger müssen nach den gleichen Kodierungsregeln (semantisch und syntaktisch) vorgehen, um sich zu verstehen b) Sprachmodell von K. BÜHLER (modifizierte Fassung) 3 Funktionen von Sprache: Ausdrucksfunktion Sender gibt Auskunft über momentane Befindlichkeit («Es ist so heiß hier...») Darstellungsfunktion Sachverhalt wird dargestellt. («Die Temperatur ist 25 °C.») Appellfunktion implizite Aufforderung an den Empfänger («Machen Sie doch mal das Fenster auf.») alle drei Funktionen sind in jeder Mitteilung enthalten, wenn auch in unterschiedlichem Maße Rückkopplungsschleife (Feedback): Sender achtet darauf, wie seine Mitteilung vom Empfänger verstanden wurde Kommunikation ist immer vom jeweiligen Kontext abhängig, dessen sich Sender und Empfänger bewusst sein müssen Kommunikationsprobleme könnten dadurch zustande kommen, dass beide sich in unterschiedlichem Kontext bewegen... c) Eine pragmatische Theorie der Kommunikation nach WATZLAWICK 5 Axiome: Man kann nicht nicht kommunizieren! Verhalten = Kommunikation (also auch Schweigen) Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. knüpft an Bühler an Inhaltsaspekt Beziehungsaspekt Mitteilungen und Infos über einen drückt aus, wie der Sender eine bestimmte Sachverhalt Mitteilung verstanden wissen möchte wahre oder falsche, gültige oder ungültige hier Missverständnisse möglich Infos persönliche Stellungnahme des Senders entscheidbar oder unentscheidbar nötig, wie er seine Mitteilung interpretiert wissen möchte Interpretation des Empfängers abhängig von: Beziehung Sender – Empfänger Merkmalen der Stimme (Tonfall) nonverbalen Merkmalen (Mimik, Gestik) sozialem Kontext (Pragmatik etc.) In der Kommunikationsbeziehung zweier Partner nimmt jeder Partner seine Interpunktion des Kommunikationsablaufs vor. Interpunktion = subjektive Ursachenzuschreibung Strukturierung des Kommunikationsprozesses: jede Äußerung eines Partners führt zu einer Gegenäußerung des anderen Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 9 Interpunktionsprobleme auflösen durch Metakommunikation Menschliche Kommunikation bedient sich sowohl digitaler als auch analoger Modalitäten digitale Modalität willkürliche Zeichen, die man per Übereinkunft für bestimmte Inhalte festsetzt (z. B. Wörter in verschiedenen Sprachen, die aber beliebig gesetzt werden können) Bsp. PC: Programmiersprache wählen, die sowohl ich also auch Computer versteht repräsentiert den Inhaltsaspekt analoge Modalität betrifft Beziehungsaspekt Beziehung über Analogien (Gesten etc.) ausdrücken nicht willkürlich Ähnlichkeitsrelation Geste (auf den Tisch hauen) – Stimmung (Wut, Ärger) Geltungsbereich weitgehend universell Bsp.: Piktogramme Kommunikation ist entweder symmetrisch oder komplementär Kernanliegen von Watzlawicks Theorie: Kommunikationsstörungen entstehen, wenn Inhalts- und Beziehungsaspekt inkongruent Spezifische Doppelbindung: «Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.» kann zu Schizophrenie führen Paradoxien z. B. Aufforderung: «Sei spontan!» Kommunikationsregeln: in Kursen aufgestellt Kritik an WATZLAWICK: Vernachlässigung des sozialen Kontexts d) Das kooperative Prinzip nach GRICE (1975) als allgemeine Grundlage der Unterredung Konversationsbeitrag so gestalten, wie Zweck und Richtung der Unterredung es erfordern beide Kommunikationspartner sollen wissen, welche Richtung Unterredung hat und welchen Kontext 4 Maximen: Maxime der Quantität Sage nichts, was der Partner schon weiß! Maxime der Qualität Sage nichts, wofür dir ausreichende Belege fehlen! Sage nichts, von dem du glaubst, dass es falsch ist! Maxime der Relevanz Sage nur für das gemeinsam vereinbarte Thema relevante Dinge! Maxime der Klarheit Sage es einfach, kurz und verständlich! 3. NONVERBALE KOMMUNIKATION Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 10 = nichtsemantische Sprachaspekte = paralinguistische Sprachmerkmale (z. B. Tonfall, Höhe, Lautstärke etc.) ca. 70% der Kommunikation nonverbal a) Funktion nonverbaler Aspekte bei der Kommunikation als diagnostischer Hinweis auf Persönlichkeitsmerkmale und Grundlage für die Personenbeschreibung zur Steuerung des Kommunikationsprozesses Eröffnung: Blickzuwendung etc. Aufrechterhaltung: Anblicken, Kopfnicken etc. Beendigung: Abwenden des Blickes etc. als Ausdruck / Indikator emotionaler Zustände (z. B. vor Angst zittern) als Beziehungsinformation an den Kommunikationspartner (z. B. ob man ihn respektiert) b) Beispiele für nonverbale Hinweisreize (cues) stimmliche Merkmale (Tonlage, Lautstärke etc.) Körperkontakt (auch kulturell verschieden) Sprech- und Sitzabstand Sitzrichtung: gegenüber: Indikator für Disput nebeneinander: Kooperation in rechtem Winkel: sachliche Kommunikationssituation, Gespräche Körperhaltung (Ausdruck von Status, momentanem Gefühlszustand etc.) Kopfnicken / -schütteln Blickrichtung / -kontakt Geruch (sexueller Signalreiz, Pheromone, unbewusst), Heben der Augenbrauen, ... Inkonsistenzen zwischen Inhalt und nonverbalen Aspekten führen zur Verunsicherung des Partners 4. INTERAKTIONS-PROZESS-ANALYSE BALES (1956) Versuch, den Kommunikationsprozess in Gruppen zu analysieren (live) Beobachtungsverfahren mit Kategoriesystem (kein Rating mit verschiedenen Ausprägungen) methodische Problematik: genaue Abgrenzung der Kategorien muss realisiert werden wenn jeder Beobachter einen Teil der Kategorien übernimmt: Vl-Effekte nicht auszuschließen Probleme: a) Auswahl und Anzahl der Kategorien (decken sie ohne Überschneidungen den ganzen Bereich ab?) nonverbaler Bereich fehlt bei BATES völlig! b) Umfang der Kategorien (nicht zu global oder zu eng) Typische Ergebnisse zur Verteilung der kommunikativen Akte auf einzelne Gruppenmitglieder: Individuen, von denen am häufigsten Kommunikation ausgeht, a) sind am häufigsten Adressaten einer Kommunikation Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 11 b) wenden sich mehr an die Gruppe c) haben die meisten Äußerungen in den Kategorien «Informationen geben», «Meinungen äußern» etc. Individuen, von denen am seltensten Kommunikation ausgeht, a) erhalten wenig Kommunikation b) wenden sich mehr an Einzelne c) haben die meisten Äußerungen in den Kategorien «Zustimmung / Widerspruch», «Ersuchen um Informationen» etc. bei wachsenden Gruppengrößen: Gefälle zwischen beiden nimmt zu [...] 5. KOMMUNIKATIONSNETZWERKE LEAVITT, BAVELAS UND FOLGEEXPERIMENTE (1950 ff.) bestimmte künstlich vorgegebene Kommunikationswege Kommunikationsstrukturen unterscheiden sich im Zentralitätsgrad verschiedene Netzwerke (Beispiele): Kreisstruktur dezentralisiert alle Mitglieder haben in gleicher Weise Zugang zu allen anderen und zu Informationen Vollkreis direkte Kommunikation zwischen allen Mitgl. 8.0 4.6 4.6 Stern (bzw. Rad) alle anderen Mitglieder müssen über eines gehen, um an Info zu kommen total zentralisiert 4.6 4.6 Zahlen: Zentralitätsindices (alle möglichen Wege / Anzahl der Wege, um alle anderen zu erreichen) Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 Ergebnisse der Untersuchung: Auswirkungen auf Gruppenleistung (Zeit, die Gruppe braucht, um Aufgabe zu lösen): einfache Aufgaben zentrale Gruppen besser schwere Aufgaben dezentralere Gruppen besser Erklärung: Theorie der Sättigung bei schweren Aufgaben ist zentrales Mitglied überfordert Auswirkungen auf Zufriedenheit: im Schnitt Mitglieder der dezentralen Gruppen zufriedener zentrale Mitglieder zufriedener als andere Erklärung: zentrales Mitglied ist unabhängiger, hat meiste Anerkennung etc. (vgl. HERKNER, S. 481 f.) III. Gruppen 1. MERKMALE VON GRUPPEN a) Wir-Gefühl Gefühl von der eigenen Identität als Gruppe, empirisch umschreibbar (durch Bezugsgruppen) b) (unmittelbare) Interaktion zwischen den Mitgliedern (im weiteren Sinne, vgl. auch WATZLAWICK) c) Rollenverteilung spezifische Erwartungen an andere Personen, die sich spezifisch in Gruppe bewegen d) gemeinsame Normen Erwartungen, die spezifisch sind für die Gruppe und die für alle Gruppenmitglieder gelten e) Gruppe als Prozess (?) 2. ENTSTEHUNGSBEDINGUNGEN UND FUNKTIONEN VON GRUPPEN a) äußere Einflüsse (z. B. Bedrohung von außen) b) Erreichung externer Ziele durch gemeinsame Gruppenaktivitäten c) Schutz nach außen, Sicherheit (soziale Sicherheit) nur bei menschlichen Gruppen: d) Gruppenaktivitäten als solche attraktiv (z. B. Freizeit-, Sportgruppen) e) Interaktionsprozess mit anderen in sich selbst befriedigend f) Bestätigung durch andere (soziale Vergleichsprozesse) 3. BEZUGSGRUPPEN Bsp.: Gruppe von Anhängern einer bestimmten Musikrichtung in der Regel keine formelle Mitgliedschaft (Mitglieder wissen oft nichts voneinander), aber Identifikation Funktionen: Vergleichs- und Bewertungsfunktion (Selbsteinschätzung im Vergleich mit anderen Mitgliedern der Bezugsgruppe) normative Funktion (Übernahme von Normen der Bezugsgruppe) «negative Bezugsgruppen»: Gruppen, denen man nicht angehören will und von denen man sich abgrenzt Übernahme von Einstellungen, die zu jenen konträr sind multiple Bezugsgruppen: Zugehörigkeit zu mehreren Bezugsgruppen möglich 12 Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 13 bei unvereinbaren Normen derer Konflikte (z. B. 2. Generation von Einwanderern Normen der eigenen Kultur gegensätzlich zu denen derer, der man jetzt angehört) Bezugsgruppenproblem – Untersuchung FRINDLE & FUNKE (1995): «politische Landkarte» von Jugendkulturen Ausmaß extremer Orientierungen korreliert mit Gruppenzugehörigkeit 4. SOZIOMETRISCHE STRUKTUR VON GRUPPEN 4.1. WAS IST SOZIOMETRIE? soziometrische Struktur = Affektstruktur Verteilung der Zu- und Abneigungen zwischen den Gruppenmitgliedern Soziometrie: Verfahren, um die Affektstruktur in Gruppen zu erfassen (Sympathie-, Kommunikations-, Machtstruktur) Begründer: MORENO (1934): «Who shall survive?» 4.2. DURCHFÜHRUNG EINER SOZIOMETRISCHEN ERHEBUNG (gut durchführbar in Klassen, Kindergärten, Arbeitsgruppen etc.) in der Regel Fragebogenerhebung Bsp., um Sympathiestruktur zu erfassen: «Nenne diejenigen 5 Mitglieder, mit denen du am liebsten zusammen bist.» anschließend: a) Wahlkriterien (Was will man erfassen?) b) begrenzte oder unbegrenzte Wahlen c) nur positive oder auch negative Wahlen d) Wahlen innerhalb einer Gruppe oder auch nach außen e) Erhebungstechnik: Partnerwahlverfahren (Fragen nach dem Typ wie obiges Bsp.) Rangfolge / Gewichtung (geht nur bei kleineren Gruppen) Paarvergleich Ratingverfahren 4.3. AUSWERTUNG (bezogen auf Partnerwahlverfahren) a) graphische Darstellung: Soziogramm Beispiel: B F C A G H D E Buchstaben: Gruppenmitglieder gerichtete Pfeile: Wahlbeziehung, Doppelpfeile: gegenseitige Wahlen, gestrichelte Pfeile: Ablehnung im Bsp.: D, E und H soziometrische Clique (wählen sich alle gegenseitig) C: isoliert; G: «soziometrischer Star» Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 14 Probleme: Anordnung der Personen völlig willkürlich durch bestimmte Anordnung kann man bestimmte Gruppenstruktur suggerieren b) Matrixdarstellung: Soziomatrix äquivalent zu a) Zeilen: Wähler, Spalten: Gewählte 1 gewählt; 0 nicht gewählt; ggf. – 1: Ablehnung obiges Beispiel: A B C D E F G H A 1 B 1 - C D E - 1 1 1 - 1 1 2 0 F 1 1 3 1 1 2 2 G 1 1 1 1 H 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 5 2 Anwendung mathematischer Verfahren (FA, MDS, CA) zur Identifikation informeller Gruppierungen Nachteil: Cliquenstrukturen nicht so gut sichtbar c) Zielscheibensoziogramm zielscheibenartige Anordnung; nach innen hin nimmt Häufigkeit der Wahlen zu Ergänzungen: vgl. auch Experiment von SHERIF: 2 Gruppen von Jugendlichen im Ferienlager anhand von Soziogrammdarstellung 2 verschieden zentralisierte Gruppen feststellbar Indices = Kennwerte von Personen / Gruppen / Teilgruppen Anzahl erhaltener Wahlen z. B. mittlerer Wahlstatus von A = ––––––––––––––––––––––– N–1 Anzahl gegenseitiger Wahlen Gruppenkohäsion (Zusammenhalt) = ––––––––––––––––––––––––––––––––– ½N(N – 1) Wahlverteilung wird statistisch mit Zufallsverteilungen verglichen 4.4. RELIABILITÄT UND VALIDITÄT a) Reliabilität = Stabilität über die Zeit Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 15 Korrelationen zwischen .45 und .90 abhängig von Zeitraum, Alter, Dauer des Bestehens von Gruppen (z. B. Schulklassen), Konsequenzen für Befragte (!) b) Validität geringe oder Nullkorrelationen zwischen soziometrischen Wahlen (Kontaktwünschen) und tatsächlichem Verhalten (Freunschaften) zu nicht unbeträchtlichem Teil Verzerrungen 4.5. WOMIT HÄNGT DER WAHLSTATUS ZUSAMMEN? hoher soziometrischer Wahlstatus hängt unter anderem zusammen mit: Schul- und Studienerfolg sozioökonomischem Status Kommunikationshäufigkeit emotionaler Stabilität Selbstvertrauen höheren Werten in Intelligenztests Aussehen IV. Soziale Macht / Einfluss, Status 1. SOZIALE MACHT UND IHRE AUSWIRKUNGEN 1.1. WAS IST SOZIALE MACHT? Relation zwischen zwei Personen A und B (keine Eigenschaft einer Person) Macht von A über B = PAB: Möglichkeit von A, das Verhalten von B zu beinflussen / zu kontrollieren Einfluss: tatsächlich ausgeübte Macht (beobachtbar) Machtrelationen sind komplementär (PAB und PBA) beide haben Macht über den jeweils anderen Ausmaß der Macht in einer Beziehung hängt ab von: a) Verfügbarkeit von Machtmitteln / -quellen b) der Abhängigkeit des Partners von diesen Machtquellen (A ist abhängig von den Machtquellen von B B hat Macht über A) c) den Handlungsalternativen des Partners 1.2. AUSWIRKUNGEN SOZIALER MACHT a) Imitationslernen (Mächtige häufig imitiert, weil beliebt und respektiert) b) Einstellungsänderung (mächtige Kommunikatoren erzeugen eher eine Einstellungsänderung) c) in einer Gruppe: stärkere Beteiligung an der Kommunikation höhere Beliebtheit (werden auch häufiger gewählt) Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 16 2. MACHTQUELLEN UND STRATEGIEN DER MACHTAUSÜBUNG 2.1. EINTEILUNG DER MACHTQUELLEN NACH FRENCH UND RAVEN (in Zweierkonstellationen: Paare mit ungleichen Machverhältnissen) 5 Machtquellen: a) Belohnungsmacht A spricht positiven Verstärker (Lob, Anerkennung) aus B nimmt A dementsprechend wahr (also keine objektive Verhaltensmöglichkeit von A, lediglich Wahrnehmung von B, dass A dazu in der Lage wäre) b) Bestrafungsmacht bewirkt äußere Anpassung, aber keine Dauerhafte Verhaltensänderung c) Identifikationsmacht (Bezugspersonenmacht) B nimmt A als ähnlich bzw. attraktiv wahr will sich mit A identifizieren funktioniert ohne Verstärker fragile, temporäre Machtwirkung (wirkt, solange A attraktiv ist) d) Expertenmacht A wird als mit bestimmten Fähigkeiten / Kenntnissen ausgestattet wahrgenommen B sieht sich als abhängig von A Bsp. Frau kocht, Mann kann nicht kochen abhängig e) «Legitime» Macht (Legitimierte Macht) B ist aufgrund seines Normen- und Wertesystems von A abhängig beide (A und B) erkennen an, dass A Macht hat und sie verwendet Bsp. Schüler und Lehrer 2.2. ALLTAGSSTRATEGIEN DER MACHTAUSÜBUNG a) direkte Machtausübung übliche Strategien im Alltag entsprechend obigen Machtquellen: Versprechungen, Drohungen, moralische Appelle, Erhöhung der eigenen Attraktivität etc. b) indirekte Machtausübung «legitime» Macht (bezieht sich auf soziale Rollen und Normen) jemanden in bestimmte Rolle drängen («Du als Psychologe musst das doch verstehen!») sich selbst in eine Rolle werfen («Ich als dein Partner habe doch ein Recht darauf.») Appell an Normen («Ich habe so gehandelt; nun handle du entsprechend...») Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 17 unabhängig davon: verschiedene Techniken der sozialen Einflussnahme (z. B. «foot-inthe-door») 3. VERÄNDERUNG VON MACHTRELATIONEN (EMERSONSCHE MACHTTHEORIE) Abhängigkeit: DBA := PAB (dependency – power) ist abhängig von der Wichtigkeit der entsprechenden Machtquellen für B, über die A verfügt wenn B eine Drittperson kennt, die A’s Machtquellen (z. B. Fähigkeiten) auch hat DBA (Un-)Gleichgewicht von Machtrelationen: (Balance-Theorie) Gleichgewicht: PAB = DBA = PBA = DAB soziales System Ungleichgewicht: z. B. PAB < PBA DBA < DAB A versucht, durch Strategien Gleichgewicht herzustellen Strategien zum Abbau von Machtgefällen: a) teilweise Lockerung der Beziehung («Ich muss nicht im Internet surfen, ich kann auch lesen.») b) Aufnahme alternativer Beziehungen («Ich gehe zum Nachbarn, der kann das sowieso besser als Du.») c) Erhöhung der Abhängigkeit des Mächtigen d) Koalitionsbildung («Mama hat gesagt...» Koalition gegen Papa) aber: Theorie von EMERSON schwierig empirisch zu überprüfen 4. SOZIALE AUSTAUSCHTHEORIE NACH THIBAUT UND KELLEY universell anwendbar (auf jede Interaktion) Interaktion = Austausch von sozialen «Kosten» und «Belohnungen» soziale Kosten: Angst in Partnerschaft (Gefühl, dass man vom Partner abhängig ist, dass einem Belohnungen entgangen sind, direkte Sanktionen des Partners, ...) soziale Belohnungen: Bekräftigung eigener Einstellungen, Befriedigung eigener Bedürfnisse, Dissonanzreduktion (feststellen, dass man ähnliche Meinung hat) Ertrag = Belohnung – Kosten Ertrag verglichen mit 2 Komponenten: a) mit dem subjektiven Standard (comparison level, CL) = Vergleichsniveau b) mit dem Vergleichsniveau für Alternativen (CLAlt) (Ertrag anderer sozialer Beziehungen) Ertrag entscheidet, ob man sich trennt oder nicht Anwendung des Modells von THIBAUT und KELLEY (1959): Auszahlungsmatrix: Beispiel: beide Partner A und B mögen Musik, aber Tanz nicht so sehr; sie sind verheiratet und wollen den Abend gemeinsam verbringen Zahlen: Wert, den das eigene Verhalten für den einen Partner hat, wenn der andere Partner ein bestimmtes Verhalten wählt Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 Konzert Konzert B +3 +3 18 Tanzen -2 +1 A Tanzen +1 -2 0 0 Typen sozialer Machtrelationen: a) Schicksalskontrolle (Ergebniskontrolle) A hat Schicksalskontrolle über B B ist vollständig von A abhängig, egal was B macht B1 A1 B B2 + + – – A A2 b) Verhaltenskontrolle A hat Verhaltenskontrolle über B wenn A eine Alternative wählt, bleibt B nur noch eine bestimmte andere B1 A1 B B2 + – – + A A2 Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 19 Problem der Theorie: es ist von vornherein nicht offensichtlich, in welchem Ausmaß das Ergebnis positiv oder negativ für welchen Partner ist Zuordnung von Werten ist von subjektiven Bewertungen abhängig theoretisch: Möglichkeit der gegenseitigen Ergebniskontrolle, so dass für beide positiver Ertrag entsteht (vgl. HERKNER, S. 396 ff.) 5. STATUS = Ansehen einer Person in einer Gruppe auf Grund geteilter Wertvorstellungen d. h.: den Status gibt es nicht; immer abhängig von Gruppennormen abgeleitet von: a) sozialer Kategorie (z. B. Alter, Geschlecht) ältere und weibliche Personen in unserer Gesellschaft niedrigerer Status b) eingenommener Position (Beruf, Rolle) c) Ausstattung, Fähigkeiten und Fertigkeiten (materiell und immateriell) Statusmerkmale: abhängig von Werten und Bedürfnissen einer Gruppe Statussymbole: Merkmale, die häufig mit hohem Status zusammen auftreten Status in Gruppen: Statusstruktur: Verteilung des individuellen Status der Mitglieder einer Gruppe (Statushierarchie, -gefälle) Status und Konformität: bei hohem Status geringste Konformität von Nöten, bei niedrigem vice versa Status und Kommunikation: hoher Status häufigerer Empfang von Kommunikation Personen mit gleich hohem Status kommunizieren häufiger untereinander als mit Personen mit anderem Status Vermeidung von Kommunikation bei Statusunsicherheit Inhalt der Kommunikation: Gruppenführer gibt Informationen, Statusniedere suchen diese (deren eigene Infos und Vorschläge weniger beachtet) V. Führung 1. FORSCHUNGSANSÄTZE a) Führung als Persönlichkeitsmerkmal Suche nach Persönlichkeitsmerkmalen von «Führern» und «Geführten» Ergebnis: erfolglos Idee, die nur im Alltag verbreitet ist b) Führung als Rollenverhalten Führung = Übernahme einer Leiterrolle oder Zuschreibung einer solchen Rolle an ein Gruppenmitglied per Wahl oder einfach durch Akzeptanz Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 20 abhängig von jeweils zu bewältigenden Aufgaben und den Erwartungen an den Leiter 2. VERHALTENSERWARTUNGEN AN TRÄGER EINER LEITERROLLE 2 Gruppen von Erwartungen: a) aufgabenbezogen Erreichung von Gruppenzielen z. B. Vorschläge unterbreiten, Zwischenziele bewerten, Lösungen anbieten etc. b) sozial-emotional Wahrung des Gruppenzusammenhalts z. B. andere ermutigen, Spannungen abbauen, angenehmes soziales Klima schaffen etc. Zusammenhang mit Konzept der Kommunikation: Fähigkeit, sich verbal ausdrücken zu können Voraussetzung für Führerrolle 3. ROLLENDIFFERENZIERUNG IN GRUPPEN a) Differenzierung zwischen Leiter und Nicht-Leiter graduelle Abstufung im Leiterverhalten: alle Menschen führen irgendwann Leiterfunktionen aus, wenn auch in unterschiedlichem Maße Funktionsteilung, Verhaltensspezialisierung b) Rollendifferenzierung von Leiterfunktionen Divergenztheorem von BALES & SLATER (1955): 2 Leiterrollen Der Tüchtige (aufgabenorientiert) Der Beliebte (sozial-emotional) in vielen Kulturen und Gesellschaften getrennt ausgeübt, z. B. König + Premierminister oder Häuptling + Medizinmann BALES & SLATER (1955): in jeder Gruppe kommt es zwangsläufig zu einer Divergenz von Personen Experiment dazu: willkürlich gebildete Gruppe von Vpn soll Problem lösen (Ideen zur Senkung der Arbeitslosigkeit) Herauskristallisierung von Mitgliedern, die tatkräftig sind, später von einem Mitglied, das auf sozial-emotionale Bedürfnisse zielte aber: Trennung nicht zwangsläufig nur, wenn Leiter zu stark auf Lösungen drängt und sozial-emotionale Aspekte vernachlässigt, ist zweiter Leiter nötig Divergenz tritt in bestimmten Situationen auf, aber nicht zwangsläufig Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 21 4. STABILITÄT VON FÜHRERROLLEN UND KONFORMITÄT DES LEITERS wenn Person Leiterrolle übernommen hat, behält sie diese auch längere Zeit Leiterrollen sind stabil. Indiz, dass Führung doch Persönlichkeitseigenschaft ist? andere Gründe: a) Gewöhnung b) Training von Leiterfunktionen durch Ausübung der Rolle (Rollenlernen) c) Motivation, den Leiterstatus zu behalten, da dieser eine Reihe von Vorteilen bietet (Statussymbole, Titel, Anerkennung) d) Entstehung von Rollenerwartungen und Normen (Leiter wird legitimiert) Konformität des Leiters mit Gruppennormen: unvereinbare Erwartungen werden an Leiter gerichtet: a) einerseits größere Konformität Zusammenhalt der Gruppe zur Erreichung des Gruppenziels b) andererseits geringere Konformität Flexibilität, Finden neuer Ziele, also Transzendenz bisheriger Gruppennormen 5. FÜHRUNGSSTIL LEWIN, LIPPITT & WHITE (1938, 1943): klassisches Führungsstilexperiment 3 Bastelgruppen von Kindern, 3 Führungsstile der Vl: autokratisch, demokratisch und laissez-faire Ergebnisse: autoritärer Stil: Kinder häufig entweder reizbar/aggressiv oder apathisch; große Unzufriedenheit mit den Gruppenaktivitäten; Produkte von hoher Quantität, aber geringer Originalität demokratischer Stil: kaum Reizbarkeit und Aggression; hohe Zufriedenheit mit Gruppenaktivitäten; hohe Qualität und Originalität laissez-faire: hohe Reizbarkeit und Aggression; sehr große Unzufriedenheit mit Gruppenaktivitäten; Leistung quantitativ am schlechtesten und von mittlerer Qualität bei meisten derartigen Untersuchungen Zufriedenheit in demokratischem Stil am höchsten, aber Leistung nicht immer am effizientesten Effizienz stark abhängig von situativen Faktoren (Gruppenstruktur, Zielsetzungen, Notsituationen) und Eigenheiten der Gruppe (Erwartungen der Mitglieder; demokratischer Stil scheitert z. B., wenn Mitglieder autoritäre Erwartungen haben) demokratischer Stil effizient, wenn: a) Mitglieder die Entscheidung für wichtig halten b) Entscheidungen in direktem Zusammenhang zu ihrer Arbeitsleistung stehen c) wenn Entscheidungen für sie mit Konsequenzen verbunden sind Kritik an Führungsstilforschung: a) Führer eingesetzt b) Gruppen ad hoc keine gemeinsame Geschichte und Zukunft, Instruktionen haben keine Konsequenzen über die Versuchssituation c) keine Einflussnahme der Gruppe auf den Führer möglich (z. B. Führer möge sich doch hilfreicher verhalten, mehr Lob und Tadel etc.) Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 22 d) optimale Führung (wie von LEWIN angenommen) gibt es nicht, da viele modifizierende Faktoren eine Rolle spielen (s. o.) e) einseitige Orientierung an Effektivitätskriterien; bei anderen Zielsetzungen, wie Selbstbestimmung, Solidarität oder Emanzipation demokratischer Stil auf jeden Fall vorzuziehen 6. LPC-MODELL VON FIEDLER (1964) Kontingenzmodell für die Effizienz von Führung: least-preferred co-worker 3 binäre situative Variablen, die operationalisierbar sind: a) Beliebtheit des Führers (beliebt – unbeliebt) b) Strukturiertheit der Aufgabe (strukturiert – unstrukturiert) c) Positionsmacht des Führers (stark – schwach) Untersuchung dazu: Kombination ergibt 2x2x2 = 8 Gruppensituationen (günstige bzw. ungünstige Bedingungen für den Führer) Kontinuum der situativen Günstigkeit: I + + + günstig II + + – III + – + IV + – – V – + + VI – + – VII – – + VIII – Beliebtheit – Aufgabenstruktur – Positionsmacht ungünstig Kontingenzhypothese: aufgabenorientierte vs. mitgliederorientierte Führung (Analogie zu LEWIN und BALES & SLATER) Operationalisierung: LPC-Skala: Fragebogen aus 20 Items wie den folgenden: 8 7 6 5 4 3 2 1 vertrauensvoll selbstsicher angenehm nicht vertrauensvoll nicht selbstsicher nicht angenehm Führer soll aus seiner Gruppe dasjenige Mitglied auswählen, mit dem er am schlechtesten zusammenarbeiten kann, und auf obiger Skala einschätzen Führer mit niedrigen LPC-Werten: aufgaben- und leistungsorientiert (schätzt schlechtestes Mitglied eher als nicht vertrauensvoll etc. ein, also als für persönliche Beziehungen und Probleme ohne Interesse) Führer mit hohen LPC-Werten: mitgliederorientiert (neigen eher zu quasi-therapeutischem Verhalten) aV: nicht die Gruppenleistung selbst, sondern Korrelation zwischen LPC-Wert und Gruppenleistung Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 23 Welcher Stil ist der günstigste? Kontingenzhypothese deshalb, weil Günstigkeit des Führungsstils stark von von situativer Bedingung (siehe Kontinuum, I bis VIII) abhängt: Korrelationskoeffizient I II III IV V VI VII VIII negative Korrelationen: (Gruppenleistung hoch + LPC-Wert niedrig) Überlegenheit des aufgabenorientierten Stils positive Korrelationen: Überlegenheit des mitgliederorientierten Stils in extremen Bedingungen aufgabenorientiert besser, in mittleren Bereichen mitgliederorientiert (bei IV und VII kein Einfluss) Kritik / Probleme: Art der Konstruktion der Führungsorientierung (LPC-Wert gibt nicht tatsächliche Orientierung des Führers wieder) niedrige Zuverlässigkeit, Schwankungen über die Zeit aV problematisch als Effizienzmaß (zu indirekt) besser: direkte Erfassung der Effizienz, z. B. durch Zeit, die die Gruppe braucht, oder Fehleranzahl etc. VI. Soziale Normen und Rollen 1. BEGRIFFSKLÄRUNGEN Normen: geteilte Erwartungen von Mitgliedern einer Gruppe legen Verhalten, Einstellungen, Reaktionen in bestimmten Situationen fest beruhen auf gemeinsamen Wertvorstellungen; gelten für alle Gruppenmitglieder in gleicher Weise formell (Gesetze, Regeln) für größerer Gesellschaften, oder informell (durch indirekte Kommunikation, durch positive oder negative Sanktionen vermittelt, nirgends fixiert) werden im Sozialisationsprozess vermittelt Rollen: spezifische Erwartungen, gelten nur für den Inhaber einer bestimmten sozialen Position innerhalb eines sozialen Systems können formell (Regeln) oder informell (Erwartungen) vermittelt werden Sozialisation: Übernahme von Einstellungen, Werten, Fähigkeiten, Kenntnissen innerhalb eines sozialen Systems durch Interaktion mit anderen Personen auf dem Wege sozialer Lernprozesse lebenslanger Prozess Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 Teilbereiche: Übernahme sozialer Normen, Rollenlernen, Ausbildung sozialer Motive (Leistungsstreben) universelle soziale Normen: Norm der Gegenseitigkeit (Gefallen erweisen, Konzessionen machen, etc.) Norm der sozialen Verpflichtung (Versprechen einhalten) Norm des Gehorsams gegenüber Autoritäten Norm der Hilfsbereitschaft 2. FUNKTIONEN SOZIALER NORMEN Richtschnur für die Lösung sozialer Konflikte erleichtern Orientierung in sozialer Umwelt ermöglichen Vorhersage des Verhaltens anderer Personen dienen der Demonstration der Gruppenzugehörigkeit (Statussymbole etc.) liefern Leitlinien für eigenes Verhalten Reduktion von Entscheidungs- und Handlungsunsicherheit ermöglichen Validierung eigener Meinungen und Einstellungen sichern Zusammenhalt und Kontinuität von Gruppen 3. SOZIALE ROLLEN legen mehr oder weniger explizit fest, wie sich Inhaber bestimmter sozialer Positionen verhalten sollen, wie sie denken und empfinden sollen, welche Rechte und Verpflichtungen sie haben verschiedene Erwartungen an Rollenträger (festgelegt durch Rollenvorschriften von der Gruppe) soziale Rollen immer bezogen auf Partnerrollen Erwartungen an Rollenträger hängen stets davon ab, mit welchem Partner er konfrontiert ist (z. B. Lehrer – Schüler oder Lehrer – Eltern) Erwartungen teilweise unvereinbar 4. ROLLENKATEGORIEN UND ROLLENKONFLIKTE Beispiele für Rollenkategorien: Rolle der Mutter in der Familie Rolle des alten Mannes (informelle Rolle) aus beruflicher Position abgeleitete Rollen (z. B. Arzt) Rollen, die sich aufgrund einer Funktionsteilung innerhalb einer Gruppe ergeben (Schwester kann z. B. Rolle der Mutter innerhalb der Familie übernehmen) Rollenkonflikte können entstehen, a) wenn Person mehrere Rollen ausführen muss (z. B. Lehrer muss eigene Kinder unterrichten) b) wenn Rollenvorschriften / -erwartungen nicht klar definiert sind (z. B. Rolle des alten Mannes) c) wenn man von einer alten in eine neue Rolle übergeht (Heranwachsende Jugendliche) d) wenn Charakteristika einer Person mit den Rollenerwartungen unvereinbar sind 24 Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 5. ROLLENLERNEN 5.1. INHALT (wenn man in neue Rolle hineinwächst) a) Erwartungen bezüglich eigener Rolle b) Erwartungen an Inhaber von Partnerrollen c) zu erwartende positive oder negative Sanktionen d) Fertigkeiten und Techniken für die Rollenausübung e) Übernahme von Einstellungen und Werten etablierter Rolleninhaber f) Identifikation mit der Rolle (Bestandteil des Selbstkonzepts) 5.2. ABLAUF a) b) c) d) positive und negative Sanktionen der Rollenpartner Nachahmung etablierter Rollenpartner (Modell-Lernen) Praktizieren / Einüben der Rolle individuelle Spielart der Rolle aushandeln mit Rollenpartnern 5.3. FÖRDERNDE BEDINGUNGEN (um Rollenwechsel zu erleichtern) a) Übergangsriten bei Rollenwechsel (Polterabende) b) Vorwegnahme der Rollenausübung (Rollenspiele, Phantasie, ...) c) Maßnahmen der Desozialisation (z. B. Isolation) d) Initiationsriten (Demütigungen, Prüfungen, Schmerzen ertragen, Mutproben etc.) e) öffentliche Distanzierung von bisheriger Rolle (Ablegen von Kleidung, Haare abschneiden etc.) f) öffentliche Festlegung auf neue Rolle (Eid, Gelübde etc.) VII. Konformität 1. ZUM BEGRIFF DER KONFORMITÄT Form des sozialen Einflusses: Nachgeben gegenüber sozialem Einfluss sich anpassen / ausrichten von Personen an die Normen einer Gruppe (SHERIF & ASCH) Einwilligung (compliance): dem Ansinnen einer oder mehrerer anderer Personen nachzukommen (bestimmte Aktivitäten auszuführen, Einstellungen zu übernehmen); Bereitschaft dazu erhöht durch Techniken sozialer Einflussnahme (vgl. unten) Gehorsam, Unterwerfung: sich einem Befehl / einer Anordnung einer tatsächlichen oder wahrgenommenen Autorität beugen (MILGRAM) Unterscheidung: Konformität als Prozess (Wie kommt es, dass Personen sich einer Mehrheitsmeinung anschließen?) Zustand (dass Mitglieder einer Gruppe alle mit Gruppennormen übereinstimmen) 25 Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 26 2. TECHNIKEN SOZIALER EINFLUSSNAHME Technik foot-in-the-door door-in-the-face Verknappung / rar machen low-ball (sehr fies) Beschreibung erst harmlose Bitte (z. B. nach Uhrzeit), dann weitergehende Bitte (z. B. nach Geld) erst weitgehende, unverschämte Bitte, die abgelehnt wird, dann sehr viel geringfügigere Bitte wird dann oft gewährt den Adressaten davon überzeugen, dass das unterbreitete Angebot «nicht billig» zu haben sei (sehr verbreitet) erst gut klingende, aber falsche Zusicherung, mit der man Zustimmung zu einem Geschäft erreicht, dann wird aber Zusicherung zurückgenommen (angeblicher Irrtum) Partner bleibt meist dennoch bei Geschäft 3. KONFORMITÄTSKONTINUUM 2 Endpunkte des Komformitätskontinuums: a) normative Konformität Bedürfnis, von den anderen Gruppenmitgliedern respektiert zu werden meist äußere Anpassung, später eventuell dauerhafte Einstellungsänderung (vgl. Linienschätzexperiment von ASCH) b) informationsbezogene Konformität Bedürfnis, von anderen Informationen über deren Sichtweise der Realität zu erhalten; sich orientieren in unsicheren Situationen oft bei metaphysischen Fragen, moralischen Werturteilen etc (vgl. autokinetisches Phänomen von SHERIF) beide Formen spielen in verschiedenen Ausprägungen in allen Paradigmen eine Rolle (schließen sich also keineswegs aus) 4. PROZESSE DER SOZIALEN ANSTECKUNG Handlungen der anderen «stecken an» einfaches Beispiel: in Gruppe schauen alle nach oben Vpn machen dies nach (MILGRAM 1969) a) Autokinetisches Phänomen (SHERIF 1935) Vp in abgedunkeltem Raum + stillstehender Lichtpunkt Vp sollen angebliche Bewegung des Lichtpunktes abschätzen Wie ändert sich Schätzverhalten in der Gruppe? Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 27 Phase I Vp allein (1. Tag) Phase II Phase III Vp in Gruppe (folgende Tage) Vp wieder allein (1 Jahr später) Schätzungen sehr verschieden Schätzungen gleichen sich Schätzungen wie Phase II mehr und mehr an Konformität Phänomen relativ stabil Gruppenphänomen Erklärungsversuche: soziale Verlgeichsprozesse (FESTINGER): Unsicherheit, da keine objektiven Messungen Grundbedürfnis, die eigene Meinung anhand derer anderer zu überprüfen individuelle Lerngeschichte (MAUSNER 1954) ist verantwortlich für individuelle Konformitätsneigung wenn Vp in ihrer Schätzung bestärkt werden, ändern sie diese nicht, sondern nur die nichtbestärkte passt sich an wenn beide unabhängig bestärkt gar keine Anpassung b) Linienschätzexperiment (ASCH 1956) a 1 2 3 Aufgabe: Vergleich (Ergebnisse eindeutig) Durchführung in Gruppe zu 6 Personen, nur die 6. ist richtige Vp die ersten 5 schätzen systematisch falsch Ergebnis: 37% aller Antworten konform (also falsch) (Quelle: MYERS, S. 215) 74% geben mindestens einmal nach (vgl. MYERS, S. 211 ff.) situative Bedingungen im ASCH-Experiment: Größe der Majorität (mind. 3 Personen) mit / ohne Partner (anderer echter Vp) mit Partner Fehlerzahl nur ca. 10% Partner verlässt Raum / gleicht sein Urteil Majorität an Vp fühlt sich «verraten» reagiert konform Urteile anonym Konformität sinkt Eindeutigkeit der Urteilssituation – vgl. Flächenschätzurteile (CRUTCHFIELD 1955) Interkulturelle Unterschiede sehr gering, Ausnahme: Bantus (dort: Konformität = Gruppennorm) vermutlich auch individuelle Lerngeschichte keine Geschlechtsunterschiede, aber Einfluss des Status (z. B., wenn Vp weiblich und Vl männlich) nur äußerliche Anpassung oder tatsächliche Meinungsänderung? Methoden zur Beantwortung der Frage: Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 28 post-hoc-Befragung der Vpn: Haben Sie Meinung wirklich angepasst? sehr fragwürdige Methode anschließende Einzelversuche (wie bei SHERIF): Vpn passen sich nur äußerlich an Verfahren aus der SDT: verschiebt sich Kriterium oder Wahrnehmung der Person? nur Kriterium, nicht aber der sensorische Parameter d’ wird geändert (UPMEYER) 5. NONKONFORMITÄT Unterscheidung: echte Nonkonformität Unabhängigkeit von Mehrheismeinung Antikonformität Opposition zur Mehrheitsmeinung (letztendlich genauso abhängig von Mehrheit) völlig verschieden voneinander um Konformität entgegenzuwirken: a) Anwesenheit von Dissidenten (Gruppenkonsensus schwächen, abweichende, aber wichtige Meinungen unterstützen, Sachverhalte beurteilen) b) Urteile anonym c) Personen für unabhängige Meinung bestärken Konformität als Persönlichkeitseigenschaft? konnte nicht bestätigt werden Geschlechtsunterschiede? fast keine, nur bei typisch männlichen oder weiblichen Themen kulturelle Unterschiede? BRONFENBRENNER (1976) ??? Metaanalyse: SMITH & BANA (1993): abendländische «individualistische» Kulturen vs. «kollektivistische» (S-Amerika, Afrika, Asien, Ozeanien) Unterschiede aber sehr gering 6. EINFLUSS VON MINORITÄTEN (MOSCOVICI) Wann kann eine Minderheit die Mehrheit beeinflussen? 2 Bedingungen: a) Minderheit vertritt abweichenden Standpunkt konsequent b) es kommt zu echten Einstellungs- und Urteilsänderungen MOSCOVICI et al. (1969): Farbwahrnehmungsaufgabe: Blau- bzw. Grün-Urteile Verhalten der Minorität konsequent vs. inkonsistent Ergebnisse: konsistente Bedingung Minorität beeinflusst Farbwahrnehmung Farbschwelle verändert (!) ASCH: Effekte bei einstimmiger Majorität viel schwächer Erklärung der Ergebnisse: a) attributionstheoretisch (HERKNER) Einfluss von Minorität nur, weil sie hohe Konsistenz über die Zeit und hohen Konsensus (Eistimmigkeit) aufweist b) dissonanztheoretisch Majorität passt sich zunächst verhaltensmäßig Minorität an Dissonanz zu ihrer Wahrnehmung Reduktion der Dissonanz durch Anpassung der Wahrnehmung aber: konsistentes Verhalten führt bei Mehrheit zum Eindruck der Rigidität Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 29 NEMETH, SWEDLUND & KANKI (1974): wie MOSCOVICI et al. (1969), aber Bedingungen des Verhaltens der Minderheit: konsistent grün rigide konsistent grün-blau kompromissbereit zufällig (mit gleicher Häufigkeit grün und grün-blau) systematisch (hellere Dias: grün; dunklere: grün-blau) Ergebnisse: Einfluss systematisch > kompromissbereit > rigide > zufällig (vgl. HERKNER, S. 463 – 468; MYERS, S. 325 – 330) weitere Einflussfaktoren: a) Doppelminoritäten (zahlenmäßig und sozial) weniger Einfluss als rein zahlenmäßig b) Unterscheidung Verhaltensstil (konsistent / inkonsistent) vs. Verhandlungsstil (rigide / flexibel kompromissbereit größerer Einfluss) c) Konversionstheorie (MOSCOVICI 1980) (vgl. HERKNER, S. 466): Majoritäts- vs. Minoritätseinfluss beide lösen jeweils unterschiedliche Konflikte aus Majorität (ASCH) nur äußere Anpassung interpersonaler Konflikt soziale Vergleichsprozesse (ohne tieferes Nachdenken über das sachliche Problem) oberflächliche Verhaltensanpassung Minorität (MOSCOVICI) echte Einstellungsänderungen kognitiver Konflikt vertiefte Auseinandersetzung mit Problem, keine Vergleichs-, sondern Validierungsprozesse Einstellungsänderung Gegenmeinung anderer Autoren: Unterschiede rein quantitativ auch bei Majorität tiefe, grundlegende Informationsverarbeitung möglich, wenn Info ich-bezogen und relevant ist bei Minorität: Selbstaufmerksamkeit erhöht Konformitätsprozesse (HERKNER, S. 467) VIII. Autoritätsgehorsam 1. DAS MILGRAM-EXPERIMENT «Vl» (eigentliche Vp) soll «Vp» (Gehilfe des Vl) bestrafen, falls gelerntes Wort falsch immer höhere Elektroschocks (in 15-V-Schritten), zuletzt lebensgefährlich Wie weit geht Vp? Ergebnisse: bis 150 V alle Vp 62% bis zum Schluss (450 V !) Selbst- und Fremdeinschätzungen viel geringer (befragte Psychiater: 0,1% gehen bis zum Schluss) Probleme: hoher psychischer Druck für Vpn führte zu Standard-Ethik-Kodex in USA (vgl. MYERS, S. 216 – 220) situative Faktoren: a) Nähe zum Opfer und Gehorsam Gehorsamsrate 30%, wenn Arm des «Schülers» auf Elektrode gedrückt werden muss b) Legitimität / Anwesenheit der Autorität wenn Vl nicht Wissenschaftler, sondern Doktorand Gehorsamsrate c) Prestige der Institution wenn keine Legitimation als wissenschaftliche Institution: Gehorsamsrate 48% d) Modelle für Ungehorsam wenn 2 andere sich weigern: Gehorsamsrate 10% e) Uneinigkeit von zwei Autoritäten Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 30 Gehorsamsrate 0% 2. WEITERE EXPERIMENTE ZUM MILGRAM-PARADIGMA HOFLING et al. (1966): Medikament soll von Schwester verabreicht werden – aber unzulässige Dosierung auf Geheiß des Arztes 95% der Schwestern befolgen dies (vgl. MYERS, S. 222) MEEUS & RAAIJMAKERS (1986): administrativer Gehorsam (vgl. MYERS, S. 242) angeblicher Bewerber für eine Stelle wurde grausamen Tests unterzogen und fiel am Ende durch angebliches Ziel: Stresserzeugung durch negative Rückmeldungen harte Auswahlkriterien, denen sich Bewerber unterziehen muss Ergebnis: 90% gehorchen 3. GROUPTHINK (JANIS) JANIS (1971, 1982): untersucht Reihe politischer Fehlentscheidungen, z. B. Pearl Harbor Invasion in der Schweinebucht Vietnamkrieg Fazit: Fehlentscheidungen beruhten auf «groupthink» (Kollektivdenken) (vgl. MYERS, S. 316 – 325) Risikoschub bei Gruppenentscheidungen: einzelne Vpn mit 2 Entscheidungsalternativen konfrontiert (z. B. sicherer Job mit wenig Bezahlung vs. Job bei neugegründeter Firma mit guter Bezahlung) Vpn sollen angeben, wie groß die Erfolgschance für riskantere Alternative sein muss, um sich dafür zu entscheiden nach Gruppendiskussion und anschließendem Konsens Risikobereitschaft deutlich größer als durchschnittliche Risikobereitschaft der Einzelurteile (= Risikoschub, risky shift) Erklärungen: Risiko wird in Gruppe auf viele Personen aufgeteilt Verantwortung für den Einzelnen sinkt Risikofreudige sind einflussreicher (extravertierter, überzeugender) aber: auch in homogener Gruppe Risikoschub größere Vertrautheit mit dem Problem (durch Gruppendiskussion) Eindruck geringerer Gefährlichkeit – aber: es gibt auch das Phänomen des cautious shift (genaues Gegenteil), wenn mögliche Folgen der riskanten Alternative besonders stark wird dadurch nicht erklärt durch Diskussion gegensätzliche soziale Normen aktiviert Vorsicht oder Risiko aktiviert oder verstärkt (normativer Einfluss) Informationseinfluss: wie normativer, aber mit Argumenten ist stärker als normativer Einfluss Gruppenpolarisierung: ursprünglich vorherrschende Position wird durch die Diskussion verstärkt (gilt für jede Art von Einstellung) Bsp.: MOSCOVICI & ZUVALLONI (1969) Einstellungen zu bestimmten Gegenständen / Personen werden nach Diskussion extremer Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 4. KOLLEKTIVDENKEN: BEDINGUNGEN, CHARAKTER UND SYMPTOME Vorbedingungen: a) Gruppe mit hohem Zusammenhalt b) Gruppe nach außen hin isoliert c) keine systematischen Verfahrensweisen, das Pro und Contra der verschiedenen Handlungsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen d) ein direktiver Führer, der eine Handlungsmöglichkeit ausdrücklich favorisiert e) starker Stress Kollektivdenken: Bedürfnis, unbedingt einen Konsensus zu erzielen und Meinungsunterschiede zu vermeiden Symptome: a) Illusion der Unverwundbarkeit, Moralität, Einmütigkeit falls abweichende Meinungen: b) Druck auf Andersdenkende Folgen des Drucks: c) Selbstzensur bei Nichtübereinstimmung d) kollektive Rationalisierungen e) selbsternannte «Meinungshüter» f) stereotype Sicht von Gegnern 5. MÄNGEL DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES BEI KOLLEKTIVDENKEN a) unvollständige Untersuchung der Ziele der Gruppe und der alternativen Handlungsmöglichkeiten b) fehlende Abschätzung der Risiken der bevorzugten Wahlentscheidung c) schlechte und unvollständige Suche nach relevanten Infos d) selektive Voreingenommenheit bei der Verarbeitung der vorliegenden Info e) fehlende Neubewertung verworfener Alternativen f) fehlende Aufstellung von Alternativen für den Fall des Scheiterns 6. MASSNAHMEN GEGEN KOLLEKTIVDENKEN (VON JANIS SELBST) a) Aufklären der Teilnehmer über das Phänomen des Kollektivdenkens b) Einführung einer «offenen Debatte» (Pro und Contra) c) Institution des «advocatus diaboli» (einer muss immer gegen alles sein und gute Argumente dafür liefern) d) Bewertung der Entscheidung durch externe Experten e) zwei unabhängige Teilgruppen bilden f) nochmaliges Treffen mit Nachvollzug des gesamten Entscheidungswegs IX. Aggression 1. WAS IST AGGRESSION? physisches oder verbales Verhalten mit der Absicht, einer anderen Person zu schaden 31 Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 32 Operationalisierung im Experiment: Schatten einer «anderen Vp» elektrische Schläge verabreichen (z. B. MILGRAM) Schlagen, treten einer aufgeblasenen Gummipuppe (z. B. BANDURA) verbale Bereitschaft zur Aggression (Fragebogen) Fremdeinschätzung der Aggressionsbereitschaft (peers, Lehrer) Selbstauskunft über früheres eigenes aggressives Verhalten 2 Formen von Aggression: a) Feindselige Aggression Aggression als Selbstzweck b) Instrumentelle Aggression (z. B. zwischen Kindern) Handlung zur Erreichung eines Ziels Theorien zur Entstehung von Aggression gehen auf diese beiden Formen zurück, beziehen aber nicht immer beide Formen ein 2. AGGRESSIONSTHEORIEN 2.1. TRIEBTHEORIE VON FREUD angeborener Todestrieb, Gegenspieler zum Eros «Triebstau», der nach Abfuhr verlangt Konzept der Katharsis Abfuhr auf nicht-destruktive, sozial akzeptierte Weise Probleme: emipirisch nicht prüfbar, nur post-hoc-Erklärungen; Katharsis zweifelhaft 2.2. ETHOLOGIE K. LORENZ, I. EIBL-EIBESFELD Aggression dient der Arterhaltung hydraulisches Energiemodell Triebenergie staut sich auf Schlüsselreize Triebabfuhr ist auch auf menschliches Verhalten übertragen worden vergleichbar Katharsis kontrollierte Abfuhr der aggressiven Energie, z. B. durch Holzhacken, Sport treiben Probleme: zu simpel, kann viele psychologische Befunde nicht erklären; Tierreich: nach Kampf sind Tiere noch aggressiver 2.3. FRUSTRATIONS-AGGRESSIONS-THEORIE DOLLARD & MILLER (1939) Frustration: Blockierung zielgerichteten Verhaltens enttäuschte Erwartung, Zielobjekte zu erlangen Deprivation: Mangel an Zielobjekten vorausgegangene Frustration Aggression 3 Erscheinungsformen der Aggression: nach innen gerichtet verschoben auf Sündenböcke direkt gegen Furstrator gerichtet Probleme: Ursachen von Aggression können vielfältige andere Faktoren sein Frustration kann auch andere Reaktionen auslösen (z. B. Apathie, Regression) MILLER reagiert mit abgeschwächter Theorie: Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 33 Frustration erhöht Bereitschaft zu Aggression; Aggression = dominante Reaktion auf Frustration 2.4. REVIDIERTE FRUSTRATIONS-AGGRESSIONS-HYPOTHESE BERKOWITZ (1969, 1982) Zusätze zur Theorie: vermittelnde Funktion von Ärger Bereitschaft zur Aggression Ärger: wenn jemand als Frustrator auftritt, obwohl er hätte anders reagieren können Vorraussetzung für Aggression: situative Faktoren, die mit aggressivem Verhalten assoziiert sind (z. B. Waffen, Vorhandensein geeigneter Opfer, auch bestimmte Kleidung etc.) Experiment von BERKOWITZ (wann?): «Ärger, Film und Aggression» 3-Personen-Situation: Vp, Vl, Vertrauter des Vl (Pseudo-Vp) Auswirkung bestimmter Filme auf den Blutdruck, danach Aufgabe ausführen Pseudo-Vp beschimpft Vp Ärger Vorbedingung für Aggression vs. keine Beschimpfung dann aggressiver vs. neutraler Film anschließend: Vp kann Pseudo-Vp elektrische Schläge geben Ergebnis: geärgert + aggressiven Film gesehen meiste Schläge ohne Ärger Aggression generell niedrig weiteres Experiment von BERKOWITZ (auch kein Jahr; vielleicht BERKOWITZ & LEPAGE 1967?): geärgert vs. nicht geärgert neutrale Objekte (Badminton-Schläger) in Umgebung vs. Raum mit aggressionsfördernden cues (Gewehr) Ergebnisse: ohne Ärger generell niedrige Aggression mit Ärger: höhere Aggression mit Waffen sogar Namen aggressiver Personen können als cues wirken Ärger ist Voraussetzung für Aggression; aggressionsfördernde cues erhöhen Aggression (vgl. ARONSON, S. 282, MYERS, S. 390) 2.5. AGGRESSION ALS GELERNTE VERHALTENSWEISE a) operante Konditionierung aggressiven Verhaltens: Lernen am Erfolg b) Lernen durch Beobachtung aggressiver Verhaltensmodelle (BANDURA, ROSS & ROSS 1961, BANDURA 1997) BANDURA, ROSS & ROSS (1961, 1963a,b): erwachsenes Modell traktiert Puppe Kinder imitieren dies anschließend kopierten nicht nur Verhalten, sondern zeigten gegenüber der Puppe auch noch andere Formen aggressiven Verhaltens (vgl. MYERS, S. 397, ARONSON, S. 267) Kritik: nur Laborsituationen, im Alltag nie einfach Kopie von Verhaltensweisen BANDURA: soziale Lerntheorie Einwirkung vieler Faktoren, wie antizipierte Konsequenzen des Verhaltens, Kosten + Belohnung etc. 2.6. AGGRESSION ALS REAKTION AUF AVERSIVE ERREGUNG Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 Aggression Formen der aversiven Erregung: Lärm, räumliche Enge, Hitze ANDERSON & ANDERSON (1994): mehr Unfälle, wenn keine Klimaanlage (hab ich nicht gefunden...) Ausschreitungen in 79 US-Städten zwischen 1967 und 1971 untersucht höhere Wahrscheinlichkeit an heißen Tagen Umgebungstemperatur und Gewalt: bei Überschreiten bestimmter Grenze Fluchtreaktion Umgebungstemperatur Lärm und Ärgerinduktion: wenn Vpn geärgert wurden Bereitschaft zu Aggression schon bei geringem Lärm hoch, besonders intensiv aber bei starkem (vgl. MYERS, S. 399 – 403) 2.7. WIRKUNG UNSPEZIFISCHER ERREGUNG a) Theorie der Erregungsübertragung (ZILLMANN 1971, 1979) unspezifische Resterregung von verschiedenen Ursachen (Hitze, Lärm, spannender Film etc.) kann übertragen werden auf neue Erregungssituation Erhöhung der Aggressionsbereitschaft, wenn Person ohnehin aggressionsbereit zuvor Ärger induziert (vgl. MYERS, S. 403 f.) b) kognitiv-neoassozianistischer Ansatz (BERKOWITZ 1993) = verallgemeinerte BERKOWITZ-Theorie aversive Stimuli (Lärm, Hitze etc.) direkter Effekt (ohne Vermittlung durch Ärger) Empfindungen von Furcht, Angst, Ärger nur Begleiterscheinungen (haben keinen vermittelnden Einfluss) 3. GEWALTDARSTELLUNG IN MEDIEN Korrelationsstudien: positiver Zusammenhang zwischen Konsum von Gewaltsendungen und Häufigkeit aggressiver Verhaltensweisen meist aber kurzfristige Effekte Katharsishypothese: Nimmt Aggressionsbereitschaft ab, wenn man Gewaltsendungen konsumiert? keine Belege 34 Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 35 Längsschnittstudien: bedeutende positive Korrelationen zwischen Konsum von Gewaltdarstellungen und aggressiven Verhaltenstendenzen ERON & HUESMANN (1984): doppelt so hohe Kriminalitätsbelastung als 30-jährige, wenn als Kind häufig Gewaltsendungen Feldexperiment: schauen von Filmen, danach Aggressionsniveau erhoben neutraler Film Aggressionsniveau niedrig Gewaltfilm Aggressionsniveau steigt bedeutsam an aber: Gewaltfilme werden auch vorrangig von gewaltbereiten Menschen konsumiert selektive Vorliebe für Gewaltsendungen + Wirkung der Sendungen an sich Einfluss auf Aggresssionsniveau (vgl. MYERS, S. 411 – 418) Faktoren für erhöhte Gewaltbereitschaft: Effektivität (Aggression erscheint wirksam für Zielerreichung) Normativität (Aggression als legitim dargestellt) Empfänglichkeit (emotionale Erregung des Zuschauers) weiterer Effekt häufig konsumierter Gewaltdarstellungen: veränderte Einstellung gegenüber Aggression und Gewalt Personen fürchten sich mehr vor Überfällen; Boom von Bodyguards etc.; Ruf nach härterem Durchgreifen der Behörden etc. Kinder beurteilen später aggressive Vergeltungshandlungen positiver 4. INDIVIDUELLE FAKTOREN BEI AGGRESSION Zusammenhänge zwischen antisozialen Persönlichkeitsstörungen und Psychopathie erhöhte Neigung zu krimineller Gewalt, verstärkt durch ungünstige Lebensbedingungen erhöhter Testosteronspiegel erhöhte Aggressionsbereitschaft Typ-A-Persönlichkeit erhöhte Aggressionsbereitschaft 5. SOZIALE KONSTRUKTION VON GEWALT UND KOLLEKTIVE GEWALT Soziale Konstruktion von Gewalt: Einschätzung von Handlungen als aggressiv hängt ab von Bewertung Beispiele: bewaffneter Wiederstand = Freiheitskampf vs. Terrorismus persönliche Gewalt = brutaler Angriff vs. legitime Notwehr Bewertung als Aggression abhängig von: eigener Einstellung sozialer Rollenzugehörigkeit Perspektive (Beobachter vs. Akteur) etc. Attribution eines Verhaltens als «aggressiv» hängt ab von: a) Verantwortungszuschreibung für aversive Konsequenzen b) Diskrepanz des Verhaltens zur Verhaltensnorm (Überreaktion, Vergeltungshandlung?) c) Motiven der Person, die Macht durch Zwang ausübt: Kontrolle anderer Gerechtigkeit wieder herstellen Notwehr / Selbstschutz Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 36 d) ergänzenden, erläuternden Informationen zum Verhalten (Entschuldigungen, Erklärungen, Rechtfertigungen) Kollektive Gewalt: = stärker als Gewalt von Einzelpersonen (klassisch: LEBON) Erklärungsversuche: a) Deindividuation in Gruppen (ZIMBARDO) nachlassende Verhaltenskontrolle (Wegfall von Hemmungen etc.) Bedingungen: Anonymität, Verantwortungsdiffusion Ergebnisse widersprüchlich b) emergente-Norm-Theorie (TURNER et al. 1972) in Gruppensituationen entstehen neue, situationsspezifische Normen, u. a. auch für aggressives Verhalten stärker nonkonformes Verhalten in Gruppen c) Norm-Verstärkungs-Hypothese aggressives Verhalten hängt von den in der Gruppe dominierenden Normen ab Gruppe verstärkt vorherrschende Norm 6. WIE KANN MAN AGGRESSIONSBEREITSCHAFT VERMINDERN? BANDURA: Beobachten nicht-aggressiver Modelle Auslösen inkompatibler Verhaltensreaktionen (Empathie, Humor etc.) kognitive Kontrollstrategien (Gedankenstopp, Ärgerkontrolle) verstärkt Wahl alternativer Verhaltensweisen ZIMBARDO: Bewusstmachen der eigenen Identität als Mensch senkt Deindividuation Bewusstmachen der Gründe für Verhalten des anderen Reduktion von Ärger und Frustration X. Einzelleistung und Gruppenleistung 1. TYPEN VON GRUPPENLEISTUNGEN Gruppenleistungen können sein vom Typ des a) Hebens und Tragens (gemeinsame Kraftanstrengung) Walter MOEDE (1920): Tauziehen-Experiment je mehr Leute, desto geringer die Kraftanstrengung des Einzelnen MINTZ (1951): Vpn. ziehen an Fäden befestigte Metallstücke aus Flasche, aber nur durch Koordination möglich (vgl. Herkner, S. 415) b) Suchens (Problemlösen) und Findens (Entscheidungsfindung) HOFSTÄTTER (1971): Figuren verschiedenen Flächeninhalts der Größe nach ordnen allein arbeiten individuelle Rangfolge; bestes Ergebnis: .67 Arbeit in synthetischer Gruppe unterschiedlicher Größe bei Gruppengröße 20 Ergebnis (.92) besser als bei Größe 7 in natürlichen Gruppen Ergebnisse schlechter (zu viele Meinungen) Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 37 c) Bestimmens (Normenbildung, Konformität) 2. MODELLVORSTELLUNGEN FÜR GRUPPENLEISTUNGEN LORGE & SOLOMON (1955): a) best-man-Modell Gruppe leistet höchstens soviel wie bestes Mitglied Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein Mitglied Aufgabe löst, ist höher, als dass eine Vp. allein dies tut Bsp. für Gruppe aus 2 Personen; Lösungswahrscheinlichkeit Person A = p, Person B = q A löst, B nicht: p(1 – q) B löst, A nicht: q(1 – p) beide lösen: pq Summe: p(1 – q) + q(1 – p) + pq > p (Behauptung) p(1 – q) + q(1 – p) + pq – p > 0 p(1 – q + q – 1) + q(1 – p) > 0 q(1 – p) > 0 da 0 < p, q < 1, gilt: 1–p > 0 p < 1 (ist per def. wahr) Gruppenwahrscheinlichkeit > Einzelwahrscheinlichkeit, q. e. d. nur bei disjunkten, einstufigen Aufgaben mit eindeutigen Lösungen (vgl. HERKNER, S. 479) b) pooling-Modell Gruppe leistet mehr als bestes Mitglied bei konjunkten, mehrstufigen Aufgaben aber: tatsächliche Gruppenleistung unterhalb der optimalen z. B. wird richtige Lösung zwar gefunden, aber nicht als Gruppenlösung akzeptiert LAUGHLIN et al. (1975): Effekt der Gruppengröße auf Gruppenleistung bei komplementären Aufgaben (d. h. einer allein kann Lösung nicht erreichen): wenn Leistungsniveau des Einzelnen gering: kaum Leistungsvorteil bei größerer Gruppe wenn Leistungsniveau über Durchschnitt: Leistungsvorteil (flacht ab bestimmter Größe ab) 3. SOZIALE LEISTUNGSAKTIVIERUNG F. W. ALLPORT (1920): social facilitation Anwesenheit anderer hat fördernde Wirkung auf die Leistung einer Person egal, ob «Publikumseffekt» (andere schauen nur zu) oder«Koaktionseffekt» (machen mit Konkurrenzsituation) bis ca. 1940: Effekte bei vielen Aufgaben (physische Kraftanstrengung, Buchstaben durchstreichen etc.) gefunden auch bei Tieren aber auch Reihe von Gegenbefunden (vgl. MYERS, S. 293) Verwirrung; Theorie der social facilitation wird 25 Jahre lang unbeachtet gelassen Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 38 Robert ZAJONC (1965): verknüpft experimentalpsychologische Befunde zu arousal mit Theorie der social facilitation Experimentalpsychologie: je höher arousal, desto größer Erleichterung für dominante Reaktion auf eine Aufgabe dominant: auch, wenn Aufgabe einfach ist, d. h. automatisiert abläuft bei Anwesenheit anderer: arousal , Erleichterung für einfache Aufgaben + Hemmung schwierigerer erklärt gegensätzliche Befunde ZAJONC & SALES (1966): Vpn. mussten Pseudowörter 1 bis 16 Mal wiederholen erschienen dann angeblich unterschwellig auf einem Monitor und sollten erkannt werden (in Wirklichkeit nur zufällige schwarze Linien) Vpn. «erkannten» v. a. häufigste Wörter waren dominant geworden bei Anwesenheit von anderen (social facilitation) Effekt noch größer (vgl. MYERS, S. 292 ff.) 4. ERKLÄRUNGEN FÜR ERREGUNG IN ANWESENHEIT ANDERER a) Bewertungs-Besorgnis-Hypothese COTTRELL (1972): Anwesenheit anderer führt zur Antizipation einer Bewertung der eigenen Leistung positive Bewertungserwartung: Antriebsniveau negative Bewertungserwartung: löst zusätzlich Angst aus führte Experiment durch wie ZAJONC & SALES (1966), aber mit 3. Bedingung: Beobachter tragen Augenbinden (können nicht bewerten) Ergebnis: mit Augenbinde wesentlich geringerer Einfluss (vgl. MYERS, S. 297) DASHIELL (1930) (?): Vpn. mussten verschiedene Aufgaben lösen (z. B. Multiplizieren, Analogien bilden) aV: Geschwindigkeit und Richtigkeit allein vs. nebeneinander ohne Konkurrenz vs. mit Konkurrenzsituation keinerlei Effekte aber: Effekte, wenn Zuschauer, die bewerten konnten MARKUS (1978): [ausgelassen] b) Ablenkungs-Konflikt-Hypothese SANDERS, BARON & MOORE (1978): durch Anwesenheit anderer Menschen Ablenkung der Aufmerksamkeit von der jeweiligen Aufgabe Konflikt zwischen Verteilung der Aufmerksamkeit auf die Aufgabe und auf das Publikum Überlastung des kognitiven Systems arousal SANDERS (1981): «social facilitation» nicht nur durch Anwesenheit anderer Menschen, sondern auch bei nichtmenschlicher Ablenkung, z. B. durch Lichtblitze (vgl. MYERS, S. 298) Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 39 c) ZAJONC-Hypothese bloße Anwesenheit anderer löst den Effekt aus ließ z. B. Farbpräferenzen äußern Material, das keiner Bewertung unterzogen werden kann ebenso Effekt bei Tieren gefunden bloße Anwesenheit genügt (vgl. MYERS, S. 298) d) Selbstaufmerksamkeitstheorie DUVAL & WICKLUND (1972): Anwesenheit anderer löst Selbstaufmerksamkeit aus Selbstaufmerksamkeit: Aufmerksamkeit ist auf eigenen Körper und eigenes Verhalten gerichtet; Vergleichsprozesse mit Idealselbst, ... Anwesenheit anderer Wahrnehmung von Diskrepanz zwischen Ideal und tatsächlicher Leistung mehr Anstrengungen Leistungsverbesserung bei schwierigen Aufgaben: Diskrepanz zu groß Motivation Leistung e) Selbstdarstellungstheorie C. F. BOND (1982): Anwesenheit anderer: Bedürfnis nach Selbstdarstellung mehr Anstrengung und Konzentration bei leichten Aufgaben bei schwierigen Aufgaben: Frustration, Angst f) Automatische vs. kontrollierte Prozesse MANSTEAD & SEMIN (1980): Publikum zieht Aufmerksamkeit auf sich leichte Aufgaben: automatische Verarbeitung wenig Aufmerksamkeit schwierige Aufgaben: kontrollierte Verarbeitung viel Aufmerksamkeit Leistung entspricht Theorie b) 5. ANSTRENGUNGSVERMINDERUNG (SOZIALE FAULHEIT) relativer Einzelbeitrag bei bestimmten Gruppenleistungen lässt nach (z. B. beim Tauziehen) vgl. MOEDE (s. o.), desgleichen Max RINGELMANN bereits vor fast 100 Jahren LATANÉ et al. (1979): «social loafing» (soziale Faulheit) ließen Vpn. so laut wie möglich applaudieren mit zunehmender Gruppengröße sinkt Einzelleistung Metaanalyse über 50 Studien: Phänomen unabhängig von Aufgabe Bedingungen: Anteil der eigenen Leistung nicht eindeutig feststellbar Aktivität geht nur auf Veranlassung des Vl zurück Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 40 Verhindern sozialer Faulheit: Vorhandensein von Selbstdarstellungsmotiven Möglichkeit zur Bewertung der Gruppenleistung reduziert soziale Faulheit Aufgabe ist für Person selbst wichtig persönliche Wichtigkeit der Gruppe (Kohäsion) Erklärungshypothese: Selbstaufmerksamkeitstheorie (MULLEN, 1987): je mehr Vpn. dem Vl. gegenüberstehen, desto geringer Selbstüberwachung (vgl. MYERS, S. 299 – 303) XI. Soziale Konflikte 1. ARTEN SOZIALER KONFLIKTE Rollenkonflikte intraindividuelle Konflikte soziale Konflikte zwischen Gruppen (z. B. SHERIF) interpersonelle Konflikte hier: Interessenkonflikte (siehe oben) 2. EXPERIMENTELLE SPIELE Beispiel (konfliktfrei): I I Spieler B 1 1 II 0 0 Spieler A II 0 0 -1 -1 Nullsummenspiel: was der eine gewinnt, verliert der andere Nicht-Nullsummenspiele: PD-Spiel: beide gewinnen oder beide verlieren «Feigling»-Spiel: beide wählen die Alternative, ein wenig zu gewinnen stürzen sich aber ins verderben und verlieren 3. PD-SPIEL = Prisoner’s Dilemma 2 Gefangene, kein Kontakt Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 41 beide leugnen beide geringe Haftstrafe genau einer gesteht er selbst Freispruch, der andere sehr hohe Haftstrafe beide gestehen beide mittlere Haftstrafen Dilemma: bei Kooperation Gefahr, ausgenutzt zu werden Was machen Partner in solchen Situationen? 30% bis 40% der Spieler kooperativ die meisten egoistisch (!) um sich nicht ausbeuten zu lassen lieber konkurrenzorientiert Lösung zur Kooperation: tit-for-tat-Strategie: gleiches mit gleichem vergelten wenn Partner A egoistischer Zug Partner B auch egoistisch; solange, bis A kooperiert Gewinne und Verluste in Auszahlungsmatrix ändern Gewinn bei Kooperation erhöht aber: auch hier spielen die meisten Spieler egoistisch Machtungleichgewicht herstellen: A hat Ergebniskontrolle über B wird am häufigsten angewandt Bedingung für kooperatives Spiel: Kommunikation (wenn Kommunikation möglich Prozentsatz steigt von 30 – 40 auf 70% !) 4. EINFLUSSVARIABLEN ZUR KOOPERATIONSBEREITSCHAFT a) b) c) d) e) f) g) Einstellungen der Partner zu Kooperation bzw. Wettbewerb Kommunikationsmöglichkeit (soziale Vergleichsprozesse) spezielle Motivation der Partner (masochistisch / sadistisch) andere soziale Einstellungen (autoritäre vs. liberale etc.) tatsächliches Partnerverhalten erwartetes Partnerverhalten (gegenseitige Wahrnehmung der Partner) Modelle (wenn man Vp sieht, die kooperativ spielt erhöhte Wahrscheinlichkeit für eigenes kooperatives Spiel) h) Höhe des möglichen Gewinnes / Verlustes i) unterschiedliche Machtverhältnisse 5. LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN SOZIALER DILEMMATA a) b) c) d) e) durch Verordnungen kleinere Einheiten / Parteien bilden Kommunikation Kosten-Nutzen-Relation verändern an soziale Normen appellieren generelles Problem: Laborsituation schwer übertragbar (Personen fassen Spiele tatsächlich als Spiele auf) Lösung: tatsächlich um Geld spielen lassen, oder Sich-Hineinversetzen in Situation erreichen da Spiele meist gespielt werden, um Spaß zu haben oder Langeweile zu vertreiben andere Modelle von Nöten Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 XII. Soziale Motivation 1. WAS IST HILFEVERHALTEN? freiwilliges Verhalten (kein Helfen von Ärzten etc.) mit der Absicht, jemandem zu helfen oft mit persönlichen Nachteilen verbunden 2. BEREITSCHAFT ZUR INTERVENTION BEI «NOTFÄLLEN» 2.1. LATANÉ & DARLEY (1968) Eindringen von Rauch in Experimentalraum wenn Vp. allein: 75% schlagen Alarm nach 2 Minuten zu dritt: 13 % nach 6 Minuten Situation umgedeutet: kein Notfall (z. B. harmloser Wasserdampf) Angst, sich lächerlich zu machen aber: starke Aktivierung aller Beobachter (keine Apathie) 2.2. LATANÉ & RODIN (1969) «Fall von der Leiter» allein: 70% Hilfeleistung zu zweit: 40% Situation nicht umdeutbar (!) 2.3. DARLEY & LATANÉ (1968) simulierter epileptischer Anfall während einer Gruppendiskussion linearer Abfall der Hilfebereitschaft mit zunehmender Gruppengröße Ursachen: u. a. Aufteilen von Verantwortung 2.4. PILIAVIN ET AL. (1969) U-Bahn in N. Y. City «Opfer» mit Krückstock: 95% helfen innerhalb von 5 Sekunden «Opfer» mit Alkoholfahne: 50% helfen innerhalb von 30 Sekunden Situation kann nicht umgedeutet werden kein Entrinnen aus Situation möglich kein Abschieben der Verantwortung Variierte Variablen: selbstverschuldet (keine Hilfebereitschaft) vs. nicht selbstverschuldet Opfer blutet oder nicht Geschlecht der Helfer: Frauen halfen weniger häufig 2.5. BRYAN & TEST (1967) Dame mit Autopanne, 1 km davor eine andere Autopanne wenn dort jemand half: 58 von 4000 halten wenn nicht: 35 von 4000 halten 42 Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 43 2.6. STAUB (1971) simulierter Notfall im Nachbarraum Bedingungen: Nebenraum darf betreten werden vs. nicht vs. kein Hinweis auf Nebenraum bei Erlaubnis deutlich mehr Hilfeleistung; Verbot oder kein Hinweis: keine Unterschiede 2.7. DARLEY & BATESON (1973) Theologiestudenten 2 Bedingungen: 2 Seminarthemen (guter Samariter vs. neutral: berufliche Probleme) Zeitdruck variiert (Vortrag zum Thema vorbereiten) auf dem Weg über den Hof kauert jemand in der Ecke Ergebnisse: Thema kaum Einfluss aber: je höher Zeitdruck, desto weniger helfen 2.8. BEAMAN ET AL. (1978) Aufklärung über Hilfebereitschaft in Notfällen (Film, Vortrag) vs. nicht 14 Tage später: Vgr: 43% Hilfe Kgr: 25% Hilfe 2.9. COHE ET AL. (1978) Bedeutung von Empathie erhoben über Fragebogen oder induziert durch Instruktionen angebliches Medikament verabreicht mit Information «entspannend» vs. «aktivierend» Radio: Kommilitonin kann sich nicht mehr um Studium kümmern, da Eltern bei Unfall ums Leben gekommen seien und sie auf kleine Geschwister aufpassen müsste wenn Erregung durch Medikament erklärbar: nicht so viele Hilfsangebote Empathie-Effekt ??? 3. EINFLUSSFAKTOREN FÜR HILFEHANDELN Entscheidungsbaum beim Hilfehandeln nach LATANÉ & DARLEY (1968): Vp muss Vorfall bemerkt haben Vp muss Vorfall als Notsituation interpretieren Vp muss sich verantwortlich fühlen Hilfe Einflussfaktoren: a) Merkmale des Opfers Ähnlichkeit mit Helfer wirkt sich positiv aus nicht, wenn Vp der Situation nicht entrinnen kann (Bsp. PILIAVIN et al. (1969)) Blut, Verletzungen, Schwere des Notfalls wenn psychische Kosten (z. B. Ekel, eigene Bedrohung) zu hoch: Hilfsbereitschaft sinkt Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 44 Beziehung Opfer – Helfer spielt große Rolle (z. B. ob Opfer vorher selbst geholfen hat) Erklärungen: abhängigen, hilfsbereiten Menschen hilft man eher aktivieren Normen des sozialen Hilfehandelns b) Situationsabhängigkeit Zahl der Zuschauer (je mehr, desto niedriger Hilfebereitschaft) Erklärung: Aufteilung der Verantwortung; Passivität der anderen suggeriert Interpretation als Nicht-Notfall Zeitdruck c) Merkmale der «Zuschauer» Empathie emotionale Erregung wahrgenommene eigene Kompetenz 4. THEORIEN ALTRUISTISCHEN VERHALTENS a) Aktivierung-Kosten-Nutzen-Theorie PILIAVIN (1969, 1981) Annahme: jede Notsituation führt zur unangenehmen Erhöhung der Aktivierung Bestrebung, diese Aktivierung so ökonomisch wie möglich zu reduzieren Kosten-Nutzen-Überlegungen gegenseitig abwägen erregunserhöhende situative Faktoren: Schwere des Notfalls Eindeutigkeit der Notsituation Ähnlichkeit Beobachter – Opfer keine selbstverschuldete Notlage physische Nähe zum Opfer 5-Stufen-Modell: 1) Situation als Notfall wahrgenommen? (ja) 2) Aktivierung empfunden? 3) Aktivierung dem Notfall zugeschrieben? 4) Berechnung von Kosten und Nutzen für Helfen oder Nichthelfen 5) Entscheidung und Handeln (Hilfe bzw. keine Hilfe) Kosten für Hilfeleistung: Zeit, Geld, Aufwand, Ekel, Befürchtung, sich lächerlich zu machen Nutzen bei Hilfe: Lob, Anerkennung, Selbstwertsteigerung, Stolz, nach Norm gehandelt zu haben Kosten bei Nichthilfe: Schuldgefühle, Vorwürfe, Strafen, Schaden für das Opfer, Selbstwertminderung Nutzen bei Nichthilfe: ungestörte Fortführung eigener Aktivitäten, Vermeidung von eventuellem Schaden Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 45 Abbau der Aktivierung: direkte Hilfe indirekte Hilfe (Arzt holen) Flucht Abwertung des Opfers Umdeutung der Situation Ignoranz der Situation b) Empathie-Altruismus-Hypothese BATSON (1987) Grundannahme: echter Altruismus ist selten am häufigsten: egoistische Motive (Belohnung, Lob, SWG stärken etc.) oder: Motivation, das eigene Unbehagen / die Aktivierung abzubauen (auch Egoismus) echter Altruismus = Hilfe als Selbstzweck Empathie-bedingte Motivation = altruistische Motivation, dem Opfer zu helfen (Empathie im Zentrum der Theorie) Kritk der Theorie: Empathie ungeignet experimentell simuliert Alternativerklärung: CIALDINI et al. (1987): Modell der negativen-Stimmungsreduktion Empathie löst negative Stimmung aus Abbau der negativen Stimmung durch Hilfe Hilfe für Opfer egoistisch motiviert c) Soziologische Theorie: soziale Normen Wir helfen, wenn wir uns dazu verpflichtet fühlen, weil dies der Norm entspricht. Normen = soziale Erwartungen bestimmten Verhaltens in bestimmter Situation 2 Normen: Norm der Reziprozität: Ich helfe denen, die mir geholfen haben. Norm der sozialen Verantwortung: Erwartung, dass Personen denjenigen helfen, die von ihnen abhängig sind Kritik: situative, personelle, kognitive Faktoren nicht berücksichtigt d) Soziobiologische Theorien Altruismus dient dem Erhalten der Art bzw. Sippe echten Altruismus (Empathie) gibt es nicht Belege: biologische Verwandtschaft: bei Katastrophen hilft man zuerst Familie, dann Freunden etc. Reziprozität: Helfen nach dem Kooperationsprinzip hat selektive Vorteile; Betrüger werden universell verachtet (Bsp.: Fledermäuse geben Beute an andere, die vorher sie gefüttert haben) 5. GESELLUNGSSTREBEN (AFFILIATION) Stanley SCHACHTER (1959): need for affiliation = überdauerndes Motiv zur Gesellung, insbesondere in angstbesetzten Situationen Sozialpsychologie II – Script von Tobias Elze, 1999 46 Warum Gesellungsstreben? SCHACHTER (1959): 3 Experimente 1. Experiment: 2 Gruppen von Vpn; angebliche Elektroschocks angekündigt; schmerzhaft vs. harmlos Fragebogen nach Angst und ob lieber allein warten oder in Gesellschaft Ergebnis: bei Angst lieber in Gesellschaft aber: Wessen Gesellschaft sucht man? 2. Experiment: lieber warten mit anderen Vpn oder mit Unbeteiligten? Ergebnis: lieber mit Personen mit dem gleichen Schicksal bestätigt durch ZIMBARDO & FORMICA: lieber mit Leuten, die Experiment noch vor sich hatten aber: Warum Gesellungsstreben? 3. Experiment: Kommunikationsbedingungen in Wartezeit variiert: nicht über Experiment sprechen vs. gar nicht sprechen Ergebnis: keine Unterschiede nonverbale soziale Vergleichsprozesse Ursache bestätigt von WRIGHTSMAN (1960): Furchtreduktion durch Anwesenheit anderer Vpn durch Fragebogen erhoben auch Einfluss auf SCHACHTERs Gefühlstheorie GERARD & RABBIE (1961): Exp. wie SCHACHTER, aber mit angeblicher Aufzeichnung der Hautleitfähigkeit nur eigene vs. auch die der anderen sichtbar in letzterer Bedingung: affiliation soziale Vergleichsprozesse Ergänzungen: Stress führt nicht immer zu Affiliation: bei mittlerer Angst Gesellschaft gesucht, bei starker eher gemieden (NOLLEMAN et al. 1986) bei Angst als trait: bei Hochängstlichen (trait) kein stärkeres Gesellungsstreben mit Personen in ähnlichen Situationen (eher hingezogen zu Personen mit ähnlicher Persönlichkeit oder hilfreichen Personen) (vgl. HERKNER, S. 468-471)