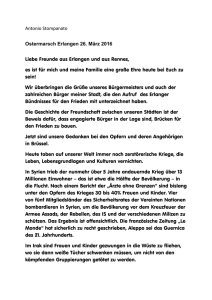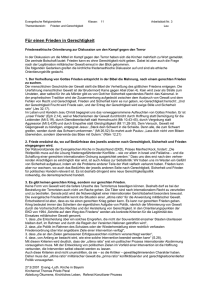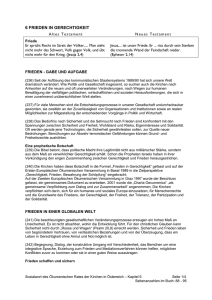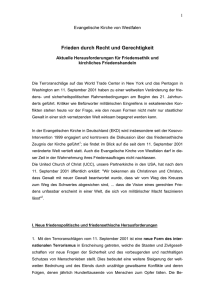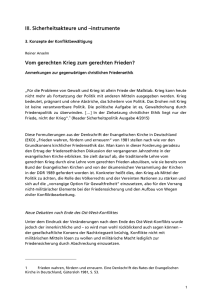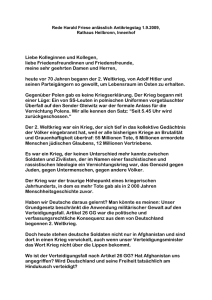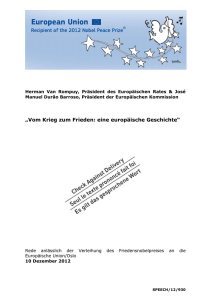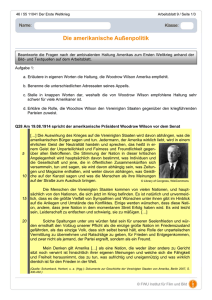Christentum und Gewalt bzw
Werbung
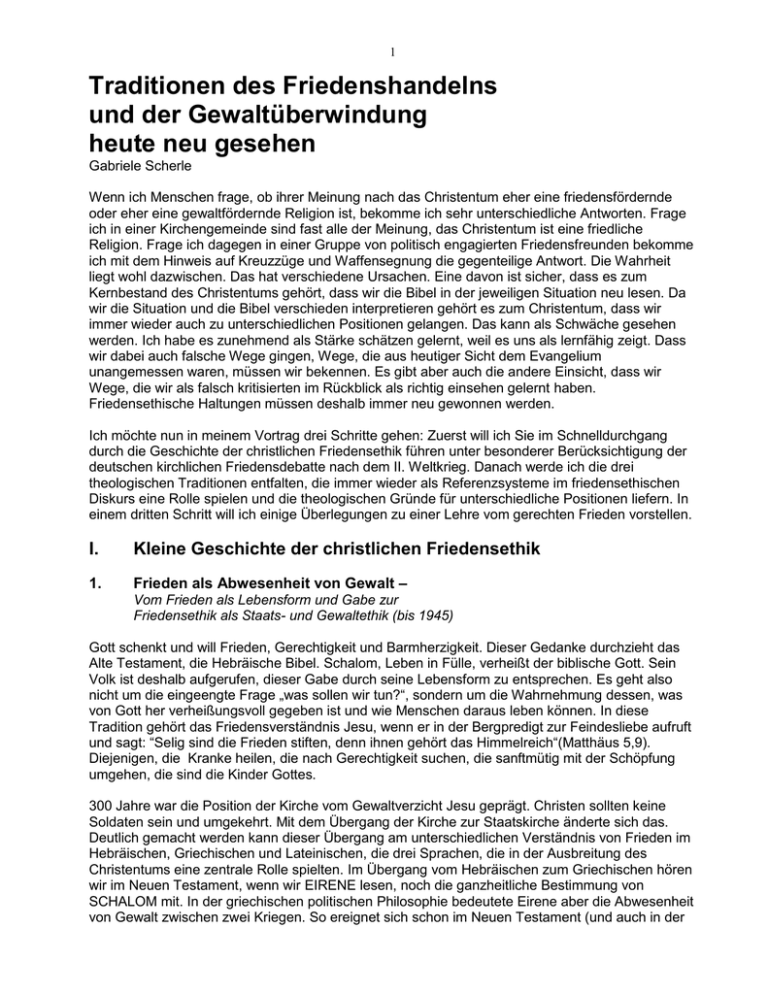
1 Traditionen des Friedenshandelns und der Gewaltüberwindung heute neu gesehen Gabriele Scherle Wenn ich Menschen frage, ob ihrer Meinung nach das Christentum eher eine friedensfördernde oder eher eine gewaltfördernde Religion ist, bekomme ich sehr unterschiedliche Antworten. Frage ich in einer Kirchengemeinde sind fast alle der Meinung, das Christentum ist eine friedliche Religion. Frage ich dagegen in einer Gruppe von politisch engagierten Friedensfreunden bekomme ich mit dem Hinweis auf Kreuzzüge und Waffensegnung die gegenteilige Antwort. Die Wahrheit liegt wohl dazwischen. Das hat verschiedene Ursachen. Eine davon ist sicher, dass es zum Kernbestand des Christentums gehört, dass wir die Bibel in der jeweiligen Situation neu lesen. Da wir die Situation und die Bibel verschieden interpretieren gehört es zum Christentum, dass wir immer wieder auch zu unterschiedlichen Positionen gelangen. Das kann als Schwäche gesehen werden. Ich habe es zunehmend als Stärke schätzen gelernt, weil es uns als lernfähig zeigt. Dass wir dabei auch falsche Wege gingen, Wege, die aus heutiger Sicht dem Evangelium unangemessen waren, müssen wir bekennen. Es gibt aber auch die andere Einsicht, dass wir Wege, die wir als falsch kritisierten im Rückblick als richtig einsehen gelernt haben. Friedensethische Haltungen müssen deshalb immer neu gewonnen werden. Ich möchte nun in meinem Vortrag drei Schritte gehen: Zuerst will ich Sie im Schnelldurchgang durch die Geschichte der christlichen Friedensethik führen unter besonderer Berücksichtigung der deutschen kirchlichen Friedensdebatte nach dem II. Weltkrieg. Danach werde ich die drei theologischen Traditionen entfalten, die immer wieder als Referenzsysteme im friedensethischen Diskurs eine Rolle spielen und die theologischen Gründe für unterschiedliche Positionen liefern. In einem dritten Schritt will ich einige Überlegungen zu einer Lehre vom gerechten Frieden vorstellen. I. Kleine Geschichte der christlichen Friedensethik 1. Frieden als Abwesenheit von Gewalt – Vom Frieden als Lebensform und Gabe zur Friedensethik als Staats- und Gewaltethik (bis 1945) Gott schenkt und will Frieden, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Dieser Gedanke durchzieht das Alte Testament, die Hebräische Bibel. Schalom, Leben in Fülle, verheißt der biblische Gott. Sein Volk ist deshalb aufgerufen, dieser Gabe durch seine Lebensform zu entsprechen. Es geht also nicht um die eingeengte Frage „was sollen wir tun?“, sondern um die Wahrnehmung dessen, was von Gott her verheißungsvoll gegeben ist und wie Menschen daraus leben können. In diese Tradition gehört das Friedensverständnis Jesu, wenn er in der Bergpredigt zur Feindesliebe aufruft und sagt: “Selig sind die Frieden stiften, denn ihnen gehört das Himmelreich“(Matthäus 5,9). Diejenigen, die Kranke heilen, die nach Gerechtigkeit suchen, die sanftmütig mit der Schöpfung umgehen, die sind die Kinder Gottes. 300 Jahre war die Position der Kirche vom Gewaltverzicht Jesu geprägt. Christen sollten keine Soldaten sein und umgekehrt. Mit dem Übergang der Kirche zur Staatskirche änderte sich das. Deutlich gemacht werden kann dieser Übergang am unterschiedlichen Verständnis von Frieden im Hebräischen, Griechischen und Lateinischen, die drei Sprachen, die in der Ausbreitung des Christentums eine zentrale Rolle spielten. Im Übergang vom Hebräischen zum Griechischen hören wir im Neuen Testament, wenn wir EIRENE lesen, noch die ganzheitliche Bestimmung von SCHALOM mit. In der griechischen politischen Philosophie bedeutete Eirene aber die Abwesenheit von Gewalt zwischen zwei Kriegen. So ereignet sich schon im Neuen Testament (und auch in der 2 griechischen Übersetzung der Hebräischen Bibel, der Septuaginta) eine Akzentverschiebung: vom Frieden als Gabe und Lebensform zum Frieden als Zwischenkriegszustand. Nachdem aber das Neue Testament in lateinischer Sprache (die Vulgata) die Bezugsgröße der westlichen Christenheit wurde, kam es zu einer weiteren Akzentverschiebung. Das lateinische PAX wurde im Zusammenhang mit der Pax Romana gehört. Frieden gesichert durch die militärische Macht Roms. Frieden wird nun als Herrschaftsform verstanden. So ist vielleicht nachvollziehbar, dass fast 2000 Jahre lang christliche Friedensethik vor allem Staats- und Gewaltethik war und die Frage bearbeitete, unter welchen Bedingungen Christen Krieg führen dürfen. Dass die Frage nach unserem Umgang mit Gewalt auch alle anderen Bereiche des Lebens umfasst, war bis in die 1970er Jahre außer in randständigen christlichen Bewegungen nicht Gegenstand des friedensethischen Nachdenkens. In diesem Kontext einer Staats- und Gewaltethik wurde in der Alten Kirche die Lehre vom gerechten Krieg auf dem Hintergrund antiker Quellen von Augustin und später von Thomas von Aquin entwickelt. Das Problem dieser Lehre ist es, dass sie zwar zur Begrenzung von Gewalt entwickelt wurde, aber im Laufe der Zeit immer mehr zur Rechtfertigung von Kriegen diente. Dabei ist aus dem Blick geraten, dass die "Lehre vom Gerechten Krieg" seit Augustin ein Versuch war, die Gewaltanwendung zwischen (christlichen) Staaten zu verringern. Gewalt konnte nicht einfach ausgeübt werden, sie war zu begründen. Bis heute ist diese Lehre das einflussreichste Referenzkonzept beim Nachdenken über Frieden in der römisch-katholischen und den evangelischen Kirchen. 2. Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein! – Von der Friedensethik als Staats- und Gewaltethik zum Nuklearpazifismus (bis 1989) Der friedensethische Konsens der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik lässt sich mit dem einfachen Satz zusammenfassen: „Nie wieder Krieg!“ Im Raum der Kirche wurde dies als religiös begründete Einsicht verstanden: "Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein!" Es war, als hätte es schon immer so eindeutig klar sein müssen: In Gottes Namen lässt sich kein Krieg rechtfertigen. Die traumatische Erfahrung zweier Weltkriege und die Erkenntnis der Mitschuld von Christen und Kirchen an diesen Kriegen haben diese Neubesinnung auf die Fragen von Krieg und Frieden eingeleitet. Daneben führte die Gefahr der Auslöschung der gesamten Menschheit durch Atomwaffen zum o. g. Bekenntnis der Kirchen. Viele verstanden diese Worte als Absage an die Lehre vom gerechten Krieg. Zu lange hatte diese zur Rechtfertigung von Gewalt herhalten müssen, jetzt schien es an der Zeit eine neue Friedensethik zu entwickeln. Es war aber die Idee der Gewaltbegrenzung - und nicht wie bis in unsere Tage vermutet wird - die pazifistische Option, die in der Nachkriegszeit zu dem Ruf: "Nie wieder Krieg!" führte. Ob mit oder ohne biblische Begründung, der Konsens der Nachkriegszeit war klar. Im Zeitalter atomarer, biologischer und chemischer Waffen und der Konfrontation von NATO und Warschauer Pakt war die Verhinderung von Krieg das von allen geteilte politische Anliegen. Die Frage, unter welchen Bedingungen es gerechtfertig, bzw. geboten sein könnte, militärische Gewalt anzuwenden, war unter dem Eindruck der möglichen Totalvernichtung bei einem atomaren Krieg nicht mehr im Blick. Im Rückblick auf die fünf Jahrzehnte (1945 – 1989) politischen Streits um die richtigen Wege der Verhütung eines großen Krieges zwischen den Supermächten ist das gemeinsame Anliegen heute deutlich: Um Gottes Willen keinen Krieg. Umstritten war allerdings, wie dieses Ziel am besten zu erreichen sei. Die einen meinten, die Bereithaltung großer Waffenarsenale, gepaart mit der Bereitschaft sie auch einzusetzen, sei dazu der beste Weg. Abschreckung sollte den Frieden sichern. 3 Die anderen meinten, auf Dauer ließe sich Krieg nicht durch immer mehr Waffen und eine Politik der Konfrontation verhindern. Nein, Abrüstung, zur Not auch einseitig, schien der einzig richtige Weg. Vor allem die immensen Kosten, an Ressourcen und Intelligenz, die das Abschreckungssystem band, und die zur Bekämpfung von Hunger und Unterentwicklung fehlten, waren im Blick. Abrüstung, Entspannung und Entwicklungspolitik sollten den Frieden ermöglichen. Deutliches Kennzeichen dieser Neubesinnung war die Umorientierung von der Frage der Erlaubtheit des Krieges hin zur Frage nach den Bedingungen des Friedens. In der Friedensethik geht es nun nicht mehr um die Rechtfertigung des Kriegs, sondern um die Sicherung eines gerechten Friedens. 3. Auf der Suche nach einer Lehre vom gerechten Frieden Die Wiedergewinnung eine weiten Begriffs von Schalom und die Initiierung eines „konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“ (seit 1985, Ansätze seit den 70er Jahren) In der Folgezeit war die Friedensdiskussion bemüht, die als gefährlich erkannte theologische Rechtfertigung des Krieges angesichts der Massenvernichtungsmittel im Kontext des Kalten Krieges zu bekämpfen. Das führte zu einer immer deutlicheren "Absage an Geist, Logik und Praxis der Abschreckung". Entspannungspolitik und Rüstungskontrolle bildeten zunächst den engeren Kontext der Suche nach einem glaubwürdigen Friedenszeugnis der Kirchen. Seit Mitte der 70er Jahre wurde das Problem der Abrüstung dann im größeren Kontext sozialer und weltweiter Ungerechtigkeit gesehen und schließlich zusammen mit einer zunehmenden Naturzerstörung als Symptom einer komplexen Krise des Friedens erkannt, die die Zukunft der Menschheit und sogar ihr Überleben bedroht. Diese Erkenntnis spiegelt sich in dem von der Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen in Vancouver 1983 angestoßenen "konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der ganzen Schöpfung". Aus diesem Prozess entwickelten sich drei friedensethische Orientierungen, die so genannten vorrangigen Optionen für die Armen, für Gewaltfreiheit und für die Bewahrung der Schöpfung. Damit wurde die Reduzierung der Friedensfrage auf Kriegsdienstverweigerung und Rüstungskontrolle endgültig verlassen und in eine alle Lebensbereiche umfassende ethische Perspektive überführt, ohne kontextlos eine prinzipielle christliche Position des Gewaltverzichts zu behaupten. 4. Die neue Diskussion um Rechtfertigung militärischer Gewalt Vom Nuklearpazifismus zu „Humanitären Interventionen“ (seit 1992) zum „Krieg gegen den Terrorismus“ (nach dem 11. Sept. 2001) und zum Präemptivkrieg“ (Irak-Krieg 2003)bei gleichzeitiger Förderung ziviler Konfliktbearbeitung als Alternative oder Ergänzung militärischer Gewalt. Nach Beendigung des Ost-West-Konflikts ist nun die Blockkonfrontation einer Vielzahl von gewalthaltigen Konflikten gewichen. Viele von ihnen sind ethnisch-religiös aufgeladen. In dieser Situation (v. a. nach dem Golfkrieg und dem Bosnienkrieg) wurde die Frage laut, ob nicht die „Lehre vom gerechten Krieg" erneut zur Geltung gebracht werden müsste. Viele meinten, militärische Gewalt dürfe, ja müsse, als letztes Mittel zur Verfügung stehen und auch eingesetzt werden. Dies gelte im Sinn der Notwehr oder der Nothilfe für andere. Militärische Gewaltandrohung sei nicht nur nötig, um einzugreifen, wenn zivile Mittel der Konfliktregelung erschöpft sind, sondern auch als permanente Abschreckungsgeste, die die Ernsthaftigkeit der Beteiligten unterstreichen soll. Dieser Argumentation folgt auch die 1994 vorgelegte EKD-Stellungnahme "Schritte auf dem Weg des Friedens", obwohl dem Bekenntnis zur vorrangigen Option für die Gewaltfreiheit und der Entwicklung von Instrumenten der zivilen Konfliktbearbeitung viel Raum gegeben wird. Zu Beginn des Kosovokrieges rechtfertigte die deutsche katholische Bischofskonferenz, ebenso wie die EKD, 4 die Beteiligung deutscher Soldaten mit der Figur der „humanitären Intervention“ unter (implizitem) Bezug auf die Lehre vom gerechten Krieg, während der Vatikan und der Ökumenische Rat der Kirchen sich ablehnend zu diesem Krieg äußerten. Allerdings nahm der Ratsvorsitzende der EKD nach dem Kosovokrieg die legitimierende Argumentation zurück und bekannte, bei gründlicher Anwendung der Kriterien hätte dieser Krieg nicht geführt werden dürfen. Nach dem 11. September und dem darauf folgenden Afghanistankrieg gab es in den Kirchen wiederum Befürworter und Kritiker eines solchen „Krieges gegen den Terrorismus“. Allerdings zweifelten auch viele Befürworter daran, ob Bombardierungen die angemessene, Erfolg versprechende Antwort auf diese Art von Terrorismus sind. Gegen den Irakkrieg sprachen sich dann in einer nie da gewesenen Breite weltweit fast alle großen Kirchen aus. Selbst aus der Perspektive der Vertreter einer Lehre vom gerechten Krieg waren die fehlende völkerrechtliche Autorität, die Zweifel an einer Gefährdung des internationalen Friedens durch den irakischen Zugriff auf Massenvernichtungswaffen, sowie die Gefahr einer großen Zahl von Opfer und einer Destabilisierung der ganzen Region hinreichend, um diesen Krieg nicht zu legitimieren. Deshalb hat sich auch der Rat der EKD gegen den Irakkrieg ausgesprochen. 5. Zusammenfassung Der knappe Blick auf die Geschichte christlicher Friedensethik zeigt, dass der Friedensbegriff schon sehr früh eine Einengung erfahren hat, die zu einer Jahrhunderte dauernden Fixierung auf die Beteiligung an und die Legitimität von staatlicher Gewalt geführt hat. Diese Einengung wurde in den Jahrzehnten nach 1945 aufgebrochen. Die Versuche, einen weiten Friedensbegriff wiederzugewinnen, treffen heute auf neue Versuche der Legitimierung militärischer Gewalt. Dadurch stellen sich grundsätzliche friedensethische Fragen neu. Die geschichtliche Skizze hat außerdem darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Vielzahl friedensethischer Positionen gab und gibt. Diese verdanken sich offensichtlich nicht allein unterschiedlichen politischen Perspektiven und Positionen. Sie berufen sich jeweils auch auf biblische und kirchliche Traditionen. Im Folgenden soll untersucht werden, was diese unterschiedlichen Bezugnahmen möglich macht. Dabei wird die Frage zu klären sein, ob das Christentum entweder auf „Gewaltverzicht“, „Begrenzung von Gewalt“ oder „Heilige Gewalt“ festzulegen ist oder ob alle drei Traditionen für die friedenethische Orientierung heranzuziehen sind. II. Friedensethische Traditionen im Christentum Auf der Grundlage der biblischen Schriften setzt sich das Christentum in dreifacher Weise mit dem Problem der Gewalt auseinander. (vgl. Roland Bainton „Christian Attitudes Towards War and Peace“,1960). Die erste Tradition ist die Tradition des prinzipiellen Gewaltverzichts, deren Grundlagen z.B. in der Bergpredigt zu finden sind. Die zweite Weise des Umgangs mit Gewalt ist die Tradition der Legitimierung von begrenzter Gewalt durch die legale (und göttlich eingesetzte) Autorität. Diese Sichtweise speist sich aus biblischen Texten, wie z.B. Römer 13 („Seid untertan der Obrigkeit …“) oder Matthäus 22,21 („… gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist…“). Neben diesen beiden Traditionen war im Christentum immer auch eine dritte Tradition virulent, die wir im Kontext der Kirche gerne vergessen, die Tradition der Heiligen Gewalt, die besonders auf apokalyptischen Bibelstellen fußt, wie z.B. Offenbarung 13. Ich will nun mit der zweiten Tradition beginnen, nicht zuletzt, weil sie die einflussreichste Tradition in unserer Kirche ist und war. 5 1. Tradition der Begrenzung von Gewalt Den wichtigsten Beitrag zur Begrenzung von Gewalt hat ohne Zweifel die Entwicklung und Durchsetzung des Rechtes geleistet. Dieser Prozess spiegelt sich etwa in den Texten des Alten Testaments. Er durchzieht aber die ganze Geschichte des Abendlandes (und anderer Kulturkreise). Und auch heute ist die Frage, ob und wie die Gewalt durch das Recht begrenzt werden kann, im Zentrum der politischen Auseinandersetzungen und friedensethischen Reflexionen. 1. Kriterien für die Begrenzung kriegerischer Gewalt Am einflussreichsten in der christlichen Geschichte war die Tradition der begrenzenden Gewalt in Form der Gewaltbegrenzungskriterien der „Lehre vom gerechten Krieg“, wie sie in der westlichen Kirche von Ambrosius und Augustin, Thomas von Aquin und Martin Luther entwickelt wurde. Die Intention lag darin, die Entscheidung zum Krieg so schwierig wie möglich zu machen (ius ad bellum), und im Falle des Krieges die Gewalt so weit wie möglich zu begrenzen (ius in bello). Ziel der Kriterien war es, dem christlichen Staat in einer Situation Orientierung zu verschaffen, in der sich gleichermaßen legitimierte (christliche) Staaten gegenüberstanden und unter Berücksichtigung der jeweiligen militärischen Entwicklungen. Dies ist der Grund, warum die Staatenordnung des Westfälischen Friedens seit dem 17. Jahrhundert – als Reaktion auf die konfessionellen Kriege und mittels der Entlegitimierung einer religiös aufgeladenen Lehre vom gerechten Krieg - nur zwei Ausnahmen für das allgemeine Friedensgebot kennt: die Selbstverteidigung eines Staates im Falle eines Überfalls und die Selbstverteidigung der Staatengemeinschaft im Falle der Bedrohung des Internationalen Friedens. Zugespitzt ließe sich sagen, dass das heutige Völkerrecht eigentlich keine Lehre vom gerechten Krieg mehr kennt. Es lassen sich – unterschiedliche Traditionen zusammenführend - sieben Kriterien zur Begrenzung von militärischer Gewalt nennen. Die ersten fünf beziehen sich auf den Kriegsbeginn (ius ad bellum) und die zwei anderen auf die Kriegsführung (ius in bello). Die Pflicht zur Begründung liegt bei denen, die den Krieg führen wollen, und es reicht nicht, sich dazu einzelne Kriterien herauszugreifen. Dabei ist das geltende Völkerrecht Bezugsrahmen für die Begründung. Um einen Krieg zu beginnen müssen folgende Kriterien erfüllt sein: 1. Gerechter Grund: Die einzig mögliche Begründung, heute würden wir sagen, der einzig rechtmäßige Grund, für einen Krieg ist die Notwehr: Auf sie beruft man sich zu Recht, um das Leben der Staatsbürger oder die Einheit des Staates zu verteidigen, wenn sie angegriffen werden. Heute ist allgemein anerkannt, dass ein Staat auch das Recht hat, einen Nachbarstaat oder einen verbündeten Staat durch Nothilfe militärisch zu unterstützen, wenn dieser angegriffen wird. Neben der Selbstverteidigung gilt heute die Bedrohung des internationalen Friedens z.B. durch Massenvernichtungsmittel und – angesichts der jüngsten Entwicklungen - durch Terrorismus als rechtmäßiger Grund für militärisches Eingreifen. Die Tatsache, dass auch Staaten kriminell werden können, hat Folgen für die Entwicklung des Völkerrechts seit 1945. So können heute auch dramatische Menschenrechtsverletzungen und Völkermord (z.B. massenhaftes Sterben von Menschen infolge von Krieg, Chaos und unterlassener Hilfeleistung bei Hungerkatastrophen; Massenvertreibungen aus rassistischen u. ä. Gründen.) als Bedrohung des internationalen Friedens wahrgenommen werden und eine „humanitäre Intervention“ begründen. 2. Legitime Autorität: Ein Krieg darf nur von einer legitimen Autorität erklärt werden. Sie trägt Verantwortung für das allgemeine Wohl der Bevölkerung und ist normalerweise die Regierung des Landes. Privatpersonen oder Gruppen sind nicht berechtigt, einen Krieg zu erklären. Nach dem Völkerrecht ist heute nur der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen als legitime Autorität einer Kriegserklärung für den Fall einer Bedrohung des internationalen Friedens zu betrachten. 6 3. Rechte Absicht: Die einzig legitime Ziel ist es, den Frieden zu fördern bzw. wieder herzustellen. Jede andere Absicht, wie z.B. Rache, Vergeltung, Eroberungsdrang, Herrschaftsansprüche, wirtschaftlicher Gewinn etc., ist verwerflich und moralisch nicht zu rechtfertigen. 4. Letzte Zuflucht: Ein Krieg darf erst begonnen werden, wenn alle nicht-militärischen Druckmittel vergeblich angewendet und ausgeschöpft wurden. Solange politische Mittel zur friedlichen Konfliktlösung bestehen, wie z. B. Verhandlungen, diplomatischer Druck, wirtschaftliche Sanktionen etc., kann ein Krieg nicht gerechtfertigt sein. 5. Aussicht auf Erfolg: Nur wenn eine ausreichend hohe Wahrscheinlichkeit besteht, die Situation zu verbessern und einen gerechten Frieden zu erzwingen, darf militärische Gewalt angewendet werden. Wird ein Krieg begonnen, müssen folgende Kriterien erfüllt werden: 6. Die Unterscheidung zwischen Kämpfenden und Nicht-Kämpfenden, zwischen Militär und unbeteiligten Zivilisten muss eingehalten werden. Zivilisten und nicht-militärische Ziele dürfen nicht absichtlich angegriffen oder vernichtet werden. Man muss also versuchen, den 'Kollateralschaden' zu vermeiden bzw. so gering wie möglich zu halten. 7. Die Verhältnismäßigkeit zwischen den Schäden, Opfern und Kosten des Kriegs sowie den guten Folgen, die der Krieg erreichen will, muss angemessen sein. Die Übel, die der Krieg zufügt, müssen kleiner sein als das Unrecht, das er beseitigen soll. 2. Durchsetzung von gewaltfreien Zeiten und Räumen Historisch sind wir in der Lage, noch andere Anstrengungen zur Begrenzung von Gewalt zu identifizieren. Im Mittelalter bekam die Begrenzung von Gewalt durch die Schaffung von gewaltfreien Zeiten und Räumen politische Relevanz. Im Kontext einer Gesellschaft, die geprägt war von „wilder Gewalt“, unkontrolliert von jeder zentralen Autorität, wurde durch die Gottesfriedensbewegung im 11. bis 13. Jahrhundert dazu aufgerufen, an bestimmten Zeiten, die in besonderer Weise Gott gehören, z.B. während der hohen Festtage und der Fastenzeiten, die Waffen ruhen zu lassen. Erinnert sei, dass deutsche und alliierte Soldaten während des 1. Weltkrieges an der Westfront gegen den Wunsch ihrer Vorgesetzten eine Waffenruhe an Weihnachten erreichen konnten. Diese Tradition ist immer noch wirksam, so z.B. als Weihnachten 1972 die Unterbrechung der Bombardierung Nordvietnams gefordert wurde oder als die christlichen Kirchen während des Ramadan 2001 die Unterbrechung des Afghanistankrieges durchsetzen wollten, interessanter Weise obwohl im Islam während des Ramadan immer auch Krieg geführt wurde. Die Gottesfriedens-Bewegung erneuerte auch die alte Idee, heilige Räumen von Gewalt freizuhalten. Das Konzept der Zufluchtstädte im Alten Testament ist dafür der Bezugspunkt. Im Christentum sind auf diesem Hintergrund Kirchen und Altäre Orte geworden, in und an denen keine Gewalt ausgeübt werden durfte. Unter Berufung auf diese Tradition gewähren heute Kirchengemeinden Kirchenasyl. Obwohl wir keine rechtsfreien Räume haben, übertritt der Staat nur sehr selten diese Grenze im Respekt vor dieser Tradition. Die atomwaffenfreien Zonen der Friedensbewegung in den 80 Jahren erinnern ebenfalls an die Tradition der gewaltfreien Räume. 3. Monopolisierung von Gewalt Neben den Gewaltbegrenzungskriterien der Lehre vom gerechten Krieg und den Bemühungen um Zeiten und Orten ohne Gewalt, muss die m. E. wichtigste Begrenzung von Gewalt erwähnt werden: Die Monopolisierung von Gewalt in der Hand des Staates. Sie ist ein Teil der Entwicklung der westlichen Zivilisation. In der europäischen Geschichte war die Monopolisierung der Gewalt ein effektiver Schritt im Bestreben, Gewalt zu minimieren. Deutlich wird die friedensfördernde Kraft heute durch die Erfahrung von entgrenzter Gewalt in einigen afrikanischen Staaten auf dem Hintergrund des Zerfalls staatlicher Strukturen. 7 Die gegenwärtige Debatte über die Rolle der Vereinten Nationen und des Sicherheitsrats folgt dieser Linie. Auch wenn man die Gefahr sieht, die in einem Weltstaat bestünde, so kann man die Attraktion, die in der Idee des Gewaltmonopols der UNO liegt, um zwischenstaatliche Gewalt zu entlegitimieren, verstehen. Wenn die UN nicht über internationale Polizeikräfte verfügen, eine Art polizeiliches Militär, und gegenwärtig bestehende Armeen sich nicht einbinden lassen in die Durchsetzung von internationalem Recht, dann ist diese Idee ohne konkrete Relevanz. 2. Die Tradition der Heiligen Gewalt Eine weitere christliche Haltung neben dem Gewaltverzicht und der Begrenzung von Gewalt ist die Tradition der „Heiligen Gewalt“, Gewalt im Namen Gottes, Frieden durch Auslöschung des Bösen. Nur widerstrebend wird hier bei uns diese Tradition als Teil der christlichen Tradition akzeptiert. Angesichts der Gewaltgeschichte der Kirche, aber auch der heutigen Rhetorik militanter Christen, vor allem in den USA, können wir nicht so tun, als gäbe es diese Tradition nicht. Es ist zu einfach, die Möglichkeit der Bezugnahme auf die „heilige Gewalt“ als nicht zum Christentum gehörig abzutun. Zum Christentum gehört die Hoffnung, dass Gott sich gegen das Böse durchsetzen wird. Besonders die apokalyptischen Texte des Alten und Neuen Testaments sind davon durchdrungen, aber auch in den Rache- und Klagepsalmen finden wir brutale Phantasien über das Strafen von Feinden und Widersachern. Wir in den Großkirchen haben diese Tradition den Fundamentalisten und Sekten überlassen. Wir haben weder die Gefahren noch die Chancen dieser Texte erkannt, so meine ich heute. Dabei geht es um ein wesentliches Problem, das wir gerne aussparen: das Böse. Die exegetischen Wissenschaften sind sich einig, dass die apokalyptischen Texte der Bibel (von Daniel über Abschnitte in den Evangelien bis hin zum Buch der Offenbarung) schlimmste Unterdrückung und Leiden widerspiegeln. Die Christenverfolgungen, die Katastrophen Israels sind ihre Hintergründe, neben persönlichen Dramen und Nöten, die in der biblischen Literatur aufbewahrt wurden. Die Hoffnung auf Bestrafung der Täter, das Ausmalen ihrer Leiden, die ihnen Gott zufügen möge, haben gerade wir modernen Theologinnen und Theologen oft ausgeblendet. Dass Opfer Genugtuung brauchen, um weiterleben zu können, dass Vergebung ein langer Prozess ist und Schuld aufgedeckt werden muss, wollten wir nicht ausreichend wahrhaben, obwohl dies zum Zentrum des christlichen Glaubens gehört, denken wir z.B. an die Vorgänge, die das Abendmahl darstellt. Die erwähnten biblischen Texte bieten eine Sprachhilfe zur persönlichen und politischen Bewältigung von Katastrophen. Dabei darf nie vergessen werden, dass die biblischen Schriften einen wesentlichen Vorbehalt kennen. Die Ahndung der Verbrechen liegt allein in Gottes Hand, die Begrenzung und Überwindung des Bösen ist nicht unsere Sache. Deshalb beten wir im Vater unser: „… und erlöse uns von dem Bösen“. Die Gefahr apokalyptischer Texte liegt darin, die Gewaltphantasien der Unterdrückten zu benutzen, um sich an die Stelle Gottes zu stellen und das Böse auslöschen zu wollen. Wenn aus politischen Gegnern absolute Feinde werden, wenn Menschen, Gruppen oder Staaten als das Böse identifiziert werden, dann sind alle Mittel der Zerstörung erlaubt, dann geht es um einen Kampf zwischen Gut und Böse, dann ist Friede die Auslöschung des Bösen. Immer wieder erlagen Christen dieser Versuchung. Die Kreuzzüge, die Ausrottung indigener Völker im Namen des Kreuzes, Judenverfolgungen im Mittelalter bis zur so genannten „Endlösung“ in Auschwitz sind gespeist von dieser Denkfigur. Aber auch die Bezeichnung der Sowjetunion als „Reich des Bösen“ in Zeiten des Kalten Krieges oder die Identifizierung von Ländern als „Schurkenstaaten“ oder „Achse des Bösen“ gehören in diese Tradition. Der amerikanische Theologe, Walter Wink, hat auch uns in Deutschland geholfen, hier weiterzukommen. So analysiert er in seinem Buch „ Engaging the Powers“ (1993), dass unsere Gesellschaften durchdrungen sind von einem „Mythos der erlösenden Gewalt“. Vom babylonischen Gilgamesch-Epos über eine weit verbreitete Comic- und Cyber-Kultur (z.B. Batman oder Lara 8 Croft) bis zu ungezählten Filmproduktionen wird die Vorstellung genährt, die Ordnung der Welt beruhe auf Gewalt, die das beständig drohende Chaos eindämmt. Wo sich die Sichtweise eingegraben hat, dass eine gute und heilsame Ordnung nur durch die überlegene Gewalt "der Guten" herzustellen oder zu bewahren ist, da wird der Gewaltanwendung in der Bekämpfung "der Bösen" eine erlösende Qualität zugeschrieben. Der Mythos selbst sieht nicht nur die menschliche Geschichte, sondern sogar die Schöpfung als Ergebnis eines Aktes ursprünglicher Gewalt. Auch Religion hat Anteil an dieser Mythologisierung der Gewalt. Wo immer "Sündenböcke" und "Opfer" zur Wiederherstellung einer vermeintlich "göttlichen" Ordnung gebraucht werden, da wird Gewalt sakralisiert und verschleiert (René Girard). Auch die biblischen Traditionen sind davon nicht frei und geraten in der Geschichte des Christentums in den Bann des Mythos der erlösenden Gewalt. Walter Wink weist darauf hin, dass diesem Mythos der erlösenden Gewalt nur durch einen anderen Mythos zu begegnen ist. Der tief sitzende Glauben, dass sich letztlich das Gute nur durch Gewalt durchsetzt bzw. durchsetzen lässt, kann nur durch eine andere tiefe Überzeugung überwunden werden: durch eine Spiritualität der Gewaltfreiheit. 3. Tradition des Gewaltverzichts Wie schon erwähnt, war die Haltung der Kirche zur Gewalt in den ersten drei Jahrhunderten geprägt vom Gewaltverzicht Jesu. Neben dem Friedensverständnis des Alten Testaments und dem Gebot der Feindesliebe aus der Bergpredigt spielte dabei die Geschichte von der Gefangennahme Jesu eine große Rolle. Im Kontext dieser Geschichte wird der Ausspruch Jesu überliefert: „Wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen.“(Matthäus 26,52). Aufbewahrt wurde diese Tradition in Gruppen am Rande der Kirche, bis heute in den so genannten historischen Friedenskirchen: den Quäkern, Mennoniten und der Kirche der Brüder, die auf den Schutz von Waffen verzichten und selber keinen Kriegsdienst für sich akzeptieren. (Ihnen haben wir die Carepakete nach dem 2. Weltkrieg zu verdanken.) Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela u. a. haben auf dieser Grundlage ihre politische Strategien entwickelt und gezeigt, dass der Verzicht auf Gewalt eben nicht den Verzicht auf Widerstand bzw. passives Hinnehmen des Unrechts bedeutet, sondern ein aktives Programm, das Entwicklung von Methoden und Training braucht. Seit Mitte der 90er Jahre engagieren sich Christen auch in Deutschland für die Etablierung eines Zivilen Friedensdienstes und für die qualifizierte Ausbildung von Friedensfachkräften, um aktiv in Vor- oder Nachkriegssituationen Friedensarbeit leisten zu können. In der Zwischenzeit gibt es eine Reihe von Friedensfachkräften, die in Krisengebieten arbeiten. So lange aber dem Aufbau solch einer Alternative oder Ergänzung nur ein Bruchteil der Mittel zur Verfügung stehen wie der Bundeswehr, muss sie den Nachweis ihre Leistungsfähigkeit schuldig bleiben. Das reicht aber nicht aus. Gewaltverzicht als christliche Haltung ist eine zutiefst spirituelle Haltung. Eine Haltung, die gespeist ist vom Glauben an die Durchsetzungskraft Gottes. Nur wer davon überzeugt ist mit ganzem Herzen, dass letztlich Gott Gerechtigkeit schaffen wird, kann diese Haltung einnehmen. Hier wird nicht an den guten Menschen geglaubt, sondern an den lebendigen Gott. Hier sehe ich die besondere Bedeutung der „Ökumenischen Dekade zur Überwindung von Gewalt“, die den Zusammenhang von Friedensarbeit und Spiritualität vorantreibt. Erst mit dem Pazifismus, der sich im Widerspruch zum Bellizismus der neuzeitlichen Nationalstaaten herausbildete, kam es zu dem Missverständnis, es handele sich beim christlichen Gewaltverzicht um eine quietistische Haltung. So konnte undeutlich werden, dass sich aus der jesuanischen Ankündigung des Schalom Gottes als Gabe und Lebensform eine aktive Haltung ergab. Krankenheilungen und Dämonenaustreibung sind Friedenszeugnisse. Sie sind Zeichen der beginnenden Heilung aller Kreatur, der Durchsetzung der Gerechtigkeit („Er stößt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen!“, Lukas 1, 52) und der versöhnten Beziehungen unter den Menschen. So ist auch der Gottesdienst, in dem diese Wirklichkeit erinnert, gefeiert und erwartet wird, christliche Friedensarbeit. 9 III. Auf der Suche nach einer Lehre vom gerechten Frieden Nehmen wir den Hinweis von Walter Wink auf, dann lässt sich der tiefere Grund erkennen, warum die Kriterien zur Begrenzung militärischer Gewalt in Gestalt der Lehre vom gerechten Krieg in der Regel nicht kriegsverhindernd gewirkt haben. Es ist der Sog des Mythos der erlösenden Gewalt, der sich hier auswirkt. Kriege als „gerecht“ zu bezeichnen, sich dabei der Pflicht einer genauen Begründung zu entziehen und stattdessen die andere Partei zu verteufeln, steht im Zusammenhang mit der Tradition heiliger Gewalt, nur dass dabei die „Erlösung vom Bösen“ nicht erbeten, sondern in die eigenen Hände genommen wird. Problematisch ist also nicht die Auseinandersetzung mit der Möglichkeit, dass Gewalt durch Gewalt begrenzt werden muss. Problematisch ist die Behauptung, dass durch Gewalt Erlösung von Gewalt möglich sei. Wird diese Unterscheidung beachtet, dann lässt sich auch die Notwendigkeit und der Ort einer Lehre vom gerechten Frieden beschreiben. An die Stelle des Mythos der erlösenden Gewalt muss eine Spiritualität der Gewaltfreiheit treten, die sich aus dem Vertrauen speist, dass es Gottes Durchsetzungskraft ist, die vom Bösen erlöst und einen gerechten Frieden schafft. Gottes Schalom zu erbitten und Zeichen für Gottes Gerechtigkeit zu setzen, entbindet aber nicht von der Aufgabe, in einer gewalttätigen Welt die Gewalt zu begrenzen. Dazu gehört dann nicht nur der Einsatz für die räumliche und zeitliche Eingrenzung von Gewalt oder für die Monopolisierung von Gewalt, sondern auch die Weiterentwicklung der Kriterien zur Begrenzung kriegerischer Gewalt, die jeden Präventivund Präemptivkrieg ausschließen. Politische Bausteine einer Lehre vom gerechten Frieden Die politische Forderungen konzentrieren sich, so weit ich sehe, auf drei Bereiche. Erstens wird eine Stärkung der Menschenrechte - durch die Verlagerung des Gewaltmonopols auf die Vereinten Nationen und die Ausweitung der internationalen Gerichtsbarkeit, wie im Den Haager Strafgerichtshof, gefordert, die eine Alternative zur militärisch konzipierten „humanitären Intervention“ darstellt. Zweitens soll der Unterminierung des Nationalstaats als Garant der Post-Westfälischen Friedensordnung entgegengewirkt werden durch die Stärkung der Staatengemeinschaft der Vereinten Nationen (gegenüber regionalen Sicherheitsbündnissen) und durch eine „Konstabularisierung“ des Militärs. Drittens muss eine Stärkung der so genannten Zivilgesellschaft erfolgen – durch die Förderung einer Politik der wechselseitigen Anerkennung und der interkulturellen Kommunikation – bis hin zu einer gesellschaftlichen Repräsentation von NGO’s und zivilgesellschaftlicher Assoziationen in den Vereinten Nationen. Vier Säulen und mögliche theologische Begründungen einer Lehre vom gerechten Frieden Bei den Versuchen einer theologischen Begründung zeigt sich bei uns ein eigentümlicher Mangel an Kreativität. Zu sehr sind die Überlegungen gefangen in dem Ringen um die Gewaltfrage. Dennoch lassen sich einzelne Elemente erkennen, die sich – um ein Bild zu nehmen – als Säulen einer Lehre vom gerechten Frieden anbieten. Immer wieder wird betont, dass die praktische Friedens- und Konfliktarbeit von Organisationen wie EIRENE, dem Ökumenischen Dienst im Konziliaren Prozess oder Pax Christi grundlegende Bedeutung hat. Es braucht Zeichen für Gottes Schalom, es braucht Menschen, die bereit sind, sich in Konflikte und Gewaltverhältnisse hineinzubegeben. Dafür bietet sich die theologische Figur der Inkarnation an: die Gewalt darf nicht sich selbst überlassen werden, sondern es geht darum, ihr einzuwohnen. Ein zweiter Aspekt ist die Bedeutung der Opferorientierung. Nur wenn es uns gelingt, beschädigte Sozialverhältnisse wieder zu heilen, wenn es gelingt, Erinnerungen zu heilen oder zu versöhnen, wenn Vergebung und Sühne in politische Prozesse eingebracht werden, hat ein gerechter Friede 10 eine Chance. Theologisch kann an das Motiv der wiederherstellenden Gerechtigkeit (restorative justice), besser noch: neuschaffenden Gerechtigkeit Gottes angeknüpft werden. Ich habe erlebt, dass mich Friedensforscher als Expertin für Versöhnung angesprochen haben und mich um Auskunft baten, wie denn Versöhnungsprozesse auf dem Hintergrund unserer jahrtausendlangen Erfahrung zu strukturieren wären. Erst diese Nachfrage hat auch mich an die alten Bußrituale der Kirche erinnert, die heute wieder zum Tragen kommen können. Zur Buße gehört in unserer Tradition die Reue, das öffentliche Bekenntnis der Schuld, die Bitte um Vergebung und die wiedergutmachenden Handlungen. Die Bedeutung dieses Rituals wird deutlich, wenn man es auf brennende Fragen wie z.B. den Nordirlandkonflikt, das Zusammenleben nach dem Bosnienkrieg, ja sogar auf die Frage nach der Lösung des Palästina-Israel-Konfliktes überträgt. Versöhnung der Erinnerungen, Heilung der Wunden ist möglich, wenn das, was in unserem alten Bußritual aufbewahrt ist, vorangeht. Am Beispiel Südafrika kann ich das deutlich machen. Mit der Wahrheits- und Versöhnungskommission wurde ein politisches Instrument geschaffen, das die Logik der Vergebung aufnimmt. Täter, die vor der Kommission ihre Taten nannten und ihre Schuld bekannten, wurden nicht mehr vor Gericht gestellt. Nicht für alle Opfer und Angehörigen von Gefolterten oder Ermordeten war das genug. Die Verbitterung war zu groß. Sie konnten nicht vergeben. Der Vorsitzende der Kommission, Bischof Tutu, war sich der Anmaßung bewusst, wenn er von einer stellvertretenden Vergebung sprach. Es ist die Anmaßung der geistlichen Autorität, die sich auf das Christusgeschehen beruft und das Abendmahl als Forum der Vergebung begreift. Indem Bischof Tutu Sitzungen der Kommission in Johannesburg in einer Kirche vor dem Altar durchführte – übrigens mit Zustimmung muslimischer Mitglieder – gab er dem Ausdruck. Dadurch eröffnete sich dem zutiefst verletzten Südafrika eine neue politische Zukunft. Es hat sich allerdings inzwischen gezeigt, dass damit die Frage der Wiedergutmachung nicht beantwortet ist. Das beschäftigt viele in Südafrika. Müssen nicht die Täter etwas tun, um wenigstens ein Zeichen für die Gerechtigkeit zu setzen. Wiedergutmachende Taten oder Leistungen können nicht die alten Verhältnisse wieder herstellen. Sie können aber ein Zeichen für die neu zu schaffende Gerechtigkeit sein. Theologisch muss neu betont werden, dass Versöhnung und Gerechtigkeit zusammengehören. Gottes Vergebung zielt auf neue, gerechte Verhältnisse. Deshalb wäre es eine Verharmlosung Gottes, Begriffe wie Rache oder Vergeltung auszublenden oder – antijüdisch – auf einen Gott des Alten Testaments zu verlagern, der mit dem Gott des Neuen Testaments nichts zu tun hätte. Es geht um die Anerkennung von Leid und Schmerz und die Hoffnung auf Heilung für die Opfer. Der dritte Aspekt ist die Betonung einer Spiritualität der Gewaltfreiheit, die nicht die Gewaltfreiheit ideologisch verabsolutiert, sondern die Gewaltfrage im Zusammenhang mit der Durchsetzung von Gerechtigkeit sehen kann. Es ist zu vermuten, dass christliche Gewaltfreiheit nur gelebt werden kann im Vertrauen auf die Durchsetzungskraft Gottes. Dieses Motiv der Durchsetzungskraft Gottes wäre die Neufassung einer politischen Theologie des Heiligen Geistes, der als Gotteskraft im Kampf gegen die Beschädigungen des Lebens ebenso wie in der Feier des Lebens aufzuspüren wäre. Damit ist, viertens, die Notwendigkeit einer Neuerfindung der Theologie in der Praxis der Überwindung von Gewalt deutlich geworden. Solche Theologie wird – mit biblischem Realismus den Widerstand der „Mächte und Gewalten“ gegen Gott mit bedenken müssen. Diese vier Säulen (oder Aspekte) einer Lehre vom gerechten Frieden sind m. E. tragfähig für eine erneuerte christliche Friedensethik. Die Lehre vom gerechten Krieg, die vom Mythos der erlösenden Gewalt geprägt ist, muss abgelöst werden. Wir brauchen eine Lehre vom gerechten Frieden, die sich aus der grundlegenden Überzeugung speist, dass sich am Ende Gottes Güte durchsetzen wird. In diesem Zusammenhang kann an den klassischen Kriterien der Begrenzung von Gewalt festgehalten werden. Aber befreit vom Glauben an eine Erlösung durch Gewalt, kann ihr eigentlicher Sinn wieder deutlich werden. Erst dann kann auch ganz klar gesehen werden, dass die wesentlichen Instrumente zur Begrenzung und Überwindung von Gewalt in der Kraft der Vergebung, in der Heilung der Erinnerung und in konkreter Friedens- und Entwicklungsarbeit liegen.