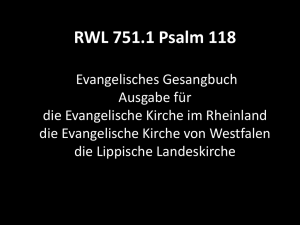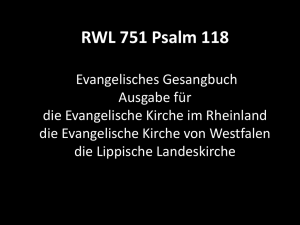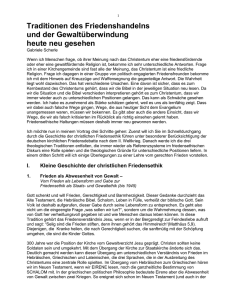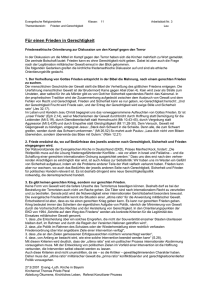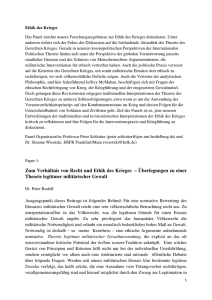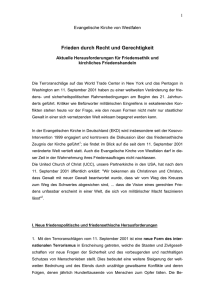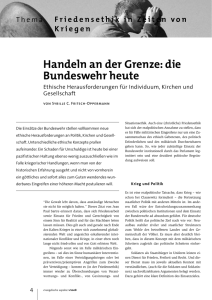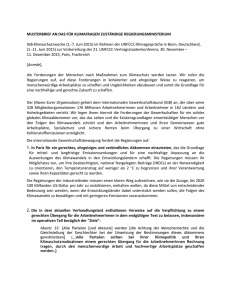Gerechter Krieg - Gerechter Friede_Korrektur_RA
Werbung

III. Sicherheitsakteure und –instrumente 3. Konzepte der Konfliktbewältigung Reiner Anselm Vom gerechten Krieg zum gerechten Frieden? Anmerkungen zur gegenwärtigen christlichen Friedensethik „Für die Probleme von Gewalt und Krieg ist allein Friede der Maßstab. Krieg kann heute nicht mehr als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ausgegeben werden. Krieg bedeutet, prägnant und ohne Abstriche, das Scheitern von Politik. Das Drohen mit Krieg ist keine verantwortbare Politik. Die politische Aufgabe ist es, Gewaltdrohung durch Friedenspolitik zu überwinden. […] In der Zielsetzung christlicher Ethik liegt nur der Friede, nicht der Krieg“.1 (Reader Sicherheitspolitik Ausgabe 4/2015) Diese Formulierungen aus der Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) „Frieden wahren, fördern und erneuern“ von 1981 stellen nach wie vor den Grundkonsens kirchlicher Friedensethik dar. Man kann in dieser Forderung geradezu den Ertrag der friedensethischen Diskussion der vergangenen Jahrzehnte in der evangelischen Kirche erblicken. Sie zielt darauf ab, die traditionelle Lehre vom gerechten Krieg durch eine Lehre vom gerechten Frieden abzulösen, wie sie bereits vom Bund der Evangelischen Kirchen und von der ökumenischen Versammlung der Kirchen in der DDR 1989 gefordert worden ist. Konkreter heißt dies, den Krieg als Mittel der Politik zu ächten, die Rolle des Völkerrechts und der Vereinten Nationen zu stärken und sich auf die „vorrangige Option für Gewaltfreiheit“ einzusetzen, also für den Vorrang nicht-militärischer Elemente bei der Friedenssicherung und den Aufbau von Wegen ziviler Konfliktbearbeitung. Neue Debatten nach Ende des Ost-West-Konfliktes Unter dem Eindruck der Veränderungen nach dem Ende des Ost-West-Konflikts wurde jedoch der innerkirchliche und – so wird man wohl rückblickend auch sagen können – der gesellschaftliche Konsens der Nachkriegszeit brüchig, Konflikte nicht mit militärischen Mitteln lösen zu wollen und militärische Macht lediglich zur Friedenssicherung durch Abschreckung einzusetzen. 1 Frieden wahren, fördern und erneuern. Eine Denkschrift des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Gütersloh 1981, S. 53. 1 Grund hierfür war die vermeintliche Evidenz lokaler humanitärer Katastrophen, auch wenn an der Oberfläche offizieller Verlautbarungen nach wie vor an der vorgegebenen Linie festgehalten wurde. Darum kam es vor dem Hintergrund der Kosovo-Krise zu deutlich divergenten Einschätzungen der Situation. Jetzt zeigte sich schnell: Aufflammende regionale Konflikte können es erfordern, notfalls und als ultima ratio, den Krieg als kleineres Übel anzuerkennen, eine Tendenz, die schon vorher in den entsprechenden Regionalkrisen wahrzunehmen gewesen war. Gleichzeitig aber wurden die Bewertungsmaßstäbe auch unklar und die Positionen uneindeutig: Im zweiten Golfkrieg 1991 zur Befreiung Kuwaits schien eine Positionsfindung noch verhältnismäßig unproblematisch, insofern dieser die Legitimation entsprechend der Charta der Vereinten Nationen für sich beanspruchen konnte und zudem von einer breiten internationalen Koalition unterstützt wurde. Viel schwieriger als diese kriegerische Auseinandersetzung zur Abwehr eines Aggressors stellten sich diejenigen Probleme dar, die im Zuge der durch den Zusammenbruch des Ostblocks ausgelösten Befreiungs-, Abspaltungs- und Nationalismus-Bewegungen aufgebrochen sind. Hier stellte sich, zunächst im ehemaligen Jugoslawien, dann in Tschetschenien und auch in Somalia die Frage, ob es nicht aus ethischen Gründen gerechtfertigt sein müsse, in letzter Konsequenz denjenigen auch mit militärischer Gewalt entgegenzutreten, die die Menschenrechte mit Füßen treten. Im Nachgang zu den Ereignissen des 11. September 2001 und unter dem Eindruck zunehmender Bedrohungen durch die Möglichkeit von immer mehr Staaten, Massenvernichtungsmittel einzusetzen, haben sich diese Fragen nochmals verschärft gestellt. Hier sei nur an die Äußerung des damaligen Bundesverteidigungsministers Peter Struck erinnert, Deutschlands Sicherheit werde auch am Hindukusch verteidigt. Im Ukraine-Konflikt setzen Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident François Hollande auf Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Foto: Bundesregierung/Kugler Die Ereignisse des vergangenen Jahres im Nahen und Mittleren Osten, in Teilen Afrikas und jüngst vor allem auch in der Ukraine haben die hier bestehende Problematik in ihrer ganzen Komplexität erneut vor Augen gestellt. Gleichzeitig, und darauf wird später noch einzugehen sein, wuchs aber auch der Widerstand gegen eine allein aus dem Gefühl der Bedrohung plausibilisierten unilateralen Interventionsdoktrin, wie sie das Handeln der „Koalition der Willigen“ gegen den Irak bestimmte. 2 Diese Uneindeutigkeit christlicher Friedensethik zu beseitigen und stattdessen ein deutliches, unverkennbares Zeichen zu setzen, dürfte wohl maßgeblich zu der in den letzten Veröffentlichungen der Evangelischen Kirche in Deutschland immer deutlicher zu vernehmenden Absage an eine an der Lehre vom gerechten Krieg orientierten und durch die Zielsetzung der Durchsetzung der Menschenrechte motivierten Interventionspolitik beigetragen haben.2 Die kritische Distanzierung gegenüber dem Afghanistan-Einsatz3 war dann die fast notwendige Folge dieses Denkens, plakativ zusammengefasst in Margot Käßmanns viel diskutierten Ausspruch „nichts ist gut in Afghanistan“. Veränderungen der friedensethischen Grundkoordinaten Ehe die Tragfähigkeit dieser Option hier genauer untersucht werden kann, ist es lohnend, den Veränderungen der friedensethischen Grundkoordinaten genauer nachzugehen. Denn der Verweis darauf, dass das Ende des Ost-West-Konflikts das Aufflammen regionaler Emanzipationsbewegungen und ethnischer Spannungen befördert habe, bekommt nämlich nur einen Aspekt der Problematik in den Blick. Ebenso sehr, wie ethnische Konflikte und Bürgerkriege nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch des Ostblocks möglich wurden, muss auch berücksichtigt werden, dass gerade durch das Ende der Ost-West-Konfrontation überhaupt erst die Möglichkeit zu militärischen Interventionen zur Wahrung von Menschenrechten in Krisengebieten geschaffen wurde. Die Intervention in Afghanistan wäre unter den Bedingungen des Kalten Krieges ebenso wenig möglich gewesen wie der NATO-Einsatz im Kosovo oder auch das Eingreifen in Libyen oder im Irak. Wohl nicht zu Unrecht betonen politische Analysten, dass die Ukraine-Krise auch mit der Selbstwahrnehmung Russlands zu tun hat, durch das interventionistische Handeln des Westens, insbesondere der USA, in seinen legitimen Eigeninteressen eingeschränkt zu werden. Zugespitzt formuliert: Auf ihre Weise belegen die Erfahrungen nach dem Ende der Blockkonfrontation nach 1989, angefangen vom ehemaligen Jugoslawien, über Afghanistan und den Irak sowie, mit umgekehrtem Vorzeichen, in Tschetschenien und eben jetzt in der Ukraine die These von der friedenssichernden Kraft militärischer 2 Vgl. Aus Gottes Frieden leben - für gerechten Frieden sorgen. Eine Denkschrift des Rates der EKD, Gütersloh 2007; vgl. insgesamt: Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.): Die Denkschriften der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bd. 1: Frieden, Versöhnung, Menschenrechte; 4 Teilbände., Gütersloh 2003, sowie Kirchenkanzlei der Evangelischen Kirche in Deutschland: Kirche und Frieden. Kundgebungen und Erklärungen aus den deutschen Kirchen und der Ökumene (EKD-Texte 3), Hannover 1982. Zur Entwicklung der evangelischen Friedensethik vgl. insbesondere Wolfgang Lienemann: Frieden. Vom „gerechten Krieg“ zum „gerechten Frieden“ (= Ökumenische Studienhefte 10), Göttingen 2000, sowie für die gegenwärtige Diskussion die Beiträge in: Hans-Richard Reuter (Hrsg.): Frieden - Einsichten für das 21. Jahrhundert. Juni 2008 in Münster, Berlin u.a. 2009. 3 Vgl. „Selig sind die Friedfertigen“. Der Einsatz in Afghanistan: Aufgaben evangelischer Friedensethik (EKD-Texte 116), Hannover 2014. Kritisch dazu äußert sich Ulrich Körtner: Neuer Streit um die Friedensethik. Anmerkungen zur gegenwärtigen Diskussion in der evangelischen Kirche in Deutschland, in: Zeitschrift für Evangelische Ethik 59 (2015), S. 3-7. 3 Abschreckung. Nur dort, wo die militärischen und politischen Risiken kalkulierbar bleiben, ist es bislang zu militärischen Interventionen zur Abwendung einer humanitären Katastrophe gekommen. Dies unterschied nicht nur den Kaukasus-Krieg vom Kosovo-Konflikt, sondern unterscheidet eben auch den Einsatz im Nordirak gegen den Islamischen Staat (IS) von der Zurückhaltung im Falle der Ukraine. ISAF Einsatz. Troops in Contact (TIC) im September 2010 in Qala e Zal/Afghanistan. Foto: Bundeswehr/vonSöhnen Neubewertung der leitenden Paradigmen in Sachen Friedensethik Die hier geschilderte Praxis legt es nahe, eine Neubewertung der leitenden Paradigmen in Sachen Friedensethik vorzunehmen. Denn so sehr eine vollständige Ablehnung des Krieges sich angesichts der konkreten politischen Herausforderungen nicht durchhalten ließ, so sehr zeigte sich auch, dass eine rein deontologische, an einer unbedingten Pflicht orientierte Argumentation mit Blick auf den Krieg als ultima ratio der Menschenrechtspolitik offenbar zu kurz greift. Eine unbedingte politische Pflicht, jedweden Menschenrechtsverletzungen notfalls auch mit militärischer Gewalt zu begegnen, lässt sich nicht in die Tat umsetzen, sie lässt sich auch nicht ethisch begründen. Vielmehr müssen die jeweiligen Umstände für eine derartige Intervention sorgsam abgewogen werden. Man mag hierin eine Doppelmoral, das Messen mit zweierlei Maßstäben erblicken und darum die unterschiedlichen, in sich letztlich inkonsequenten Vorgehensweisen im Falle Tschetscheniens, des Iraks, den Dauerkrisenherden mittleres Afrika und Naher Osten sowie und des ehemaligen Jugoslawiens und der Ukraine kritisieren. Diese Kritik trägt aber in sich das Problem, dass sie meint, mit unbedingten Maßstäben operieren zu können – gerade auch dann, wenn die vermeintlichen oder realen Interessen der Intervenierenden als moralisch illegitim kritisiert werden. So ist es trotz allem Bestreben nach Eindeutigkeit irritierend, mit welcher Sicherheit die Vertreter der Kirchen in der Irakkrise einen Militäreinsatz kategorisch ablehnten, obwohl sie ihn im Falle des Kosovo für dringend geboten hielten und sich auch im Fall des IS eher zustimmend geäußert haben. Nüchterner und mit einem für die theoretischkonzeptionellen Probleme geschärften Blick betrachtet, lässt sich dieses Messen mit zweierlei Maß darum auch positiv beschreiben: Es ist kennzeichnend für ein Handlungsprinzip, das es eben nicht bei unbedingten moralischen Ansprüchen 4 bewenden lässt, sondern die Folgen des eigenen Handelns mit ins eigene Kalkül einbezieht. Es ist die Erweiterung einer gesinnungsethischen zu einer verantwortungsethischen Position. Weiterentwicklung zu einer angewandten Ethik In dieser Perspektive wäre bei den Äußerungen zur Friedens- und Interventionsfrage weniger eine Mehrperspektivität und eine situative Pluralität zu kritisieren, als vielmehr eine vermeintliche Eindeutigkeit, die unbedingte Maßstäbe über eine Kultur des Abwägens stellt. So betrachtet, fügen sich die unterschiedlichen Stellungnahmen durchaus in einen größeren Theorierahmen ein, wobei das Bestreben nach Eindeutigkeit in den jüngsten Veröffentlichungen der EKD wohl eher als Rückfall in alte Positionen denn als Fortschreibung der friedensethischen Urteilsbildung zu verstehen ist: Für die Ethik insgesamt, insbesondere auch die evangelische Ethik gilt, dass sie sich in den letzten Jahren von einer vorrangig an Grundsatzfragen hin zu einer stärker an materialen Einzelproblemen orientierten Fragestellung entwickelt hat. Das Handbuch zur Friedensethik der Militärseelsorge. Foto: Militärseelsorge/Patrick Rossille Die differenzierte Sicht militärischer Interventionen resultiert damit nicht allein aus einer veränderten geostrategischen Gesamtlage. Vielmehr entspricht sie den grundlegenden Veränderungen, die sich im Zusammenhang von Modernisierung und Pluralisierung auf nahezu allen Feldern der ethischen Diskussion vollzogen haben und für die der aus dem Englischen übernommene Begriff der applied ethics, der angewandten Ethik steht. Der Begriff angewandte Ethik führt dabei leicht in die Irre: Es geht hier gerade nicht darum, einfach bestimmte, aus der theoretischen Reflexion gewonnene normative Leitvorstellungen auf eine bestimmte Situation anzuwenden. Vielmehr gilt es, in den je spezifischen Konstellationen eine ethische Entscheidung zu fällen, die beidem, den grundlegenden ethischen Prinzipien und den jeweiligen situativen Erfordernissen gleichermaßen gerecht wird. 5 Leitlinien für situationsbezogene Entscheidungen Vor diesem Hintergrund lässt sich die Frage nach der Rechtfertigung der Androhung und Anwendung militärischer Gewalt nicht grundsätzlich beantworten. Vielmehr können hier nur Leitlinien für eine jeweils situationsbezogene Entscheidung angegeben werden. Die konkrete Entscheidungsfindung kann jedoch nicht auf dem Feld der Ethik, sondern nur auf der Ebene politischer Urteilskraft erfolgen. Eine solche Vorgehensweise ist freilich mehr als die bloße Anpassung der Ethik an den Zeitgeist. Sie spiegelt – aller Generalisierungsrhetorik gerade auch der evangelischen Kirche zum Trotz – vielmehr eine grundprotestantische Tendenz wider: Die Entideologisierung und damit auch die Pragmatisierung von Entscheidungsprozessen, bei der nicht allein moralische Maximen, sondern vor allem auch die konkreten Konsequenzen mit bedacht werden. Fortschreibung der Lehre von gerechten Krieg Eine Schlüsselrolle dabei spielt, trotz aller immer wieder formulierten Kritik, die bereits angesprochene Fortschreibung der aus der Antike herstammenden und im Kontext des Christentums insbesondere durch Thomas von Aquin ausgearbeiteten Lehre vom gerechten Krieg. Dafür lassen sich insbesondere zwei Gründe angeben: Diese Lehre repräsentiert zum einen selbst einen Denkstil, der versucht, die Ziele, die besondere Charakteristik und die Konsequenzen des eigenen Handelns in die Urteilsbildung mit einzubeziehen. Zum anderen möchte diese Lehre den Krieg als unkontrollierten Ausbruch von Gewalt dem Recht unterstellen. Dieser von ihr vertretene Vorrang des Rechts macht sie, wenn auch erheblich modifiziert, in besonderer Weise anschlussfähig für eine gegenwärtige Position. Die mittelalterliche Lehre basierte dabei noch auf der Vorstellung der Welt als eines geordneten Kosmos, einer Welt, die durch grundsätzliche Ordnung und durch ein als allgemein verbindlich und objektiv geltendes Wertesystem gekennzeichnet wurde. In einer solchen Denkweise lässt sich eine Störung der Weltordnung, eine Verschiebung des Gleichgewichts präzise und für alle Seiten gleichermaßen evident verorten. Die ethische Legitimität des Krieges als Verteidigungskrieg gegen denjenigen, der es unternimmt, die vorgegebene Ordnung zu zerstören, musste in dieser Perspektive einleuchten: Krieg erscheint dabei als legitimer, zeitlich befristeter Zustand der Unordnung, als ein Mittel, um die vorgegebene Ordnung wieder herzustellen. Dieser hier skizzierten Grundentscheidung sind alle weiteren Kriterien der Lehre zugeordnet. Nicht jedermann, wie im mittelalterlichen Fehdewesen üblich, ist berechtigt, Krieg zu führen, sondern nur die legitime Herrschaft, die selbst als Repräsentantin einer höheren Ordnung fungiert. Zudem muss das Ziel des Krieges auch tatsächlich in der Wiederherstellung des Kosmos liegen, nicht etwa in der Rache oder der Mehrung der eigenen Einflusssphäre. Als Zustand der Unordnung und des Chaos darf der Krieg selbst nur die ultima ratio darstellen, die letzte Möglichkeit, nachdem alle anderen Möglichkeiten, die Ordnung wieder herzustellen, sich als untauglich erwiesen haben. Schließlich muss die Verhältnismäßigkeit der Mittel gewahrt bleiben. Die durch den Krieg verursachte Zerstörung darf nicht größer sein als das Maß der Ordnungsstörung, der der Krieg begegnen soll. 6 Bedingungen der Moderne Wenn die Lehre vom gerechten Krieg hier wieder ins Feld geführt wird, so bedeutet dies freilich nicht, dass diese einfach unmodifiziert in die Gegenwart übernommen werden könnte. Denn die Voraussetzungen eines einheitlichen, evidenten Ordnungsdenkens, auf denen die Lehre vom gerechten Krieg beruht, sind unter den Bedingungen der Moderne nicht mehr gegeben. Mit dem Zerfall des Wert- und Deutemonopols der römischen Kirche und dem Zerfall vormoderner KosmosVorstellungen zerfällt auch die regulative Funktion einer dergestalt verstandenen Lehre vom gerechten Krieg. Denn ohne eine allgemein evidente Auffassung dessen, was als Verstoß gegen die naturgegebene Ordnung zu verstehen ist, wann mithin ein legitimer Grund für eine Militärintervention vorliegt, ist die traditionelle Lehre vom gerechten Krieg untauglich, um bewaffnete Konflikte einzugrenzen. Auch der Verweis auf das Naturrecht hilft nicht wirklich weiter, denn gerade das Naturrecht hat sich im Blick auf konkrete Handlungsfragen als hochgradig ideologieanfällig erwiesen: Bei der Beurteilung dessen, was eine justa causa für einen Krieg oder eine Militärintervention darstellt, kann es zu höchst unterschiedlichen Ergebnissen kommen, da wir als endliche Subjekte über keinerlei absolute Maßstäbe in Sachen wahr und falsch, gerecht und ungerecht, gut und böse verfügen. Sich auf derartige Kriterien zu berufen, steht darum ständig in der Gefahr ideologischer Absolutsetzung der eigenen Position, schlimmer noch: steht in der Gefahr, jede kriegerische Auseinandersetzung zu einem „heiligen Krieg“ werden zu lassen, zu einer Auseinandersetzung um die Vorherrschaft der eigenen Werteordnung. Doch nicht nur die Individualisierung und Pluralisierung gesellschaftlicher Wertvorstellungen lassen einen Rückgriff auf die Lehre vom gerechten Krieg in dieser Fassung als obsolet erscheinen. Ohne eine zugrunde liegende Kosmos-Vorstellung fehlt der Lehre auch ihre Zielorientierung. Unter den Bedingungen der Gegenwart gilt: Ordnungen können nicht einfach wiederhergestellt werden. Vielmehr ist das Fehlen von elementaren gesellschaftlichen Ordnungsstrukturen selbst das Problem, das in der Regel allererst zum Ausbruch von Konflikten führt. Auch hierfür sind sowohl der Kosovo-Konflikt als auch die Beispiele von Afghanistan und des Iraks lehrreiche Beispiele. Da eine klare Zielvorgabe für eine Ordnungsstruktur fehlt, ist derzeit ein Ende der Militärintervention nicht in Sicht. Von der Wiederherstellung der Menschenrechte, die ja zu ihrer Gewährung ebenfalls konstitutiv auf einen politischen Ordnungsrahmen angewiesen sind, ist man derzeit weit entfernt. Ordnungsvorstellungen neu entwickeln In beiden Punkten, der Frage einer allgemeinverbindlichen und objektiven Werteordnung und im Blick auf eine zugrunde liegende Ordnungsvorstellung, erscheint also die traditionelle Lehre vom gerechten Krieg modifikationsbedürftig. Unter den Voraussetzungen, dass eine allgemeine Ordnungsvorstellung mit unzweifelhaften, in aller Regel durch die Religion legitimierten Herrschern nicht mehr existiert, gilt es, 7 solche Ordnungsvorstellungen positiv zu entwickeln. Darin liegt es auch begründet, dass eine bloße Abwesenheit von Krieg und Gewalt als nicht suffizient erscheint, sondern das Ziel eine entwickelte Ordnungsvorstellung sein sollte. Dabei ist allerdings mit dem Problem adäquat umzugehen, dass solche Ordnungsvorstellungen durchaus pluralen Charakter haben können, dass also nicht dieselben Vorstellungen von Freiheit und Menschenwürde überall verbindlich gemacht werden können. Am Ehrenmal der Bundeswehr. Foto: Bundeswehr/Sebastian Wilke Diese Überlegungen leiten dazu an, als Bezugsrahmen für die Weiterentwicklung einer Lehre vom gerechten Krieg nicht mehr einen auf der Erkennbarkeit des objektiv Guten durch die menschliche Vernunft gegründeten Denkstil zu wählen, sondern einen, der auf der konstitutiven Begrenztheit menschlichen Urteilsvermögens und der Unfähigkeit einer objektiven Erkenntnis des Guten basiert. Denn die Einsicht in die Begrenztheit der eigenen Position bedeutet immer auch, auf Absolutheitsansprüche zu verzichten und die grundsätzliche Pluralität von verschiedenen Wertesystemen und Handlungsalternativen anzuerkennen. Es liegt in der Logik einer solchen Sichtweise, den Entscheidungsprozess über die Vorherrschaft einer bestimmten Sichtweise strikt zu formalisieren und auf die Ebene des Rechts, und zwar des positiven Rechts, zu verlagern. Zudem entspricht es auch der Erfahrung der europäischen Geschichte, dass eine dauerhafte Friedensordnung nur dort möglich ist, wo der Konflikt unterschiedlicher Wertesysteme und Auslegungen des überpositiven Rechts einem geregelten Verfahren unterworfen wird. Das bedeutet aber auch: Anders als es oft in den entsprechenden Verlautbarungstexten den Anschein haben könnte, bilden die Programme des gerechten Friedens mit dem Verweis auf die Notwendigkeit einer Rechtsordnung und die Lehre vom gerechten Krieg keinen Gegensatz, sondern sie müssen einander ergänzen. Der Gedanke einer internationalen Rechtsordnung Die gilt nun auch noch in einer anderen Perspektive. Nicht nur ist die Lehre vom gerechten Krieg nach dem Ende der Kosmos-Vorstellung und dem Zerfall des Naturrechts auf eine weiterentwickelte Rechtsordnung angewiesen, sondern auch 8 umgekehrt gilt: Eine Rechtsordnung ist auf eine Macht- oder eine Gewaltordnung angewiesen. Gerade von Seiten der lutherischen Staatslehre ist immer betont worden, dass eine Rechtsordnung selbst schützender Institutionen, nämlich des Staates, bedarf. Dementsprechend heißt es auch in der 1994 erstmalig erschienenen Erklärung der EKD zur Friedensethik „Schritte auf dem Weg des Friedens“: „Eine Friedensordnung, international ebenso wie innerstaatlich, die ihre Geltung jedoch ausschließlich auf den Gedanken der Akzeptanz stützen wollte, entbehrt nach aller geschichtlichen Erfahrung der Realität. Im Konfliktfall muss Recht auch durchgesetzt werden“.4 Diese Formel, die das Gewaltmonopol des Staates aufnimmt und sowohl auf den nationalen, wie auf den internationalen Kontext bezieht, zielt zunächst auf das in der UN-Charta festgehaltene Gewaltmonopol der UN. Denn gemäß Artikel 2, Ziffer 4 der UN-Charta ist nur die individuelle und die kollektive Selbstverteidigung durch Nicht-UN-Organe legitim. Alle weiteren Interventionen, insbesondere die Abwehr von Aggressionen, Friedensbrüchen und -bedrohungen sind, nach Vorbild der Polizeigewalt, allein durch die Organe der UN selbst zulässig. Es ist deutlich: hier wird intendiert, die überkommene Lehre vom gerechten Krieg durch den Gedanken einer internationalen Rechtsordnung zu ersetzen. Soldatenseelsorge im Einsatz. Foto: Bundeswehr/Bastian Fischborn Staatliches Gewaltmonopol Doch was passiert eigentlich, wenn die UN nicht in der Lage sind, das Recht durchzusetzen? Oder wenn es eben nicht nur um rechtserhaltende, sondern um rechtschaffende Gewalt geht?5 Die schwierige Frage, die sich hier stellt, gilt der Abwägung, welche Mittel angewendet werden müssen und dürfen, damit es überhaupt 4 Schritte auf dem Weg des Friedens. Ein Beitrag des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD-Texte 48), Hannover 1994, 27. Der Anhang der 3., erweiterte Auflage von 2001 bringt dies sogar noch deutlicher zum Ausdruck. 5 Siehe dazu ausführlicher: Reiner Anselm: Staat – Frieden – Menschenrechte. Über die Eigenarten des evangelischen Umgangs mit gegenwärtigen Konflikten, in: Zeitschrift für Evangelische Ethik 54 (2010), S. 124-129. 9 zu einer Wiederaufrichtung des staatlichen Gewaltmonopols kommt. In diesem Zusammenhang hilft es nicht weiter, einen Vorrang ziviler Friedensarbeit zu betonen, sondern die drängende Frage besteht darin, wie Regeln für einen Einsatz von Gewalt unter den geschilderten Bedingungen neuer Kriege gefunden werden können, wohl wissend, dass die Errichtung eines staatlichen Gewaltmonopols einen komplexen Prozess in der Kombination von militärischer Stärke und kulturell-politischer Entwicklung, von Abschreckung und gesellschaftlicher Akzeptanz darstellt. Denn ohne staatliches Gewaltmonopol ist schon die Unterscheidung in zivile und nicht-zivile Friedenssicherung problematisch und genau mit der gewollten Unschärfe zwischen zivilgesellschaftlichem und militärischem Engagement operieren auch die meisten Akteure in innerstaatlichen Konflikten. Hier gilt es Elemente der traditionellen Lehre vom gerechten Krieg weiterzuentwickeln und deren Zielrichtung, den Krieg an das Recht zu binden, so aufzunehmen, dass kriegerische Gewalt die Bedingung für die Implementierung von Recht sein kann, durch eben dieses Ziel jedoch auch begrenzt wird. Zur Notwendigkeit einer Weltgewaltordnung Man braucht hier mit Sicherheit nicht allem zustimmen, was der Soziologe Karl-Otto Hondrich unter dem Stichwort Weltgewaltordnung schon unter dem Eindruck des Kosovo-Krieges entwickelt hat, aber sich einer Ethik der Gewaltordnungsverhältnisse vollständig zu verschließen, scheint ebenso unangemessen.6 Hondrich diagnostiziert präzise die Problematik der Sichtweise, die vornehmlich auf die Etablierung einer Friedensordnung setzt und dabei jedoch die Frage der Sanktionierbarkeit dieser Ordnung vernachlässigt. Denn zu den Schwächen des Völkerrechts zählt noch immer das Fehlen eines internationalen Gewaltmonopols. Mit der Bildung nationaler Gewaltmonopole wurde ein historischer Prozess eingeleitet, der am Ende zum Aufbau einer internationalen Weltgewaltordnung führen soll. Sie kann nach Hondrichs Überzeugung jedoch nicht ohne einen Hegemon auskommen, „der die Einzelgewalten entmachtet und im gleichen Zuge sich selbst als Übergewalt herausbildet“.7 Dies sei derzeit die historische Rolle der USA. 6 Vgl. Karl Otto Hondrich: Wieder Krieg, Frankfurt /M. 2002. 7 Karl-Otto Hondrich: Auf dem Weg zu einer Weltgewaltordnung: Der Irak-Krieg als Exempel: Ohne eine Hegemonialmacht kann es keinen Weltfrieden geben, NZZ vom 22/23.3.2003, S. 74. 10 Das zerstörte Bagdader Canal Hotel nach dem Bombenanschlag auf die United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 2003. Foto: USAirforce/James Bowman Aufgrund dieser Überlegungen fand der Irakkrieg bei Hondrich eine erstaunliche Rechtfertigung: „Ginge es in ihm nur um den Irak, genügte die Kriegsdrohung. Aber nur der Krieg selbst zeigt, was die Drohung allein nicht zeigen kann: dass die USA sie wahr machen“.8 Da keine Ordnungsmacht und Gewalt stark genug sei, „um alle Gewalt gleicher- und gerechtermaßen zu unterdrücken“, müssten einzelne „Exempel“ statuiert werden, von denen eine abschreckende Wirkung ausgehe.9 Und genau das geschehe im Krieg gegen Saddam Hussein. Damit aber verweist die Rechtsordnung als Grundlage eines „gerechten Friedens“ wieder zurück auf die Lehre vom gerechten Krieg für den Fall des Versagens der Rechtsordnung. Eine solche Anerkennung der eigenständigen ethischen Theorie des gerechten Krieges wird dementsprechend auch von einigen evangelischen Ethikern vertreten – eine Auffassung, die durchaus nachvollziehbar erscheint.10 Allerdings gilt auch hier: Ebenso wie es naiv ist, beim Recht allein auf Akzeptanz ohne die Androhung (und exemplarische Durchsetzung!) von Gewalt zu setzen, ebenso naiv ist es allerdings auch, zu verkennen – was Hondrich in anderem Zusammenhang selbst betont hat –, dass nämlich die dauerhafte Akzeptanz des staatlichen Gewaltmonopols nicht ausschließlich und primär auf Gewaltandrohung, sondern auf der Herrschaft des Rechts und einer Ordnung beruht, die von den Bürgern und Bürgerinnen als gerecht empfunden wird. Recht und Gewalt dürfen somit nicht als Gegensätze, sondern als komplementäre Größen aufgefasst werden. 8 Ebd. 9 Ebd. 10 Vgl. dazu v.a. Ulrich Körtner: „Gerechter Friede“ – „gerechter Krieg“. Christliche Friedensethik vor neuen Herausforderungen, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche 100 (2003), S. 348-377. Kritisch: Hans-Richard Reuter: Recht und Frieden. Beiträge zur politischen Ethik, Leipzig 2013. 11 Militärgeneraldekan Matthias Heimer im Gespräch mit Soldatinnen und Soldaten in Karahmanmarasch/Türkei. Foto: Militärseelsorge Die Relevanz des Völkerrechts und die Theorie des gerechten Krieges Das bedeutet aber eben auch: Durch das moderne Völkerrecht wird – unbeschadet aller Vorzüge, die durch dieses geleistet werden – die so ungeliebte Lehre vom gerechten Krieg nicht überflüssig. Zweifellos bedeutet das grundsätzliche Gewaltverbot der Charta der UN völkerrechtlich wie friedensethisch einen großen Fortschritt. Aber es kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es nur um den Preis zahlreicher Ausnahmetatbestände aufrechterhalten werden kann. Um diese allerdings einer kontrollierten Bearbeitung zugänglich zu machen und zu vermeiden, dass es zu einer Beliebigkeit in den Ausnahmesachbeständen kommt, bleibt eine Theorie des gerechten Krieges auch weiterhin notwendig.11 In diesem Zusammenhang ist außerdem die Unterscheidung zwischen Legalität und Moralität in Erinnerung zu rufen. Auch wenn in der modernen Gesellschaft das Recht teilweise die Funktion der Moral übernommen hat, wird diese doch nicht durch das Recht vollständig ersetzt. In dem Fall, dass Instanzen des Völkerrechts versagen, bleibt auch weiterhin eine eigene ethische Theorie des gerechten Krieges vonnöten.12 Diesbezügliche Vorbehalte gerade in der evangelischen Kirche beruhen möglicherweise auf der Verwechslung von ethischer und theologischer Theorie des Krieges: Eine theologische Legitimation des Krieges ist auf jeden Fall zurückzuweisen. Ethik aber, jedenfalls wenn sie als Verantwortungsethik entworfen wird, setzt voraus, dass Entscheidungen über Krieg und Frieden nach den Kriterien der Urteilskraft getroffen werden und nicht einfach dem Ränkespiel der Kräfte überlassen werden dürfen. 11 In eine ähnliche Richtung argumentiert auch die Friedensdenkschrift der EKD von 2007 (s. Anm. 1), allerdings bleibt diese Argumentation gegenüber dem starken Akzent auf das Paradigma des gerechten Friedens eher blass. 12 Vgl. Michael Haspel: Friedensethik und humanitäre Intervention. Der Kosovo-Krieg als Herausforderung evangelischer Friedensethik, Neukirchen 2002, 63ff. 12 Autor Dr. Reiner Anselm, Jahrgang 1965, ist Professor für Systematische Theologie und Ethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und hat zahlreiche Publikationen zu theologischen und ethischen Themen verfasst. Literatur Michael Haspel, Friedensethik und humanitäre Intervention. Der Kosovo-Krieg als Herausforderung evangelischer Friedensethik, Neukirchen 2002. Karl Otto Hondrich, Wieder Krieg, Frankfurt/M. 2002. Wolfgang Huber/Hans-Richard Reuter, Friedensethik, Stuttgart u.a. 1990. Ulrich Körtner, „Gerechter Friede“ – „Gerechter Krieg“. Christliche Friedensethik vor neuen Herausforderungen, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche 100 (2003), S. 348377. Wolfgang Lienemann, Frieden. Vom „gerechten Krieg“ zum „gerechten Frieden“, Ökumenische Studienhefte 10, Göttingen 2000. Hans-Richard Reuter (Hrsg.), Frieden – Einsichten für das 21. Jahrhundert. Münster 2008 und Berlin u.a. 2009. Jean-Daniel Strub, Der gerechte Friede. Spannungsfelder eines friedensethischen Leitbegriffs, Forum Systematik 36, Stuttgart 2010. Links http://www.ekd.de/EKD-Texte/friedensdenkschrift.html http://www.ekd.de/EKD-Texte/ekdtext_116.html 13