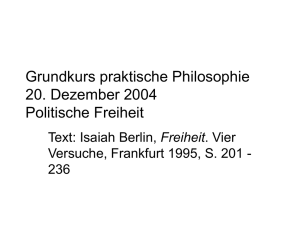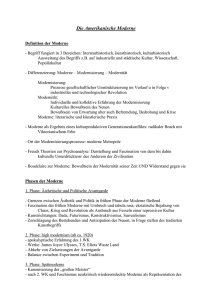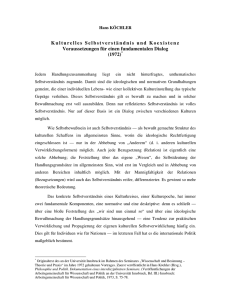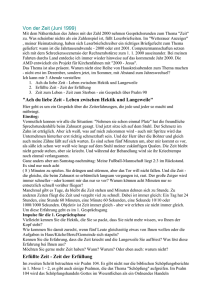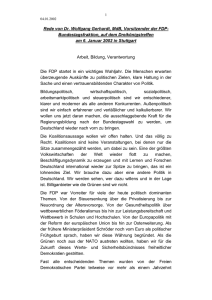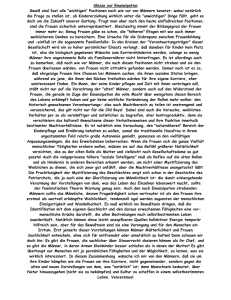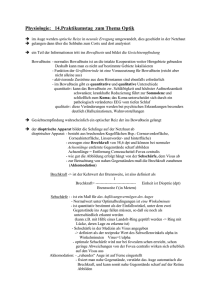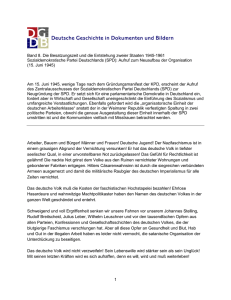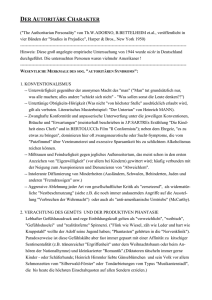Geist und praktisches Selbstverständnis
Werbung

Holmer Steinfath Geist und praktisches Selbstverständnis (Vortrag im Rahmen der öffentlichen Ringvorlesung „Begriffe des Geistes“ des Philosophischen Seminars der Universität Göttingen am 23.01.2007) Ich beschließe heute mit meinem Vortrag eine Reihe, die den Titel „Begriffe des Geistes“ trägt. Innerhalb der Gegenwartsphilosophie ist „Geist“ primär Gegenstand der sogenannten „Philosophie des Geistes“ respektive „philosophy of mind“, die selbst wiederum der sogenannten „Theoretischen Philosophie“ zugeordnet wird. Wie viele von Ihnen wissen, liegen meine eigenen philosophiesystematischen Kompetenzen vornehmlich im Bereich der sogenannten „Praktischen Philosophie“. Das bringt es mit sich, daß ich heute eine Reihe von Fragen anschneiden werde, im Umgang mit denen ich unsicher bin, weil ich das Feld der theoretischen Alternativen, die man zu ihrer Beantwortung erwägen kann und muß, nicht hinreichend überblicke. Das Thema „Geist“ ragt jedoch mit vielen seiner Facetten in den Bereich des Handelns und der Praxis hinein, so daß es mir nicht künstlich erscheint, wenn ich es von einer mir vertrauteren Seite her angehen möchte, nämlich von dem Verständnis her, das wir von uns selbst als praktische bzw. handelnde Wesen haben. In einem ersten Schritt werde ich einige Dimensionen und Implikationen dessen, was ich unser „praktisches Selbstverständnis“ nenne, entfalten. Die Elemente, um die es mir dabei geht, sind insofern „geistige“ Elemente, als sie Züge von uns als bewußtseinsbegabte Wesen, die bestimmte im engeren und weiteren Sinn kognitive Vermögen auszeichnet, betreffen. Vor dem Hintergrund meiner Skizze unseres praktischen Selbstverständnisses möchte ich dann in einem zweiten Schritt einige der Herausforderungen aufgreifen, die mit naturalistischen Konzeptionen von uns selbst verbunden sind wie sie etwa in den Neurowissenschaften und in Zweigen der Philosophie, die sich an derartige Wissenschaften anschließen, vorherrschen. Im Zentrum meiner Überlegungen werden zwei Implikationen unseres praktischen Selbstverständnisses stehen, die zumindest auf den ersten Blick in einer besonderen Spannung 1 zu naturalistischen Projekten stehen. Dies sind erstens der Gedanke der Freiheit und zweitens das komplexe Phänomen des Normativen. * Gleich am Anfang muß ich einräumen, daß die Rede von „dem“ oder „unserem“ praktischen Selbstverständnis eine fragwürdige Einheitlichkeit suggeriert, die, falls es sie überhaupt gibt, erst auszuweisen wäre. Auch als handelnde Wesen können wir uns auf unterschiedliche Weisen verstehen, und daß alle Handlungen im Kern dieselbe Struktur haben, ist alles andere als offensichtlich. So will ich dann auch nicht bei menschlichen Aktivitäten im allgemeinen einsetzen, sondern bei einer bestimmten Form menschlicher Aktivität und weitgehend offen lassen, wie sich diese Form zu anderen Formen verhält. Ich meine jedoch, daß die Art des Handelns, die ich im Auge habe, für unser Selbstverständnis als Personen essentiell ist und auch keineswegs selten vorkommt. Zur Illustration kann ich deswegen Beispiele aus dem Alltag heranziehen. Nehmen wir eine Person, die sich an einem Mittwochabend aufmacht, um einen Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung „Begriffe des Geistes“ zu hören. Wie können wir uns das, was diese Person tut, verständlich machen und wie muß sie sich selbst verstehen, wenn sie sich in dem, was sie tut, als handelnde Person begreifen will? Auf einen zentralen Zug ihres praktischen Selbstverständnisses stoßen wir sehr schnell, wenn wir uns klar machen, daß die Person sich jedenfalls nicht als eine Person sehen wird, der, indem sie tut, was sie tut, etwas bloß widerfährt. Im Vorlesungsraum mag ihr widerfahren, daß ihr friert oder daß sie gähnen muß. Aber das Aufbrechen zum Vortrag und der Gang dorthin ist nichts, was an der Person einfach ablaufen würde. Was sie tut, ist kein anonymes Geschehen, das sich an oder in ihr ereignet, sondern etwas Aktives, das sie selbst vollzieht. Damit stehen wir vor der Frage, was es mit dem hier relevanten Unterschied zwischen passiv und aktiv, Widerfahrnis und Vollzug 2 auf sich hat. Gerade für das Verständnis der von mir ins Auge gefaßten Handlungsart ist die Differenz von passiv und aktiv konstitutiv. Unterscheidungen zwischen Formen des Passiven und Formen des Aktiven können wir jedoch auch außerhalb menschlicher Handlungen treffen, so daß es auf die genaue Art dieser Unterscheidung zur Charakterisierung der Vollzüge von Personen ankommt. Wenn ein Thermostat die Temperatur registriert, dann ist dies ja in gewisser Hinsicht auch etwas Aktives im Unterschied etwa zum Vorgang des Zerbrechens des Thermostats in Folge eines Schlags mit einem Hammer. Und wenn eine Biene ein Rapsfeld anfliegt, weil es dort Nektar gibt, so ist dies auch eine Form des Tuns im Unterschied etwa zum Starrwerden ihres Körpers bei zu großer Kälte. Ein weiteres Beispiel liefert ein Raubtier, das seine Beute aktiv verfolgt, während es dem Beutetier widerfährt, vom Raubtier gefressen zu werden. Wir können sogar versuchen, für alle diese Fälle, den Fall der Person, die den Vortrag besucht, eingeschlossen, ein einheitliches Verhaltensmodell zu entwerfen.1 Kybernetiker haben Geräte als „intelligent“ bezeichnet, wenn ihr Aufbau drei Komponenten einschließt: Erstens müssen sie so organisiert sein, daß sich ihr Verhalten auf einen Referenzwert oder ein Ziel bezieht bzw. beziehen läßt; zweitens müssen sie in der Lage sein, ihre Umwelt zu verändern, auf sie kausal einzuwirken; und drittens müssen sie ein FeedbackSystem eingebaut haben, das es ihnen möglich macht, Veränderungen in ihrer Umwelt in eine Beziehung des Passens oder Nichtpassens zum Referenzwert zu setzen. Beim Thermostaten ist die erste Bedingung dadurch erfüllt, daß er auf eine bestimmte Raumtemperatur eingestellt ist; er springt, sagen wir, an, wenn die Temperatur unter 20 Grad sinkt, dies ist sein Referenzwert oder Ziel. Wenn er anspringt, löst er einen Mechanismus aus, aufgrund dessen die Heizung angeschaltet wird. Dies entspricht der zweiten Bedingung, der Fähigkeit, auf die Umgebung kausal einzuwirken. Schließlich kann der Thermostat differenzieren, ob die Außentemperatur mit dem Referenzwert übereinstimmt oder nicht, und entsprechend 3 reagieren, so daß auch die dritte Bedingung erfüllt ist. Bei komplizierteren Geräten werden die drei Komponenten komplexer ausfallen, aber die Struktur bleibt dieselbe. Was kommt bei Bienen und Raubtieren hinzu? Auch ihr Verhalten läßt sich mit Hilfe der Komponenten Ziel, Umweltänderung und einem Feedback-System, das das Verhältnis von Umwelt und Ziel repräsentiert, beschreiben. Wenn wir Einzelheiten übergehen, scheint der einzige wesentliche Unterschied zum Thermostaten der zu sein, daß dem Tier der Referenzwert nicht in dem Sinn von außen vorgegeben ist wie er dem Gerät durch seinen Erfinder oder Hersteller vorgegeben ist. Das Tier ist nicht von jemandem programmiert, auf eine Temperatur oder einen Blütengeruch oder die Gestalt eines Beutetiers in spezifischer Weise zu reagieren. Deswegen nehmen wir es als aktiver wahr denn ein Gerät; es „tut“ eher etwas als dieses, obwohl wir in loser Sprechweise auch von unserem PC sagen können, er „täte“ dies und „unterlasse“ jenes und „wolle“ im übrigen nicht so wie wir. Doch als wie immer aktiv wir ein Tier im Vergleich zu Artefakten betrachten mögen – wenn wir uns selbst als handelnde Personen verstehen, verstehen wir uns, so möchte ich behaupten, in anderer Weise als aktiv als noch das Tier (vielleicht abgesehen vom Grenzfall höherer, nichtmenschlicher Primaten). Aristoteles, über dessen Leib-Seele-Konzeption uns Professor Patzig berichtet hat, faßt den Unterschied in den Begriff der „prohairesis“, wörtlich übersetzt dem Vornehmen. Auch beim Tier liege der Ursprung seiner Bewegungen in ihm selbst, ja Tiere und sehr kleine Kinder könnten auch etwas wollen (boulomai), aber sie könnten sich nichts vornehmen. Für welchen Unterschied in den Phänomenen steht diese zunächst rein terminologische Differenzierung? * In der Diskussion zu dem lehrreichen Vortrag, den er in dieser Reihe zur Frage „Was heißt es, über Begriffe zu verfügen?“ gehalten hat, hat Professor Newen einen Unterschied zwischen Repräsentation und Bewußtsein gemacht. Die Biene repräsentiert in einem bestimmten Sinn 4 das Rapsfeld und kann anderen Bienen durch ihren Tanz die Lage des Rapsfeldes mitteilen, aber sie hat allem Anschein nach kein Bewußtsein davon, was wohl daran liegt, daß die verschiedene Diskriminationsvermögen, über die sie verfügt, nicht hinreichend integriert sind. Man könnte daher erwägen, ob sich die Person, die zum Vortrag geht, nicht dadurch von der Biene, die zum Rapsfeld fliegt, unterscheidet, daß ihr das Ziel ihres Tuns und möglicherweise auch noch der Feedback-Mechanismus bewußt sind. Aber das kann nicht alles sein. Zum einen werden wir wohl auch dem Raubtier eine Form des Bewußtseins kaum absprechen können, so daß wir mit Verweis auf Bewußtsein nicht die Grenze ziehen können, die wir ziehen möchten. Zum anderen – und das ist hier der wichtigere Punkt – würden wir durch ein bloßes Hinzufügen von Bewußtsein zu Beobachtern unserer selbst; wir würden dann einem anonymen Geschehen, das sich in uns vollzieht, zuschauen so wie wir dem Ausschlag eines Temperaturanzeigers zuschauen können. Epiphänomenalisten zeichnen zuweilen ein solches Bild von Bewußtsein und uns selbst. Doch der Vortragsbesucher beobachtet sich nicht oder tut dies doch nur beiläufig. Er sagt sich, in der Tür seiner Wohnung stehend, nicht „Aha, ich bin wohl im Begriff zu gehen und wie ich mich kenne, werden mich meine Schritte sicherlich in den Hörsaal Audi 11 führen“. Anders als vielleicht sein Nachbar, der ihn Mittwochabend für Mittwochabend zur Ringvorlesung hat gehen sehen, sieht er sich nicht von außen und macht keine Vorhersagen über sein weiteres Verhalten, obwohl ich nicht bestreiten möchte, daß wir uns manchmal auch zu uns selbst so verhalten können. Was im Fall des Vortragsbesuchers wie ich ihn mir zurechtlege geschieht, ist etwas ganz anderes. Daß er sich im Sinn von Aristoteles’ prohairesis etwas vornimmt, heißt, daß er sich sein Ziel, zum Vortrag zu gehen, allererst setzt. Es ist ihm nicht vorgegeben – weder von außen noch von innen –, sondern Ergebnis seiner eigenen Schöpfung. Professor Carl hat in seinem Vortrag zu dieser Ringvorlesung die Struktur dieses kreativen Akts bereits skizziert. Worum es an dieser Stelle geht, ist die Bildung von Absichten („Absicht“ ist eine mögliche Übertragung des lateinischen „intentio“, das bei Thomas von Aquin und anderen seinerseits 5 an die Stelle des griechischen „prohairesis“ tritt). Der Vortragsbesucher hat die Absicht, zum Vortrag zu gehen, und diese Absicht verdankt sich einem Vollzug der Person selbst. Ich bin unsicher, ob dies für alle Absichten gilt, wie ich an anderer Stelle behauptet habe. Gibt es nicht auch das Phänomen, daß wir uns mit einer Absicht vorfinden, entdecken, daß wir dieses oder jenes beabsichtigen? Und finden wir uns nicht manchmal sogar zu diesem oder jenem entschieden vor, so daß wir die Entscheidung nicht eigentlich treffen?2 Es gibt Fälle, auf die solche Beschreibungen im Passiv passen. Aber für unser praktisches Selbstverständnis scheint mir dann doch unverzichtbar, daß diese Fälle vor dem Hintergrund unserer Fähigkeit zu verstehen sind, Absichten und Entscheidungen in einem prägnanten Sinn zu „machen“. Bei unserer Beispielperson können wir uns dies als Abschluß einer praktischen Überlegung vorstellen, und das entspricht wiederum der Analyse bei Aristoteles, der die prohairesis als Resultat bzw. Teilresultat eines mit sich zu Rate Gehens (bouleuo) auffaßt. Meines Erachtens hat das Überlegen, das dabei zum Zuge kommt, eine reflexive und insoweit höherstufige Form. Unsere Person mag vor ihrer Entscheidung, zum Vortrag aufzubrechen, zwischen verschiedenen Möglichkeiten schwanken. Sollte sie nicht lieber das angefangene Buch zu Ende lesen oder endlich einmal wieder mit einem Freund telefonieren? Diese Optionen sind für sie jedoch nur Optionen, weil sie in der einen oder anderen Weise geneigt ist, sie zu verfolgen. Sie kann, so wollen wir annehmen, der Lektüre und dem Telefonat durchaus etwas abgewinnen. Diese Möglichkeiten erscheinen ihr im Licht ihrer Gefühle und Wünsche anziehend, und ebenso geht es ihr mit dem Vortragsbesuch. Praktisch überlegend verhält sich die Person reflexiv zu ihren Neigungen. Anders als in einem Handlungsmodell, wie es von Thomas Hobbes, über den in dieser Reihe Professor Ludwig Auskunft erteilt hat, vertreten wurde, haben wir es hier nicht mit einem Mechanismus zu tun, bei dem sich der stärkste Wunsch (Hobbes spricht von „endeavour“) ohne Zutun der Person durchsetzt. Vielmehr nimmt die Person zu ihren Neigungen Stellung; sie gewichtet sie und sagt gewissermaßen „Ja“ oder „Nein“ zu ihnen. Professor Carl hat in seinem Vortrag den schönen 6 englischen Ausdruck „making up one’s mind“ zitiert, den sich Harry Frankfurt für seine Konzeption höherstufiger Volitionen zunutze macht. Indem wir uns reflexiv und stellungnehmend zu unseren eigenen mentalen Einstellungen erster Stufe, also etwa unseren Wünschen und Gefühlen, aber auch zu unseren Meinungen verhalten, machen wir unseren Geist erst zu dem, was er ist. Das Setzen von Zielen, das Verfolgen von Absichten, das Treffen von Entscheidungen – all dies sind kreative Vorgänge, wenn auch nicht creationes ex nihilo, sondern Umgestaltungen von vorgegebenem Material in Gestalt unserer Gefühle, Wünsche und Meinungen. Anders als es die in diesem Zusammenhang fast unweigerlich bemühten optischen und handwerklichen Metaphern nahe legen, sollten wir uns den Bezug auf unsere eigenen intentionalen Einstellungen – wie überhaupt das Modell des performativreflexiven Geistes – allerdings nicht als eine Form der inneren Wahrnehmung oder des inneren Gestaltens vorstellen. Auch unser Vortragsbesucher befragt nicht einfach seine Neigungen, sondern er versucht, seine Handlungsoptionen nach wichtig und weniger wichtig zu ordnen, doch sind diese Optionen für ihn, wie gesagt, nur Optionen aufgrund seiner Neigungen, so daß sein Bezug auf sich selbst Implikation seines Bezugs auf seine Situation ist. Andere Beispiele führen dies noch besser vor Augen. Wer sich etwa angesichts eines eigenen Verhaltens, in dem er ein Versagen sieht, schämt und dann fragt, ob es wirklich angemessen ist, sich seines Verhaltens zu schämen, verhält sich so fragend zu seiner Scham, aber auch in diesem Fall schaut er nicht einfach auf seine Scham, sondern versucht, sein Verhalten unter anderen Aspekten zu sehen und indem er dies tut, verhält er sich zu seinem Schamgefühl.3 Wir haben in dieser Ringvorlesung keinen Vortrag über Kants komplexe Theorie des Geistes gehört. Ich möchte deswegen nur anmerken, daß der Gedanke einer Formierung des eigenen Geistes im Zuge eines Sichzusichverhaltens eine Parallele in Kants Maximenkonzeption findet. Meine Neigungen machen mir dem zufolge sozusagen Handlungsangebote; unsere Person zieht es zur Lektüre, zum Telefonat, zum Vortrag. Aber um zur Handlung zu führen, 7 so interpretiere ich Kants Ausführungen zu Beginn der Metaphysik der Sitten und im ersten Stück der Religionsschrift, muß ich die jeweilige Neigung erst in eine Maxime, ein subjektives Handlungsprinzip aufnehmen. Das führt auf die interessante Frage, der ich hier nicht nachgehen kann, ob nicht letztlich hinter allen unseren Handlungen bestimmte, bereichsspezifische Grundsätze stehen. Im Bereich des Geldausgebens etwa mag der Geizige dem praktischen Grundsatz folgen, möglichst wenig auszugeben, nicht um mit dem Geld irgend etwas anzufangen, sondern weil ihm der Geldbesitz ein letzter Zweck ist. In Fragen der Ehre mag der auf seine Ehre Bedachte dem Grundsatz folgen, keine Beleidigung ungerächt zu lassen. Solche Grundsätze verfestigen sich durch kontinuierliche Befolgung zu jenen Grundhaltungen, die traditionell als Tugenden und Laster bezeichnet werden, und bei Aristoteles sind Tugenden (aretai) tatsächlich Weisen des Sichzusichverhaltens, nämlich, wenn wir uns auf die ethischen Tugenden beschränken, Weisen des reflexiven Verhaltens zu den eigenen Affekten (pathe). Diese Sicht menschlichen Handelns läßt sich zu der Auffassung zuspitzen, daß sich in dem, was jemand tut, letztlich zeigt, was für ein Mensch er ist und daß er es selbst ist, der sich zu diesem Menschen macht oder doch daran mitwirkt, gleich ob er sich dessen besonders bewußt ist oder nicht. Statt diese Dimension unseres praktischen Selbstverständnisses zu vertiefen, möchte ich auf zwei andere Implikationen der bisher gelieferten Skizze aufmerksam machen, die die vorgreifend genannten Stichworte „Freiheit“ und „Normativität“ in umgekehrter Reihenfolge aufgreifen. * Wenn wir uns noch einmal unser Beispielszenarium vor Augen führen, so können wir die praktische Überlegung, die die Person beim Durchgang durch ihre Möglichkeiten, ihren Mittwochabend zu gestalten, vollzieht, auch als ein Abwägen von Gründen charakterisieren. Daß es einen Grund für etwas gibt, heißt, daß etwas dafür spricht. Mit dem Abwägen von 8 Gründen betritt die Person den Raum des Normativen. Sie fragt sich ja nicht, was sie am Abend tun wird (sie hat eben kein beobachtend-prognostisches Verhältnis zu sich), sondern sie fragt sich, was sie tun soll oder was für sie zu tun das beste ist. Und wenn sie einen ausschlaggebenden Grund für den Besuch des Vortrags zu haben meint, dann meint sie damit zugleich, daß sie genau dies tun sollte. In den Diskussionen, die in der gegenwärtigen analytischen Metaethik geführt werden, herrscht große Uneinigkeit über den genauen Status von Gründen und die Art ihrer Normativität. Manchmal wird so geredet, als eignete Gründen eine Art magnetischer Kraft, die einen Druck auf uns ausübt, in ihrem Sinn tätig zu werden. Von pro tanto Gründen geht ein schwacher Druck aus, der durch den Druck anderer Gründe ausgeglichen wird, während ausschlaggebende oder „all things considered“ Gründe auf die Handlungsentscheidung der Person durchschlagen. Doch solche Metaphorik fördert das Verständnis nicht. Gehen wir dagegen von der Beobachtung aus, daß der menschliche Geist nichts einfach Gegebenes ist, sondern im Rahmen eines reflexiven Verhaltens erst performativ hergestellt wird, dann sind auch Gründe nichts objektiv Vorliegendes, das mit einer magischen Kraft ausgestattet ist, sondern immer Gründe für jemanden, der erst im Vollzug des praktischen Überlegens so zu etwas Stellung nimmt, daß es für ihn zum Grund wird. Gründe und die sie kennzeichnende Normativität erschließen sich insoweit grundsätzlich nur aus der Perspektive einer ersten Person, eines Ich, das sich zu sich verhält. In einem bestimmten, mir selbst nicht völlig durchsichtigen Sinn ist alles Normative an diese Perspektive gebunden, während das Deskriptive seine Entsprechung in der Perspektive der dritten Person, der eines Beobachters findet. Und ich würde gerne noch einen Schritt, den ich ebenfalls nicht völlig ausweisen kann, weiter gehen und behaupten, daß das Normative an Personen als Handlungswesen gebunden ist; es gibt ein Wechselverhältnis von Normativität und Aktivität, wobei die fragliche Aktivität allerdings eine ist, die sich nicht auf äußere Handlungen beschränkt, sondern ihren eigentlichen Ort im Überlegen, im sogenannten praktischen genauso wie im theoretischen hat. 9 Überlegungen, so wie ich sie verstehe, sind nicht „a mere going on“, wie Tyler Burge sagt, über den Professor Mühlhölzer referiert hat, sondern ein Tun, mit „ich“ als grammatischem Subjekt4, und dieses Tun kann, soll es einen Unterschied machen, kein bloßes Registrieren von Vorgegebenem sein. Ich muß jedoch anmerken, daß ich dieses Bild des Normativen für unvollständig halte. Es hat eine voluntaristische Schlagseite. Ob es einen guten Grund dafür gibt, dies oder etwas anderes zu tun, steht nicht einfach im Belieben des einzelnen. Nichts kann ein Grund für eine Person sein, dem diese nicht frei zugestimmt hat oder zumindest zustimmen könnte. Aber daß etwas ein Grund für eine Person ist, verdankt sich nicht allein ihrer Zustimmung. Wenn wir an unseren Vortragsbesucher denken, so gehen in seinen Entschluß, sich Richtung Hörsaal aufzumachen, zum ersten alle möglichen Annahmen über Faktisches ein, die wahr oder falsch sein können. Vielleicht macht er sich ganz falsche Vorstellungen von dem, was ihn im Hörsaal erwartet, und vielleicht würde er seinen Entschluß zurückziehen, würde er über seinen Irrtum aufgeklärt. Zum zweiten muß es bereits etwas geben, aufgrund dessen dem Vortragsbesucher ein Aufbruch Richtung Hörsaal überhaupt attraktiv erscheint. Er muß, wie erwähnt, schon geneigt sein, einen Vortrag zu hören. Durch seine Gefühle und Neigungen kommt ein Moment der Rezeptivität ins Spiel, das seine Entscheidung als solche nicht enthält. Sein Wollen begegnet daher auch nicht einer gleichsam grauen, noch nicht evaluativ gefärbten Welt. In seinen Gefühlen und Neigungen, verbunden mit seinen nicht weiter hinterfragten Meinungen, ist ihm die Welt immer schon als in der einen oder anderen Weise werthaft erschlossen. Zum dritten wird sich die Person normalerweise nicht einfach zwischen ihren Neigungen entscheiden, sondern in einem komplexeren Vorgang der Selbst- und Situationsinterpretation erst herauszukristallisieren versuchen, was sie eigentlich will. In diesen Vorgang gehen sowohl Momente des Entdeckens wie des Erfindens ein. Und zum vierten wird die Norm, die sich der Besucher setzt, indem er sich zum Ziel macht, zum Hörsaal zu gehen, seine Selbstaufforderung, daß es so sein soll, in ein Netz von sozialen 10 Normen eingelassen oder auf ein solches bezogen sein. Beispielsweise könnte es zu seinem Selbstbild als Bildungsbürger gehören, öffentliche Ringvorlesungen zu besuchen, und dieses Bild wird als ein kulturell überliefertes nur zum Teil ein selbstgestricktes sein. Aber selbst wenn wir die mögliche intersubjektive Dimension von Gründen einbeziehen, werden sie nicht zu etwas, was sich aus der Perspektive der dritten Person konstatieren läßt, denn die Perspektive, um die es in diesem Fall geht, ist eine Perspektive der ersten Person Plural. Von hier ließe sich ein Bogen zur Moral schlagen, für die eine spezifische Wir-Perspektive bestimmend ist, doch das ist ein Thema, das ich für heute zur Seite stellen muß. * Wie steht es mit dem zweiten Stichwort, das ich zu explizieren versprochen habe, der Freiheitsthematik? Kant hat gemeint, wir seien als Personen Wesen, die nicht anders als unter der Idee der Freiheit handeln können. Auch dies können wir an unserem Beispielszenarium nachvollziehen. Die vorgestellte Person steht vor der Wahl zwischen verschiedenen Handlungsalternativen: der Lektüre, dem Telefonat, dem Vortrag. In der noch nicht abgeschlossenen praktischen Überlegung werden ihr diese Möglichkeiten als für sie prinzipiell offene erscheinen. Sie könnte das eine tun, aber auch das andere oder ein drittes und viertes. Allem Anschein nach ist mit dem Bewußtsein der Handlung stets das Bewußtsein der Möglichkeit ihres Unterlassens oder ihrer Modifikation mitgegeben. Zum bewußten Handeln gehört das Bewußtsein eines Handlungsspielraums und damit einer elementaren Freiheit. Die Person sagt sich, daß sie die Lektüre fortsetzen könnte oder telefonieren könnte oder zum Vortrag gehen oder noch anderes tun könnte. „Es liegt an mir“, so kann sie sich sagen, „welche Option ich verfolgen werde“. Dieses „es liegt an mir“ ist jedoch nicht nur in Wahlsituationen angebracht. Im Anschluß an Stuart Hampshire hat Ernst Tugendhat darauf aufmerksam gemacht, daß jeder Handlungsvorsatz, jedes auf ein Ziel aus Sein, in einer Spannung von Versuchen und 11 Gelingen steht.5 Der Student, der versucht, für eine Prüfung zu lernen, kann sich dabei mehr oder weniger anstrengen. Er kann seine Kräfte mehr oder weniger anspannen. Und in diesem sich Anspannen kann er sich sagen, es läge an ihm, ob er sein Ziel erreicht oder nicht. Tugendhat spricht in diesem Zusammenhang von „Selbstaktivierung“. Die relevante Selbstaktivierung bezieht sich primär auf das Wollen. Wie stark der Student für die Prüfung lernt, hängt zumindest auch davon ab, wie stark er dies will, und dies wiederum ist mit davon abhängig, wie er sich reflexiv zu seinen eigenen Antrieben verhält. Das „ich könnte auch anders“ und das „es liegt an mir“ sind zwei Seiten einer Medaille, an denen sich die Verwiesenheit von Handeln auf Freiheit zeigt. Auch von diesem Punkt ließe sich wieder eine Brücke zur Moral schlagen, denn die Unterstellung zumindest einer elementaren Freiheit wie sie zu unserem Selbstverständnis als praktisch überlegende Personen gehört ist eine notwendige Voraussetzung für die Zuschreibung moralischer Verantwortung. Wenn wir jemanden für sein Tun verantwortlich machen, gehen wir davon aus, daß es in der angezeigten Weise an ihm lag, das, was er tat, zu tun oder zu unterlassen. Aber auch das soll heute nicht mein Thema sein. * Ziehen wir ein kurzes Zwischenresümee. Daß wir ein praktisches Selbstverständnis haben, heißt, daß wir uns als handelnde Personen verstehen, die aktiv auf die Welt einwirken. Indem wir handeln, widerfährt uns nicht einfach etwas. Die für Personen charakteristische Aktivität ist jedoch nicht lediglich eine des äußeren Verhaltens. Es ist vielmehr eine des geistigen Verhaltens, genauer des Sichzusichverhaltens. Wir sind Wesen mit Gefühlen, Wünschen, Meinungen, doch was uns auszeichnet ist die Fähigkeit, zu diesen Einstellungen erster Stufe auf einer zweiten Stufe Stellung zu nehmen. Wir tun dies, indem wir überlegen, was für und was gegen die Optionen spricht, die uns im Licht unserer Gefühle, Wünsche und Meinungen attraktiv erscheinen. So überlegend, wägen wir Gründe gegeneinander ab, die uns Antworten 12 auf die Frage „Was soll ich tun?“ liefern sollen. Mit dieser Frage betreten wir den Raum des Normativen. Zugleich eröffnet sich mit ihr das Bewußtsein der Freiheit. „Was soll ich tun?“ heißt eben nicht „Was werde ich tun?“. Wer sich fragt, was er tun soll, verhält sich nicht beobachtend zu sich und macht keine Voraussagen über sein künftiges Verhalten. Er meint vielmehr, daß es an ihm selbst liegt, was er tun wird. Er sieht sich in einem Spielraum von Handlungsmöglichkeiten, den er in die eine oder die andere Richtung ausschreiten kann. * Obwohl ich hoffe, daß dieses Bild von uns selbst Ihnen nicht unvertraut ist und daß Sie deswegen meine bisherigen Ausführungen weitgehend haben nachvollziehen können, so will ich jetzt in einem zweiten Schritt den Blick auf möglicherweise problematische Seiten des entworfenen Bildes lenken. Eine Schwierigkeit hatte ich schon zu Beginn kenntlich gemacht: Die Implikationen, die ich am einfachen Beispielfall unseres Vortragsbesuchers freizulegen versucht habe, lassen sich nicht als Elemente allen menschlichen Tuns aufweisen, das wir als „Handeln“ im Unterschied zu einem „bloßen Verhalten“ anzusehen geneigt sind. Wenn ich Ihnen unverhofft in der Stadt begegne und Sie spontan grüße, dann widerfährt mir auch dies nicht so wie es mir widerfährt, vor Schreck zusammenzuzucken, wenn Sie in mich hineinrennen. Aber meinem Grüßen gehen keine Überlegungen und kein Abwägen von Gründen voraus. Mein Tun resultiert nicht aus einer vorgängigen Absicht, obwohl es adverbiell als absichtlich gelten muß. Und es wäre gewiß eine gewaltsame Interpretation, wollten wir in meinem Gruß den Ausdruck eines reflexiven Verhaltens sehen. Daraus könnte man den Schluß ziehen, daß es eben verschiedene Formen des Handelns gibt, die sich nicht alle mit einem Modell erfassen lassen. Ich glaube, daß das ein voreiliger Schluß wäre. Nicht daß ich bestreiten möchte, daß es verschiedene Formen des Handelns gibt; mein Grüßen ist nicht so wie das überlegte Aufbrechen zum Hörsaal. Aber mir scheint, daß die 13 Einstufung des Grüßens als ein absichtliches Tun nur möglich ist vor dem Hintergrund unserer Fähigkeit zum reflexiven Verhalten. So zählen wir beispielsweise als Handeln nur ein Tun, zu dem wir uns grundsätzlich entscheiden können, obgleich wir uns nicht notwendig zu ihm entschieden haben müssen. Das unterscheidet mein Grüßen von Ihrem Gähnen; man kann sich dazu entschließen, jemanden zu grüßen, nicht dagegen dazu, zu gähnen, obwohl man sich dazu entschließen kann, sein Gähnen zu unterdrücken. Zur Explikation des Grüßens als Handlung brauchen wir also den Begriff der Entscheidung oder des Entschließens, und zwar in seiner aktiven Variante. Ähnlich können wir auch ein Handeln, dem kein Überlegen vorhergeht, nur dann als frei charakterisieren, wenn es sich keinem Zwang verdankt, aber ob etwas einen Zwang darstellt oder nicht, bemißt sich daran, ob die Person ihrem Tun zustimmen könnte. Hier brauchen wir zur Erläuterung den Begriff des Zustimmens, und zwar wiederum in seiner aktiven Variante. Eine andere Schwierigkeit des von mir gezeichneten Bildes von Personen verbindet sich mit dem Verdacht, in ihm werde ein kulturspezifisches Moment unterderhand zum Anthropologicum erklärt. Aus meiner Sicht spricht wenig für einen solchen Verdacht. Ganz gewiß handelt es sich bei der Fähigkeit des Sichzusichverhaltens nicht um ein Spezifikum des modernen Menschen. Der Sache nach wird es früh in der Philosophie thematisiert. Aristoteles’ ethische Tugenden sind, wie angeführt, Weisen des sich Verhaltens zu den eigenen Affekten, und werden von Aristoteles auch so aufgefaßt. Der speziellere Gedanke höherstufiger Wünsche wird in der Gegenwartsphilosophie meist im Anschluß an die bahnbrechenden Arbeiten von Harry Frankfurt diskutiert, aber er findet sich explizit zum Beispiel auch schon bei Augustinus. Ich sympathisiere daher mit der Überzeugung, der zufolge das Vermögen zum reflexiven Verhalten tatsächlich ein anthropologisches Merkmal ist. In den Zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts haben es Vertreter der sogenannten Philosophischen Anthropologie wie Max Scheler und Helmuth Plessner zu Recht in den Mittelpunkt ihrer Deutungen vom Menschen gestellt, der in Göttingen aus nachvollziehbaren 14 Gründen nicht sonderlich geschätzte Scheler (Professor Patzig hat seine Art des sprunghaftoriginellen Philosophierens einmal harsch eine „Fehlform philosophischer Existenz“ genannt)6 tut dies übrigens ausdrücklich unter dem Titel „Geist“.7 Trotzdem enthält der besagte Verdacht ein Körnchen Wahrheit. Daß wir über reflexive Fähigkeiten verfügen und versuchen können, unser Leben von Gründen geleitet zu führen, ist ein Faktum der menschlichen Existenz. Ob und wie sehr wir diese Fähigkeiten und eine rationale Lebensführung schätzen, ist dagegen nichts Zwingendes; dies liegt an uns, daran, ob wir uns einem weit verstandenen Projekt der Aufklärung verpflichtet fühlen oder nicht. * Nun muß aber gerade diejenigen, die in der Tradition der Aufklärung stehen, irritieren, unter Umständen sogar verstören, daß alles andere als offenkundig ist, ob und wie sich das skizzierte praktische Selbstverständnis in ein wissenschaftliches Weltbild fügt, das sich ja seinerseits nicht unwesentlich der Aufklärung verdankt. Damit komme ich zu der Schwierigkeit, die ich eingangs als besondere Herausforderung in Aussicht gestellt hatte. Statt die allzu etikettenhafte Rede vom „wissenschaftlichen Weltbild“ zu bemühen, hatte ich von einer „naturalistischen Konzeption“ von uns selbst und vom menschlichen Geist gesprochen; das ist präziser, selbsterklärend ist es aber leider nicht. Sie werden mir nachsehen, daß ich nicht so vorgehen kann, daß ich zunächst eine mögliche naturalistische Konzeption des Geistes entwickele, um dann zu überlegen, wie sich unser praktisches Selbstverständnis mit ihm vereinbaren läßt. Wie zu Beginn angeschnitten, möchte ich eine Abkürzung wählen und fragen, wieso sich zwei zentrale Momente unseres Selbstverständnisses, nämlich Freiheit und Normativität, einer bestimmten naturwissenschaftlichen Zugangsweise zu uns und zu unserem Geist zu entziehen scheinen. Die meisten Philosophen, die sich heute mit der Freiheitsproblematik beschäftigen, halten den Gegensatz von praktischem Selbstverständnis und Naturwissenschaft für bloßen Schein. Sie 15 plädieren für eine durchgängige Vereinbarkeit von Freiheit und Handeln aus Gründen einerseits und naturwissenschaftlicher Erklärung auch unseres Handelns andererseits. Oft eher implizit unterlegen sie der naturwissenschaftlichen Forschung einen kausaldeterministischen Ansatz, dem zufolge jedes Ereignis notwendige Wirkung einer vorausgehenden Ursache ist und es erst die Situierung in einem geschlossenen Kausalnexus erlaubt, retrospektiv eindeutige Erklärungen bereits zu Ende gekommener Geschehensverläufe zu geben sowie prospektiv wissenschaftliche Vorhersagen über künftige Verläufe zu machen. Dahinter steht die Vorstellung, wir lebten in einer Welt, „in der“, wie Peter Bieri schreibt, „die Vergangenheit […] eine einzige, eindeutig bestimmte Zukunft fest[legt]. Die tatsächliche Vergangenheit dieser Welt, zusammen mit den in dieser Welt gültigen Gesetzen, läßt nur ein einziges zukünftiges Geschehen zu.“8 Bei Bieri klingt es so, als sei die Festlegung auch unseres Handelns durch die Vergangenheit sogar notwendige Bedingung dafür, daß wir uns selbst verständlich bleiben. Wir könnten gar nicht planen, gäbe es keinen grundlegenden „Zusammenhang zwischen Bedingung, Gesetzmäßigkeit und Verstehen“.9 Diese Überlegung, die sich schon bei David Hume und in anderer Form, ungeachtet aller Differenzen, auch bei Kant findet, machen sich allerdings nicht alle Vereinbarkeitstheoretiker oder Kompatibilisten in der neueren Freiheitsdiskussion zu eigen. Für sie ist wesentlich nur, daß unser praktisches Selbstverständnis jedenfalls nicht bedroht wäre, sollte sich die Determinismusthese als wahr erweisen, und daß es deswegen auch keinen Gegensatz zwischen unserem praktischen Selbstverständnis und einem mit deterministischen Prämissen arbeitenden naturwissenschaftlichen Zugang zu uns selbst und unserem Geist geben kann. Der gegenteiligen Auffassung wird eine Verwechslung von Bedingtheit und Zwang unterstellt. Entscheidend sei nicht, ob wir in unserem Handeln determiniert seien, sondern wodurch. Und an dieser Stelle wird dann auch auf praktische Überlegungen und Gründe rekurriert. Die im praktischen Selbstverständnis unterstellte Freiheit sei solange gegeben, wie sich unser Handeln unserem Wollen und unser Wollen unserem Überlegen und Abwägen von 16 Gründen verdanke, gleich wodurch dieses seinerseits bedingt sein könnte. Um auch hier wieder Bieri zu Wort kommen zu lassen, der in vorbildlich verständlicher Weise zusammenfaßt, was heute vorherrschende Meinung ist: „Die Freiheit des Handelns [ist] die Möglichkeit, tun und lassen zu können, was man will. Zu dieser Freiheit gehört […] der Gedanke, daß uns zu einem bestimmten Zeitpunkt mehrere Wege offenstehen. […] Es liegt an uns, welche der verschiedenen Möglichkeiten wir verwirklichen, und das heißt: Es liegt daran, was wir wollen.“10 Und dieses Wollen selbst sei frei, wenn es sich als ein Wille beschreiben lasse, „der sich unter dem Einfluß von Gründen, also durch Überlegen bildet.“ „Der Unterschied zwischen der Freiheit und der Unfreiheit von Tun und Wollen“ sei „ein Unterschied in der Art und Weise des Bedingtseins“, nicht ein Unterschied zwischen dem Unbedingten und dem Bedingten.11 * Dieses, wie gesagt sehr verbreitete, kompatibilistische Bild ist in meinen Augen von trügerischer Einfachheit. Eine Merkwürdigkeit, auf die ich nur hinweisen will, ohne ihr auf den Grund gehen zu können, liegt schon in der eigentümlichen Unschärfe, mit der das Festgelegtsein noch unseres Wollens und Handelns durch Naturgesetze beschrieben wird.12 Naturgesetze schreiben nicht vor, wie sich die Welt zu verhalten hat, sondern beschreiben in systematisierter Form, wie die Welt beschaffen ist.13 Welche Gesetzesaussagen wahr sind, hängt deswegen davon ab, was in der Welt geschieht, nicht umgekehrt.14 Das läßt die Möglichkeit offen, daß menschliche Handlungen nicht durch Gesetze festgelegt sind, sondern selbst erst der Welt jene Gestalt verleihen, über die dann mit naturgesetzlichen Allaussagen quantifiziert wird. Doch lassen wir diesen Punkt auf sich beruhen; es ist nicht der Punkt, der sich von der Skizze des praktischen Selbstverständnisses am meisten aufdrängt. Vor dem Hintergrund dieser Skizze halte ich den Zusammenhang von Freiheit, Gründen und Ursachen für erläuterungsbedürftiger. So wie ich es dargestellt habe, handelt es sich bei 17 Gründen um normative Gründe; „Grund“ ist ein normativer Begriff. Aber wenn ich die Verbindung von Freiheit und Gründen richtig entwickelt habe, dann ist auch Freiheit ein normativer Begriff. Zum einen liegt die Erfahrung der Freiheit in der Erfahrung des Abwägens von Gründen. Unser Vortragsbesucher sieht sich nur deswegen nicht genötigt, zum Vortrag zu gehen, weil er seine verschiedenen Möglichkeiten auf ihr Für und Wider hin gewichten kann. Sie liegen noch nicht gewichtet vor, schon gar nicht in der Weise, daß sich eine Neigung, die ihm eine Option attraktiv erscheinen läßt, kausal so gegen andere Neigungen durchsetzt, daß die Person ihr im Handeln folgt. Zum anderen können wir einen freien und einen unfreien Willen gar nicht anders denn im Rekurs auf Gründe unterscheiden. So macht es auch Bieri in einer der zitierten Passagen, wenn er den freien Willen als durch den Einfluß von Gründen bedingten beschreibt. Die Differenz zwischen Faktoren, die Freiheit einschränken, und Faktoren, die dies nicht tun, besteht darin, daß die Faktoren, die Freiheit nicht einschränken, rationale respektive normative Faktoren in Form von Gründen sind, die die Person als solche akzeptiert. Ohne den Begriff des Grundes (oder einen äquivalenten Begriff) können wir den Begriff der Freiheit nicht erläutern, und das macht diesen Begriff zu einem nicht rein deskriptiven. Nun meine ich aber, daß sich die so verstandene Freiheit und die so verstandenen Gründe notwendig einer naturwissenschaftlichen Herangehensweise entziehen. Der Empiriker, der das Gehirn oder das menschliche Verhalten untersucht, beschreibt dieses Verhalten aus der beobachtenden Perspektive der dritten Person. Das Abwägen von Gründen und die mit ihm einhergehende Erfahrung der Freiheit sind dagegen nur aus der Perspektive der ersten Person, meist im Singular, zuweilen auch im Plural, möglich. Und deswegen können das praktische Überlegen und die praktischen Gründe auch nicht als kausale Faktoren in einer naturwissenschaftlichen Beschreibung auftauchen, genauso wenig wie übrigens der Begriff der Person, ein Umstand, auf den in dieser Reihe Professor Kemmerling hingewiesen hat. Es dürfte kein Zufall sein, daß eine weitere eigentümliche Unschärfe in Bieris (und nicht nur 18 seiner) Darstellung darin liegt, daß sie die Rede vom „Bedingtsein“ des Willens durch Überlegungen und Gründe nicht näher expliziert, vor allem weitgehend im Unbestimmten läßt, ob es sich bei dieser Bedingtheit um eine kausale handeln soll. * Es gibt verschiedene Strategien, um diese prima facie mißliche Konstellation zu entschärfen. Eine strikt anti-naturalistische hat vor kurzem Akeel Bilgrami in seinem Buch Self-knowledge and Resentment vorgeschlagen, auf das Professor Carl in seinem Vortrag hingewiesen hatte.15 Bilgramis Vorschlag läuft auf eine scharfe Trennung sowohl von Gründen und Ursachen als auch von Erster-Person- und Dritter-Person-Perspektive hinaus. Danach können wir ein und dasselbe Geschehen einmal – nämlich aus der Perspektive der ersten Person – als eine Handlung, die den von der Person selbst gesetzten Standards (Bilgrami redet vornehmlich von den „commitments“ der Person) gerecht wird oder nicht gerecht wird, begreifen und einmal als ein Verhalten, das sich aus den und den Ursachen erklärt. Im Fall unseres Vortragsbesuchers hieße das, daß wir einmal eine Aussage darüber treffen können, ob er seinen eigenen Absichten gefolgt ist (er hat sich gesagt, er sollte zum Vortrag gehen, und hat es, wie wir annehmen wollen, tatsächlich getan), und ein andermal Feststellungen darüber treffen können, was den Besucher faktisch kausal in den Vortragssaal gebracht hat, also etwa bestimmte Prozesse in seinem Gehirn und in seinem Körper. Eine ähnliche Trennung von Gründen und Ursachen war eine Zeitlang in der Wittgensteinrezeption in den fünfziger und sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts en vogue. Sie prägt zum Beispiel auch noch die besondere Variante des Kompatibilismus, die Peter Strawson, auf den sich Bilgrami vielfach beruft, in seinem berühmten Vortrag „Freedom and Resentment“ ausgearbeitet hat. Ein wichtiges Anliegen von Strawson wie Bilgrami liegt in der Vermeidung metaphysischer Fragen; unser normatives Vokabular wird als Effekt einer sozialen Praxis beschrieben, die Zuschreibung moralischer Verantwortung zum Beispiel als Effekt unserer „reactive attitudes“ 19 wie Empörung und Schuldgefühl, ohne daß diese Praxis selbst eines irgendwie tieferen Fundamentes bedürfte. Ich glaube inzwischen, daß diese Strategie nicht verfängt. Mich überzeugt weder die scharfe Trennung von Gründen und Ursachen noch die scharfe Trennung der Perspektiven der ersten Person und der dritten Person. Was erstere anbelangt, so scheint mir zu unserem praktischen Selbstverständnis doch auch zu gehören, daß es unsere Absichten selbst sind, die uns, wenn es gut geht, dazu bringen, und zwar kausal dazu bringen, zu tun, was wir uns vorgenommen haben. Und vermittelt über unsere Absichten wirken sich auch unsere praktischen Überlegungen und Gründe auf unser Handeln und damit auf die Welt aus. Zwar ist es eine offene Frage, ob das Verhältnis von Überlegen und Absicht als ein kausales zu denken ist (wohl eher nicht), aber der Weg von der Absicht zum Handeln kann vernünftigerweise nur als ein ereigniskausaler konzipiert werden. Auf diese Weise verursacht eine für Gründe offene mentale Einstellung etwas in der Welt. Bilgrami möchte dagegen das gesamte Vokabular intentionaler Einstellungen auf normative Kontexte (im Unterschied zu explanatorischen) beschränken. Eine derartige Restriktion kommt einer epiphänomenalistischen Sicht, die unser geistiges Leben von dem, was den Lauf der Welt wirklich bestimmt, entkoppelt, problematisch nahe. Meine Reserve auch gegenüber einer scharfen Separierung der Perspektiven der ersten und der dritten Person rührt – das sei hier nur am Rande vermerkt – von einem Verständnis des referentiellen Gebrauchs des Personalpronomens „ich“ her, für das Strawson in anderem Zusammenhang argumentiert hat. Demzufolge kann ich mit „ich“ auf mich nur so Bezug nehmen, daß ich damit auf eine Person referiere, die selbst Teil einer raumzeitlichen Welt ist, auf die wir aus der Perspektive der dritten Person Bezug nehmen können.16 Insofern verweisen beide Perspektiven aufeinander; sie lassen sich nicht vollständig scheiden. * 20 Erfolgreicher könnte eine andere Strategie sein, die naturalistische Züge trägt. Sie geht von der heute kaum noch bestrittenen Einsicht aus, daß mentale Prozesse nach allem, was wir wissen, physisch realisiert sind. Während ich Überlegungen anstelle und Handlungsgründe abwäge, geschieht etwas in meinem Gehirn. Meine Gedanken haben neuronale Korrelate. Es ist wichtig zu sehen (und wird leider häufig übersehen), daß diese Korrelationsbeziehung keine kausale ist; weder bestimmt mein Gehirnzustand kausal meinen Gedanken noch determiniert mein Gedanke kausal meinen Hirnzustand. Daß es sich bei einer simultanen Realisierungsbeziehung um einen kausalen Nexus handelt, ist begrifflich ausgeschlossen, denn Ursache und Wirkung können nicht gleichzeitig auftreten. Insofern ist „die Erforschung neuronaler Korrelate des Mentalen für das Freiheitsproblem irrelevant“, wie Geert Keil im letzten Heft der Deutschen Zeitschrift für Philosophie richtig konstatiert.17 Er hätte allerdings hinzufügen sollen, daß bis heute im Dunkeln geblieben ist, welche ontologischen Implikationen der Gedanke einer Realisierung von Mentalem in Physischem eigentlich hat. Ungeachtet ontologischer Probleme könnte man nun aber erwägen, ob die Kausalität unserer praktischen Überlegungen nicht einfach mit der Kausalität der materiellen Korrelate, in denen sie realisiert sind, zu identifizieren ist. Unsere Absichten etwa wären dann kausal in der Weise wirksam wie es das Feuern von Synapsen sein mag. Und dieser Kausalzusammenhang wäre natürlich naturwissenschaftlich erforschbar und beschreibbar, ja er wäre es nur so. Ich vermute, daß Professor Pauen irgend etwas in dieser Art vorschwebte, als er seinen in dieser Ringvorlesung gehaltenen Vortrag ein wenig vollmundig mit „Warum sich Bewußtsein erklären läßt“ betitelte. Nicht zufällig ist auch Pauen in Fragen der menschlichen Freiheit ein überzeugter Kompatibilist, dem es inzwischen gelungen ist, selbst Neurowissenschaftler wie Gerhardt Roth davon zu überzeugen, daß ihre Forschungen zum Gehirn keine Gefahr für die menschliche Freiheit bedeuten. Aber ist nicht auch dieser Weg zu einfach? Trotz meiner Kritik an Bilgrami scheint er mir doch etwas richtig zu sehen, was in der zweiten Strategie wieder verloren zu gehen droht. Der 21 empirische Neurowissenschaftler, der die neuronalen Korrelate intentionaler Einstellungen erforscht, erforscht streng genommen allein diese Korrelate, nicht die Einstellungen. Für diese wie für alles Normative oder mit Normativem in Form von Gründen Verknüpfte gilt weiter, daß es aus der reinen Beobachterperspektive nicht zugänglich ist. Um neuronale Muster als Korrelate von intentionalen Einstellungen identifizieren zu können, ist der Neurowissenschaftler vielmehr auf die lebensweltlichen Erfahrungen von Personenprobanden angewiesen, die ihm aus der Perspektive der ersten Person berichten, was ihnen gerade durch den Kopf geht. Ich kann deswegen auch nicht erkennen, daß der Neurowissenschaftler sensu strictu die Kausalität von intentionalen Einstellungen erkundet. Bei dieser Kausalität scheint es sich vielmehr um eine Kausalität eigener Art zu handeln. Leider muß ich gestehen, daß mir völlig schleierhaft ist, wie diese Kausalität positiv zu verstehen ist. Das Rätsel, das sich zumindest mir an dieser Stelle stellt, ist nicht irgendein Rätsel. Es betrifft nichts Geringeres als die Frage, wie die vernünftigen, von Gründen geleiteten Überlegungen von Personen einen Unterschied in der Welt machen können. Dieses Problem ist natürlich nicht neu, wie sollte es auch? Kant hat es unter dem Begriff einer Kausalität aus Freiheit bzw. unter der Fragestellung, wie Vernunft praktisch sein kann, thematisiert. Es hat ihn zu einer Zwei-Welten-Lehre oder vielleicht auch nur Zwei-AspekteLehre geführt, der zufolge beides gelten soll: daß wir als Sinnenwesen einem strikten naturgesetzlichen Kausalzusammenhang unterliegen und daß wir als Vernunftwesen spontan und den Gesetzen unserer Vernunft folgend neue Kausalketten in der Welt initiieren können. Ich habe immer gefunden, daß das nicht zusammengeht. Und deswegen überrascht es mich nicht weniger als es manche von Ihnen überraschen dürfte, daß in der Konsequenz meiner Überlegungen zwar nicht unbedingt die kantische Metaphysik liegt, aber doch ein Gedanke, der ihr verwandt ist, der Gedanke nämlich, daß die Kausalität unserer mentalen Einstellungen eine andere sein muß als diejenige, die durch die Naturwissenschaften erforscht wird. Da 22 mich dieses Ergebnis verwirrt, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir in der Diskussion aufzeigen könnten, wo ich in die Irre gegangen bin. Eine für mich sehr ungewohnte Perspektive, die unter Umständen auf eine Lösung führen könnte, hat sich schon in meinem kurzen Disput mit Professor Mühlhölzer im Anschluß an seinen Vortrag über externalistische Konzeptionen des Geistigen angedeutet. Herr Mühlhölzer hatte nämlich zu bedenken gegeben, ob die Rede von einem kausalen Zusammenhang nicht nur in alltäglichen Handlungserklärungen und gar nicht in naturwissenschaftlichen Erklärungen angebracht sein könnte. Das wäre die Umkehrung des Bildes, das wir bei Leuten wie Bilgrami und eventuell Strawson finden. Ich habe keine Zeit gefunden, darüber gründlicher nachzudenken. * An einem allerdings möchte ich festhalten: Ich habe den Eindruck, daß aus einem falschen Respekt vor den Natur- und insbesondere den Neurowissenschaften, deren Verdienste niemand wird in Abrede stellen wollen, in der öffentlichen, aber auch in großen Teilen der philosophischen Diskussion das Bewußtsein für die Schwierigkeiten der Probleme geschwunden ist, die uns ein tieferes Nachdenken über den menschlichen Geist aufschließt. Dieses Bewußtsein sollte zurückgewonnen werden. Vgl. zum folgenden Michael Tomasello et al., „Understanding and sharing intentions: The origins of cultural cognition“, Behavorial and Brain Sciences (2005) 28, S. 675-735, bes. S. 676 ff. 2 So beschreibt es Ulrich Pothast, Philosophisches Buch, Frankfurt: Suhrkamp 1998, S. 195. 3 Zu Umwertungen von Schamgefühlen vgl. Charles Taylor, „Self-Interpreting Animals“. 4 So Ernst Tugendhat, Egozentrizität und Mystik, München, Beck 2005, S. 47. 5 Vgl. Ernst Tugenthat, Egozentrizität und Mystik, 3. Kapitel. Tugenthat vertritt allerdings eine kompatibilistische Freiheitskonzeption, die ich ablehne. 6 Günther Patzig, Nachwort zu Rudolf Carnap, Scheinprobleme in der Philosophie, Frankfurt: Suhrkamp 1976, S. 86. 7 Siehe etwa Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, Bonn: Bouvier 1991, S. 38, 48, 55 u.ö. 8 Peter Bieri, Das Handwerk der Freiheit. Über die Entdeckung des eigenen Willens, München: Hanser 2001, S. 16. 9 Ebenda. 10 Peter Bieri, Das Handwerk der Freiheit. Über die Entdeckung des eigenen Willens, München: Hanser 2001, S. 165 f. 11 Peter Bieri, Das Handwerk der Freiheit. Über die Entdeckung des eigenen Willens, München: Hanser 2001, S. 166. 1 23 Vgl. dazu den hilfreichen Aufsatz von Geert Keil, „Naturgesetze, Handlungsvermögen und Anderskönnen“, Deutsche Zeitschrift für Philosophie 55 (2007) 6, S. Geert Keil, „Naturgesetze, Handlungsvermögen und Anderskönnen“, Deutsche Zeitschrift für Philosophie 55 (2007) 6, S.929-948. 13 Geert Keil, „Naturgesetze, Handlungsvermögen und Anderskönnen“, Deutsche Zeitschrift für Philosophie 55 (2007) 6, S. 934. 14 Geert Keil, „Naturgesetze, Handlungsvermögen und Anderskönnen“, Deutsche Zeitschrift für Philosophie 55 (2007) 6, S. 940. 15 Akeel Bilgrami, Self-Knowledge and Resentment, Cambridge, Mass.: Harvard University Press 2006, bes. Kap. 3. Vgl. auch A. Bilgrami, „Some Philosophical Integrations“, in: C. MacDonald, G. MacDonald (Hrsg.), McDowell and His Critics, Oxford: Blackwell 2006, 50–66. 16 Darauf macht auch John McDowell in seiner Antwort auf Bilgrami aufmerksam; siehe sein „Response to Akeel Bilgrami“, S. 72 in: Cynthia MacDonald/ Graham MacDonald (Hrsg.), McDowell and his Critics, Oxford: Blackwell 2006, S. 66-72. 17 Geert Keil, „Naturgesetze, Handlungsvermögen und Anderskönnen“, Deutsche Zeitschrift für Philosophie 55 (2007) 6, S. 945. 12 24