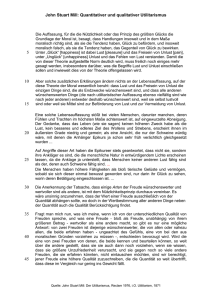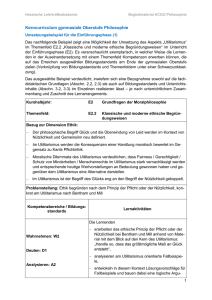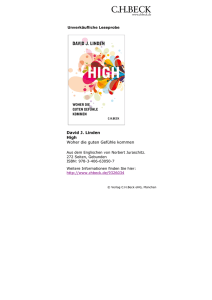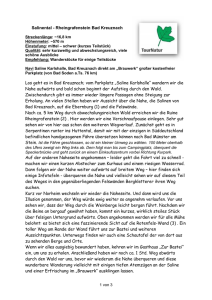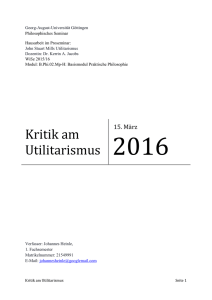I. John Stuart Mills Utilitarismus - UK
Werbung

PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus I. John Stuart Mills Utilitarismus John St. Mills relativ schmales Buch Der Utilitarismus (1861) darf als eins der Hauptwerke nicht nur der utilitaristischen Ethik, sondern der Ethik insgesamt gelten. Wie Kants GMS gehört Der Utilitarismus zum Standardrepertoire der philosophischen Ethik, und jeder der sich philosophisch ernsthaft mit ethischen Fragen beschäftigen möchte, sollte es kennen und darüber nachgedacht haben. Anders als Benthams Werk An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, das für Mill der zentrale Anstoß für seine eigene praktische Philosophie bildete, finden wir Mill in seinem Essay Der Utilitarismus bemüht, einem weiten intellektuellen Publikum den Utilitarismus als eine rationale und überzeugende Moraltheorie vorzustellen, und das vor allem vor dem Hintergrund verbreiteter Kritiken, die der Benthamismus heraufbeschworen hat. Die reformerische Emphase, mit der Bentham die fundamentalen Prinzipien der Moral und des Rechts als kritische Instrumente gegen die herrschenden Rechtsinstitutionen wendete, ist in Mills Essay nicht tonangebend. Zu seinem Bemühen, die Rationalität und Plausibilität des Utilitarismus darzulegen, gehört vielmehr auch der Versuch, ihn nicht als eine radikal revisionäre, sondern als eine mit der Alltagsmoral im großen und ganzen konvergierenden Moralauffassung darzustellen. Zunächst ein Überblick über den Aufbau. Mills Essay ist in fünf Kapitel gegliedert. Kapitel 1: „Allgemeine Anmerkungen“ hat die Funktion einer Einleitung, in der Mill einerseits das Vorhaben des Essays umreißt, und andererseits nicht-utilitaristische Moraltheorien kritisiert. Das Kapitel 2: „Was heißt Utilitarismus“ entwickelt die utilitaristische Moralkonzeption zusammen mit der Beantwortung von Kritiken des Utilitarismus. Hier werden zentrale Bestandteile des Utilitarismus entwickelt – so Mills eigene, gegenüber Bentham modifizierte PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus Wohlfahrtstheorie, und eine differenzierte Sicht über die Rolle des utilitaristischen Moralprinzips. Kapitel 3: „Von der fundamentalen Sanktion des Nützlichkeitsprinzips“ behandelt die Frage moralischer Motivation – und insbesondere die Frage nach den Motivationsquellen für die utilitaristische Moral. „Sanction“ war ein technischer Terminus in der Ethik des 18. und 19. Jahrhunderts und wird bei Bentham definiert als eine Quelle von Lust und Schmerz, die Menschen zu handeln motivieren oder zu einer Handlung verbinden (Bentham, S. 34, Kap III). Kapitel 4: „Welcherart Beweis sich für das Nützlichkeitsprinzip führen lässt“ ist, wie Sie sich vorstellen können, nicht nur ein sehr zentrales, sondern auch eins der umstrittensten Kapitel des Essays: Hier geht es um die Begründung des Nützlichkeitsprinzips oder näher um die der entscheidenden These, dass das allgemeine Glück das einzige Kriterium der Moral ist. Das Kapitel 5: „Über den Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Nützlichkeit“ ist für Mills Verteidigung des Utilitarismus von besonderer Bedeutung. Denn der Utilitarist muss sicherstellen, dass es keinen eigenständigen Standard moralischer Beurteilung unter dem Namen der Gerechtigkeit gibt, um seine Sicht, dass Nützlichkeit die letzte Berufungsinstanz in allen ethischen Fragen ist (vgl. Mill, Über die Freiheit, S. 18), einsichtig machen zu können. 1. Mills Kritik der intuitionistischen oder aprioristischen Ethik In dem sehr kurz gehaltenen ersten Kapitel setzt sich Mill kritisch mit Schulen der Ethik auseinander, die er – in gewissen Hinsichten – für unvereinbar mit dem Utilitarismus hält. Seine Diskussion ist denkbar knapp und führt sicherlich nicht zu einem zwingenden Ergebnis. Trotzdem ist es interessant, auf seine Punkte kurz einzugehen. Ethiken, gegen die er sich wendet, bezeichnet Mill hier als intuitionistische oder auch als aprioristische Ethiken und kontrastiert sie mit der „induktiven“ Schule der Ethik: „Der einen Auffassung zufolge sind die PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus Grundsätze der Moral a priori evident und erzwingen Zustimmung, sobald die Wortbedeutungen verstanden sind; der anderen zufolge sind Recht und Unrecht ebenso wie Wahrheit und Falschheit eine Frage von Beobachtung und Erfahrung.“ (§3, S. 6) Wie Mill den Unterschied hier darstellt, handelt es sich klarerweise um einen Unterschied nicht innerhalb der Ethik, sondern um einen auf der Ebene der Metaethik: Intuitionismus ist eine bestimmte Auffassung über die Art und Weise wie wir herausfinden oder wie wir wissen können, was moralisch von uns gefordert wird, keineswegs aber eine Auffassung darüber, was es denn ist, was moralisch von uns gefordert wird. Wenn Intuitionismus nur die Auffassung ist, dass wir die Grundsätze der Moral intuitiv und weder auf der Basis von Erfahrungen, noch auf der Basis von Argumenten erfassen und dass die Grundsätze der Moral folglich selbstevidente Handlungsregeln sind, dann scheint Intutionismus gegenüber der Frage, was denn diese Grundsätze sind, neutral zu sein. Könnte nicht auch das utilitaristische Prinzip selbst eben ein Prinzip sein, das wir intuitiv erfassen oder das den Status eines selbstevidenten Prinzips hat? Das scheint eine echte Option zu sein. Und in der Tat hat die nächste große Figur des utilitaristischen Denkens nach Mill – Henry Sidgwick – die Auffassung vertreten, dass das Prinzip der rationalen Benevolenz, wie er es nennt, axiomatischen Status hat und nicht nur ein, sondern das einzige Prinzip moralischen Denkens ist, das wirklich selbstevident genannt werden darf und genannt werden muss: „Utilitarianism is thus presented as the final form into which Intuitionism tends to pass, when the demand for really self-evident first principles is rigorously pressed.“1 Zu beachten ist hier allerdings, dass es lediglich das oberste Prinzip der Moral ist, von dem Sidgwick behauptet, es sei selbstevident. Untergeordnete Grundsätze oder Sekundärprinzipien, wie Mill sie nennt, können jedoch keineswegs selbstevident sein. Denn die Folgen von Handlungen, von denen nach utilitaristischer Auffassung die moralische Richtigkeit und Falschheit der Handlungen abhängt, können ja nicht a priori gewusst werden. Selbst wenn 1 Henry Sidgwick, The Methods of Ethics. S. 388. (Buch III, Kapitel XIII). PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus Sidgwick recht hätte, würde deshalb nicht folgen, dass die praktische Frage: Was soll ich tun? selbstevidente Antworten hat, deren Richtigkeit unabhängig von unserem erfahrungsbasierten Wissen über die Welt und über uns selbst unmittelbar einsichtig sind. Mills Gegnerschaft gegen die intuitionistische Schule der Ethik lese ich daher vor allem als eine Zurückweisung der Prätention, dass wir lediglich an unsere moralischen Intuitionen appellieren müssen und auch an nichts anderes appellieren können, um die Gültigkeit moralischer Urteile und Forderungen einsehen zu können. Mill sieht, dass diese Prätention nicht nur metaethischer Natur ist, sondern sich vielmehr auch in einer charakteristischen Auffassung über die Gestalt der Moral und damit in einer charakteristischen Ausgestaltung der Ethik niederschlägt. Die Intuitionisten, schreibt er, machen [...] nur selten den Versuch, ein Verzeichnis der Prinzipien a priori anzulegen, die als Prämissen dieser Wissenschaft [der Moral] dienen könnten, und noch seltener machen sie sich die Mühe, jene verschiedenen Prinzipien auf ein Grundprinzip, eine gemeinsame Grundlage aller moralischen Verpflichtungen zurückzuführen. Entweder erkennen sie die gewöhnlichen Moralvorschriften als a priori gegeben an, oder aber sie stellen als gemeinsame Grundlage jener Maximen irgendein allgemeines Prinzip auf, dessen Verbindlichkeit viel weniger einsichtig ist als die der Maximen selbst und dem es nie gelungen ist, allgemeine Anerkennung zu finden. Wollten sie ihren Anspruch begründen, müsste es jedoch entweder ein grundlegendes Prinzip oder Gesetze geben, auf der die gesamte Moral letztlich beruht, oder, falls es deren mehrere geben sollte, eine bestimmte Rangordnung unter ihnen; und jenes grundlegende Prinzip bzw. die Regel, nach der in Konfliktfällen zwischen den einzelnen Prinzipien zu entscheiden ist, sollte unmittelbar evident sein. (§ 3, S. 6) Wenn man Mills Gedanken hier auf einen Punkt bringen will, so besteht er darin, dass der Intuitionismus deshalb zutiefst unglaubwürdig ist und rational nicht akzeptiert werden kann, PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus weil er kein kritisches Potential zur Begründung moralischer Verpflichtungen enthält. Und das in mehrerer Hinsicht. Er enthält erstens keine kritisches Potential im Hinblick auf die Beurteilung der Alltagsmoral. Denn wie soll sich der Intuitionist zur Alltagsmoral stellen? Er kann die moralischen Urteile oder Verhaltensvorschriften der Alltagsmoral als a priori gegeben, das heißt als selbstevidente Urteile oder Vorschriften akzeptieren. Aber hier taucht ein Problem auf. Denn der Intuitionist scheint keine Möglichkeit zu haben, die Tatsache, dass er sie akzeptiert, selbst eine kritischen Prüfung zu unterziehen. Das heißt es scheint für ihn keine Möglichkeit zu geben, die behauptete Selbstevidenz jener Urteile oder Vorschriften von der schlichten Tatsache zu unterscheiden, dass er sie zu akzeptieren geneigt ist. Das heißt aber nichts anderes, als dass er diejenigen Urteile, die er akzeptiert, gar nicht weiter rationalisieren kann. Der Mangel an kritischem Potential ist also ein Mangel an der Möglichkeit einer kritischen Beurteilung der eigenen Intuitionen. Der Intuitionist steht also immer in der Gefahr, das, was er selbst zu akzeptieren geneigt ist, nachträglich mit der Weihe der Selbstevidenz zu versehen. Daraus entspringt, zweitens, als ein weiteres Problem das Problem wie man sich als Intuitionist rational mit abweichenden Moralvorstellungen auseinandersetzen soll. Denn angenommen, der Intuitionist teilt nicht alle Urteile der Alltagsmoral. Dann kann er die Alltagsmoral nicht als Verkörperung eines Systems selbstevidenter Handlungsbeschränkungen einstufen. In diesem Fall muss er aber einen Unterschied machen zwischen dem, was jemand als unmittelbar einsichtig zu akzeptieren bereit ist, und dem, was unmittelbar einsichtig ist. Und das wird ihn als einen Intuitionisten in die Verlegenheit bringen, sein Urteil als gültig auszuweisen, unabhängig von seiner Bereitschaft, es zu akzeptieren. Aber wie sollte er das tun, wenn die letzte Appellationsinstanz in moralischen Fragen das moralische Gefühl, das Gewissen oder die moralische Intuition ist? Nun können Intuitionisten – und das ist eine Möglichkeit, die Mill im zitierten Text anzeigt – aber durchaus ein höherstufiges Prinzip aufstellen, das jenen von ihnen akzeptierten Urteilen PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus oder Verhaltensregeln zugrunde liegt. Dieses Prinzip müsste dann jedoch im Unterschied zu den von ihm abhängigen Verhaltensregeln in sehr viel höherem Masse einsichtig sein, ja intuitiv gewiss sein. Aber das ist, wie Mill hervorhebt, keineswegs der Fall. Mill denkt hier wahrscheinlich an so etwas wie Kants kategorischen Imperativ. Verglichen mit einem gemeinhin akzeptierten Urteil wie dem, dass es unmoralisch ist, andere zu belügen, oder dem ebenfalls einhelligen Urteil, dass es unmoralisch ist, andere zu quälen, ist dieses Prinzip aber zweifellos nicht in höherem Masse evident oder gewiss. Ein weiterer, dritter, Punkt, den Mill kritisch gegen die intuitionistische Schule hervorhebt, betrifft das Problem der Anwendung der als selbstevident ausgegebenen Verhaltensregeln. Wenn es selbstevidente Regeln gibt, die mir sagen, was ich tun und unterlassen soll, sollte es eigentlich auch selbstevident sein, was ich in einer gegebenen Situation tun soll. Es sollte also eine wiederum gewisse Regel geben, „nach der in Konfliktfällen zwischen den einzelnen Prinzipien zu entscheiden ist.“ Um das Problem zu veranschaulichen, denken sie an David Ross’ pluralistische Deontologie der prima facie Pflichten. Ross hatte darauf hingewiesen, dass wir auch in Fällen des Konflikts von Pflichten unser moralisches Denken keineswegs als ein an den Konsequenzen des Handelns orientiertes Denken rekonstruieren müssen. Dass ich in einer Situation, in der ein anderer ohne meine Hilfe ums Leben kommen würde, einem relativ belanglosen Versprechen nicht Folge leisten muss, liegt in seiner Sicht nicht daran, dass das Halten des Versprechens weniger gute Konsequenzen hat, als die Hilfsleistung, sondern daran, dass in einem solchen Fall, wie er sich ausdrückt, die eine Pflicht die andere überwiegt oder mehr von einer Pflicht ist: „it is not because I think I shall produce more good thereby but because I think it the duty which is in the circumstances more of a duty.“ Dass die Pflicht zur Hilfsleistung in einer solchen Situation ‚mehr von einer Pflicht’ ist, würden wir sicherlich alle akzeptieren. Aber mehr als ein Appell an unsere Intuition lässt Ross’ Auffassung nicht zu. Das bedeutet aber, dass wir gar nicht mehr zu sagen im Stande sind, warum in einer solchen Situation jene Pflicht stärker bindet als diese Pflicht. Es gibt hier keine Regel PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus zur Beurteilung und Entscheidung in Situationen des Pflichtenkonflikts. Eine solche Regel müsste es aber, glaubt Mill, geben, wenn der Intuitionist seinem eigenen Anspruch gerecht werden will, dass die moralische Beurteilung von Handlungen auf selbstevidenten Prinzipien beruht. Die geringe Plausibilität der intuitionistischen Schule zeigt sich für Mill nach meiner Auffassung also nicht so sehr auf der Ebene der Metaethik, sondern auf der Ebene der Ethik selbst. Ihr fehlt es (1) an Ressourcen der kritischen Beurteilung der eigene Theoriebildung, sie stellt (2) keine Ressourcen zur kritischen Beurteilung unserer moralischen Praxis bereit, und sie bietet (3) gerade da keine Orientierung, wo wir sie brauchen, wo die Frage: Was soll ich tun? wirklich drängend wird. Die Unglaubwürdigkeit einer intuitonistischen oder aprioristischen Ethik zeigt sich für Mill auch indirekt daran, dass sich Intuitionisten, wenn sie moralische Urteile überhaupt einer kritischen Prüfung unterziehen, dann insgeheim utilitaristischer Argumente bedienen: „[...] zumindest jene Apriori-Moralisten, die das Argumentieren überhaupt noch für notwendig halten, [können] auf utilitaristische Argumente nicht verzichten.“ (§ 4, S. 7) Diesen Punkt versucht Mill am Beispiel von Kant zu erhärten: Sobald er es [...] unternimmt, aus dieser Regel [dem kategorischen Imperativ] einige konkrete moralische Pflichten herzuleiten, misslingt ihm in geradezu grotesker Weise der Nachweis, dass darin, dass alle vernünftigen Wesen nach den denkbar unmoralischsten Verhaltensnormen handeln, irgendein Widerspruch, irgendeine logische oder auch nur physische Unmöglichkeit liegt. Was er zeigt, ist eigentlich das, dass die Folgen einer allgemeinen Befolgung dieser Normen derart wäre, dass jedermann von ihnen verschont bleiben wollte. (§4, S. 8) Mills Punkt ist hier nicht von Interesse als eine Interpretation von Kant. Wichtig ist seine Beobachtung, dass es zumindest nicht leicht fällt, unabhängig von jeder Folgenorientierung PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus eine moralische Überlegungen zu rekonstruieren, durch die bestimmte Handlungen als richtig oder falsch bewertet werden. Jeder Versuch einer Zurückweisung des Utilitarismus im Namen einer deontologischen Ethik hat daher zu achten hat, nicht selbst von utilitaristischen Erwägungen Gebrauch zu machen. Einen in diese Richtung gehenden Punkt hatte schon Bentham herausgestrichen: When a man attempts to combat the principle of utility, it is with reasons drawn, without his being aware of it, form that very principle itself. His arguments, if they prove any thing, prove not that the principle is wrong, but that, according to the applications he supposes to be made of it, it is misapplied. Is it possible for man to move the earth? Yes, but he must first find out another earth to stand upon. Benthams Bemerkung ist natürlich vollkommen überzogen. Wenn er recht hätte, dann wäre es unmöglich das Prinzip der Nützlichkeit zurückzuweisen, ohne es zugleich zu akzeptieren; und Bentham hätte eine Art transzendentales Argument für den Utilitarismus geliefert. Das ist natürlich nicht so. Auch Mill glaubt keinesfalls, dass seine Kritik an der intuitionistischen Schule schon irgendeine Art von Beweis für den Utilitarismus ist. Einen solchen indirekten Beweis führt er selbst nicht und er glaubt auch weder, dass das erforderlich, noch, dass es besonders sinnvoll ist, wenn Beweise die Funktion haben sollen, eine Position rational einsichtig zu machen. Sein nächster Schritt ist daher zunächst einmal die genaue Klärung des Sinns des utilitaristischen Moralprinzips. 2. Das Nützlichkeitsprinzip - Vorklärungen Das zweite Kapitel „Was heißt Utilitarismus“ beschäftigt sich nicht mit der Begründung, sondern mit der Erläuterung des Nützlichkeitsprinzips. Mill hält dieses Prinzip vor allem angesichts der weitverbreiteten Kritiken am Utilitarismus für erläuterungsbedürftig. Er PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus bemüht sich zu zeigen, dass diese Kritiken auf Missverständnissen beruhen, und dass, wenn diese Missverständnisse behoben sind, der Spielraum für eine rationale Zurückweisung des Utilitarismus zumindest extrem klein wird. Obwohl er sich hier nicht mit der Frage nach der Beweisfähigkeit oder dem Beweis für das utilitaristische Moralprinzip, sondern nur mit dessen Sinn beschäftigt, hat daher das zweite Kapitel für Mill doch die wichtige dialektische Funktion, dem Gegner des Utilitarismus den Wind aus den Segeln zu nehmen. Auf die dialektischen Aspekte werde ich jedoch zunächst einmal nicht eingehen und mich vor allem auf die Frage nach dem Gehalt des utilitaristischen Moralprinzips beschränken. Mill präsentiert es im § 2 des zweiten Kapitels: Die Auffassung, für die die Nützlichkeit oder das Prinzip des größten Glücks die Grundlage der Moral ist, besagt, dass Handlungen insoweit und in dem Maße moralisch richtig sind, als sie die Tendenz haben, Glück zu befördern, und insoweit moralisch falsch, als sie die Tendenz haben, das Gegenteil von Glück zu bewirken. Unter „Glück“ [happiness] ist dabei Lust [pleasure] und das Freisein von Unlust [pain], unter „Unglück“ [unhappiness] Unlust und das Fehlen von Lust verstanden. (§ 2, S. 13). Betrachten wir das gesamte Kapitel, so sind es vor allem zwei Fragen, deren Beantwortung aus Mill’scher Sicht zum Verständnis dieses Standards der Moral besonders dringlich sind. Die erste Frage betrifft den genauen Sinn der Rede von Lust und Unlust/Schmerz. Die zweite Frage betrifft die Rolle dieses Prinzips. Im großen und ganzen strukturieren diese beiden Fragen das zweite Kapitels, wobei Mill der ersten Frage in den §§ 3 – 18 (S. 13 – 31) nachgeht, der zweiten in den darauffolgenden §§ 19 – 25 (S. 31 – 45). Bevor wir Mills Diskussion dieser Punkte näher betrachten, ist es nützlich, noch einige Vorklärungen zu treffen. Wir können an Mills Formulierung einmal weitere strukturelle Merkmale des Utilitarismus ablesen; aber dann auch einige irreführende Formulierungen in Mills eigener Präsentation beseitigen. PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus (1) Für das Verständnis des utilitaristischen Standards der Moral ist es wesentlich, dass das Glück, um dessen Beförderung es geht, nicht das Glück des jeweils Handelnden ist. Das sagt Mill auch selbst explizit in § 18 (S. 30): „[...] das Glück, das den utilitaristischen Maßstab des moralisch richtigen Handelns darstellt, [ist] nicht das Glück des Handelnden selbst, sondern das Glück aller Betroffenen.“ Der utilitaristische Standard verlangt also nicht das, was ein egoistischer Standard verlangen würde. Ein am Glück als Endzweck des Handelns orientierter egoistischer Standard würde verlangen, dass jeder sein eigenes Glück befördern soll. Utilitarismus und Egoismus sind also miteinander unvereinbar. Aber das heißt wiederum nicht, dass das Glück des Handelnden selbst nicht zählt. Das heißt, wenn der utilitaristische Standard verlangt, das Glück zu befördern, dann ist darin das Wohl des Handelnden selbst eingeschlossen. Der utilitaristische Standard impliziert also nicht unmittelbar die Selbstaufopferung des eigenen Glücks zugunsten des Glücks anderer. Wenn ich also zum Beispiel entscheiden müsste, ob ich meine bettlägerige und pflegebedürftige Mutter selbst pflegen soll oder die Pflege einer unpersönlichen Institution anvertrauen soll, dann zählt nicht nur, was die Alternativen für meine Mutter, sondern auch, was sie für mich selbst bedeuten. (2) Der Ausdruck „alle Betroffenen“ kann in zwei verschiedenen Weisen gedeutet werden. Wenn wir eine bestimmte Entscheidungsangelegenheit betrachten, in der ein Handelnder zwischen Alternativen A und B wählen muss, dann sind die Betroffenen die von den zur Entscheidung stehenden Handlungen A und B Betroffenen. Es gibt aber auch einen grundsätzlicheren Sinn der Rede von allen Betroffenen. Das wird klar, sobald wir uns bewusst machen, dass eine Antwort auf die rein faktische Frage, wer oder was alles von einer Handlung betroffen wird, uns noch keine Antwort auf die Frage gibt, wer oder was unter den Betroffenen in moralischer Hinsicht auch berücksichtigt werden muss. In utilitaristischer PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus Hinsicht zählen zu den in moralischen Urteilen zu berücksichtigen Wesen alle empfindungsfähigen Wesen. Der Utilitarismus ist also nicht anthropozentrisch, sondern, wie manche sagen, pathozentrisch. Außerdem zählen zu den Betroffenen im Sinne der in der moralischen Handlungsbeurteilung zu berücksichtigenden Wesen nicht nur die gegenwärtig Lebenden, sondern auch die zukünftig Lebenden. (3) Mit der Antwort auf die Frage, wer oder was zum Kreis der Betroffenen zählt, deren Glück in utilitaristischer Sicht zu berücksichtigen ist, ist noch nicht gesagt, wie diese Betroffenen zu berücksichtigen sind. Hier fordert der Utilitarismus auf der Ebene des Moralprinzips selbst eine strenge Unparteilichkeit. Das hebt Mill im § 18 hervor: „Der Utilitarismus fordert von jedem Handelnden, zwischen seinem eigenen Glück und dem der anderen mit ebenso strenger Unparteilichkeit zu entscheiden wie ein unbeteiligter und wohlwollender Zuschauer.“ Der Kreis der Betroffenen lässt also – auf der prinzipiellen Ebene des utilitaristischen Standards – keine normative Abstufung in dem Sinne zu, dass das Glück einiger mehr zählt als das Glück anderer. Bentham hatte diese strenge Unparteilichkeit mit der berühmten Formel ausgedrück: Everyone to count as one and no one more than one. Um keine Missverständnis aufkommen zu lassen, ist es hier wichtig zwischen einem formalen und einem substantiellen Egalitarismus zu unterscheiden. Die Unparteilichkeit der Berücksichtigung ist ein formal egalitäres Prinzip: es schließt nur aus, dass das Wohl einiger von einer Handlung Betroffener mehr zählt als das Wohl anderer. Es ist aber nicht substantiell egalitär, insofern das utilitaristische Prinzip nicht vorschreibt, dass unter den Betroffenen ein gleiches Nutzen oder Wohlfahrtsniveau herzustellen ist. (4) Mill spricht von dem Glück aller Betroffen, das zu befördern nach utilitaristischer Sicht moralisch gefordert ist. An anderer Stelle (Kap. 4, § 3, S. 61) spricht er auch vom allgemeinen Glück. Der Ausdruck „das Glück aller“ und der Ausdruck „allgemeines Glück“ suggerieren, PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus dass damit auf eine bestimmte Entität Bezug genommen wird, die unabhängig von und zusätzlich zum Glück der Individuen bestehen kann. Aber so ist das von Mill nicht gemeint. Das Glück aller oder das allgemeine Glück ist nach utilitaristischen Verständnis nichts anderes als die Summe des Glücks der Individuen. Glück ist, wenn Sie so wollen, additiv. Schädige ich eine Person und vermindere damit ihr Glück, so vermindere ich damit (ceteris paribus) auch das Glück aller oder das allgemeine Glück. Es gibt in utilitaristischer Sicht aber nicht irgendeinen mysteriösen Allgemeinnutzen, der von der Verminderung oder der Erhöhung des Glücks der Individuen unberührt bleiben könnte. Dieser Punkt ist besonders wichtig, um nicht dem Missverständnis zu erliegen, der Utilitarismus verfolge unter dem Titel „der Allgemeinnutzen“ oder „das Gemeinwohl“ ein abstraktes Ideal, dessen Realisierung von uns verlang, die Interessen der Individuen nicht zu berücksichtigen. Eine solche Vorstellung ist dem Geist des Utilitarismus geradezu entgegengesetzt. Mills Utilitarismus kennt nur ein intrinsisches Gut: das Glück. (5) Mill bezeichnet das utilitaristische Prinzip dort, wo er es eingeführt hat, als das Prinzip des größten Glücks. Mills Text kümmert sich nicht sonderlich um eine Erklärung dieses Punktes, der für die utilitaristische Ethik aber eine besondere Bedeutsamkeit hat. Nehmen wir seine nachfolgende Darstellung, der zu Folge Handlungen insofern und in dem Maße moralisch richtig sind, als sie die Tendenz haben, Glück zu befördern, als eine Erläuterung, dann wird der Sinn der Rede vom größten Glück aber leidlich klar. Der utilitaristische Standard kann in dem Sinne als das Prinzip des größten Glücks bezeichnet werden, dass er die Maximierung des Glücks zum Kriterium der moralischen Bewertung macht. [Mills Formulierung ist daher unglücklich. Denn eine Handlung kann durchaus das Glück (aller) befördern ohne es zu maximieren. Die Maximierungsforderung steckt also im Namen, nicht in der Formulierung des Prinzips]. PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus Dabei ist es wichtig zu sehen, dass die Forderung der Maximierung des Glücks (so wie sie in Mills Formulierung des Prinzips figuriert) nicht die Forderung zu einer bestimmten Handlung oder die Forderung zu einem bestimmten Handlungsplan ist. Obwohl „maximieren“ ein Verb – ein Tätigkeitswort – ist, darf man hier nicht der Assoziation mit einer Tätigkeit erliegen. Gemeint ist einfach folgendes. Wenn wir zum Beispiel vor der Entscheidung zwischen zwei Handlungsalternativen A und B (wobei B auch für die Unterlassung von A stehen kann) stehen, dann wäre es in moralischer Hinsicht falsch, B zu wählen, wenn A die im Hinblick auf das Glück aller Betroffenen besseren Konsequenzen hat. Unter den gegebenen Alternativen hat A nicht nur den größeren, sondern den maximalen Nutzen: A ist dann unter den gegebenen Alternativen diejenige, die den Nutzen oder das Glück maximiert. Die Rede vom größten Glück ist also kriteriell gemeint und gibt uns einen Maßstab zur Handlungsbeurteilung oder besser: ein Kriterium für die Richtigkeit und Falschheit einer Handlung. Eine andere Interpretation der Maximierungsforderung würde ungefähr so aussehen: Das utilitaristische Prinzip verlang von uns, unser Leben darauf auszurichten, soviel Glück wie möglich zu realisieren. Unter dieser Interpretation wäre das utilitaristische Prinzip zunächst einmal sehr viel anspruchsvoller als unter der eben erwähnten. Unter der eben erwähnten gilt einfach: Wenn Du in einer Situation bist, in der Du zwischen zwei oder mehr Handlungsalternativen zu wählen hast, dann sollst Du diejenige wählen, die im Hinblick auf das Glück aller Betroffenen die beste ist. Unter der substantiellen Lesart von ‚Maximierung des Glücks’ gilt jedoch: Versuche alles in Deiner Macht stehende zu tun, das Glück aller zu befördern. Der Unterschied zwischen beiden Lesarten ist nicht unbeträchtlich: Denn nach der zweiten, nicht aber nach der ersten Lesart ist die Beförderung des Glücks aller ein Lebensziel, das der Utilitarismus vorschreibt. Eine Standardkritik des Utilitarismus liest das utilitaristische Prinzip gerade auf diese Weise. Ich werde darauf noch zurückkommen. An dieser Stelle ist jedoch wichtig festzuhalten: Das utilitaristische Prinzip sagt uns, unter welchen PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus Bedingungen eine Handlung falsch und unter welchen Bedingungen eine Handlung richtig ist. Es schreibt uns aber nicht die Maximierung des Glücks als ein Lebensprojekt vor. (5a) Klar ist, dass Handlungen oftmals sowohl negative als auch positive Wohlfahrtseffekte haben. Diejenige von zwei Handlungen, die das Glück aller Betroffenen maximiert, ist daher nicht diejenige, die den größten positiven Nutzen hat, sondern diejenige die, wie man sagt, den größten Nettonutzen hat. Es kommt also auf die Nutzenbilanz einer Handlung an und nicht auf den Betrag ihrer positiven Effekte. Henry Sidgwick hat das in seiner Formulierung des utilitaristischen Standards sehr viel klarer expliziert als Mill. Nach seiner Formulierung lautet der utilitaristische Standard: an action is right if and only if it brings about at least as much net happiness as any other action the agent could have performed; otherwise it is wrong. Nehmen wir einmal nur zur Veranschaulichung an, dass es möglich sei, die Größe von Glück und Unglück mit mathematischer Präzision, also rein quantitativ auszudrücken. Und nehmen wir an eine Handlung A würde 8 Einheiten von Glück und 4 Einheiten von Unglück produzieren. Der Nettonutzen der Handlung A wäre dann gleich 4 Einheiten von Glück. Eine andere Handlung B, nehmen wir an, würde 10 Einheiten von Glück aber 7 Einheiten von Unglück produzieren. Obwohl B mehr Glück produzieren würde, ist der Nettonutzen von B gleich 3 und damit kleiner als der von A. Also ist A und nicht etwa B diejenige Handlung, die den Nutzen oder das Glück maximiert. Nach dem utilitaristischen Standard ist A die moralische richtige, B jedoch die moralisch falsche Handlung. Damit haben wir weitere wichtige strukturelle Merkmale des Utilitarismus vor Augen. Utilitarismus ist (1) teleologisch oder konsequentialistisch (der moralische Wert einer Handlung ist abhängig vom komparativen Wert ihren Konsequenzen), (2) welfaristisch (Wohlergehen ist der einzige intrinsische Wert), (3) monistisch (es gibt einen Standard der PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus moralischen Bewertung), (4) aggregativ (der Gesamtnutzen ist eine Funktion des individuellen Nutzens), (5) universalistisch (das Glück aller Betroffenen und nicht das Glück des Handelnden allein zählt), (6) unparteilich oder formal egalitär (das Wohl jedes einzelnen zählt und zählt gleich wie das Wohl jedes anderen). (6) maximierend Jetzt noch einige wichtige Implikationen und Klärungen. (A) Das utilitaristische Prinzip macht den moralischen Wert einer Handlung offenbar nicht abhängig von den Motiven des Handelnden. Es macht sie daher – und das ist überaus wichtig – auch nicht davon abhängig, ob der Handelnde nach dem utilitaristischen Prinzip selbst oder aus anderen Motiven und Erwägungen heraus handelt. Mill unterscheidet daher scharf zwischen Handlungs- und Charaktermoral. So unterstreicht er in § 19 (S. 32), „dass das Motiv zwar sehr viel mit dem moralischen Wert des Handelnden, aber nichts mit der moralischen Richtigkeit der Handlung zu tun hat. Wer einen Mitmenschen vor dem Ertrinken rettet, tut, was moralisch richtig ist, einerlei, ob er es aus Pflichtgefühl tut oder in der Hoffnung, für seine Mühe entschädigt zu werden.“ Das ist ein wichtiger Punkt, der uns noch an späterer Stelle etwas näher beschäftigen wird. (B) Wenn Mill das Nützlichkeitsprinzip als das Kriterium der moralischen Richtigkeit einer Handlung beschreibt, sollte man den Begriff der Handlung so fassen, dass auch Unterlassungen darunter fallen. Das ergibt sich schon daraus, dass nicht der Wert der Folgen einer Handlung für sich betrachtet, sondern der komparative Wert der Folgen einer Handlung das Kriterium ist. Das folgt aus der Logik der Maximierung. Obwohl Mill sich dazu nicht äußert, gehört es zur typischen utilitaristischen Auffassung, dass zwischen Tun und Unterlassen in moralischer Hinsicht kein grundlegender Unterschied besteht. Einem Hunger leidenden Menschen kein Stück Brot zu geben ist nicht allein darum, PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus weil es sich um die Unterlassung einer Hilfeleistung handelt, schon weniger zu verurteilen als wenn man ihm sein letztes Stück Brot wegnehmen würde. Wer das Brot nicht gibt, hat vielleicht einen weniger perfiden Charakter als der, der das Brot nimmt. Wenn aber die Konsequenzen des Wegnehmens und die des Nicht-Gebens gleich sind, besteht zwischen beiden Verhaltensweisen moralisch gesehen kein interessanter Unterschied. (C) Der letzte Punkt macht schon deutlich, dass der Utilitarist die Rede von Folgen, Konsequenzen und Resultaten nicht so eng interpretiert, wie wir das im Alltag tun. Unserem Alltagsverständnis nach ist das Resultat einer Handlung etwas das (1) zeitlich nach der Handlung kommt, (2) von der Handlung verursacht ist. Was das letztere betrifft, ist klar, dass damit die Resultate von Unterlassungen nicht erfasst werden könnten. Denn wenn ich etwas nicht tue und es geschehen lasse, dass jemand verhungert, dann kann man nicht sagen, dass ich einen kausalen Beitrag zu seinem Verhungern geleistet habe. Dennoch wollen wir hier von einem Resultat meiner Untätigkeit sprechen. Und das macht Sinn. Denn es ist wahr, dass dann, wenn ich nicht untätig geblieben wäre, der Hungernde nicht verhungert wäre. Zweitens müssen Resultate auch nicht unbedingt etwas sein, was zeitlich nach einer Handlung eintritt. Das hat zumindest zwei Gründe. (1) Glück und Unglück können eine Handlung begleiten und müssen nicht zeitlich nachfolgende Konsequenzen sein. Die Befriedigung des Musikhörens oder Lesens ist eine Befriedigung, die mit dem Hören oder dem Lesen einhergeht. (2) Standardhandlungsbeschreibungen umfassen oftmals selbst oder implizieren logisch Folgen oder Konsequenzen. Bsp. „Mord“, „Betrug“, „Verrat“. Es wäre aber absurd, würde man nur das als Konsequenzen zählen, was von Standardbeschreibungen einer Handlung nicht umfasst oder logisch impliziert wird. PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus (D) Als letztes möchte ich noch auf einige Unbestimmtheiten und Unklarheiten in Mills Präsentation des utilitaristischen Standards hinweisen, soweit sie nicht mit den beiden Fragen zusammenhängen, die wir im folgenden besprechen werden. (1) Der erste Punkt betrifft die Zuordnung von moralischer Richtigkeit zur Glücksförderung und die Zuordnung von moralischer Falschheit zur Bewirkung des Gegenteils von Glück. Hier liegt eine Unbestimmtheit in Mills Formulierung des utilitaristischen Standards. Mill sagt dort, dass Handlungen insoweit und in dem Maße moralisch richtig sind, als sie die Tendenz haben, Glück zu befördern und insoweit falsch als sie die Tendenz haben das Gegenteil von Glück zu bewirken. Diese Formulierung legt nahe, dass einige Handlungen sowohl richtig als auch falsch sein können, dass nur solche Handlungen richtig sind, die überhaupt keine negativen Konsequenzen haben, und dass nur solche Handlungen falsch sind, die überhaupt keine positiven Konsequenzen haben. Aber diese Sicht würde dem utilitaristischen Grundgedanken gerade widersprechen. Wir haben gesehen, dass es der komparative Wert einer Handlung ist, wodurch ihr moralischer Wert bestimmt wird: Die richtige Handlung kann daher durchaus negative Folgen haben und die falsche durchaus positive. Also kann eine Handlung nicht zum Teil richtig, zum Teil falsch sein, weil sie sowohl positive als auch negative Folgen hat. (2) Ein damit direkt zusammenhängendes Problem ergibt sich aus Mills Behauptung, dass eine Handlung in dem Maße richtig ist, wie sie die Tendenz hat Glück zu befördern. Das Problem liegt darin, dass die Semantik von „richtig“ und „falsch“ im Unterschied zur Semantik von „gut“ einen Komparativ verbietet. Es macht daher keine Sinn von zwei Handlungen zu sagen, dass die eine richtiger sei als die andere. Der geradlinige utilitaristische Gedanken ist der, dass eine Handlung richtig ist, wenn sie das Glück maximiert, und andernfalls falsch. PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus (3) Ein drittes Problem hängt mit Mills Rede von den Tendenzen einer Handlung ab. Eine Möglichkeit ihn zu interpretieren ist diese: Es geht um die Frage, ob die aktualen oder die erwarteten bzw. erwartbaren Konsequenzen den moralischen Wert einer Handlung bestimmen. Ein wichtiger Punkt ist hier, dass Mill wie der Utilitarist im allgemeinen, nur zwischen diesen beiden Optionen entscheiden kann. Der Utilitarist wird beispielsweise nicht berücksichtigen welche unter den aktualen Handlungsfolgen von dem Handelnden intendiert waren. Das folgt meines Erachtens schon daraus, dass für Utilitaristen Tun und Unterlassen in moralischer Hinsicht nicht grundsätzlich verschieden zu beurteilen sind. Wer etwas zu tun unterlässt beabsichtigt typischerweise ja nicht die Folgen seiner Unterlassung. So wäre es natürlich eine phantastische Konstruktion, wollten wir jemandem, der es unterlässt einem Ertrinkenden zur Hilfe zu eilen, nur deshalb, weil er es unterlässt, den Wunsch zuschreiben, dass der Betreffende ertrinkt. Würden wir nun lediglich die vom Akteur gewünschten oder intendierten Konsequenzen berücksichtigen, wären Unterlassungen von Hilfsleistungen typischerweise niemals moralisch falsch. Aber eben das kann der Utilitarist sicherlich nicht zulassen, wenn er daran festhalten will, dass etwas zu tun unterlassen nicht grundsätzlich anders zu bewerten ist als etwas tun. Soweit sich aus Mills Text überhaupt etwas in Bezug auf unsere Frage entnehmen lässt, spricht einiges dafür, dass er die Auffassung favorisiert, dass die Richtigkeit oder Falschheit einer Handlung durch die nach einem objektiven Informations- und Wissensstandard erwartbaren oder voraussehbaren Konsequenzen bestimmt wird. Das scheint mir eben der Punkt seiner Rede von einer Tendenz von Handlungen zu sein. Denn damit scheint er die Auffassung, nach welcher die faktischen Konsequenzen den moralischen Wert einer Handlung bestimmen, ausschließen zu wollen. Mills Rede von der Tendenz einer Handlung PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus weist auf die Regelmäßigkeit unter so etwas wie Normalbedingungen hin, wobei Normalbedingungen jene Bedingungen sind, unter denen sich ein regelmäßiger Zusammenhang zwischen Handlungen eines Typs und Konsequenzen eines Typs im Verlaufe der Geschichte menschlicher Erfahrungen gezeigt hat. Diesen Punkt hat Mill selbst herausgestrichen, wenn er (§ 24, S. 40) darauf hinweist, dass es keine prinzipielles Problem mit der Bestimmung der Auswirkungen von Handlungsweisen auf das allgemeine Glück gebe, da die Erfahrungen, die uns zu einer solchen Bestimmung befähigen, tradiert werden und damit in ein sozial geteiltes Wissen eingehen. (4) Ein letzter Punkt über den Mill uns etwas im Unklaren lässt ist der Begriff einer das Glück befördernden Handlung. Das heißt es ist nicht ganz klar, unter welchen Bedingungen eine Handlung als eine solche zählen kann, durch die Glück befördert wird. Die Unklarheit ergibt sich vor allem aufgrund einer Passage in § 12 (S. 22). Dort sagt Mill, dass „das utilitaristische Prinzip ja nicht nur das Streben nach Glück, sondern auch die Verhinderung und Milderung von Unglück beinhaltet.“ Diese Stelle suggeriert, dass die Verhinderung und Milderung von Unglück etwas anderes ist als die Beförderung von Glück. Wenn wir jedoch den utilitaristischen Standard auf der Basis dieser so interpretierten Textstelle lesen würden, wären wir zu einer Revision gezwungen: Wir müssten dann sagen, dass (nach Mill’scher Auffassung) der utilitaristische Standard von jedem Handelnden verlangt Glück zu befördern oder Leid zu verhindern. Aber diese Lesart lässt sich in Anbetracht des Gesamttextes nicht legitimieren. So bezeichnet er beispielsweise schon im ersten Kapitel die Frage nach dem summum bonum als die Frage nach den Grundlagen der Moral. Der Gedanke ist hier der, dass es ein oberstes Ziel der Moral gibt und dass das moralisch richtige Handeln im Hinblick auf dieses oberste Ziel bestimmt werden muss. Das summum bonum ist für Mill nun aber klarerweise das Glück: „Der Utilitarismus sagt, dass Glück wünschenswert ist, dass es das einzige ist, das als Zweck wünschenswert ist, und dass alles andere nur als Mittel zu diesem Zweck wünschenswert ist.“ PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus (4. Kap. § 2, S. 60). Damit kommen wir zu einer eindeutigen Lesart der Begriff einer das Glück befördernden Handlung. Glück wird durch eine Handlung befördert, wenn es den von der Handlung Betroffenen aufgrund der Handlung besser geht als vorher oder wenn es den von der Handlung Betroffenen schlechter ginge, wäre die Handlung nicht ausgeübt worden. Daher zählt auch jede Handlung, durch die Leiden vermindert wird, und auch jede Handlung, durch die Leiden verhindert wird, als glücksfördernde Handlung. Eine das Glück aller Betroffenen fördernde Handlung ist dann die das Glück aller maximierende Handlung. 3) Die Wertbasis des Mill’schen Utilitarismus Der Utilitarismus ist eine konsequentialistische Ethik. Die moralische Qualität einer Handlung ist abhängig und allein abhängig von ihren Konsequenzen. Genauer gesagt: vom Wert ihrer Konsequenzen. Moralischer Wert wird deshalb kriteriell abhängig von einem oder mehreren außermoralischen Werten. Die außermoralischen Werte oder der außermoralische Wert liefert die Grundlage zur Beurteilung des moralischen Werts. Was wir bisher schon wissen ist, dass es für Mill durchaus verschiedene wünschenswerte Dinge gibt, aber nur eins, was um seiner selbst willen wünschenswert ist und von dem der Wert aller anderen wünschenswerten Dinge wiederum abhängt – nämlich Glück. Ich zitierte noch einmal: „Der Utilitarismus sagt, dass Glück wünschenswert ist, dass es das einzige ist, das als Zweck wünschenswert ist, und dass alles andere nur als Mittel zu diesem Zweck wünschenswert ist.“ (Kap. 4, § 2, S. 60). Glück ist, anders gesagt, das summum bonum, das in utilitaristischer Sicht die Grundlage (nämlich die Wertbasis) der Moral bildet. Weiterhin wissen wir, dass Mill Glück mit Hilfe der Begriffe von pleasure (Lust) und pain (Unlust oder Schmerz) analysiert. Ich zitiere auch hier noch einmal: „Unter Glück ist dabei Lust und das Freisein von Unlust, unter Unglück Unlust und das Fehlen von Lust verstanden.“ (Kap. 2, § 2, S. 13). Diese These lässt sich natürlich als eine PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus hedonistische These bezeichnen. Es handelt sich dabei aber nicht um einen psychologischen Hedonismus, welcher Handlungen aus dem Streben nach Lust erklärt. Dass Glück in den Begriffen von Lust und Unlust/Schmerz zu analysieren ist, sagt ja nichts über die Erklärung menschlichen Handelns. Es handelt sich aber auch nicht um einen ethischen Hedonismus, welcher moralische Richtigkeit und Falschheit kriteriell von deren hedonischen Konsequenzen abhängig macht. Was die These zum Ausdruck bringt ist vielmehr eine Wohlfahrtstheorie: es handelt sich um einen wohlfahrtstheoretischen Hedonismus. Eine Wohlfahrtstheorie ist eine Theorie über das Wesen und die Quellen menschlichen Wohlergehens. Sie untersucht, was es heißt, dass das Leben eines Menschen ein gutes Leben ist, oder was es heißt, dass es einem Menschen wohl ergeht, und untersucht dann auch, was dazu erforderlich ist, dass es einem Menschen wohl ergeht. Mit Hilfe des Begriffs der Wohlfahrt oder des Wohlergehens können wir das Charakteristische von Mills Auffassung zunächst in zwei verschiedene, aber aufeinander aufbauende Thesen zerlegen: (1) Wohlfahrt besteht in oder ist identisch mit Glück, (2) Glück besteht in oder ist identisch mit Lust und dem Freisein von Schmerz. Womit Mill sich in der ersten Hälfte des zweiten Kapitels beschäftigt ist nun etwas, das wir dann in Form einer dritten These formulieren müssten. Er beschäftigt sich mit der Analyse der Begriffe von Lust und Schmerz. Zur Verdeutlichung des utilitaristischen Standards müsse nämlich „insbesondere [etwas] darüber [gesagt werden], was die Begriffe Lust und Unlust einschließen“ (Kap. 2, § 2, S. 13). Wir sollten uns zunächst einmal einen Überblick über Mills Thesen zu diesem Punkt verschaffen. Seine bekannteste These ist die, dass es nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Differenzen zwischen pleasures (Freuden) gibt. Seine zweite These ist die, dass einige Freuden aufgrund ihrer Qualität einen höheren Wert haben als andere Freuden. Seine dritte These ist die, dass die qualitativ höherwertigen Freuden diejenigen sind, die mit den spezifisch menschlichen Fähigkeiten verbunden sind. In Mills eigener Darstellung werden diese drei sachlich zu unterscheidenden Thesen nicht getrennt behandelt. Das liegt nicht PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus zuletzt daran, dass er seine These von den qualitativen Differenzen zwischen Freuden als Antwort auf eine Kritik am Utilitarismus entwickelt – eine Kritik, die in der Polemik gipfelt, der Utilitarismus enthalte eine niedrige Ansicht von den Zielen des Lebens, welche „nur der Schweine würdig [ist]“ (Kap. 2, §3, S. 14). Um seine These von den qualitativen Differenzen richtig zu verstehen, ist zunächst ein negativer Punkt – ein Punkt darüber, wie diese These nicht zu verstehen ist – wichtig. Im § 4 spricht Mill von Quellen der Lust und dann davon, dass „einige Arten der Freude wünschenswerter und wertvoller sind als andere“ (ebd.). Mit dem Ausdruck „Arten von Freuden“ umschreibt Mill natürlich seinen Begriff qualitativ verschiedener Freuden. Dass es bei Freuden eine qualitative Differenz gibt – und das ist der hier wichtige negative Punkt – lässt sich aber nicht hinreichend durch den Verweis auf eine Unterschiedlichkeit der Lustquellen begründen. Denn die Quellen der Lust können unterschiedlicher Natur sein, ohne dass die durch sie hervorgerufenen Freuden in qualitativer Hinsicht verschieden wären. So hatte auch Bentham, für den pleasures und pains lediglich quantitativ – im Hinblick auf ihre Intensität und im Hinblick auf ihre Dauer – unterschieden waren, ohne sich dabei eines Widerspruchs schuldig zu machen durchaus von Sorten und Arten von Freuden und Leiden gesprochen. (Vgl. Bentham, An Introduction, Kap. 4, S. 38 ff.). In seiner Auflistung finden sich etwa: Pleasures of sense, Pleasures of wealth, Pleasures of skill, Pleasures of amity, Pleasures of a good name usw. Diese Auflistung unterscheidet aber nicht zwischen Freuden für sich betrachtet, sondern zwischen Freuden im Hinblick auf ihre Quellen oder Ursprünge. Für sich selbst – in Absehung von ihren Ursprüngen betrachtet – gibt es in Bentham’scher Sicht aber keine Unterschiede zwischen Freuden außer den quantitativen der Intensität und der Dauer. Wenn daher Mill von Arten der Freude im Sinne qualitativ unterschiedener Freuden redet, dann meint er damit nicht, dass die Empfindung der Freude unterschiedliche Quellen haben kann, sondern dass Freuden als solche betrachtet qualitativ voneinander verschieden sind. Dem steht nicht im Wege, dass die qualitativen Verschiedenheiten der Freuden für Mill offenbar mit den qualitativen Verschiedenheiten der Quellen PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus der Freude positiv korreliert ist. Welche Basis hat Mill für seine Behauptung der qualitativen Verschiedenheit? Die Basis ist einfach introspektive Psychologie: Ob es qualitative Unterschiede zwischen Freuden gibt, lässt sich durch Introspektion und nur durch Introspektion – durch eine aufmerksame Betrachtung der eigenen Erlebnisse – belegen. So betont Mill, wenn es um die Bewertung von verschiedenen Freuden geht, dass nur derjenige eine Urteilskompetenz hat, welcher die in Frage stehenden Freuden erfahren hat. (Kap. 2, § 5, S. 15) Er muss sie, mit anderen Worten, selbst erlebt haben und in diesem Sinne eine unmittelbare Bekanntschaft mit ihnen haben, um urteilen zu können, welche vorziehenswert ist. Mills These von der qualitativen Verschiedenheit von Freuden lässt sich durch eine aufmerksam phänomenologische Betrachtung von Erlebnissen sicherlich belegen. Die Freude oder Lust, die man bei einem kühlen Glas Bier empfindet, ist sicherlich nicht nur quantitativ von der Freude verschieden, die man empfindet, wenn man ein Examen bestanden hat, und entsprechend sind etwa auch der Schmerz einer Niederlage und der Schmerz einer Sehnenscheidenentzündung nicht nur quantitativ – was ihre Intensität und Dauer betrifft – verschieden. Dass es qualitative Unterschiede zwischen Freuden gibt, sagt uns aber noch nichts über die Natur dieser Erlebnisse. Zwei Modelle oder Auffassungen können hier miteinander kontrastiert werden. Der einen Auffassung nach sind Freuden Empfindungen, die sich von anderen Erlebnissen durch die Art wie sie sich anfühlen unterschieden sind. Kombinieren wir diese Auffassung mit der Mill’schen These von der qualitativen Verschiedenheit, so besteht die qualitative Verschiedenheit von zwei Freuden darin, dass sie sich anders anfühlen auch wenn sie in quantitativer Hinsicht gleichartig sind. Die andere Auffassung konstruiert Freude nicht als eine distinkte Art von Empfindung, sondern als eine Einstellung zu den Empfindungsaspekten von Erfahrungen. Die Freude an einem kühlen Glas Bier besteht dann nicht in einer beim Trinken erlebten Empfindung, sondern darin, dass man die beim Trinken erlebten Empfindungen mag. Diese zweite Auffassung ist schwer mit der Mill’schen These von der qualitativen Verschiedenheit von Freuden zu kombinieren. Lesen wir das Einstellungsmodell in PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus Mill hinein, dann müsste seine Auffassung etwa die sein, dass zwei Freuden qualitativ verschieden sind, wenn wir einer Sache, die wir mögen, einer anderen Sache, die wir mögen, den Vorzug geben unabhängig von der quantitativen Differenz der jeweils beteiligten Empfindungen. Diese zweite Auffassung ist aber sicherlich nicht Mills Auffassung über die Natur von pleasure und pain. Denn er unterscheidet deutlich zwischen der qualitativen Differenz von Freuden und der Bewertung, der Wertschätzung oder dem Wert von Freuden. Er ist also nicht bereit, Freuden mit Bewertungen oder wertenden Haltungen zu identifizieren, noch durch Bewertungen zu erklären. Das geht aus der folgenden Textstelle hervor: Fragt man mich nun, was ich meine, wenn ich von der unterschiedlichen Qualität von Freuden spreche, und was eine Freude – bloß als Freude, unabhängig von ihrem größeren Betrag – wertvoller als eine andere macht, so gibt es nur eine mögliche Antwort: von zwei Freuden ist diejenige wünschenswerter, die von allen oder nahezu allen, die beide erfahren haben [...] entschieden bevorzugt wird. (Kap. 2, § 5, S. 15 f.) Hier ist deutlich, dass nach Mill’scher Auffassung Freuden Gegenstände der Bewertung sind, die unabhängig von wertenden Einstellungen erlebt werden, so dass sich dann erst die Frage stellt, welche von zwei qualitativ verschiedenen Freuden zu bevorzugen ist. Pleasure und pain können wir daher sagen, sind für Mill Empfindungen, die durch ihre jeweilige phänomenale Gefühlsqualitäten unterschieden sind. Pleasures selbst wiederum sind dann ebenfalls qualitativ verschieden aufgrund der Art wie sie sich anfühlen. Es ist nicht so, dass eine Empfindung als Freude oder Lust beschrieben werden kann, weil wir sie mögen, sondern umgekehrt so, dass wir eine Empfindung mögen, weil sie eine Freude oder Lust ist. Dass pleasure und pain für Mill Empfindungen und nicht Einstellungen lässt sich direkt durch den Text unterstützen. In § 8 (S. 20) spricht er ausdrücklich von Schmerz- und von lustvollen Empfindungen, und dann auch davon dass angenehme und unangenehme Empfindungen untereinander sehr ungleichartig sind. Wenn diese Rekonstruktion richtig ist, dann haben wir PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus mit der Bestimmung von pleasure und pain als Empfindungen, die aufgrund ihrer phänomenalen Gefühlsqualitäten verschieden sind, den grundlegenden Aspekt der dritten Komponente der Mill’schen Wohlfahrtstheorie festgestellt. Die beiden weiteren Aspekte betreffen den Wert oder die Bewertung der hedonisch unterschiedlichen Freuden. Erinnern wir uns, dass die beiden Mills hier lauten, dass einige Freuden aufgrund ihrer Qualität einen höheren Wert haben als andere Freuden, und dass die qualitativ höherwertigen Freuden diejenigen sind, die mit den spezifisch menschlichen Fähigkeiten verbunden sind. Beide Thesen werden von Mill zusammen behandelt, da der Test, den er vorschlägt, um die eine These zu untermauern zugleich auch der Test ist, der nach seiner Auffassung die andere These untermauert. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, sind noch einige Vorbemerkungen angebracht. (1) Wenn Freuden qualitativ verschieden sind, dann ist damit zumindest die Möglichkeit eröffnet, dass eine Freude wünschenswerter ist als eine andere aufgrund ihrer qualitativen Verschiedenheit. Dass Freuden qualitativ verschieden sind, impliziert für sich genommen jedoch weder, dass die Qualität einer Freude das einzige, noch dass es immer das vorrangige Bewertungskriterium sein muss. Dass einige Freuden aufgrund ihrer Qualität anderen vorgezogen werden können, ist jedoch keine Überraschung. Denn wenn es sich um Erlebnisse mit qualitativ verschiedenen Gefühlstönungen handelt, dann wäre es sehr seltsam, wenn diese Unterschiede keine Rolle für ihre komparative Bewertung spielen würden. (2) Dass Freuden qualitativ verschieden sind, impliziert nicht, dass sie im Hinblick auf ihre Rolle für das Wohlergehen eines Wohlfahrtssubjekts unvergleichbar sind. Unvergleichbarkeit würde besagen, dass komparative Urteile der Form „A ist besser als B“ in Bezug auf Freuden unmöglich sind. Qualitative Verschiedenheit schließt lediglich aus, dass komparative Urteile in quantitativen Termen ausgedrückt werden können: Wir können zwar sagen, dass A besser als B ist, nicht aber um wieviel A besser als B ist. Letzteres wäre nur möglich, wenn Freuden PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus wie bei Bentham lediglich quantitativ verschieden sind. Für Mill selbst ist dabei nicht nur die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Freuden unter dem Aspekt ihrer Qualität, sondern auch die Vergleichbarkeit zwischen Qualität und Quantität unproblematisch. So spricht er (Kap. 2, § 10, S. 21) von einem „Maßstab, an dem Qualität gemessen und mit der Quantität verglichen wird.“ (3) Angesichts von Mills These über den höheren Wert bestimmter Arten von Freuden darf man nicht vergessen, dass aus seiner Sicht jede Freude intrinsisch wertvoll ist oder um ihrer selbst willen erstrebenswert ist. Dass eine Freude A einer anderen Freude B vorzuziehen ist, impliziert daher nicht, dass B nicht der Kategorie des intrinsisch Wertvollen angehört. Es impliziert aber auch nicht, dass B eine Art von Erlebnis ist, das zu haben oder nicht zu haben gleichgültig wäre. Betrachten wir nach diesen Vorbemerkungen nun den von Mill vorgesehenen Test. Sowohl dass einigen Freuden aufgrund ihrer Qualität und ungeachtet quantitativer Differenzen anderen vorzuziehen sind, als auch welche Freuden diese Superiorität genießen ist für Mill aufgrund des Urteils kompetenter Urteilender zu entscheiden: „Gegen das Urteil der einzig zuständigen Richter kann es, so meine ich, keine Berufung geben.“ (§ 8, S. 19). Hier ist natürlich zu fragen, was dazu erforderlich ist, damit ein Richter über den Wert von Freuden ein kompetenter Richter ist. Das hauptsächliche Erfordernis für Mill ist, dass der Richter die zu beurteilenden Freuden erfahren hat: „Darüber, welche von zwei Befriedigungen es sich zu verschaffen am meisten lohnt [...] kann nur das Urteil derer, die beide erfahren haben [...] als endgültig gelten.“ (ebd.) Ein weiteres Erfordernis scheint für Mill darin zu liegen, dass die Richter in ihrem Urteil in dem Sinne unvoreingenommen sind, dass sie sich nicht durch Erwägungen über externe Faktoren beeinflussen lassen: „Aus Charakterschwäche“, schreibt Mill, „entscheiden sich die Menschen sowohl bei der Wahl zwischen zwei sinnlichen wie auch bei der Wahl zwischen sinnlichen und geistigen Freuden oft für das nähere Gut, obgleich PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus sie wissen, dass es einen geringeren Wert hat.“ (§ 7, S. 18). Zeitliche Nähe oder Ferne, Aufwendigkeit oder Unaufwendigkeit, sowie auch die Wahrscheinlichkeit des Eintretens, sind alles externe Faktoren, welche die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit der Realisierung eines Zustands betreffen, gehören aber nicht zur Frage nach dem Wert des Zustands. Daher sollte das Urteil über der Wert einer Freude nicht von diesen Faktoren abhängig gemacht werden. Hochhängende Trauben zum Beispiel sind nicht deshalb, weil sie schwer zu bekommen sind, auch sauer. Und ein zeitlich näherliegendes Gut ist nicht allein darum besser als ein anderes nur deshalb weil es zeitlich näher liegt. Die nächste Frage wäre, wie ein kompetenter Richter zu urteilen hat, wenn er über den in ihrer Qualität begründeten Wert von Freuden beurteilt. Hier fordert Mills Test negativ, dass die zu beurteilenden Freuden (a) als solche „unabhängig von ihrem größeren Betrag“ (§ 5, S. 15) oder „ungeachtet ihrer Intensität“ (§ 8, S. 20) betrachtet werden müssen, und dass sie (b) „ungeachtet des Gefühls, eine von beiden aus moralischen Gründen vorziehen zu müssen“ (§ 5, S. 15 f.) bzw. „ungeachtet ihrer moralischen Eigenschaften und ihrer Folgen“ betrachtet werden müssen (§8, S. 19). Das erste Erfordernis der Vernachlässigung quantitativer Aspekte ergibt sich trivialer Weise daraus, dass eben in Frage steht, ob und wenn ja welche Freuden allein aufgrund ihrer qualitativen Beschaffenheit vorziehenswert sind. Das zweite Erfordernis ergibt sich daraus, dass eine Beurteilung glückskonstituierender Erlebnisse nach moralischen Maßstäben erstens in eine Zirkularität führen würde (wir können, was für Glück relevant ist, nicht auf der Basis moralischer Erwägungen bestimmen, wenn Glück die Basis der Moral sein soll), und weil das zweitens auch sachlich falsch wäre, da eine nach moralischen Maßstäben gute Lebensführung nicht auch eo ipso ein nach dem Maßstab des Wohlergehens gutes Leben ist. [Was allerdings nicht einschließt, dass Glück und Tugendhaftigkeit einander ausschließen würden!] PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus Außer diesen negativen Erfordernissen finden wir bei Mill aber auch eine positive Charakterisierung der Art der Beurteilung. Um ein angemessenes Urteil über den Wert qualitativ unterschiedlicher Freuden zu gewinnen, fordert uns Mill implizite auf, nicht besondere Realisierungen hedonischer Zustände zu betrachten, sondern ganze Lebensweisen. (Vgl. § 6 und § 8) Eine Lebensweise ist dabei durch eine charakteristische Orientierung an bestimmten Arten von Freuden bestimmt und von anderen unterschieden. Der Test, ob eine Freude der Art A einer Freude der Art B vorzuziehen ist, besteht für Mill daher letztlich darin, ob ein kompetenter Richter eine an A orientierte Lebensweise einer an B orientierten Lebensweise vorziehen würde. Und auf der Basis dieses Test ergibt sich nun für Mill, dass einige Freuden aufgrund ihrer Qualität anderen vorzuziehen sind, und dass es die geistigen oder intellektuellen Freuden sind, die den sinnlichen vorzuziehen sind. Das erste Ergebnis ergibt sich aus einem recht einfachen Grund – der in der Tat so einfach ist, dass Mill sich darüber nicht äußert. Der Grund ist der, dass auch kompetente Richter Präferenzen haben, so dass es ihnen wie auch jedem nicht kompetenten Richter nicht gleichgültig sein kann, in welcher Weise er sein Leben lebt. Das zweite Ergebnis ergibt sich aus einem fast ebenso einfachen Grund. Ob geistige Freuden sinnlichen vorzuziehen sind, soll der kompetente Richter anhand der Frage entscheiden, ob er bereit wäre, eine an geistigen Freuden orientierte Lebensweise gegen eine ausschließlich an sinnlichen Freuden orientierte einzutauschen. Bedenken wir nun, dass von einem kompetenten Richter verlangt ist, dass er beide Arten von Freuden kennt und erlebt hat. Geistige Freuden sind nun solche, die aufs engste mit der Entwicklung und der Ausübung intellektueller Fähigkeiten verbunden sind. Eine ernsthafte Bereitschaft zu haben, eine ausschließlich an sinnlichen Freuden orientierte Lebensweise zu wählen, hieße nun aber nichts anderes als auf die Entwicklung und Ausübung geistiger Fähigkeiten zu verzichten. Und das hieße, dass der kompetente Richter auf etwas verzichten PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus müsste, was seine eigene Identität ausmacht – er müsste darauf verzichten, der zu sein, der er ist. Ich zitiere Mill: Nur wenige Menschen würden darein einwilligen, sich in eines der niederen Tiere verwandeln zu lassen, wenn man ihnen verspräche, dass sie die Befriedigungen des Tiers im vollen Umfange auskosten dürften. Kein intelligenter Mensch möchte ein Narr, kein gebildeter Mensch ein Dummkopf, keiner, der feinfühlig und gewissenhaft ist, selbstsüchtig und niederträchtig sein – auch wenn sie überzeugt wären, dass der Narr, der Dummkopf oder der Schurke mit seinem Schicksal zufriedener ist als sie mit dem ihren. (§ 6, S. 16) Wie sind Mills Thesen zu bewerten? Um das zu entscheiden, müssen wir uns anschauen, welche Implikationen sie haben. Diese sind, wie wir gleich sehen werden, durchaus nicht eindeutig. Zunächst müssen wir uns daran erinnern, dass Mill eine Wohlfahrtstheorie entwirft – eine Theorie, die uns sagen soll, worin das Wohlergehen eines Wohlfahrtssubjekts besteht; und diese Theorie sollte uns eine Antwort darauf geben, was ein Leben besser und was ein Leben schlechter macht. Die Frage ist nun, ob Mill uns mit seinen Thesen darüber schon hinreichend Auskunft gibt: Ist eine Reflexion über den Wert unterschiedlicher Lebensweisen überhaupt geeignet, um darüber urteilen zu können, ob es einer Person gut oder schlecht geht? Kann eine Reflexion über Lebensweisen eine hinreichende Basis für interpersonelle Vergleiche sein, bei denen es darum geht, ob es einer Person besser oder schlechter geht als einer anderen? Kann schließlich eine Reflexion über Lebensweisen eine hinreichende Basis für intrapersonelle Vergleiche sein, bei denen es darum geht, ob der Verlauf des Lebens einer Person eine Verbesserung oder Verschlechterung darstellt? Hilft uns, allgemein gesagt, die kontrastive Bewertung von Lebensweisen bei einer Bewertung von Leben? PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus Das wäre der Fall, wenn die These von der Superiorität geistiger Freuden eine These darüber wäre, wie wir unser Leben gestalten müssen, damit wir glücklich sind. Aber diese Lesart von Mills Superioritätsthese würde zu einer vollkommen unplausiblen Auffassung führen. Wir müssten dann nämlich sagen, dass ein kompetent Urteilender bei jeder Gelegenheit, bei der er vor der Wahl zwischen einer qualitativ höheren und einer qualitativ niedrigeren Freude steht, die höhere vorzieht. Diese Auffassung würde besagen, dass geistigen Freuden eine absolute Priorität gegenüber anderen Freuden haben. Aber das ist klarerweise absurd. Hätten geistige Freuden eine absolute Priorität, dann müssten wir sagen, dass eine geistige Freude, und sei sie noch so geringen Ausmaßes, allein aufgrund ihrer Qualität jeder anderen Freude, und hätte sie ein noch so großes Ausmaß, vorzuziehen ist. Und entsprechend müsste dann auch gelten, dass eine sinnliche Unlust jeder geistigen Unlust vorzuziehen ist selbst wenn die geistige Unlust von sehr geringem, die sinnliche Unlust aber von erheblichem Ausmaß ist. Diese Auffassungen scheint aber auch Mill selbst nicht unterstützen zu wollen. In § 10 (S. 21) schreibt er: „Nach dem Prinzip des größten Glücks ist [...] der letzte Zweck, bezüglich dessen und um dessentwillen alles andere wünschenswert ist [...] ein Leben, das so weit wie möglich frei von Unlust und in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht so reich wie möglich an Lust ist.“ Diese Beschreibung impliziert offenbar, dass qualitative Differenzen keine absolute Priorität bei der Wahl eines Lebens genießen können. So fährt Mill an der besagten Stelle auch fort, indem er von einem Maßstab spricht, „an dem Qualität gemessen und mit der Quantität verglichen wird“ – was offenbar impliziert, dass das größere Ausmaß einer Freude ein guter Grund sein kann, sie einer anderen vorzuziehen, die von höherer Qualität ist. Der sachlich wichtige Punkt ist hier der folgende. Wir müssen unterscheiden zwischen der Superioritätsthese und einer Prioritätsthese. Die Superioritätsthese besagt: Der qualitative Unterschied zwischen zwei Freuden A und B kann ein Grund sein die eine der anderen vorzuziehen, so dass A höherwertig ist als B, wenn der qualitative Unterschied zwischen beiden dafür spricht A zu wählen. PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus Die Prioritätsthese würde etwas sehr viel stärkeres besagen: Wenn A (qualitativ) höherwertig ist als B, dann ist A gegenüber B zu präferieren, egal was sonst noch der Fall ist. Es ist klar, dass die Superioritätsthese die Prioritätsthese nicht impliziert. Das sieht man bereits daran, dass diese Prioritätsthese nur aufgrund einer Zusatzannahme etabliert werden kann. Die Zusatzannahme besagt, dass bei einer Entscheidung darüber, welche von zwei Freuden vorzuziehen ist, zunächst einmal nur die qualitativen Differenzen beachtet werden müssen. Das heißt: Quantitative Differenzen können erst ins Spiel gebracht werden, wenn auf der Ebene der Qualität kein Unterschied besteht. Kurz, die Zusatzannahme, die zur Etablierung der Prioritätsthese vonnöten ist, ist die, dass Qualität immer vor Quantität geht. Gerade diese Zusatzannahme wird von Mill aber nicht unterstützt. Im Gegenteil. Implizite lehnt er eine solche Sichtweise ab, wie wir gerade gesehen haben, denn für ihn kann ein größeres Ausmaß an Freude ihre qualitative Unterlegenheit aufwiegen. Wir sollten ihm die Prioritätsthese also nicht zuschreiben. Das ist ein erster Hinweis darauf, dass die Reflexion über Lebensweisen uns zwar Auskunft über die Bedeutsamkeit qualitativ unterschiedlicher Freuden gibt, damit aber durchaus keine Auskunft über die Art geben kann, wie eine rationale Person ihr eigenes Leben gestalten muss, damit es ihr gut geht. Das Problem, das hier im Hintergrund steht, ist, dass der bei der Reflexion über Lebensweisen in Anschlag gebrachte Test – wärest Du bereit diese Art von Freuden für jene Art aufzugeben – nichts darüber impliziert, was man bei einer bestimmten Gelegenheit wählen würde. Gefragt, ob ich bereit wäre, die Philosophie zugunsten einer anderen Aktivität wie etwa Radfahren aufzugeben, würde ich sagen: Nein. Aber das impliziert nicht, dass ich bei jeder Gelegenheit mich lieber mit Philosophie beschäftige als Rad zu fahren. Es gibt vieles, was ich für die Möglichkeit mich mit Philosophie zu beschäftigen aufgeben würde, aber dennoch gibt es viele Situationen, in denen ich andere Dinge einer philosophischen Beschäftigung klarerweise vorziehe. Was ich bereit wäre aufzugeben, ist also PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus kein Test, durch den entschieden werden könnte, wie ich mein Leben gestalten muss, damit es mir gut geht. Ein weiteres Problem, an dem sich der begrenzte Wert von Mills Tests zeigt, besteht darin, dass sehr viel von dem Umfang der Frage, was man bereit ist für was aufzugeben, abhängt. Die Frage, ob man bereit wäre, die geistige Freude der Lektüre eines (guten) philosophischen Buchs zugunsten der sinnlichen Freude des Schwimmens aufzugeben, führt sicherlich zu einem ganz anderen Ergebnis als die Frage, ob man bereit ist, jene geistige Freude zugunsten aller sinnlichen Freuden aufzugeben. Ein kompetenter Richter könnte, wenn ihm die letztere Frage gestellt wird, durchaus eine negative Antwort geben. Das allerdings würde uns dann nicht zeigen, dass eine ausschließlich an sinnlichen Freuden orientierte Lebensweise einer an geistigen orientierten vorzuziehen ist. Es würde uns zeigen, dass ein Leben ohne jede sinnliche Freude ein depraviertes Leben ist. Mills Test mag uns also zwar zeigen, dass Utilitarismus keineswegs eine Lehre ist, die nur der Schweine würdig ist. Was er nicht zeigt ist jedoch, dass geistige Freuden in dem Sinne höher sind, dass das Glück allein von dem Ausmaß der Realisierung geistiger Freuden abhängt. Eine geistige Freude kann aus Gründen ihrer Qualität vor anderen Freuden bevorzugt werden, sie muss es aber nicht. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass Mill durchaus nicht die Auffassung vertritt, dass ein Mangel an geistigen Freuden die Quelle allen Unglücks ist. Denn in § 14 finden wir eine Auflistung der größten Übel des Lebens und diese sind: körperliches und seelisches Leid, Not, Krankheit, Herzlosigkeit, Unwürdigkeit und der vorzeitige Verlust derer, die wir lieben. Damit müssen wir noch auf die These zu sprechen kommen, ob sich der Unterschied zwischen geistigen und sinnlichen Freuden mit dem von höherstufigen und niederstufigen deckt. Hat Mill also Recht, dass die mit den spezifisch menschlichen Fähigkeiten verbundenen Freuden die höheren sind? Der Test: Was ich bereit wäre aufzugeben, etabliert PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus diese These nicht. Denn ein Leben ohne sinnliche Freuden ist klarerweise ein depraviertes Leben. Der Punkt ist hier der, dass geistige Freuden, einen Mangel an sinnlichen nicht kompensieren können. Wer zum Beispiel keine Geschmacksempfindung hat, ist schlecht dran, auch wenn er oder sie sich am Lesen von Büchern erfreut. Wenn aber keine Kompensation stattfindet, kann man dann sagen, dass geistige Freuden zu haben ipso facto mehr zählt als sinnliche Freuden zu haben? Das zieht Mills These zumindest in Zweifel. Eine bessere Strategie ist aber die Suche nach Gegenbeispielen. Denken wir an die Aktivität des Spielens – sagen wir das Spielen von Kindern oder das Spielen von Erwachsenen mit Kindern. Das ist zweifellos keine spezifisch menschliche Aktivität; und es bedarf auch keine spezifisch menschlichen Fertigkeiten, keiner höheren intellektuellen Fähigkeiten, um zu Spielen. Trotzdem scheint es klar zu sein, dass die Freude am Spielen eine Qualität besitzt, aufgrund derer sie vorziehenswert ist. Wenn das richtig ist, dann lässt sich nicht sagen, dass die höherwertigen Freuden mit den geistigen Freuden zusammenfallen. Fassen wir das bisherige zusammen, so ergibt sich das folgende Bild: Mill weist uns, wie ich meine, zurecht darauf hin, dass Freuden nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ verschieden sind. Damit ist die Möglichkeit eröffnet, dass eine rationale, um ihr eigenes Wohlergehen besorgte Person, sich aus Gründen der qualitativen Beschaffenheit für eine Freude entscheidet. Wird eine Freude aufgrund ihrer qualitativen Beschaffenheit einer anderen vorgezogen (oder ist ihre qualitative Beschaffenheit ein Grund, sie vorzuziehen), dann ist diese Freude höherwertig als eine andere. Auch das scheint mir plausibel und unproblematisch zu sein: Mills zweite These kann man also unterstützen. Diese These impliziert jedoch nicht, dass eine höherwertige Freude immer vorziehenswert ist oder dass eine Freude die einen höheren Wert hat als eine andere dieser gegenüber Priorität genießt. Diese Behauptung wird von einigen Überlegungen Mills zwar nahegelegt, passt aber mit PD Dr. A. Lohmar, VL SS 06, Utilitarismus anderen zentralen Thesen nicht zusammen. Dazu gehört Mills Auffassung, dass die Quantität von Freuden keine untergeordnete Rolle spielt. Da die Prioritätsthese auch sachlich nicht haltbar ist, sollte man sie Mill nicht zuschreiben. Außerdem gilt, dass auch ein kompetenter Richter nicht bei jeder Gelegenheit eine höherwertige Freude einer anderen vorziehen wird. Auch ein kompetenter Richter wird urteilen, dass ein Leben ohne sinnliche Freuden ein depraviertes Leben ist – selbst wenn diese nicht so wertvoll sein sollten wie geistige Freuden. Schließlich haben wir gesehen, dass Mills Identifikation von höherstufigen mit geistigen Freuden zumindest extrem zweifelhaft ist. Das besagt nicht, dass geistige Freuden nicht zu den höherwertigen gehören. Was mir unplausibel erscheint ist lediglich die These, dass die Klasse der höherwertigen mit der Klasse der geistigen Freuden zusammenfällt. Diese überaus anspruchsvolle These von Mill ist sicherlich seinem Bemühen geschuldet, den Kritikern des Utilitarismus zu verdeutlichen, dass der Utilitarismus keineswegs eine nur der Schweine würdige Theorie ist. Um das zu zeigen genügt es aber schon auf die Tatsache hinzuweisen, dass auch geistige Freuden aufgrund ihrer besonderen Qualität zählen. Festzuhalten bleibt aber, dass Mills fundamentale These die des Hedonismus ist.