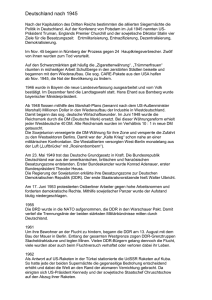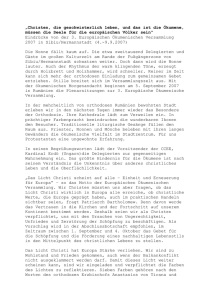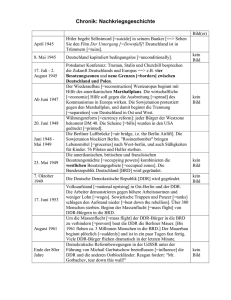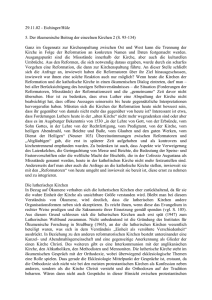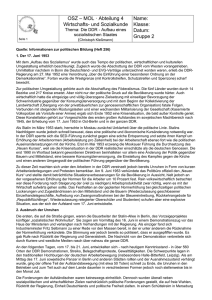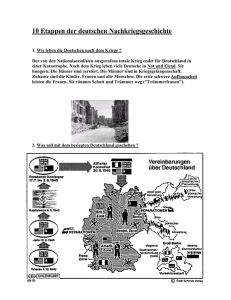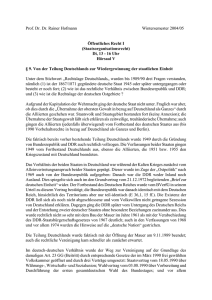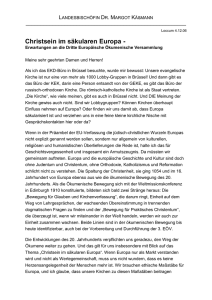Utrecht am 2. Oktober 2009 Heino Falcke I. Dankesworte Sehr
Werbung
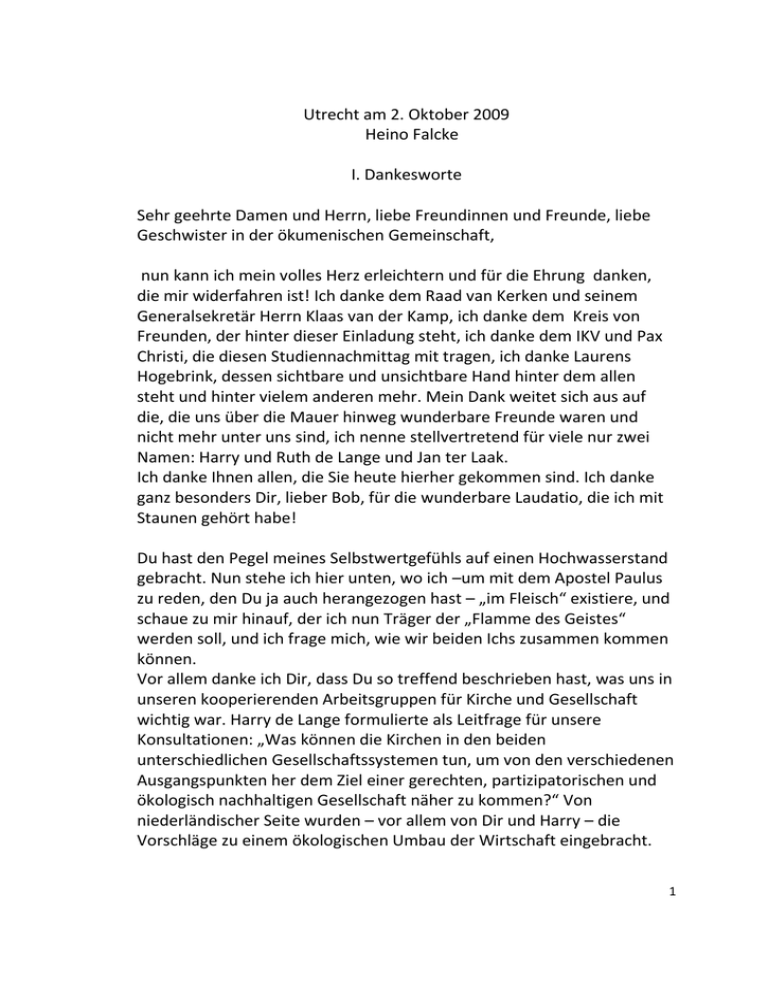
Utrecht am 2. Oktober 2009 Heino Falcke I. Dankesworte Sehr geehrte Damen und Herrn, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Geschwister in der ökumenischen Gemeinschaft, nun kann ich mein volles Herz erleichtern und für die Ehrung danken, die mir widerfahren ist! Ich danke dem Raad van Kerken und seinem Generalsekretär Herrn Klaas van der Kamp, ich danke dem Kreis von Freunden, der hinter dieser Einladung steht, ich danke dem IKV und Pax Christi, die diesen Studiennachmittag mit tragen, ich danke Laurens Hogebrink, dessen sichtbare und unsichtbare Hand hinter dem allen steht und hinter vielem anderen mehr. Mein Dank weitet sich aus auf die, die uns über die Mauer hinweg wunderbare Freunde waren und nicht mehr unter uns sind, ich nenne stellvertretend für viele nur zwei Namen: Harry und Ruth de Lange und Jan ter Laak. Ich danke Ihnen allen, die Sie heute hierher gekommen sind. Ich danke ganz besonders Dir, lieber Bob, für die wunderbare Laudatio, die ich mit Staunen gehört habe! Du hast den Pegel meines Selbstwertgefühls auf einen Hochwasserstand gebracht. Nun stehe ich hier unten, wo ich –um mit dem Apostel Paulus zu reden, den Du ja auch herangezogen hast – „im Fleisch“ existiere, und schaue zu mir hinauf, der ich nun Träger der „Flamme des Geistes“ werden soll, und ich frage mich, wie wir beiden Ichs zusammen kommen können. Vor allem danke ich Dir, dass Du so treffend beschrieben hast, was uns in unseren kooperierenden Arbeitsgruppen für Kirche und Gesellschaft wichtig war. Harry de Lange formulierte als Leitfrage für unsere Konsultationen: „Was können die Kirchen in den beiden unterschiedlichen Gesellschaftssystemen tun, um von den verschiedenen Ausgangspunkten her dem Ziel einer gerechten, partizipatorischen und ökologisch nachhaltigen Gesellschaft näher zu kommen?“ Von niederländischer Seite wurden – vor allem von Dir und Harry – die Vorschläge zu einem ökologischen Umbau der Wirtschaft eingebracht. 1 Ende der achtziger Jahre fasstet Ihr das in dem Buch zusammen, dessen deutscher Titel heißt: Weder Armut noch Überfluss, Plädoyer für eine neue Ökonomie. Ich denke, hierin lag inhaltlich das Wichtigste für uns DDR-Leute: eine nichtkommunistische kapitalismuskritische und kulturkritische Analyse und Vision kennen zu lernen, die West und Ost über den status quo des Systemgegensatzes hinaus einen Weg in die Zukunft eröffnet. Als ich es vor einigen Tagen wieder las, erschien es mir in manchen Partien, als wäre es für die heutigen Krisen geschrieben. Der Gedanke einer Selbstbegrenzung des Menschen aus Freiheit ist heute vielleicht die zentrale und die tiefste Herausforderung, an der die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft hängt. Gesetze können diese Selbstbegrenzung wohl teilweise erzwingen, aber nicht als eine neue Kultur der Gesellschaft herbeiführen. Solch eine Kultur der Selbstbegrenzung lebt aus tieferen Quellen, von denen die Religionen die vielleicht wichtigsten sind. Ich sage bewusst „Religionen“, nicht „Kirchen“, denn die drei monotheistischen Religionen, die unsere Kultur prägen, enthalten alle den Gedanken der Geschöpflichkeit und Geschöpflichkeit heißt Begrenztheit, eine Begrenztheit, die als Wohltat dankbar bejaht werden kann, weil sie von dem kommt, dem wir unser Leben verdanken. – So fordert unsere frühere gemeinsame Arbeit zum weiterdenken heraus. Ich danke Dir, lieber Bob. Aber ich muss noch etwas zu dieser Preisverleihung sagen. Ich kann sie eigentlich nur stellvertretend entgegennehmen, stellvertretend für alle diejenigen, die in der DDR bis 1989 die Partnerschaften und vielfältigen Beziehungen zu den niederländischen Christen, Gemeinden, Kirchen und Initiativen getragen und gestaltet haben. Ich selbst war nur an einem schmalen Sektor dieses ökumenischen Beziehungsgeflechtes beteiligt. Es ist gut, dass wir jetzt in Beatrice de Graafs Buch „Über die Mauer hinweg“ eine kenntnisreiche und ebenso umfassende wie detaillierte Darstellung dieses Stücks lebendiger und intensiver Ökumene haben. Und weiter: Es fiele mir sehr viel leichter, diesen Preis entgegen zu nehmen, wenn es etwas Vergleichbares gäbe, das die Kirchen in der DDR den niederländischen Kirchen als Dank für die über viele Jahre gewährte ökumenische Gemeinschaft überreicht hätten. Es beschämt mich, dass dies meines Wissens nicht geschehen ist. Es mag eine Folge dessen sein, 2 dass sich der Kirchenbund im deutschen Vereinigungsprozess viel zu schnell als eigenständig handelndes Subjekt aufgegeben hat und in der EKD aufgegangen ist. Aber diese Erklärung mindert nicht die Dankesschuld unserer Kirchen in der DDR. Ich möchte diese Gelegenheit ganz bewusst nutzen, um diesen überfälligen Dank auszusprechen. Er ist umso begründeter, als die Initiative für diese ökumenische Gemeinschaft weit überwiegend von den Niederländern ausging. In diesem merkwürdigen Gedenkjahr 2009 jährt sich auch das Jahr 1939 und erinnert uns daran, dass nach den deutschen Verbrechen in den Niederlanden unsere ökumenische Gemeinschaft nur durch die Vergebungs- und Versöhnungsbereitschaft der Niederländer möglich wurde. Nach dem Mauerbau waren es dann die niederländischen Christen, die sich auf die Reise in die DDR machten. In den sechziger Jahren konnten wir uns auf die Atomwaffendenkschrift der Hervormde Kerk beziehen, als wir in der Handreichung zur Seelsorge an Wehrpflichtigen die Präferenz für die Wehrdienstverweigerung erklärten, und in den achtziger Jahren gingen uns die Niederländer mit ihrer Entscheidung für eine einseitige Denuklearisierung der Niederlande voraus. Für die Friedensarbeit der Kirchen in der DDR war es ja nicht nur eine schöne Arabeske, dass wir auf die niederländischen Kirchen verweisen konnten, es war wesentlich für die Glaubwürdigkeit des christlichen Friedenszeugnisses. Nur so war deutlich zumachen, dass wir auf beiden Seiten des kalten Krieges gegen die eigentliche Gefährdung des Friedens, das Abschreckungssystem selbst, kämpften und nicht die Partei der jeweiligen Gegenseite nahmen. Weil die EKD in der Bundesrepublik unsere Position nur gebrochen teilte, waren die niederländischen Kirchen so wichtig für uns. 1989/90 kam wieder von den Niederlanden die Initiative, die Vergangenheit der Kirchen in Europa, vor allem in Osteuropa und die Rolle der ökumenischen Bewegung im kalten Krieg gemeinsam kritisch zu sichten. Daraus erwuchsen Konsultationen, Berichtsbände von Laurens Hogebrink und Ludwig Mehlhorn herausgegeben und die Schrift „Verlorene Jahre?“ mit einem offenen Fragezeichen. Wir hätten also zuerst zu danken gehabt. Immerhin stiess ich auf einen Brief, den Joachim Garstecki im September 2002 an Laurens Hogebrink geschrieben hat. Aus ihm möchte ich einige Sätze zitieren: 3 Geblieben ist aus den Kontakten mit Euch „eine Schlüsselerfahrung: Wir müssen die fest gefügten, oft unüberwindlich scheinenden Grenzen kirchlichen wie politischen Agierens ständig ins scheinbar Unmögliche hinein verschieben, wenn die Chance und der Gewinn ökumenischer Kommunikation nicht verspielt werden soll… Dein Ökumene-Horizont war immer größer und weiter als das, was politisch gerade „ging“ oder „nicht ging“. Was wir an unsern niederländischen Freunden stets bewunderten und manchmal fürchteten: ihre emanzipatorische Ungeduld, ihr Drängen auf Veränderung, das kam bei Dir aus einem weiten ökumenischen Horizont. In diesem Horizont durfte man nicht zu klein und schon gar nicht kleinlich denken.“ II. Diskussionsbeitrag am Nachmittag Ich danke Stephen Brown herzlich für seine umsichtige Darstellung des Konziliaren Prozesses in der DDR. Er hat gut beschrieben, wie die Impulse aus der Ökumene dem „Veränderungsstau“, der sich in der DDR der achtziger Jahren verstärkte, eine Richtung und Klärung der Motivation und auch eine sozialethische Legitimation gab. Von hier aus muss ich aber noch einmal zum Beginn des Konziliaren Prozesses bei der Vollversammlung des Ökumenischen Rates in Vancouver zurückgehen. Ich wurde öfter danach gefragt, welche Rolle der Vorschlag der ostdeutschen Delegierten für ein Friedenskonzil in Vancouver gespielt hat. Von Konrad Raiser war dieser Text in die Verhandlungsdokumente der Versammlung eingeschleust worden. Er erregte im Beginn der Vollversammlung großes öffentliches Aufsehen und da ich der Hauptverfasser war, wurde ich in Interviews und Podien dazu befragt. Diese öffentliche Aufmerksamkeit steigerte sich, weil der Text ins kirchenpolitische Kreuzfeuer geriet. Die EKD Delegation reagierte verstimmt und ablehnend und vom Sekretariat des Kirchenbundes kam ein Telegramm, das jede Publikation des Textes untersagte. Die Gründe und Hintergründe dieses Telegramms konnten nie aufgeklärt werden. Dass aus unserm Vorschlagstext, dessen Schwerpunkt auf der Friedensfrage lag, der Vorschlag eines konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung wurde, ist weitgehend Ulrich Duchrow zu verdanken, der in seiner Arbeitsgruppe 6 4 und im Komitee für Programmrichtlinien darauf hingearbeitet hat. Mit ihm war ich seit Mitte der siebziger Jahre freundschaftlich verbunden, so dass diese Kooperation auch kein Zufall war. Nach der Vollversammlung und dessen Votum für den Konziliaren Prozess stellte sich der Kirchenbund hinter den Text seiner Delegierten und nahm die Impulse des Konziliaren Prozesses auf. Er gewann aber vor allem durch die Ökumenische Versammlung große Bedeutung für die politische Rolle der Kirchen in der Endphase der DDR und der Revolution 1989. So kam es dann, dass der Konziliare Prozess vor allem mit den Kirchen in der DDR und ihren Protagonisten verbunden wurde. Was aber war eigentlich dieser Konziliare Prozess? Im größeren zeitlichen Abstand und aus heutiger Perspektive erscheint er mir als der Versuch des Weltrates der Kirchen, den Krisen der globalisierten Welt im ganzen und in der Tiefenschicht zu begegnen. Mit dem vielfach schillernden Begriff der Globalisierung meine ich nicht nur den neoliberal deregulierten Weltmarkt, sondern auch die ökologischen, technologischen und waffentechnischen Krisenentwicklungen, ich meine Globalisierung in ihren Unumkehrbarkeiten, aber auch als Herausforderung zur Umkehr und alternativen Gestaltung. Der Weltrat der Kirchen, so kann man etwa schematisierend sagen, legte in seiner ersten Phase den Schwerpunkt auf die Friedensfrage, es folgte in den sechziger Jahren die Entwicklungspolitik und die Gerechtigkeitsfrage, in den siebziger Jahren griff der ÖRK die ökologischen Fragen auf. In Vancouver stellte sich der Weltrat der Kirchen dem Ganzen dieses Krisensyndroms, dessen Ursachen- und Wirkungszusammenhänge in der sich globalisierenden Welt immer erschreckender zutage traten. Vielleicht eilte er damit – wenn nicht seiner Zeit – so doch dem Zeit-Bewusstsein voraus. Das lässt nicht nur sein stockender Gang in der Ökumene, sondern auch der politische Umbruch 1989 in der DDR vermuten, der die Impulse der Ökumenischen Versammlung bald hinter sich ließ. Aber das gegenwärtige Zusammentreffen von Klimakrise, Finanz- und Wirtschaftskrise und der wieder aufwachsenden nuklearen Gefahr zeigt doch, dass der Weltrat der Kirchen damals eine Warnung ausgesprochen und eine UmkehrPerspektive gezeigt hat, für die es allerhöchste Zeit war und deren Zeitfenster heute bereits sehr eng wird. 5 Wie ich schon sagte und viele von Ihnen wissen, haben wir in den Endphase der DDR versucht, die dort anstehenden gesellschaftlichen Veränderungen in den Horizont des Konziliaren Prozesses zu rücken. Der erste Aufruf zur Beteiligung an der Ökumenischen Versammlung trug das Logo des Konziliaren Prozesses. Diese Verflechtung der globalen und lokalen Perspektiven durchzieht auch mit wenigen Ausnahmen alle Ergebnistexte der Ökumenischen Versammlung. Ob das auch für die über zehntausend Antworten gilt, die der Aufruf auslöste, hat Katharina Kunter in ihrer großen Untersuchung infrage gestellt, weil dort die DDRinternen Probleme dominierten. Das verwundert freilich nicht so sehr, weil das eigene Land natürlich die einzige Handlungsperspektive bot. Ob damit auch der globale Horizont ausgeblendet wurde, bleibt noch zu fragen. Keine Frage aber ist, dass die Verflochtenheit beider Perspektiven verloren ging, als die Revolution aus dem Raum der Kirche auf die Straße trat, das Volk zum Subjekt des politischen Handelns wurde und dessen Mehrheit nur das Ende der DDR und die Vereinigung mit der Bundesrepublik wollte. Ich halte es jedoch für falsch, und zwar auch für historisch falsch, die globale Perspektive des Konziliaren Prozesses und die politischen Wechsel in Deutschland wie Utopismus und Realismus, wie Polit-Traum und Realpolitik zu unterscheiden. Beide gehören vielmehr zwei unterschiedlichen geschichtlichen Entwicklungssträngen an, denen unterschiedliche Paradigmen entsprechen und von denen der eine zu ende ging, der andere aber wachsende Geschichtsmächtigkeit gewann. Es handelt sich einerseits um das Ende der Nachkriegszeit und die Aufarbeitung der in Yalta und Potsdam festgeschriebenen Kriegsfolgen für Deutschland und Osteuropa. Andererseits drängte die Entwicklung nach vorn, die wir heute allgemein Globalisierung nennen. Der erste Entwicklungsstrang beherrschte das öffentliche Bewusstsein in Deutschland seit November 89, sein starkes Symbol wurde die Fällung der Mauer und die deutsche Vereinigung. Im geläufigen Begriff „Wiedervereinigung“ ist der Rückbezug auf die Nachkriegsgeschichte und das Aufatmen angesichts ihres glücklichen Endes deutlich spürbar. Enthält aber „Wiedervereinigung“ auch eine Zukunftsperspektive? Der andere Strang, die Globalisierung wurde fast völlig verdrängt, vielleicht muss man sogar sagen: die Globalisierung wurde von der eingemauerten und provinzialistischen DDR-Mentalität noch gar nicht wirklich wahrgenommen. 6 Gleichwohl war sie längst Realität. Gorbatschow hatte begriffen, dass in der zusammenwachsenden Weltwirtschaft ein abgeblockter Osten nicht mehr zu halten war. Er entwickelte sein „neues Denken“, das sich universalistisch öffnete, im Westen freilich neben Glasnost und Perestroika kaum wahrgenommen und schon gar nicht ernst genommen wurde. In dem sich entwickelnden „world wide web“ war ein abgegrenzter Mauerstaat schlicht ein Anachronismus, einem Eisberg vergleichbar, der im sich erwärmenden Meer der Globalisierung zwangsläufig dahinschmilzt. Der enorme Druck des Weltmarktes und die harten Währungen durchlöcherten längst die Mauer und die Telekommunikation flog über sie hinweg. Und die Katastrophe von Tschernobyl zeigte jedermann, dass Umweltzerstörungen keine Grenzen kennen. Ich denke also, dass die Implosion des „Real existierenden Sozialismus“ mindestens auch aus der Dynamik der Globalisierung verstanden werden muss und der Konziliare Prozess auch analytisch dicht an der Realität war, wenn er die kleine DDR in diesen Prozess einbezogen sah. Seine kritische Analyse schloss freilich auch den real existierenden Kapitalismus ein und das widersprach dem anderen, dem Ost-WestParadigma, in dem nach dem Umbruch ein Denken in beinahe ideologischen Alternativen herrschend wurde: Freiheit kontra Kommunismus, deregulierter freier Markt kontra Staatssozialismus. Die Vereinigung wurde als nachholende Modernisierung des Ostens verstanden, und wer die Modernisierung selbst kritisch unter die Lupe nahm, störte nur. Die wachsende Geschichtsmächtigkeit der Globalisierung und ihrer Schlagschatten ging vielen erst mit den gegenwärtigen Krisen auf – freilich ohne Folgen für die jüngsten deutschen Wahlen. Wir Deutschen haben wahrhaftig allen Grund, dafür dankbar zu sein, dass die Nachkriegsgeschichte für uns mit dem Geschenk der Vereinigung abschloss. Ich plädiere aber dafür, dass wir diese Vereinigung nicht im nationalstaatlichen Paradigma des 19. und 20. Jahrhunderts begreifen, sondern im sich hoffentlich bildenden Geist des 21. Jahrhunderts begehen und also als die Chance ergreifen, befreit von dem destruktiven Ost-West-Konflikt eine konstruktive Rolle in Europa und der Globalisierten Welt zu spielen. 7 Erlauben Sie, dass ich abschließend noch einige Reflexionen zur Rolle der Kirche in der Herbstrevolution 1989 anstelle. Diese herausragende Rolle konnte die evangelische Kirche nur spielen, weil sie sich in den vierzig Jahren einer Diktatur mit totalitären Tendenzen als staatsfreier Raum behauptet hatte. Dadurch konnte sie der einzige Raum eines kritischen politischen Diskurses in dieser Gesellschaft sein, Einübungsraum demokratischer Verfahren, Schutz und Entfaltungsraum gesellschaftskritischer Gruppen und so schließlich Bereitstellungsraum und Impulsgeber der Revolution. Gleichzeitig aber gab es in diesem Raum die Differenzen und Konflikte zwischen der Institution Kirche und den gesellschaftskritischen Gruppen. Unsere niederländischen Freunde, vor allem aus dem IKV, hatten uns seit Anfang der achtziger Jahre energisch nach den dissentierenden Friedensgruppen gefragt und den Kontakt mit ihnen gesucht. Das beunruhigte nicht nur die Staatssicherheit, sondern auch die Kirchenleitungen und das Sekretariat des Kirchenbundes. Die Verständigung ist da nicht immer geglückt und es standen auch Klischees auf beiden Seiten im Wege. Aber diese Beunruhigung war unbedingt notwendig und vielleicht sogar heilsam. Sie war notwendig, weil bei der Arbeit für den Frieden die Frage der Menschenrechte und der Demokratisierung nicht ausgeklammert werden kann, und weil die Ausgrenzung der dissentierenden Gruppen und Einzelnen aus der ökumenischen Kommunikation nicht hinnehmbar war. Ich denke aber, dass diese Beunruhigung auch heilsam war. Sie stieß die Kirchen auf ein ekklesiologisches Defizit, dem sie dann im Herbst 1989 nicht mehr ausweichen konnten. Die gesellschaftskritischen Basisgruppen wurden die Protagonisten der Herbstrevolution, die Kirchen schlossen sich ihnen an und übernahmen so etwas wie eine „Treuhänderschaft“ (Konrad Raiser) für den zivilgesellschaftlichen Aufbruch. Die Ökumenische Versammlung 1988/89, die nicht nur die Konfessionen, sondern auch Oberkirchenräte und Gruppenvertreter vereinte, hatte das vorbereitet. Die beunruhigende Frage der niederländischen Freunde: „Wo sind eure Brüder Dissidenten?“ sehe ich im Rückblick wie ein sensibilisierendes Vorspiel zum Herbst 1989. Ich war damals ein Anwalt der Gruppen in den Kirchenleitungen und bei den Gruppen warb ich um Verständnis für die Kirchenleitungen. Ich war 8 der Meinung, dass die Kirche die Gruppen als Sozialgestalt und in ihrem Engagement in ihr Kirchenverständnis hätte aufnehmen, bzw. ihr Kirchenverständnis für sie hätte öffnen müssen. Beide, Kirchenleitungen und Gruppen wollte ich davon überzeugen, dass sie diesem Konflikt, so scharf er auch bisweilen war, nicht mit Denkmustern des Entweder-oder gerecht werden können. Es ging auch um unterschiedliche Strategien politischer Verantwortung und um unterschiedliche Mandate von Kirchenleitungen und Gruppen. Auch gab es in dem Konflikt deutliche Synergie-Effekte, wenn sich z.B. Kirchenleitungen dem Staat gegenüber zum Interpreten der Gruppen machten und die Gruppen den Kirchenleitungen die Problemanzeigen lieferten, die diese dann den Staatsvertretern auf den Tisch legten. Was ich sagen möchte ist: Mit steilen Alternativen von Anpassung oder gar Kollaboration einerseits und Opposition oder gar Widerstand andererseits wird man diesem Konflikt nicht gerecht. Er bedarf der kirchensoziologischen Aufklärung, um ihn nicht vorschnell mit Theologisierungen zu überblenden oder mit politischen Deutungsmustern zu verzerren. Dabei kommt man zu Urteilen, die bei genauem Hinsehen nicht zu halten sind und auch unverständlich machen, wie im Herbst 1989 die Institution Kirche zum Aufbruchsort der Revolution werden konnte, handgreiflich in den Friedensgebeten, die in kleinsten Dorfkirchen und den repräsentativsten Domen das Volk versammelten. Diese Kooperation war freilich durch ein Modell der Konfliktaustragung vorbereitet, das überraschend in den beiden letzten DDR-Jahren zustande kam. Ich meine die vom Konziliaren Prozess inspirierte Ökumenische Versammlung, die nicht nur die christlichen Konfessionskirchen, sondern auch Kirchenvertreter und Gruppenvertreter an einem Tisch und zum Gespräch in Augenhöhe zusammenführte. Freilich muss gleich wieder auch das andere gesagt werden: Diese Phase gelingender Kooperation ging schon 1990 wieder zu ende, als die Kirchenleitungen, selbst ihren Synoden vorgreifend, eine schnelle strukturelle Vereinigung von EKD und Kirchenbund beschlossen und damit auch manchen Veränderungsimpulsen der Ökumenischen Versammlung und der revolutionären Gruppen Möglichkeiten des Weiterwirkens nahmen. Nur einmal noch in den neunziger Jahren wurden die Impulse der Ökumenischen Versammlung und des Konziliaren Prozesses aufgegriffen: in dem ökumenischen 9 Konsultationsprozess, der zu der Erklärung zur wirtschaftlichen und sozialen Lage mit dem Titel „Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“ führte. Dieses geschichtliche Erinnern und Vergessen aber nötigt zu der Frage, was unsere Kirche aus dem Herbst 1989 zu lernen hätte. Ich versuche darauf einige Antworten, der Kürze wegen in mehr thetischer als argumentativer Form. 1. Die Kirche braucht eine klare Orientierung an ihrem biblischen Auftrag und eine klare, das Kirchenschiff wirklich leitende theologische Kielführung. Darin gründet ihre Freiheit und Identität. Die Kirche wird sich nicht von außen auf eine „Kernkompetenz“ des spezifisch Religiösen festlegen lassen dürfen und sie darf sich vom Haupttrend gegenwärtiger religiöser Bedürfnisse nicht auf den Pfad der Individualisierung und Innerlichkeit drängen lassen. Sie wird die in ihrem Auftrag gründende Einheit von Gottesliebe und Nächstenliebe, von Gottesbeziehung und Weltverantwortung, von Spiritualität und Kampf (Taizè) festhalten und die ganze vieldimensionale Fülle der biblischen Spiritualitäten in die Gesellschaft einbringen. 2. Die Kirche wird ihre Stellung und Funktion im öffentlichen Raum neu zu bedenken haben. ( Hier schließe ich mich an Gedanken an, die Konrad Raiser kürzlich im Anschluss an die Rolle der Kirche im Herbst 1989 vorgetragen hat. ) Der europäische Protestantismus hat sich nach der Reformation in die damals gesellschaftsprägenden politischen Strukturen hineingegeben oder ihnen angepasst. In den neuesten kirchlichen Reformprojekten sucht sich der deutsche Protestantismus an dem Modell von Wettbewerb und Markt zu orientieren, das zum dominanten Modell gesellschaftlicher Organisation geworden ist. Dies hat die Kirchen nolens volens auf einen Markt der religiösen Nachfragen und Angebote versetzt, auf dem sie sich in der Tat neu und situationsgerecht verhalten muss. Wie sich der Protestantismus jedoch einst nicht der Logik staatlicher Machtausübung ausliefern durfte, so heute nicht der ökonomischen Logik des Marktes. Sie treibt die Kirche einerseits in die Sorge um sich selbst, ihr Wachstum, ihre Effizienz und Qualitätssteigerung und macht sie andererseits abhängig von den an sie herangetragenen Bedürfnissen und Wünschen. 10 Im Herbst 1989 verbündeten sich die Kirchen in der DDR mit dem Aufbruch der Zivilgesellschaft, dem „osteuropäischen Bürgerfrühling“ ( Timothy Garton Ash). In der Zivilgesellschaft, so sagt Konrad Raiser im Anschluss an den Religionssoziologen José Casanova, geht es um die Stärkung von Beziehungen und Kommunikation im weitesten Sinn. Zivilgesellschaftliche Prozesse dienen der Bewahrung und Verbesserung von Lebensqualität und der Verständigung über grundlegende Wertorientierungen. Im Herbst 1989 wurde die christliche Gemeinde in der Minderheitssituation zum Katalysator zivilgesellschaftlicher Prozesse, die gewaltfrei zur Revolutionierung der wirtschaftlichen und politischen Machtverhältnisse führten. Nach dem poltischen Umbruch haben die Kirchen in Deutschland diese Erfahrung bei ihrem großen Projekt der Kirchenreform bisher leider völlig vernachlässigt. 3. Die christliche Gemeinde muss sich als konziliare Gemeinschaft verstehen und auch organisieren. Das ist die Lehre, die ich aus dem Konflikt zwischen institutioneller Kirche und gesellschaftskritischen Gruppen in der DDR der achtziger Jahre ziehe. Der Gedanke eines konziliaren Prozesses wurzelte auch in der langjährigen theologischen Arbeit des Weltrates der Kirchen am Konzilsverständnis. Sie hatte dazu geführt, „Konziliarität“ als eine Lebensform der christlichen Gemeinde überhaupt zu verstehen. Hier gilt es jetzt weiter zu denken. Konziliarität ist ein Einheitsmodell der Kirche, das nicht nur einer hierarchischen Verfasstheit der Kirche widerspricht, sondern auch über unsere repräsentativen Synodalverfassungen hinausgeht. Konziliarität meint partnerschaftliche Konfliktaustragung und Konsensfindung, eine versöhnte Verschiedenheit, die Gegensätze aushält und Unterschiede gelten lässt. Sie meint einen Streit um die Wahrheit, der autoritäre Dekretierung ebenso vermeidet wie pluralistische Vergleichgültigung der Wahrheit. Sie gründet in einem Verständnis der Wahrheit, die sich nicht primär in zeitlosen Begriffen und Definitionen manifestiert, sondern in der Geschichte ereignet und dort „in alle Wahrheit leitet“. Konziliarität wird der Pluralität des heiligen Geistes gerecht und befähigt die Kirche, einer gelingender Pluralität in der Gesellschaft zu dienen. Wie weit dieses Modell auch dem Zusammenleben mit anderen Religionen dienen kann, wäre zu prüfen. Dies ist ja das neue Feld, in das der alte kirchenkonzentrierte Konziliare Prozess heute hineingehen muss. 11 4. und letztlich: Die Kirchen müssen sich selbst ökumenisch als Gliedkirchen der einen universalen Christenheit begreifen. Nur so können sie ihrer Verantwortung in der globalisierten Welt und im eigenen Land entsprechen und vielleicht sogar zu Hoffnungszeichen einer alternativen Globalisierung werden. Ich sage dies auf dem Hintergrund der immensen Bedeutung, welche die ökumenische Bewegung für die Kirchen und Gemeinden in der DDR gewann. Ich sage es aber auch in der Beunruhigung über den Bedeutungsschwund des Weltrates der Kirchen in der Gegenwart. Aus den Mitgliedskirchen müssen neue Impulse zur Stärkung und Vitalisierung der ökumenischen Bewegung hervorgehen, weil wir unsern Auftrag „vor Ort“ nicht mehr wahrnehmen können, ohne in den globalen und ökumenischen Zusammenhängen präsent zu sein. Gerade dieses Letzte aber sage ich in dem der immer wieder neu aufflackernden Staunen über die große Rolle, welche die niederländischen Kirchen in der Ökumenischen Bewegung gespielt haben. Ich danke Ihnen. 12