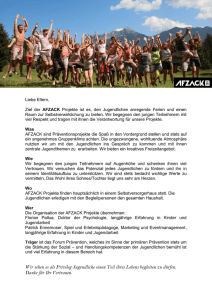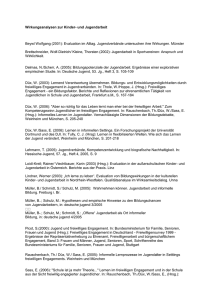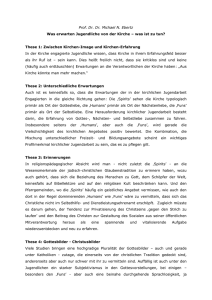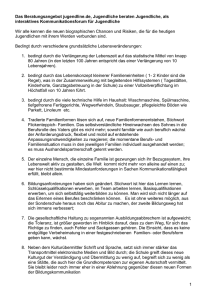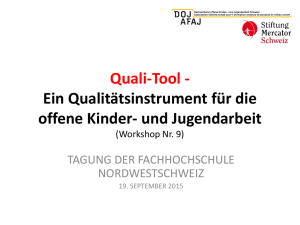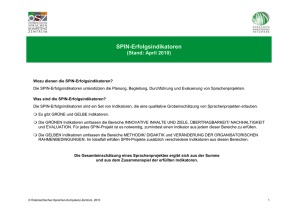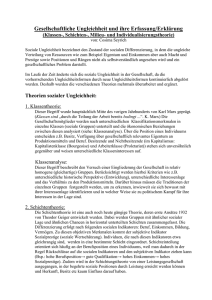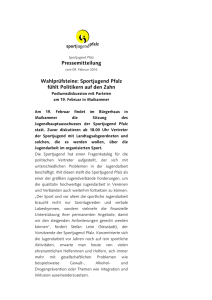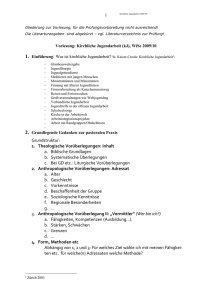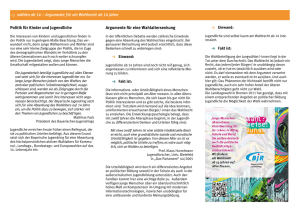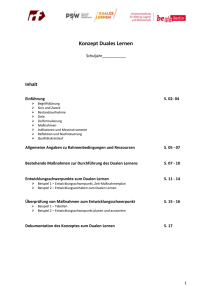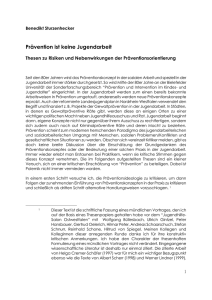Qualitäts-Selbstcheck
Werbung

Qualitäts-Selbstcheck für die Kinder- und Jugendarbeit im Erzbistum Berlin Impressum: Qualitäts-Selbstcheck für die Kinder- und Jugendarbeit im Erzbistum Berlin Hrsg. von der Jugendseelsorgekonferenz im Erzbistum Berlin Berlin Januar 2005 Redaktion: Burkhard Rooß (BDKJ), Helmut Jansen (EAJ), Markus Papenfuß (Pastoralreferent), Susanne Wagner-Wimmer (Gemeindereferentin), Martin Reiland (Pastoralreferent), Christian Andrees (Pastoralassistent), Arnd Franke (Diözesanjugendseelsorger), Frank Hoffmann (BDKJ-Präses), Jörg Nottebaum (BDKJ) Inhalt Die richtigen Dinge richtig tun S. 3 1. Qualitäts-Selbstcheck kurzgefasst S. 7 2. Qualitäts-Selbstcheck im Detail S. 8 3. Methoden zur Entscheidungsfindung Punktwahlmethode Konsensfindung Paarweiser Vergleich Portfolio S. 14 S. 14 S. 14 S. 15 S. 16 4. Qualitäts-Selbstcheck: Die Fragebögen Leitziel: Identitätsentwicklung Leitziel: Entwicklung von Spiritualität Leitziel: Entwicklung von Partizipation und Selbstbestimmung Leitziel: Entwicklung von gelingenden Beziehungen und Gemeinschaft Leitziel: Anregung und Hinführung zu sozialem und politischem Engagement Leitziel: Personalentwicklung S. 19 S. 20 S. 27 S. 32 S. 40 S. 48 S. 55 5. Methoden zur Zielentwicklung s.m.a.r.t. Kopfstandtechnik Lösungsmatrix Gemeinsam Ziele bilden Zukunftswerkstatt S. 62 S. 63 S. 63 S. 64 S. 64 S. 65 6. Hilfe! Downloads Qualitätszirkel Literatur Fachliche Unterstützung S. 68 S. 68 S. 68 S. 68 S. 69 Die richtigen Dinge richtig tun In der Kinder- und Jugendarbeit „die richtigen Dinge richtig tun“ – schön wär’s, wenn das immer klappen würde. Aber was sind die „richtigen Dinge“, was heißt schon, etwas „richtig tun“? Das sind Fragen, vor denen Verantwortliche in der Kinder- und Jugendarbeit – seien es ehrenamtliche oder berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – immer wieder stehen. Für Leute, die sich diese Fragen stellen oder künftig stellen wollen, ist dieser Qualitäts-Selbstcheck gedacht. Das heißt nicht, dass ihr hier die Antworten auf alle eure Fragen finden werdet, denn im Allgemeinen finden diejenigen, die als Expertinnen und Experten vor Ort aktiv sind, auch ganz gut alleine die passenden Lösungen. Nicht umsonst sind „Selbstbestimmung“ und „Selbstorganisation“ zwei wichtige Qualitätsmerkmale kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit. Die Qualität der eigenen Arbeit verbessern – denn darum geht es – kann man unserer Überzeugung nach nicht mit Lehrsätzen. Vielmehr kommt es darauf an, die konkrete „Irgend etwas müssen wir falsch gemacht haben, der Situation in den Blick zu nehmen, das was Hahn jedenfalls sagt keinen Ton mehr.“1 gut läuft weiter zu führen und mit anderen gemeinsam dort nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen, wo Unzufriedenheit sich breit macht. Auf diesem Weg können richtige Fragen eine viel bessere Hilfestellung sein als ein „Ihr sollt...“ oder ein „ihr müsst...“. Fragen können:2 1 2 tiefgründig aufspüren, was sonst verdeckt bliebe, ansprechen, was sonst nicht erwähnt werden dürfte, deutlich machen, was gut läuft, auf Ideen bringen, tiefergehende Fragen provozieren, ein Arbeitsfeld strukturieren, unglaublich nervig sein, Probleme zur Sprache bringen, eine Überforderung darstellen, da niemand alles beantworten kann. Quelle konnte leider nicht ausfindig gemacht werden. Vgl. Landesjugendring Niedersachsen e.V. 2002: Handbuch zur Qualitätsentwicklung in der Jugendverbandsarbeit, Hannover, S.10. 3 Bevor wir versucht haben, „richtige“ Fragen zu formulieren, fragten wir uns selber, woran sich unsere Fragen orientieren sollten? Mit anderen Worten: Was sind eigentlich die Ziele kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit im Erzbistum Berlin? Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Kinder- und Jugendarbeit haben in einem intensiven Austausch zu genau dieser Frage ein Leitbild entwickelt und Ziele formuliert und diese im „Pastoralplan für die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit im Erzbistum Berlin“ veröffentlicht. „Aha!“ werden einige jetzt sicherlich sagen, also doch eine Vorgabe, die sagt, was „die richtigen Dinge“ sind? Ohne Zielvorstellungen kommt man nicht aus, davon sind wir überzeugt. Das Besondere am Pastoralplan ist aber, dass er ein Ergebnis ist, das Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam entwickelt haben, Frauen und Männer, Leute aus Jugendverbänden und aus anderen Organisationsformen, aus Gemeinden und aus Dekanaten, vom Land und aus der Stadt, sogar aus dem alten Ost und dem alten West. Wenn ihr mögt, überzeugt euch selber von der Sinnhaftigkeit der Leitziele kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit: Leitziel: Identitätsentwicklung Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit eröffnet und fördert Wege, die eigene Identität und Persönlichkeit, ein eigenes Wertesystem und einen eigenen Lebensstil unter Einbeziehung der Mit- und Umwelt zu entdecken und zu entwickeln. Sie fördert Selbstbewusstsein und Verantwortungsbewusstsein, indem sie zur Orientierung am Gemeinwohl, zum Respekt und zur Toleranz der und des jeweils anderen anregt. Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit will Kinder und Jugendliche zu kritischem Urteil und eigenständigem Handeln aus christlicher Verantwortung heraus befähigen und anregen. Leitziel: Entwicklung von Spiritualität Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit bietet Erfahrungs- und Handlungsräume, die Botschaft Jesu Christi glaubwürdig kennen zu lernen und zu erleben, sich Glauben anzueignen und ihn zu leben. Sie hilft jungen Menschen, Gott in ihrem eigenen Leben zu entdecken und die gemachten Erfahrungen mit anderen zu teilen, indem sie Raum schafft für den Austausch von Wertvorstellungen, Wünschen, Ängsten und Hoffnungen und für Entwicklung und Praxis verschiedenster Formen, Glauben und Leben zu feiern. Leitziel: Entwicklung von Partizipation und Selbstbestimmung Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit will junge Menschen dazu befähigen, Mündigkeit in Gesellschaft und Kirche zu entfalten und zu leben. Sie schafft Möglichkeiten der Beteiligung, Mitbestimmung und Mitentscheidung, sie fördert und weckt die Kompetenz von Kindern und Jugendlichen, eigene und gemeinsame Interessen zu formulieren und zu vertreten, Verantwortung wahrzunehmen, Entscheidungen zu treffen und Kinder- und Jugendarbeit selber zu bestimmen und zu organisieren. Leitziel: Entwicklung von gelingenden Beziehungen und Gemeinschaft Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit will positive Erfahrungen von tragfähiger Gemeinschaft ermöglichen und dazu befähigen, selber Gemeinschaft zu stiften, solidarisch mit anderen zu leben und 4 Verantwortung in Kirche und Gesellschaft zu übernehmen. Sie fördert Kommunikations- und Kritikfähigkeit in glaubwürdigen und tragfähigen Beziehungen und zielt auf ein partnerschaftliches und teamorientiertes Miteinander. Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit bietet Gruppen Gleichaltriger, in denen junge Menschen ihr Leben gemeinsam gestalten lernen und erfahren, was es heißt, füreinander und für andere Verantwortung zu tragen. Leitziel: Anregung und Hinführung zu sozialem und politischen Engagement Kirchliche Kinderund Jugendarbeit stellt sich den Herausforderungen von Ungerechtigkeiten und führt zu sozialem und politischem Engagement. Sie befähigt junge Menschen, Gesellschafts- und Lebensentwürfe kritisch zu hinterfragen und sich für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung einzusetzen. Sie trägt dazu bei, im gesellschaftlichen und kirchlichen Raum Bedingungen zu schaffen, die ein menschenwürdiges Aufwachsen und Leben in Freiheit und Solidarität ermöglichen. Die Ziele kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit sind auf unterschiedlichen Wegen erreichbar. Auch angesichts der vielfältigen Ausgangssituationen und -voraussetzungen in der Kinder- und Jugendarbeit ist eine Vielfalt an Wegen erforderlich. Vielfalt bedeutet aber nicht Beliebigkeit. Daher sind im Pastoralplan sogenannte Qualitätsmerkmale als Hilfestellung und Orientierungspunkte entwickelt worden für alle, die für ihre Kinder- und Jugendarbeit herausbekommen wollen, was es heißt, „die richtigen Dinge richtig zu tun“. An diesen Qualitätsmerkmalen haben wir unsere Fragen ausgerichtet und zu einem „Qualitäts-Selbstcheck“ ausgearbeitet.3 Wie der funktioniert, erfahrt ihr gleich. Vielleicht fragt ihr euch aber auch noch, warum um das Thema Qualität so ein TamTam gemacht wird, schließlich ist das alles ja nichts Neues. Schon immer war es in der Kinderund Jugendarbeit wichtig, auf gute Qualität zu achten:4 3 4 Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit wird maßgeblich von Ehrenamtlichen und freiwillig Engagierten getragen. Sie wollen Spaß haben, etwas Sinnvolles für sich und andere tun, sie möchten angemessene Anforderungen gut bewältigen, sie möchten sichtbare Erfolge erzielen und dafür Anerkennung und Wertschätzung erfahren. Wenn das nicht möglich ist, ziehen sich Ehrenamtliche schnell zurück. Die Quittung kommt prompt: Ohne Qualität keine Ehrenamtlichen. Kinder und Jugendliche haben ihre eigenen Vorstellungen, Wünsche und Bedürfnisse. Die Erlebnisqualität der Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit muss in der Lage sein, diese Wünsche aufzugreifen. Die Quittung kommt prompt: Ohne Qualität keine Kinder und Jugendlichen. Hilfreich war für unsere Arbeit auch das „Handbuch Qualitätsmanagement der Berliner Jugendfreizeitstätten“ der Projektgruppe Qualitätsentwicklung der Berliner Jugendarbeit, dessen Grundschema einer Selbstevaluation wir für unsere Zwecke übertragen haben. Vgl. Landesjugendring Niedersachsen e.V. 2002, S. 12f. 5 Damit das alles möglich ist, braucht es Unterstützung im Verband, in der Gemeinde, in der Schule oder im Dekanat durch fachliche personelle Unterstützung, Räume und angemessene materielle Ausstattung. Die Quittung kommt prompt: Ohne Qualität keine Unterstützung. Schließlich muss auch die Organisationsstruktur stimmen. Ohne Transparenz von Informations- und Entscheidungswegen, Mitbestimmungsstrukturen, gelingende Teamsitzungen, Auswertungen usw. versinkt bald alles im Chaos. Die Quittung kommt prompt: Ohne Qualität keine Verantwortlichkeit. Insofern habt ihr völlig recht: Qualität ist nichts Neues. Vielleicht habt ihr ja gerade deswegen Lust, mit dem Qualitäts-Selbstcheck eine Methode auszuprobieren und zu nutzen, die Qualität eurer Kinder- und Jugendarbeit immer weiter zu verbessern. Dabei wünschen wir euch viel Spaß und viel Erfolg! Am Ende haben wir noch eine Bitte: Der Qualitäts-Selbstcheck ist nicht ein für allemal festgeschrieben, sondern soll selber auch immer besser werden. Eure Erfahrungen, Ergänzungen, Änderungswünsche, selbst gesteckten Ziele usw. sind daher für uns ganz wichtig. Bitte mailt uns eure Anregungen an [email protected] oder [email protected]. Wir werden eure Ideen auswerten und anderen Gruppen zugänglich machen, so dass möglichst viele Gruppen voneinander profitieren können. Alle Bögen zum Qualitäts-Selbstcheck könnt ihr euch übrigens downloaden unter www.bdkj-berlin.de oder www.erzbistumberlin.de. Die Steuerungsgruppe der Jugendseelsorgekonferenz zum Pastoralplan für die Kinder- und Jugendarbeit im Erzbistum Berlin 6 1. Qualitäts-Selbstcheck kurzgefasst Der Selbstcheck ist vorrangig gedacht für Gruppen und Teams. Wir haben insgesamt 29 Themen vorbereitet, zu denen ihr euch selbstchecken könnt. Die 29 Themen sind die 29 Qualitätsmerkmale der fünf Leitziele im Pastoralplan für die Kinder- und Jugendarbeit im Erzbistum Berlin plus dem Ziel Personalentwicklung. Wir haben versucht, jedes Qualitätsmerkmal etwas genauer zu beschreiben. Worum geht’s? Was wollen wir erreichen? Wen betrifft es? Und: Woran erkennen wir, dass ein Ziel erreicht wurde? Beschreibung Worum geht es? Was wollen wir erreichen? Wie wollen wir arbeiten? Zielgruppe Wen sprechen wir bei diesem Qualitätsmerkmal an? Tipps An einigen Stellen geben wir euch eine Empfehlung, mehrere Qualitätsmerkmale im Zusammenhang anzugehen. Indikatoren Woran können wir erkennen, dass wir das Qualitätsmerkmal umsetzen? Und so funktioniert es: Start: Entscheidet euch, ob und wann ihr den Selbstcheck mit welchem Qualitätsmerkmal beginnen und wie viel Zeit ihr euch dafür nehmen wollt. Indikatoren ergänzen: Lest euch die genauere Beschreibung des Qualitätsmerkmals durch, schaut euch die Indikatoren an und ergänzt dort, wo es für eure Situation notwendig ist. Streichungen solltet ihr nur vornehmen, wenn die Frage nicht zu eurer Arbeitsebene passt. Bewerten: Jetzt kreuzt jede Person bei jeder Frage an, welche Antwort ihrer Meinung nach für eure Situation zutrifft. Berechnen: Addiert die angekreuzten Ziffern pro Indikator und dividiert die Summe durch die Anzahl der Bewertungen. Je nach Ergebnis ergibt sich ein unterschiedlicher Bedarf an Weiterarbeit. Ziele setzen: Erzählt euch, warum ihr glaubt, dass etwas gut oder nicht gut läuft. Versucht nun in den Bereichen, wo sich etwas ändern muss, Ziele zu verabreden und Schritte, mit denen ihr euer Handlungsziel erreichen wollt. Falls ihr sehr viel Verbesserungsbedarf seht, konzentriert euch auf die wesentlichsten Dinge. Dokumentieren: Haltet in den Auswertungsbogen fest, was bei euch gut läuft und was schlecht abgeschnitten hat. Notiert außerdem eure vereinbarten Handlungsziele und wer bis wann für deren Umsetzung verantwortlich ist. Überprüfen: Habt in den nächsten Wochen im Blick, dass ihr eure verabredeten Ziele und Umsetzungsschritte auch wirklich umsetzt und verabredet, wann ihr dieses Qualitätsmerkmal das nächste Mal einem Selbstcheck unterziehen wollt. 7 2. Qualitäts-Selbstcheck im Detail Hier stellen wir euch die einzelnen Schritte noch einmal ausführlich vor. Das Ausfüllen der Fragebögen ist zwar sehr einfach, reicht aber für den Selbstcheck nicht aus. Damit eure Kinder- und Jugendarbeit auch wirklich vom Selbstcheck profitieren kann, gibt es einiges zu berücksichtigen. Start Arbeitsschritte Klärung: QualitätsSelbstcheck ja oder nein? Verabredung: Wann, Wo und Wie? Ebene klären Hinweise Den Qualitäts-Selbstcheck könnt ihr nur machen, wenn die Leute in eurer Gruppe oder eurem Team das auch wollen oder sich wenigstens einverstanden erklärt haben, mitzudenken. Ihr solltet daher im Vorhinein verabreden, ob ihr einen Selbstcheck machen wollt oder nicht. Auswerten und Ziele setzen kann man nicht verordnen. Wenn es bei euch keine Mehrheit dafür gibt, ist der Zeitpunkt wahrscheinlich (noch) nicht der richtige. Je nachdem wie intensiv und umfangreich ihr einsteigen wollt, müsst ihr euch mehr oder weniger Zeit nehmen: eine Teamsitzung, einen Gruppennachmittag oder mehrere Abende, besonders gut eignet sich der Selbstcheck für ein Klausurwochenende o.ä., auf dem ihr eure Arbeit des letzten Jahres reflektieren und für die Zukunft planen wollt. Wenn ihr euch ein bestimmtes Qualitätsmerkmal vornehmen möchtet und schon etwas geübt seid, reichen wahrscheinlich 2,5 Stunden, für ein ganzes Leitziel oder mehrere Qualitätsmerkmale solltet ihr entsprechend mehr Zeit einplanen. Wenn ihr euch für die Bearbeitung eines Qualitätsmerkmals entschieden habt, haltet noch einmal ausdrücklich fest, auf welche Gruppe bzw. Ebene sich eure Auswertung beziehen soll. Als diözesanes Leitungsteam eines Jugendverbandes müsstet ihr euch z. B. entscheiden, ob sich die Fragen allein auf die Diözesanebene beziehen oder ob ihr auch die Gegebenheiten eurer einzelnen Ortsgemeinschaften, Stämme oder Regionalgruppen mit in eure Bewertung einbezieht. Entsprechendes gilt für eine Dekarunde im Verhältnis von Dekanatsebene und Gemeinden. Nur wenn ihr das Gleiche bewertet, könnt ihr eure Ergebnisse auch vergleichen und feststellen, ob bei euch ein Verbesserungsbedarf besteht. 8 Verabredung: Was? Der Qualitäts-Selbstcheck enthält 29 Qualitätsmerkmale mit Fragen, an denen ihr erkennen könnt, wie ihr ein Qualitätsmerkmal in eurer Arbeit bislang berücksichtigt. Mal sind es nur drei Fragen, mal 20. Weder ist es so gedacht noch ist es sinnvoll, dass ihr euch alle 29 Qualitätsmerkmale auf einmal vornehmt. Setzt selber Schwerpunkte und wählt euch ein einzelnes Merkmal aus oder beschäftigt euch mit den Qualitätsmerkmalen eines ausgewählten Leitzieles. Bei einigen Qualitätsmerkmalen empfehlen wir euch, sie in Verbindung mit einem bestimmten anderen vorzunehmen (Kategorie TIPP). Auf längeren Veranstaltungen könnt ihr auch arbeitsteilig an mehreren verschiedenen Qualitätsmerkmalen arbeiten. Methoden zur Entscheidungshilfe, womit ihr konkret beginnen wollt, findet ihr im Kapitel 3 „Methoden zur Entscheidungsfindung“. Indikatoren ergänzen Arbeitsschritte Indikatoren überprüfen Veränderungen weiter leiten Hinweise Wenn ihr entschieden habt, mit welchem Qualitätsmerkmal oder mit welchen Qualitätsmerkmalen ihr euch beschäftigen wollt, könnt ihr noch die Indikatoren dahin gehend überprüfen, ob sie alle aus eurer Sicht wichtigen Fragestellungen abdecken. Den entsprechenden Selbstcheck-Bogen könnt ihr downloaden und nach euren speziellen Erfordernissen selber ergänzen oder anpassen. Streichen solltet ihr Fragen nur dann, wenn die Ebene nicht stimmt (z. B. Ministrantinnen an Schulen). Lasst euch dabei nicht zu sehr von eurer gegenwärtigen Situation beeinflussen, nach dem Motto: „Ha‘m wa nich‘, brauch‘n wa nich“. Vielleicht bergen ja manche Fragen, die man eher leichtfertig abtun würde, bei näherer Betrachtung wertvolle Anregungen. Die Überprüfung und ggf. Veränderung der Indikatoren sollte möglichst im Vorfeld geschehen, so dass beim eigentlichen Treffen gleich mit der Bewertung begonnen werden kann. Bitte mailt uns eure Veränderungen an [email protected] oder [email protected], damit wir Rückmeldungen auswerten und den Selbstcheck schrittweise immer weiter verbessern können. Bewerten Arbeitsschritte Ankreuzen Hinweise Jede Person kreuzt auf ihrem Selbstcheck-Bogen an, welche Bewertung zu den einzelnen Fragen ihrer Ansicht nach für eure Gruppe zutrifft. 9 Ergebnisse transparent machen oder anonym einsammeln Je nach Gruppe, Qualitätsmerkmal oder Situation kann es günstig oder weniger günstig sein, die Bewertungen Einzelner transparent zu machen. Wir schlagen euch deswegen drei unterschiedlich transparente bzw. anonyme Auswertungsformen vor: 1. anonym: ausgefüllte anonyme Fragebögen einsammeln 2. halboffen: auf einem Plakat ist jede Frage als Stichwort aufgeschrieben, jede Person schreibt dahinter ihre Bewertungsziffer. Es wird sichtbar, welche Bewertungen abgegeben werden und wie weit die Bewertungen auseinander fallen. 3. transparent: für jede Bewertungsziffer wird ein Platz im Raum festgelegt, jede Frage wird aufgerufen, alle stellen sich entsprechend ihrer Bewertung auf den vorher festgelegten Platz. Es wird sichtbar, wer welche Bewertung abgibt und wie weit die Bewertungen auseinander fallen. 10 Berechnen Arbeitsschritte Durchschnittswerte berechnen Rangliste herstellen Hinweise Haltet am besten einen Taschenrechner bereit, um die Durchschnittswerte schnell zu berechnen. Dazu müsst ihr die einzelnen Bewertungen addieren und durch die Anzahl der Bewertungen teilen. Bei manchen Fragen könnte es auch Sinn machen, dass man die Durchschnittswerte von Kleingruppen ermittelt, z. B. die der ehrenamtlichen einerseits und der beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter andererseits. Stellt eine Rangliste der Fragen entsprechend eurer Durchschnittswerte so auf, dass sie für alle sichtbar ist (Flipchart, Beamer, Folie o.ä.). Ziele setzen Arbeitsschritte Gutes würdigen Kommentieren Handlungsbedarf feststellen Hinweise Bevor ihr euch den problematischen Dingen widmet, vergesst nicht, euch für eure Erfolge zu gratulieren. Ihr könnt euch z.B. in einen Kreis stellen, euch alle um 90° drehen und dem Vordermenschen auf die Schulter klopfen. Manche Durchschnittsergebnisse können überraschen. Gebt die Möglichkeit, mindestens die besten und die schlechtesten Ergebnisse zu kommentieren: Warum hat jemand so oder so gepunktet? Entscheidet, in welchen Bereichen ihr eure Situation verbessern wollt. Die Durchschnittswerte geben einen Anhaltspunkt (mehr nicht). An diesen Werten könnt ihr euch zunächst orientieren: 3,0 bis 4,0: Prima, ihr dürft euch auf die Schultern klopfen! Es gibt bereits gute Ansätze! Entscheidet selber, ob es für euch an der Zeit ist zu überlegen, wie ihr euch verbessern könnt! Hier hakt es! zwischen 2 und 3: 1,0 bis 2,0: Ziele erarbeiten Konzentriert euch auf die Bereiche, die euch als Gruppe oder Team am wichtigsten sind. Ihr könnt dies im Gespräch klären oder wieder Methoden zur Entscheidungshilfe einsetzen (Kapitel 3). Kleiner Hinweis: Es kann vorkommen, dass ihr einen Aspekt als sehr schlecht bewertet, im Gespräch aber feststellt, dass ihr aus bestimmten Gründen trotzdem keinen dringenden Handlungsbedarf seht. Das ist nicht weiter schlimm, die Bewertungen sind Anhaltspunkte und Entscheidungshilfe, keine Vorschrift. Macht euch dann daran, Lösungen für eure Probleme oder unbefriedigenden Situationen zu entwickeln. Methoden zur Erarbeitung von Zielen findet ihr im Kapitel 5. Kleingruppen können sich auch mit unterschiedlichen Problemen beschäftigen und Vorschläge für das Plenum machen. 11 Dokumentieren Arbeitsschritte Auswertungsbogen ausfüllen Verantwortlichkeiten festlegen Hinweise Tragt in den Auswertungsbogen „Rangliste“ die Ergebnisse eurer Bewertungen ein (Kopievorlage bzw. Download). Haltet außerdem im Auswertungsbogen „Verbesserungsprojekte“ fest, wo ihr Verbesserungsbedarf seht und welche Verabredungen und Ziele ihr euch bis wann gesteckt habt. Auf diese Weise habt ihr immer einen guten Überblick zum Stand eurer Planungen. Viele gute Ideen scheitern daran, dass man mal drüber gesprochen hat, sich aber niemand wirklich darum kümmert, dass auch etwas passiert. Bei der Verabredung von Zielen solltet ihr deswegen nie vergessen festzulegen, wer für die Erledigung einer konkreten Aufgabe bis zu einem bestimmten Zeitpunkt verantwortlich ist. Entsprechender Platz ist im Auswertungsbogen „Verbesserungsprojekte“ frei gehalten. Überprüfen Arbeitsschritte „Beschlusskontrolle“ Zeitpunkt für neuen Selbstcheck Hinweise Euer ausgefüllter Auswertungsbogen „Verbesserungsprojekte“ erleichtert euch die „Beschlusskontrolle“, wenn ihr bei nachfolgenden Treffen nachfragt, wie weit die geplanten Vorhaben vorangeschritten sind. Interessant für euch kann es werden, wenn der Selbstcheck eines Qualitätsmerkmals kein einmaliger Akt bleibt, sondern nach einem längeren Zeitraum wiederholt wird (z.B. nach ein oder zwei Jahren). Ihr könnt dann vergleichen, wie sich die Bewertung in einzelnen Bereichen verändert hat und ob eure geplanten Verbesserungsprojekte gewirkt haben. Auf dem Auswertungsbogen ist deswegen ein Feld freigehalten, wo ihr den geplanten Zeitpunkt einer neuen Bewertung eintragen könnt. 12 Auswertungsbogen: Rangliste Zum Selbstcheck des Qualitätsmerkmals: Gruppe: Datum: Anzahl der Bewertungen: Das läuft gut! 4,0 bis 3,0 So lá lá zwischen 2 und 3 Hier hakt es! 2,0 bis 1,0 © Qualitäts-Selbstcheck für die Kinder- und Jugendarbeit im Erzbistum Berlin Auswertungsbogen: Verbesserungsprojekte Zum Selbstcheck des Qualitätsmerkmals: Gruppe: Hier sehen wir Verbesserungsbedarf: Datum: Anzahl der Bewertungen: Was können wir ändern? Unsere Handlungsziele sind: Dieses Qualitätsmerkmal wollen wir uns wieder vornehmen im Wer ist dafür verantwortlich? Bis wann soll das erledigt sein? (Monat und Jahr) © Qualitäts-Selbstcheck für die Kinder- und Jugendarbeit im Erzbistum Berlin 3. Methoden zur Entscheidungsfindung Punktwahlmethode5 Stärke der Methode: Geringer Zeitaufwand, Visualisierung der Wünsche und Meinungen Zeitdauer: Bei 10 Leuten ca. 10 min. Vorgehensweise: Jede beteiligte Person hat eine bestimmte Anzahl von Klebepunkten zu vergeben, alternativ: einen Edding zum Punkte Malen. Auf einem Plakat werden die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten aufgeschrieben, jede Person vergibt ihre Punkte durch Aufkleben bzw. durch Aufmalen auf dem Plakat. Die Punkte werden pro Alternative addiert, eine Rangfolge ist erstellt. Damit man sich nicht zu sehr von den bereits vergebenen Punkten beeinflussen lässt, empfiehlt es sich, erst zu überlegen oder aufzuschreiben, wohin man seine Punkte vergeben möchte. Festzulegen ist vorab, wie viele Punkte eine Person vergeben darf und ob mehrere Punkte auf eine Möglichkeit gesetzt werden dürfen (Empfehlung: Anzahl der Möglichkeiten geteilt durch 2). Für den Selbstcheck sollten nicht alle 29 Qualitätsmerkmale zur Auswahl gestellt werden, sondern nur diejenigen die von einzelnen vorgeschlagen werden. Möglich ist es auch, zunächst das Leitziel zu bestimmen und erst in einem zweiten Durchgang ein bestimmtes Qualitätsmerkmal. Zu beachten: Die Punktwahlmethode ist eine Hilfe zur Festlegung von Prioritäten. Es muss nicht automatisch ein Konsens erzielt werden, es ist auch möglich, dass mehrere Möglichkeiten als gleichwichtig anerkannt werden. Ohne die Festlegung gemeinsamer Kriterien gilt der „individuelle Gustus“. Der eine wünscht die billigste Alternative. Die nächste die, die sich am raschesten erreichen lässt. Der Dritte setzt wieder eine ganz andere Priorität. Zur besseren Vergleichbarkeit könnt ihr euch auf ein bestimmtes Bewertungskriterium verständigen, z. B.: „Wo haben wir derzeit die größten Probleme?“ „Womit haben wir uns lange nicht beschäftigt?“ „Was ist mir persönlich am wichtigsten?“ „Wo erreichen wir die meisten Jugendlichen?“ Konsensfindung6 Stärke der Methode: Wenn eine Gruppe vollständig hinter einer Entscheidung stehen soll. Zeitdauer: Pro Entscheidungsphase max. 10 min. 5 6 Vgl. u.a. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: QS 28 Leitfaden für Qualitätsbeauftragte, Bonn 2000, S. 59. QS 28, S. 58. 16 Vorgehensweise: Es werden Zweiergruppen gebildet, die jeweils einen Konsens zu einer bestimmten Fragestellung erzielen sollen. Fragestellungen für die Auswahl beim Selbstcheck könnten sein: „Welche fünf Qualitätsmerkmale sind für die Zukunft unserer Gruppe am wichtigsten?“ „Von welchem Leitziel sind wir am weitesten entfernt?“ „Bei welchen drei Themen hättest du bzw. hättet ihr als Kleingruppe die größte Motivation, Verantwortung zu übernehmen?“ Dann finden jeweils zwei Zweiergruppen zusammen und wiederholen die Konsensfindung (und so weiter bis zu Achter- oder Sechzehnergruppen). Wichtig: In keiner Phase darf jemand überstimmt werden. Zu beachten: Extreme Alternativen scheiden in der Regel aus. Somit sind sehr kreative Lösungen selten. Paarweiser Vergleich7 Stärke der Methode: Sie gilt als die genaueste Bewertungsmethode und bietet den großen Vorteil, dass hier der Vergleich einer jeden Alternative unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien mit den übrigen möglich ist. Zeitdauer: Bei 10 Leuten ca. 15 min. Vorgehensweise: Der Vergleich ausgewählter Qualitätsmerkmale oder der Leitziele geschieht mit Hilfe einer Matrix (s. Kopievorlage bzw. Download) nach einem von euch bestimmten Kriterium. Solche Kriterien könnten sein: „Wo haben wir derzeit die größten Probleme?“ „Womit haben wir uns lange nicht beschäftigt?“ „Was ist mir persönlich am wichtigsten?“ „Wo erreichen wir die meisten Jugendlichen?“ Die Alternativen werden direkt miteinander verglichen, die Bewertungen in die Matrix eingetragen: 2 Punkte entsprechen „mehr als“ 0 Punkte entsprechen „weniger als“ 1 Punkt entspricht „gleich“ Die Punkte werden in die waagerechten Zeilen eingetragen. Wenn alle Alternativen miteinander verglichen sind, wird die Summe waagerecht ermittelt. Das Qualitätsmerkmal oder das Leitziel mit den meisten Punkten wird für den Selbstcheck favorisiert. Es entstehen differenziert begründete Rangfolgen. Einzelergebnisse oder die Ergebnisse von Kleingruppen müssen anschließend addiert werden. 7 Ebd. S. 60 17 Portfolio8 Stärke der Methode: Es können mehrere Positionen gewichtet werden. Zeitdauer: Ca. 10 min für Einzelarbeit, anschließender Entscheidungsprozess je nach Größe der Gruppe. Vorgehensweise: Zwei Achsen werden mit den Entscheidungskriterien „inhaltliche Bedeutung“ und „Bedeutung für unsere Gruppe/Ebene“ benannt. Dadurch entsteht ein Achsenfeld mit vier Quadraten, die unterschiedliche Gewichtungen bekommen (s. Kopievorlage): I. Mir ist wichtig, dass sich unsere Gruppe damit beschäftigt II. Das Thema ist interessant, passt aber nicht auf unsere Gruppe/Ebene III. Damit könnten wir uns zu einem späteren Zeitpunkt beschäftigen IV. Für dieses Thema sehe ich keinen Handlungsbedarf Jetzt können alle oder die von Einzelnen bereits vorgeschlagenen Qualitätsmerkmale in die Quadrate eingetragen oder genau positioniert werden. Dies kann eine kleine Gruppe gemeinsam tun, ansonsten empfehlen sich Kleingruppen und eine anschließende Abstimmung im Plenum. Zu beachten: Ein Nachteil ist die geringe Genauigkeit bei der Bestimmung der Gewichtung. Bei größeren Gruppen dient die Methode eher der Vorauswahl, da sich ein weiterer Einigungs- oder Abstimmungsprozess im Plenum anschließen kann (z. B. per Punktwahlmehode). 8 QS 28, S. 61. 18 Paarweiser Vergleich Alternat Alternat Alternat Alternat Alternat Alternat Summe ive 1 ive 2 ive 3 ive 4 ive 5 ive 6 Rang Alternat ive 1 Alternat ive 2 Alternat ive 3 Alternat ive 4 Alternat ive 5 Alternat ive 6 © Qualitäts-Selbstcheck für die Kinder- und Jugendarbeit im Erzbistum Berlin Portfolio Inhaltliche Bedeutung Das Thema ist interessant, passt aber nicht auf unsere Gruppe/Ebene Mir ist wichtig, dass sich unsere Gruppe damit beschäftigt Für dieses Thema sehe ich keinen Handlungsbeda rf Damit könnten wir uns zu einem späteren Zeitpunkt beschäftigen Bedeutung für die Gruppe/Ebene © Qualitäts-Selbstcheck für die Kinder- und Jugendarbeit im Erzbistum Berlin 4. Qualitäts-Selbstcheck: Die Fragebögen Übersicht: Leitziel: Identitätsentwicklung Qualitätsmerkmal Wertschätzung Qualitätsmerkmal Werteorientierung Qualitätsmerkmal Ganzheitlichkeit Qualitätsmerkmal Geschlechtsidentität Qualitätsmerkmal Lebensentwürfe Qualitätsmerkmal Konfliktfähigkeit und Krisenbewältigung Leitziel: Entwicklung von Spiritualität Qualitätsmerkmal Lebensreflexion Qualitätsmerkmal Glauben erfahren, leben und feiern Qualitätsmerkmal Reichtum an Ausdrucksmöglichkeiten Qualitätsmerkmal Prophetisches Wirken Leitziel: Entwicklung von Partizipation und Selbstbestimmung Qualitätsmerkmal Förderung und Respektierung von Selbstorganisation Qualitätsmerkmal Lebenswelt- und Bedürfnisorientierung Qualitätsmerkmal Demokratische Strukturen und Interessenvertretung Qualitätsmerkmal Qualifizierung und Unterstützung Ehrenamtlicher Qualitätsmerkmal Verbindung von Kinder- und Jugendarbeit Qualitätsmerkmal Jugendräume Leitziel: Entwicklung von gelingenden Beziehungen und Gemeinschaft Qualitätsmerkmal Begegnungen Qualitätsmerkmal Gruppenarbeit Qualitätsmerkmal Teamarbeit Qualitätsmerkmal Offene Angebote Qualitätsmerkmal Ökumene Leitziel: Anregung und Hinführung zu sozialem und politischem Engagement Qualitätsmerkmal Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung Qualitätsmerkmal Lebensweltorientierte Anknüpfungspunkte Qualitätsmerkmal Gender Mainstreaming Qualitätsmerkmal Gleiche Chancen und Bedingungen junger Menschen Qualitätsmerkmal Konkretes Mitwirken in der Jugend- und Kirchenpolitik Leitziel: Personalentwicklung Qualitätsmerkmal Personalentwicklung Ehrenamtlicher Qualitätsmerkmal Personalentwicklung beruflicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Qualitätsmerkmal Zusammenarbeit zwischen ehrenamtlichen und beruflichen pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kinder- und Jugendarbeit 21 Leitziel Identitätsentwicklung Qualitätsmerkmal Wertschätzung Beschreibung Zielgruppe Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit erhebt kirchliche Bindung nicht zum Maßstab, sondern öffnet sich allen jungen Menschen als Ebenbildern Gottes gleich welcher Herkunft und Lebenssituation. Sie unterstützt Kinder und Jugendliche v. a. durch Begegnungen und Gemeinschaftserfahrungen dabei, Zutrauen und Selbstvertrauen zu entwickeln sowie ihre unterschiedlichen Bedürfnisse zu erkennen, ihre Fähigkeiten zu nutzen und auszubauen und Energien einzuteilen. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Gruppe oder Ebene sich eure Antworten beziehen sollen (gesamter Verband, einzelne Gruppe, ganze Pfarrjugend, GruppenleiterInnenrunde...) Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Wertschätzung 1. Herkunft oder Lebenssituation sind keine Hindernisse, bei uns mitzumachen: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft zu Trifft zu einladend selbstverständlich Trifft eher zu 2. Neue kommen in unsere Gruppen und bleiben auch: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu 3. Von Außen betrachtet ist der Umgangston in unserer Gruppe: Ausgrenzend Befremdlich Ganz normal 4. Persönliche Interessen werden bei uns ernst genommen: Niemals Halbherzig Wenn’s passt 5. Unkonventionellen oder „verrückten“ Ideen wird Offenheit entgegengebracht: Niemals Halbherzig Wenn’s passt selbstverständlich 6. Über den Umfang unseres Engagements können wir selber bestimmen: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu Ausdrücklich 7. Unser Engagement wird geschätzt und gewürdigt: Gar nicht Auf Nachfrage ausreichend 22 Leitziel Identitätsentwicklung Qualitätsmerkmal Werteorientierung Beschreibung Zielgruppe Den Fragen von Kindern und Jugendlichen nach Sinn und Orientierung, nach gelingendem Leben in Verantwortung räumt kirchliche Kinder- und Jugendarbeit breiten Raum ein. Sie tritt in die Verständigung über unterschiedliche Wertevorstellungen ein und bringt die mit dem Reich Gottes verbundenen Werte wie Freiheit und Verantwortung, Frieden und Gerechtigkeit, Solidarität und Versöhnung, Nachhaltigkeit und Bewahrung der Schöpfung deutlich zum Ausdruck. Sie will junge Menschen zur Nachfolge Jesu gewinnen, respektiert aber auch andere mögliche Entscheidungen. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Gruppe oder Ebene sich eure Antworten beziehen sollen (gesamter Verband, einzelne Gruppe, ganze Pfarrjugend, GruppenleiterInnenrunde...) Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Werteorientierung 1. Bei uns gibt es jemanden, dem wir uns bei persönlichen Fragen anvertrauen können: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 2. Bei uns kann offen über unterschiedliche Wertvorstellungen gesprochen werden: Nie Selten Manchmal Häufig 3. Bringt jemand bei euch die Perspektive des Evangeliums in Wertfragen zur Sprache? Nie Selten Manchmal Häufig selbstverständlich 4. Spielt das Evangelium bei euch ausdrücklich eine Rolle? Niemals Halbherzig Wenn’s passt 5. Bei uns fühlen sich auch Jugendliche aufgenommen, die sonst nichts mit Kirche zu tun haben: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu 23 Trifft zu Leitziel Identitätsentwicklung Qualitätsmerkmal Ganzheitlichkeit Beschreibung Zielgruppe Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit nimmt den ganzen Menschen in den Blick und eröffnet Erfahrungs- und Erlebnisräume, in denen sich Identität im Zusammenwirken von Verstehen, Empfinden und Handeln entfalten kann. Durch dieses ganzheitliche Lernen werden alle Sinne angesprochen und Wahrnehmungs-, Ausdrucks- und Gestaltungsfähigkeit gleichermaßen gefördert. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Gruppe oder Ebene sich eure Antworten beziehen sollen (gesamter Verband, einzelne Gruppe, ganze Pfarrjugend, GruppenleiterInnenrunde...) Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Ganzheitlichkeit 1. Beim Programm unserer Gruppe/an unserem Jugendabend ist das Verhältnis von Kopf, Herz und Hand (Wissen, Fühlen, Handeln) ausgewogen: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 2. Beim Programm unserer Wochenendveranstaltungen und Fahrten ist das Verhältnis von Kopf, Herz und Hand (Wissen, Fühlen, Handeln) ausgewogen: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 3. Bei unseren Gottesdiensten ist das Verhältnis von Kopf, Herz und Hand (Wissen, Fühlen, Handeln) ausgewogen: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 4. Wir achten auch bei unseren Sitzungen darauf, dass sie nicht zu kopflastig sind: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu 24 Trifft zu Leitziel Identitätsentwicklung Qualitätsmerkmal Geschlechtsidentität Beschreibung Zielgruppe Geschlechtsbezogene Angebote der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit unterstützen die Entwicklung der Geschlechtsidentität und gegenseitige Akzeptanz. Geschlechtsidentität umfasst das Wahrnehmen und die Akzeptanz des eigenen biologischen Geschlechts und die Ausgestaltung der sozialen Geschlechterrolle. Die Auseinandersetzung Jugendlicher mit ihrer sexuellen Orientierung und den Fragen zu Heterosexualität und Homosexualität nimmt kirchliche Jugendarbeit ernst und begleitet sie. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Gruppe oder Ebene sich eure Antworten beziehen sollen (gesamter Verband, einzelne Gruppe, ganze Pfarrjugend, GruppenleiterInnenrunde...) Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Geschlechtsidentität 1. Geschlechtsspezifische Interessen und Sichtweisen von Mädchen und Jungen bzw. jungen Frauen und Männern finden bei uns Beachtung: Selten Manchmal Oft (fast) immer 2. Wir fördern, dass sich Jungen und Mädchen bzw. junge Männer und Frauen gleichstark einbringen können: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 3. Wir setzen bewusst geschlechtsspezifische Kleingruppen in unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ein: Selten Manchmal Oft Regelmäßig Regelmäßig 4. Das Thema Sexualität und Partnerschaft greifen wir auf: Selten Manchmal Oft 5. Die Auseinandersetzung von Jugendlichen mit ihrer sexuellen Orientierung wird bei uns ernstgenommen und begleitet: Trifft nicht zu Trifft eher nicht Trifft eher zu Trifft zu 6. Diskriminierungen zwischen Jungen und Mädchen bzw. jungen Männern und Frauen kommen bei uns vor: Gezielt Unbewusst Nie 7. Berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch in Fragen von Sexualität authentische GesprächspartnerInnen: Trifft nicht zu Trifft eher nicht Trifft eher zu 25 Trifft zu Leitziel Identitätsentwicklung 8. Das Verhältnis von Mädchen/jungen Frauen und Jungen/jungen Männern in Leitungsteams ist bei uns: Einseitig ausgeglichen 9. Mit kirchlichen Aussagen zu Sexualität setzen wir uns auseinander: Nie Oberflächlich Informierend 26 Intensiv Leitziel Identitätsentwicklung Qualitätsmerkmal Lebensentwürfe Beschreibung Zielgruppe Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit versteht sich als Alternative zu leistungs- und konsumorientierten Lebensentwürfen, die das Evangelium als Orientierungsmöglichkeit vorlebt und erfahrbar werden lässt. Sie befähigt junge Menschen dazu, eine eigene reflektierte Lebensweise zu entwickeln, die gesellschaftlich jeweils aktuellen Lebensentwürfe kritisch zu hinterfragen, nach Alternativen zu suchen und neue Handlungsmuster für sich selber zu entdecken. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Gruppe oder Ebene sich eure Antworten beziehen sollen (gesamter Verband, einzelne Gruppe, ganze Pfarrjugend, GruppenleiterInnenrunde...) Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Lebensentwürfe 1. Bei uns gibt es Anregungen, die eigene Lebensweise kritisch zu hinterfragen: Gar nicht Auf Nachfrage ausreichend Ausdrücklich 2. Bei uns kommt das Evangelium als Orientierungshilfe für den persönlichen Lebensweg zur Sprache: Nie Selten Manchmal Häufig Trifft zu 3. Unsere Gemeinschaft hilft uns, das eigene Leben zu reflektieren: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu 27 Leitziel Identitätsentwicklung Qualitätsmerkmal Konfliktfähigkeit und Krisenbewältigung Beschreibung Zielgruppe Eine Atmosphäre, in der Konflikte offen und ehrlich miteinander austragen werden können und konstruktive Formen der Konfliktbewältigung tragen in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit zur Konfliktfähigkeit junger Menschen bei. In Krisensituationen wie z. B. Trennung der Eltern, Zerbrechen der eigenen Partnerschaft, Krankheit oder Tod, Erfolglosigkeit in Schule oder Ausbildung bietet kirchliche Kinder- und Jugendarbeit Raum für Hilfe und Bewältigung dieser Erfahrungen durch Gespräch und Trauerarbeit. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Gruppe oder Ebene sich eure Antworten beziehen sollen (gesamter Verband, einzelne Gruppe, ganze Pfarrjugend, GruppenleiterInnenrunde...) Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Konfliktfähigkeit und Krisenbewältigung 1. Bei uns werden unterschiedliche Anliegen und Wahrnehmungen ernst genommen: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 2. Wir legen selbst Regeln für den Umgang und die Kommunikation untereinander fest: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 3. Konflikte werden... Nicht gesehen den Tisch Unter gekehrt Nur angesprochen, wenn’s unausweichlich ist Offen angesprochen 4. Wir nehmen uns Zeit, Konflikte zu lösen: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 5. Meinungsverschiedenheiten werden folgendermaßen gelöst: Durch Durch Durch Aussitzen Einvernehmlich Machtverhältnisse Mehrheitsverhältnisse oder körperliche Gewalt 6. Sensibilität für persönliche Misserfolge und Krisen ist vorhanden: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu 28 Trifft zu Leitziel Identitätsentwicklung 7. Bei uns gibt es jemanden, mit dem wir vertrauensvoll über persönliche Misserfolge oder Krisen sprechen können: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu 29 Trifft zu Leitziel Entwicklung von Spiritualität Qualitätsmerkmal Lebensreflexion Beschreibung Zielgruppe Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit ermöglicht eine konstruktive und kritische Lebensreflexion, indem sie Mädchen und Jungen, junge Frauen und Männer befähigt, ihre Erfahrungen des Alltags, Aspekte ihrer Lebenssituation und Lebensgeschichte mit Blick des Glaubens zur Sprache zu bringen und gemeinsam Antworten darauf aus dem Glauben heraus zu suchen. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Gruppe oder Ebene sich eure Antworten beziehen sollen (gesamter Verband, einzelne Gruppe, ganze Pfarrjugend, GruppenleiterInnenrunde...) Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Lebensreflexion 1. Wird Gott in eurer Gruppenarbeit oder bei euren Treffen erfahrbar? Nie Manchmal Häufig Durchgängig 2. Bei uns gibt es jemanden, dem wir uns in persönlichen Gesprächen anvertrauen können: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 3. Kommen die eigenen Lebenssituationen und Lebensgeschichten bei euch zur Sprache? Niemals Halbherzig Wenn’s passt selbstverständlich 4. Bringt jemand bei uns die Perspektive des Evangeliums in Lebensfragen zur Sprache? Nie Selten Manchmal Häufig 5. Ermutigt ihr euch gegenseitig, das eigene Leben aus dem Glauben heraus zu deuten? Niemals Halbherzig Wenn’s passt 30 selbstverständlich Leitziel Entwicklung von Spiritualität Qualitätsmerkmal Glauben erfahren, leben und feiern Beschreibung Zielgruppe Tipp In der Auseinandersetzung mit Lebens- und Glaubenserfahrungen, mit Hoffnungen, Freude, Sprachlosigkeit, Zweifeln und Ängsten, durch Austausch und Gruppenerleben, durch Gebet, Sakramente und Gottesdienst verhilft kirchliche Kinder- und Jugendarbeit jungen Menschen, selbst in die Beziehung und in Begegnung mit Gott zu treten. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Gruppe oder Ebene sich eure Antworten beziehen sollen (gesamter Verband, einzelne Gruppe, ganze Pfarrjugend, GruppenleiterInnenrunde...) Wir empfehlen euch, die Umsetzung dieses Qualitätsmerkmals zusammen mit dem Qualitätsmerkmal „Reichtum an Ausdrucksmöglichkeiten“ zu überprüfen und bei unbefriedigenden Ergebnissen Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen und Umsetzungsschritte zu verabreden. Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Glauben erfahren, leben und feiern 1. Wir erfahren unsere Gruppe als einen intensiven spirituellen Ort? Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 2. Wenn wir mehr als einen Tag gemeinsam verbringen, feiern wir auch einen Gottesdienst: Niemals Halbherzig Wenn’s passt selbstverständlich 3. Bei uns gibt es RKW’s oder Kinderfahrten mit religiösen Elementen: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu Herausforderung 4. Die Beschäftigung mit biblischen Texten erleben wir als: Zwang Pflicht Bereicherung 31 Leitziel Entwicklung von Spiritualität Qualitätsmerkmal Reichtum an Ausdrucksmöglichkeiten Beschreibung Zielgruppe Tipp Kinder und Jugendliche werden in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit einerseits unterstützt, in eine geprägte Praxis von kirchlichem Leben, Liturgie und gesellschaftspolitischem Engagement hineinzuwachsen, andererseits aber auch immer wieder neue Formen zu suchen und zu finden, sich dem Geheimnis Gottes zu nähern. Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit leistet damit einen visionären und experimentellen Beitrag zu einer sich ständig erneuernden, von allen mitgestalteten Kirche, die in die Gesellschaft hineinwirkt. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Gruppe oder Ebene sich eure Antworten beziehen sollen (gesamter Verband, einzelne Gruppe, ganze Pfarrjugend, GruppenleiterInnenrunde...) Wir empfehlen euch, die Umsetzung dieses Qualitätsmerkmals zusammen mit dem Qualitätsmerkmal „Glauben erfahren, leben und feiern“ zu überprüfen und bei unbefriedigenden Ergebnissen Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen und Umsetzungsschritte zu verabreden. Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Reichtum an Ausdrucksmöglichkeiten 1. Bei uns fühlen sich Kinder im Sonntagsgottesdienst angesprochen: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu Wöchentlich 2. Gibt es bei euch spezielle Kindergottesdienste? Nie Sporadisch Mind. monatlich 3. Bei uns fühlen sich Jugendliche im Sonntagsgottesdienst angesprochen: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu Wöchentlich 4. Gibt es bei euch spezielle Jugendgottesdienste? Nie Sporadisch Mind. monatlich 5. Bei uns gibt es für Jugendliche auch andere Gottesdienstformen als Eucharistiefeier: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 6. Gibt es einen Kinderliturgiekreis bzw. Leute, die Kindergottesdienste vorbereiten? Nein In Planung Ja 7. Wir bereiten Gottesdienste selber vor: 32 Leitziel Entwicklung von Spiritualität Niemals Halbherzig Wenn’s passt selbstverständlich 8. Werden Kinder oder Jugendliche zum fantasievollen Spiel mit Liturgie ermutigt? Bewusst nicht Eigentlich nicht Hin und wieder Ausdrücklich 9. Bei uns kommt der persönliche Glaube auch über den Gottesdienst hinaus zur Sprache: Niemals Halbherzig Wenn’s passt 33 selbstverständlich Leitziel Entwicklung von Spiritualität Qualitätsmerkmal Prophetisches Wirken Beschreibung Zielgruppe Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit berücksichtigt, dass sich Gott in vielfältiger Art und Weise vermittelt, offenbart und entdecken lässt und nimmt Kinder und Jugendliche mit ihrer Sprache, ihren Bildern und Ausdrucksmöglichkeiten für ihre eigene Spiritualität ernst. Damit Mädchen und Jungen, junge Frauen und Männer Glaubenserfahrungen machen und Ausdrucksformen für ihren Glauben aus der Begegnung mit dem Evangelium in der Kirche entwickeln können, fördert sie die Entwicklung und Praxis verschiedenster Formen, Glauben und Leben zu feiern. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Gruppe oder Ebene sich eure Antworten beziehen sollen (gesamter Verband, einzelne Gruppe, ganze Pfarrjugend, GruppenleiterInnenrunde...) Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Prophetisches Wirken 1. In unserer Umgebung ist bekannt, dass es uns gibt: In der Pfarrgemeinde Im Kiez Gar nicht In unserem Bezirk/Landkreis 2. Leistet ihr mit der Kinder- und Jugendarbeit einen Beitrag für eine bessere Gesellschaft? Einen ausbaufähigen Einen einzigartigen Einen Keinen auswechselbaren 3. Welche Rolle spielen Kinder und Jugendliche in eurer Gemeinde/Schule? Gehören einfach Motor der Gar keinen Lückenbüßer dazu Verbesserung 4. Hat eure Kinder- und Jugendarbeit eine Vision? Ja, aber nicht Nein Unbewusst veröffentlicht Veröffentlicht 5. Werden Wege zum Geheimnis Gottes gesucht? In modernen Formen In ausgetretenen Nein Pfaden In mutigen Experimenten 6. Wer sagt den Satz „Wir haben einen Traum von Veränderung“ am ehesten? 34 Leitziel Entwicklung von Spiritualität Niemand Andere Wir selber 35 Leitziel Entwicklung von Partizipation und Selbstbestimmung Qualitätsmerkmal Förderung und Respektierung von Selbstorganisation Beschreibung Zielgruppe Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit bietet in ihren Strukturen und Angeboten Lern- und Erlebnismöglichkeiten von Selbstorganisation und Beteiligung junger Menschen an Entscheidungsund Gestaltungsprozessen in Kirche und Gesellschaft. Primär werden Formen und Angebote mit Kindern und Jugendlichen und erst sekundär für Kinder und Jugendliche entwickelt. Entsprechend werden Strukturen, in denen sich Kinder und Jugendliche selbst organisieren und unabhängig von hauptberuflicher Leitung ihre Kinder- und Jugendarbeit gestalten und bestimmen, vorrangig begleitet und unterstützt. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Gruppe oder Ebene sich eure Antworten beziehen sollen (gesamter Verband, einzelne Gruppe, ganze Pfarrjugend, GruppenleiterInnenrunde...) Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Förderung und Respektierung von Selbstorganisation 1. Selbstorganisierte Kinder- und Jugendarbeit wird von den Verantwortlichen unserer Gemeinde/ Schule/ Dekanat: Verboten Geduldet Akzeptiert Gefördert 2. Wer bestimmt bei euch, wo es lang geht? Wir nicht selber Ist nicht geklärt Gewählte Jugendleitung 3. Bei uns haben die ehrenamtliche Leitung und die beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter miteinander geklärt, welche Stellung die beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der selbstorganisierten Jugendarbeit innehaben: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 4. Es gibt bei den Ehrenamtlichen eine Verständigung darüber, für welche Bereiche sie im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit Verantwortung übernehmen: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 5. Wir sind Initiatorinnen und Initiatoren von Aktionen und Veranstaltungen und setzen nicht bloß Ideen oder Vorgaben anderer um: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu 36 Trifft zu Leitziel Entwicklung von Partizipation und Selbstbestimmung 6. Auch bei Personalwechsel der für Kinder- und Jugendarbeit Zuständigen (PastoralreferentIn, GemeindereferentIn, Kaplan...) laufen unsere Angebote für eine Übergangszeit weiter: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu 7. Für unsere Leitungsaufgaben in der Kinder- und Jugendarbeit: Gibt es niemanden Sind wir noch am Finden sich nur alte Suchen Hasen Trifft zu Finden sich immer wieder Neue 8. Bei uns gibt es einen angemessenen Etat für Kinder- und Jugendarbeit: Ja plus jährliche Nein Nicht bekannt Ja Kollekte 9. Unsere Leitungsrunde entscheidet selbständig über die Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel für die Kinder- und Jugendarbeit: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 10. Wie werden Konflikte mit beruflichen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern bei euch gelöst? Durch Ausstieg oder Mit Beratung von Partnerschaftlich Reglementierung von Außen „oben“ 11. Berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren über Angebote und Strukturen von Jugendverbänden und ermöglichen Kontakte: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 12. Wir beteiligen uns an Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen auch über die Organisation von Kinder- und Jugendarbeit hinaus: Selten Manchmal Oft 37 (fast) immer Leitziel Entwicklung von Partizipation und Selbstbestimmung Qualitätsmerkmal Lebenswelt- und Bedürfnisorientierung Beschreibung Zielgruppe Methoden und Angebote in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit orientieren sich an der Lebenswelt und den Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppe. Sofern die Angebote nicht schon durch junge Menschen selber entwickelt und organisiert werden, gewährleistet kirchliche Kinder- und Jugendarbeit die mitbestimmende Einbindung von Kindern und Jugendlichen in die konzeptionelle und praktische Ausgestaltung von Angeboten. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Gruppe oder Ebene sich eure Antworten beziehen sollen (gesamter Verband, einzelne Gruppe, ganze Pfarrjugend, GruppenleiterInnenrunde...) Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Lebenswelt- und Bedürfnisorientierung 1. Den Kindern und Jugendlichen in unserer Umgebung ist bekannt, dass es uns gibt: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 2. Meint ihr, euer regionales Umfeld profitiert von euren Angeboten und Aktivitäten: Nein Eher nicht Eher ja Ja richtungsweisend 3. Die Wünsche unserer Mitglieder sind für unsere Arbeit: Egal Nicht bekannt Wichtig 4. Unsere (Bildungs)Angebote gestalten wir nach unseren Interessen und Ausdrucksweisen: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu 38 Trifft zu Leitziel Entwicklung von Partizipation und Selbstbestimmung Qualitätsmerkmal Demokratische Strukturen und Interessenvertretung Beschreibung Zielgruppe Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit organisiert sich innerhalb demokratischer Strukturen und befähigt junge Menschen zur Teilhabe daran. Sie fördert und unterstützt Mädchen und Jungen, junge Frauen und Männer, ihre Interessen zu entdecken, zu formulieren und in Kirche, Politik und Gesellschaft zu vertreten. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Gruppe oder Ebene sich eure Antworten beziehen sollen (gesamter Verband, Leitungsteam, ganze Pfarrjugend, GruppenleiterInnenrunde...) Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Demokratische Strukturen und Interessenvertretung 1. Bei uns gibt es eine gewählte Jugendleitung: Nein Ist geplant Ja 2. Bei uns gibt es demokratische Regeln, die in einer Satzung oder Ordnung schriftlich festgehalten sind: Nein Ist geplant Ja 3. Die Gremien, die wir uns gegeben haben, funktionieren gut: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 4. Bei uns gibt es für Kinder Beteiligungsverfahren und Mitbestimmungsformen: Über berufliche Nein Über die Jugend Direkt MitarbeiterIn 5. Wir verständigen uns auf gemeinsame inhaltliche Positionen und vertreten diese gegenüber Dritten (in der Kirche, im Kiez, in einem Amt, in der Politik): Nie oder selten Ist geplant Manchmal Häufig Regelmäßig 6. Unsere inhaltlichen Positionen machen wir öffentlich: Nie oder Selten Manchmal Häufig 7. Wir bemühen uns um Kontakte oder Gespräche mit Verantwortlichen aus der Kinderund Jugendpolitik: Nie oder Selten Manchmal Häufig 39 Regelmäßig 40 Leitziel Entwicklung von Partizipation und Selbstbestimmung Qualitätsmerkmal Qualifizierung und Unterstützung Ehrenamtlicher Beschreibung Zielgruppe Ehrenamtliche Leitungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit qualifizieren sich für ihre pädagogische, politische und pastorale Tätigkeit durch die Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie durch Mitgestaltung und Übernahme von Verantwortung. Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit schafft die Voraussetzungen, dass Ehrenamtliche motiviert, qualifiziert und persönlich befriedigend Verantwortung wahrnehmen können. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Ebene sich eure Antworten beziehen sollen (gesamter Verband, ganze Pfarrjugend, ganzes Dekanat, Stamm, Ortsgemeinschaft...) Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Qualifizierung und Unterstützung Ehrenamtlicher 1. Wer bei uns für eine Gruppe oder eine Fahrt Verantwortung übernimmt, hat eine JuleiCa: Unter 25% 25-50% 50-75% Über 75% 2. Wir führen selber JuleiCa-Schulungen durch bzw. kooperieren dabei mit einem BDKJ Mitglieds- oder Dekanatsverband: Stimmt nicht Ist geplant Alle zwei Jahre 3. Bei uns werden die Kosten für JuleiCa-Schulungen und Fortbildungen durch die Gemeinde/das Dekanat übernommen: Der überwiegende Trifft nicht zu Ein kleiner Teil Trifft komplett zu Teil Jährlich 4. Bei uns gibt es jemanden, der Ehrenamtliche bei der Vor- und Nachbereitung von Gruppenstunden, Reisen, Projekten u.ä. unterstützt: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 5. Durch berufliche Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter in unserer Gemeinde/unserem Verband/Dekanat (GemeindereferentIn, PastoralreferentIn, Kaplan, Pfarrer, ...) fühlen wir uns geistlich begleitet: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 6. Bei kritischen Anfragen von Außen erhalten Ehrenamtliche Rückendeckung: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu 41 Trifft zu Leitziel Entwicklung von Partizipation und Selbstbestimmung 7. Die technischen Geräte und Dienstfahrzeuge vor Ort können wir unkompliziert nutzen: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu Trifft zu 8. Auslagen für die Kinder- und Jugendarbeit werden erstattet: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu 42 Leitziel Entwicklung von Partizipation und Selbstbestimmung Qualitätsmerkmal Verbindung von Kinder- und Jugendarbeit Beschreibung Zielgruppe Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit sind keine zwei getrennten Bereiche, sondern konzeptionell, strukturell und personell eng miteinander verbunden. Die Verbindung zwischen der Arbeit mit Kindern und der Arbeit mit Jugendlichen bietet Kontinuität, gegenseitige Befruchtung und Entlastung und die Möglichkeit für Jugendliche, die Übernahme zunehmender Verantwortung zu erlernen. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Ebene sich eure Antworten beziehen sollen (gesamter Verband, ganze Pfarrjugend, ganzes Dekanat, Stamm, Ortsgemeinschaft...) Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Verbindung von Kinder- und Jugendarbeit 1. Kindergruppen werden von Jugendlichen selbständig geleitet: Trifft nicht zu Ausnahmsweise Überwiegend Trifft zu 2. Bei Veranstaltungen, RKW’s, Reisen und Projekten mit Kindern setzen Jugendliche nicht bloß Ideen und Vorgaben anderer um: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu Trifft zu 3. Gibt es altersübergreifende Angebote für Kinder und Jugendliche? Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu 4. Wir achten darauf, dass es für die Altersgruppe der 13-15jährigen keinen Abbruch von Angeboten gibt: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu 43 Trifft zu Leitziel Entwicklung von Partizipation und Selbstbestimmung Qualitätsmerkmal Jugendräume Beschreibung Zielgruppe Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit bietet Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern Räumlichkeiten als selbstgestaltete Frei- und Experimentierräume. Die verantwortlichen ehrenamtlichen Leiterinnen und Leiter haben eigenständig Zugang zu den Räumen. Auch alle weiteren Gemeinderäume können Kinder und Jugendliche selbstverständlich nutzen. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Ebene sich eure Antworten beziehen sollen (gesamter Verband, ganze Pfarrjugend, ganzes Dekanat, Stamm, Ortsgemeinschaft...) Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Jugendräume 1. Bei uns gibt es Räume für die Kinder- und Jugendarbeit: Räume mit Gar keine Räume Geeignete eingeschränkter Nutzungsmöglichkeit Geeignete und selbstgestaltete 2. Die Zugangsmöglichkeit für verantwortliche Jugendleiterinnen und Jugendleiter zu den Räumen ist: Nur schwer Nur eingeschränkt Problemlos über Eigenständig andere möglich möglich möglich möglich 3. Pfarrsaal, Kirche und andere Gemeinderäume stehen zur Mitnutzung zur Verfügung: Nein Bei Nachdruck Halbherzig 44 selbstverständlich Leitziel Entwicklung von gelingenden Beziehungen und Gemeinschaft Qualitätsmerkmal Begegnungen Beschreibung Zielgruppe Tipp Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit ermöglicht Begegnungen und Gemeinschaftsbildung und schafft dadurch Kontrasterfahrungen zu vielfältigen Vereinzelungen. In den verschiedenen Formen von Gruppenarbeit und offener Arbeit bietet sie Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft und Lebenssituation Begegnungsräume mit einladendem Charakter. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Ebene sich eure Antworten beziehen sollen (gesamter Verband, ganze Pfarrjugend, ganzes Dekanat, Stamm, Ortsgemeinschaft...) Wir empfehlen euch, die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Begegnungen im Zusammenhang mit den Qualitätsmerkmalen „Gruppenarbeit“, „Offene Angebote“ und „Qualifizierung und Unterstützung Ehrenamtlicher“ zu überprüfen und bei unbefriedigenden Ergebnissen Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen und Umsetzungsschritte zu verabreden. Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Begegnungen 1. Uns ist Begegnung wichtig, deswegen gehen wir auf andere zu: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 2. Wenn es jemandem von uns nicht gut geht, nimmt sich jemand anderes von uns Zeit für sie oder ihn: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 3. Wir lassen uns gerne von anderen überraschen oder herausfordern und nehmen neue Ideen auf: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu Trifft zu Trifft zu 4. Neue Leute sind bei uns willkommen und bleiben: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu 5. In unserer Gruppe bleibt es nicht bei Oberflächlichkeiten: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu 45 Leitziel Entwicklung von gelingenden Beziehungen und Gemeinschaft Qualitätsmerkmal Gruppenarbeit Beschreibung Zielgruppe QualitätsSicherung Die Gruppe ist für die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit zentrale Angebotsform, da sich in ihr die Ziele kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit, wie Identitätsentwicklung, Beziehungsfähigkeit, Selbstorganisation sowie soziales und politisches Engagement besonders intensiv verwirklichen lassen. Kinder- und Jugendgruppen werden von qualifizierten ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern geleitet. Diese werden inhaltlich, pädagogisch, spirituell und organisatorisch begleitet und unterstützt durch ehrenamtlich oder beruflich Verantwortliche. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Ebene sich eure Antworten beziehen sollen (gesamter Verband, ganze Pfarrjugend, ganzes Dekanat, Stamm, Ortsgemeinschaft...) Wir empfehlen euch, die Umsetzung des Qualitätsmerkmals „Gruppenarbeit“ im Zusammenhang mit dem Qualitätsmerkmal „Qualifizierung und Unterstützung Ehrenamtlicher“ zu überprüfen und bei unbefriedigenden Ergebnissen Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen und Umsetzungsschritte zu verabreden. Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Gruppenarbeit 1. Bei uns gibt es Kindergruppen oder MinistrantInnengruppen für Kinder, die sich mindestens vierzehntägig treffen: Keine In Planung Einige Viele 2. Wir nutzen die Erstkommunionvorbereitung zur Werbung für den Aufbau neuer bzw. die Verstärkung bestehender Gruppen: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 3. Bei uns gibt es Gruppen, Projektgruppen oder MinistrantInnengruppen für Jugendliche, die mindestens vierzehntägig stattfinden: Keine In Planung Einige Viele 4. Wir nutzen die Firmvorbereitung zur Werbung für den Aufbau neuer bzw. die Verstärkung bestehender Gruppen: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 5. Wer initiiert bei euch Gruppen, Projekt- oder MinistrantInnengruppen? Berufliche Jugendliche mit Hilfe Die Jugendlichen Keiner MitarbeiterInnen von anderen selber alleine 46 Leitziel Entwicklung von gelingenden Beziehungen und Gemeinschaft 6. Kinder-, Jugend- und MinistrantInnengruppen werden bei uns von Jugendlichen selber geleitet: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 7. Wir laden Kinder bzw. Jugendliche, die an einem offenen Angebot teilnehmen, ein in einer bestimmten Gruppe mitzumachen: Trifft zu 8. Gruppenleiterin bzw. Gruppenleiter kann man werden... Ohne bestimmte Nach punktueller Nach einem JuleiCa Voraussetzungen Vorbereitung Grundkurs Nur mit JuleiCa 9. Wer entscheidet bei euch, wer eine Gruppe leiten kann? Wer will, kann Hauptberufliche, Hauptberufliche, machen obwohl es ein wenn es kein Leitungsteam gibt Leitungsteam gibt Leitungsteam Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu 10. Uns stehen für die Vorbereitung von Gruppenstunden ausreichend Bücher und Materialien mit Tipps und Hilfestellungen zur Verfügung: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu 47 Trifft zu Leitziel Entwicklung von gelingenden Beziehungen und Gemeinschaft Qualitätsmerkmal Teamarbeit Beschreibung Zielgruppe Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit sucht verbindliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit, sie fördert und lebt partnerschaftliches, teamorientiertes und solidarisches Miteinander. Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit wird in Teamarbeit gestaltet, in der die Beteiligten sich gegenseitig ernstnehmen und Verantwortung teilen, die unterschiedlichen Rollen und Aufgaben von Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen berücksichtigen, Absprachen und gemeinsame Gespräche nicht nur über Termine, sondern auch über konzeptionelle und inhaltliche Ziele, über spirituelle Fragen und persönliche Motive stattfinden. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welches Team sich eure Antworten beziehen sollen (Vorstand, Dekanatsrunde, GruppenleiterInnenrunde, Pfarrjugendleitung, Projektteam....). Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Teamarbeit 1. Die Leitung besteht aus einem Team: nein ist geplant 2. Wie ist die Gestaltung der Leiterrunden? Nur Just for fun Terminabsprachen Ja Ein inhaltlicher Schwerpunkt Von allem etwas 3. Die Ziele unserer Arbeit werden gemeinsam entwickelt, abgestimmt und reflektiert: selten oder nie manchmal meistens immer immer 4. Mehrheitsentscheidungen werden von allen mitgetragen: selten oder nie manchmal meistens 5. Angebote und Projekte werden von Teams vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet: selten oder nie manchmal meistens immer ja 6. Die Zuständigkeiten und Arbeitsverteilungen haben wir geregelt: nein ist geplant teilweise 7. Der Arbeitsaufwand für die nicht selber übernommenen Aufgaben ist auch allen anderen bekannt: kaum jemand wenige die meisten 48 alle Leitziel Entwicklung von gelingenden Beziehungen und Gemeinschaft 8. Einen Turnus für regelmäßige Treffen haben wir festgelegt: nein ist geplant teilweise ja kontinuierlich alle immer 9. Den Umgang im Team untereinander reflektieren wir: nie nur bei Konflikten manchmal 10. Auf die Teamsitzungen bereiten sich alle vor: kaum jemand wenige die meisten 11. Die Ergebnisse der Teamsitzungen werden protokolliert: selten oder nie manchmal meistens 12. Die im Team getroffenen Vereinbarungen und verteilten Aufgaben setzen wir zuverlässig um: selten oder nie manchmal meistens immer 13. Die Mitglieder im Team sind davon überzeugt, dass die Aufgaben gerecht verteilt sind: kaum jemand wenige die meisten alle meistens immer 14. Die Arbeit im Team macht Spaß: selten oder nie manchmal 49 Leitziel Entwicklung von gelingenden Beziehungen und Gemeinschaft Qualitätsmerkmal Offene Angebote Beschreibung Zielgruppe Jugendtreffs, Einrichtungen der offenen Jugendarbeit, offen ausgeschriebene Ferienreisen, Wochenendseminare und andere Veranstaltungen der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit sprechen auch Kinder und Jugendliche an, die nicht oder nicht regelmäßig an Angeboten der Gemeinden oder Jugendverbände teilnehmen. Kinder und Jugendliche können auf diese Weise sinnvoll ihre Freizeit gestalten, Gruppen Gleichaltriger erleben, altersgemäße Mitgestaltungsund Mitbestimmungsmöglichkeiten erfahren und Ansätze kirchlicher Kinderund Jugendarbeit kennen lernen. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Ebene sich eure Antworten beziehen sollen (gesamter Verband, ganze Pfarrjugend, ganzes Dekanat, Stamm, Ortsgemeinschaft...) Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Offene Angebote 1. Bei uns gibt es für Jugendliche mindestens monatlich ein offenes Treffpunkt-Angebot: Nein In Vorbereitung Sporadisch 2. Wenn jemand Neues zu unserem offenen Treff kommt... gucken alle anderen Nimmt niemand Notiz Wird Interesse sichtbar ganz komisch davon Regelmäßig Geht jemand zur Begrüßung auf ihn oder sie zu 3. Fahrten oder Wochenenden für Kinder, die offen angeboten werden, finden bei uns statt: Gar nicht Ist in Planung Jährlich Mehrmals im Jahr 4. Bei Reisen, Wochenenden u. a. Veranstaltungen nehmen auch Kinder teil, die sonst gar nicht oder nicht regelmäßig bei uns auftauchen: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 5. Fahrten oder Wochenenden für Jugendliche, die offen angeboten werden, finden bei uns statt: Gar nicht Ist in Planung Jährlich Mehrmals im Jahr 6. Bei Reisen, Wochenenden u. a. Veranstaltungen nehmen auch Jugendliche teil, die sonst gar nicht oder nicht regelmäßig bei uns auftauchen: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu 50 Trifft zu Leitziel Entwicklung von gelingenden Beziehungen und Gemeinschaft 7. Wo werbt ihr für eure Angebote? Nur im Pfarrblatt/ Gar nicht Verbandszeitschrift Nur im Dekanat In Schulen und im Kiez 8. Offene Angebote werden auch von beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Pfarrgemeinderat: Verhindert Hingenommen Gewünscht 51 Gefördert Leitziel Entwicklung von gelingenden Beziehungen und Gemeinschaft Qualitätsmerkmal Ökumene Beschreibung Zielgruppe Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit sucht ökumenische Begegnung und ökumenisches Zusammenwirken, um Glauben und Leben in der Gemeinsamkeit und Vielfalt konfessioneller Ausdrucksmöglichkeiten zu feiern und um sich den Herausforderungen auf die gesellschaftlichen und globalen Zukunftsfragen gemeinsam zu stellen. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Ebene sich eure Antworten beziehen sollen (gesamter Verband, ganze Pfarrjugend, ganzes Dekanat, Stamm, Ortsgemeinschaft...) Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Ökumene 1. Gibt es bei euch gemeinsame ökumenische Veranstaltungen und Aktionen? Nie Selten 2. Die benachbarte evangelische Jugend... Ist eine unbekannte Soll es geben Größe Projektbezogen Kontinuierlich Kennen wir gut Ist ein verlässlicher Partner 3. Ein ökumenischer Kinder- oder Jugendgottesdienst findet bei uns statt: Gar nicht Selten 4. Ökumenische Zusammenarbeit ist... Zeitverschwendung Unausweichlich Jährlich Mehrmals im Jahr Eine Chance Eine Bereicherung Regelmäßig 5. Die Leitungsteams verschiedener Konfessionen treffen sich... Nie Hoffentlich bald Projektbezogen 52 Leitziel Anregung und Hinführung zu sozialem und politischem Engagement Qualitätsmerkmal Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung Beschreibung Zielgruppe Vor dem Hintergrund des Evangeliums ermutigt kirchliche Kinder- und Jugendarbeit Mädchen und Jungen, junge Frauen und junge Männer zur Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Verhältnissen auch innerkirchlich. Dabei nimmt sie eine kritische und zur Reform anregende Funktion ein und entwickelt mit jungen Menschen in konkreten Maßnahmen, Angeboten und Aktionen alters- und lebensweltbezogene Möglichkeiten zum Einsatz für eine menschenwürdigere Welt. Sie sucht die Vernetzung mit anderen Gruppen und Organisationen. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Gruppe oder Ebene sich eure Antworten beziehen sollen (gesamter Verband, einzelne Gruppe, ganze Pfarrjugend, GruppenleiterInnenrunde...) Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung 1. Gibt es in eurer Bildungsarbeit Angebote zu den Themen Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung? Zu keinem davon Zu einem davon Zu zweien davon Zu allen dreien 2. Setzt ihr euch öffentlich mit Aktionen zu den Themen Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung ein? Zu keinem davon Ist geplant Zu einem davon Zu mehreren 3. Wir verständigen uns auf gemeinsame inhaltliche Positionen und vertreten diese gegenüber Dritten (in der Kirche, im Kiez, in einem Amt, in der Politik): Nie oder selten Ist geplant Manchmal Häufig 4. Kauft ihr für Veranstaltungen, Wochenenden und Reisen fair gehandelte Produkte? Nie Manchmal Meistens 53 selbstverständlich Leitziel Anregung und Hinführung zu sozialem und politischem Engagement Qualitätsmerkmal Lebensweltorientierte Anknüpfungspunkte Beschreibung Zielgruppe Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit knüpft an Widersprüchen, Ungerechtigkeiten oder positiven Erfahrungen im Erleben junger Menschen an und nimmt die eigene Betroffenheit als Ausgangspunkt sozialen und politischen Handelns. Sie wird unbequem, indem sie strukturelle Gewalt aufzeigt und politisch Verantwortliche mit Ungerechtigkeiten konfrontiert. Über die persönliche Betroffenheit hinaus fördert kirchliche Kinder- und Jugendarbeit globales Denken und Handeln, indem sie für globale Zusammenhänge sensibilisiert, internationale und interkulturelle Begegnungsfelder schafft. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Gruppe oder Ebene sich eure Antworten beziehen sollen (gesamter Verband, einzelne Gruppe, ganze Pfarrjugend, GruppenleiterInnenrunde...) Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Lebensweltorientierte Anknüpfungspunkte 1. Beschäftigen wir uns mit Problemen in sozialen Brennpunkten unseres Einzugsgebietes? Nie Selten Manchmal Häufig 2. Setzt ihr euch öffentlich mit Aktionen für eure Anliegen, die euren Einzugsbereich betreffen, ein? Nie Selten Manchmal Häufig 3. Auseinandersetzungen mit persönlich empfundenen Ungerechtigkeiten finden bei uns statt: In Randgesprächen Nie In Gremien In vielen Gruppen 4. Jugendliche dürfen in der Gemeinde/Schule/im Dekanat: Das tun, was der oder In ihren Bereichen Über ihren Bereich Wenig auffallen die Hauptberuflichen tun, was sie für richtig hinaus unbequem wollen halten 5. Habt ihr Kontakt mit Jugendlichen aus anderen Ländern? In einmaligen Als kontinuierliche Nein (internationalen) Partnerschaft Begegnungen 54 sein und mahnen Leitziel Entwicklung von gelingenden Beziehungen und Gemeinschaft 55 Leitziel Anregung und Hinführung zu sozialem und politischem Engagement Qualitätsmerkmal Gender Mainstreaming Beschreibung Zielgruppe Die biblische Betonung der Gleichwertigkeit von Mann und Frau fordert kirchliche Kinder- und Jugendarbeit heraus, geschlechtsspezifische Benachteiligungen abzubauen. Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit beachtet daher die geschlechtsspezifischen Wirklichkeiten: Sie bedenkt bei allem die unterschiedlichen und gemeinsamen Zugangswege und Auswirkungen für Mädchen und junge Frauen, für Jungen und junge Männer und macht spezifische geschlechtsgetrennte, aber auch geschlechtsbewusste gemeinsame Angebote, um Unterschiedlichkeiten und Gemeinsamkeiten Rechnung zu tragen. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Gruppe oder Ebene sich eure Antworten beziehen sollen (gesamter Verband, einzelne Gruppe, ganze Pfarrjugend, GruppenleiterInnenrunde...) Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Gender Mainstreaming 1. Geschlechtsspezifische Interessen und Sichtweisen von Mädchen und Jungen bzw. jungen Frauen und Männern finden bei uns Beachtung: Selten Manchmal Oft (fast) immer 2. Haben Jungen und Mädchen einen gleichberechtigten Platz bei uns? Ist selbstverständlich Wir haben erste Nein Wir arbeiten dran Erfolge 3. Gibt es bewusst geschlechtsgetrennte oder geschlechtsübergreifende Angebote? Nie Selten Manchmal Regelmäßig Sind ein Novum Sind selbstverständlich 4. Messdienerinnen in der Gemeinde: Gibt es nicht Werden ertragen 5. Kirchliche Aussagen zur Rolle der Frau und zur Rolle des Mannes: Sind nicht bekannt Sind uns im Groben Sind uns inhaltlich Dienen der Auseinandersetzung bekannt bekannt 6. Leitungsfunktionen nehmen wahr: Ausschließlich Sowohl Männer als Männer oder Frauen auch Frauen Männer und Frauen paritätisch 56 Männer und Frauen paritätisch nach Satzung/Ordnung Leitziel Anregung und Hinführung zu sozialem und politischem Engagement 7. Diskriminierungen zwischen Jungen und Mädchen bzw. jungen Männern und Frauen kommen bei uns vor: Gezielt Unbewusst 8. Gender Mainstreaming: Interessiert uns nicht Ist unbekannt Nie Finden wir o.k. 57 Gilt als Richtschnur Leitziel Anregung und Hinführung zu sozialem und politischem Engagement Qualitätsmerkmal Gleiche Chancen und Bedingungen junger Menschen Beschreibung Zielgruppe Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit stellt sich den Herausforderungen von Armut und der Benachteiligung junger Menschen. Sie greift dort ein, wo die Chancen für die Entwicklung einer selbstbestimmten und selbstbewussten Lebenspraxis eingeschränkt werden. Sie trägt mit dazu bei, gesellschaftliche Bedingungen von Chancengleichheit zu schaffen und Benachteiligungen abzubauen. Vorrangiges Ziel ist es dabei, die Betroffenen zur Wahrnehmung ihrer eigenen Interessen anzuregen und zu befähigen. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Gruppe oder Ebene sich eure Antworten beziehen sollen (gesamter Verband, einzelne Gruppe, ganze Pfarrjugend, GruppenleiterInnenrunde...) Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Gleiche Chancen und Bedingungen junger Menschen 1. Kinder und Jugendliche, die nicht fließend deutsch sprechen... haben bei uns keine Werden nicht nach Versuchen wir zu Machen bei uns selb- Chance stverständlich mit Hause geschickt integrieren 2. Kinder und Jugendliche mit Behinderungen kommen... nicht zu uns, weil die zu uns, obwohl die zu uns, weil sie nicht zu uns Räume ungeeignet Räume nicht geeignet willkommen und auch die Räume sind sind behindertengerecht sind 3. Kinder und Jugendliche mit Behinderungen... haben bei uns keine werden nicht nach versuchen wir zu integrieren Chance Hause geschickt machen bei uns selbstverständlich mit 4. Wer Kosten für eine Veranstaltung, Fahrt o.ä. nicht aufbringen kann... taucht auch sonst kann leider nicht wird auf Nachfrage weiß, dass es mitkommen finanziell unterstützt finanzielle nicht bei uns auf Unterstützung gibt 5. Unsere Gruppen und Angebote... schließen Kinder und richten sich einseitig Jugendliche an Kinder und bestimmter Jugendliche eines sprechen Kinder und Jugendliche aller 58 nehmen Kinder und Jugendliche aller Leitziel Anregung und Hinführung zu sozialem und politischem Engagement Schultypen aus Schultyps Schultypen an 59 Schultypen wahr Leitziel Anregung und Hinführung zu sozialem und politischem Engagement Qualitätsmerkmal Konkretes Mitwirken in der Jugend- und Kirchenpolitik Beschreibung Zielgruppe Durch Einbindung und Mitarbeit in Strukturen und Arbeitszusammenhängen von Jugend- und Kirchenpolitik wirkt kirchliche Kinder- und Jugendarbeit an Prozessen der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung mit. Dabei übernehmen Jugendverbände die Rolle der direkten Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen, kirchliche Dienststellen die Funktion der parteiischen Anwaltschaft für junge Menschen. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Ebene sich eure Antworten beziehen sollen (gesamter Verband, ganze Pfarrjugend, ganzes Dekanat, Stamm, Ortsgemeinschaft...) Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Konkretes Mitwirken in der Jugend und Kirchenpolitik 1. Wir verständigen uns auf gemeinsame inhaltliche Positionen und vertreten diese gegenüber Dritten (in der Kirche, im Kiez, in einem Amt, in der Politik): Nie oder selten Ist geplant Manchmal Häufig Regelmäßig 2. Unsere inhaltlichen Positionen machen wir öffentlich: Nie oder Selten Manchmal Häufig 3. Wir bemühen uns um Kontakte oder Gespräche mit Verantwortlichen aus der Kirchen, Kinder- und Jugendpolitik: Nie oder Selten Manchmal Häufig Regelmäßig projektbezogen Kontinuierlich 4. Wir kooperieren mit anderen Einrichtungen: Gar nicht Selten 5. Jugendliche sind im Pfarrgemeinderat: Nicht vertreten Nur als „Berufene“ Als Gewählte und „Berufene“ 6. Im Kirchenvorstand werden Interessen der Kinder und Jugendlichen vertreten: Durch ein Mitglied im Durch jemand von Nein Nachrangig der Jugend Kirchenvorstand Nominierten 60 Leitziel Anregung und Hinführung zu sozialem und politischem Engagement 7. Vertreten wir unsere Interessen im BDKJ-Dekanatsverband/ in der Dekanatsjugendrunde/ im Jugendverband/ auf BDKJ-Diözesanebene? Nie Sporadisch Meistens Kontinuierlich 8. Wir wirken auf Dekanatsebene mit im Jugendring des Bezirks, des Kreises oder der kreisfreien Stadt: Nie Sporadisch Meistens Kontinuierlich 9. Werden Jugendliche für Vertretungsaufgaben vorbereitet? Von Hauptberuflichen Von den Nur durch Gar nicht Fachliteratur VorgängerInnen 10. Vor Wahlen für politische oder kirchliche Aufgaben und Ämter gibt es bei uns... Eine Gar nichts Einen Wahlaufruf Einen Info-Abend Auseinandersetzung mit den KandidatInnen 61 Leitziel Personalentwicklung Qualitätsmerkmal Personalentwicklung Ehrenamtlicher Beschreibung Zielgruppe Tipp Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wesentliche Grundlage kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit. Der Einsatz und die Mitarbeit Ehrenamtlicher bedürfen einer sorgfältigen Planung, Vorbereitung und Begleitung. Dazu gehören eine qualifizierte Ausbildung, Einarbeitung, Reflexion, Fortbildung und eine angemessene Form der Verabschiedung. Vorstände, Leitungen WICHTIG: Vor dem Ankreuzen bei den Indikatoren müsst ihr verabreden, auf welche Leitung, welchen Vorstand sich eure Antworten beziehen sollen (Verbandsleitung, Pfarrjugendleitung...). Wir empfehlen euch, das Qualitätsmerkmal „Personalentwicklung Ehrenamtlicher“ am besten in der Verbindung mit dem Qualitätsmerkmal „Qualifizierung und Unterstützung Ehrenamtlicher“ anhand der Indikatoren zu überprüfen und bei unbefriedigenden Ergebnissen Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen und Umsetzungsschritte zu verabreden. Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Personalentwicklung Ehrenamtlicher 1. Unsere Leitziele sind bei den Ehrenamtlichen, die bei uns mitmachen, anerkannt: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 2. Für die wichtigsten unserer ehrenamtlichen Aufgaben und Funktionen gibt es ein Anforderungsprofil („Wir suchen – wir bieten“): Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 3. Bei uns gibt es Möglichkeiten des Ausprobierens und unverbindlichen Kennenlernens neuer Aufgabenfelder: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 4. In Gesprächen mit Ehrenamtlichen überlegen wir gemeinsam, in welchen Funktionen sie ihre Potentiale voll einbringen können: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 5. Für die gezielte Einarbeitung in neue Aufgaben gibt es eine persönliche Bezugsperson: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 6. Wir reflektieren und tauschen uns aus, ob Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung übereinstimmen (keine Über- oder Unterforderung): Nie oder Selten Manchmal Häufig 62 Regelmäßig Leitziel Personalentwicklung 7. Kritik, Anregungen und Verbesserungsvorschläge von Ehrenamtlichen sind als Bereicherung erwünscht: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu Trifft zu 8. Wir suchen frühzeitig nach Nachfolgerinnen und Nachfolgern: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu 9. Gründe, warum Ehrenamtliche ausscheiden, werden erfragt und reflektiert: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 10. Ausscheidende Ehrenamtliche erhalten einen Tätigkeitsnachweis über ihr Engagement: Nie oder Selten Manchmal Häufig Regelmäßig 11. Für Ehrenamtliche, die bei uns ausscheiden, gibt es eine angemessene Form des Dankes und der Verabschiedung: Nie oder Selten Manchmal Häufig Immer 12. Wir gestalten oder organisieren spezielle Angebote zur Fortbildung von Ehrenamtlichen: Nie oder Selten Manchmal Häufig Regelmäßig Trifft zu 13. Bei uns gibt es ausreichend Kompetenz für folgende Bereiche: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Zutreffende Ziffer bitte in nachfolgende Kästchen schreiben! Liebe, Beziehung, Sexualität und Partnerschaft! – Sensibilisierung, Pädagogik und zielgruppenorientierte Methoden für die Arbeit mit Gruppen Religiöse Elemente in der Gruppenarbeit! – Selbstwahrnehmung, Ideen und mutmachende Ansätze für die Arbeit mit Gruppen Gruppenpädagogik: Konflikte, Methoden und Motivations-Training! – Gruppenanalyse, Leitungsstile und Konflikt-Lösungsmodelle für die Arbeit mit Gruppen Qualifizierung zum politischen Handeln! – Zeitgeschehen, Initiativen und Mutmachen zum Einmischen für die Arbeit mit Gruppen Formenvielfalt in der Liturgie! - Traditionen und Innovationen im liturgischen Bereich für die Arbeit mit Gruppen Krieg und Frieden, Bewahrung der Schöpfung und Eine Welt! Schwerpunktfindung, Projekte und Methoden für die Arbeit mit Gruppen Identitätsfindung von Jungen und Mädchen! – Geschlechtsbezogene Pädagogik, Rollenverhalten und hilfreiche Unterscheidungen für die Arbeit mit Gruppen Gesprächsleitung und Moderation! - Rhetorik, Kommunikation und effektives Sitzungsleiten für die Arbeit mit Gruppen 63 Leitziel Personalentwicklung Einführung in Leitungstätigkeiten auf Pfarr- oder Dekanatsebene 64 Leitziel Personalentwicklung Personalverantwortung Internationale Jugendbegegnung Austausch, Grundinformationen und Weiterbildung für Jugendvertreterinnen und vertreter im Pfarrgemeinderat Qualifizierung und Beratung für Vertreterinnen und Vertreter in Jugendhilfeausschüssen und Jugendringen Ausbildung von Beraterinnen und Beratern für Kriegsdienstverweigerer 65 Leitziel Personalentwicklung Qualitätsmerkmal Personalentwicklung beruflicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Beschreibung Zielgruppe Personaleinsatz und -entwicklung erfordert ein qualifiziertes Personalkonzept. Dazu gehört eine qualifizierte Ausbildung, Personalauswahl, Einarbeitung, fachliche Anbindung und Fortbildung und bietet Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung. Vorstände und Leitungen mit Personalverantwortung für berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Personalentwicklung beruflicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 1. Die Leitziele sind bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anerkannt: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 2. Es existieren aktuelle Stellenbeschreibungen und Anforderungsprofile: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 3. Anforderungsprofile und Leitziele bilden die Grundlage für die Personalauswahl: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 4. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden systematisch eingearbeitet: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 5. Der Vorstand hat sich für seine Arbeitgeberfunktion arbeitsrechtliche und arbeitstechnische Grundkenntnisse angeeignet: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 6. Zwischen Vorstand und Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern gibt es Zielvereinbarungen (konkret formulierte Verabredungen): Nein Ist geplant Ja 7. Der Vorstand führt „Mitarbeitergespräche“, erfragt die Zufriedenheit und gibt Feedback: Nie oder Selten Manchmal Häufig Regelmäßig 8. Wir reflektieren und tauschen uns aus, ob Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung beruflicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übereinstimmen (keine Über- oder Unterforderung): Nie oder Selten Manchmal Häufig 66 Regelmäßig Leitziel Personalentwicklung 9. Wir nutzen bei wichtigen Entscheidungen die Beratung durch berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Nie oder Selten Manchmal Häufig Regelmäßig 10. Wir bemühen uns, Entscheidungen des Vorstands nachvollziehbar zu begründen: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 11. Kritik, Anregungen und Verbesserungsvorschläge von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind als Bereicherung erwünscht: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 12. Es gibt einen konstruktiven Umgang mit Konflikten und Interessenunterschieden: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 13. Wir ermitteln regelmäßig Fortbildungsbedarf und entsprechende Wünsche: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 14. Fortbildungen im eigenen Arbeitsbereich werden finanziell unterstützt und als Arbeitszeit angerechnet: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu Regelmäßig 15. Gewonnene Erfahrungen aus Fortbildungen werden kommuniziert: Nie oder Selten Manchmal Häufig 16. Berufliche Perspektiven der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir im Blick: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 17. Ein angemessenes Gehalt wird gezahlt, die Eingruppierungen stimmen: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu Trifft zu 18. Personalkosten sind mittel- und langfristig abgesichert: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu 19. Wir bieten praktikable und zufrieden stellende Arbeitszeitregelungen: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 20. Für den Krankheitsfall und Urlaub sind eindeutige Vertretungsregelungen getroffen: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu 67 Trifft zu Leitziel Personalentwicklung Qualitätsmerkmal: Zusammenarbeit zwischen ehrenamtlichen und beruflichen pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kinder- und Jugendarbeit Beschreibung Zielgruppe Tipps Berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Ehrenamtliche arbeiten in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit eng zusammen. Unterschiedliche Kompetenzen, Qualifikationen, Zeitbudgets und Motivationen gilt es miteinander abzustimmen und Verantwortlichkeiten verbindlich zu regeln. In den verschiedenen Aufgabenbereichen nehmen ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedliche Funktionen wahr. Diese Funktionsvielfalt mit ihren Wechseln birgt Chancen und Herausforderungen. Partnerschaftliche Zusammenarbeit setzt gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung, Dialog- und Kompromissbereitschaft und -fähigkeit voraus. Ehrenamtliche Vorstände und Leitungen und berufliche pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zusammen arbeiten Wir empfehlen euch, das Qualitätsmerkmal „Zusammenarbeit zwischen Ehrenamtlichen und beruflichen pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kinder- und Jugendarbeit“ am besten in der Verbindung mit dem Qualitätsmerkmalen „Teamarbeit“ und „Förderung und Respektierung von Selbstorganisation“ anhand der Indikatoren zu überprüfen und bei unbefriedigenden Ergebnissen Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen und Umsetzungsschritte zu verabreden. Außerdem empfehlen wir eine getrennte Bildung von Durchschnittsbewertungen bei Ehrenamtlichen einerseits und beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern andererseits. Indikatoren für die Umsetzung des Qualitätsmerkmals Zusammenarbeit zwischen ehrenamtlichen und beruflichen pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kinder- und Jugendarbeit 1. Berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen die Kompetenzen und Fähigkeiten der Ehrenamtlichen und umgekehrt: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 2. Den Ehrenamtlichen sind die Ziele, Aufgaben und Stellenbeschreibungen der beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit bekannt: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 3. Den beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Organisationsstrukturen und Entscheidungswege in unserer Kinder- Jugendarbeit bekannt: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 4. Berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Vertrauen in die Kompetenzen und Fähigkeiten der Ehrenamtlichen: 68 Leitziel Personalentwicklung Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 5. Es gibt bei den Ehrenamtlichen eine Verständigung darüber, für welche Bereiche sie im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit Verantwortung übernehmen: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 6. Bei uns haben die ehrenamtliche Leitung und die beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter miteinander geklärt, welche Stellung die beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der selbstorganisierten Jugendarbeit innehaben: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 7. Aufgaben und Verantwortlichkeiten zwischen den ehrenamtlichen und beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind bei uns klar abgesprochen: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 8. Bei uns ist Kritik zwischen ehrenamtlichen und beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewünscht und wird auch geäußert: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 9. Berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich bei Konflikten anwaltlich für Ehrenamtliche ein: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu 10. Konflikte zwischen Ehrenamtlichen und beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klären sich bei uns: Durch Ausstieg oder Durch Einschaltung Mit Beratung von Partnerschaftlich Reglementierung von Dienstvorgesetzter Außen „oben“ 11. Bei uns gibt es eine Kultur der gegenseitigen Anerkennung und des Dankes: Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu 69 Trifft zu 5. Methoden zur Zielentwicklung Wünschen ist eine Kunst!9 oder: Eine Geschichte darüber, wie schwer es fällt, sich klare Ziele zu setzen. „Die Wunschmaschine stand nämlich so schmutzig und staubig auf dem Tisch, wie sie vorher oben auf dem Speicher gestanden hatte. „Was soll denn das Licht bedeuten?“, fragte Herr Taschenbier.„Das ist das Zeichen, dass die Maschine startbereit ist “,erklärte das Sams.„Du musst den Hebel auf EIN stellen und deinen Wunsch dort oben in den Trichter hineinsprechen. Wenn er erfüllt ist, stellst Du den Hebel auf AUS. Das ist alles.“ Herr Taschenbier stellte den Hebel auf EIN und überlegte. Das Lichtchen begann ganz schnell zu blinken. „Ich wünsch´ mir ganz viel Geld!“, sagte Herr Taschenbier in den Trichter. „Wohin?“, flüsterte ihm das Sams zu.„Du musst sagen, wohin Du es Dir wünschst, sonst landet es irgendwo ...“ „Ach so: Ich wünsche mir ganz viel Geld hier in dieses Zimmer!“ Die Maschine gab einen Summton von sich, und das rote Licht hörte auf zu blinken. Herr Taschenbier schaute sich um. Neben der Maschine auf dem Tisch lag ein Fünfmarkstück, das vorher nicht dagelegen hatte. Auf dem Stuhl entdeckte er einen Zwanzigmarkschein, auf dem Teppich unter dem Tisch noch einmal drei Geldscheine. „Ist das alles?“, fragte Herr Taschenbier ein wenig enttäuscht.„Das soll ganz viel Geld sein?“ Er hob die drei Scheine vom Boden auf und betrachtete sie. „Dreimal zehn Dollar! Was soll ich denn mit amerikanischem Geld?!“ „Das ist ganz bestimmt nicht alles. Du musst nur danach suchen “,sagte das Sams.„Hier schau, im Schuh: sieben Fünfzig-Lire-Münzen! Und da im Buch: ein Hundert-Rubel-Schein! Schau mal in die Lampe: acht Schweizer Franken und ein Zehnmarkschein! Hier in der Vase: vierzehn Dinar! Es ist genau so, wie Du es gewünscht hast, es ist ganz viel Geld im Zimmer. Du musst es nur finden.“ „Ich merke schon, ich habe wieder einmal nicht genau genug gewünscht “, sagte Herr Taschenbier.„Ich werde es gleich noch einmal versuchen: Ich wünsche, dass hier auf diesem Stuhl ein ganzer Waschkorb voll mit deutschen Geld steht!“. Die Maschine begann wieder zu blinken und zu summen. Gleich darauf stand ein ganzer Waschkorb voller Pfennige auf Herrn Taschenbiers Stuhl. Herr Taschenbier ärgerte sich.„Wieder falsch!“, sagte er unwillig.„Ich kann doch nicht in ein Geschäft gehen und mit lauter Pfennigen bezahlen. Bevor ich wieder wünsche, muss ich mich erst mal hinsetzen und alles genau durchdenken.“ 9 Paul Maar: Am Samstag kam das Sams zurück. Hamburg 1985, S.40-42. 70 s.m.a.r.t.10 Stärke der Methode: Unterstützung bei der Entwicklung konkreter, überprüfbarer und realistischer Handlungsziele. Zeitdauer: Bei 10 Leuten insgesamt ca. 2 Stunden (40 min für Ideensammlung in 2er oder 3er Gruppen ,anschließender Entscheidungsprozess, welche Ideen weiter verfolgt werden sollen, je nach Größe der Gruppe und Anzahl der Lösungsvorschläge). Vorgehensweise: Ausgehend von einer Problemsituation – in unserem Fall das schlechte Abschneiden bei einer Fragestellung innerhalb eines bestimmten Qualitätsmerkmals – wird paarweise oder in Kleingruppen nach Lösungen gesucht. Die Handlungsziele müssen s.m.a.r.t. formuliert sein (vgl. Kopiervorlage bzw. Download): spezifisch, messbar, akzeptabel/attraktiv, realistisch und terminiert. Die Paare bzw. Kleingruppen stellen ihre Handlungsziele im Plenum vor und zur Diskussion. Die Gesamtgruppe entscheidet, welche der vorgeschlagenen Handlungsziele sie verfolgen möchte. Zu beachten: Handlungsziele nach den s.m.a.r.t. Regeln zu formulieren ist komplizierter als es aussieht und bedarf einiger Übung. Aufgabe der Moderation ist es darauf zu achten, dass die Regeln eingehalten werden und der Bezug zum Problem und dem Qualitätsmerkmal nicht verloren geht. Kopfstandtechnik11 Stärke der Methode: Die kreative Umkehrung einer Problemstellung kann eingefahrene Sichtweisen aufbrechen, macht Spaß und erleichtert das Mitmachen aller Beteiligten. Zeitdauer: Bei 10 Leuten ca. 2 Stunden. Vorgehensweise: Leitfrage für diese Methode ist: „Was muss passieren, was können wir tun, damit alles möglichst schlecht läuft?“ Zunächst wird das Problem noch einmal eingegrenzt: Worum geht es genau? Anschließend greifen Paare oder Kleingruppen die Leitfrage auf: „Was muss passieren, dass wir nächstes Jahr in unserer Bewertung des Qualitätsmerkmals noch schlechter abschneiden als diesmal?“ Nach einer Ideensammlung wird versucht, Verbesserungsansätze durch positive Umkehrschlüsse zu bilden. Die Vorschläge werden im Plenum vorgestellt und diskutiert. Die Gesamtgruppe entscheidet, welche der Verbesserungsansätze sie aufgreifen möchte. Es wird verabredet, wer bis wann die konkreten Aufgaben übernimmt. 10 11 Vgl. Maja Heiner: Qualitätsentwicklung durch Evaluation. Freiburg 1996. Vgl. Landesjugendring Niedersachsen 2002, S. 37. 71 Zu beachten: Die Auseinandersetzung mit Gedanken und Ideen der konträren Problemstellung berücksichtigt, dass es manchmal leichter fällt, Probleme zu beschreiben als positive Zielformulierung zu entwickeln. Manchmal zeigt sich, dass sich atmosphärische Störungen und Probleme im Blick auf inhaltliche Ziele gegenseitig bedingen. Bei der Kopfstandtechnik kann es vorkommen, dass ihr auf dem Wege des Assoziierens bei Lösungsideen landet, die nicht mehr unbedingt zum Ausgangsproblem gehören. Diese anderen Gedanken sind euch nicht umsonst gekommen. Ihr könnt auch an diesen Ideen weiter arbeiten, haltet aber fest, auf welches Problem sich diese Ideen beziehen. Vielleicht findet ihr ein Qualitätsmerkmal, mit dessen Hilfe ihr das Thema noch vertiefen könnt. Lösungsmatrix12 Stärke der Methode: Gründe für Probleme werden badacht, äußere Bedingungen, die eine Problemlösung negativ oder positiv beeinflussen, werden berücksichtigt. Zeitdauer: Bei 10 Leuten insgesamt ca. 2 Stunden (30 min für Ideensammlung in 2er oder 3er Gruppen ,anschließender Entscheidungsprozess, welche Ideen weiter verfolgt werden sollen, je nach Größe der Gruppe und Anzahl der Lösungsvorschläge). Vorgehensweise: Paarweise oder in Kleingruppen wird die vorliegende Matrix ausgefüllt (Kopiervorlage bzw. download). Dabei wird das Problem genau beschrieben und nach Gründen für die unbefriedigende Situation gesucht, es werden Lösungsideen entwickelt, Hemmnisse und Unterstützungsmöglichkeiten bedacht und schließlich konkrete Ziele entworfen. Wenn die Gesamtgruppe Lösungswege verabredet hat, sollten noch Verantwortlichkeiten und Zeitrahmen geklärt werden. Zu beachten: Auf den ersten Blick sehen die Fragen: „Welche Lösungsideen habt ihr?“ und „Welche wollt ihr angehen?“ doppelt gemoppelt aus. Ziel der Lösungsmatrix ist es, dass auf erste Ideen noch die Zwischenfragen folgen, was die Umsetzung der Lösungsideen hemmt bzw. fördert. Diese Zwischenfragen wirken wie ein Filter und tragen dazu bei, dass ihr euch möglichst realistische Ziele setzt bzw. hemmende Faktoren vorab zu beseitigen versucht. Gemeinsame Ziele bilden13 Stärke der Methode: Aus persönlich bewusst überlegten Zielen werden gemeinsame und von der Gruppe getragene Ziele entwickelt. 12 13 Vgl. Landesjugendring Niedersachsen 2002, S. 36. Vgl. Landesjugendring Niedersachsen 2002, S. 47. 72 Zeitdauer: Bei 8 Leuten insgesamt ca. 1,5 Stunden. Vorgehensweise: Jede und jeder schreibt für sich 3-5 mögliche Lösungsideen auf, wie ein Problem angegangen werden könnte (ca. 5 min). Alle lesen ihre Ideen im Plenum laut vor. Nun setzen sich jeweils zwei Teilnehmende zusammen, tauschen sich aus und verständigen sich gemeinsam auf 3-5 Lösungswege (ca. 10 min). Beide schreiben die Ideen auf. Nun setzen sich 4 Teilnehmende zusammen (ca. 15 min), dann 8 usw. Die zuletzt erarbeiteten Vorschläge werden in der Gesamtgruppe vorgestellt, erläutert und entschieden. Zum Schluss werden noch Indikatoren benannt, anhand derer man feststellen kann, in welchem Maß ein Ziel auch erreicht wird. Wie immer wird noch geklärt, wer bis wann für die Umsetzung der Aufgabe verantwortlich ist. Zu beachten: Die Anzahl von Lösungsmöglichkeiten sollte danach gewählt werden, wie viele Vorhaben die Gruppe realistischer Weise auch umsetzen kann. Zukunftswerkstatt Wenn ihr euch mit einem ganzen Leitziel intensiv beschäftigen wollt, bietet sich die Zukunftswerkstatt als eine sehr umfassende Methode an. Hierfür sollte aber nach Möglichkeit ein ganzes Wochenende zur Verfügung stehen. Stärke der Methode: Methodisch-kreatives Arbeiten in einem offenen Prozess, der von den Teilnehmenden selber bestimmt und ausgefüllt wird. Vorgehensweise: Die Zukunftswerkstatt ist ein offener Prozess, der sich in drei Phasen gliedert: Die Beschwerde- und Kritikphase (Bestimmung des Ist-Zustandes, kritische Aufarbeitung der Probleme) Die Phantasie- und Utopiephase (Überwindung des Ist-Zustandes, Entwicklung eines Wunschhorizonts) Verwirklichungs- und Praxisphase (Klärung des Handlungspotentials, Umsetzungsschritte entwickeln) Der BDKJ hat eine Arbeitshilfe zur Methode der Zukunftswerkstatt herausgegeben und kann auf Nachfrage auch die Moderation einer solchen übernehmen. 73 Formulierung von Handlungszielen nach s.m.a.r.t. S Spezifisch M Messbar Ein konkretes Teilziel ist benennbar Der Grad der Zielerreichung lässt sich beobachten oder messen A Akzeptabel/ Attraktiv Ein Minimalkonsens ist erreichbar, das Ziel stellt keine Über- oder Unterforderung dar R Realistisch Das Ziel ist unter den gegebenen finanziellen, personellen, politischen u. a. Rahmenbedingungen erreichbar T Terminiert Ein Zeitpunkt für die voraussichtliche Zielerreichung ist angegeben © Qualitäts-Selbstcheck für die Kinder- und Jugendarbeit im Erzbistum Berlin Lösungsmatrix Was genau ist das Problem? Welche Gründe sehr ihr dafür? Welche Lösungsideen habt ihr? Was hemmt deren Umsetzung? Was fördert deren Umsetzung? Welche wollt ihr angehen? © Qualitäts-Selbstcheck für die Kinder- und Jugendarbeit im Erzbistum Berlin 6. Hilfe! Downloads unter www.bdkj-berlin.de oder www.erzbistumberlin.de. Den Qualitäts-Selbstcheck, alle Fragebögen zu den Qualitätsmerkmalen, die Auswertungsbogen und die Vorlagen von Methoden der Entscheidungsfindung und der Zielentwicklung könnt ihr euch zur Weiterarbeit downloaden. Wer noch mehr über den „Pastoralplan für die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit im Erzbistum Berlin“ wissen möchte, findet auch diesen zum Downloaden. Auch das Evaluationskonzept für den Pastoralplan könnt ihr euch gerne runterladen. Qualitätszirkel Für ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit dem Qualitäts-Selbstcheck intensiver befassen möchten und den Austausch mit anderen suchen, bieten wir den Qualitätszirkel Selbstcheck. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch unter [email protected] oder [email protected]. Literatur Wer sich mehr mit Qualitätsentwicklung beschäftigen möchte empfehlen wir zur Lektüre: Beywl, Wolfgang .a. (Hg.): Evaluation im Alltag. Jugendverbände untersuchen ihre Wirkungen. Münster 2001. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.): Materialien zur Qualitätssicherung in der Kinder- und Jugendhilfe, Bonn 2002 (36 Hefte mit Datenbank auf CD, kostenlos anzufordern unter www.bmfsfj.de). Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen (Hg.): Selbstevaluation – Anregungen für Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der verbandlichen Jugendarbeit, Wien 2001. Landesjugendring Niedersachsen e.V. (Hg.): Handbuch zur Qualitätsentwicklung in der Jugendverbandsarbeit, Hannover 2002. Merchel, Joachim (Hg.): Qualität in der Jugendhilfe, Münster 1999². Peterander, Franz und Speck, Otto (Hg.): Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen, München 1999. Projektgruppe Qualitätsentwicklung der Berliner Jugendarbeit (Hg.): Handbuch Qualitätsmanagement der Berliner Jugendfreizeitstätten, Berlin 2004. Spiegel, Hiltrud von (Hg): Jugendarbeit mit Erfolg. Arbeitshilfen und Erfahrungsberichte zur Qualitätsentwicklung und Selbstevaluation, Münster 2000. 76 Fachliche Unterstützung Wenn ihr bei der Bearbeitung eines Qualitätsmerkmals Fragen habt oder inhaltlich nicht weiter kommt, wendet euch bitte an die beruflichen pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gemeinde oder im Dekanat. Wenn es die nicht gibt oder der Kontakt auch nicht weiter hilft, stehen euch auf Diözesanebene hilfreiche Menschen zur Seite. Dies gilt natürlich auch für methodische Fragen. Bitte wendet euch an: Burkhard Rooß, BDKJ im Erzbistum Berlin, Waldemarstr. 8-10, 10999 Berlin, [email protected], Tel: 030.756 903 78 www.bdkj-berlin.de, Helmut Jansen, EAJ, Niederwallstr. 8-9, 10117 Berlin, [email protected], Tel: 030.32 684 273, www.erzbistumberlin.de Anregungen und Ideen Bitte mailt uns eure Erfahrungen, Ergänzungen, Änderungswünsche, selbst gesteckten Ziele usw. an [email protected] oder [email protected]. Wir werden eure Ideen auswerten und anderen Gruppen zugänglich machen, so dass möglichst viele Gruppen voneinander profitieren können. 77