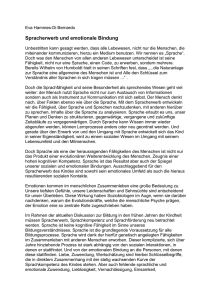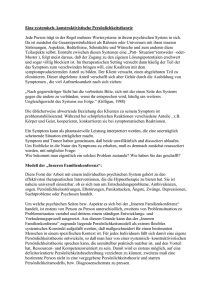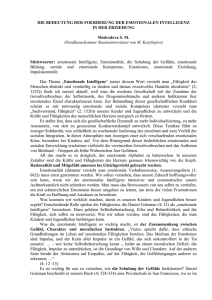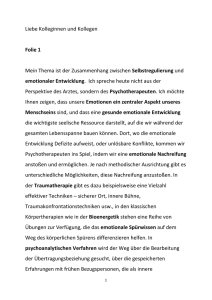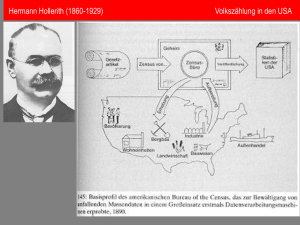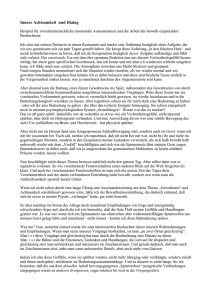Überlegungen zur emotionalen Dimension im Sport aus der Sicht
Werbung
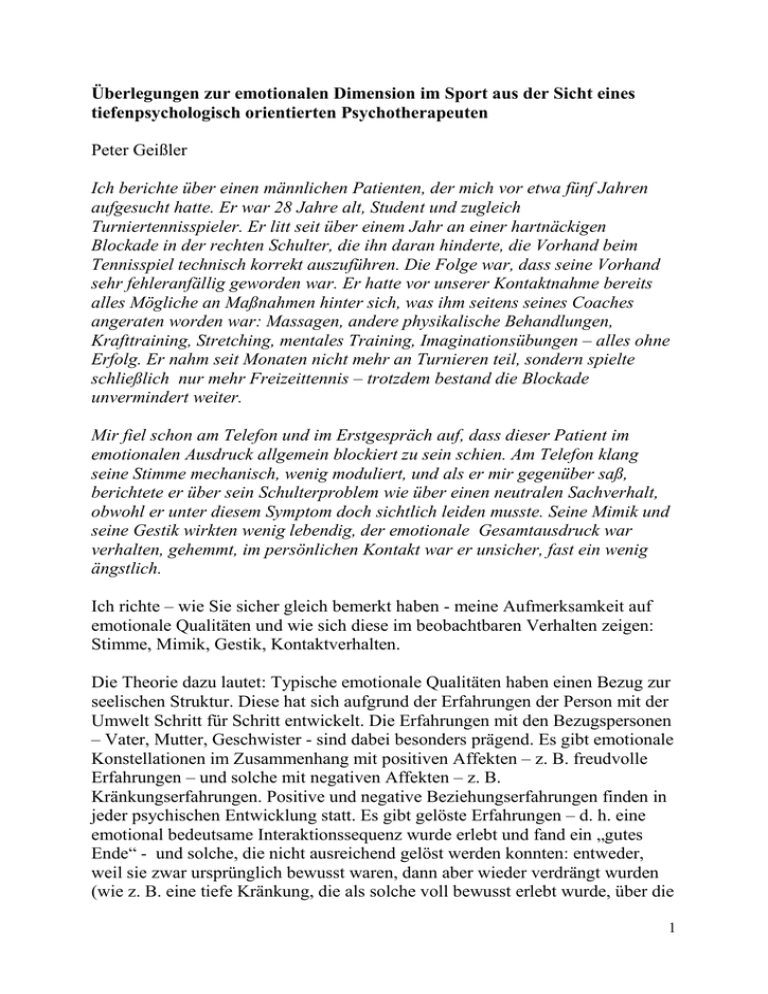
Überlegungen zur emotionalen Dimension im Sport aus der Sicht eines tiefenpsychologisch orientierten Psychotherapeuten Peter Geißler Ich berichte über einen männlichen Patienten, der mich vor etwa fünf Jahren aufgesucht hatte. Er war 28 Jahre alt, Student und zugleich Turniertennisspieler. Er litt seit über einem Jahr an einer hartnäckigen Blockade in der rechten Schulter, die ihn daran hinderte, die Vorhand beim Tennisspiel technisch korrekt auszuführen. Die Folge war, dass seine Vorhand sehr fehleranfällig geworden war. Er hatte vor unserer Kontaktnahme bereits alles Mögliche an Maßnahmen hinter sich, was ihm seitens seines Coaches angeraten worden war: Massagen, andere physikalische Behandlungen, Krafttraining, Stretching, mentales Training, Imaginationsübungen – alles ohne Erfolg. Er nahm seit Monaten nicht mehr an Turnieren teil, sondern spielte schließlich nur mehr Freizeittennis – trotzdem bestand die Blockade unvermindert weiter. Mir fiel schon am Telefon und im Erstgespräch auf, dass dieser Patient im emotionalen Ausdruck allgemein blockiert zu sein schien. Am Telefon klang seine Stimme mechanisch, wenig moduliert, und als er mir gegenüber saß, berichtete er über sein Schulterproblem wie über einen neutralen Sachverhalt, obwohl er unter diesem Symptom doch sichtlich leiden musste. Seine Mimik und seine Gestik wirkten wenig lebendig, der emotionale Gesamtausdruck war verhalten, gehemmt, im persönlichen Kontakt war er unsicher, fast ein wenig ängstlich. Ich richte – wie Sie sicher gleich bemerkt haben - meine Aufmerksamkeit auf emotionale Qualitäten und wie sich diese im beobachtbaren Verhalten zeigen: Stimme, Mimik, Gestik, Kontaktverhalten. Die Theorie dazu lautet: Typische emotionale Qualitäten haben einen Bezug zur seelischen Struktur. Diese hat sich aufgrund der Erfahrungen der Person mit der Umwelt Schritt für Schritt entwickelt. Die Erfahrungen mit den Bezugspersonen – Vater, Mutter, Geschwister - sind dabei besonders prägend. Es gibt emotionale Konstellationen im Zusammenhang mit positiven Affekten – z. B. freudvolle Erfahrungen – und solche mit negativen Affekten – z. B. Kränkungserfahrungen. Positive und negative Beziehungserfahrungen finden in jeder psychischen Entwicklung statt. Es gibt gelöste Erfahrungen – d. h. eine emotional bedeutsame Interaktionssequenz wurde erlebt und fand ein „gutes Ende“ - und solche, die nicht ausreichend gelöst werden konnten: entweder, weil sie zwar ursprünglich bewusst waren, dann aber wieder verdrängt wurden (wie z. B. eine tiefe Kränkung, die als solche voll bewusst erlebt wurde, über die 1 aber nie wieder gesprochen wurde), oder weil sie nie wirklich komplett bewusstseinsfähig wurden, und zwar weil die beteiligten Gefühle nicht ausreichend in Worte gefasst werden konnten; also z. B. eine tiefe Kränkung, die sich wie ein dumpfer unklarer Schmerz anfühlte; oder eine traumatische Erfahrung, die vom Erleben her gänzlich unfassbar war. Ungelöste konflikthafte oder traumatische Erfahrungen wirken in der seelischen Dynamik weiter und suchen nach Ausdrucksmöglichkeiten; eine solche Möglichkeit sind Körpersymptome, eine andere sind bestimmte Handlungen. Z. B. neigen Patienten, die als Kinder geschlagen wurden später selbst dazu, ihre eigenen Kinder zu schlagen. Sie drücken ihre eigenen ungelösten emotionalen Traumata in ihrem Verhalten aus. Wir sagen: „Der Körper erinnert sich.“ In der Therapie geht es darum, die problematischen unbewussten emotionalen Konstellationen zu identifizieren und sie gemeinsam in ihrer Wirkung auf das gegenwärtige Verhalten zu rekonstruieren. Werden die arretierten oder nie symbolisierten Gefühle allmählich bewusst und besprechbar, ändert sich in Schritten die seelische Dynamik und als Auswirkung davon das Verhalten und auch die Symptomatik. Wir versuchen in unserer Art der Arbeit also nicht, das Symptom direkt anzugehen, denn wir verstehen es als konstruktiven Hinweis der Seele auf konflikthafte emotionale Muster. Wir suchen nach Verstehen und Versprachlichung. D. h. es gibt ein Gedächtnis, über das wir bewusst und sprachlich nicht verfügen. Gedächtnisforscher sprechen von einem impliziten Wissen, und ein Teil dieses Wissens ist das emotionale Gedächtnis. Es organisiert unser Erleben, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Das ist freilich eine andere Konzeption psychischer oder mentaler Prozesse, die in der Sportpsychologie allgemein üblich zu sein scheint. Wenn Sie von Erleben sprechen, meinen Sie, wenn ich es recht verstehe, innere und weitgehend bewusstseinsfähige Vorgänge wie Gedanken, Gefühle und Motive. So verstehe ich auch die IZOF-Konzeption nach Yuri Hanin1, das Konzept der individuellen Zone des optimalen Funktionierens. Es scheint mir dabei um bewusstseinsnahe Dynamiken zu gehen. Zur Herstellung des optimalen Zustandes stehen Interventionen zur Verfügung, die am bewussten Erleben ansetzen. Das mag durchaus wirksam sein, setzt jedoch nicht an der zugrunde liegenden emotionalen Struktur an. Es ist ein anderer Ansatzpunkt als der tiefenpsychologisch-psychoanalytische. Mein Patient spürte zu Beginn der Therapie sehr wenig von sich selbst. Er merkte zwar die Schulterblockade in ihrer Auswirkung auf das Tennisspiel, dass 1 Hanin, Y. L.. (1997) Emotions and athletic performance: Individual zones of optimal functioning model. European yearbook of sport psychology A publication of FEPSAC 2 jedoch eine allgemeine emotionale Blockade bestand, konnte er nicht fühlen. Er war vollkommen auf sein Symptom und dessen Auswirkungen fixiert, was angesichts der Tatsache, dass er Vater eines Kindes war, ein wenig merkwürdig erschien. Eine Zeit lang waren in der Therapie daher Spürübungen wichtig, die sein körperlich-emotionales Bewusstsein förderten. In den Spürübungen begann er Emotionen in einer Weise zu fühlen, die neu für ihn war, und in den Gesprächen begann er erstmals tiefgründig über Aspekte seines Lebens nachzudenken und einzelne Teile zueinander in Beziehung zu setzen. Solche Spürübungen bestanden bei diesem Patienten darin, dass ich ihn bat, die Schlagbewegung vor meinen Augen durchzuführen und dabei in sich hineinzuspüren. Am Anfang nahm er gar nichts wahr, außer den mechanischen Bewegungsablauf. Langsam begann er die Bewegung von innen her zu fühlen. Und dann begann er allmählich emotionale Qualitäten in seiner Bewegung zu spüren, z. B. den Unterschied zwischen schwungvoll und verkrampft. Durch das schrittweise Verknüpfen solcher gefühlsartigen Wahrnehmungen mit Rückmeldungen zu seinem Verhalten begann er allmählich wahrzunehmen, wie verkrampft er eigentlich war – ohne Stresseinwirkung von außen. Er befand sich in einem Zustand chronischer Anspannung. Wir hatten nun einen Teil seines impliziten Wissens an die Oberfläche gebracht, ohne allerdings noch den zugrunde liegenden Konflikt zu verstehen (sofern ein solcher vorhanden war). Die Forschung zum „implizite Wissen“ ist sehr in Fluss, doch scheint sie darauf hinauszulaufen, dass etwas in uns mehr weiß, als wir uns bewusst machen können. Hervorzuheben ist die Entdeckung der Spiegelneuronen Ende des letzten Jahrhunderts. Das sind Nervenzellen, die feuern, wenn wir unser Gegenüber in seinem Verhalten beobachten. Wir erfassen mit Hilfe unserer Spiegelneuronen unmittelbar sowohl die Intention als auch den emotionalen Gehalt all dieser Bewegungen. Wenn ich z. B. die Stimme meines Patienten höre, feuern akustische Spiegelneuronen in mir, und dadurch bin ich in der Lage, den Patienten in seiner Befindlichkeit und in seiner Intention, wie sie sich in seiner Stimme ausdrücken, von innen her zu verstehen – auf einer emotionalen Ebene – auch wenn ich das bewusst gar nicht weiß und dieses Wissen gar nicht in Worte fassen kann! Das ist implizites Wissen, ein intuitives Spürwissen. Implizites Wissen, Emotionen und der Körper stehen in einem engen Zusammenhang. Das haben auch andere Wissenschaften entdeckt, wie z. B. manche Evolutionstheoretiker, oder Kognitionswissenschaftler, die neuerdings von „embodied cognitions“ sprechen. Sie meinen damit mentale Prozesse in ihrer körperlich-emotionalen Einbettung. Einen knappen Überblick über 3 diesbezügliche Forschungsansätze finden Sie in meinem Artikel im „Spectrum der Sportwissenschaften“.2 All dies läuft im Grunde auch ein neues Menschenbild hinaus, in dem die Emotionen stärker gewichtet werden als bisher, und zwar die Emotionen in ihrer unbewussten Dimension, im impliziten Bereich! Ich nenne in diesem Zusammenhang den einflussreichen portugiesischen Neurowissenschaftler Antonio Damasio. Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts kam ein Buch von ihm heraus, in dessen Titel der Paradigmenwechsel in pointierter Form angesprochen wird: „Ich fühle, also bin ich.“3 Damasio ersetzt damit das klassische kartesianische Paradigma „Cogito ergu sum“ = Ich denke, also bin ich“, das seit dem 17. Jahrhundert einen großen Einfluss auf unser Wissenschaftsverständnis hatte. Hier wurde die menschliche Denkfähigkeit überbewertet. Bei meinem Patienten hatten wir Zugang zum impliziten Wissen gefunden, zu seiner allgemeinen emotionalen Blockierung. Befand sich im Kern von alledem ein unbewusst wirksamer Konflikt? Er war seit jungen Jahren sehr von seinem Vater geprägt worden. Sein Vater zeichnete dafür verantwortlich, dass er schon als Kind seine Liebe zum Tennis entdeckte; er übte mit ihm, trainierte ihn später, fuhr mit ihm auf Turniere. Auch die Entscheidung für die akademische Laufbahn gründete sich, wie sich allmählich herausstellte, auf eine Erwartung seines Vaters, auch wenn eine solche nie offen ausgesprochen worden war. In dieser Familie war nämlich über Gefühle und Bedürfnisse kaum offen gesprochen worden. Zu Beginn der Therapie sprach der Patient immer dann, wenn er über den Vater berichtete, in neutraler Weise. Je mehr er seine Gefühle spürte und sie zu verbalisieren vermochte, umso stärker trat eine Ambivalenz zutage, die mit einer für ihn damals noch unklaren Unsicherheit dem Vater gegenüber zu tun hatte. Schritt für Schritt erkannte er, dass sowohl seine Probleme im Studium (er konnte auch keine Prüfungen mehr machen) als auch seine Gedanken um den Tennissport damit zu tun hatten, dass er seinen Vater nicht enttäuschen wollte, von dem er noch immer finanziell teilabhängig war. Je mehr er sich in die Erfahrung mit dem Vater vertiefte, umso stärker verspürte er einen Zorn, den er zunächst nicht verstand. Zorn war ihm nämlich fremd, und auf bewusster Ebene – d. h. in seinen bewussten Gedanken von sich selbst stufte er sich als friedfertig und unaggressiv ein. 2 Geißler, P. (2010): Überlegungen zur emotionalen Dimension im Sport aus der Sicht eines Psychotherapeuten. Spectrum der Sportwissenschaften, im Druck. 3 Damasio, A. R. (1999): Ich fühle, also bin ich. Die Entschlüsselung des Bewusstseins. München (DTV). 4 Das ist ein wichtiger Punkt: bestimmte Denkprozesse des Patienten, die mit seinem Bild von sich selbst in Verbindung standen – „Ich bin ein friedfertiger Mensch“ – waren als Bearbeitung unbewusster emotionaler Erfahrungen zu verstehen. Offenbar war ein verdrängter Zorn am Werk und bewirkte, dass er von sich selbst dachte, er sei friedfertig. Das Denken war, ebenso wie die Muskelfunktionen in seiner rechten Schulter, in den Dienst der Emotionsabwehr geraten und zementierte sein falsches Bild von sich selbst. Dieser Patient berichtete gelegentlich über Träume mit aggressiven Inhalten – wie z. B. Kriegsgeschehnissen – die ihm fremd und unverständlich erschienen. Er hatte sie anfangs als unwesentlich abgetan. Allmählich lernte er, seine Träume als Hinweise auf wichtige Aspekte seines unbewussten Erlebens zu verstehen. In dem Maß wie das gelang kamen - gleichermaßen als Antwort auf unsere Bemühungen - Erinnerungen an bislang verdrängte frühe Szenen hoch, in denen er vom Vater gedemütigt und entwertet worden war. Diese Kränkungen waren nun offensichtlich die Quelle des Zorns. Er hatte unbewusst gelernt, die Kränkungen hinter einer Fassade angepasster Freundlichkeit zu verbergen. Der Preis für dieses chronische Verbergen war die motorische Gehemmtheit, die Bremsung in seinen Bewegungen, die sich schließlich in der Schulterblockade zugespitzt hatte. Ich kann hier aus Zeitgründen nicht auf weitere Details eingehen, aber die Therapie mündete darin, dass der Patient sich dem Vater gegenüber emanzipierte, sich von seinen Erwartungen befreite und das Studium beendete. Mittlerweile konnte er verstehen, dass die Schulterblockade einen Kompromiss darstellte zwischen der Anpassung an die väterlichen Erwartungen und der aggressiven Verweigerung im Dienste der Selbstbestimmung, aus der Not geboren: das Symptom als unbewusste kreative Schöpfung. Die Schulterblockade hatte sich gebessert, war aber nicht vollständig verschwunden. Das war dem Patienten nun aber weniger wichtig geworden, denn im Mittelpunkt seines gegenwärtigen Lebens stand nun das Ziel, wirklich erwachsen zu werden. Das hieß unter anderem auch, sich um sein Kind als aktiver Vater zu kümmern, und es hieß, sich vom Vater finanziell komplett unabhängig zu machen, sich auf die eigenen Füße zu stellen. Wie es mit dem Tennis weitergehen sollte, hielt er sich offen. Das fand ich – gemessen an seiner gegenwärtigen Entwicklung - durchaus vernünftig. 5 Was können Sie als Sportpsychologen aus dem hier Gesagten eventuell ableiten? Mir ist klar, dass ich für Sie von einer Außenperspektive heraus spreche. Ich kenne Ihren Diskurs nicht gut genug, und ich werde mich daher damit begnügen, einige Fragen anzureißen. Zum Abschluss möchte ich dann auf einen Ihrer Kollegen verweisen, bei dem ich einen möglichen Brückenschlag entdeckt habe. Hinter jeder Theorie steckt ein Menschenbild. Welches Menschenbild ist es bei Ihnen? Spielen in diesem Menschenbild unbewusste Emotionen eine Rolle? Wenn ja: aufgrund welcher Theorie? Vor allem: welcher Entwicklungstheorie? Wie stellen sich Sportpsychologen zu Aspekten wie Körpererinnerung, implizites Wissen, unbewusster Konflikt und Körpersymptomatik? Wird ein Symptom als kreative Schöpfung der Seele angesehen, und wenn ja, was heißt das dann in der sportpsychologischen Beratung? Folgt die Praxeologie der sportpsychologischen Beratung einem Entwicklungsmodell? Entwicklung bedeutet nämlich im Grunde „Zeit geben“. Also: Im Unterschied zu Zielen, die man bewusst anstreben kann, ist es im Falle eines Entwicklungsmodells so, dass Entwicklungen einer inneren Dynamik folgen, die man nicht willkürlich durch Zielvorgaben steuern kann. Wenn man einem Entwicklungsmodell folgt, wie geht man dann mit Aufträgen seitens dritter Personen um? Unterscheiden Sportpsychologen im Hinblick auf mentale Prozesse, auf gedankliche Tätigkeit, zwischen Gedanken im Dienste des emotionalen Geschehens und solchen, denen eine Abwehrfunktion zukommt? Für mich ist die Frage in letzter Konsequenz: Inwieweit ist der sportwissenschaftliche Diskurs anschlussfähig an den genannten Paradigmenwechsel – „Ich fühle, also bin ich“ – und welche Konsequenzen werden daraus wirklich abgeleitet? Abschließend der Brückenschlag, von dem ich gesprochen habe: Die Rede ist von Jürgen Freiwald aus Wuppertal. Er war vor drei Monaten im Rahmen der Fitnesstrainerausbildung an der Bundessportakademie Linz als Referent eingeladen. Ich hatte Gelegenheit, mir einen Mitschnitt seines Vortrages anzuhören und habe mich von vielen Gedanken direkt angesprochen gefühlt. Wenn Freiwald beispielsweise von Sensomotorik spricht, dann meint er damit zutiefst subjektive Vorgänge. Freiwald ist der Ansicht, dass der Sportler seine motorischen Abläufe unbewusst aufgrund seiner Freiheitsgrade konstruiert – es ist also ein Konstruktivist – und dass in diese Konstruktionen die subjektiven 6 Befindlichkeiten des Sportlers zentral eingehen - „Ich fühle, also bin ich!“ Freiwald denkt systemisch, und das heißt: Jede Äußerung eines Systems ist ein sinnvolle Angelegenheit, sodass der Akzent darauf liegt, ein Symptom zunächst in dessen Funktionalität zu verstehen, anstatt es einfach beseitigen zu wollen. Das ist ein Vorgehen, wie ich es bei meinem Patienten vorgestellt habe! Seinem Credo „Der Ansatz ist die Persönlichkeit des Sportlers und nicht die Technik!“ kann ich mich vorbehaltlos anschließen. Freiwald stützt sich meinem Verständnis nach auf die dynamische Systemtheorie – das ist die Theorie hoch komplexer, sich selbst organisierender Systeme, die von molekularen bis zu kulturellen Prozessen reicht und in die alle Zeitebenen, von Millisekunden bis Jahrmillionen, miteinbezogen werden. Systemtheoretisch zu denken, heißt nicht nur, den Sportler als hochkomplexes System zu sehen, sondern auch das gesamte Umfeld miteinzubeziehen – den Coach, das elterliche Umfeld, das Vereinsumfeld, beteiligte Institutionen, bei Spitzensportlern die Medien etc. In der dynamischen Systemtheorie, die mit unserem tiefenpsychologischen Denken weitgehend kompatibel ist, könnte also künftig auf der Suche nach weiteren Brücken ein gemeinsames Forschungsfeld liegen. Ich vermute, der Dialog könnte sich auch für Sie lohnen, auch wenn die Implikationen beträchtlich sein, denn wie geht man tatsächlich, wenn man systemisch denkt, mit einem Sportler um, der eigentlich nur sein Symptom loswerden will? - wie vor Beginn der Therapie mein Patient. All dies führt für mein Gefühl letztlich in sehr grundsätzliche Gedanken, wie unsere Gesellschaft und unsere Welt beschaffen ist, von der der Sport ein Teil ist. 7