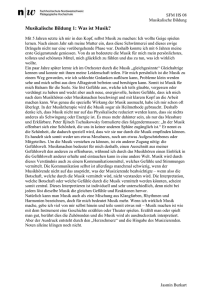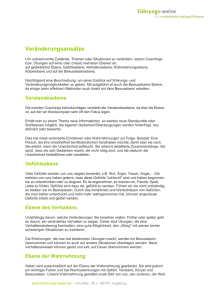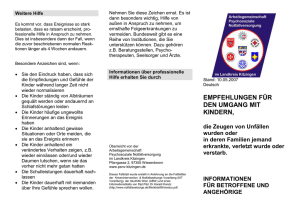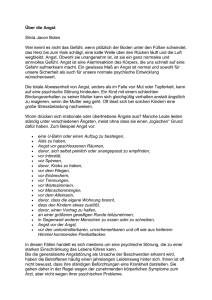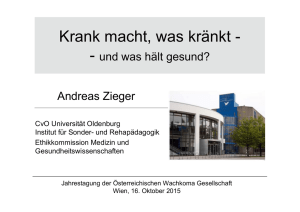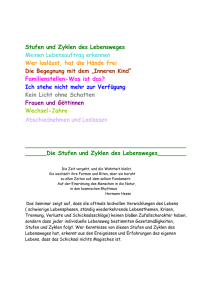Text über Gefühle
Werbung
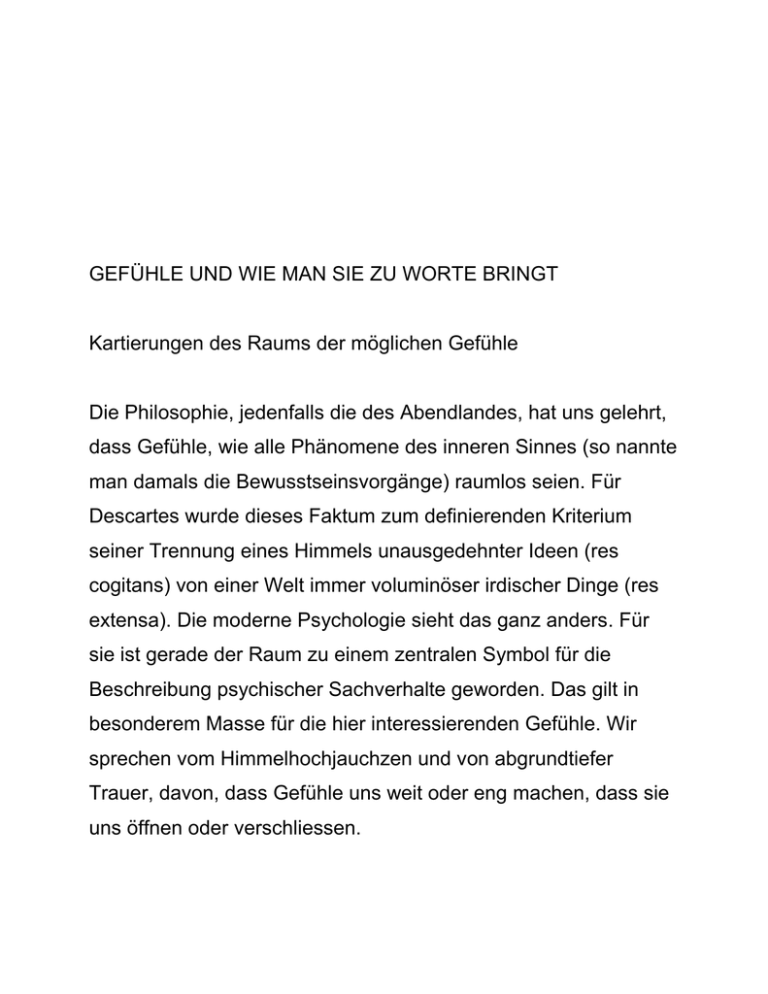
GEFÜHLE UND WIE MAN SIE ZU WORTE BRINGT Kartierungen des Raums der möglichen Gefühle Die Philosophie, jedenfalls die des Abendlandes, hat uns gelehrt, dass Gefühle, wie alle Phänomene des inneren Sinnes (so nannte man damals die Bewusstseinsvorgänge) raumlos seien. Für Descartes wurde dieses Faktum zum definierenden Kriterium seiner Trennung eines Himmels unausgedehnter Ideen (res cogitans) von einer Welt immer voluminöser irdischer Dinge (res extensa). Die moderne Psychologie sieht das ganz anders. Für sie ist gerade der Raum zu einem zentralen Symbol für die Beschreibung psychischer Sachverhalte geworden. Das gilt in besonderem Masse für die hier interessierenden Gefühle. Wir sprechen vom Himmelhochjauchzen und von abgrundtiefer Trauer, davon, dass Gefühle uns weit oder eng machen, dass sie uns öffnen oder verschliessen. Die Psychologie geht sogar noch einen Schritt weiter und betrachtet den Raum nicht nur als ein inhaltsunabhängiges Gefäss, dessen Dimensionen bedeutungslose Koordinaten sind, sie geht bei ihren Modellierungen davon aus, dass Dimensionen inhaltlich bedeutsam sein, dass Räume auch semantische Räume sein können. In diesem Sinne lässt sich auch ein semantischer Raum möglicher Gefühle konzipieren. Wie die Psychologie versucht, diesen Raum zu kartieren, soll Gegenstand meines heutigen Vortrags sein. Räume zu rekonstruieren bedeutet zunächst Distanzen zu definieren und Operationen anzugeben, mit deren Hilfe sie bestimmt werden können. In einem semantischen Raum wird Nähe durch Ähnlichkeit definiert. Je ähnlicher zwei 'Reizobjekte' (so der Fachterminus) sind, desto näher beieinander werden sie im semantischen Raum abgebildet. Der Apfel liegt näher bei der Birne als bei der Kirsche, die Wut befindet sich in engerer Nachbarschaft zum Ärger als zur Freude. Einen semantischen Raum vermessen, heisst also Ähnlichkeiten zwischen den darin enthaltenen Objekten quantifizieren. Wie geht das? Menschen haben die bemerkenswerte Fähigkeit, nicht nur Objekte wahrzunehmen und Eigenschaften an ihnen zu erkennen, sondern auch zwischen ihnen bestehende Ähnlichkeiten zu 2 beurteilen. Wir können Menschen, Gerüche oder Situationen mehr oder weniger ähnlich finden. Solche Einschätzungen sind in der Regel ziemlich stabil, d.h. sie lassen sich zu späteren Zeitpunkten mit vergleichbaren Ergebnissen wiederholen. Wenn jemand einen Apfel einer Birne ähnlicher einschätzt als einer Kirsche, ändert er dieses Urteil nicht in den nächsten Tagen wieder, vermutlich auch nicht in den nächsten Jahren. Die Psychologie hat mittlerweile ein ganzes Arsenal von Methoden entwickelt, solche Ähnlichkeitseinschätzungen zu quantifizieren. Die psychologische Messtheorie nimmt nun an, dass die globalen Ähnlichkeitsurteile, man spricht auch von 'Über-allesÄhnlichkeiten', zusammengesetzt sind aus den Einzelwerten aller Merkmale, die zwei miteinander verglichenen Objekten gemeinsam sind. Zwei Menschen können miteinander verglichen werden bezüglich ihrer Haar- und Augenfarbe, ihrer Kleidergrösse, ihrer 'Figur', der Gestaltung der Ohrmuscheln, aber auch bezüglich ihrer Intelligenz, ihres Temperaments, ihrer Kreativität und vieler anderer Aspekte. In vielen Fällen bestimmt der Kontext einer konkreten Aufgabe, welche von den zahlreichen möglichen Merkmalen als besonders relevant beachtet, welche eher vernachlässigt werden sollen. Für die Wahl eines Mr. Universum werden zum Vergleich zwischen Kandidaten andere Merkmale relevant als für die Wahl eines Hochschullehrers. 3 Die Verknüpfung der verschiedenen Merkmalswerte zu einem Globalurteil erfolgt automatisch. Wir sind uns dieses Vorgangs nicht bewusst, können es auch nicht werden, da er nicht bewusstseinsfähig ist. Wir können jedoch im nachhinein Globalurteile mit Hilfe mathematischer Methoden wieder in ihre Merkmalskomponenten zerlegen, wir können berechnen, welche Merkmale mit welchem Gewicht in das Globalurteil eingegangen sind. Dieses Verfahren wird als 'Skalierungs-Technik' bezeichnet. Mit ihrer Hilfe lässt sich nun ein Raum der möglichen Gefühle rekonstruieren. Eine spezielle Schwierigkeit ergibt sich jedoch in diesem Fall: Gefühle sind nicht im Labor so beliebig verfügbar zu machen wie andere Untersuchungsobjekte. Der experimentelle Zugriff stösst hier an Grenzen sowohl des ethisch Vertretbaren als auch des technisch Machbaren. Wir wissen nicht, wie man mal eben zu Versuchszwecken in Menschen Eifersucht, Reue, Neid, Zuneigung oder Trauer erzeugt, auf Wunsch wieder verschwinden lässt und durch ein anderes Gefühl ersetzt, das jetzt als Vergleichsreiz gebraucht wird. Wir müssen uns da mit verbalen Konzepten, sprich Gefühlsbegriffen, behelfen. Auf diese Weise gelangen wir jedoch nicht zu einer Beschreibung der Phänomene 4 selbst, sondern zur Rekonstruktion der Wissensstruktur, die wir über die Phänomene gebildet haben. Nun macht es in der Regel Sinn anzunehmen, dass zwischen Sprachstrukturen und den Realitätsaspekten, die sie abbilden sollen, eine strukturelle Übereinstimmung besteht, dass also die Sprache, wie WITTGENSTEIN das ausgedrückt hat, darstellt, was der Fall ist. Das wäre eine im Prinzip nicht unplausible Überlegung, wenn es sich nicht gerade um Gefühle handeln würde. Diese nämlich zählen zu den weniger eindeutig strukturierten Gegebenheiten des Erlebens, sodass die Festlegung von Strukturen in diesem Bereich eher dem Typus von kollektiven Leistungen des Bestimmens entspricht, als dem von Leistungen des Erkennens. Da die Phänomene selber kein bestimmtes System zwingend nahelegen, haben verschiedene Sprachgemeinschaften unterschiedliche Abgrenzungen in diesem Bereich vorgenommen, was zu unterschiedlichen Denotationen der Gefühlsbegriffe geführt hat, wie wir sie selbst zwischen standardeuropäischen Sprachen feststellen können. Die Psychologie geht davon aus, dass sprachliche Konventionen und das Erleben dadurch zusammenstimmen, dass Kinder lernen, die Gefühlsnuancen zu erleben, die im sprachlichen Inventar ihrer Kultur vorgesehen sind. Wenn aber das Erleben wesentlich 5 bedingt ist durch die Konzepte, die eine Gemeinschaft in diesem Bereich gebildet hat, dann erscheint es legitim, die Sprache als Königsweg zur Erforschung der Ordnung der Phänomene zu benutzen. Genau genommen wird auf diesem Weg jedoch nicht die Struktur der Phänomene selber rekonstruiert, sondern wie schon ausgeführt die interne Repräsentation, die wir über die Struktur der Phänomene gebildet haben. Dieser theoretische Ansatz hat die keineswegs triviale Implikation, dass Gefühle keine reinen Naturphänomene sind, die Psychologen nur noch identifizieren und benennen müssten. Gefühle sind immer auch kulturell überformt. OSGOOD (1966) hat in diesem Zusammenhang die Hypothese aufgestellt, dass lediglich die Grunddimension des Raumes möglicher Gefühle für alle Menschen dieselben sind. Die jeweiligen Abgrenzungen in diesem Raum und die verbalen Etikettierungen sind kollektive Leistungen verschiedener Sprachgemeinschaften. Da Kultur eine historische Dimension hat, impliziert der hier vorgetragene theoretische Ansatz immer auch die Notwendigkeit einer Kulturgeschichte des Fühlens. Davon ist in anderen Beiträgen dieser Tagung die Rede. Ich möchte mich im Folgenden darauf beschränken, die Schritte zu skizzieren, die zu einer Rekonstruktion des Gefühlsraums führen und Ihnen 6 abschliessend das Ergebnis einer solchen Rekonstruktion demonstrieren. Der erste Schritt der Analyse besteht darin, die Reizobjekte zu bestimmen, die in die Untersuchung einbezogen werden sollen. Wenn diese eine überschaubare Menge bilden, wie z.B. die politischen Parteien der Schweiz oder die Verwandtschaftsbegriffe, kann man die, wie die Statistiker sagen, 'Grundgesamtheit' untersuchen. Bei den Gefühlsbegriffen jedoch ist diese Grundgesamtheit viel zu gross, um vollständig einbezogen zu werden. In einem solchen Fall zieht man eine Stichprobe aus der Menge der Gefühlsbegriffe. Aus ökonomischen und technischen Gründen ist eine Stichprobengrösse zwischen 20 und 30 Objekten optimal. Im zweiten Schritt werden die Ähnlichkeiten zwischen den ausgewählten Objekten bestimmt. Im Falle der Untersuchung, die ich Ihnen präsentieren möchte und die ich selber 1982 durchgeführt habe, ist das mit Hilfe der Methode des fortgesetzten freien Assoziierens geschehen. Die Grundannahme dieses Verfahrens ist, dass zwei Gefühlsbegriffe, die in der internen Repräsentation des Gefühlsraums nahe beieinanderliegen – wie z.B. Eifersucht und Neid – mehr gleiche Assoziationen auslösen als Elemente, die weit voneinander entfernt liegen wie z.B. Neid 7 und Liebe. So kann die Menge gemeinsamer Assoziationen zu zwei Begriffen als Indikator gedeutet werden für die Distanz dieser Elemente in der internen kognitiven Struktur der Vpn. Solche Berechnungen des Prozentsatzes gemeinsamer Assoziationen werden zwischen allen Begriffen angestellt. Daraus resultiert eine Tabelle von Ähnlichkeitswerten, die Sie sich vorstellen können wie eine Tabelle der Entfernungen zwischen Schweizer Städten, nur dass hier jetzt anstelle der Städtenamen Gefühlsbegriffe stehen und statt der Kilometer-Angaben Überlappungs-Koeffizienten, so heisst nämlich das berechnete Ähnlichkeitsmass. Natürlich geben diese Koeffizienten keine im metrischen Sinne exakten Distanzen wieder, aber sie können ordinal gedeutet werden, derart, dass grössere Werte auch grössere Nähe anzeigen als kleinere Werte. Aus solchen vergleichsweise 'weichen' Daten, und das ist beim Aufkommen dieser Technik ein viel bestauntes 'Wunder' gewesen, vermag eine NMDS nach langwierigen schwierigen Berechnungen und einem Durchlaufen oft von mehr als 100 Iterationsschleifen eine quasi-metrische Lösung zu erzeugen. Im Falle der Untersuchung von 1982 sah diese folgendermassen aus: 8 Abbildung 1: Gefühlsraum, 1982 Ich möchte mich jetzt noch nicht mit einzelnen Positionen befassen, sondern zuerst auf den zentralen Aspekt der Untersuchung abheben, nämlich auf die semantischen Dimensionen des Raums, die in Form von Pfeilen dargestellt sind. Der waagerechte Pfeil stellt die Dimension "Lust-Unlust" dar, der nicht ganz senkrechte die Dimension "Aktivation", bzw. "Erregung". Dass diese beiden Dimensionen nicht perfekt onthogonal zueinander stehen, entspricht den tatsächlichen Einschätzungen der Vpn: Unlustvolle Gefühle werden von ihnen eher als aktivierend eingestuft als lustvolle. Das erscheint auch für den Phänomenbereich nicht ganz unplausibel: Neid, Hass und Ärger bringen uns eher dazu, aktiv zu werden als Zuneigung und Zufriedenheit. Ausgehend von theoretischen Überlegungen, aber auch experimentellen Befunden, die bei der Analyse des Feldes der Verwandtschaftsbegriffe angefallen waren und die eine Dominanz-Hierarchie der semantischen Dimensionen aufzeigten, wurde 1985 ein zweites Experiment durchgeführt. Um die besonders dominante Lust-Unlust-Dimension zu neutralisieren, wurden die Teilräume der positiven und der negativen Gefühlsbegriffe je getrennt analysiert. Dabei konnte, wie erwartet, 9 eine dritte Dimension des Raumes möglicher Gefühle identifiziert werden. Diese Dimension repräsentiert die soziale Komponente des Fühlens, und wurde deshalb als "soziale Nähe – soziale Distanz" bezeichnet. Abb. 2: Positive Gefühlsbegriffe // Abb. 3: Negative Gefühlsbegriffe Natürlich ist eine solche Kartierung schon um ihrer selbst willen interessant; denn sie erweitert unser Wissen über die Ordnungen der Dinge in unseren Köpfen. Man kann sie benutzen, um sich zu unterschiedlichen Zwecken in diesem Raum zu orientieren. Um die Karte zu lesen und zu verstehen, wird freilich vorgängig phänomenologisches Wissen benötigt; umgekehrt aber sollte das Studium der Karte solches Wissen nicht nur bestätigen, sondern auch ergänzen und bereichern, im besten Falle unseren Blick auf so noch nicht bekannte Tatsachen lenken und auch zu neuen phänomenologischen Überlegungen Anlass geben. Die Erkenntnisse in beiden Bereichen sollten also konvergieren, je weiter unser Wissen fortschreitet. Ich möchte das an einem konkreten Beispiel demonstrieren. Betrachten wir dazu noch einmal den Raum der positiven 10 Gefühle. Sie finden dort drei Gefühle eingetragen, die wir in unserem Alltagsverständnis als eng zusammengehörig empfinden: Liebe, Glück, Lust. In der vorliegenden Karte sind diese drei Konzepte jedoch relativ weit voneinander entfernt dargestellt. Diese Darstellung hat schon mehrfach Fragen ausgelöst, sogar Zweifel genährt, ob die Methode tatsächlich zu „vernünftigen“ Ergebnissen führt. Das gibt zu phänomenologischen Überlegungen Anlass, Anlass dazu, Liebe zu erklären. Wenn man Menschen auffordert, spontan Gefühle zu nennen, wie sie ihnen gerade einfallen, dann kommt unter Freude, Neid, Sehnsucht und Wut an prominenter Stelle immer auch Liebe vor. Scham, Schuld oder Reue werden nur selten erwähnt; aber das ist eine andere Geschichte. An dieser Stelle soll die Frage aufgeworfen werden, ob mit dem Wort „Liebe“ tatsächlich ein Gefühl gemeint ist wie all die anderen, die da aufgezählt wurden, wie Ärger, Hoffnung, Eifersucht. Wenn jemand sagt, er sei zornig, dann weist er damit auf eine aktuelle Befindlichkeit hin, auf einen Zustand, der sich zugleich im Körper manifestiert als messbare physiologische Erregung und im Erleben als besondere qualitative Veränderung des Bewusstseins. Eine solche Emotion hat einen Auslöser, entfaltet 11 sich zu einer bestimmten Intensität und klingt wieder ab. Niemand ist ständig zornig, traurig oder in höchstem Masse aufgekratzt. Wenn er es wäre, würden wir das als ein pathologisches Problem betrachten, das in schwereren Fällen einer therapeutischen Intervention bedarf. Mit der Liebe verhält es sich anders. Da ist es nicht nur erlaubt, da wird es geradezu erwartet oder doch erhofft, dass sie ein ganzes Jahr und noch viel mehr andauern, ja, dass sie im Idealfall kein Ende mehr nehmen möge. Dennoch kann es vorkommen, dass wir uns über einen Menschen, den wir lieben, von Zeit zu Zeit auch einmal ärgern, dass wir gar Wut auf ihn empfinden, dass er uns vorübergehend gleichgültig lässt. Trotzdem würden wir behaupten, auch während des Ärgers, der Wut und selbst der Gleichgültigkeit nie aufgehört zu haben, ihn zu lieben. Liebe meint also offensichtlich nicht nur aktuell erlebte Zuneigung zu einem Menschen, sondern auch so etwas wie eine Disposition, für diesen Menschen immer wieder Zuneigung zu empfinden. Anders ausgedrückt: Liebe ist das Gefühl, das eine dauerhafte emotionale Bindung an eine andere Person widerspiegelt. Solche Bindungen sind der Kitt, der menschliche Gemeinschaften zusammenhält, ja, sie überhaupt erst ermöglicht. Schon Aristoteles hat den Menschen bekanntlich als „zoon politicon“ 12 definiert, also als politisches oder Herdentier. Das gilt jedoch nur in einem eingeschränkten Sinne: Der Mensch ist von Natur aus nicht Bürger eines grossen Gemeinwesens, sondern Mitglied einer Familie. Die emotionalen Bindungen, die wir zunächst an die Eltern und andere Bezugspersonen, dann an Sexualpartner und schliesslich an die eigenen Kinder entwickeln, sind der Ursprung der Liebe, so wie der Verlust von Bindungspartnern der Ursprung der Trauer ist. Solche Bindungen sind jedoch nicht nur die Quelle von Zuneigung, sondern auch von Gefühlen der Geborgenheit, der Sicherheit, des Aufgehobenseins und der Zugehörigkeit. Sie alle stabilisieren eine Beziehung auch dann noch, wenn die Zuneigung geringer wird, vielleicht sogar in Abneigung umschlägt. Das erklärt, warum misshandelte Kinder weiter an ihren Eltern hängen oder geschlagene Frauen trotzdem bei ihren Partnern bleiben. Sie lieben sie eben immer noch, nicht im Sinne einer erlebten Zuneigung, sondern im Sinne einer weiterhin bestehenden Bindung. Freilich bekommt das Wort „Liebe“ in diesem Kontext eine andere Semantik: Zuneigung und damit verbundene Glücksgefühle sind jetzt nicht mehr notwendiger, sondern nur noch potentieller Bestandteil von Liebe. 13 Und der Sex? – Muss, wenn von Liebe die Rede ist, nicht auch etwas über Sexualität gesagt werden? Obwohl bereits die Griechen eine klare Unterscheidung zwischen der sexuellen und der allgemeinen Menschenliebe gemacht haben, ist seit Freud der Verdacht in der Welt, dass es bei der Liebe immer auch um Sexuelles geht, dass die vielbeschworene Macht der Liebe sich letztlich aus der Libido herleitet, also aus der sexuellen Lebensenergie. Bindungen entstehen in der Sichtweise Freuds dadurch, dass andere Personen (, in der herzlosen Sprache der Psychoanalyse „Objekte“ genannt,) mit gewissen Portionen der Libido „besetzt“ werden. Da die Libido zunächst auf den eigenen Körper gerichtet ist, lieben wir immer zuerst uns selbst, dann lernen wir, auch andere zu lieben. Da diese Liebe jedoch dem sexuellen Begehren abgemietet ist, müssen wir dabei ebenfalls lernen, auf die Erfüllung eines solchen Begehrens zu verzichten – abgesehen von der einen grossen Ausnahme; aber das kommt später. Der Kitt, der eine Lebensgemeinschaft zusammenhält, wäre also das Begehren, auf dessen Erfüllung verzichtet wird, wäre, in der Sprache Freuds, sublimierte Libido. Freilich mutet das befremdlich an, die Familie primär als den Ort des nicht vollzogenen Inzests zu sehen. Das ist eine Folge des Blickpunkts der klinischen 14 Pathologie, aus dem heraus Freud seine Theorie und seine Terminologie entwickelt hat. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, ist das „Normale“ immer nur der nicht eingetretene Defekt. Doch selbst wenn in jeder intensiven menschlichen Beziehung eine erotische Komponente mitschwingen sollte, bedeutet das noch lange nicht, dass sich aus dem Vollzug der Sexualität allein auch schon Bindungen ergäben, gar Liebe entstehen müsse. Die Phänomene der Prostitution und der Vergewaltigung belegen eindrucksvoll, dass Lustgewinn gesucht und gefunden werden kann ganz ohne Zuneigung, gar Bindung an das Lustobjekt. (In diesem Kontext erscheint die psychoanalytische Terminologie durchaus angemessen...) Bei Arten, die keine oder zumindest keine gemeinsame Brutpflege beider Eltern kennen, mag eine solche eher dem Typus einer Vergewaltigung entsprechende Form der Sexualität für die erfolgreiche Reproduktion ausreichen. Wir können solche Formen im Hühnerhof beobachten oder bei Eidechsen. Bei Arten, bei denen sich beide Eltern noch längere Zeit hindurch gemeinsam um das Aufkommen ihres Nachwuchses kümmern, müssen sich zumindest temporäre Bindungen zwischen Geschlechtspartnern ausbilden. 15 Zu diesem Zwecke (und zu einigen anderen, die an dieser Stelle nicht erörtert werden müssen,) hat die Natur uns ein körpereigenes Belohnungssystem eingebaut, das für die Euphorie von frisch Verliebten verantwortlich ist. Sie sind gewissermassen drogenabhängig, wenn auch abhängig von einem im Körper selber produzierten Stoff. Auf diese Weise werden sie lange genug beieinander gehalten, dass zwischen ihnen eine Bindung wachsen kann, stabil genug, auch unlustvolle Situationen auszuhalten; denn die kommen ja unweigerlich, früher oder später. Ob tatsächlich etwas gewachsen ist, muss sich allerdings erst weisen, wenn der Dauerrausch der Verliebtheit vorbei ist. Erst dann zeigt sich Liebe – oder eben auch nicht. Auf keinen Fall sollte man Verliebtheit schon für Liebe halten, sie weist zwar den Weg dahin, dass aber das Ziel auch erreicht wird, ist nie eine sichere Sache. Es gibt süchtig Gewordene, für die längst der Weg das Ziel geworden ist und die am Ende des Rausches, kurzzeitig ernüchtert, sogleich eine neue Partnerschaft suchen, um nach Möglichkeit ständig auf dem Kamm der Woge zu reiten. Das ist die Strategie des Don Juan. Er ist nicht im eigentlichen Sinne ein Sexbesessener, über den Fall wird noch zu reden sein, er ist ein Junkie, die Frau ist für ihn nur das Instrument, um an das Dope heranzukommen; und um da 16 heranzukommen, ist er, wie alle, die an der Nadel hängen, völlig hemmungslos und bereit, selbst zu lügen, zu stehlen, ja, wenn es sich unglücklicherweise so ergibt, auch zu töten. Die Sucht deformiert den Charakter – jede Sucht. Was den Don Juan für Frauen so unwiderstehlich macht, ist die Tatsache, dass er sein Liebesgeflüster selber glaubt, dass das alles wirklich wahr ist – solange der Rausch anhält; denn das ist eine der Nebenwirkungen der körpereigenen Droge, dass sie die Kritikfähigkeit diese eine besondere Person betreffend buchstäblich lähmt. Das Sprichwort weiss das schon lange, die Neuropsychologie hat es kürzlich bestätigt: Liebe macht blind. Genauer müsste es freilich heissen: Verliebtheit. Liebe sieht sehr wohl, sie macht nicht blind, sie macht nachsichtig. Liebe ist, wenn man trotzdem Zuneigung empfindet; und es gibt immer ein Trotzdem oder auch zwei... Das Glücksgefühl der Verliebtheit ist nicht zu verwechseln mit dem Lustgefühl, das purer Sex hervorrufen kann, der ohne jede Bindung, Beziehung oder Zuneigung vollzogen wird. Der reine Triebablauf kann jedoch auch zur Besessenheit werden, kann Männer zu Prostituierten treiben oder zu Vergewaltigern machen. Während für den Don Juan die Frau eine Königin ist, wenn auch auf Zeit, ist sie für den Sexbesessenen, wie übrigens auch für den 17 Sadisten, nur ein Objekt, das er kalten Herzens konsumiert, ja, das er vielleicht sogar verachtet. Dieser aus grosser emotionaler Distanz heraus praktizierten Sexualität haftet immer das Erniedrigende der Verrichtung einer Notdurft an. Im Grunde ist die daraus bezogene Lust nur die Rückseite der durch einen allzu drängenden Triebreiz aufgestauten Unlust. Ist dieser quälende Drang endlich zur Ruhe gebracht, stellt sich sehr schnell ein übler Nachgeschmack ein. Das wusste man schon in der Antike: post coitum omne animal triste. Das Lustgefühl wird schnell verdrängt durch ein Gemisch aus Abneigung, Scham und Überdruss. Das Glücksgefühl der Verliebtheit dagegen ist sehr viel nachhaltiger, es kann ganze Tage, ganze Lebensabschnitte erhellen. Doch weder Glück noch Lust führen mit Sicherheit zu stabilen Bindungen. Sie sind zwar notwendige, aber noch keineswegs schon hinreichende Voraussetzungen für das Entstehen von Liebe. Sie sind, wenn es gut geht, Durchgangsstadien auf dem Weg dahin. Man könnte etwas überpointiert geradezu formulieren: Liebe ist das, was bleibt, wenn der Rausch der Verliebtheit verflogen ist und der Sex keine so wichtige Rolle mehr spielt – wenn dann noch etwas bleibt... Man kann sie jedoch auch positiv definieren: Liebe ist das immer wieder als spontane Zuneigung erlebte Gefühl einer stabilen Bindung an einen anderen Menschen. 18 Lust dagegen sucht nicht den anderen, Lust sucht sich selbst, ihre Befriedigung ist letztlich Selbstbefriedigung. Das dabei benutzte Objekt hat nur vorübergehenden Wert, ist gewissermassen „Verbrauchsmaterial“ im Dienste der Lusterzeugung, das „danach“ entsorgt und dann getrost vergessen werden kann. Erst wenn Liebe ins Spiel kommt, wird es möglich, im Objekt ein anderes Subjekt zu sehen und damit die Grenze des eigenen Ichs zu überschreiten in Richtung auf ein Du, und zwar dauerhaft und real und nicht nur vorübergehend und virtuell wie das bei der Verliebtheit der Fall ist. Verliebte sind vernarrt in ein phantasiertes Idealbild, das sie auf eine andere Person projizieren, Liebende empfinden Zuneigung zu einer real existierenden Person wie sie tatsächlich ist. Nun ist Liebe nicht das einzige Gefühl, das sich der Bildung einer festen Grenze um das eigene Ich verdankt und der daraus resultierenden Notwendigkeit, über diese Grenze hinauszugelangen, um ein soziales Wesen werden und bleiben zu können. Vor allem der Antagonismus von Scham und Schuld, von Sich-Öffnen und Sich-Verschliessen, regelt, wieviel Nähe im Umgang mit den anderen möglich, aber auch, wieviel Distanz nötig ist. Während wir jedoch Scham empfinden können vor jedem, der Augen hat, uns zu sehen, trifft Liebe eine sehr 19 begrenzte Auswahl. Sie ist immer exklusiv und zugleich auch das sichere Gegenmittel gegen die Sprödigkeiten der Scham, sie lässt Intimität zu, physisch und psychisch. Der Anspruch der Exklusivität wird im Erleben manifest im Gefühl der Eifersucht. Nun muss am Ende auch noch von ihr die Rede sein; denn auch sie ist ein Aspekt der Liebe. Auch wenn sie entarten kann und sich materialisieren in so bizarren Dingen wie Keuschheitsgürteln und Haremsmauern, so sollte man sie doch nicht grundsätzlich schlecht reden oder gar ganz für überflüssig erklären. Die Exklusivität liegt im Interesse beider Partner, wenn auch aus unterschiedlichen Motiven. Darüber, dass sie gewahrt bleibt, muss zwar nicht unbedingt ein Argus wachen oder ein blindwütiger Berserker; aber es sollten zu diesem Dienst auch nicht gerade die törichten Jungfrauen aufgeboten werden. So zeigt sich am Ende, dass Eifersucht das Negativ der Zuneigung ist, dass zur Freude an einer Beziehung immer auch die Sorge gehört um den Bestand. Wenn es gut ist, ist es Zuneigung, wenn es wehtut, ist es Eifersucht – und in beiden Bewusstseinsqualitäten wird Bindung erlebt, geht es um Liebe. Literatur: 20 Marx, Wolfgang (1982): Das Wortfeld der Gefühlsbegriffe. Zeitschrift für Experimentelle und Angewandte Psychologie, 29, 137-146. Marx, Wolfgang (1985): Semantische Dimensionen positiver und negativer Gefühlsbegriffe. Archiv für Psychologie, 137, 6573. Marx, Wolfgang (1989): Geographie der Leidenschaft. Sturzflüge, 28, 43-45. Marx, Wolfgang (1997): Semantische Dimensionen des Wortfelds der Gefühlsbegriffe. Zeitschrift für Experimentelle Psychologie, 44, 478-494. Osgood, Charles F. (1966): Dimensionality of the semantic space for communication via facial expression. Scandinavian Journal of Psychology, 7, 1-30. Schlosberg, Herbert (1952): The description of facial expressions in terms of two dimensions. Journal of Experimental Psychology, 61, 81-88. Traxel, Werner & Heide, H.J. (1961): Dimensionen der Gefühle. Psychologische Forschung, 26, 179-204. 21