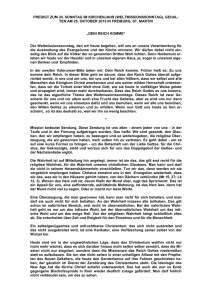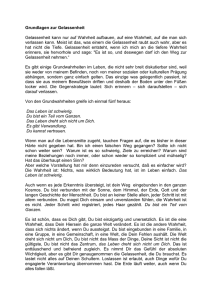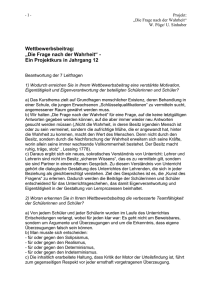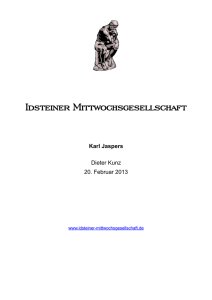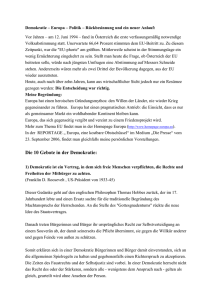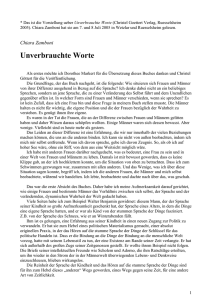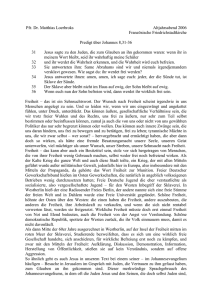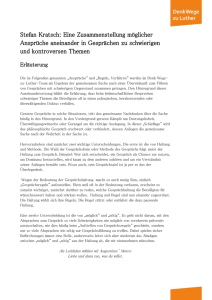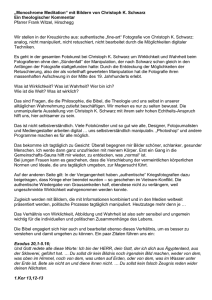Forschung als Kontaktprozess
Werbung

Anita Barkhausen FORSCHUNG ZWISCHEN ELFENBEINTURM UND KONTAKT Assoziationen einer Forschungssupervisorin Was für Bilder haben wir im Kopf, wenn wir an wissenschaftliche Forschung denken? Lassen wir einmal unsere Vorurteile und stereotypen Vorstellungen zu Wort kommen. Vor unserem inneren Auge erscheint ein Schreibtisch mit überdimensional wirkendem PC und überquillendem Aschenbecher. Ein paar schmutzige Kaffeetassen stehen herum. Der Schreibtisch hat schon bessere Tage gesehen und wird flankiert von Türmen aus Aktenordnern auf dem Boden. Halbvertrocknete Pflanzen stehen auf der Fensterbank und bemächtigen sich des wenigen Tageslichts, das die halbblinden Scheiben hindurchlassen. Unabhängig von der Tageszeit brennt Neonlicht von der Zimmerdecke. Mitten in diesem Szenario sitzt eine – irgendwie geschlechtsneutral wirkende - schlaksige Gestalt mit Ringen unter den Augen und nach vorne hängenden Schultern. Wissenschaftliches Forschen assoziieren wir mit einsamem Arbeiten fernab der Lebenswirklichkeit. Was sind das für Menschen, die sich freiwillig der Forschung verschreiben? Eine kontaktarme Spezies, welche ihre Not zur Tugend macht und sich dabei immer weiter vom sinnlichen Leben und dem Dunstkreis menschlichen Miteinanders entfernt? Kann man mit so jemandem beim Essen übers Wetter plaudern oder landet man dann mindestens bei der Verifikation einer komplexen Theorie zur globalen Klimaverschiebung? Bleiben wir noch etwas bei unserem Unbehagen an der Forschung und heben das skizzierte Szenario auf ein etwas höheres Abstraktionsniveau. Im Elfenbeinturm der Universität vermuten wir gerade in den Sozialwissenschaften eine Nische für Menschen, deren Forschungsleistungen zugleich durch den Wunsch und durch die Angst angetrieben werden, mit der sozialen Wirklichkeit in Kontakt zu treten. Methodische Kontrollinstrumente gewährleisten ihnen immerhin eine ausreichende Distanz, um dem Forschungsinteresse an sozialen Phänomenen weitgehend angstfrei und unangefochten nachgehen zu können (vgl. Devereux 1992). Das hehre Ziel der objektiven Erkenntnisgewinnung befreit zumindest einige Stunden am Tag von der verunsichernden Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Zu Forschungszwecken kann jede, noch so beunruhigende soziale Interaktion ordentlich aufgespaltet werden in das forschende Subjekt und das zu erforschende Objekt, und wird somit vorhersehbar, messbar, be-„greifbar“. Als Gestalttherapeuten haben wir uns von solchen Forschungskontexten bewußt abgewandt und verkörpern – um nun ebenfalls im Stereotyp zu bleiben – mit unserer sinnlichen Hingabe an das Hier und Jetzt einer Begegnung geradezu die Antithese des eingangs beschriebenen Forschertypus. Diese scheinbare Negativbeziehung zwischen Gestalttherapie und wissenschaftlicher Forschung werde ich im folgenden kritisch hinterfragen und aufzuzeigen versuchen, dass - genauso wie in therapeutischen Prozessen - der Erkenntnisgehalt beim Forschen davon abhängt, wie lebendig die Kontaktprozesse zwischen der forschenden Person und den zu erforschenden Phänomenen verlaufen. Dazu werde ich fünf Missverständnissen nachgehen, die in dem oben beschriebenen Forschungs-Szenario enthalten sind. 1 MISSVERSTÄNDNIS NUMMER EINS: Forschung ist monolithisch Die Wissenschaft oder die Forschung gibt es genau so wenig, wie es die Therapie gibt. Hinter den unterschiedlichen Ausrichtungen von empirischen Forschungsansätze verbergen sich, wie wir wissen, meilenweite Differenzen, was das Menschenbild und die zugrundeliegende Haltung anbelangen. Natürlich gibt es die herkömmlichen Forschungsstandards an „sauberes“ empirisches Arbeiten, die verlangen, dass man vorab Thesen aufstellt, um sie dann möglichst mechanistisch mit eindeutigen Auswertungsschritten in bestimmter Reihenfolge zu überprüfen. Aber wie wir in der Gestalttherapie keinen Schreibtisch zwischen uns und unsere Klienten stellen, keinen weißen Kittel anziehen oder vorweg eine Diagnose stellen, die dann mit Hilfe eines zeitlich festgelegtenTherapieplans geheilt würde, so gibt es auch in der empirischen Forschung prozessorientierte und ganzheitliche Vorgehensweisen, die ihre Theorien erst entwickeln, nachdem sie sich auf das Feld eingelassen haben. Eine solche methodische Vorgehensweise bietet die „Grounded Theory“ (Strauss & Corbin 1996). Statt durch die Brille einer abstrakt entwickelten Theorie auf ein Forschungsfeld zu blicken, erfolgt hier die Theoriebildung aus den nur subjektiv wahrnehmbaren Eigenheiten des Feldes heraus. Als ForscherIn heißt das, den sicheren Außenstandpunkt aufzugeben, sich involvieren zu lassen und den weißen Kittel auszuziehen (vgl. Hahn 2001). Nach herkömmlichen Standards ist die Grounded Theory eine „unsaubere Methode“, weil sie mehrdimensional genug ist, um sich für das Unvorhergesehene, sprich: die ganze Komplexität eines Feldes zu interessieren. In diesem qualitativen Methodenansatz findet die Gestalttherapie meines Erachtens ein interessantes Forschungs-Pendent für ihre praktische Arbeitsweise. MISSVERSTÄNDNISS NUMMER ZWEI: Forschen ist einsam Während wir in der Therapie oder auch im täglichen Miteinander einen „interpersonalen Dialog“ führen, pflegen wir bei den geistigen Tätigkeiten, also im Denken und Forschen, vor allem den „intrapersonalen Dialog“. Was heißt das? „Interpersonaler Dialog” beschreibt die Beziehung, die eine Person zu einer anderen Person eingeht, während „intrapersonaler Dialog” die Beziehung bezeichnet, die jemand denkend zu sich selbst eingeht (vgl. Hyatt 1992). Doch wem antworten wir, wenn wir denken? Wen fragen wir im stummen Gespräch mit uns selbst? Mikhail Bakhtin ist der Auffassung, dass es die internalisierten Anderen sind, denen wir antworten, wenn wir denken. „A person has no internal sovereign territory, he is wholly and always at the boundary; looking inside himself, he looks into the eyes of another or with the eyes of another” (Bakhtin 1984, 287). Zum Verhältnis zwischen interpersonalem und intrapersonalem Dialog vertritt er die Position, dass intrapersonale Dialoge von einer einzigen Person nur geführt werden können, wo individuelle Differenzen und Widersprüche durch soziale Vielfalt reichhaltig genährt werden; wo ein dialogischer Widerhall im Denken einer Person nicht auf abstrakte, semantische Höhen verbannt wird, sondern von der sinnlichen Erfahrung dialogischen Sprechens im Kontakt mit Anderen durchdrungen ist (vgl. Bakhtin 1981). In diesem Sinne möchte ich die geistigen Tätigkeiten, das Denken und Forschen, als intrapersonalen Dialog mit den internalisierten Anderen begreifen. 2 Weiter ausgeführt hat diesen Gedanken Hannah Arendt. Für sie ist es gerade der Unterschied zwischen mir und mir, der das Denken zu einer wirklichen Tätigkeit macht, „in der man gleichzeitig der Fragende und der Antwortende ist” (Arendt 1989, 184). Die Aufspaltung des Bewusstseins in „Zwei-in-einem” (ebd. 179) aktualisiert laut Arendt mit dem inneren Unterschied die unendliche Vielzahl menschlicher Perspektiven. Und so kommt es, dass der Mensch im Arendtschen Sinne auch dann nicht einsam ist, wenn er allein ist. Denn er ist mit sich selbst zusammen; „und dies Selbst, das niemals zu einem leiblich unverwechselbar Bestimmten werden kann, ist zugleich auch jedermann” (Arendt 1996, 977). Im Denken ist der Mensch nicht einsam sondern „zweisam”, weil er sich ein inneres Gegenüber schafft. Denken im Arendtschen Sinne ist daher kein stummer Monolog. Es ist gerade dialogisch und in Gesellschaft mit den internalisierten Anderen. Es erweitert die gewohnte eigene Perspektive um denkbare andere und bezieht insofern die Pluralität der Anderen ins innere Zwiegespräch mit ein. Foucault bezeichnet kritisches Denken als eine dialogische Haltung, die „statt zu rechtfertigen, was man schon weiß, in der Anstrengung liegt, zu wissen, wie und wie weit es möglich wäre, anders zu denken” (Foucault 1986, 16). Kritisches Denken im Foucaultschen Sinne wäre also gerade eine Kultivierung des Zweifels. Es wäre ein Denken, das sich selbst provoziert und das eigene, bisherige Verständnis eines Sachverhaltes gegen den Strich bürstet. Auch Lévinas hält nichts von einem selbstgewissen „Wissen, in dem das Andere dem Selben gehört” (1995a, 13). Wissenschaftliches Denken, das sich ein Phänomen der Welt aneignen will, es in Besitz nehmen, es be-greifen will, ist nicht das, was ihn reizt (vgl. 1995b). Lévinas beendet seine Gedankengänge gerne mit einer Frage und schließt sie dadurch gerade nicht ab. Sein Denken „hält ihn ausgespannt auf das Andere hin” (Wenzler 1995, 89). Dialogisches Denken, das sich der Andersartigkeit des anderen Menschen nicht verschließt, denkt mehr, als es von sich aus denken kann. Lévinas nennt solch ein dialogisches Denken „Verlangen” (ebd. 78). Eine lebendige Forschung, der es nach neuen Erkenntnissen „verlangt“, zeichnet sich durch permanenten intrapersonalen und regelmäßig aufgesuchten interpersonalen Dialog aus. MISSVERSTÄNDNIS NUMMER DREI Forschung ist neurotisch Der Rückzug des Forschers von der sinnlichen Gegenwart des täglichen Lebens ist kein primärer Ausdruck von Kontaktstörung oder Lebensangst. Ein bewusst vorgenommener, zeitweiliger Rückzug in eine raumzeitliche Nische ist vielmehr unabdingbar, um den vollen Kontakt zwischen forschender Person und zu erforschendem Phänomen zu gewährleisten. Wie wir in der Therapie einen von alltäglichen Störungen weitestgehend geschützten Zeit-Raum schaffen, um unseren KlientInnen zu ermöglichen, grundlegend neue Erfahrungen zu machen, so können laut Hannah Arendt gerade die geistigen Tätigkeiten nur durch einen bewussten Rückzug von den Erscheinungen zustande kommen. Es ist weniger der Rückzug von der Welt [...], als vielmehr ein Rückzug von der sinnlichen Gegenwart der Welt. Jeder geistige Akt beruht darauf, dass sich der Geist etwas vergegenwärtigen kann, was den Sinnen nicht gegenwärtig ist. Die Vor-Stellung, die das faktisch nicht Gegenwärtige vergegenwärtigt, ist die besondere Fähigkeit des Geistes [...]. Doch das kann der 3 Geist erst, wenn er sich von der Gegenwart und den Nöten des täglichen Lebens zurückgezogen hat (Arendt 1989, 81f.). Als politische Philosophin pflegte Hannah Arendt einen starken Bezug zur Welt. Und sie gewährleistete diesen Bezug zum öffentlichen Raum über ihre Rückzüge ins Private. In privaten Raum-Zeit-Nischen durchdachte sie die rasanten politischen Veränderungen des 20. Jahrhunderts. Heute, zum beginnenden 21. Jahrhundert, sind die raumzeitlichen Nischen des Rückzugs, die es für geistige Tätigkeiten im Arendtschen Sinne braucht, auch im Wissenschaftsbetrieb nicht mehr selbstverständlich. Sie müssen zunehmend erkämpft und dem durchgetakteten Arbeitsleben abgetrotzt werden. Internet, E-Mails und globale Vernetzungsbestrebungen sorgen für einen ständigen Reaktionsnotstand im Kampf um die neuesten Informationen. In einer raumzeitlich beschleunigten, omnipräsenten Welt sind WissenschaftlerInnen derzeit vor die Aufgabe gestellt, eine neue Balance zwischen globaler Informationsvernetzung und raumzeitlichen Rückzügen zu finden. MISSVERSTÄNDNIS NUMMER VIER: Forschung ist objektiv Wenn man den Gedanken der Relativität ernstnimmt, dann gibt es keine absoluten, für alle Menschen und alle Zeiten gültigen Erkenntnisse. Der weit verbreitete Gedanke, dass man Wahrheit einmal herausfinden und dann besitzen könne, ist vom missionarischen Kolonialismus geprägt und als solcher ausgesprochen monologisch konnotiert (vgl. Todorov 1985). Die „Wahrheit” der Missionare war von anderen Menschen nicht abhängig, war nur für sie, zu ihrem Heile, war ihnen zu verkünden (vgl. Jaspers 1991). Im Unterschied zu einem derart herrschaftlich besetzten Wahrheitsverständnis unternimmt Jaspers (1987, 1991) den Versuch, Wahrheit dialogisch zu bestimmen. Er betont, dass Wahrheit gerade nicht „in sich geschlossen, objektiv, aus der Zeit herausgenommen, für sich vollkommen” ist (Jaspers 1991, 587). Sie ist vielmehr auf das Miteinander von Menschen angewiesen und in ihrer Tiefe kommunikativ (vgl. Jaspers 1987). Kein Mensch, auch kein wissenschaftlicher Experte, kann in seinem endlichen Zeitdasein eine ausschließliche Wahrheit für alle erlangen. Für Jaspers gelangt ein Mensch „zur Wahrheit nur unter der Bedingung grenzenloser Kommunikation. Wahrheit zeigt sich nur in Erscheinungen, die unlösbar von Kommunikation sind. Der Sinn von Wahrsein ist wesentlich in Kommunikation und nie ohne sie” (Jaspers 1991, 587). Auch Buber vertritt die Auffassung, für die Wahrheit zwischen Menschen gelte kein „So ist es” oder „So ist es nicht”, gelte kein Sein oder Nichtsein. Vielmehr walte das „So-und-anders, das Sein-und-Nichtsein, das Unauflösbare” (Buber 1994, 92). Unter dialogischem Vorzeichen ist Wahrheit eine gemeinsame Suchrichtung in der Kommunikation zwischen Menschen (vgl. Hersch 1996). Doch es bleibt ein ewiges Suchen. Wahrheit ist laut Jaspers kein Ziel, das dann am Ende ohne Kommunikation an sich gültig wäre. Wenn eine vermeintliche Wahrheit beginnt, Endgültigkeit für sich zu beanspruchen, verliert sie die Grenze „des Fragenkönnens und des Hörenkönnens” (Jaspers 1991, 560). Und damit verliert sie auch den Raum, in dem sie sich suchend im Zeitdasein erst entfalten könnte. Die Gewissheit des Rechthabens bezeichnet Jaspers als eine Scheinüberlegenheit, deren Festigkeit allerdings von allem Fragen und Denken bedroht bleibt (vgl. ebd.). Wenn die eine Wahrheit als „objektiv“ 4 und allgemeingültig für alle behauptet wird, beginnt nach Jaspers die Unwahrhaftigkeit (vgl. Schüßler 1995). Überträgt man diese dialogische Vorstellung von Wahrheit auf wissenschaftliche Erkenntnisprozesse, dann sind Forschungsergebnisse wahr, wenn sie ihre zeitliche und örtliche Begrenztheit nicht verleugnen und stattdessen eine Suchrichtung markieren, die durch innere Kommunikation und Kontaktprozesse mit den zu erforschenden Phänomenen eingeschlagen wird. Wissenschaftliche Forschung dient nicht der objektiven Erkenntnisgewinnung im Sinne einer geronnenen, erhärteten Wahrheit, sondern einer zutiefst kommunikativen Theoriebildung mit örtlich und zeitlich begrenzter Reichweite. Von der Haltung her entspricht eine so erworbene Forschungserkenntnis in vielerlei Hinsichten dem gestalttherapeutischen Verständnis von Prozessdiagnostik. MISSVERSTÄNDNIS NUMMER FÜNF: Forschung ist (geschlechts-)neutral Als Gestalttherapeutin und Wissenschaftlerin vertrete ich den Standpunkt, dass die eigene Person in ihrer Subjektivität das zentrale Erkenntnisinstrument innerhalb beider Tätigkeitsfelder ist. Sowohl in der Psychotherapie als auch in der Wissenschaft sind Erkenntnisse eine Frage der Perspektive. Von einem bestimmten subjektiven Standpunkt aus treten wir in einen Diskurs, in einen Dialog und begegnen einem Thema, einer Situation oder einem Menschen auf persönliche, einzigartige Weise. Es ist nicht egal, ob wir das als Mann oder Frau tun, als junger oder alter Mensch, als anerkannte Staatsbürgerin oder als geduldete Migrantin. Es ist nicht egal, ob wir eher aus einer superioren oder einer inferioren Position heraus einen Sachverhalt zu verstehen suchen. Die Persönlichkeit ist ein wesentliches Werkzeug der Erkenntnisgewinnung – ein Werkzeug, das für beide Tätigkeitsfelder der Therapie und der Forschung achtsam geschult, gepflegt und supervidiert werden will – wenn auch auf eine je spezifische Weise (vgl. Blastik 1999). Forschungssupervision kann hier einen wichtigen Beitrag leisten, denn Forschen ist eine Tätigkeit an der Kontaktgrenze zwischen der wissenschaftlich arbeitenden Person und dem zu untersuchenden Phänomen (vgl. Barkhausen 2001). Aus dieser Überzeugung heraus arbeite ich seit 1999 als freiberufliche Forschungssupervisorin und verbinde dabei meine gestalttherapeutischen und wissenschaftlichen Erfahrungshintergründe. Mit diesem Angebot reagiere ich auf eine Lücke in den universitären Lehrplänen. Denn während Supervision für Psychotherapeuten zum schulenübergreifenden Standard gehört, wird sie in den Wissenschaften weiterhin vernachlässigt. Eine zentrale Arbeitsfrage in der Supervision therapeutischer Prozesse lautet: Welche Gefühle und Handlungsimpulse weckt ein spezieller Klient beim Therapeuten, und inwiefern sind diese Gegenübertragungen zurückzuführen auf eigene unerledigte Geschichten des Therapeuten bzw. wo enthalten sie Hinweise auf die Konflikte des Klienten? Als Devereux 1967 erstmalig darauf aufmerksam machte, dass es auch beim Forschen Gegenübertragungen gibt, und diese keineswegs nur als lästige Arbeitsstörungen anzusehen seien, sondern – im Gegenteil – von hohem Erkenntniswert sein könnten, war das ein bahnbrechender Gedanke. Dass Gegenübertragungen auf den Forschungsgegenstand – wenn sie als solche erkannt und genutzt werden – den Weg weisen in die Richtung neuer Erkenntnisse über diesen Gegenstand, ist eine Vorstellung, die dem traditionellen Selbstverständnis der Wissenschaft entgegenstand. Während vorher Distanz, ja Emotionslosigkeit, zwischen 5 Forschungssubjekt und Forschungsobjekt angestrebt wurden, weil man in ihnen einen Garant sah für wissenschaftlich „sauberes“ Vorgehen, wird von Devereux die wechselseitige Beziehung zwischen beiden – und damit eine Aufhebung der SubjektObjekt-Spaltung befürwortet. Leider sind Devereuxs Überlegungen nur von Teilen der Wissenschaft produktiv aufgegriffen und weiterentwickelt worden. Eine gestalttherapeutisch ausgerichtete Forschungssupervision versucht gar nicht erst, die Involviertheit der ForscherInnen ängstlich zu meiden oder methodisch zu leugnen. Vielmehr geht es darum, das schöpferische Potential aus dieser Involviertheit freizusetzen (vgl. Blastik 1999, Barkhausen 2001, 2002). Besonders angehende WissenschaftlerInnen zeigen in den letzten Jahren ein deutliches Interesse an einer solchen supervisorischen Begleitung ihrer Forschungsprozesse (vgl. z.B. Ostermann 2001). Und in der Gestalttherapie haben wir hierfür enorm viel zu bieten mit unserer systematischen Bearbeitung von Kontaktunterbrechungen in den vier verschiedenen Figurbildungsphasen von Vorkontakt, Kontaktaufnahme, Kontaktvollzug und Nachkontakt. Ich schlage vor, Forschungsprozesse wie andere Figurbildungsprozesse gestalttherapeutisch zu betrachten und als solche unterstützend zu begleiten. FORSCHUNG ALS KONTAKTPROZESS Vergleicht man den Figurbildungsprozess beim Forschen mit anderen Kontaktprozessen, so ist die ihm innewohnende Langsamkeit vielleicht sein auffälligstes Charakteristikum. So kann eine einzige Kontaktphasen viele Monate oder manchmal sogar mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Zu Beginn einer wissenschaftlichen Studie, also in der Vorkontaktphase, ist das Forschungsinteresse noch recht unspezifisch und wenig gerichtet. Die vielen Wahrnehmungen und Fragen zum Untersuchungsfeld erscheinen alle gleich wichtig. Wer in seiner Persönlichkeitsfunktion als ForscherIn zu dysfunktionaler Konfluenz neigt, verbleibt wahrscheinlich allzu lange in dieser Anfangsphase, trägt das Forschungsvorhaben jahrelang im Hintergrund mit sich herum, liest unzählige Artikel und Bücher, wobei jeder neue Input die bisherigen Ansätze einer Kontaktaufnahme wieder in Frage stellt. Um aus den unzähligen Möglichkeiten, sich einem Forschungsfeld zu nähern, einen eigenen Zugang zu wählen, ihn zur Figur werden zu lassen und damit andere Möglichkeiten zu verwerfen, bedarf es einer nicht geringen positiven Aggression (vgl. Perls u.a. 1991) und einer guten Portion bejahten Eigenwillens (vgl. Rank 1929). In dieser Phase der Kontaktaufnahme müssen oft erhebliche Hürden genommen und Widerstände überwunden werden. Angehenden Wissenschaftlern wird hier z.B. gerne von seiten ihrer wissenschaftlichen Betreuer der wohlmeinende Rat erteilt, es doch besser alles ganz anders zu machen. Gekoppelt mit der Frage: „Haben Sie eigentlich schon dieses oder jenes Buch zur Kenntnis genommen?“ lässt sich ein zaghafter Figurbildungsprozess nur allzu leicht wieder unterbrechen. Wer dazu neigt, die Normen und Werte von Autoritäten zu introjezieren, erleidet hier mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Ich-Funktionsverlust. Das deutsche Hochschulsystem mit seinen ausgeprägten Abhängigkeiten bis zum Abschluss der Habilitation im reifen Erwachsenenalter provoziert alte Mutter- oder Vaterübertragungen, die solche Dilemmata noch verstärken (vgl. Barkhausen 2001). In der Phase des Kontaktvollzugs füllt die Forschungsarbeit fast das gesamte Bewusstsein aus, während die alltäglichen Dinge, andere Bedürfnisse, andere Gesprächsthemen etc. im Hintergrund verblassen. In dieser Phase wirken WissenschaftlerInnen für die Außenwelt tatsächlich recht verschroben, werden Freundschaften riskiert und sogar Grundbedürfnisse missachtet. Die forschende Person wirft sich 6 mit all ihrer Spontanität in den Kontakt zum Forschungsgegenstand und gibt sich selbstvergessen der Eigenlogik dieses Prozesses hin. In dieser Phase des Forschungsprozesses „setzt sich die Figur selbst ihre Grenze. Es gibt daher keine IchFunktionen“ (Perls u.a. 1991, 214). Wer in dieser Forschungsphase Supervision sucht, hat meist die Frage: „Darf ich das? Darf ich so lange eintauchen in meine Forschungsarbeit und alles um mich herum vernachlässigen, oder ist das gefährlich bzw. böse?“ Diese Frage gewinnt zunehmend an Aktualität dadurch, dass die informationstechnologischen Arbeitsmittel einen Aufforderungscharakter mit sich bringen, sich jederzeit mit aller Welt zu befassen. Ständig eintrudelnde E-Mails und Internetzugänge sorgen eher für Zerstreuung, als dass sie die Konzentration auf den vollen Kontakt fördern. Wer mit der ganzen Welt vernetzt ist, muss sich erst einmal die Erlaubnis geben, den Fokus für eine längere Zeit auf das eigene Forschungsprojekt zu begrenzen. In der Phase des Nachkontakts vollzieht sich ein Trennungsprozess zwischen der forschenden Person und ihrem Werk. Zufrieden und stolz betrachtet sie das Vollbrachte, nimmt Abschied von ihm, besinnt sich wieder auf sich selbst und übergibt das Werk einer interessierten Öffentlichkeit. Es gibt verschiedene Gründe, weshalb jemand zögern mag, einen Punkt unter eine fast abgeschlossene Arbeit zu setzen. Manchmal ist es die Angst vor der Leere, die bei NachwuchswissenschaftlerInnen auch oft als existentiell erlebte Zukunftsangst benannt wird. Vielleicht ist es auch eine innere Weigerung, das eigene Werk gutzuheißen. Dann werden bestehende Kapitel zum hundertfünfundzwanzigsten Mal überarbeitet, ohne je vor den eigenen Augen bestehen zu können. Oder es ist eine verdeckte Schamthematik, die jemanden daran hindert, die Früchte jahrelanger Arbeit zu ernten. Die als bedrohlich erlebten Gefühle von Scham oder Angst werden retroflektiert und so manche Studie gerät zum Ewigkeitsprojekt bzw. verschwindet irgendwann unbeachtet in einer Schublade. Kontaktunterbrechungen treten immer wieder auf und sind in jeder der beschriebenen Forschungsphasen gegeben. Eine gestalttherapeutisch ausgerichtete Forschungssupervision unterstützt WissenschaftlerInnen wirkungsvoll darin, dass der Kontaktprozess Forschung gelingt. Was ich mir wünsche? Dass die Forschungssupervision mit dem sprichwörtlichen leeren Stuhl noch an so manchem Lehrstuhl zur Verlebendigung der Wissenschaften beiträgt. LITERATUR ARENDT, H. (1989): Vom Leben des Geistes. Band I. Das Denken. München, Zürich (Piper). ARENDT, H. (1996): Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, totale Herrschaft. München (Piper). BAKHTIN, M. M. (1981): The Dialogic Imagination. Austin (University of Texas Press). BAKHTIN, M. M. (1984): Problems of Dostojevsky’s Poetics. Minneapolis (University of Minnesota Press). BARKHAUSEN, A. (2001): Promovieren zwischen Aufbruch und Abhängigkeit. In: MOHR, D. (Hrsg.): Lost in Space: Die eigene wissenschaftliche Verortung in und außerhalb von Institutionen. Dokumentation der siebten Wissenschaftlerinnen-Werkstatt der Promovendinnen der Hans-Böckler-Stiftung vom 2. Bis 5. November 2000. 143-152. Düsseldorf (edition der Hans Böckler Stiftung). 7 BARKHAUSEN, A. (2002): Das große Werk und die kleinen Schritte. Forschungssupervision für den Alltag wissenschaftlichen Arbeitens. In: OSTERMANN, I. (Hrsg.): Perspektive: GLOBAL! Internationale Wissenschaftlerinnenkooperationen und Forschung. Dokumentation der achten WissenschaftlerinnenWerkstatt der Promovendinnen der Hans-Böcker-Stiftung vom 9. Bis 12. September 2001. Düsseldorf (edition der Hans Böckler Stiftung), im Druck. BLASTIK, A. (heute Barkhausen) (1999): Das Puzzle von Forschung und Leben zusammensetzen. In: HERZOG, M. (Hrsg.): Im Netz der Wissenschaft? Frauen und Macht im Wissenschaftsbetrieb. Dokumentation der sechsten Wissenschaftlerinnen-Werkstatt der Promovendinnen der Hans-BöcklerStiftung vom 1. Bis 3. Oktober 1999. 31-36. Düsseldorf (edition der Hans Böckler Stiftung). BUBER, M. (1994): Das dialogische Prinzip. Gerlingen (Lambert Schneider). DEVEREUX, G. (1992): Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften. Frankfurt/Main (Suhrkamp). FOUCAULT, M. (1986): Sexualität und Wahrheit. Zweiter Band. Der Gebrauch der Lüste. Frankfurt/ Main (Suhrkamp). HAHN, A. (2001): „Mir gehen die Bilder nicht aus dem Kopf“. Annäherung an ein fremdes Forschungsfeld. Gestalttherapie 1, 2001, 28-47. HERSCH, J. (1996): Karl Jaspers (1883-1969). In: HERSCH, J.: Das philosophische Staunen. Einblicke in die Geschichte des Denkens. 318-339. München, Zürich (Piper). HYATT, K. S. (1992): Creativity through intrapersonal communication dialog. Journal of Creative Behavior, 26, 1, 65-71. JASPERS, K. (1987): Vernunft und Existenz. Fünf Vorlesungen. München (Piper). JASPERS, K. (1991): Von der Wahrheit. München (Piper). LÉVINAS, E. (1995a): Die Zeit und der Andere. Hamburg (Meiner). LÉVINAS, E. (1995b): Zwischen uns. Versuche über das Denken an den Anderen. München, Wien (Hanser). OSTERMANN, I. (2001): AG Supervision. Ein Workshop zum Thema Beziehungsgeflecht von Doktorandin und wissenschaftlicher Betreuungsperson. In: MOHR, D. (Hrsg.): Lost in Space: Die eigene wissenschaftliche Verortung in und außerhalb von Institutionen. Dokumentation der siebten Wissenschaftlerinnen-Werkstatt der Promovendinnen der Hans-Böckler-Stiftung vom 2. Bis 5. November 2000. 33-35. Düsseldorf (edition der Hans Böckler Stiftung) PERLS, F. S./ HEFFERLINE, R. F./ GOODMAN, P. (1991): Gestalttherapie. Grundlagen. München (dtv). RANK, O. (1929): Wahrheit und Wirklichkeit. Entwurf einer Philosophie des Seelischen. Leipzig, Wien (Deuticke). SCHÜSSLER, W. (1995): Die Wahrheit der Philosophie. In SCHÜSSLER, W.: Karl Jaspers - zur Einführung. 113-121. Hamburg (Junius). STRAUSS, A. L. /. CORBIN, J. (1996): Grounded Theory: Grundlagen qualitativer Sozialforschung. Weinheim (Belz). TODOROV, T. (1985): Die Eroberung Amerikas. Das Problem der Anderen. Frankfurt/Main (Suhrkamp). WENZLER, L. (1995): Zeit als Nähe des Abwesenden. Diachronie der Ethik und Diachronie der Sinnlichkeit nach Emmanuel Levinas. In: LÉVINAS, E.: Die Zeit und der Andere. 67-92. Hamburg (Meiner). 8 Anschrift der Verfasserin: Dr. phil. Anita Barkhausen Truchseßstr. 28 53177 Bonn www.anita-barkhausen.de BARKHAUSEN, Anita, Dr. phil., geb. 1967, Diplom-Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin, Gestalttherapeutin, lebt und arbeitet in Bonn, ist nebenberuflich als Forschungssupervisorin tätig und setzt sich im Vorstand der DVG für die Belange von Theorie und Forschung ein. 9