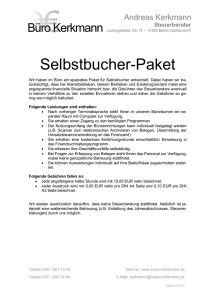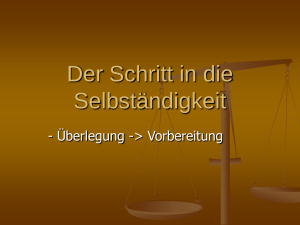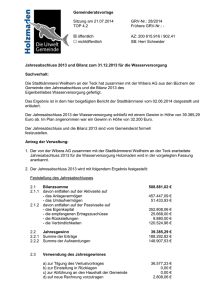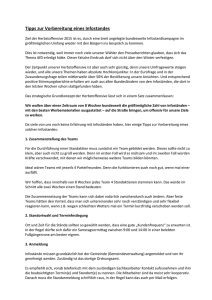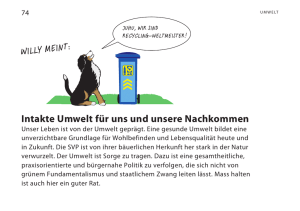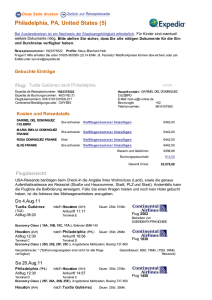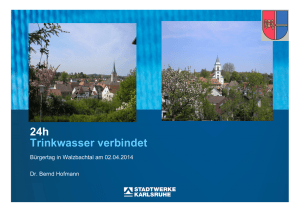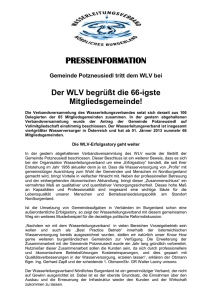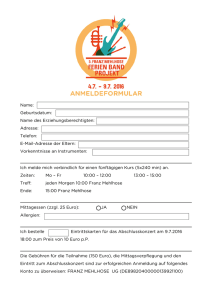Link öffnet in einem neuen Fenster - Bau
Werbung

Wasserversorgung Reglement und Tarif Muster 2002 mit Kommentar Wasser- und Energiewirtschaftsamt des Kantons Bern Verfasser und Herausgeber Wasser- und Energiewirtschaftsamt des Kantons Bern Ausgabe 2002 Diese Broschüre kann unter www.wea.bve.be.ch heruntergeladen werden Inhaltsverzeichnis Wasserversorgungsreglement I. Allgemeines Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Aufgabe Geltungsbereich des Reglementes Schutzzonen Generelle Wasserversorgungsplanung (GWP) Erschliessung Pflicht zum Wasserbezug Wasserabgabe a Menge und Qualität b Betriebsdruck Einschränkung der Wasserabgabe Verwendung des Wassers Bewilligungspflicht Haftung Handänderung Ende des Wasserbezuges II. Wasserverteilung A. Grundsätze Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Anlagen zur Wasserverteilung Öffentliche Anlagen Private Anlagen B. Öffentliche Anlagen 1. Leitungen Artikel 18 Planung und Erstellung Artikel 19 Leitungen im Strassengebiet Artikel 20 Sicherung öffentlicher Leitungen Artikel 21 Schutz der öffentlichen Leitungen 2. Hydrantenanlagen und Hydrantenlöschschutz Artikel 22 Hydranten und Hydrantenlöschschutz 3. Wasserzähler Artikel 23 Einbau, Kostentragung Artikel 24 Standort Artikel 25 Revision, Störungen C. Private Anlagen 1. Grundsätze Artikel 26 Kostentragung Artikel 27 Mängel Artikel 28 Informations-, Betretungs- und Kontrollrecht Artikel 29 Installationsbewilligung 2. Hausanschlussleitungen und Hausinstallationen Artikel 30 Bewilligung/Durchleitungsrechte/Durchleitungsrechte Artikel 31 Technische Bestimmungen III. Finanzielles Artikel 32 Artikel 33 Artikel 34 Artikel 35 Artikel 36 Artikel 37 Artikel 38 Artikel 39 Artikel 40 Artikel 41 Artikel 42 Finanzierung der Anlagen Einmalige Gebühren a Anschlussgebühr b Löschgebühr c Gemeinsame Bestimmungen Jährliche Gebühren a Grundgebühr b Verbrauchsgebühr c Löschgebühr Rechnungsstellung Fälligkeiten a Anschlussgebühr b Einmalige Löschgebühr c Jährliche Gebühren Einforderung der Gebühren/Verzugszins Verjährung Gebührenpflichtige Personen Grundpfandrecht IV. Straf- und Schlussbestimmungen Artikel 43 Artikel 44 Artikel 45 Artikel 46 Widerhandlungen Rechtspflege Übergangsbestimmung Inkrafttreten/Anpassung Wassertarif I. Einmalige Gebühren Artikel 1 Artikel 2 Anschlussgebühr Einmalige Löschgebühr II. Jährliche Gebühren Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Grundgebühr Verbrauchsgebühr Jährliche Löschgebühr Ungemessene Wasserbezüge Mehrwertsteuer III. Schlussbestimmungen Artikel 6 Artikel 7 Formulare Kommentar Zuständigkeiten Inkrafttreten WASSERVERSORGUNGSREGLEMENT I. Allgemeines Artikel 1 Aufgabe 1 Die Wasserversorgung versorgt die Bevölkerung, die Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungsbetriebe mit ausreichend und qualitativ einwandfreiem Trink- und Brauchwasser. 2 Gleichzeitig gewährleistet sie in ihrem Versorgungsgebiet den vorschriftsgemässen Hydrantenlöschschutz. Artikel 2 Geltungsbereich des Reglementes 1 Dieses Reglement gilt für alle WasserbezügerInnen im Versorgungsgebiet und für alle EigentümerInnen von Bauten und Anlagen, die durch Hydranten geschützt sind. 2 Als WasserbezügerInnen gelten die EigentümerInnen der angeschlossenen Bauten oder Anlagen. Artikel 3 Schutzzonen 1 Die Wasserversorgung scheidet zum Schutz ihrer Trinkwasserfassungen die erforderlichen Schutzzonen aus. Das Verfahren richtet sich nach dem Wasserversorgungsgesetz (WVG). 2 Die Schutzzonen sind im Zonenplan der Standortgemeinde einzutragen. Artikel 4 Generelle Wasserversorgungsplanung (GWP) 1 Die Wasserversorgung erstellt und überarbeitet periodisch für ihr Versorgungsgebiet eine Generelle Wasserversorgungsplanung (GWP). 2 Die GWP enthält insbesondere den Umfang, die Lage, die Ausgestaltung, die zeitliche Realisierung und die Kosten der künftigen Wasserversorgungsanlagen. Artikel 5 Erschliessung 1 Die Erschliessungspflicht besteht für die Bauzonen sowie die geschlossenen Siedlungsgebiete ausserhalb der Bauzonen. 2 Die Wasserversorgung kann zusätzlich erschliessen: a Bestehende Bauten und Anlagen mit eigener qualitativ oder quantitativ ungenügender Versorgung. b Neue Standort gebundene Bauten und Anlagen, wenn ein öffentliches Interesse besteht. Artikel 6 Pflicht zum Wasserbezug Im Versorgungsgebiet muss, unter Vorbehalt von Artikel 7 Absatz 2 WVG, das Trink- und das Brauchwasser, soweit es Trinkwasserqualität aufweisen muss, von der öffentlichen Wasserversorgung bezogen werden. Artikel 7 Wasserabgabe a Menge und Qualität 1 Die Wasserversorgung gibt in ihrem Versorgungsgebiet dauernd Trink- und Brauchwasser in ausreichender Menge und einwandfreier Qualität ab. Vorbehalten bleibt Artikel 9. 2 Die Wasserversorgung ist nicht verpflichtet, a besonderen Komfortanforderungen oder technischen Bedingungen (Prozesswasser) Rechnung zu tragen (z.B. Härte, Salzgehalt); b einzelnen WasserbezügerInnen grössere Brauchwassermengen abzugeben, wenn dies mit Aufwendungen verbunden ist, die von allen übrigen WasserbezügerInnen getragen werden müssen. Artikel 8 b Betriebsdruck Die Wasserversorgung gewährleistet einen Betriebsdruck, der so hoch ist, dass a das gesamte Versorgungsgebiet für den häuslichen Gebrauch mit Ausnahme der Hochhäuser bedient werden kann; b der Hydrantenlöschschutz nach den Bedingungen der Gebäudeversicherung Bern (GVB) gewährleistet ist. Artikel 9 Einschränkung der Wasserabgabe 1 Die Wasserversorgung kann die Wasserabgabe vorübergehend und grundsätzlich entschädigungslos einschränken oder unterbrechen a bei Wasserknappheit, b für Unterhalts- und Reparaturarbeiten, c bei Betriebsstörungen, d in Notlagen und im Brandfall. 2 Voraussehbare Einschränkungen oder Unterbrüche werden rechtzeitig angekündigt. Artikel 10 Verwendung des Wassers Die Wasserabgabe für häusliche Zwecke und für lebensnotwendige Betriebe geht andern Verwendungsarten vor, ausser in Brandfällen. 6 Artikel 11 Bewilligungspflicht 1 Eine Bewilligung der Wasserversorgung ist erforderlich für - den Neuanschluss einer Baute oder Anlage, - die Einrichtung von Löschposten, Kühl- und Klimaanlagen, - die Erweiterung oder Entfernung von sanitären Anlagen, - die Vergrösserung des umbauten Raumes, - vorübergehende Wasserbezüge und Wasserentnahmen aus Hydranten, - die Wasserabgabe oder -ableitung an Dritte (mit Ausnahme der Miet- und Pachtverhältnisse). 2 Die Gesuche sind der Wasserversorgung mit allen erforderlichen Unterlagen einzureichen. Artikel 12 Haftung Die WasserbezügerInnen haften gegenüber der Wasserversorgung und Dritten für allen Schaden, den sie durch vorsätzliches oder fahrlässiges widerrechtliches Handeln verursachen. Sie haben auch für andere Personen einzustehen, die mit ihrem Einverständnis die Anlagen benützen. Artikel 13 Handänderung Die bisherigen WasserbezügerInnen haben der Wasserversorgung jede Handänderung innert 10 Tagen schriftlich zu melden. Artikel 14 Ende des Wasserbezuges 1 Wer für die eigene Baute oder Anlage kein Trinkwasser mehr benötigt, hat dies der Wasserversorgung unter Angabe der Gründe mitzuteilen. 2 Die Gebührenpflicht für das Trinkwasser dauert mindestens bis zur Abtrennung des Anschlusses durch die Wasserversorgung, auch wenn kein Wasser mehr bezogen wird. 3 Die Kosten für die Abtrennung der Hausanschlüsse sind von den bisherigen WasserbezügerInnen zu tragen. II. Wasserverteilung A. Grundsätze Artikel 15 Anlagen zur Wasserverteilung Der Wasserverteilung dienen a die öffentlichen Leitungen einschliesslich aller Absperrschieber und die Hydrantenanlagen, b die Hausanschlussleitungen und die Hausinstallationen als private Anlagen. 7 Artikel 16 Öffentliche Anlagen 1 Die öffentlichen Leitungen umfassen die Transport- und Verteilleitungen. Sie werden von der Wasserversorgung erstellt und bleiben in ihrem Eigentum. , 2 Im Zweifelsfalle gelten Leitungen als öffentlich, die in ihrer Lage und Bemessung dem Hydrantenlöschschutz dienen. 3 Die Hydrantenanlagen werden von der Wasserversorgung nach den Vorschriften der GVB erstellt und an die öffentlichen Leitungen angeschlossen. Artikel 17 Private Anlagen 1 Die Hausanschlussleitungen verbinden die öffentliche Leitung ab dem Absperrschieber auf der öffentlichen Leitung. Die Wasserversorgung bestimmt die Lage des Absperrschiebers. 2 Die Leitung zu einer zusammengehörenden Gebäudegruppe gilt als gemeinsame Hausanschlussleitung, auch wenn das Areal in mehrere Grundstücke aufgeteilt ist. 3 Hausinstallationen sind alle Leitungen und Einrichtungen im Gebäudeinnern nach dem Wasserzähler. B. Öffentliche Anlagen 1. Leitungen Artikel 18 Planung und Erstellung 1 Die Wasserversorgung plant und erstellt die öffentlichen Leitungen gemäss dem Erschliessungsprogramm der Gemeinde. Fehlt dieses, bestimmt sie den Zeitpunkt der Erstellung nach pflichtgemässem Ermessen und im Einvernehmen mit den anderen Erschliessungsträgerschaften. 2 Die öffentlichen Leitungen sind so nahe an die erschlossenen Grundstücke heranzuführen, dass der Hydrantenlöschschutz gemäss den Vorschriften der GVB gewährleistet ist. Artikel 19 Leitungen im Strassengebiet 1 Die Wasserversorgung ist berechtigt, gegen vollen Schadenersatz schon vor dem Erwerb des für den Bau von Strassen ausgeschiedenen Landes in die künftige Strassenfläche öffentliche Leitungen einzulegen. 2 Das Verfahren richtet sich nach dem WVG. Artikel 20 Sicherung öffentlicher Leitungen 1 Die Durchleitungsrechte für öffentliche Leitungen sowie für die zugehörigen Sonderbauwerke und Nebenanlagen werden im Verfahren nach WVG oder mit Dienstbarkeitsverträgen gesichert. 2 Zuständig für den Beschluss der Überbauungsordnung nach WVG ist die Exekutive der Wasserversorgung. 8 3 Für die Durchleitungsrechte werden keine Entschädigungen geleistet. Vorbehalten bleibt die Ausrichtung von Entschädigungen für den durch den Leitungsbau und -betrieb verursachten Schaden sowie von Entschädigungen wegen enteignungsähnlichen Eingriffen. Artikel 21 Schutz der öffentlichen Leitungen 1 Die öffentlichen Leitungen und die zugehörigen Sonderbauwerke und Nebenanlagen sind, soweit keine anders lautenden vertraglichen Vereinbarungen vorliegen, im Rahmen der kantonalen Gesetzgebung in ihrem Bestand geschützt. 2 Bauten haben in der Regel einen Abstand von 4 Metern gegenüber bestehenden und projektierten Leitungen einzuhalten. Die Wasserversorgung kann im Einzelfall für die Sicherheit der Leitung einen grösseren Abstand vorschreiben. Kleinere Abstände bedürfen der Bewilligung der Wasserversorgung. 3 Im Weiteren gelten die jeweiligen Überbauungsvorschriften. 4 Die geschützten öffentlichen Leitungen und die zugehörigen Sonderbauwerke und Nebenanlagen dürfen nur an einen andern Ort verlegt werden, wenn dies ohne technische Nachteile möglich ist. Die Kosten tragen die EigentümerInnen des belasteten Grundstücks. 2. Hydrantenanlagen und Hydrantenlöschschutz Artikel 22 Hydranten und Hydrantenlöschschutz 1 Die Wasserversorgung erstellt, bezahlt, unterhält und erneuert alle Hydranten auf den öffentlichen Leitungen. Muss sie dafür privaten Grund in Anspruch nehmen, gilt Artikel 136 BauG. 2 Die Verursachenden tragen die Mehrkosten gegenüber dem konformen Hydrantenlöschschutz (z.B. Mehrdimensionierung der Leitungen für Sprinkleranlagen, grössere Löschreserven oder zusätzliche Hydranten). Dasselbe gilt für die Erneuerungskosten. 3 Im Brandfall und für Übungszwecken stehen der Feuerwehr alle dem Löschschutz dienenden öffentlichen Wasserversorgungsanlagen unentgeltlich zur Verfügung. 3. Wasserzähler Artikel 23 Einbau, Kostentragung 1 In jedes Gebäude (auch im Stockwerkeigentum) wird in der Regel nur ein Wasserzähler eingebaut. Nebenzähler können für die Messung von Wasser eingebaut werden, das nicht in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet wird (Ställe, Gärtnereien), oder dessen Verwendung Abwasser erzeugt, das besonders behandelt werden muss. 2 In Siedlungen mit verdichteter Bauweise (Reihen-, Atrium- und Terrassenhäuser) ist für alle WasserbezügerInnen je ein Wasserzähler einzubauen. 3 Die Wasserzähler werden auf Kosten der Wasserversorgung installiert, unterhalten und ersetzt. Nebenzähler werden den WasserbezügerInnen gesondert verrechnet. 9 Artikel 24 Standort 1 Die Wasserversorgung bestimmt den Standort des Wasserzählers unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der WasserbezügerInnen. Der Platz für den Einbau ist unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 2 Der Wasserzähler muss jederzeit leicht zugänglich sein. 3 Ausser den Organen der Wasserversorgung darf niemand am Wasserzähler Änderungen vornehmen oder vornehmen lassen. Artikel 25 Revision, Störungen 1 Die Wasserversorgung revidiert die Wasserzähler periodisch auf ihre Kosten. Störungen sind der Wasserversorgung sofort zu melden. 2 Die WasserbezügerInnen können jederzeit eine Prüfung ihres Wasserzählers verlangen. Bei Mängeln übernimmt die Wasserversorgung die Kosten. 3 Bei fehlerhafter Zählerangabe (mehr als ± 5% bei 10% Nennbelastung des Wasserzählers) wird für die Festsetzung des Verbrauchs auf das Ergebnis des Vorjahres abgestellt. C. Private Anlagen 1. Grundsätze Kostentragung Artikel 26 1 Die WasserbezügerInnen tragen die Kosten für die Erstellung, den Unterhalt und die Erneuerung von privaten Anlagen (Hausanschlussleitungen und Hausinstallationen). Dasselbe gilt für Anpassungen an privaten Anlagen bei veränderten Verhältnissen. 2 Die privaten Anlagen sind mit einer vorschriftsgemässen Rückflussverhinderung zu versehen. Artikel 27 Mängel Mängel an privaten Anlagen sind durch die WasserbezügerInnen sofort auf eigene Kosten beheben zu lassen. Bei Säumnis kann die Wasserversorgung die Behebung auf Kosten der WasserbezügerInnen anordnen. Artikel 28 Informations-, Betretungs- und Kontrollrecht Die Organe der Wasserversorgung sind befugt, alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Angaben und Unterlagen zu verlangen, Grundstücke zu betreten und die Bauten, Anlagen und Einrichtungen zu kontrollieren. 10 Artikel 29 Installationsbewilligung 1 Hausanschlussleitungen und Hausinstallationen dürfen nur von Personen erstellt oder ausgeführt werden, die über eine Bewilligung der Wasserversorgung verfügen. Wartungsarbeiten sind bewilligungsfrei. 2 Bewilligungsvoraussetzung ist eine ausreichende berufliche Qualifikation. Als solche gilt insbesondere ein eidg. Diplom im Sanitärbereich oder eine gleichwertige Ausbildung. 2. Hausanschlussleitungen und Hausinstallationen Artikel 30 Bewilligung Durchleitungsrechte 1 Die Wasserversorgung bestimmt im Bewilligungsverfahren nach Artikel 11 die Stelle und die Art der Hausanschlussleitungen. 2 Der Erwerb der notwendigen Durchleitungsrechte ist Sache der WasserbezügerInnen. Artikel 31 Technische Bestimmungen 1 In der Regel ist pro Grundstück nur eine Hausanschlussleitung zu erstellen. Vorbehalten bleibt Artikel 17 Absatz 2. 2 Am Anschlusspunkt an die öffentliche Leitung baut die Wasserversorgung auf ihre Kosten einen Absperrschieber ein, der nur von dieser bedient werden darf. 3 Die Wasserleitungen dürfen nicht für die Erdung von elektrischen Anlagen benützt werden. 4 Vor dem Eindecken sind die Hausanschlussleitungen unter Aufsicht der Wasserversorgung einer Druckprobe zu unterziehen und auf Kosten der WasserbezügerInnen durch eine von der Wasserversorgung bezeichnete Person einzumessen. III. Finanzielles Finanzierung der Anlagen Artikel 32 1 Die Aufgabe der Wasserversorgung, einschliesslich der Sicherstellung des Hydrantenlöschschutzes, muss finanziell selbsttragend sein. 2 Die Wasserversorgung finanziert sich ausschliesslich mit a einmaligen und jährlichen Gebühren b Beiträgen oder Darlehen Dritter. 2 Mit Gross- und SpitzenwasserbezügerInnen, bei denen die Anwendung des Wassertarifs zu einem offensichtlichen Missverhältnis zur Kostendeckung führt, wird ein Wasserlieferungsvertrag auf der Grundlage von kostendeckenden Leistungs- und Arbeitspreisen abgeschlossen. 11 Artikel 33 Einmalige Gebühren a Anschlussgebühr 1 Die WasserbezügerInnen haben für jeden direkten oder indirekten Anschluss eine Anschlussgebühr zu bezahlen. 2 Die Anschlussgebühr wird aufgrund der Belastungswerte (BW) nach SVGW und des umbauten Raumes der anzuschliessenden Baute oder Anlage erhoben. 3 Bereits bezahlte einmalige Löschgebühren werden an die Anschlussgebühr zum effektiv geleisteten Frankenbetrag angerechnet. 4 Ist der Hydrantenlöschschutz im Zeitpunkt des Anschlusses noch nicht gewährleistet, bemisst sich die Anschlussgebühr vorderhand allein nach den BW. Die Nachzahlung für den gesamten umbauten Raum wird im Zeitpunkt der Gewährleistung des Hydrantenlöschschutzes erhoben. Artikel 34 1 b Löschgebühr Die einmalige Löschgebühr ist geschuldet für nicht an die Wasserversorgung angeschlossene Bauten und Anlagen im Umkreis von 300 m vom nächsten Hydranten, wenn dieser den erforderlichen Löschschutz gewährleistet. 2 Die einmalige Löschgebühr wird nach dem gesamten umbauten Raum berechnet. Artikel 35 c Gemeinsame Bestimmungen 1 Bei einer Erhöhung der massgebenden Bemessungsgrössen der Gebühren ist eine Nachzahlung der Gebühren geschuldet. Bei einer Verringerung der massgebenden Bemessungsgrössen werden keine Gebühren zurückerstattet. 2 Beim Wiederaufbau eines Gebäudes infolge Brand oder Abbruch werden die früher bezahlten einmaligen Gebühren angerechnet, sofern mit den Arbeiten innert 5 Jahren begonnen wird. Wer die Anrechnung beansprucht, ist beweispflichtig. Artikel 36 VARIANTE A Jährliche Gebühren a Grundgebühr b Verbrauchsgebühr 1 Zur Deckung der Einlagen in die Spezialfinanzierung und der Zinskosten haben die WasserbezügerInnen eine jährliche Grundgebühr zu bezahlen. Sie wird aufgrund der installierten BW und des umbauten Raumes erhoben. 2 Zur Deckung der restlichen Kosten der Laufenden Rechnung haben sie eine jährliche Verbrauchsgebühr je bezogenen m³ Wasser zu bezahlen. VARIANTE B Jährliche Gebühren a Grundgebühr für WV mit einem Anschlussgrad bis 75 % für WV mit einem Anschlussgrad über 75 % 1 Zur Deckung der Einlagen in die Spezialfinanzierung und der Zinskosten haben die WasserbezügerInnen eine jährliche Grundgebühr zu bezahlen. Sie wird aufgrund der installierten BW erhoben. 12 b Verbrauchsgebühr 2 Zur Deckung der restlichen Kosten der Laufenden Rechnung haben sie eine jährliche Verbrauchsgebühr je bezogenen m³ Wasser zu bezahlen. VARIANTE C Jahresgebühr für grosse Wasserversorgungen 1 Zur Deckung der jährlichen Kosten der Wasserversorgung haben die WasserbezügerInnen eine Jahresgebühr zu bezahlen. 2 Die Jahresgebühr wird aufgrund der gesamten bezogenen m³ pro Jahr erhoben. c Löschgebühr 3 Für geschützte Gebäude im Sinn von Art. 34 haben die jeweiligen EigentümerInnen jährliche Löschgebühren zu bezahlen. Sie werden aufgrund des umbauten Raumes erhoben. 4 Die Exekutive der Wasserversorgung legt die Höhe der jährlichen Gebühren im Wassertarif fest, der zu veröffentlichen ist. Artikel 37 Rechnungstellung 1 Die Zählerablesung und die darauf basierende Rechnungstellung erfolgen in regelmässigen, von der Wasserversorgung zu bestimmenden Zeitabständen. 2 Die Wasserversorgung ist berechtigt, in begründeten Fällen Vorauszahlungen zu verlangen oder innerhalb kürzerer Fristen Rechnung zu stellen. Die zusätzlichen Kosten gehen zulasten der WasserbezügerInnen. Artikel 38 Fälligkeiten a Anschlussgebühr b Einmalige Löschgebühr c Jährliche Gebühren 1 Die Anschlussgebühr ist im Zeitpunkt des Wasseranschlusses fällig. Vorher kann die Wasserversorgung nach Baubeginn eine Akontozahlung verlangen. Diese wird aufgrund der voraussichtlich installierten BW und des voraussichtlichen umbauten Raumes berechnet. Die Schlusszahlung ist mit der Installation der neuen Armaturen oder Apparate bzw. nach Abschluss der Aus- und Umbauten fällig. 2 Die einmalige Löschgebühr wird mit der Fertigstellung des geschützten Gebäudes fällig. Wird der Löschschutz später erstellt, ist die Gebühr mit dessen Fertigstellung fällig. Nachzahlungen sind nach Abschluss der Aus- und Umbauten fällig. 3 Die jährlichen Gebühren sind jeweils am ............... fällig. Auf den ................... wird eine Teilrechnung gestellt, die sich auf den Wasserverbrauch der ersten ... Monate des Vorjahres stützt. 4 Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Rechnungstellung. Artikel 39 Einforderung der Gebühren 1 Wird die Gebührenrechnung nicht bezahlt, fordert die Wasserversorgung die Gebühren nach den Vorschriften des Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRPG) ein. 13 Verzugszins 2 Nach Ablauf der Zahlungsfrist sind ein zusätzlicher Verzugszins in der Höhe des vom Regierungsrat für das Steuerwesen jährlich festgelegten Zinssatzes und die Inkassogebühren geschuldet. Artikel 40 Verjährung Die einmaligen Gebühren verjähren zehn, die jährlichen fünf Jahre nach Eintritt der Fälligkeit. Für die Unterbrechung der Verjährung sind die Vorschriften des Schweiz. Obligationenrechts sinngemäss anwendbar. Die Verjährung wird ausserdem durch jede Einforderungshandlung (wie Rechnungstellung, Mahnung) unterbrochen. Artikel 41 Gebührenpflichtige Personen Die Gebühren schuldet, wer im Zeitpunkt des Wasseranschlusses WasserbezügerIn der angeschlossenen oder geschützten Baute oder Anlage ist. Alle Nacherwerbenden schulden die im Zeitpunkt ihres Liegenschaftserwerbs noch ausstehenden Anschlussgebühren, soweit die Liegenschaft nicht im Rahmen einer Zwangsverwertung ersteigert wurde. Artikel 42 Grundpfandrecht Die Wasserversorgung geniesst für ihre fälligen Forderungen auf den einmaligen Gebühren ein gesetzliches Grundpfandrecht auf der angeschlossenen Liegenschaft gemäss Artikel 109 Absatz 2 Ziffer 6 EG zum ZGB. IV. Straf- und Schlussbestimmungen Widerhandlungen Artikel 43 1 Widerhandlungen gegen das Wasserversorgungsreglement sowie die gestützt darauf erlassenen Verfügungen werden mit Busse gemäss Gemeindegesetzgebung bestraft. 2 Vorbehalten bleiben die weiteren kantonalen und eidgenössischen Strafbestimmungen. 3 Wer ohne Bewilligung Wasser von der öffentlichen Wasserversorgung bezieht, schuldet der Wasserversorgung zusätzlich die entgangenen Gebühren mit Verzugszins. Artikel 44 Rechtspflege 1 Gegen Verfügungen der Organe der Wasserversorgung kann unter Vorbehalt anderer gesetzlicher Regelungen innert 30 Tagen seit Eröffnung schriftlich Verwaltungsbeschwerde erhoben werden. 2 Im Übrigen gelten die Vorschriften des VRPG. 14 Artikel 45 Übergangsbestimmung Vor Inkrafttreten fällige einmalige Gebühren werden nach bisherigem Recht (Bemessungsgrössen und Gebührenansätze) erhoben. Im Übrigen gelten die Bestimmungen dieses Reglementes uneingeschränkt. Artikel 46 Inkrafttreten, Anpassung 1 Dieses Reglement tritt am ................. in Kraft. 2 Mit dem Inkrafttreten werden alle mit diesem Reglement im Widerspruch stehenden früheren Vorschriften aufgehoben. 3 Die Wasserversorgung bestimmt, wie weit und innert welcher Frist bestehende Anlagen den Bestimmungen dieses Reglementes anzupassen sind. So beraten und angenommen durch die Legislative am .................... Namens der Legislative Der/die PräsidentIn: Der/die GemeindeschreiberIn: ................................., ...... ................................ Es folgt das Auflagezeugnis Anhänge - Gesetzliche Grundlagen - Muster Gesuch um einen Wasseranschluss - Muster Installationsanzeige - Muster Bewilligung für einen Wasseranschluss - Muster Fertigstellungsmeldung 15 .............................................. Anhang: Gesetzliche Grundlagen Das Wasserversorgungsreglement stützt sich insbesondere auf folgende übergeordnete Bestimmungen: Bund - Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (GSchG) Eidgenössisches Lebensmittelgesetz (LMG) Verordnung über die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Notlagen (VTN) Kanton - Wasserversorgungsgesetz (WVG) Baugesetz (BauG) Feuerschutz- und Feuerwehrgesetz (FFG) Feuerschutz- und Feuerwehrverordnung (FFV) Einführungsverordnung zum Eidg. Lebensmittelgesetz (EV LMG) Gemeindegesetz (GG) Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG) 16 WASSERTARIF Die Legislative bzw. die Exekutive der Wasserversorgung erlässt gestützt auf Artikel 32 ff des Wasserversorgungsreglementes vom ................... folgenden Tarif. I. Einmalige Gebühren Anschlussgebühr Artikel 1 Die Anschlussgebühr wird nach den installierten Belastungswerten (BW) gemäss SVGW und nach dem umbauten Raum (m3 uR) berechnet. Sie beträgt pro BW a für die ersten 50 BW für die weiteren 100 BW für jeden weiteren BW Fr Fr. Fr. und pro m3 uR b für die ersten für die weiteren für jeden weiteren Fr. Fr. Fr. 1'000 m3 uR 2'000 m3 uR m3 uR 150.-75.-25.-4.-1.--.50 Es werden in jedem Fall mindestens 10 BW und 100 m3 uR berechnet Einmalige Löschgebühr Artikel 2 Die einmalige Löschgebühr einer nicht angeschlossenen Baute oder Anlage im Bereich des Hydrantenlöschschutzes wird nach ihrem umbauten Raum berechnet und ist gleich hoch wie der Anteil der Anschlussgebühr gemäss Artikel 1 Buchstabe b. II. Jährliche Gebühren und ungemessene Wasserbezüge Artikel 3 Variante A für WV mit einem Anschlussgrad bis 75 % Grundgebühr 1 Die jährliche Grundgebühr wird nach den installierten Belastungswerten (BW) und nach dem umbauten Raum (m3 uR) berechnet. Sie beträgt pro BW a für die ersten 50 BW für die weiteren 100 BW für jeden weiteren BW Fr. Fr. Fr. und pro volle 100 m3 uR b für die ersten 1'000 m3 uR für die weiteren 2'000 m3 uR für alle weiteren Fr. Fr. Fr. 6.-3.-1.50 20.-10.-5.-- Es werden in jedem Fall mindestens 20 BW und 200 m3 uR berechnet. Verbrauchsgebühr 2 Die Verbrauchsgebühr beträgt bis zu einem Jahresbezug von 2'000 m3 für alle weiteren m3 17 Fr. Fr. 1.--/m3 -.50/m3 Jährliche Löschgebühr 3 Die jährliche Löschgebühr einer nicht angeschlossenen Baute oder Anlage im Bereich des Hydrantenlöschschutzes wird nach ihrem umbauten Raum berechnet und ist gleich hoch wie der Anteil der Grundgebühr gemäss Absatz 1 Buchstabe b. Variante B für WV mit einem Anschlussgrad über 75% 1 Grundgebühr Sie beträgt pro BW für die ersten 50 BW für die weiteren 100 BW für jeden weiteren BW Die jährliche Grundgebühr wird nach den installierten Belastungswerten (BW) berechnet. Fr. Fr. Fr. 10.-5.-2.50 Es werden in jedem Fall mindestens 20 BW berechnet. Verbrauchsgebühr 2 Die Verbrauchsgebühr beträgt bis zu einem Jahresbezug von 2'000 m3 für jeden weiteren m3 Jährliche Löschgebühr Fr. Fr. 1.--/m3 -.50/m3 3 Die jährliche Löschgebühr einer nicht angeschlossenen Baute oder Anlage im Bereich des Hydrantenlöschschutzes wird nach ihrem umbauten Raum berechnet. Sie beträgt pro volle 100 m3 uR für die ersten 1'000 m3 uR für die weiteren 2'000 m3 uR für alle weiteren Fr. Fr. Fr. 20.-10.-5.-- Es werden in jedem Fall mindestens 200 m3 uR berechnet. Variante C für grosse Wasserversorgungen Jahresgebühr Jährliche Löschgebühr 1 Die Jahresgebühr wird nach der bezogenen Wassermenge in m3 berechnet und beträgt Wasserbezug Jahresgebühr für jeden m3/Jahr Fr. weiteren m3 Fr. 0 200.-2.-200 600.-1.50 2'000 3'300.-1.-- 2 Die jährliche Löschgebühr einer nicht angeschlossenen Baute oder Anlage im Bereich des Hydrantenlöschschutzes wird nach ihrem umbauten Raum (m3 uR) berechnet und beträgt umbauter Raum m3 uR Löschgebühr Fr. bis 200 40.-- 1'000 200.-- 3'000 400.-- je weitere volle 100 m3 uR Fr. 20.-10.-5.-- 18 Ungemessene Wasserbezüge Mehrwertsteuer Artikel 4 Für ungemessene Wasserbezüge (Bauwasser und andere vorübergehende Wasserbezüge) wird eine Grundgebühr von Fr. 200.-- und zusätzlich eine Gebühr von Fr. 200.-- pro volle 100 m3 umbauten Raum bzw. Fr. 20.-- pro Tag für Anlagen ohne umbauten Raum erhoben. Artikel 5 Die Mehrwertsteuer ist in den Ansätzen der Gebühren inbegriffen, die ihr unterstellt sind. III. Schlussbestimmungen Zuständigkeiten Inkrafttreten Artikel 6 Für die Tarife gemäss Artikel 1 und 2 ist die Legislative, für die restlichen Bestimmungen die Exekutive der Wasserversorgung zuständig. Artikel 7 1 Dieser Tarif tritt am .................. in Kraft. 2 Mit dem Inkrafttreten werden alle mit diesem Tarif im Widerspruch stehenden früheren Vorschriften aufgehoben. Insbesondere aufgehoben wird: .......................................................................................................... So beschlossen durch die zuständigen Organe am .................... .........................., ............. Der/die Präsident/in: Der/die Sekretär/in: ................................ ................................ Es folgt das Auflagezeugnis für die Artikel 1 und 2 19 Muster-Formulare für das Bewilligungsverfahren für einen Wasseranschluss einschliesslich Fertigstellungsmeldung 1. Anschlussgesuch Wasser (basierend auf dem Formular 5.4 des Verbandes der bernischen Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreiber BEGG). Behandlung im Rahmen eines Baubewilligungsverfahrens: Ist die Gemeinde nicht selber Trägerin der öffentlichen Wasserversorgung, ist das Gesuch durch die zuständige Wasserversorgung zuhanden der Gemeindebehörden zu behandeln. 2. Installationsanzeige 3. Bewilligung für einen Wasseranschluss: Ist das Gesuch im Rahmen eines Baubewilligungsverfahrens zu beurteilen, ist der Baubewilligungsbehörde keine eigenständige Bewilligung sondern ein Amts- bzw. Fachbericht mit Antrag einzureichen. 4. Fertigstellungsmeldung 20 5.4 Gemeinde-Nr.: Anschluss Wasser Eingang: PLZ / Gemeinde: ___________________ ________________________ Amt-Nr.: Wasserversorgung: Strasse / Ort: Nr.: Parzelle(n) / Baurecht-Nr.(n): Planung und Ausführung (sofern bekannt, sonst bitte nachmelden) Sanitär-Planer: (Firma, Adresse, Kontaktperson): Tel. Nr. / Fax. Nr. / Nutzung und Wasserbedarf □ Wohnungen: Anzahl ______ □ Zentralboiler _________l □ Gewerbe / Industrie: Wasserlöschposten: □ bestehend Sprinkleranlage: □ bestehend Belastungswerte □ bestehend Umbauter Raum □ bestehend □ 1 Boiler je Wohnung __________l Wasserbedarf: □ neu □ neu □ neu □ neu max. ___________l / min max. ___________l / min max. ___________l / min Anzahl __________ BW __________m3 uR Erschliessung Haupt-/Verteilleitung (öffentliche Leitung): □ bestehend (Anschlussstelle gemäss Situationsplan) Entfernung vom Gebäude: Hausanschlussleitung (private Leitung): □ neu verlegen Durchmesser Material Gasanschluss vorgesehen/interessiert: □ Heizung wenn ja: m □ bestehend Durchleitungsrechte erforderlich: □ neu □ ja (Kopie beilegen) □ ja □ Prozess □ ändern □ nein □ nein □ Haushalt Baugruben-Abmessung gemäss Situationsplan: Länge/Breite/Tiefe m Bestehende Werkleitungen im Abstand zur Baugrube innerhalb 10m: □ keine □ Elektrizität Hausinstallation: □ Wasser □ neu erstellen □ Gas □ andere (TV, Telefon…)_________ □ ändern / anpassen □ erweitern Bemerkungen Ort und Datum: Der / Die Beauftragte: Dem Gesuch sind beizulegen: 1 Kopie von Formular 1.0 und 1.0.1 1 Kopie von Formular 5.5 (kann auch später vor Installationsbeginn eingereicht werden) 2 Situationspläne 1 : 1'000 oder 1: 500 1 Grundriss Untergeschoss 1 : 100 oder 1 : 50 mit eingezeichneter Wassereintrittsstelle bis Verteilbatterie Installationsanzeige Die nachstehende Installationsanzeige umfasst alle Apparate und Armaturen der anzuschliessenden Liegenschaft, also auch allfällig bestehende. Apparate/Armaturen Normalinstallationen A B N Stockwerk Anzahl K W BW pro Anschluss Handwaschbecken 1 Spülkasten 1 Bidet 1 Spülbecken 2 Geschirrspülmaschine 2 Duschbatterie 3 Waschautomat bis 6 kg 4 Durchlauferwärmer 4 Badebatterie 4 Gartenventil 5 Garageventil 5 Anschluss ½" 5 Anschluss ¾“ 8 Selbsttränke Grossvieh 1 Selbsttränke Schweine ½ Löschposten Spezialinstallationen BW K BW W Total U BW 5/0* Beschrieb: l/min Kühl- und Klimaanlage 1 BW = 6 l/min Melkmaschine Bassin Laufender Brunnen *wird nicht berechnet, wenn er ausschliesslich dem Löschschutz dient. ./. Total Belastungswerte (A + B + N) davon bestehend (A + B) Neuinstallation (N) BW = Belastungswerte nach W3 SVGW A = Auswechslung B = Bestehend K = Kalt W = Warm T = Total N = Neuinstallation U = Umrechnung Bewilligung für den Wasseranschluss Gestützt auf Artikel 11 des Wasserversorgungsreglementes wird die nachgesuchte Bewilligung für den Anschluss an das Wasserleitungsnetz mit folgenden Bedingungen erteilt: Installateur: Sämtliche Arbeiten und Installationen dürfen nur von einem Installateur durchgeführt werden, der Inhaber einer Bewilligung der Wasserversorgung ist. Anschlusspunkt: Wird von der Wasserversorgung bezeichnet. Er befindet sich unmittelbar nach dem Absperrschieber, der von ihr montiert wird. Hausanschlussleitung: Ist auf Kosten der Gesuchstellenden zu erstellen. Material ____________________ ______ mm Tiefe ________ m Wasserzähler: Wird von der Wasserversorgung auf ihre Kosten geliefert. Hausinstallationen: Gemäss Installationsanzeige. Abweichungen während der Ausführung sind mit der Fertigstellungsmeldung anzugeben. Voraussichtliche Anschlussgebühr: Diese beträgt gestützt auf Art. 1 des Wassertarifs und auf die separate Berechnung voraussichtlich Fr. Die Fälligkeiten und Zahlungsfristen richten sich nach dem Wasserversorgungsreglement. Dieser provisorischen Berechnung vorbehalten bleiben die Änderungen des Reglementes oder des Tarifs vor der Fälligkeit der Gebühren. Fertigstellungsmeldung: Nach durchgeführtem Anschluss und Fertigstellung der Installationen ist 1 Exemplar dieser Bewilligung mit der Fertigstellungsmeldung der Wasserversorgung unaufgefordert zurückzuschicken. Weitere Bedingungen und Berechnung der Anschlussgebühr: Siehe Beiblatt Gültigkeitsdauer: Diese Bewilligung gilt bis zum Verwaltungsgebühr: Für diese Bewilligung ist eine Verwaltungsgebühr von Fr. __________ zu entrichten. Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen bei _______________ schriftlich und begründet Beschwerde erhoben werden. Allfällige Beweismittel sind zu nennen und beizulegen. Ort und Datum Beilagen: Doppel dieser Bewilligung mit weiteren Bedingungen Situationsplan Kellergrundriss und Schnitt Auszug aus dem WV-Reglement + Tarif Für die Wasserversorgung } mit allfälligen Anmerkungen der Wasserversorgung Fertigstellungsmeldung Änderungen der BW gegenüber der Installationsanzeige Apparate/Armaturen Änderungen A B N Stockwerk Anzahl K W BW pro Anschluss BW K BW W Total Total Änderungen gegenüber Bewilligung Total bewilligte Belastungswerte Effektiv installierte Belastungswerte Bestätigung des Sanitärinstallateurs Der unterzeichnende Sanitärinstallateur bestätigt, die Hausanschlussleitungen und die Hausinstallationen nach den einschlägigen Vorschriften und Normen sowie nach den Bedingungen der Anschlussbewilligung ausgeführt zu haben. Die Fertigstellungsmeldung und die Pläne entsprechen den ausgeführten Anlagen. ________________________________________________________________________ Ort und Datum Der Sanitärinstallateur: ________________________________________________________________________ Bestätigung des Bewilligungsinhabers Der unterzeichnende Bewilligungsinhaber hat vom Wasserversorgungsreglement und vom Wassertarif der Wasserversorgung Kenntnis genommen und verpflichtet sich, dieses einzuhalten. Ferner verpflichtet er sich, eine allfällige Veräusserung der Liegenschaft der Wasserversorgung unverzüglich mitzuteilen. ________________________________________________________________________ Ort und Datum Der/die Bewilligungsinhaber/in: ________________________________________________________________________ Beilagen Situationsplan 1: _________ mit eingetragener und vermasster Hausanschlussleitung, (Fassade bis Absperrschieber auf der öffentlichen Leitung) Ausführungsplan Kellergrundriss und Schnitt mit Wassereintrittstelle und Verteilbatterie Musterreglement und Mustertarif Wasserversorgung Ausgabe 2002 Kommentar Einleitung Im schon gewohnten Fünfjahresrhythmus haben Sie nun wiederum ein neues Musterreglement des Wasser- und Energiewirtschaftsamtes (Ausgabe 2002) vor sich. Gleichzeitig mit diesem Muster haben wir auch den alten Kommentar überarbeitet und angepasst. Wo sich keine Änderungen im Reglement ergaben, ist er mit demjenigen von 1997 identisch. Entgegen der Fassung von 1997 haben wir dieses Mal keine Totalrevision vorgenommen, sondern die Vorlage vor allem redaktionell überarbeitet und - soweit möglich - mit dem Muster-Abwasserreglement 1999 in Übereinstimmung gebracht. Trotzdem, einige Anpassungen und Änderungen waren notwendig, so insbesondere: ‒ Einführung der Erhebung von jährlichen Löschgebühren; ‒ Differenzierte Modelle für die Tarifgestaltung; ‒ Verbot der Benützung der Wasserleitungen für die Erdung; ‒ Modifizierte Regelung in den Überbauungsvorschriften für die Sicherung von Wasserleitungen und der zugehörigen Sonderbauwerke (aufgrund eines Entscheides der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion); ‒ Der Begriff "Liegenschaft" wird durch die Umschreibung "Bauten und Anlagen" (in Anlehnung an das kantonale Baugesetz) ersetzt. Damit soll klargestellt werden, dass bei der Auslegung des Begriffs nicht die Umschreibung des Zivilrechts massgebend ist (Liegenschaft ≠ Grundstück). Der Begriff "Wehrdienste" wird durch "Feuerwehr" aufgrund der Änderung der Feuerschutz- und Feuerwehgesetzgebung per 1.1.2002 abgelöst. Im Übrigen sind aber auch unsere in den letzten fünf Jahren gesammelten Erfahrungen, Bemerkungen und Probleme sowie deren Lösungsansätze eingeflossen. Wir haben uns bemüht, noch konzentrierter ein für die meisten bernischen Wasserversorgungen direkt anwendbares Reglement mit Tarif zu erarbeiten und hoffen so, wiederum ein taugliches Instrument zur Verfügung zu stellen. Da der überwiegende Teil der Wasserversorgungsreglemente auch weiterhin keiner kantonalen Genehmigung bedarf und auch eine Vorprüfung in vielen Fällen fakultativ ist, erachten wir es als wichtig, an dieser 23 Stelle erneut daran zu appellieren, nur in wirklich begründeten Fällen von unseren Mustervorschriften abzuweichen. Mit diesem Vorgehen soll Wasserversorgungsreglemente auch in Zukunft zweckmässig und gewährleistet sachlich korrekt sein, sind dass und die einer gerichtlichen Prüfung standhalten vermögen. Selbstverständlich ist unser Amt auch weiterhin bereit, Vorprüfungen durchzuführen und steht für rechtliche und technische Beratungen ebenfalls zur Verfügung. Vorbemerkung Produktehaftpflicht: Seit dem 1. Januar 1994 gilt das Bundesgesetz über die Produktehaftpflicht. Ein Produkt (hier das Wasser) ist fehlerhaft, "wenn es nicht die Sicherheit bietet, die man unter Berücksichtigung aller Umstände zu erwarten berechtigt ist". Der durch die Fehlerhaftigkeit des Produktes entstehende Schaden lässt eine Haftung entstehen, wenn a eine Person getötet oder verletzt wird, oder b eine Sache beschädigt oder zerstört wird, die nach ihrer Art gewöhnlich zum privaten Gebrauch oder Verbrauch bestimmt und vom Geschädigten hauptsächlich privat verwendet worden ist. Geschädigte haben Sachschäden bis zur Höhe von Fr. 900.-- selber zu tragen. Die Erfüllung all dieser Voraussetzungen, um eine Produktehaftpflicht auszulösen, ist in Anbetracht der gesetzlichen Vorschriften im Bereich der Wasserversorgung in technischer und qualitativer Hinsicht eher gering. Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber, dass sich die Wasserversorgungen ihrer Verantwortung bewusst sind und insbesondere die vom Kantonalen Laboratorium - gestützt auf die Lebensmittelgesetzgebung - vorgeschriebenen Qualitäts-Systeme aufbauen und anzuwenden. Kommentar zu einzelnen Artikeln Aufgabe (Artikel 1) Die Sicherstellung der Wasserversorgung ist und bleibt in erster Linie eine Gemeindeaufgabe. Die Gemeinde ist somit im Rahmen der Erschliessungs- und Versorgungspflicht verantwortlich für die ordnungsgemässe Erfüllung der Aufgaben. Ebenfalls hat sie für die Sicherstellung des Hydrantenlöschschutzes besorgt zu sein. Die beiden Bereiche gehören technisch und rechtlich zusammen; der Hydrantenlöschschutz ist untrennbar mit den Wasserversorgungsanlagen verbunden (Leitungen, Hydranten, Löschreserve in den 24 Reservoiren, Steuerungsanlagen). Die gesamte Aufgabe muss finanziell kostendeckend ausgestaltet werden. Schnittstelle zur alleinigen Zuständigkeit der Feuerwehr bilden die Hydranten (Trennung beweglicher und unbeweglicher Löschschutz), wobei die Hydranten immer zur Wasserversorgung gehören. Wasserversorgung Erstellung, Unterhalt und Erneuerung Feuerwehr Betriebsbereitschaft und Betrieb Beispiele für die Zuständigkeit der Gemeinde (und nicht der Wasserversorgung): Sicherstellung der Zugänglichkeit der Hydranten (Schneeräumung etc.). In der Regel sind diese Arbeiten dem Ressort Tiefbau/Strassen unterstellt. Ebenfalls nicht zuständig ist die Wasserversorgung für die netzunabhängigen Löschanlagen, wie Feuerweiher, Löschsilos etc. Bau, Betrieb und Unterhalt solcher Anlagen fallen in die Zuständigkeit der Feuerwehr. Schliesslich hat die Gemeinde unabhängig von der Trägerschaft der öffentlichen Wasserversorgung in Zusammenarbeit mit den weiteren Betroffenen die Trinkwasserversorgung in Notlagen zu organisieren und zu gewährleisten. Rechtliche Basis bilden die Bundesverordnung über die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Notlagen (VTN) und das WVG (Art. 25 bis 29). Geltung des Reglements (Artikel 2) Der Geltungsbereich wird gegenüber den bisherigen Formulierungen in den Musterreglementen präziser umschrieben. Neu wird explizit unterschieden zwischen a. den WasserbezügerInnen und b. den EigentümerInnen von geschützten Bauten und Anlagen, für die nur die gebührenrechtlichen Bestimmungen der Löschgebühren gelten (Bauten und Anlagen, die nicht an der öffentlichen Wasserversorgung angeschlossen sind). 25 26 Schutzzonen (Artikel 3) Die Kantone bzw. die Wasserversorgungen sind gestützt auf das eidgenössische Gewässerschutzgesetz (Art. 20) verpflichtet, für den Schutz ihrer Trinkwasserfassungen die erforderlichen Schutzzonen auszuscheiden. Nach Artikel 20 WVG können Nutzungsbeschränkungen auch auf die Zuströmbereiche ausgedehnt werden. Zuständig für die Erarbeitung der Grundlagen und den Erlass einer Schutzzone sind die Wasserversorgungen. Die Verfahren werden vom WEA durchgeführt. Im Übrigen siehe Kommentar zu den Artikel 20 und 21. Generelle Wasserversorgungsplanung (Artikel 4) Die Wasserversorgungen haben eine Generelle Wasserversorgungsplanung (GWP) zu erstellen und periodisch zu überarbeiten (Art. 18 WVG). Die GWP ist beim Aufstellen des Erschliessungsprogrammes nach Baugesetz (BauG) zu berücksichtigen, damit die beiden Instrumente widerspruchsfrei sind. Die GWP soll auch bei der ordentlichen Ortsplanung als Grundlage für die Gemeinden dienen. Einzelheiten finden Sie in der Broschüre des Wasser- und Energiewirtschaftsamtes (WEA) "Wegleitung für die Generelle Wasserversorgungsplanung". Erschliessung und Erschliessungspflicht (Artikel 5 und Artikel 21 Absatz 3) Die Erschliessungspflicht der Wasserversorgungen richtet sich nach dem WVG und der Baugesetzgebung. Die Wasserversorgungen müssen gemäss Art. 23 WVG die Basis- und die Detailerschliessung in allen Bauzonen (also auch in den Ferienhauszonen) sowie in den geschlossenen Siedlungsgebieten (Art. 9 Abs. 1 WVG) vornehmen (vgl. auch die Broschüre des WEA "Erschliessung". Die Formulierung ist recht flexibel, die Wasserversorgungen haben damit einen gewissen Spielraum in der Beurteilung. Wie die Erschliessung technisch erfolgt, ist nicht näher geregelt. Es ist somit durchaus denkbar und teilweise üblich, dezentrale Anlagen zu erstellen. Dabei ist zu beachten, dass die Anlagen den Normen und Richtlinien der anerkannten Fachorganisationen (SIA, SVGW, SSIV) entsprechen. Wasserbezug (Artikel 6) Die Pflicht zum Wasserbezug deckt sich im Wesentlichen mit derjenigen zur Wasserabgabe. Nicht nur das Trinkwasser sondern auch das Brauchwasser - soweit es Trinkwasserqualität aufweisen muss (z.B. Wasser für die Herstellung von Lebensmitteln, Badewasser etc.) - ist von der öffentlichen Wasserversorgung zu beziehen. Ausgenommen von dieser generellen Bezugspflicht ist somit nur das reine Brauchwasser, wie Wasser für die Gartenbewässerung, Garagenwasser, Wasser für die WC-Spülung und für die Waschmaschine. Hahnen, die 27 öffentlich zugänglich sind und aus denen kein Trinkwasser fliesst, sind gut sichtbar als solche zu kennzeichnen. Die Bezugspflicht gilt sowohl für das Kalt- wie auch für das Warmwasser. Dies ergibt sich insbesondere daraus, dass die Temperatur des Warmwassers je nach Gebrauch nachlässt (Boiler) und Kaltwasser nachfliesst. Ist das Wasser nur noch lauwarm, sind die Wachstumsbedingungen für Bakterien optimal, und die Qualität des Wassers ist nicht mehr einwandfrei. Das WVG (Art. 15 Abs. 2) statuiert die Ausnahme von der Bezugspflicht. Entbunden sind nur diejenigen Bauten und Anlagen, die im Zeitpunkt der Erschliessung durch die öffentliche Wasserversorgung bereits aus andern Anlagen mit Trinkwasser versorgt werden, das den Bestimmungen der Lebensmittelgesetzgebung entspricht. Eine andere Regelung durch die Wasserversorgungen ist unzulässig. Im Weiteren ist aus dem Grundsatz abzuleiten, dass nach einem Anschluss keine Wahlfreiheit mehr besteht. Das Abhängen von der öffentlichen Wasserversorgung (z.B. weil man findet, das Wasser sei zu teuer) und der Bezug von privatem Wasser ist nicht zulässig (Ausnahme: Reines Brauchwasser). Wasserabgabe (Artikel 7 und 8) Die Wasserabgabepflicht der Wasserversorgungen erstreckt sich über das gesamte benötigte Trink- und Brauchwasser (unabhängig von der erforderlichen Qualität). Sie geht aber nicht über den ordentlichen normalen Verbrauch hinaus. Vor allem Industriebetriebe mit grossem Wasserbedarf müssen diesen weiterhin selber decken, wenn die Wasserversorgungen nicht in der Lage sind, das Wasser ohne aufwändige Investitionen, die von allen übrigen WasserbezügerInnen mitgetragen werden müssten, zu liefern. Es steht den Wasserversorgungen aber offen, mit Gross- und Spitzenwasserbezügern besondere Verträge über die Wasserlieferung und die Preise abzuschliessen. Bei der Ausgestaltung muss aber die Kostendeckung gewährleistet sein (vgl. Art. 2 Abs. 3 und Art. 32 Abs. 3). Die Verträge unterliegen keiner kantonalen Genehmigung. Die Wasserversorgungen sind in qualitativer Hinsicht verpflichtet, die Bestimmungen der Lebensmittelgesetzgebung einzuhalten. Sie sind aber nicht gehalten, weitere spezielle Anforderungen zu erfüllen. Sind solche notwendig, haben sie die betroffenen Wasserbezüger auf eigenen Kosten zu ergreifen. Einschränkungen der Wasserabgabe durch die Wasserversorgung (Artikel 9) Nach wie vor dürfen bzw. müssen die Wasserversorgungen die Wasserabgabe in den in Artikel 9 genannten Fällen vorübergehend einschränken oder unterbrechen, ohne allein dadurch schadenersatzpflichtig zu werden. Die Zuständigkeit für die Anordnung von Massnahmen richtet sich nach der Verwaltungsorganisation. Selbstverständlich sind die 28 Wasserversorgungen gehalten, alle Massnahmen zu treffen, dass Schäden möglichst verhindert werden/gar nicht entstehen können. Handeln die Wasserversorgungen aber fahrlässig oder pflichtwidrig, können sie sich nicht durch diese Bestimmung schadlos halten. Bewilligungspflichtige Tatbestände (Artikel 11) Neu ist, dass sämtliche Bewilligungstatbestände nach dem Reglement in einem Artikel geregelt sind. Es gilt zu beachten, dass auch für die erwähnten Bewilligungstatbestände das Koordinationsgesetz (vor allem bei Baubewilligungen) zu beachten ist. Es ist somit durchaus möglich, dass die Wasserversorgungen nicht selber eine Anschlussbewilligung oder eine Bewilligung für die Änderung der Belastungswerte oder des umbauten Raumes erteilen, sondern ihre Auflagen und Bedingungen im Rahmen eines Mitberichtes mit Antrag formulieren. Hinweis: Bei der Bewilligung von Anschlussgesuchen wird den Wasserversorgungen dringend empfohlen, in diese oder in den Mitbericht keine Frankenbeträge aufzunehmen, wenn sie bereits Aussagen zu den Anschlusskosten machen. Es gilt für die Anschluss- und die Löschgebühren immer derjenige Gebührentarif, der im Zeitpunkt des Wasseranschlusses bzw. der Sicherstellung des Löschschutzes gültig ist. Zudem sollten die Anschlussbewilligungen befristet werden (vgl. Muster im Anhang). Ende des Wasserbezuges (Artikel 14) Es hat in der Praxis mit dieser Bestimmung verschiedentlich Probleme gegeben. Die jetzige Formulierung trägt diesem Umstand Rechnung, indem geregelt ist, dass jedenfalls bis zur Abtrennung (durch die zuständigen Organe der Wasserversorgungen) die Gebühren geschuldet sind. Der alleinige Verzicht auf den Wasserbezug reicht nicht aus, um von den Grundgebühren befreit zu werden. Bei Ende des Wasserbezuges muss die Abtrennung der Hausanschlüsse verfügt werden, wenn dies nicht im gegenseitigen Einvernehmen erfolgt. Die Kosten für die fachgerechte Abtrennung gehen zulasten des bisherigen Wasserbezügers. Anlagen zur Wasserverteilung (Artikel 15 bis 17) Die Definition der öffentlichen und privaten Anlagen hat sich in der Praxis grundsätzlich bewährt und findet deshalb weitgehend unverändert Eingang ins neue Musterreglement. Für die Leitungen gilt: 29 Öffentliche Leitungen Hausanschlussleitungen Definitionen Alle Leitungen der Basis- und Detailerschliessung gemäss Artikel 106 ff BauG. Im Zweifelsfall, wenn sie dem Löschschutz dienen. Leitungen nach dem Absperrschieber bis zum Wasserzähler, die ein Gebäude oder eine zusammengehörige Gebäudegruppe erschliessen. Erstellung und Kostentragung Gemeinde oder andere öffentliche Nach den reglementarischen Wasserversorgungsträgerschaften, Bestimmungen, meist gemäss Erschliessungsprogramm GrundeigentümerInnen. oder nach pflichtgemässem Ermessen. Eigentum, Unterhalt, Ersatz Gemeinde oder andere öffentliche Nach den reglementarischen Wasserversorgungsträgerschaften Bestimmungen, meist GrundeigentümerInnen. Bemerkung: Wasserversorgungen Einige sind EigentümerInnen der Hausanschlussleitungen. Dies ist zulässig. Zu beachten ist in diesen Fällen allerdings, dass diese Leitungen auch in die Wiederbeschaffungswertberechnungen einbezogen werden müssen. Schwierigkeiten ergaben sich aber in der konkreten Abgrenzung zwischen den öffentlichen und den privaten Anlagen. Die nun vorgesehene, eindeutige Regelung (Artikel 15 Buchstabe a, Artikel 17 Absatz 1, Artikel 31 Absatz 2) legt fest, dass alle Leitungen bis zum 1. Absperrschieber von der öffentlichen Leitung im Eigentum der Wasserversorgung stehen sollen. Dasselbe gilt auch für den Absperrschieber selbst, der neu von der Wasserversorgung einzubauen und zu bezahlen ist. Mit dieser Regelung können die Wasserversorgungen z.B. bestimmen, dass sie das Eigentum an der Abzweigleitung im Strassenbereich behalten. Erschliessungsanspruch (Artikel 18) Neu ist Artikel 108a des Baugesetzes ausdrücklich vorbehalten. Diese Bestimmung legt fest, dass die GrundeigentümerInnen nach Ablauf einer bestimmten Frist (wie Erschliessungsprogramme oder spätestens 15 Jahre nach der Einzonung) Anspruch auf eine Erschliessung haben und diesen Anspruch auf Kosten des erschliessungspflichtigen Gemeinwesens durchsetzen können. Leitungen im Strassengebiet (Artikel 19) Das Einlegen von Leitungen im Strassengebiet richtet sich nach dem Verfahren für die öffentlichrechtliche Sicherung von Durchleitungsrechten (vgl. dazu Kommentar zu Art. 20, öffentlichrechtliche Sicherung, Bst. b). Zudem wird in Absatz 2 eine Lücke in der Gesetzgebung geschlossen. Bisher muss, ohne anders lautende Bestimmung, die Überbauungsordnung durch die Legislative beschlossen werden (grössere Leitungen). Neu soll vor allem aus technischen Gründen, und weil kein 30 grosser Spielraum bei der Festlegung der Linienführung besteht, für den Beschluss der Überbauungsordnung für Wasserleitungen immer die Exekutive zuständig sein. Durchleitungsrechte (Artikel 20) Privatrechtliche Sicherung Die Durchleitungsrechte für öffentliche Leitungen können privatrechtlich in Form von Dienstbarkeiten begründet werden. Dies führt zu folgenden rechtlichen Konsequenzen: Dienstbarkeiten kommen nur im gegenseitigen Einvernehmen zustande (falls nicht Notrecht gilt). In der Regel ist für die Durchleitungsrechte eine Entschädigung zu bezahlen. Für baubewilligungspflichtige Sonderbauwerke und Nebenanlagen - auch im Zusammenhang mit der Linienführung - ist ein Baubewilligungsverfahren durchzuführen. Das Recht wird im Grundbuch als Dienstbarkeit zulasten eines Grundstücks eingetragen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Zivilrechts (Art. 691ff ZGB). Dies ist insbesondere von Bedeutung für die Verlegung einer Leitung an einen andern Ort. Nach dem Zivilrecht haben in der Regel die Berechtigten - also die Wasserversorgungen - die Kosten zu tragen (Art. 693 ZGB). Öffentlichrechtliche Sicherung a Allgemeines Die Wasserversorgungen haben die Möglichkeit, öffentliche Leitungen in einem öffentlichrechtlichen Verfahren sichern zu lassen (Art. 21 WVG, früher Art. 130a WNG). Es handelt sich um ein formelles verwaltungsrechtliches Verfahren und hat gegenüber der privatrechtlichen Vereinbarungfür die Beanspruchung von privatem Land folgende gewichtige Vorteile: Die Durchleitungen sind an sich entschädigungslos zu dulden, es sei denn, es handle sich um einen enteignungs-(ähnlichen) Eingriff. Zu entschädigen sind in jedem Fall Inkonvenienzen und insbesondere Landschaden im Zusammenhang mit der Erstellung der Anlagen. Das Terrain ist nach Durchführung der Arbeiten wieder herzustellen. Mit den öffentlichen Leitungen verbundene Sonderbauwerke und die für die Erstellung und den Unterhalt der Leitungen notwendigen Nebenanlagen werden in diesem Verfahren mitbewilligt. Für den Bau bedarf es somit keiner weiteren Bewilligungen mehr. Zudem können zusätzlich besondere Überbauungsvorschriften erlassen werden. Die Linienführung kann im Grundbuch angemerkt werden. Die Anmerkung hat deklaratorische Bedeutung und gilt nur als Hinweis, das heisst, das Recht besteht 31 auch, wenn es nicht im Grundbuch steht. Aus Gründen der Transparenz soll von dieser Möglichkeit aber immer Gebrauch gemacht werden. Im Übrigen gelten die öffentlichrechtlichen Bestimmungen des Wasserversorgungsgesetzes. Der Verlegungsanspruch der GrundeigentümerInnen fällt dahin; die Kosten der Verlegung an einen andern Ort haben sie selber zu tragen. Die Verlegung kommt zudem nur in Betracht, wenn dies ohne Nachteil für das Werk möglich ist. Für die Beanspruchung von öffentlichen Strassen, Gewässer, Wälder, Schutzgebiete und ähnliches gehen die einschlägigen Bestimmungen der Spezialgesetzgebung vor. b Verfahren (Artikel 21 und 22 WVG; gilt sinngemäss auch für den Erlass von Schutzzonen) Vorprüfung: Da die Bestimmungen für den Erlass einer Überbauungsordnung massgebend sind, sind die Unterlagen (Pläne, Genehmigungsvermerke, Sonderbauvorschriften) vor Eröffnung des Verfahrens dem WEA zur Vorprüfung einzureichen. Der Vorprüfungsbericht gehört zu den Auflageakten. Vor oder - wenn möglich - mit der Publikation ist die Mitwirkung durchzuführen. Gemäss Artikel 58 BauG kann bei einer Überbauungsordnung, die nicht von allgemeinem Interesse ist, die Mitwirkung auch im Rahmen des Einspracheverfahrens gewährt werden. Dies sollte für die Verfahren nach WVG die Regel sein. Die verschiedenen Verfahren - Linienführungen von Leitungen, die sich über das Gebiet mehrerer Gemeinden erstrecken, regionaler Trägerschaften oder von Leitungen auf anderem Gemeindegebiet und Schutzzonen: - Gesuchstellerin: Wasserversorgung Verfahrensleitende Behörde: WEA Beschluss: Wasserversorgung Genehmigungsbehörde: WEA Kommunale Linienführungen: Gesuchstellerin: Wasserversorgung Verfahrensleitende Behörde: Wasserversorgung/Gemeinde Beschluss: Wasserversorgung Genehmigungsbehörde: WEA 32 Einsprache, Rechtsverwahrung und Gebühren - Einsprachebefugnis: Zur Einsprache befugt ist, wer im Plangebiet (oder daran angrenzend) Grundeigentum oder andere Rechte an Grundstücken besitzt und durch die aufgelegten Pläne in den eigenen schutzwürdigen Interessen berührt ist. - Einsprachegründe: Verfahrensfehler, mangelnde Recht- oder Zweckmässigkeit oder fehlendes öffentliches Interesse an der Planvorlage (Genehmigungsfähigkeit). Bei Änderungsvorlagen können auch Planinhalte angefochten werden, deren Änderung nicht vorgesehen ist. - Rechtsverwahrung: Das Verfahren kennt formell keine Rechtsverwahrung. Die privatrechtlichen Ansprüche sind nicht Gegenstand des Planerlassverfahrens. Ihre Meldung ist jedoch zweckmässig, weshalb weiterhin Rechtsverwahrungen entgegengenommen werden. - Gebühren: Für die Behandlung der Einsprachen kann das WEA eine Gebühr erheben, wenn den Anträgen nicht stattgegeben wird. Ansonsten ist das Verfahren grundsätzlich kostenlos, wenn es sich um ein Schutzzonenverfahren handelt. Geringfügige Änderung von Plänen und Projektänderung Geringfügige Änderungen können ohne Publikation und Vorprüfung durch die Wasserversorgungen beschlossen werden. Es bedarf dazu der vorgängigen Orientierung der GrundeigentümerInnen mit der Einräumung einer Einsprachefrist von mindestens 10 Tagen. Die Änderungen sind vom WEA zu genehmigen. Für Projektänderungen gilt Artikel 43 des Baubewilligungsdekretes. Während des erstinstanzlichen Verfahrens ist eine Projektänderung ohne erneute Publikation möglich, wenn keine öffentlichen oder wesentlichen privaten Interessen zusätzlich betroffen werden. 33 c Schema Regionale Leitungen, Leitungen auf anderem Gemeindegebiet Kommunale Leitungen Gesuch WV an WEA zur Vorprüfung (+ Orientierung der GrundeigentümerInnen durch WV) Gesuch WV an WEA zur Vorprüfung (+ Orientierung der GrundeigentümerInnen durch WV) Wenn nicht in Ordnung, zurück an WV zur Überarbeitung Wenn nicht in Ordnung, zurück an WV zur Überarbeitung Gesuch der WV an WEA Publikation durch WEA/Mitwirkung (mind. 30 Tage) Publikation durch WV/Mitwirkung (mind. 30 Tage) Einspracheverhandlungen durch WEA Beschluss und Antrag WV an WEA Einspracheverhandlungen durch WV/Gemeinde Beschluss und Antrag WV an WEA Genehmigungsbeschluss WEA und Publikation Genehmigungsbeschluss WEA und Publikation Hydrantenanlagen und -löschschutz (Artikel 22) Beim Aufstellen von Hydranten auf privatem Grund handelt es sich gemäss Baugesetzgebung um Eigentumsbeschränkungen von untergeordneter Bedeutung (Art. 136 BauG). Die GrundeigentümerInnen sind verpflichtet, solche Anlagen auf ihren Grundstücken grundsätzlich entschädigungslos zu dulden. Sie sind aber rechtzeitig zu benachrichtigen, ihre Standortwünsche sind nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Zudem ist ihnen verursachter Kultur- und Sachschaden zu ersetzen. Nachweisbare erhebliche Nachteile in der Benützung oder Bewirtschaftung der Grundstücke sind zusätzlich zu entschädigen. Unter dem ordentlichen Hydrantenlöschschutz sind sämtliche Aufwendungen auf dem Leitungsnetz zu verstehen. Diese müssen von den Wasserversorgungen getragen werden, unabhängig vom Brandrisiko und von der Bedeutung der Anlage. Nur die Mehrkosten, die sich auf die Inneneinrichtungen allein oder die Mehrdimensionierung von Leitungen und Anlagen, die über das normale Brandrisiko des betreffenden Siedlungsgebietes hinaus gehen, sind von den Verursachenden zu tragen. Sie sollen aber eine gebührenrechtliche Privilegierung geniessen, indem die Belastungswerte von Sprinkleranlagen, Löschposten und Innenhydranten nicht in die Berechnung der Anschlussgebühren einzubeziehen sind. Dies, weil sonst die Durchsetzung der wichtigen gebäudeinternen Löschbereitschaft unnötig erschwert würde. Für Übungszwecke und im Brandfall stehen der Feuerwehr alle Anlagen gratis zur Verfügung. Dies gilt auch für die zu diesen Zwecken bezogene Wassermenge. 34 Wasserzähler (Artikel 23 bis 25) Im Sinn einer sachgerechten Tarifierung ist der Wasserverbrauch mit Wasserzählern zu messen. Im Gegensatz etwa zur Stromversorgung wird pro Gebäude aber nur ein Zähler - und nicht für jede Wohnung einer - installiert. Die Abweichungen von diesem Grundsatz sind in Artikel 23 Absätze 2 und 3 geregelt. Die Wasserzähler stehen im Eigentum der Wasserversorgungen. Sollen weitere Zähler (Nebenzähler) auf Begehren der WasserbezügerInnen angebaut werden, können die Wasserversorgungen diese gesondert verrechnen (Zählergebühr). Die Kosten des Hauptwasserzählers sind in der jährlichen Grundgebühr inbegriffen. Die Gebührenansätze für die Nebenwasserzähler sind im Tarif festzulegen, bedürfen also einer Rechtsgrundlage wie alle anderen Gebühren auch. Rückflussverhinderung (Artikel 26) Explizit im Musterreglement festgehalten ist die technische Vorgabe, dass die Privaten dafür besorgt sein müssen, dass kein Wasser von den privaten Anlagen in die öffentlichen Anlagen zurück fliessen kann. Mängel (Artikel 27) Stellen die Wasserversorgungen an privaten Anlagen Mängel fest, die die WasserbezügerInnen auf eigene Kosten zu beheben haben, teilen sie dies den WasserbezügerInnen mit, fordern sie mit eingeschriebenem Brief zur Stellungnahme oder zur Behebung der Mängel innert Frist auf. Ist Gefahr im Verzug, können sie direkt verfügen. Nach unbenütztem Ablauf der Frist ordnen die Wasserversorgungen die Behebung der Mängel innert einer neuen Frist mit Verfügung an, verbunden mit der Androhung der Ersatzvornahme im Unterlassungsfall und der Bestrafung nach Artikel 292 des Schweizerischen Strafgesetzbuches im Falle des Ungehorsams (Haft oder Busse). Diese Verfügung muss eine Rechtsmittelbelehrung enthalten. Sind die Mängel immer noch nicht behoben, ordnen die Wasserversorgungen mit Verfügung die Ersatzvornahme an (= Vollstreckungsverfügung: wann und wie wird vollstreckt). Die Vollstreckungsverfügung ist ebenfalls mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen: Sie unterliegt dem gleichen Rechtsmittel wie die Verfügung in der Sache. Installationsbewilligung (Artikel 29) Die Bewilligungspflicht für die Befugnis, private Anlagen zu erstellen oder zu montieren, fusst in der Überlegung, dass die Anlagen sachgerecht erstellt und gleichzeitig die berechtigten Personen verpflichtet werden, alle gebührenpflichtigen Änderungen, die sie an den privaten Anlagen vornehmen, den Wasserversorgungen unverzüglich und ohne Aufforderung zu 35 melden. So bekommen die Wasserversorgungen auf einfache Weise eine Erhöhung der Belastungswerte zur Kenntnis. Im Widerhandlungsfall können sie die Bewilligung entziehen. Weitere Einschränkungen für die Erteilung der Bewilligung als die in Artikel 29 vorgesehenen sind nicht zulässig. Insbesondere wäre die Bevorzugung des ortsansässigen Gewerbes rechtlich nicht haltbar, weil gegen die Wirtschaftsfreiheit verstossend. Auch künftig soll die Installationsbewilligung nur an natürliche Personen und nicht an Firmen abgegeben werden, denn nur natürliche Personen können die erwähnten Bewilligungskriterien erfüllen. Erdung (Artikel 31 Absatz 3) Neu dürfen die Wasserleitungen generell nicht mehr für die elektrische Erdung benützt werden; bisher war dafür eine Bewilligung erforderlich. Finanzierung der Anlagen (Artikel 32) Wie bis anhin muss die Aufgabe der Wasserversorgung eigenwirtschaftlich finanziert werden (Art. 10 WVG). Neu ist lediglich der Ersatz des Begriffes "Löschschutz" durch "Hydrantenlöschschutz", weil diese Bezeichnung präziser ist. Eigenwirtschaftlichkeit bedeutet, dass für die Finanzierung der Aufgaben explizit keine Steuern eingesetzt werden dürfen, dass sich die Wasserversorgung also allein aus den in Artikel 33 genannten einmaligen und wiederkehrenden Gebühren finanzieren muss. Hinsichtlich der Ausgestaltung der Gebühren, der Einlagen in die Spezialfinanzierung und der Abschreibungen (Abs. 2) wird auf die Broschüre des WEA "Finanzierung der Wasserversorgung" verwiesen. Hier sei nur erwähnt, dass die gemeinderechtlichen Vorschriften, insbesondere die Abschreibungsvorschriften des neuen Rechnungsmodells, für die Wasserversorgung nicht anwendbar sind sondern die spezialrechtlichen Bestimmungen des WVG gelten. Einmalige und jährliche Gebühren (Artikel 33 bis 36) Im Rahmen der Vorgaben der Eigenwirtschaftlichkeit stehen den Wasserversorgungen die in Artikel 33 erwähnten Gebühren zur Verfügung. Auf die Erhebung von Grundeigentümerbeiträgen gemäss BauG soll weiterhin verzichtet werden, weil sich dieses System für die Wasserversorgung nicht eignet. Nachzahlungspflicht und Anrechnung bereits bezahlter Gebühren: Bei den einmaligen Gebühren (Anschluss- oder Löschgebühren) haben wir wiederum die Nachzahlungspflicht und die Anrechnung Wasserversorgungen von bereits degressive bezahlten Gebühren Gebührenansätze geregelt. festlegen, ist Soweit die bei der Nachzahlungspflicht zu berücksichtigen, dass jeweils derjenige Ansatz zur Anwendung 36 gelangt, der gelten würde, wenn eine "normale" Anschlussgebühr geschuldet wäre. Beispiel: Ein Gebäude erhöht seinen umbauten Raum um 50 m³ auf 1'050 m³. Die ersten 1'000 m³ kosten gemäss Reglement Fr. 4.--/m³ uR, ab 1'000 bis 3'000 m³ beträgt der Ansatz noch 1.--. Angewendet werden muss nun der Ansatz ab 1'000 m³, also 1.--/m³. Hinsichtlich der Anrechnung bereits bezahlter Gebühren ergeben sich im Grundsatz keine Änderungen gegenüber dem alten Musterreglement. Infolge verschiedener Anfragen haben wir aber eine nochmals klarere Formulierung gewählt. Es wird eindeutig festgelegt, dass nur der effektiv geleistete Frankenbetrag an die nach dem geltenden Tarif geschuldete Gebühr angerechnet wird. Die weiteren Erläuterungen zu den tariflichen Bestimmungen finden Sie im Kommentar zum Wassertarif. Fälligkeiten (Artikel 38) Die Anschlussgebühr ist in dem Zeitpunkt geschuldet, ab dem Wasser bezogen werden kann, d.h. mit dem Einbau des Wasserzählers (= Wasseranschluss). Die andern Fälligkeiten bedürfen keiner weiteren Ergänzung. Einforderung der Gebühren (Artikel 39) In der Regel verschicken die Wasserversorgungen zuerst eine Rechnung. Wird diese auch nach Mahnung nicht bezahlt, müssen sie eine Verfügung mit Rechtsmittelbelehrung erlassen, um die Forderung durchzusetzen (vgl. auch Bemerkungen zu Art. 41). Es ist aber zulässig, bereits die erste Rechnung als Verfügung auszugestalten und so auf die Mahnung zu verzichten; dies müsste im Reglement allerdings so vorgesehen sein (Abs. 3). Einstellung der Wasserlieferung? Die Einstellung der Wasserlieferung wegen Verschuldens der WasserbezügerInnen ist als Massnahme des Verwaltungszwangs grundsätzlich möglich, aber an einschränkende Voraussetzungen geknüpft. Im Allgemeinen gilt das Verhältnismässigkeitsprinzip. Die Liefersperre ist als schärfstes Mittel erst zulässig, wenn andere, weniger einschneidende Massnahmen, wie die Vorauszahlung künftiger Wasserlieferungen, nicht zum Ziel führen. In Übereinstimmung mit der Verwaltungspraxis, darf aber das lebensnotwendige Wasser in keinem Fall entzogen werden, selbst nach fruchtloser Betreibung der ausstehenden Zahlungen nicht. Der lebensnotwendige Bedarf bestimmt sich nach den jeweiligen Umständen (vgl. dazu auch Dr. Kilchenmann, Handkommentar zum Energiegesetz des Kantons Bern, N 63). Dieser Grundsatz gilt für natürliche Monopolbetriebe, wie es auch die Wasserversorgungen sind, weil keine Wahlfreiheit besteht und die Betroffenen das Wasser nirgendwo anders beschaffen können. Wird das bezogene Wasser nicht bezahlt, können die 37 Wasserversorgungen Bussen (gestützt auf Art. 43 des Wasserversorgungsreglements) aussprechen und die Zahlungsunwilligen wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen anzeigen (Art. 292 StGB). Gebührenpflichtige Handlungen Eine solche Bestimmung ist nur notwendig, wenn die Wasserversorgungen über keine andere Rechtsgrundlage für die Erhebung von Verwaltungsgebühren verfügen. In der Regel (bei Gemeinden) ist die Grundlage aber bereits im Baureglement oder in einem separaten Gebührenreglement vorhanden. Folgende Formulierung wird im Bedarfsfall empfohlen (Einschub zwischen Art. 40 und Art. 41). Weitere gebührenpflichtige Tätigkeiten Artikel 40a 1 Für die Erteilung von Bewilligungen gestützt auf dieses Reglement, für Kontrollen, die zu Beanstandungen führen und für besondere Dienstleistungen, zu denen die Wasserversorgung nicht verpflichtet ist, wird eine Gebühr nach Zeitaufwand erhoben. 2 Die Exekutive legt den Stundenansatz im Tarif fest. Gebührenpflichtige Personen; Schuldbetreibung und Konkurs (Artikel 41 und 42) a Betreibungsverfahren (einmalige und wiederkehrende Gebühren) Ist die Forderung fällig, ist eine Verfügung zu erlassen. Ist die Verfügung rechtskräftig, erhalten die Wasserversorgungen einen definitiven Rechtsöffnungstitel; sie können die Betreibung fortsetzen und die Verwertung verlangen. b Fortsetzung der Betreibung Einmalige Gebühren Die Gemeinde geniesst für die einmaligen Gebühren gemäss Artikel 109 EG zum ZGB ein gesetzliches Grundpfandrecht. - Normalfall Nach erfolgloser Betreibung können die Wasserversorgungen das Pfandverwertungsbegehren stellen. Wird dem Begehren entsprochen (richterliches Verfahren), werden die Wasserversorgungen aus dem Erlös der Versteigerung des Grundstücks, auf dem das Grundpfandrecht lastet, befriedigt. - Forderung im Konkursverfahren Wird der Konkurs eröffnet, müssen die einmaligen Gebührenforderungen angemeldet werden. Sind sie in diesem Zeitpunkt fällig, wird im Rahmen des Konkursverfahrens auch die grundpfandversicherte Forderung behandelt. Diese wird - wenn möglich - im 38 Rahmen der Verwertung befriedigt, entweder durch öffentliche Versteigerung des grundpfandversicherten Grundstücks oder durch freihändigen Verkauf (wenn die Grundpfandgläubiger diesem Vorgehen zustimmen). Der Erlös kommt in erster Linie den Grundpfandgläubigern des verwerteten Grundstücks zu. Ist er grösser als die Forderungen, fällt der Rest in die Aktiven der Konkursmasse und steht den weiteren (weniger privilegierten) Gläubigern zur Verfügung. Ist der Erlös aber kleiner als die Forderungen, die auf dem Grundstück lasten, wird er unter den Grundpfandgläubigern jedes einzelnen Grundstücks anteilsmässig verteilt. Mit dem nicht gedeckten Anteil nehmen die noch nicht vollumfänglich befriedigten Forderungen im Rahmen des nach Konkursrecht geltenden Ranges bzw. der geltenden Klasse (in der Regel der dritten) am Erlös der ganzen übrigen Konkursmasse teil. Dies gilt, sofern der Schuldner für die Forderung auch persönlich haftet (nicht für Grundlast und Gült). Die grundpfandversicherten Forderungen, die bei der Konkurseröffnung nicht fällig sind, werden - im Gegensatz zu den anderen Forderungen - nicht automatisch fällig. In diesem Fall werden diese Schulden den Ersteigenden im Rahmen der Verwertung (Versteigerung oder freihändiger Verkauf) als persönliche Schuld überbunden. Jährliche Gebühren Im Normalfall werden die jährlichen Gebühren im Pfändungsverfahren eingefordert. In einem Pfandverwertungs- oder Konkursverfahren werden sie mit den Steigerungsbedingungen den Nacherwerbenden überbunden. Verwaltung und Organisation Die Verwaltung und die Organisation sind meistens bereits im Organisationsreglement (OgR) geregelt. Die Details und die Aufgaben der jeweiligen Kommissionen und Angestellten können in einem Pflichtenheft festgehalten werden. Falls Bestimmungen im OgR fehlen, nachfolgend Formulierungsvorschläge für die Regelung im Wasserversorgungsreglement einer Gemeinde (neuer Titel nach Art. 42). Verwaltung und Organisation Aufsicht, Leitung Aufgaben Artikel x Die Wasserversorgung steht unter der Aufsicht des Gemeinderates. Die technische und administrative Leitung der Wasserversorgung obliegt der Wasserkommission. Artikel x+1 1Die Wasserkommission besteht aus ... Mitgliedern. Diese werden gemäss OgR gewählt. 2Die näheren Aufgaben und Zuständigkeiten der Wasserkommission werden in einem vom Gemeinderat erlassenen Pflichtenheft umschrieben. 39 3Für die Belange der Wasserqualität ist die Gesundheitskommission, für die Belange des Löschschutzes der Feuerwehrkommandant beizuziehen. Sekretariat Fachpersonal Plansammlung Artikel x+2 Zur Besorgung der laufenden Verwaltungsangelegenheiten wählt der Gemeinderat auf Antrag der Wasserkommission eine Person, die das Sekretariat führt. Sie muss nicht Mitglied der Kommission sein. Artikel x+3 Zur Aufsicht über die Anlagen der Wasserversorgung wählt der Gemeinderat auf Antrag der Wasserkommission das Fachpersonal. Artikel x+4 Die Wasserkommission legt von allen öffentlichen und privaten Anlagen der Wasserversorgung eine vollständige Plansammlung an und führt sie periodisch nach. Übergangsbestimmung (Artikel 45) Diese Bestimmung gilt für die Durchführung des Verfahrens, d.h. für die formellen verfahrensrechtlichen Vorschriften und Zuständigkeiten, nicht aber für die Anwendung z.B. der Tarife. Für die Gebühren sind immer diejenigen Bestimmungen massgebend, die im Zeitpunkt der Fälligkeit in Kraft sind. Verfahren für den Erlass des Reglements Das Verfahren untersteht den Vorschriften über den Erlass von Gemeindereglementen (Veröffentlichung und Fristen). Da - ausser den Reglementen für Genossenschaften - die Reglemente im Bereich der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion seit dem 1. Januar 1996 nicht mehr genehmigungspflichtig sind (gilt auch für Änderungen genehmigter Reglemente), bedeutet dies: Der Beschluss der Gemeindeversammlung muss publiziert werden mit dem Hinweis, dass dagegen innert 30 Tagen Beschwerde geführt werden kann. Im Rahmen des Erlassverfahrens unerledigt gebliebene Einsprachen sind als Gemeindebeschwerden an das zuständige Regierungsstatthalteramt mit allen erforderlichen Unterlagen und einem Antrag zur Beurteilung zu überweisen. Privatrechtliche Trägerschaften überweisen die Akten der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion. Den Beschwerden kommt in der Regel aufschiebende Wirkung zu, was bedeutet, dass das Reglement bis zur endgültigen Erledigung nicht in Kraft gesetzt werden kann. 40 Kommentar zum Wassertarif 1. Grundsätzliche Überlegungen Seit den Achtzigerjahren sinken sowohl der mittlere als auch der Spitzenwasserbedarf in der ganzen Schweiz, langsam aber stetig. Diese Entwicklung hat nicht nur eine positive Seite, sondern auch die negative Erscheinung, dass wegen des extrem hohen Festkostenanteils der Wasserversorgung die Wasserpreise unter Druck geraten. Da ohnehin in vielen Wasserversorgungen ein Nachholbedarf wegen der ungenügenden Refinanzierung der kapitalintensiven Anlagen bestand und teils noch besteht, ist es entscheidend, die Preise sachgerecht zu gestalten. Man muss sich weit mehr bewusst werden, welche die massgebenden Kostenfaktoren sind, um auch einem richtig verstandenen Verursacherprinzip zum Durchbruch zu verhelfen: Kosten verursacht nicht primär wer Wasser braucht, sondern wer eine Infrastruktur beansprucht, und sei dies auch nur gelegentlich (Tourismus) oder am liebsten gar nicht (Löschschutz). Wir müssen uns ebenfalls bewusst sein, dass in der grossen Mehrzahl unserer Wasserversorgungen der Hydrantenlöschschutz allein 30 - 50 % der gesamten Werterhaltungskosten ausmacht, die mit dem Wasserverbrauch nichts zu tun haben. Aber auch die Kosten der Trink- und Brauchwasserversorgung haben nur einen bescheidenen Zusammenhang mit dem Wasserverbrauch. Wegen steigendem mittlerem Verbrauch jedenfalls wird keine Anlage vergrössert werden müssen, weil sämtliche Anlageteile auf die Verbrauchsspitzen ausgelegt sind. Heute bestehen keine ausgereiften technischen Lösungen, um die Verbrauchsspitzen bei den einzelnen Wasserbezügern zu erfassen und in die Tarifgestaltung einfliessen zu lassen. Kostensenkende Massnahmen sind deshalb nicht bei den Bezügern zu treffen, am wenigsten durch eigene Regenwassernutzungsanlagen, sondern bei den Wasserversorgungen selbst, indem sie in erster Linie durch regionale Kooperation die Wiederbeschaffungswerte ihrer Anlagen senken und ihre Dienstleistungen effizienter anbieten, z.B. durch die Einführung von Betreibermodellen. Bei der Tarifgestaltung müssen sie dafür sorgen, dass sie die Kosten möglichst denjenigen anlasten, die sie verursachen. Das sind eben gerade nicht die Wasserbezüger, die die Anlagen auslasten - ohne sie allerdings zu überlasten - sondern wer Investitionen für eine schlechte Auslastung der Anlagen auslöst. 2. Bewährtes und Neues An den drei Säulen "Belastungswert - umbauter Raum - Wasserverbrauch" als Bemessungsgrundlagen für die Wassergebühren ändert sich nichts. Seit 2002 sind lediglich die jährlichen Löschgebühren dazu gekommen, damit auch in kleineren Wasserversorgungen mit geringem Anschlussgrad die Gebührenlast gerechter verteilt 41 werden kann. Als weitere Neuerung werden die einmalige Bereitstellungsgebühr und die Grundeigentümerbeiträge nicht mehr als Finanzierungsinstrument erwähnt. Die Bereitstellungsgebühr wäre zwar zur Erhöhung des Selbstfinanzierungsrades geeignet, aber die Wasserversorgungen scheuen offenbar den damit verbundenen Aufwand. Die Grundeigentümerbeiträge haben ebenfalls nicht an Beliebtheit gewonnen, weil sie für die Wasserversorgung sehr umständlich und Risiko behaftet sind. An deren Stelle sind vermehrt Erschliessungsverträge getreten, in manchen Fällen allerdings in fragwürdiger Ausgestaltung. Eine weitere Neuerung sind die degressiven Ansätze für alle drei Bemessungsgrundlagen, dies aus zwei Gründen: Erstens führen Einheitsansätze bei grossen Anschluss- gebührenrechtlichen und Verbrauchswerten Grundsätze arg zu übersetzten strapazieren, und Gebühren, zweitens die sind die sie betriebswirtschaftlich nicht korrekt, weil sie die Kostenstrukturen der Wasserversorgung verzerrt abbilden. Diese Neuerung wird ausführlich in Abschnitt 5 behandelt. Als letzte Neuerung schliesslich führt der Wassertarif 2002 drei Varianten A, B und C mit folgender Begründung ein: Variante A Diese ist auf ländliche Wasserversorgungen zugeschnitten, wo der Anschlussgrad (noch) gering ist. Mit der zweigeteilten Grundgebühr bezahlen auch die angeschlossenen geschützten Liegenschaften im Rahmen der Grundgebühren einen Anteil an den Löschschutz (Löschkomponente). Dieses Vorgehen gewährleistet eine gerechte Gebührenverteilung. Variante B Bei dieser Variante, wo nur vereinzelte Liegenschaften nicht angeschlossen sind, verzichtet man auf die Gebührenkomponente nach dem umbauten Raum. Dafür muss die Grundgebühr auf den BW höher angesetzt werden. Dies erleichtert den Vollzug, weil nur der umbaute Raum der nicht angeschlossenen Liegenschaften erhoben (und nachgeführt) werden muss. Gleichzeitig nimmt man aber eine leichte Verzerrung in Kauf, indem grosse Bauten mit wenig Belastungswerten tendenziell zu tiefe Gebühren bezahlen. Variante C Diese Variante führt einen Einheitstarif ein, der gleichzeitig die Degression gewährleistet und den erheblichen Aufwand einer grossen Wasserversorgung für die Erhebung und Nachführung der Belastungswerte ausschaltet. Wir empfehlen auch kleineren Wasserversorgungen, lieber diese Variante zu wählen, als Grundgebühren auf untauglichen Bemessungsgrundlagen zu erheben. Auch in diesem Gebührenmodell ist übrigens eine 42 standardisierte Grundgebühr enthalten, allerdings im Gebührenrahmen versteckt. Grobe Abweichungen des Verhältnisses Anschlusswert zu Wasserbezug von den Durchschnittswerten bleiben im Gegensatz zu den Varianten A und B deshalb unberücksichtigt. 3. Berechnungsgrundlagen der Grundgebühr Für die Berechnung der (einmaligen) Anschluss- und Löschgebühren sind die Belastungswerte (BW) und der umbaute Raum (uR) praktisch unbestritten und in sehr vielen Wasserversorgungen eingeführt. Das ist darauf zurückzuführen, dass diese Werte im Rahmen der Bau- und Anschlussbewilligungsverfahren ohnehin von den Gesuchstellern angegeben werden müssen. Anders verhält es sich bei den jährlichen Grundgebühren, für deren Erhebung diese Werte über das ganze Versorgungs- und Löschgebiet nachträglich erhoben werden müssen. Diese Schwelle wird dann häufig zum Anlass genommen, um die Tauglichkeit grundsätzlich in Frage zu stellen. Deshalb dazu noch folgende Ausführungen: 3.1 Belastungswerte Unter den vielen theoretisch zur Verfügung stehenden Bemessungsgrundlagen haben wir bereits in unserem Musterreglement 1997 die Belastungswerte (BW) nach SVGW empfohlen, weil diese dem Grad der möglichen Benutzungsintensität der Wasserversorgung am nächsten kommen. Inzwischen sind fünf Jahre verstrichen, die uns erlauben, die Tauglichkeit der Belastungswerte zu bekräftigen. Von allen Bemessungsgrundlagen sind die BW nach wie vor die objektivste, die praktisch auf alle Fälle angewendet werden kann. Die anderen Parameter sind entweder sehr grob (Nennleistung des Wasserzählers), führen zu Verzerrungen (raumplanerische Parameter), haben mit der beanspruchten Leistung keinen sachlichen Zusammenhang (Steuer- und Versicherungswerte) oder sind auf einzelne Bezügerkategorien nicht anwendbar (Zimmerzahl, Geschossfläche). Die Erfassung und ständige Aktualisierung der BW in den versorgten Liegenschaften kann mit einem beträchtlichen administrativen Aufwand verbunden sein, namentlich bei komplizierten Installationen (z.B. Landwirtschaft, Spitäler, Industriebetriebe). Wasserversorger ohne strikte Meldepflicht und Kontrolle der Hausinstallationen haben zudem kein Instrument für die Nachführung. 3.2 Umbauter Raum Dank der systematischen Erhebung der Wiederbeschaffungswerte und der daraus abgeleiteten jährlichen Werterhaltungskosten können die früher 43 nur im Einzelfall berechneten Mehrkosten des Hydrantenlöschschutzes zuverlässig angegeben werden. Für eine Wasserversorgung mit rund 2'000 angeschlossenen Einwohnern ergeben sich folgende Werte für die einzelnen Anlageteile: Werterhaltungskosten Trinkwasser allein Mehrkosten Löschwasser Total Anlageteile % % % Wassergewinnung 10 0 10 Transport 13 7 20 Speicherung 12 5 17 Verteilung 30 12 42 Hydranten 0 5 5 MSR-Anlagen 5 1 6 70 30 100 Total In Abhängigkeit der versorgten Einwohner können für die Gesamtheit der Anlagen folgende Werte angegeben werden: Versorgte Einwohner Trinkwasser allein % Mehrkosten Löschwasser % 200 50 50 500 60 40 1'000 65 35 2'000 70 30 5'000 80 20 10'000 85 15 Wir empfehlen deshalb folgende tarifliche Massnahmen: a den kleinen und mittleren Wasserversorgungen mit geringem Anschlussgrad die Erhebung einer 2-Komponenten Grundgebühr auf der Grundlage der BW und des uR; b allen Wasserversorgungen die Einführung einer jährlichen Löschgebühr für alle nicht angeschlossenen Bauten und Anlagen im Bereich des Hydrantenlöschschutzes auf der Grundlage des uR. Der umbaute Raum ist die zweckmässigste Bemessungsgrundlage für die Löschgebühr. Vom Gebäudeversicherungswert als nahe liegende Bemessungsgrundlage ist abzusehen, weil er: a in keinem sachlichen Zusammenhang mit den Kosten des Hydrantenlöschschutzes steht b auch von der Gebäudeversicherung aus administrativen Gründen nicht unterstützt wird. 44 Da die Erfassung des uR für die jährlichen Löschgebühren mit einem recht hohen Aufwand verbunden ist, sollen an die Genauigkeit keine grossen Ansprüche gestellt werden. Der Tarif ist so aufgebaut, dass sich Fehler von ± 10 % nur mit Fr. 10.-- bis 30.-- pro Jahr auswirken. Dies gilt wegen der degressiven Gebührenansätze auch für grosse Gebäude. Wir empfehlen deshalb, nach folgender vereinfachten Berechnungsart vorzugehen, die an drei Beispielen gezeigt wird. 45 46 Jene Wasserversorgungen, die die Variante A des Gebührenmodells verwenden wollen und deren Grundbuchvermessung numerisch vorliegt (GRUDA), empfehlen wir zudem, die Gebäudeflächen mit luftfotogrammetrischen Aufnahmen zu ergänzen, mit denen die Terrainund Dachkoten abgegriffen und daraus die Gebäudehöhen berechnet werden können. Dadurch können die uR flächendeckend über den ganzen Löschschutzperimeter computergestützt berechnet werden. Aus Luftbildern (links) werden die Dachflächen (rechts) und die Höhe des gewachsenen Terrains dreidimensional erfasst. 1 2 3 4 Quader Rasterpunkte Die Hauptumrisse der Gebäude aus der amtlichen Vermessung definieren die Grundfläche für die Volumenberechnung. In den Gebäudehauptumriss wird ein fester Raster gelegt (z.B. 1m2). Für jeden Rasterpunkt wird aus der Terrainhöhe und der Dachhöhe die Gebäudehöhe berechnet. Dies ergibt für jeden Rasterpunkt einen Quader mit einer festen Grundfläche und der Gebäudehöhe. Das Volumen des Gebäudes ist die Summe aller Quader. Beispiel ID-Nr Parz. Nr 1 2 3 4 441 442 443 443 Grundstückfläche m2 150 1'014 274 380 umbauter Raum berechnet effektiv Abweichung 3 3 % m m 1'462 1'508 3 10'261 9'978 -3 2'236 2'413 7 2'641 2'707 2 47 4. Gebührendegression 4.1 Linearität der Kosten Jede Erschliessungstätigkeit verursacht einen hohen Grundaufwand. Die Investitionskosten sind jedoch nicht proportional zur installierten Leistung. So verursacht ein Mehrfamilienhaus gegenüber einem Einfamilienhaus einen unterdurchschnittlichen Erschliessungsaufwand je Wohneinheit. Dazu kommt, dass auch die Betriebskosten zum grössten Teil verbrauchsunabhängig sind (Löhne, Unterhalt). Die Jahreskosten sind deshalb resistent gegen Verbrauchsschwankungen, was bei der Festsetzung der Gebühren verstärkt berücksichtigt werden muss. 4.2 Degressive Gebühren Das auf einer Grund- und Verbrauchsgebühr beruhende Doppel-Tarifsystem führt im Ergebnis bereits jetzt zu degressiven Gebühren. Das heisst, je höher der Wasserverbrauch ist, desto günstiger wird der Gesamtpreis pro m3. Letztlich hat jeder Wasserbezüger also schon heute einen unterschiedlichen Wasserpreis. Dieser betriebswirtschaftlich notwendige Mechanismus muss noch verstärkt werden, indem die Ansätze der einzelnen Gebührenkategorien selbst degressiv ausgestaltet werden. Die nachstehende Graphik, mit den Werten des Beispiels in Abschnitt 6, zeigt deutlich, dass mit den degressiven Gebühren die Deckung der Kosten in Abhängigkeit des Wasserbezugs besser gewährleistet ist als mit linearen Gebühren. Um eine vollständige Kongruenz mit der Kostenentwicklung zu erhalten, müsste die Degression sogar noch verstärkt werden. Kostendeckung Fr./Jahr 310000 Jahreskosten 290000 Lineare Gebühren 270000 250000 110000 Degressive Gebühren 120000 130000 Wasserbezug m 3/Jahr 48 5. Zusammenfassung 5.1 Gebührenpflicht Die Gebührenpflicht für die drei in der Praxis vorkommenden Fälle (wobei der Fall 2 nur selten) kann folgt zusammengefasst werden: Gebührenpflicht einmalig Fall Beschrieb AG BW uR LG uR 1 Anschluss mit Hydrantenlöschschutz X X 0 2 Anschluss ohne Hydrantenlöschschutz X 0 3 Nur Hydrantenlöschschutz 0 0 Es bedeuten AG = Anschlussgebühr LG = Löschgebühr BW = Belastungswerte 5.2 jährlich GG BW/uR VG m3 LG uR (X) X 0 0 (X) X 0 X 0 0 X GG = Grundgebühr VG = Verbrauchsgebühr uR = umbauter Raum Varianten und Bemessungsgrundlagen Je nach Struktur der Wasserversorgung können die Gebührenmodelle gemäss der Variante A, B oder C gewählt werden, die sich in der Anzahl der notwendigen Bemessungsgrundlagen für die Erhebung der jährlichen Gebühren unterscheiden Bemessungsgrundlagen Var. einmalig Struktur der Wasserversorgung jährlich BW uR BW uR m3 Kleine und mittlere Wasserversorgungen A - mit Anschlussgrad ≤ 75 % X X X X X B - mit Anschlussgrad > 75 % X X X 0 X C Grosse Wasserversorgungen X X 0 0 X 49 5.3 Die Gebührentypen Gebührentyp Verwendung für a *Alle Ansätze sind degressiv, um der Nicht-Linearität der Kosten Rechnung zu tragen Einmalig Einheit Belastungswerte (BW) und umbauter Raum (uR) Ansatz* Fr. 150.-- 25.--/BW Fr. 4.-- -.50/m3uR Anschlussgebühr Investitionen Löschgebühr Mehrinvestitionen für den Hydrantenlöschschutz b Im Musterreglement werden 3 Varianten A, B und C unterschieden Jährlich 48 Grundgebühr Variante A Variante B Einlage in Spezialfinanzierung Werterhalt und Passivzinsen Umbauter Raum (uR) Fr. 4.-- -.50/m3uR Belastungswerte (BW) und umbauter Raum (uR) Fr. 6.-- Fr. 1.50/BW + Fr. 20.-- Fr. 5.--/ 100 m3 uR Belastungswerte (BW) Fr. 10.-- Fr. 2.50/BW Geschuldet für Erstmaliger Anschluss und Erweiterung von Bauten und Anlagen Nicht angeschlossene Bauten und Anlagen im Hydrantenperimeter (< 300 m; > 2 bar) Wie einmalige Anschlussgebühr Verbrauchsgebühr Varianten A + B Personal- und Sachaufwand Wasserverbrauch (m3) Fr. 1.-- -.50/m3 Jahresgebühr Variante C Gesamter Aufwand der Laufenden Rechnung Wasserverbrauch (m3) Fr. 200.-- + Fr. 2.-- Fr. 1.--/m3 Löschgebühr Varianten A, B, C Werterhalt der Mehrinvestitionen für den Hydrantenlöschschutz Umbauter Raum (uR) Fr. 20.-- Fr. 5.--/100 m3 uR Wie einmalige Löschgebühr 6. Gebührenstruktur Es sollen folgende Randbedingungen erfüllt sein: a Die einmaligen Gebühren betragen rund das 20-fache der jährlichen Grundgebühr (Kapitalisierung). b Der Ertrag aus den Grundgebühren beträgt mindestens 50 % der Jahresgebühren. Bei der Variante C ist es ein theoretischer Betrag: Grundgebühr = Jahresgebühr ./. Fr. 1.--/m3. c Bei der Variante A beträgt der Anteil der Grundgebühr auf dem uR rund 40 %. d Die Varianten A, B und C müssen mit den standardisierten Werten 1 BW = 5 m3/Jahr = 20 m3 uR für die Wasserbezüger zu annähernd gleichen Jahresgebühren führen. Die nachstehenden Diagramme zeigen, dass mit der gewählten Tarifstruktur und den Ansätzen im Mustertarif alle Bedingungen erfüllt sind: Variante A 12000 10000 Fr./Jahr 8000 GG auf BW 6000 GG auf BW + uR 4000 Jahresgebühr 2000 0 0 2000 4000 6000 8000 10000 m3/Jahr Variante B 12000 Fr./Jahr 10000 Grundgebühr 8000 6000 Jahresgebühr 4000 2000 0 0 2000 4000 6000 m3/Jahr 8000 10000 Variante C 12000 Fr./Jahr 10000 6000 theoretische Grundgebühr 4000 Jahresgebühr 8000 2000 0 0 2000 4000 6000 8000 m3/Jahr 51 10000 7. Berechnungsbeispiel Die Gebührenstruktur und die Ansätze im Mustertarif beruhen auf folgenden Grundlagen: Anzahl Wasserbezüger 400 Anschlüsse Wasserbezug 120'000 m3/Jahr Erforderlicher Gebührenertrag Fr. 282'000.--/Jahr Um die Darstellung nicht zu überlasten, führen wir das Beispiel mit der Variante C aus, also mit dem degressiv gestaffelten Einheitstarif. Wenn wir wie bisher mit konstanten Ansätzen für die Wasserbezüge rechnen würden, könnten diese anhand einer einfachen Division des Gebührenertrages mit dem gesamten Wasserbezug ermittelt werden. Der Ansatz würde Fr.2.35/m3 betragen. Anders verhält es sich bei variablen Ansätzen. In diesem Fall wird jedem Wasserverbrauch ein eigener Ansatz zugeordnet. Deshalb müssen für die nachstehenden Betrachtungen die sortierten Wasserverbräuche bekannt sein (Anzahl Bezüger, deren Wasserverbrauch einen bestimmten Wert übersteigt). Für unser Beispiel mit 400 Wasserbezügern ergibt sich nachstehendes Bild: Sortierte Wasserbezüge 2500 m3/Jahr 2000 1500 1000 500 0 0 100 200 300 400 Anzahl Wasserbezüger Nun wird in einem weiteren Schritt mittels der Tarifstruktur der Variante C eine Tabellenkalkulation durchgeführt. Die Formeln für alle drei Varianten finden sich im Anhang A. Gebührenstruktur gemäss Variante C Die Jahresgebühr beträgt m3/Jahr 0 Fr. für jeden weiteren m3 200.-A 200 200.-- + 200 x A ¾A 2000 600.-- + 1350 x A ½A A = Ansatz in 52 Fr./m3 Nach zwei Rechnungsgängen erhält man für A Fr./m3 1.-3.-- Der anwendbare Ansatz berechnet sich daraus zu: A = 1 + (3-1)/(382-182)(282-182) = Fr. 2.--/m3 Fr./Jahr 182'000.-382'000.-- Mit diesem Wert erhält man tabellarisch die Gebühren aller Wasserbezüger: Bezüger Nr. Bezug m3/Jahr Gebühr Fr. Bezüger Nr. Bezug m3/Jahr Gebühr Fr. Bezüger Nr. Bezug m3/Jahr Gebühr Fr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 0 0 5 10 17 20 20 20 20 21 . 200 200 210 220 234 240 240 240 240 242 . 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 . 198 198 198 200 200 200 203 203 204 206 . 596 596 596 600 600 600 605 605 606 609 . 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 Total 1095 1188 1205 1231 1313 1837 2711 4510 5713 10675 120000 1943 2082 2108 2147 2270 3056 4011 5810 7013 11975 282000 Im Unterschied zu den Einheitstarifen ergeben sich für die degressiven Tarife folgende Vergleiche: Vergleich der Wasserpreise Gebührenvergleich Lineare Gebühren 4.00 2000 Fr./m3 Jahresgebühr Fr./Jahr Degressive Gebühren 2500 1500 1000 3.00 2.00 500 0 1.00 0 500 1000 0 Wasserbezug m3/Jahr 500 Wasserbezug m3/Jahr 53 1000 Damit werden die vielen tieferen Wasserbezüge etwas mehr belastet und die wenigen grösseren Wasserbezüge entlastet. So wird der Kostenstruktur der Wasserversorgung Rechnung getragen und gewährleistet, dass auch bei einem Rückgang der einzelnen Wasserbezüge die Gebührenansätze die Kosten zu decken vermögen. Um dieses Kapitel abzurunden befindet sich im Anhang noch ein Berechnungsbeispiel für alle drei Varianten A, B und C mit den drei verschiedenen Gebäudetypen, für die unter Abschnitt 3.2 der umbaute Raum berechnet wurde. WASSER- UND ENERGIEWIRTSCHAFTSAMT Anhänge A. Formeln für die Tabellenkalkulation B. Berechnungsbeispiel für einmalige und jährliche Gebühren 54 A. Formeln für die Tabellenkalkulation Formel für die Tabellenkalkulation der Jahresgebühr für die Variante C =WENN (B<201;200+B*A;WENN(UND((B>199;B<2001);200+200*A+(B-200)*3/4*A);WENN(B>1999;600+1350*A+(B-2000)*A/2))) Es bedeuten A = Ansatz in Fr./m3 und B = Wasserbezug in m3/Jahr Diese Berechnung kann auch problemlos für die Varianten A und B angewendet werden. Die betreffenden Formeln mit den aus dem Mustertarif eingesetzten Gebührenansätzen lauten dann: Grundgebühr auf den Belastungswerten (BW) Variante A =WENN(BW<51;BW*6;WENN(UND(BW>50;BW<151);500+(BW-50)*3;WENN(BW>150;1000+(BW-150)*1.5))) Variante B =WENN(BW<51;BW*10;WENN(UND(BW>50;BW<151);500+(BW-50)*5;WENN(BW>150;1000+(BW-150)*2.5))) Grundgebühr auf dem umbauten Raum (uR) Variante A =WENN(uR>1001;uR*0,2;WENN(UND(uR>1000;uR<3001);200+(uR-1000)*0.1;WENN(uR>3000;400+(uR-3000x0.05))) Verbrauchsgebühr (m3) Variante A und B =WENN(m3<2001;m3*1;2000+(m3-2000)*0.5) B. Berechnungsbeispiel für einmalige und jährliche Gebühren Objekt Bemessungswerte Einfamilienhaus 40 BW 875 m3 uR 220 m3 H2O einmalige Gebühren Menge 40 875 x Fr. 150 4 Total Landwirtschaftsbetrieb 90 BW 2'800 m3 uR = Fr. 6'000 3'000 9'000 Menge 50 40 1'000 1'800 x Fr. 150 75 4 1 = Fr. 7'500 3'000 4'000 1'800 800 m3 H2O Total Wohn- und Geschäftshaus 210 BW 4'500 m3 uR Menge 50 40 10 18 800 x Fr. 6 3 200 10 1 16'300 Menge 50 100 60 1'000 2'000 1'500 x Fr. 150 75 25 4 1 -.50 = Fr. 7'500 7'500 1'500 4'000 2'000 750 2'700 m3 H2O Total Menge 40 8 220 Variante A x Fr. 6 20 1 23'250 jährliche Gebühren Variante B Variante C = Fr. Menge x Fr. = Fr. Menge x Fr. 240 40 10 400 160 220 220 1 220 1 200 220 2 620 620 = Fr. 300 120 200 180 800 x Fr. 6 3 1.50 20 10 5 1 -.50 = Fr. 300 300 90 200 280 75 2'000 350 3'595 200 440 640 Menge 50 40 x Fr. 10 5 = Fr. 500 200 Menge x Fr. = Fr. 800 1 800 1 600 600 1.50 600 900 1'500 1'600 Menge 50 100 60 10 20 15 2'000 700 = Fr. 1'500 Menge 50 100 60 x Fr. 10 5 2.50 = Fr. 500 500 150 Menge x Fr. = Fr. 2'000 700 1.--.50 2'000 350 3'500 1 700 3'300 -.50 3'300 350 3'650